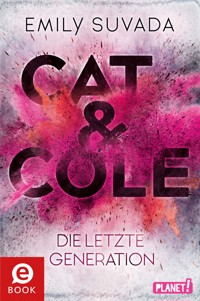
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
1 Milliarde Leben am Abgrund. 2 Menschen, die sie retten können. 1 Geheimnis, versteckt in ihrer DNA. Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche Einschränkungen: von der Erde gelöscht! Mensch und Technik sind verschmolzen, jeder trägt ein Panel in sich, das den eigenen Körper perfektioniert. Fast! Eine mörderische Seuche ist ausgebrochen, und nur eine einzige Person auf der Welt ist fähig, den Impfstoff zu entschlüsseln – Catarina Agatta. Gemeinsam mit Cole, dessen Körper gentechnisch verändert wurde, kommt die geniale Hackerin Cat einer Wahrheit näher, die grausamer ist als jedes tödliche Virus!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Wenn du das liest, bin ich tot.
Habe einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt.
Er ist unsere letzte Rettung.
Du musst ihn entschlüsseln.
Und sie dürfen dich niemals kriegen.
Die Autorin
© privat
Emily Suvada wurde in Australien geboren, wo sie einen Abschluss in Mathematik gemacht hat. Wenn sie nicht gerade Algorithmen entwickelt oder sich dem Schreiben widmet, findet man sie beim Wandern, Fahrradfahren oder bei chemischen Experimenten in ihrer Küche. Im Moment lebt sie zusammen mit ihrem Ehemann in Portland, Oregon.
Mehr über Emily Suvada: emilysuvada.com
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autoren und Illustratoren: www.planet-verlag.de
Planet! auf Facebook: www.facebook.com/thienemann.esslinger
Viel Spaß beim Lesen!
Für Edward: meinen besten Freund, meine Liebe, meine Inspiration. Du bist der strahlende Fokus meines Herzens.
1
Die Sonne geht unter, und der Himmel steht in Flammen, aber nicht wegen Wolken oder Staub, sondern durch die schillernden Federn einer Million gengehackter Wandertauben. Sie segeln in wirbelnden Bögen aus Orangerot und Gold über den Himmel wie ein lebendes impressionistisches Gemälde. Ihre seltsamen Rufe klingen wie der Aufprall von Kieselsteinen an einem Fenster, und sie bewegen sich in perfektem Einklang, bis sie die Sonne verdunkeln.
Amateurprogrammierer in Nevada haben die DNA der lange ausgestorbenen Taube geklont, die Gene dann gespleißt und so etwas Neues, Gewagtes geschaffen. Schnäbel mit rasiermesserscharfer Spitze. Erhöhter Stoffwechsel. Federn, die mit der Anspannung eines einzigen Muskels ihre Farbe ändern und den ganzen Schwarm vor Gefahr warnen können.
Durch jahrelange Arbeit haben sie die Tauben in etwas verwandelt, was stärker ist als ihre Vorfahren. Sie sind schlanker, klüger, wilder.
Und ihre Schöpfer haben dafür gesorgt, dass die Vögel aussehen wie lebende Flammen.
Ich lehne mich über das Geländer der Veranda, meine Hüften gegen das Holz gedrückt, und spähe durch das Zielfernrohr des Gewehrs meines Vaters. Ohne Vergrößerung besteht der Schwarm nur aus einem Chaos getüpfelter Farbflecken, doch durch das Zielfernrohr, mit dem Sichttek, das meinen Blick schärft, kann ich in dem Strudel aus Farben die Flügel und Brüste einzelner Vögel erkennen.
»Komm schon, kleines Vögelchen«, hauche ich, als ich den Abzug drücke. Der Schuss hallt durch die Berge, und der Geruch von Schießpulver erfüllt die Luft. Es ist selbst gemachtes Schießpulver. Schwefelarm, fein, nanogedruckt im Keller und so beschaffen, um einen Beruhigungspfeil abzuschießen und mir einen Vogel vom Himmel zu holen, ohne ihn zu töten.
Der Pfeil saust durch die Luft, sogar mit meinem Tek kaum mehr als ein verschwommener Fleck. Meine Audiofilter ordnen ihn bei Mach 2 ein, was viel zu schnell ist. Meine Berechnungen waren wieder einmal falsch. Ich wende den Blick zu spät ab und sehe, wie der Pfeil eine Taube trifft und in eine Wolke aus bunten Federn verwandelt.
»Verdammt«, blaffe ich und lasse das Gewehr fallen, ohne es zu sichern. Es ist nur noch ein Briefbeschwerer von fünfzehn Kilo Gewicht, jetzt da ich ganz offiziell keine Munition mehr dafür habe. Na ja, wenn man die Kugel nicht mitzählt, die an der Kette um meinen Hals hängt. Aber das ist meine Notfallkugel, und die werde ich nur verwenden, wenn es keinen Ausweg mehr gibt.
Der tote Vogel fällt wie ein Stein, trudelt nach unten, bis er am felsigen Ufer des winzigen Sees vor der Hütte aufprallt. Der Taubenschwarm wechselt sofort die Richtung und stößt einen ohrenbetäubenden Warnschrei aus, der von den steilen Berghängen widerhallt wie eine Maschinengewehrsalve.
»Ich weiß, ich weiß«, murmele ich. Der Schwarm zerstreut sich wütend. Die Federn der Vögel wechseln zu Scharlachrot, um den Angriff anzuzeigen. Ich wollte die Taube nicht verletzen. Sie sollte ein Geschenk sein. Ein kleines gengehacktes Haustier für meine Nachbarin Agnes, um ihr Gesellschaft zu leisten. Jetzt werde ich den Vogel beerdigen müssen, weil ich ihn auf keinen Fall essen werde. Seit dem Ausbruch isst so gut wie niemand mehr Fleisch.
Die letzten zwei Jahren haben uns etwas beigebracht, was wir einfach nicht vergessen können: dass Fleisch von Tieren und Menschen sehr ähnlich schmeckt.
Das Verandageländer knirscht, als ich darüberspringe und durch den Vorgarten zu dem Federhaufen in der Nähe des Sees jogge. Eine Brise bewegt das kniehohe Gras und fegt über das Wasser, erfüllt von den Rufen der Tauben, der Kühle des Abends und dem reichhaltigen, vielschichtigen Duft des Waldes.
Ich befinde mich hier draußen in der Wildnis. Dieses abgelegene Tal tief in den Black Hills ist seit drei Jahren mein Zuhause, seit zwei Jahren meine Zuflucht vor der Seuche. Steile, baumbewachsene Berge erheben sich rechts und links des Sees. Meine heruntergekommene Hütte steht unweit des Ufers. Sie ist gut genug versteckt, dass man sie, ohne zu wissen, wo sie ist, nicht findet, aber doch nah genug an der Stadt, dass ich auf meinem Fahrrad hinfahren kann. Alles in allem ist sie der perfekte Ort, um dort die Apokalypse zu verbringen. Es gibt nur einen Nachteil: Der Sprachempfang ist zum Kotzen.
»Hey, Wildkatze. Hier … Agnes …«
Ich lege den Kopf schräg, als Agnes’ mütterliche Stimme knisternd in meinen Ohren erklingt; laut durch mein subdermales Kommlink hallt. Agnes nimmt fast täglich Kontakt zu mir auf, um zu erfahren, wie es mir geht, aber sie weigert sich, mir zu texten. Ruft immer an, obwohl ich sie nicht hören kann. Ich schließe die Augen und öffne das mentale Interface, um ihr eine Nachricht zu schicken, doch dann durchbricht ihre Stimme das statische Rauschen.
»Dringend … Gefahr …«
Ihre Stimme bricht ab. Kein Rauschen mehr, gar nichts.
Ich wirble herum und renne einen der Berghänge hinauf.
»Agnes?«, rufe ich. Verdammte russische Satelliten. Sie sind ein Jahrhundert alt, aber leider die einzigen Satelliten, die wir nutzen können, jetzt wo Cartaxus jedes andere Netzwerk auf dem Planeten übernommen hat. Zwar kann mein Kommlink in der Hütte Texte empfangen, doch jedes Mal wenn ich telefonieren will, muss ich eine halbe Meile bergauf laufen.
Wieder erklingt ein Rauschen. »… du mich … Wildkatze?«
»Warte kurz!«, rufe ich und rase den felsigen Hang nach oben. Der Pfad zwischen den Bäumen ist noch feucht vom Regen letzte Nacht. In einer Kurve rutsche ich aus und muss darum kämpfen, mich auf den Beinen zu halten.
Agnes könnte verletzt sein. Sie ist ganz allein. Dieses alte Mädchen ist bewaffnet und zäh wie altes Schusterleder, aber es gibt Dinge in der Welt, gegen die man nicht kämpfen kann. Dinge, für die es keine Heilung gibt.
»Fast da!«, rufe ich und eile die letzte Steigung hinauf. Ich stürme auf die Lichtung am Gipfel und klappe zusammen. »Agnes? Geht es dir gut? Kannst du mich hören?«
Die Stille einer Übertragungsverzögerung füllt meine Ohren, dann höre ich wieder Agnes’ Stimme. »Mir geht es gut, Wildkatze. Wollte dir keine Angst einjagen.«
Ich sinke im Gras auf die Knie und versuche, wieder zu Atem zu kommen. »Du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst.«
»Tut mir leid. Aber zumindest weiß ich jetzt, wie ich dich dazu bringe, deine Anrufe anzunehmen.«
Ich verdrehe die Augen und streiche mir ein paar verschwitzte Strähnen aus dem Gesicht. »Was ist so dringend?«
»Bist du auf dem Hügel?«
»Na ja, jetzt schon.«
Sie lacht leise, fast unhörbar unter dem statischen Knistern. »Ich habe gerade einen Anruf von einem der Einheimischen bekommen. Sie haben einen Jeep in der Nähe deiner Hütte gesichtet. Groß, schwarz. Siehst du von da oben irgendwas?«
Ich springe auf die Beine und lasse meinen Blick über den Wald gleiten. Von diesem Aussichtspunkt kann ich an einem klaren Tag meilenweit schauen. Die Black Hills erstrecken sich vor mir, grauer Granit unter Kiefern, mit Seen, die wie kleine Farbtupfer wirken, und einem Netz aus blätterbedeckten Straßen. Um diese Zeit vor zwei Jahren hätte ich auf dem Highway nach Osten noch einen ständigen Strom von Scheinwerfern gesehen – Pendler auf dem Weg nach Hause. Flugzeuge wären Richtung Rapid geflogen, und zwischen den Bäumen hätten die Lichter von Häusern geleuchtet. Doch jetzt sind die Hügel dunkel, und der Highway ist ein leeres, schwarzes Band.
Alle Häuser sind vernagelt und das Land mit Kratern übersät. Bei dem Anblick wird mir übel, doch nur hier habe ich Empfang.
»Keine Scheinwerfer«, murmele ich. »Könnte sein, dass sie Infrarot verwenden. Du bist dir sicher, dass es ein Jeep war?«
»Nagelneu, haben sie gesagt. Muss Cartaxus gehören.«
Mir stellen sich die Nackenhaare auf. Ich habe hier draußen noch nie zuvor einen Jeep gesehen. Cartaxus schickt seine Truppen immer in getarnten Lastwagen, mit summenden Drohnen als Luftunterstützung. Erneut lasse ich meinen Blick über den Wald gleiten; reize mein Sichttek bis zum Anschlag aus.
»Ich habe versucht, dich anzurufen«, sagt Agnes. »Ein paar Mal in den letzten Tagen.«
»War im Labor«, murmele ich, als ich über die Straßen blicke. »Wollte Schießpulver machen.«
»Das klingt gefährlich.«
Ein leises Lächeln verzieht meine Lippen, und meine Finger krümmen sich instinktiv, um über die frisch nachgewachsene Haut an meinen Handflächen zu streichen. »Es gab ein paar kleinere Explosionen. Aber nichts, womit mein Heiltek nicht fertiggeworden ist.«
Agnes schnalzt mit der Zunge. »Wildkatze. Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen?«
»Ähm … gestern?«
»Hast du saubere Kleidung?«
Ich sehe an meinem schmutzigen Pullover und den dreckverschmierten Jeans herab. »Äh …«
»Schaff deinen Hintern sofort zu mir, junge Dame. Mir gefällt die Nachricht von diesem Jeep überhaupt nicht, und du musst mal eine Nacht aus diesem verdammten Labor raus. Jetzt sofort, hast du verstanden?«
Ich unterdrücke ein Lachen. »Okay, Yaya. Ich werde bald da sein.«
»Und wie du das wirst. Und bring deine Dreckwäsche mit.«
Mit einem Zischen verklingt die Verbindung in meinem Ohr. Ich bleibe grinsend zurück. Agnes ist nicht wirklich meine Yaya, auch wenn sie sich so benimmt. Wir teilen keine DNA. Aber wir haben Essen und Tränen geteilt – und seit dem Ausbruch ist das alles, was zählt. Manchmal glaube ich, wir leben beide nur noch deswegen, weil wir den Gedanken nicht ertragen können, den anderen allein zurückzulassen.
Ich strecke die Arme über den Kopf und lasse meinen Blick ein letztes Mal über den Wald gleiten, bevor ich mein Sichttek wieder herunterregle. Das in meinen Unterarm eingebettete Panel, das meine Teks antreibt, verbraucht selbst im Ruhezustand ein paar Hundert Kalorien am Tag, und Essen ist nicht mehr im Überfluss vorhanden. Mein Sichtfeld verschwimmt, als meine Augen sich wieder scharfstellen, daher kostet es mich eine Sekunde zu verstehen, dass am Horizont eine Wolke schwebt, die bisher nicht da war.
»Oh, oh!«
Ich erstarre und zähle die Sekunden, bis der Knall mich erreicht. Die Dampffahne schießt nach oben, bevor sie pilzförmig in den Himmel auffächert. Der Taubenschwarm verteilt sich in mehrere panische Bänder, die so schnell wie möglich vor der wogenden Wolke fliehen. Das Geräusch braucht fünfzehn Sekunden, um mich zu erreichen. Das heißt, dass die Explosion drei Meilen entfernt lag. Zu weit, um Genaueres erkennen zu können, doch ich sehe, dass die Wolke ein kränkliches Rosa zeigt.
Die Farbe, wenn ein menschlicher Körper zu Nebel zerrissen und in die Luft geschleudert wird, weil seine Zellen explodieren.
Eine Hydra-Wolke.
Mein Magen hebt sich. Je nachdem aus welcher Richtung der Wind weht, könnte diese entfernte Wolke mich töten. Ein Atemzug ist alles, was nötig ist: ein Moment, in dem sich die Lunge mit den unsichtbar schwebenden Viruspartikeln füllt, die sich danach in jeder Zelle meines Körpers ausbreiten werden. Man bekommt Fieber; das Virus vervielfältigt sich; und zwei Wochen später explodiert man wie eine Granate, um jeden in einem Umkreis von einer Meile zu infizieren.
Es gibt keine Behandlung, keine Heilung. Es existiert nur ein Weg, Immunität zu erlangen, doch es ist sechsundzwanzig Tage her, seitdem ich die letzte Dosis aufgenommen habe.
Agnes’ Stimme knistert in meinem Ohr. »Das … in deiner Nähe?«
Ich schließe die Augen und gebe den geistigen Befehl, der mein Kommtek in den Textmodus schaltet. Nachrichten schreiben geht langsamer – ich muss mich mehr konzentrieren und jedes Wort nacheinander in meinem Geist bilden – aber dafür ist kein allzu gutes Signal nötig.
3 MEILEN, SCHICKE ICH. WIRD NACH OSTEN GETRIEBEN. BEFINDE MICH WAHRSCHEINLICH AUSSERHALB VOM INFEKTIONSRADIUS.
VERSCHWINDE SCHNELL, antwortet sie.
WERDE ICH. Das muss Agnes mir nicht zweimal sagen. Bevor ich mich auf den Weg mache, zögere ich kurz. Ich will noch einmal abschätzen, in welche Richtung die Wolke treibt. Sie ist doppelt so groß wie die Wolken, die ich beim Ausbruch gesehen habe, vor zwei Jahren. Das Virus entwickelt sich schnell, und die Explosionen werden stärker. Wenn das so weitergeht, wird es wahrscheinlich bald keinen Ort mehr geben, an dem man sich verstecken kann.
Ich verdränge diesen Gedanken und laufe den Berg wieder hinunter, wobei ich versuche, den schlimmsten Schlammpfützen auszuweichen. Wegen einer Wolke, die so weit entfernt ist, muss ich mich nicht verrückt machen; aber ohne Immunität spüre ich doch eine gewisse Nervosität.
Ich werfe einen Blick zurück, als ich zwischen die Bäume trete. Die Wolke ist Meilen entfernt; mir wird nichts passieren. Ich werde zu Agnes gehen, und sie wird mich mit Linsen füttern und mir wie immer diese widerlichen Lakritzbonbons anbieten. Wir werden ihren Holzofen anheizen und ein wenig Karten spielen. Kein Problem. Ganz locker. Doch gerade als die Hütte in Sicht kommt, zerreißt ein weiterer Knall die Luft, und ich stoppe abrupt.
Eine zweite Wolke steigt auf, pink und beängstigend und erfüllt von wirbelnden Blättern. Nah genug, dass ich keine Sekunden zählen konnte. Der Nebel verteilt sich in der Luft wie ein lebender Organismus. Er verbreitet sich durch den Wald, vertreibt die Tauben. Der Wind schiebt die Wolke von mir weg, doch die Windrichtung kann sich jeden Moment ändern.
Diese Wolke ist mir viel zu nahe. Ich muss rennen.
Agnes’ Name poppt vor meinen Augen auf, als ich den Berg hinuntereile.
NOCH EINE.
ICH WEISS, antworte ich, als ich am Fuß des Hügels ins Schlittern gerate.
DAS GEFÄLLT MIR NICHT, WILDKATZE, schreibt sie. HÄTTEST DEINE IMMUNITÄT NICHT AUSLAUFEN LASSEN SOLLEN.
Dazu gibt es nichts zu sagen, weil ich weiß, dass sie recht hat; es war leichtsinnig, meine Vorräte ausgehen zu lassen. Es gab einen Grund dafür, doch wenn ich jetzt darüber nachdenke, brennen meine Wangen vor lauter Dummheit.
Ich rase die Stufen zur Veranda hinauf und schnappe mir meinen Rucksack und mein Messer. Ich greife nach dem Gewehr, nur um es wieder fallen zu lassen. Unnützer Ballast. Ich stürme zu meinem Fahrrad, einem alten BMX mit verrostetem Rahmen, das über die Trampelpfade jagen kann wie kein anderes. Ich werfe mir den Rucksack über die Schulter, schiebe mir das Messer in den Gürtel und reiße mein Rad aus den Büschen, zwischen denen ich es versteckt habe. Ich habe bereits den Lenker umfasst und ein Bein über die Stange geworfen, als mein Audiotek Alarm schlägt und ich mich instinktiv ducke.
Ein Rascheln. Ganz in der Nähe. Ein »normales« Ohr würde es nicht hören, doch meine Filter verstärken das Geräusch zu langsamen, schweren Schritten. Angestrengt und ungleichmäßig. Wie von einem Infizierten.
Die Schritte erklingen direkt hinter mir, zwischen den Bäumen, und kommen in meine Richtung.
»Oh scheiße«, hauche ich. Meine Hände zittern.
IN MEINER NÄHE, schicke ich an Agnes. Meine Gedanken rasen, sodass ich die Worte kaum bilden kann.
VERSTECK DICH. SOFORT, antwortet sie.
Der Befehl sieht ihr so gar nicht ähnlich, ist so panisch und bizarr, dass ich ihn keine Sekunde infrage stelle. Ich lasse einfach mein Fahrrad fallen und fliehe.
Die Hütte ist zu weit entfernt, doch in der Nähe des Sees steht eine Weide. Ich ziehe mich an den Ästen nach oben, sodass meine frisch verheilten Handflächen durch die Rinde zu brennen beginnen. Ich trete gegen den Stamm, zerre mich innerhalb von Sekunden auf einen hohen Ast und hangle mich hektisch, getrieben von reinem Adrenalin, in den Baum. Sobald ich mein Gleichgewicht gefunden habe, stürmt ein Mann durch die Büsche. Ich halte mir genau in dem Moment die Nase zu, als er in den See stolpert.
Es ist ein Berster, daran besteht kein Zweifel. Er fällt im flachen Wasser auf die Knie und schnappt rasselnd nach Luft. Er ist schwer verletzt. Scharlachrote Bäche ergießen sich über seine Arme, rinnen aus den unzähligen Schnitten und Bisswunden auf seiner Haut. Er sieht aus, als hätte ihn ein Mob erwischt. Durch ein faseriges Loch in seiner Wange kann ich seine Zähne sehen. Seine Augen sind zugeschwollen, seine Ohren nur noch zerfetzte Stümpfe.
Er hat Fieber, und er verblutet. Definitiv infiziert. Zweites Stadium, wahrscheinlich ungefähr einen Tag vor der Detonation. Selbst mit der zugehaltenen Nase kann ich spüren, wie mein Körper auf seinen Geruch reagiert und anfängt zu zittern.
Nichts ist vergleichbar mit dem Geruch der Infektion. Kein Gestank und kein Parfüm kann die scharfe, schwefelige Aura imitieren, die von der Haut eines Hydra-Opfers aufsteigt. Manche Leute vergleichen ihn mit dem Geruch verbrennenden Plastiks oder der Luft nach einem Blitzeinschlag. Ich fand immer, dass sie wie die heißen Quellen riechen, die ich als Kind einmal besucht habe. Womit auch immer man den Geruch vergleicht, niemandem bleibt viel Zeit, um darüber nachzudenken – denn sobald man den Geruch bemerkt, raubt er einem den Atem.
Aber das ist nicht alles, was er tut.
Ich beiße die Zähne zusammen und kämpfe gegen das Bedürfnis, das in mir aufsteigt. Instinktiv vergrabe ich meine Fingernägel in der Rinde des Baums. Den Geruch einzuatmen, ist nicht schädlich – Berster sind vor ihrer Explosion nicht infektiös –, aber der Geruch kriecht in mein Gehirn und entzündet dort eine Reaktion, die man nicht kontrollieren kann. Obwohl ich nur durch den Mund atme, spüre ich, wie der Drang sich in mir aufbaut, wie ein Fluch. Ich will nach dem Messer an meiner Hüfte greifen, mich aus meinem Platz im Baum werfen.
Das Monster freilassen, das beim leisesten Hauch von Infektionsgeruch in mir erwacht.
Doch ich will ihm nicht nachgeben. Ich packe den Stamm fester, schüttle den Kopf und rufe mein Kommlink auf. IN … BAUM … ÜBER IHM, schicke ich Agnes.
Der Mann versucht aufzustehen, doch er ist zu schwach. Erneut fällt er auf die Knie, dann stößt er ein Stöhnen aus. Der Wind trägt seinen Geruch in die Äste, sodass er mich trifft wie ein Schlag.
DU MUSST ES MACHEN, antwortet Agnes.
Ich blinzle, um die Worte zu löschen. Ich zittere, und meine Sicht verschwimmt.
KEINE WAHL, WILDKATZE. IST DER EINZIGE WEG.
ICH WERDE NICHT, schreibe ich, nur um die Worte zu löschen, weil sie recht hat. Oder vielleicht auch, weil der Geruch von mir Besitz ergriffen hat und meine Selbstkontrolle außer Gefecht setzt. Auf jeden Fall befindet sich eine Wolke weniger als eine Meile von mir entfernt, und es gibt nur einen Weg, um dafür zu sorgen, dass ich lebend aus dieser Situation herauskomme. Ich brauche Immunität, oder ich werde sterben. Die Rechnung ist denkbar einfach. Ich ziehe mein Messer, und mein Magen hebt sich bei dem Gedanken daran, was ich tun muss.
Der Mann unter mir beginnt zu heulen, ohne sich meiner Anwesenheit bewusst zu sein. Das Blut, das aus seinen Bisswunden fließt, erzeugt scharlachrote Wirbel im klaren Wasser des Sees. Ein einziger Bissen seines Fleisches, aufgenommen in den nächsten paar Minuten, wird mich für zwei Wochen gegen das Virus immunisieren. Das ist die grausamste Seite des Hydra-Virus: Es zwingt die Gesunden dazu, die Kranken zu essen. Zu jagen und zu töten und sich von anderen Menschen zu nähren, um sich selbst zu retten. Die Natur hat eine Seuche als zweiseitiges Schwert geschaffen: Entweder sie nimmt dein Leben, oder sie nimmt dir deine Menschlichkeit.
Ich rutsche auf meinem Ast herum, als ich auf den Mann herunterstarre, das Messer so fest umklammert, bis meine Knöchel weiß hervortreten. Mit der anderen Hand halte ich mir immer noch die Nase zu, um den Geruch zurückzuhalten und einen Augenblick länger zu widerstehen. Mein Kommlink rauscht heftig in meinem Ohr. Agnes kennt mich gut genug, um zu ahnen, dass ich zögere. Sie versucht, mich anzurufen und mir ins Ohr zu schreien, dass er sowieso bald sterben wird, dass er wollen würde, dass ich es tue.
Doch ich möchte das nicht hören. Ich will meine Taten nicht rechtfertigen, um diesen Höllenkreis des Todes am Laufen zu halten. Deswegen habe ich aufgehört, meine Dosen zu nehmen; deswegen habe ich meine Immunität auslaufen lassen. Ich wollte einfach ein paar Wochen lang so etwas wie ein normales Leben führen, ohne dass das Blut eines anderen Menschen in meinen Adern kribbelt. Ich wollte das Monster zurückhalten und mich über meine Instinkte erheben.
Doch tief in mir wächst der Hunger stetig.
Der scharfe, schwefelige Geruch des Mannes hat sich in meine Lunge gegraben. Meine Hände zittern bereits. Es ist eine neurologische Reaktion. Der Geruch hämmert gegen meinen Geist wie Fäuste gegen eine bröckelige Mauer, bis ich das Monster einfach nicht mehr zurückhalten kann.
Als ich endlich die Finger von der Nase löse und den Geruch tief in mich aufnehme, fühlt es sich an, als würde ich zum ersten Mal atmen.
Für einen Moment bin ich frei, gewichtslos und euphorisch, wie auf dem höchsten Punkt einer Achterbahn unmittelbar vor der Abfahrt.
Dann trifft es mich. Ein Zucken durchfährt meinen Körper. Wut ergreift Besitz von ihm, sorgt dafür, dass ich knurrend die Zähne fletsche.
Mein Blick schießt zu dem Mann unter mir, das Messer fest in der Hand.
Die Welt versinkt in einem scharlachroten Schleier, und ich werfe mich nach vorne, in die Arme der Schwerkraft.
2
ZWEI JAHRE ZUVOR
»Das sieht lustig aus«, meint Dax. »Was hast du vor, Prinzessin?«
»Wenn du mich noch einmal Prinzessin nennst, werde ich stattdessen auf dich schießen.«
Der Himmel zeigt ein unglaublich klares Blau, die Sonne steht hoch über mir und beleuchtet die Federn eines Schwarms Wandertauben. Sie schimmern in Weiß und Gold, blenden mich förmlich mit ihren Manövern, die Luft erfüllt von ihren seltsamen schlagenden Rufen. Ich stehe schon seit fünf Minuten auf der vorderen Veranda und ziele mit dem Gewehr meines Vaters auf sie, doch ich bringe es einfach nicht fertig, den Abzug zu drücken.
»Weißt du, Prinzessin, du hältst das Ding falsch.«
Mit einem Stöhnen wirble ich herum, um überrascht festzustellen, dass Dax direkt hinter mir steht. Der Lauf des Gewehrs trifft seine Brust. Er packt die Waffe rasend schnell und sichert sie, bevor ich auch nur blinzeln kann. »Nun«, sagt er. »Ich nehme an, ich müsste inzwischen wissen, dass man Agattas beim Wort nehmen muss.«
»Tut mir leid«, stoße ich hervor, als ich auf das Gewehr starre. »Ich … ich habe nicht nachgedacht.«
»Nicht nachgedacht? Also, das wäre mal was ganz Neues.« Er lehnt das Gewehr an die Wand der Hütte und verschränkt die Arme, bevor er mir das verschmitzte Lächeln schenkt, das mein Herz immer zum Rasen bringt.
Dax ist der Laborassistent meines Vaters. Er lebt bei uns in der Hütte, seitdem er ganz allein aufgetaucht ist, um darum zu betteln, mit dem großen Dr.Lachlan Agatta arbeiten zu dürfen. Er ist erst siebzehn, zwei Jahre älter als ich. Er hatte kein Empfehlungsschreiben, keinen Abschluss, aber Dax gehört zu den Menschen, denen man unmöglich etwas abschlagen kann.
Außerdem war er zufällig der Autor einer Hepatitis-App, die laut meinem Vater aus dem schönsten Code besteht, den er je gesehen hat.
»Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Genkit«, sagt er, als er näher herantritt. »Jemand hat es so umprogrammiert, dass es Videos von Schweinswalen abspielt, wann immer ich einen Befehl eintippe.«
»Oh?«, frage ich, als ich mich gegen das Geländer lehne. »Das ist seltsam.«
»Ja«, sagt er und tritt weiter vor, bis ich seinen Atem auf meiner Haut spüren kann. »Die Wale scheinen eine klare Meinung zu meinen Programmierfähigkeiten im Vergleich zu deinen zu haben. Sehr entmutigend. Sie schlagen mir ständig vor, ich solle meine Arbeit auf /dev/null speichern.«
Ich unterdrücke ein Lächeln. »Kluge Schweinswale.«
»In der Tat.« Er tritt zurück und wirft einen Blick auf das Gewehr. »Wolltest du ein wenig jagen?«
Ich zucke mit den Achseln. »Ich habe nur versucht, mich von diesem ganzen Ende-der-Welt-Kram abzulenken.«
Von den Sondersendungen auf jedem Kanal. Von den stündlichen Berichten über neue Infektionen und dem Video von Patient Null, das sie immer wieder ausstrahlen – das zeigt, wie er den Kopf in den Nacken legt; wie er explodiert; wie ein pinker Nebel durch die Straßen von Punta Arenas treibt.
»Okay«, sagt Dax und nickt ernst. »Und jetzt lassen wir unsere schlechte Laune an den Tauben aus, ja? In Ordnung. Ich mochte ihre kleinen Knopfaugen sowieso nie.«
Ich kann ein Lächeln nicht unterdrücken. »Ich will nur eine Probe, um sie zu sequenzieren. Dieser Schwarm sieht aus, als entspränge er einem neuen Stamm. Ich glaube, sie könnten den Rest zum Gedicht beisteuern.«
Das Gedicht ist ein Sonnet. Ich habe bereits drei Vierzeiler, und ich warte seit Monaten darauf, dass das Reimpaar auftaucht.
»Ah«, meint Dax und schnappt sich das Gewehr. »Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Wir müssen Vögel erschießen.«
Als die ersten gengehackten Tauben vor einem halben Jahr am Himmel erschienen, war es mein Vater, der zuerst einen Vogel heruntergeholt hat, um die DNA zu untersuchen. Die Gene waren meisterhaft codiert, bis auf einen winzigen Abschnitt – einen unordentlichen DNA-Strang, der einfach nicht zu passen schien. Mein Vater hat erklärt, es wäre Genmüll, doch mir hat das Rätsel keine Ruhe gelassen. Also habe ich mir eine Probe genommen, um sie mit meinem tragbaren genetischen Sequenzierer zu bearbeiteten – meinem zuverlässigen Laptop-Genkit. Keiner der eingebauten Suchalgorithmen konnte ein Muster entdecken, bis ich aus einer Laune heraus die Basenpaare erst in binären Code, dann in ASCII und danach in eine Folge von alphanumerischen Buchstaben übertragen habe.
Dann ergab plötzlich alles Sinn. Das war kein Gen – sondern eine Nachricht. In dieser seltsamen Ansammlung von G, T, C und A verbargen sich die Worte eines Gedichtes.
Das ist das Fantastische an Gentech – der Wissenschaft der genetischen Codierung. Man verliert sich in Details, doch dann tritt man manchmal einen Schritt zurück und plötzlich erscheint ein Muster, wie Sonnstrahlen, die durch Wolken brechen. Den genetischen Code einer Feder oder Zelle zu lesen, kann einem das Gefühl vermittelt, als lese man Poesie, die von Gott geschrieben wurde.
Unglücklicherweise wurde das Gedicht in den Tauben von Amateur-Genhackern verfasst. Es ist nicht der beste Text, den ich je gelesen habe, aber ich will trotzdem wissen, wie es endet.
»Eine oder zwei? Groß oder klein?« Dax späht durch das Zielfernrohr des Gewehrs in den wirbelnden Schwarm über uns. Sein schulterlanges rotes Haar ist im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ein paar lose Strähnen umrahmen sein Gesicht. Eine Strähne ist weißblond, was eher eine Prahlerei mit seinen Programmierfähigkeiten als eine modische Aussage darstellt. Das gesamte Kopfhaar ist leicht zu hacken, aber man muss schon ein Programmiergenie sein, um nur ein paar Haare zu verändern.
Mit verschränkten Armen sehe ich zu den Vögeln auf. »Du glaubst, du kannst wirklich nur eine treffen?«
»Ich weiß, dass ich es kann.«
Ich verdrehe die Augen, doch wahrscheinlich hat er recht. Dax’ Sichttek ist supermodern, genauso wie jede andere App, die auf dem Panel in seinem Arm läuft. Das Panel erstreckt sich von seinem Handgelenk bis zum Ellbogen, eine dünne Schicht aus nanocodiertem Silikon, das in kobaltblauem Licht unter seiner Haut leuchtet. Darin erzeugen winzige Prozessoren einen gentechnischen Code, zu einzelnen Apps verpackt, um seine DNA anzupassen und seinen Körper zu verändern. Diese Apps verwalten alles, von seinen implantierten sensorischen Upgrades bis zu seinem Grundumsatz – selbst die Strähne in seinem Haar.
Die Computer, die DNA genetisch manipulieren können, waren einst zimmergroß … doch irgendwann wurden sie klein genug, um sie in Körper einzubauen. Ein Gentech-Panel ist eine perfekte Kombination aus Hardware, Software und Wetware, die einen ständigen Strom algorithmisch konzipierter Nanobots generiert. Diese Nanobots bewegen sich auf einem Netzwerk aus Kabeln durch den Körper, dann dringen sie in die Zellen ein, um dort Spulen aus synthetischer DNA zu schaffen und zu zerstören. Gentech kann Kabel und Schaltkreise wachsen lassen, wie der Körper Knochen bildet, oder es kann von Geburt aus glattes Haar in perfekte Locken verwandeln. Fast jeder Mensch besitzt ein Panel. Es wird bei der Geburt eingepflanzt, um mit dem Körper heranzuwachsen. Die meisten Leute tragen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Apps in sich.
An meinem Handgelenk leuchten nur sechs einsame Punkte. Meine Hypergenese – eine Allergie auf die Nanobots, die den Großteil der Gentech ausführen – bedeutet, dass mein Arm kaum mehr ist als ein aufwendiges Telefon. Ich habe standardisiertes Heiltek und Sinnestek und besitze ein fehleranfälliges Kommtek mit zwölf Kilobyte, das mein Vater persönlich für mich programmiert hat. Doch wenn ich irgendetwas anderes downloade, selbst die einfachste aller Apps, zerfetzen die Nanobots meine Zellen und werden mich innerhalb weniger Stunden töten.
Eigentlich ist das ziemlich ironisch. Ich bin die Tochter des größten Gentech-Programmierers der Welt, doch einen Großteil seiner Arbeit werde ich niemals ausprobieren können.
Dax drückt ab. Ein Schuss erklingt, und Federn explodieren in der Luft. Ein einzelner Vogel fliegt auf, dann fällt er zu Boden. Dax senkt das Gewehr, lehnt es wieder gegen die Wand und zieht eine Augenbraue hoch. »Was hältst du davon: Der Erste, der den Vogel erreicht, darf das Gedicht lösen.«
Meine Kinnlade klappt nach unten. »Nein. Das ist mein Projekt. Du kannst es nicht beenden. Das wäre nicht fair.«
Er wirft sich über das Geländer und landet mit katzengleicher Grazie im Gras, dann legt er den Kopf schräg und lächelt zu mir auf. »Das Leben ist nicht fair, Prinzessin.«
»Oh«, hauche ich und lasse die Knöchel knacken. »Jetzt kannst du dich auf was gefasst machen.«
Ich renne die Stufen hinunter und sause durch das Gras, sodass mein langes schwarzes Haar hinter mir flattert. Dann biege ich abrupt nach links ab, als Dax versucht, meinen Weg zu blockieren. Er ist stärker, aber ich bin schneller. Ich springe an ihm vorbei, stoppe schlitternd am Ufer des Sees und schnappe mir mit ausgestreckter Hand den Vogel.
Ich bin schnell, aber nicht schnell genug. Dax rammt mich, wirft mich zu Boden und reißt mir die Taube aus der Hand. Ich rolle über das Gras und komme gerade rechtzeitig wieder auf die Beine, um eine Faust in seinen Haaren zu vergraben.
Ich reiße daran, fest. Dax stößt einen Schrei aus, lässt die Taube fallen und wirbelt mit einem wilden Ausdruck zu mir herum.
Vor ein paar Sekunden waren wir zwei Programmierer, die über DNA diskutierten, doch jetzt benehmen wir uns wie Wölfe. Wir umkreisen einander und kämpfen um etwas, was keiner von uns braucht. Die Taube ist unwichtig. Jede der einzelnen Federn auf dem Boden könnte ihre DNA preisgeben. Doch hier geht es nicht wirklich um den Vogel, oder um das Gedicht. Hier geht es um Dax und mich und die Anspannung zwischen uns, die immer mehr angestiegen ist, seitdem er mich letzte Woche geküsst hat, als mein Vater nicht da war. Seitdem haben wir nicht darüber gesprochen. Ich habe versucht, so zu tun, als wäre es nie geschehen, weil ich zu viel Angst davor habe, dass mein überbehütender Vater es herausfinden und Dax feuern könnte. Wir haben die Woche mit dem Versuch verbracht, weiter zusammenzuarbeiten und das Knistern zwischen uns zu ignorieren, als wären wir zwei Elektroden kurz vor dem Funken.
Ich senke den Blick auf die Taube. Als ich eine winzige Bewegung mache, schlingt Dax einen Arm um meine Taille und reißt mich einfach von den Füßen. Mein Herz rast, ich spüre seine Brust an meinem Rücken, doch dann rutscht er aus. Eine Sekunde lang schwanken wir gemeinsam, bevor wir schließlich in den See fallen.
»Dax, nein!«, kreische ich und weiche zurück, während ich mir mein nasses Haar aus dem Gesicht streiche.
Er lacht nur, bevor er seinen Kopf nach hinten wirft, sodass er für einen Moment einen glitzernden Iro aus Wasser trägt. »Ich hatte nicht vor, dir den verdammten Vogel zu stehlen.«
»Warum hast du dann damit angefangen? Wie sollen wir das meinem Vater erklären?«
Er grinst. »Das wollte ich dir erzählen. Er weiß es, Prinzessin. Wir hatten ein Gespräch. Es ist okay für ihn, aber er hat mir immer wieder gesagt, dass manche Dinge besser sind, wenn man sich Zeit lässt.«
Mir stockt der Atem. »Machst du Witze?«
»Nö. Ich habe keine Ahnung, ob es mit dem ganzen Apokalypsen-Ding zu tun hat oder nicht, aber ich habe eine offizielle Agatta-Zustimmung. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass ich deinen Namen annehmen werde, wenn wir heiraten, und dass wir alle unsere Kinder nach deinem Vater Lachlan nennen werden. Das könnte für die Mädchen etwas schwer werden, aber ich bin mir sicher, sie werden es verstehen, und …
»Catarina!«
Wir wirbeln beide herum, als mein Vater die Eingangstür öffnet.
Ich schaue zu Dax, der bleich geworden ist. Mein Magen verkrampft sich. Er hat gelogen. Es gab kein Gespräch, keine Agatta-Zustimmung, und jetzt sind wir beide geliefert. Es ist unverantwortlich. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass wir uns so nahekommen. Alles ist ruiniert.
Dax wird entlassen werden. Ich werde wieder aufs Internat geschickt. Die wunderbarste, glücklichste Zeit meines Lebens wird enden, bevor sie überhaupt begonnen hat.
»Kommt beide rein, sofort!«, schreit mein Vater.
»Wir haben nur … eine Taube geschossen«, sage ich. »Das Gedicht …«
»Ich weiß«, sagt mein Vater. »Vergesst den verdammten Vogel und kommt rein.«
Dax und ich wechseln nervöse Blicke, als wir zur Hütte eilen. Mein Vater flucht nur, wenn er wütend ist – aber es klingt nicht, als wäre er wütend auf uns. Dax hüpft auf einem Bein, um sich die Turnschuhe auszuziehen, während ich meine Sweatshirt-Jacke öffne und auf der Veranda fallen lasse.
In der Hütte steht mein Vater in der Mitte des Wohnzimmers und starrt an die Wand, makellos gekleidet in seinem Laborkittel. Nur dass er nicht wirklich an die Wand starrt. Er starrt nicht mal wirklich. Er befindet sich in einer Virtual-Reality-Session und beobachtet etwas mithilfe seines Panels. Eine Liveübertragung von Bildern, die von seinem Panel durch die Fiberglaskabel in seinem Körper direkt in seinen Sehnerv eingespeist werden. Für sein Hirn besteht da kein Unterschied. Die Übertragung des Panels und seine Augen laufen zusammen und verschmelzen, sodass ein einzelnes nahtloses Bild entsteht. Während mein Vater an die Wand starrt, könnte er einen Bildschirm sehen, auf dem ein Video läuft, ein Gemälde oder einen Nachrichtenticker.
Oder er sieht etwas vollkommen anderes. Einen Strand. Die Sterne. Sein Panel könnte ihn aus der Hütte in eine virtuelle und vollkommen andere Welt katapultieren. Zumindest hat man mir das so erklärt. Ich selbst habe es nie ausprobiert. Die einzige Grafikkarte, die in Kombination mit meinem Panel funktioniert, ist zu schwach für VR. Ich habe nur einen uralten Chip, auf dem grundlegende optische Filter laufen und der fähig ist, ein paar Zeilen Text in mein Sichtfeld einzublenden. Das reicht, um Nachrichten durch mein Komm zu schicken, aber nicht genug, um Filme zu schauen, Spiele zu spielen oder auch nur auf dieselbe Art zu programmieren wie der Rest der Welt.
Mein Vater hat einen seiner Kittelärmel nach oben gerollt. Seine Krypto-Manschette umschließt seinen Unterarm. Das ist eine dünne Chrom-Manschette, welche die Übertragungen aus dem Wlan-Chip seines Panels verschlüsselt. Er trägt sie nur für wichtige Gespräche, um Cartaxus davon abzuhalten, seine Gespräche zu belauschen.
Ich starre auf die Manschette, und mein Magen hebt sich. Mein Vater war nicht wütend auf Dax und mich. Er hat mit jemandem über den Ausbruch gesprochen. Was auch immer er gehört hat, es hat ihn zitternd zurückgelassen.
»Was ist los?« Ich berühre seinen Ellbogen, um ihn wissen zu lassen, dass ich da bin. Sein Blick ist glasig; er sieht wahrscheinlich 360 Grad reine VR.
»Das Virus hat sich durch Nicaragua ausgebreitet«, sagt er. »Jetzt, wo es den Kanal übersprungen hat, kann nichts es mehr aufhalten. Sie planen Luftangriffe.«
»Auf Zivilisten?« Ich schaue zu Dax. »Wer kommt auf so eine bescheuerte Idee?«
Mein Vater blinzelt, um seine Session zu schließen. Sein Blick wird wieder scharf, dann dreht er sich zu mir um. »Alle, Liebling. Jede Regierung der Welt denkt darüber nach.«
Ich schlucke schwer, als ich die blutunterlaufenen Augen meines Vaters sehe, die Anspannung in seinem Gesicht. Alles an diesem Krankheitsausbruch ist beängstigend, aber nichts macht mir mehr Sorgen als die Falten auf seiner Stirn. Er ist der größte Gentech-Programmierer der Welt und hat die Heilung für Influenza X geschrieben. Aber so wie jetzt habe ich ihn noch nie gesehen.
Wir müssen uns in ernsthafter Gefahr befinden.
»Nicaragua«, wiederholt Dax mit gerunzelter Stirn. »Das ist nahe. Die Krankheit ist erst vor zwei Tagen ausgebrochen. Wenn sie sich weiter so schnell ausbreitet, könnte sie uns innerhalb von Tagen erreichen.«
»Stunden«, sagt mein Vater. »Sie verbreitet sich exponentiell. Sobald sie die Städte erreicht, wird Chaos ausbrechen. Alle werden in Panik geraten, eine Impfung gibt es nicht … bis es so weit ist, wird es lange dauern.« Er nimmt meine Hände. »Im Keller ist Essen, der See liefert sauberes Wasser, auf dem Dach sind neue Solarplatten und du kannst dich immer in den alten Minenstollen in den Bergen verstecken.«
»Was … was willst du sagen?« Ich visiere die Krypto-Manschette an. »Mit wem hast du gesprochen?«
Wie als Antwort erhebt sich in der Ferne ein klopfendes Geräusch, und die Schreie der Tauben werden ohrenbetäubend. Doch es sind nicht die Tauben, auf die ich lausche, sondern der Klang der Hubschrauberrotoren, die mit jeder Sekunde näher kommen, bis die Fenster vibrieren. Durch die Scheiben entdecke ich zwei schwarze Comox-Quadrikopter, die ins Tal fliegen, ihre Bäuche mit einem weißen Logo gekennzeichnet.
Ich würde dieses Symbol überall erkennen. Es erscheint in meinen Albträumen.
Zwei stilisierte weiße Geweihstangen, die sich überkreuzen.
Das ist Cartaxus.
Nicht Militär. Keine Firma. Sondern eine riesige internationale Mischung aus Technologie und Gewalt. Eine Verbindung aus öffentlichen und privaten Interessen, die sich zum größten Anbieter und Kontrolleur von Gentech entwickelt hat. Mein Vater hat zwanzig Jahre lang für Cartaxus gearbeitet, bis er es nicht mehr ertragen konnte und sich endlich aus ihrem eisernen Griff befreit hat. Er hat mir immer gesagt, dass dieser Tag kommen könnte; dass sie auftauchen und ihn entführen würden, obwohl er geschworen hat, nie wieder für sie zu arbeiten. Nicht nach all den schrecklichen Dingen, die er gesehen hat. Den Gräueln, die ihn nachts wach halten und über die er immer noch nicht sprechen kann.
Jetzt kommen sie ihn holen, genau wie er es immer prophezeit hat. Er dreht sich zu mir um, Resignation in jeder Falte seines Gesichts.
»Nein«, stoße ich mit brechender Stimme hervor. »Sie können dich nicht einfach mitnehmen.«
»Das können sie und das werden sie. Hier geht es nicht um eine Grippe, Liebling. Sie treiben alle zusammen, von denen sie glauben, sie könnten helfen.«
»Aber du kannst dich verstecken«, flehe ich. »Wir können fliehen.«
Er schüttelt den Kopf. »Nein, Catarina, sie werden mich finden, egal wo ich hingehe. Sie glauben, Dax und ich könnten einen Impfstoff für dieses Virus schreiben. Wir haben keine andere Wahl, als mit ihnen zu gehen.«
Dax tritt einen Schritt zurück. »Sie wollen mich? Ich gehe nirgendwohin.«
»Du darfst dich nicht wehren«, drängt mein Vater. »Ich habe für Cartaxus gearbeitet, und ich weiß, wozu sie fähig sind. Sie wollen dein Hirn, aber deine Beine brauchen sie nicht.«
Dax wird bleich. Die Helikopterrotoren werden lauter. Ihre Vibrationen lassen Staub von der Decke rieseln. Sie landen bereits auf der Grasfläche vor dem Haus und jagen gischtgekrönte Wolken über die Oberfläche des Sees. Die Fensterscheiben klappern, als ein Sturm aus Gras und Staub die Hütte trifft. Die Haustür knallt durch den Wind zu.
Mein Vater umklammert meine Hände. »Geh in den Schutzraum, Catarina. Du musst dort bleiben. Ich weiß, dass du es schaffen kannst.«
»Nein!« Ich reiße meine Hände zurück. »Ich komme mit dir. Ich kann mit dem Impfstoff helfen. Niemand kennt deine Arbeit besser als ich.«
»Dessen bin ich mir bewusst, aber du kannst nicht mitkommen, Liebling. Es ist nicht sicher. Du weißt nicht, wie diese Leute sind. Sie werden dich foltern, wenn sie glauben, dass ich dann schneller arbeite. Sie werden dich umbringen, um mich zu brechen, wenn ich versuche, mich ihnen zu widersetzen. Du musst dich von ihnen fernhalten.«
»Aber du kannst mich nicht einfach zurücklassen.«
»Oh, mein Liebling. Ich wünschte, ich müsste es nicht tun, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich weiß, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Aber du musst mir versprechen, dass du niemals zulässt, dass sie dich erwischen. Egal was passiert, du musst dich von Cartaxus fernhalten. Versprich mir das.«
»Nein«, stoße ich hervor, bevor ich anfange zu weinen. »Nein, ich komme mit.«
Rufe erklingen über das Röhren der Rotoren. Mein Vater wendet sich an Dax. »Versteck sie«, blafft er. »Schnell. Sie kommen.«
»Nein!« Ich klammere mich am Kittel meines Vaters fest, doch Dax löst meine Finger. Ich trete um mich und winde mich, doch er hält mich unerbittlich fest und zerrt mich mit sich, als er in den hinteren Teil des Hauses läuft.
Es ist nutzlos. Ich kann mich nicht wehren. Ich kann nur heulen. Cartaxus wird meinen Vater entführen, und ich konnte mich nicht mal richtig verabschieden.
Die Stimmen draußen werden lauter. Schwere Stiefelschritte erklingen auf der Veranda. Dax lässt mich fallen und reißt die Tür zum Schutzraum auf.
»Pass gut auf dich auf, Prinzessin«, flüstert er. Er schubst mich in das enge schallgedämpfte Kämmerchen, dann küsst er mich drängend. Er presst seine Lippen fest auf meine.
Das Letzte, was ich sehe, ist sein Gesicht, bleich vor Angst, als die Soldaten das Haus stürmen.
Dann schlägt er die Tür zu, und alles wird still.
Ich weiß, dass draußen Cartaxus-Soldaten sind, und ich weiß, dass sie schreiend in der Hütte ausschwärmen, doch ich höre nicht das Geringste. Das einzige Geräusch ist mein Herz, das wie wild gegen meine Rippen schlägt, laut genug, dass auch die gepolsterten Wände mit ihren Störimpulsen mich auf keinen Fall verbergen können. Die Soldaten müssen mich hören. Ich schlage mir die Hände über den Mund, um meine Atmung zu dämpfen, während ich darauf warte, dass Fäuste in schwarzen Handschuhen die Tür aufreißen.
Doch das geschieht nicht.
Zehn Minuten vergehen in absolutem, verängstigtem Schweigen, bis mein verräterisches Herz von allein beginnt, sich zu beruhigen. Ein Körper kann nur eine gewisse Menge Adrenalin produzieren, während man sich in vollkommener Reizabschirmung befindet. Schließlich ertrage ich das Warten nicht länger und zwinge mich dazu, den Schalter für den Druckverschluss an der Wand des Schutzraums umzulegen und die Tür aufzuschieben.
Es ist bereits Nacht. In der Hütte brennt keinerlei Licht. Das Wohnzimmerfenster wurde eingeschlagen, doch das Glas wächst bereits wieder nach, in schneeflockenähnlichen Kristallen, die das Mondlicht in Regenbogen auffächern. Im Raum herrscht Chaos. Tote Glasscherben überziehen den Boden, zusammen mit goldenen Federn, schlammigen Stiefelabdrücken und einer Pfütze glänzenden Blutes.
Mit zitternden Knien stehe ich über dem Blut, erfüllt von einer so heißen Wut, wie ich sie noch nie zuvor empfunden habe.
Sie haben auf ihn geschossen. Das weiß ich, ohne nachzusehen. Cartaxus ist in die Hütte gestürmt, hat auf meinen Vater geschossen und ihn davongeschleppt.
Mein Genkit bestätigt, dass das Blut meinem Vater gehört, doch ich finde keine Patronenhülsen, obwohl ich den gesamten Raum durchsuche. Mein rudimentäres Panel ist nicht fähig, mir den VR-Feed der Sicherheitskameras anzuzeigen, und sie lassen sich nicht leicht in 2D konvertieren, aber schließlich schaffe ich es, ein körniges schwarz-weißes Bild auf dem kleinen Laptopbildschirm meines Genkits aufzurufen. Der Film zeigt meinen Vater, der neben Dax auf dem Boden kniet, die Köpfe gesenkt, die Hände erhoben, als die Soldaten den Raum stürmen.
Befehle werden gebrüllt. Zwölf halbautomatische Gewehre werden auf zwei unbewaffnete Männer gerichtet – auf zwei Wissenschaftler, die Cartaxus braucht, um einen Impfstoff zu entwickeln. Mein Vater dreht plötzlich den Kopf und steht auf, um nach etwas an der Wand zu greifen. Als ich das sehe, fange ich erneut an zu weinen. Ich weiß, wonach er gegriffen hat. Er will das Foto von meiner Mutter holen, aus der Zeit, als ich kaum mehr war als eine sanfte Wölbung unter ihrem Kleid. Es gelingt meinem Vater kaum, einen Schritt zu machen, bevor ein Soldat zweimal schießt. Das Mündungsfeuer verpixelt mein Bild.
Eine Kugel trifft den Oberschenkel, die anderen den Bizeps. Keine Arterien, sondern nur Muskeln werden verletzt, die das Heiltek innerhalb einer Woche reparieren wird.
Im unscharfen, stockenden Video sackt mein Vater auf dem Boden zusammen, und Dax schreit. Der Schrei wird nur stumm dargestellt, in meinem Kopf kann ich ihn trotzdem hören. Die Soldaten zerren Dax und meinen Vater aus der Hütte, dann peitschen die Kopter beim Aufsteigen einen Hurrikan aus Federn durch das Fenster.
Die Nacht vergeht, und der Morgen bricht herein. Ich sitze allein in der leeren Hütte, während die Bildschirme eine stetige Zahl von Ausbrüchen überall auf der Welt melden. Ich knie mit dem gerahmten Foto meiner Mutter in der Hand auf dem Boden, neben der Blutpfütze meines Vaters, und gebe ihm ein Versprechen.
Egal was auch geschieht, ich werde tun, was er mir gesagt hat. Ich werde auf mich aufpassen und ich werde frei bleiben.
Ich werde niemals zulassen, dass sie mich kriegen.
3
GEGENWART – ZWEI JAHRE NACH DEM AUSBRUCH
Vom Sonnenuntergang bleibt nur noch ein flacher Strich aus Licht am Horizont. Das Glitzern des Mondlichts auf dem Wasser führt mich zur Küste, wo ich meine besudelten Ärmel nach oben schiebe und mir den Dreck und das Blut von den Händen wasche. Das Wasser ist eiskalt auf meiner Haut. Vereinzelte Federn drehen sich auf der Oberfläche, verloren von den Tauben, die immer noch über mir kreisen, dunkle Silhouetten vor dem Sternenhimmel.
Ich werde die DNA dieses Schwarms morgen sequenzieren, doch ich weiß bereits, dass ich nur dieselben Zeilen des Gedichtes finden werde, entstellt durch Genmutationen. Jede neue Generation enthält mehr Schreibfehler. Ganze Wörter lösen sich in Unsinn auf. Langsam glaube ich, dass dies von Beginn an die Botschaft des Dichters sein sollte.
Meine Hände zittern im Wasser, fahrig durch die Nachwirkungen meiner instinktiven Reaktion auf den Geruch des infizierten Mannes. Die offizielle Bezeichnung dafür lautet »akute psychotische Anthropophagie«, ausgelöst durch den Neurotransmitter Epinephrine-Gamma-2. Die meisten Leute nennen es einfach »Den Grimm«. Das Biest, das vom Gehirn Besitz ergreift und einem die Menschlichkeit raubt. Es ist schwer, sich an Details zu erinnern, wenn man sich dem Grimm ergibt. Alles verwandelt sich in einen Nebel aus Zähnen und Fleisch und Instinkt. Manche Leute bemerken nicht einmal, dass sie sich ihm hingegeben haben, bis sie davontaumeln und das Blut an ihren Händen entdecken.
ALLES OKAY, WILDKATZE?
Agnes’ Text erscheint in meinem Blickfeld. Klobige Courier-Schrift, die einzige Schriftart, die meine jämmerliche Grafikkarte anzubieten hat. Die Worte schwanken über die Oberfläche des Sees, als ich den Kopf schüttle. Sie folgen meinen Bewegungen, bis ich sie mit einem Blinzeln vertreibe. OKAY, antworte ich und konzentriere mich, bis mein Panel den Gedanken erkennt und vor meinen Augen darstellt. BIN BALD DA … VIELLEICHT EINE STUNDE.
SOLL ICH DICH HOLEN?
NEIN. Ich spritze mir Wasser ins Gesicht. WERDE NOCH BEIM MARKT VORBEISCHAUEN. HABE EIN PAAR PORTIONEN, DIE ICH GEGEN MUNITION EINTAUSCHEN KANN.
Portionen Fleisch, heißt das. Es gibt einen Immunitätsmarkt in der Stadt, wo die Einheimischen sich versammeln, um das Fleisch von Infizierten gegen Essen und Munition zu tauschen. Ich habe den Körper so weit von der Hütte weggeschleppt wie möglich, habe fünfzig Dosen herausgeschnitten und sie in meinen letzten Frierpack gesteckt, um diesen dann so lange gegen einen Baum zu schlagen, bis alles gefroren war. Das reicht aus, um eine Person für ein Jahr zu immunisieren. Die Hälfte davon wird auf dem Markt verkauft, der Rest wird als mein persönlicher Vorrat in die solarbetriebene Gefriertruhe der Hütte wandern. Ich werde nicht noch mal zulassen, dass mir die Vorräte ausgehen – nicht nach heute Abend. Das war knapper als jemals zuvor seit dem Ausbruch.
Auf der gegenüberliegenden Seeseite treten ein paar Rehe zwischen den Bäumen heraus, um im Schutz der nächtlichen Dunkelheit zu trinken. Sie nähern sich vorsichtig dem Wasser, beobachten mich aus großen, glänzenden Augen, heben die Köpfe, verwirrt von meinem Geruch. Er steigt von meiner Haut auf wie ein durchdringendes Parfüm. Schwefel und Holzrauch – fast derselbe Geruch wie der des Infizierten, aber ohne einen wesentlichen Bestandteil. Meine Haut, mein Haar, meine Kleidung und mein Atem, alles stinkt nach der Seuche, aber ich bin nicht infiziert.
Sondern immun.
Das ficto-nimbische Virus, allgemein als Hydra bekannt, durchläuft zwei unterschiedliche Phasen, bevor sein Opfer explodiert. Zuerst injiziert es Trigger in die Zellen des Opfers, sodass sie Fieber bekommen und ein Mosaik aus schwarz-blauen Flecken auf der Haut erscheint. Nach einer Woche beginnt die zweite Phase, wo das Virus jede Zelle im Körper in eine Schicht aus Proteinen hüllt, wie die Hülle um eine Bombe. Diese Schicht ist es, die den Duft erzeugt, der jeden in der Nähe in den Grimm katapultiert – und sie ist auch das Einzige, was das Virus davon abhalten kann, in die Zellen einzudringen.
So funktioniert die Immunität. Wenn man das Fleisch eines Opfers in der zweiten Phase isst, bemerkt das Virus nicht, dass es den Wirt gewechselt hat. Innerhalb einer Stunde nach einer Dosis umwickelt es alle Zellen und bildet so die einzige Barriere, die stark genug ist, um das Virus vom Eindringen abzuhalten. Allerdings muss man vorsichtig sein. Isst man eine zu frühe Dosis von einem Opfer in der ersten Phase, infiziert man sich selbst mit dem Virus. Nimmt man die Dosis zu spät auf, von einem Opfer in der zweiten Phase, das kurz vor der Detonation steht, könnte das Fleisch einem ein Loch in den Bauch sprengen, bevor man es verdaut hat. Die Dosis, die ich heute aufgenommen habe, entstammt dem Ende der letzten Phase, aber ich konnte keine Warnzeichen entdecken – keine Bluttropfen, die aus zerstörten Äderchen dringen und so auf eine direkt bevorstehende Detonation hinweisen.
Das war reiner Dusel, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich mich hätte zurückhalten können, sobald der Geruch der Infektion mir zu Kopf gestiegen war.
Die Rehe senken die Köpfe, um zu trinken. Ihre Ohren zucken, als ich mir Gesicht und Hände im eiskalten Wasser des Sees wasche. Jedes Mal wenn ich blinzle, steigt vor meinem inneren Auge das Gesicht des toten Mannes auf; eine ständige Erinnerung daran, was ich gerade getan habe, um am Leben zu bleiben. Um ehrlich zu sein, könnte ich mit dem Töten leben, sogar mit dem Essen, auch wenn ich vor der Seuche noch geschworen hätte, dass ich lieber sterben würde, als Menschenfleisch zu verspeisen.
Diese Redewendung ist witzig – ich würde lieber sterben, als … Witzig, weil niemand sie ernst meint. Die Wahrheit lautet, dass keiner weiß, wozu man fähig ist, wenn sonst der sichere Tod droht. Leute zu töten, die sowieso sterben werden, ist fast schon zu einfach.
Fast.
Nein, es ist nicht das Töten, das mich verfolgt, oder die Immunität in meinem Blut. Es ist die Tatsache, dass es jedes Mal, wenn ich das tue, einen Teil von mir gibt, dem es gefällt.
Wann immer der Grimm eine Person überkommt, ist es wie ein Instinkt – so mächtig wie der Drang zu überleben und so grundlegend wie Hunger. Und sobald man sich diesem Instinkt ergibt, ist es ein Rausch. Endorphine. Feuerwerk im Kopf. Ein ganzes Arsenal aus Neurochemikalien ergießt sich ins Hirn. Der Körper versucht, einen davon zu überzeugen, dass jemanden zu töten das Beste ist, was man je getan hat.
Es ist wie eine Droge, und zwar eine gefährliche. Der Grimm ist so allumfassend, dass manche Leute sich darin verlieren und niemals wieder auftauchen. Wir nennen sie Schleicher. Sie ziehen in Rudeln umher und jagen wie Wölfe, gefangen in einem ständigen Rausch aus Hunger und Blutlust.
Ich wische mir die Hände an der Jeans ab, sammle meine Sachen ein und folge dem Kiesweg zur Hütte. Die Nacht bricht schnell herein, sodass ich kaum sehen kann, wohin ich gehe. Mein Sichttek startet einen schwachen Versuch, mir zu helfen; verstärkt das Mondlicht, bis meine Welt sich in Pixel auflöst. Vor dem Ausbruch habe ich meinen Vater angebettelt, mir kosmetische Apps wie SkinSmooth und Schimmer zu schreiben, doch er hatte immer darauf beharrt, dass das reine Zeitverschwendung wäre. Heutzutage würde ich ihn um Ultraview oder Echolot-Orientierung bitten, oder auch nur die einfachste Art von Nachtsicht, selbst wenn sie Narben um die Augen erzeugt.
Ich lasse meinen Rucksack auf die Veranda fallen und wedle mit meinem Unterarm vor einem Sensor in der Nähe der Tür herum, dann warte ich, bis die grüne LED-Lampe im Griff aufleuchtet. Man sieht sie kaum, wenn man nicht danach sucht. Genauso wenig wie die Elektromagnete, die sich im Türrahmen verstecken – oder zumindest nicht, bevor es zu spät ist. Wenn Panels zum ersten Mal gesät werden, lassen sie ein Netzwerk aus Kabeln im Körper wachsen – wie ein U-Bahn-System, das die Nanobots durch den Körper transportiert. Die Kabel nutzen Steckkupplungen aus Metall in Schultern und Knien, also habe ich zwei Elektromagnete innerhalb der Tür angeschlossen, die jedem die Kniekupplungen herausreißen, der sich an einem Einbruch versucht.
Es ist kein perfektes Security-System, aber besser als nichts. Besonders nachdem ich nur noch eine Kugel für das Gewehr besitze.
Die Tür öffnet sich mit einem Klicken, und das Licht in der Hütte schaltet sich ein, um das Wohnzimmer in kränklich gelbes Licht zu tauchen. Mein Schlafsack liegt zusammengeknüllt auf einer Matratze vor dem Kamin, wo die letzte Glut von gestern Nacht vorsichtig leuchtet. Die Wände sind kahl, abgesehen von einem einzigen Foto, das Dax kurz vor dem Ausbruch von meinem Vater und mir geschossen hat. Der Arm meines Vaters liegt um meine Schulter, und ich habe die Hand halb erhoben, um mir eine windgepeitschte Strähne aus dem Gesicht zu schieben.
Wir sehen uns so ähnlich. Ich habe seine grauen Augen, seine lange, schmale Nase. Unsere Kinne sind ein wenig spitz, wie das untere Ende eines Herzsymbols. Auf dem Foto hat mein Vater den Mund zu einem seltenen Lächeln verzogen – wir hatten gerade einen Code fertiggestellt, an dem wir monatelang gearbeitet hatten. Er hat das Wort »Liebe« nie in den Mund genommen, doch an dem Tag, an dem wie dieses Foto aufgenommen hatten, war er stolz auf meine Arbeit – und das hat mir gereicht.
Ich sammle meine dreckige Kleidung vom Wohnzimmerboden und stopfe alles in den Rucksack, um sie mit zu Agnes zu nehmen. Mein leidgeprüftes Genkit liegt versteckt unter einer Jeans – ein altes Laptopmodell mit einem Nadelkabel, um es in Panels einzustecken. Genkits sind Codierungswerkzeuge, die man benutzt, um Zugang zu Gentech-Software zu erhalten, sie zu programmieren, Apps anzupassen und zu editieren oder Instandhaltung vorzunehmen. Technisch gesehen sind sie keine Computer, doch mein Genkit benimmt sich so, wenn ich es nett darum bitte. Es war in den letzten zwei Jahren immer mein treuer Begleiter.
Ich öffne das Kit, während ich versuche zu entscheiden, ob ich es mitnehmen soll. Fünfundneunzig Prozent des gesplitterten Bildschirms erwachen zum Leben. Eine Chatanforderung poppt im Menü auf, und das Gesicht einer Frau erscheint auf dem Monitor. Dr.Anya Novak. Scharlachrotes Haar, Fingernägel aus Rhodium und ein typisches Lächeln, das dreimal täglich in der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Sie ist die Anführerin von Skies, der lose verbundenen Gruppe von Überlebenden, die sich gebildet hat, nachdem Cartaxus den Ausbruch genutzt hat, um zu übernehmen, was von der Welt noch übrig war.
Natürlich haben sie die Macht nur an sich gerissen, um uns zu helfen. Cartaxus will immer nur helfen. Sie haben versucht, meinem Vater in einen Hubschrauber zu helfen, indem sie zweimal auf ihn geschossen haben. Sie haben nach dem Ausbruch versucht, uns zu helfen, indem sie die Regierungen der Welt genauso aufgelöst haben wie die Medien, um die Menschen dann in ihre riesigen unterirdischen Bunker zu drängen.
Damals klang das nach einer guten Idee. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich mich zusammen mit den meisten Einheimischen vor dem nächstgelegenen Bunker – Homestake – angestellt. Essen, Obdach, Luftschleusen. Schutz vor dem Virus. Den meisten Menschen fiel kein einziger Grund ein, es nicht zu tun.
Mir allerdings schon. Die Worte meines Vaters hallen auch heute noch in meinen Ohren wider, zwei Jahre später. Du musst dich von ihnen fernhalten. Und tatsächlich, obwohl die Bunker von Faradayschen Käfigen und Wachen geschützt wurden, gab es Gerüchte über die schrecklichen Zustände darin. Leute lebten in dunklen, dreckigen Zellen. Cartaxus hatte die Kontrolle über ihre Panels übernommen und jede nicht der Norm entsprechende App, jeden unabhängig geschriebenen Code gelöscht. Die Security war knallhart. Familien wurden auseinandergerissen.
Die Wahl war klar: das Leben auf der Oberfläche riskieren oder alle Rechte gegen eine Zelle hinter der Sicherheit von Luftschleusen eintauschen.
Unnötig zu erwähnen, dass nicht alle sich auf diesen Handel eingelassen habe. Das war der Beginn von Skies.
Novak winkt auf dem zerbrochenen Bildschirm des Genkits zu mir auf. Die meisten Leute rufen in VR an, also musste ich einen altmodischen Videocode ausgraben, um mit ihr zu sprechen. Ihr Gesicht verschwindet für einen Moment hinter Pixeln aus grün-purpurnem Rauschen, beeinträchtigt durch die schwache Satellitenverbindung. Das Genkit hat in der Hütte besseren Empfang als mein Kommlink, aber die Verzögerung ist trotzdem ein Witz.
Sie lächelt. »Guten Abend, Catarina.«
Ich zucke zusammen. Das Skies-Netzwerk ist verschlüsselt, trotzdem verwende ich nicht gern meinen richtigen Namen. Soweit Cartaxus weiß, bin ich beim Ausbruch gestorben, und dabei würde ich es gerne belassen.
»Tut mir leid, Wildkatze«, sagt sie. »Ich habe den Asthma-Code bekommen, den du geschickt hast. Dank dir atmet ein kleiner Junge in Montana wieder aus eigener Kraft. Ich habe einen Beitrag für die Ausstrahlung vorbereitet. Ich würde dich unglaublich gerne auf Sendung bringen.«
»Nein.« Ich wedle abwehrend mit den Händen. »Auf keinen Fall.«
Novak hält inne, während meine Worte von einem Satelliten zum anderen geworfen werden, um sie erst eine Weile später zu erreichen. Sie seufzt. Diese Diskussion führen wir jedes Mal, wenn ich ein Code-Segment von den Servern von Cartaxus stehle und es an Skies übertrage. Noch so eine Art, wie Cartaxus versucht, uns zu helfen – indem sie medizinische Programme zurückhalten und nur den Leuten in den Bunkern zur Verfügung stellen. Wenn man krank wird oder sich verletzt, kann man nicht mehr einfach eine App herunterladen, wie es früher der Fall war. Man muss sich entweder in einen Bunker zurückziehen oder einsam leiden.
Oder man kann es bei Novak und ihren Leuten probieren. Sie führen das letzte unabhängige Netzwerk, auf Grundlage der alten russischen Satelliten. Sie haben ganze Bibliotheken von Programmen – Open Source, frei wie die Vögel am Himmel –, doch diese Apps sind fehleranfällig und überwiegend von Amateuren geschrieben. Hin und wieder schreibe auch ich Apps oder Patches, doch meinen größten Beitrag leiste ich durch die Angriffe, die ich auf Cartaxus’ Server starte. Schnelle, unkomplizierte Einbrüche. Ich hacke mich in ihre Datenbanken und stehle jegliche Programme, die ich finden kann. Manchmal sind es Antibiotika, manchmal Kommpatches und manchmal auch ein Codesegment, das von Dax oder meinem Vater entwickelt wurde.
Jedes Mal wenn ich eine ihrer Dateien finde, ist das für mich wie ein Sonnenstrahl. Plötzlich scheinen die Jahre sich in Luft aufzulösen, und ich bin wieder unten im Labor. Es gibt kein Virus, keine Cartaxus-Soldaten. Für einen kurzen atemlosen Moment gibt es nur Dax’ dämliche Variablennamen und die Liebe meines Vaters zur Fibonacci-Suche. Schon das allein – Fetzen ihrer Arbeit zu finden und zu wissen, dass sie noch am Leben sind – verleiht den einsamen Jahren Wert, in denen ich coden und hacken gelernt habe.
»Irgendwann werde ich dich auf Sendung bringen«, sagt Novak, als sie eine scharlachrote Augenbraue hochzieht. »Doch deswegen rufe ich nicht an. Bei Cartaxus geht irgendwas Großes vor. Wir haben deinen Namen im Rauschen gehört.«
»Meinen Namen?«
»Ja, deinen echten Namen. Wir konnten keine Details auffangen, aber dein Vater wurde ebenfalls erwähnt. Ich weiß nicht, was vor sich geht, aber mir gefällt das nicht. Du solltest vielleicht eine Weile in Deckung gehen.«
Meine Brust ist wie zugeschnürt. »Wann war das?«
»Vor einer Stunde. Ich habe den Bericht gerade erst bekommen und habe dich angerufen, so schnell es ging.«
Ich werfe einen Blick zum Fenster. Das war ungefähr zur selben Zeit, als Agnes mich vor einem Jeep in der Nähe meines Grundstücks gewarnt hat. Das kann kein Zufall sein.
»Alles okay bei dir?«, fragte Novak. »Catarina, kannst du mich hören?«
Ihre Stimme wird lauter, doch ich schweige. Mein Nacken kribbelt, und meine Hand schiebt sich zur Stummtaste des Genkits. Durch das Wohnzimmerfenster kann ich die letzten Sonnenstrahlen auf dem Wasser sehen und eine Herde aufgescheuchter Rehe.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














