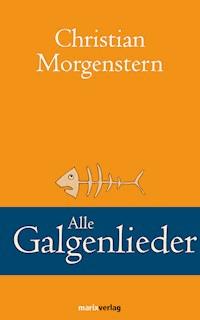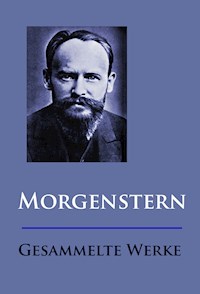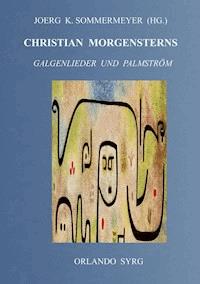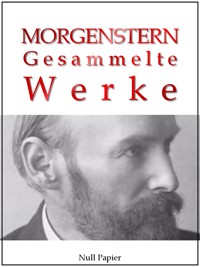
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Und er kommt zu dem Ergebnis: »Nur ein Traum war das Erlebnis. Weil«, so schließt er messerscharf, »nicht sein kann, was nicht sein darf.« Diese bekannten Zeilen stammen von Christian Morgenstern, einem der größten Lyriker der deutschen Sprache. Er war ein Großer in der Meisterschaft der "kleinen" Literaturformen: Gedichte, Epigramme und Aphorismen waren seine Stärke. Lesen Sie hier die größte digitale Auswahl seiner Werke. mit alphabetischem Index Und dann schüttelst du mit Einem dich des Schauders wieder frei, wendest wieder dich zu Deinem, und der Zauber ist vorbei. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Morgenstern
Christian Morgenstern
Gesammelte Werke
Christian Morgenstern
Christian Morgenstern
Gesammelte Werke
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Jürgen Schulze 2. Auflage, ISBN 978-3-954187-93-5
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Christian Morgenstern
Lyrik
Quellen
Dem Geiste Friedrich Nietzsches
Prolog
Auffahrt
Im Traum
Phanta’s Schloß
Sonnenaufgang
Wolkenspiele
Sonnenuntergang
Homo Imperator
Kosmogonie
Das Hohelied
Zwischen Weinen und Lachen
Im Tann
Der zertrümmerte Spiegel
Das Kreuz
Die Versuchung
Der Nachtwandler
Andre Zeiten, andre Drachen
Die Weide am Bache
Abenddämmerung
Augustnacht
Mädchentränen
Landregen
Der beleidigte Pan
Mondaufgang
Mondbilder
Erster Schnee
Talfahrt
Epilog
Ich hebe Dir mein Herz empor
Hymne
Überwinde!
Wer vom Ziel nicht weiß...
O gib mir Freuden
Die zur Wahrheit wandern
Geschöpf nicht mehr...
Da nimm
Wie macht’ ich mich von DEINEM Zauber los
Im Baum, du liebes Vöglein dort
Lucifer
Von zwei Rosen ...
So wie ein Mensch, am trüben Tag, der Sonne vergißt ...
Nach der Lektüre des Helsingforsers Cyclus 1912
O Nacht ...
Erblinden mag ich, sprach ich kühn ...
Nun wohne du darin ...
Die zur Wahrheit wandern ...
Leis auf zarten Füßen naht es ...
Evolution
Überwinde! Jede Stunde ...
Sieh nicht, was andre tun ...
O wie gerne lern ich Milde ...
Du Weisheit meines höhern Ich ...
O gib mir Freuden, nicht mit dem verstrickt ...
Dein Wunsch war immer -- fliegen ...
Stör’ nicht den Schlaf der liebsten Frau, mein Licht ...
An den andern
O ihr kleinmütig Volk, die ihr vom Heute ...
Ich will aus allem nehmen, was mich nährt ...
Das ist der Ast in deinem Holz ...
Du hast die Hand schon am Portal ...
Wer vom Ziel nicht weiß ...
Was klagst du an ...
Das bloße Wollen einer großen Güte ...
Bedenke, Freund, was wir zusammen sprachen ...
An eine Freundin
Einen Freund über seinen Liebeskummer zu trösten
Der Kranke
(an viele)
(an manche)
(an einige)
»Brüder!«
Ich habe den Menschen gesehn in seiner tiefsten Gestalt ...
Gib mir den Anblick deines Seins, o Welt ...
Ich bin aus Gott wie alles Sein geboren ...
Die Fußwaschung
Der Engel ...
Licht ist Liebe
Faß es, was sich dir enthüllt ...
Wie macht’ ich mich von Deinem Zauber los ...
Da nimm. Das laß ich dir zurück, o Welt ...
Ich hebe Dir mein Herz empor ...
Die Sonne will sich sieben Male spiegeln ...
Im Baum, du liebes Vöglein dort ...
Mond am Mittag
Wasserfall bei Nacht
Die drei Spatzen
Das Butterbrotpapier
Schnauz und Miez
Die Behörde
Es pfeift der Wind ...
Die Zirbelkiefer
Sprachstudien
Die Kugeln
Die Enten laufen Schlittschuh
Kleine Geschichte
Ausflug mit der Eisenbahn
Die Lampe
Im Reich der Interpunktionen
Der Sperling und das Känguruh
Nach Norden
Der Schnupfen
Herr Meier
Segelfahrt
Wenn es Winter wird
Denkmalswunsch
Es ist Nacht
Fips
Die zwei Parallelen
Entwurf zu einem Trauerspiele
Steine statt Brot
Der Sündfloh
Das Löwenreh
Neue Bildungen, der Natur vorgeschlagen
Die wirklich praktischen Leute
Die zwei Turmuhren
Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst
Die unmögliche Tatsache
Nachtbild
Der Papagei
Das Geierlamm
Gruselett
Die Nabelschnur
Ein modernes Märchen
An meine Taschenuhr
Von dem großen Elefanten
Auf dem Fliegenplaneten
Die Windhosen
Die Mausefalle
Mägde am Sonnabend
Zäzilie
Der Hecht
Bahn frei!
Eine Stimmung aus dem vierten Kreis
Der Mond
Der Träumer
Der Vergeß
Die Tagnachtlampe
Die beiden Esel
Scholastikerprobleme
Zukunftssorgen
Die Nähe
Muhme Kunkel
Der Droschkengaul
Der Papagei
Die Lämmerwolke
Erntelied
Wenn von links mich Feld und Dickicht riefe ...
Die Mittagszeitung
Der Leu
Die Elster
Die Vogelscheuche
Die Brille
Die Unterhose
Korfs Verzauberung
Die Trichter
Das Auge der Maus
Das Polizeipferd
Gespenst
Das Warenhaus
Der fromme Riese
Der Ästhet
Der Glaube
Palmström legt des Nachts sein Chronometer ...
Vormittag am Strand
Waldmärchen
Gleichnis
Hirt Ahasver
Die Irrlichter
Mensch und Möwe
Der Schuß
Der gläserne Sarg
Der Stern
Der Besuch
Das Bild
Malererbe
Das Äpfelchen
Rosen im Zimmer
Kinderglaube
Der Sämann
Vöglein Schwermut
Der Tod und das Kind
Der Tod und der Müde
Der Tod und der einsame Trinker
Der fremde Bauer
Der Tod in der Granate
Im Nebel
Am Ziel
Die Gedächtnistafel
Am Moor
Im Fieber
Eine Großstadt-Wanderung
Meeresbrandung
Erdriese
Der Sturm
Die Flamme
Der vergeßene Donner
Das Häuschen an der Bahn
Amor der Zweite
Der zeitunglesende Faun
Goldfuchs, Schürz’ und Flasche
Die Brücke
Der Tag und die Nacht
Der Schlaf
Pflügerin Sorge
Legende
Die apokalyptischen Reiter
Parabel
Das Ende
Der Born
Der Urton
Der einsame Turm
Aufforderung
Krähen bei Sonnenaufgang
Das Häslein
Mittag-Stille
Sommernacht im Hochwald
Mattenrast
Bergziegen
Der alte Steinbruch
Beim Mausbarbier
Elbenreigen
»Ur-Ur«
Geier Nord
Vor einem Gebirgsbach
Morgen
Und doch!
Nebel im Gebirge
Vor zurückgeschickten Versen
Abendliche Wolkenbildung
Abendbeleuchtung
»Dichter«?
Briefe
Vor einem Wasserfall
»Leberbrünnl«-Schlucht
Natur spricht
Ich antworte
Nebel ums Haus
Zum Abschied an F.-L.
Anmutiger Vertrag
Die beiden Nonnen
Am See
Auf dem Strome
Frage
Sehnsucht
Friede
Bestimmung
Motto
Jünglings Absage
Caritas, caritatum caritas
O -- raison d’esclave
Gebt mir ein Ross ...
Frühling
Das Königskind
Leise Lieder
Frohsinn und Jubel ...
Was rufst du ...
Nun hast auch du ...
Winternacht
Ein Wunsch
Als ich einen Lampenschirm mit künstlichen Rosen zum Geschenk erhielt
Entwickelungs-Schmerzen
Schicksals-Spruch
Frage ohne Antwort
Wohin?
Inmitten der großen Stadt
Am Meer
Vaterländische Ode
Der einsame Christus
Der Blick
Der Wissende
Das Auge Gottes
Der Abend
Ein Sklave
Frühlingsregen
Abend am See
So möcht ich sterben ...
Schicksale der Liebe
Casta regina!
Prometheus
Hymnus des Hasses
Traum
Der Spieler
Im Eilzug
An Friedrich Nietzsche
Refugium
An Sirmio
Auf der piazza Benacense
Fliegendes Blatt
Übermut
Per exemplum
Asbestos gelos
Botschaft des Kaisers Julian an sein Volk
Auf mich selber
Übern Schreibtisch
Vor alle meine Gedichte
Wir Lyriker
Pöblesse obligee
Einigen Kritikern
Kriegerspruch
Herbst
Morgenandacht
Ein fünfzehnter Oktober
Und so hebe dich denn ...
Die Kinder des Glücks
Gefühl
Bei einer Sonate Beethovens
Vor die vier Sätze einer Symphonie
Kinderliebe
»Aber die Dichter lügen zu viel«
Glück
Macht-Rausch
Präludium
Wo bist du ...
Gleich einer versunkenen Melodie ...
Gesellschaft
Lieder!
Ewige Frühlingsbotschaft
An Mutter Erde
Feierabend
Volkslied
Geheime Verabredung
Der Abend
Nachtwächterspruch
Gebet
Erden-Wünsche
Eins und alles
Ob sie mir je Erfüllung wird ...
Künstler-Ideal
An meine Seele
Mondstimmung
An die Wolken
Vor Strindbergs »Inferno«
Ne quid nimis!
Quos ego!
Natura abundans
Du trüber Tag ...
Konzert am Meer
Der freie Geist
Nur wer ...
Die Luft ward rein ...
Aus Religion
Ja trutze nur ...
Morgenstimmung
Weiße Tauben
Allein im Gebirg
Abendpromenade
Görlitzer Brief
An die Moral-Liberalen
An N.
An ✳✳
An denselben
Lebensluft
Stilles Reifen
Mensch Enkel
Abendläuten
Oh zittre mir nicht so ...
Mag noch so viel dein Geist dir rauben ...
Wozu das ewige Sehnen?
In allem pulsieren
Was mir so viel vom Tage stiehlt ...
Wohl kreist verdunkelt oft der Ball ...
Singende Flammen
Moor
Nächtliche Bahnfahrt im Winter
Dunkle Gäste
Begegnung
Dunst
Ohne Geige
Venus Aschthoreth
Reine Freude
An die Messias-Süchtigen
Ersehnte Verwandlung
Das sind die mitleidlosen Steine
Und bricht einmal dein volles Herz
Daß er so wenig weiß und kann
Die russische Truhe
Vorfrühling
Thalatta!
Zum II. Satz
Eine junge Witwe singt vor sich hin
Mir kommt ein altes Bergmannslied zu Sinn
Du dunkler Frühlingsgarten ...
Bundeslied der Galgenbrüder
Galgenbruders Lied an Sophie, die Henkersmaid
Nein!
Das Gebet
Das große Lalulā
Der Zwölf-Elf
Das Mondschaf
Lunovis
Der Rabe Ralf
Fisches Nachtgesang
Galgenbruders Frühlingslied
Das Hemmed
Das Problem
Der Tanz
Das Knie
Der Seufzer
Bim, Bam, Bum
Das ästhetische Wiesel
Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse
Die Beichte des Wurms
Das Weiblein mit der Kunkel
Die Mitternachtsmaus
Himmel und Erde
Mondendinge
Der Gingganz
Der Lattenzaun
Die beiden Flaschen
Das Lied vom blonden Korken
Der Würfel
Kronprätendenten
Die Weste
Philanthropisch
Die Westküsten
Unter Zeiten
Unter Schwarzkünstlern
Palmström
Der Traum der Magd
Das Nasobem
Anto-Logie
Die Hystrix
Die Probe
Im Jahre 1900
Der Gaul
Der heroische Pudel
Das Huhn
Möwenlied
Der Werwolf
Die Fingur
Km 21
Geiß und Schleiche
Der Purzelbaum
Die zwei Wurzeln
Zeit und Ewigkeit
Im Tal von Arosa
Nachts im Wald
Abend im Gebirge
Der Giebel
Neuschnee
Erinnerung an Wolfenschiessen
Ebenengewitter
Traumwald
Nebelweben
Du schlankes Reh ...
Nebel am Wattenmeer
Bezauberung
Evas Haar
Ein Rosenzweig
Schauder
In der Sistina
Vor den Fresken der Appartementi Borgia
Bei der Pyramide des Cestius
Papstjubiläum 1903
Fiesolaner Ritornelle
Berlin
Junge ehe
Draußen in Friedenau
Die Allee
Bild aus Sehnsucht
Herbstabend
Der Gärtner
Ein Gedicht Walters von der Vogelweide
Ein Kindergedicht
Vor dem Bilde meiner verstorbenen Mutter
An P.B.-H.
An E.S.
Sie und er
Reinheit ...
Die Primeln blühn und grüßen ...
Wein und Waffe
Goethe
Tolstoi
Für Viele
Schlummer
Schweigen
Gebet
Das Licht
Unheimliche Zeitung
Immer Wieder
Ich riß des Herzens Furchen auf ...
Alles Leben steht auf Messers Schneide ...
Dulde, trage ...
Gib, gib und immer wieder gib der Welt ...
Worte
Wachsende Unsicherheit
Lehre
In so vielem
Gnoti seayton
Dankbarkeit und Liebe
O Freunde, liebt mich nicht ...
Ewiges Einerlei
Wer alles ernst nimmt, was Menschen sagen
Verwunderung
Tragikomödie des Phantasten
O Ihr, an so viel »letztem Wissen« Leidenden
Die Sonne grübelt nicht, warum sie scheine
Schule
Es martert dich
Die Lösung ist -- so sieh doch hin
Nietzsche
Ja, gib der Welt nur Wein und Brot
Suprema Lex
Jenachdem
Vom neuen Reich
Wozu, so fragt man sich, Reich, Wohlstand, Macht
Zu Russischem und Weiterem
Allen Knechtschaffenen
Freiheit
Gelehrte
Moderne Ästheten
Ein Münzen-Bild für Psychologengaben ...
Einen Einzelnen abschätzen heißt schon lügen ...
Hirn als Mechanismus ...
Wie süß ist alles erste Kennenlernen! ...
Walter von der Vogelweide
An Dostojewski
Zum täglichen Leben
Schach, das königliche Spiel
In Wald und Welt
Ein ander Mal
Der Specht
Einer Jugendfreundin
Dunkler Tropfe
Verantwortung
Genug oft
Der kann von Liebe nicht reden ...
Durch manchen Herbst
Non veder non sentir m’e gran ventura ...
Was willst du Liebe denn ...
Wir merkten bald im Reden-Wechselspiel ...
Mit Dir, wer weiß ...
Auch Du bist fremd ...
Schneefall
Wie kam es nur?
Du bist so weit oft fort
Vergessen
Ein Weihnachtslied
Deine Rosen an der Brust ...
Den langen Tag ...
Ich wache noch in später Nacht ...
Du bist mein Land
Es kommt der Schmerz gegangen
In einer Gletscherspalte
Mit einem Lorbeerblatt
Und wir werden zusammen schweigen
Und so verblasste goldner Tag
Lärchenwald im Wintermorgenstrahl
O braune, nährende Erde ...
Die Berge stehn
Mond am Nachmittag
Ein Wassertropfen in verschlungnen Kehren
Ein Schlänglein ...
(Nordstrand.)
O sieh das Spinnenweb ...
Einer Schottin
Einer jungen Schweizerin
Was kannst du, Süße ...
Wer seine Sehnsucht ...
O Schicksal, Schicksal, Schicksal ...
O Seele, Seele ...
O, wer sie halten könnte ...
Ode an das Meer
Caesari immortali
Vor einer Büste Schopenhauers
Nur immer rein des Zweifels
Noch niemals ...
Das Unerträglichste ...
(Segantini.)
An Ludwig Jaeobowski (†)
Du hast nie andre ...
Hab’ ich dich endlich ...
Man preist’s Resignation ...
Den stehngebliebnen Zeiger ...
Wer wahrhaft Künstler ...
(Nietzsche.)
Wind, du mein Freund!
Glückselig nach dem Regen lacht
Butterblumengelbe Wiesen
Von Frühlingsbuchenlaub ein Dom
Feuchter Odem frischer Mahd
Das sind die Reden ...
Wie der wilde Gletscherbach
Bergschwalben rauschen durch die Luft
Des Morgens Schale ...
Welch ein Schweigen ...
Bleich in Sternen ...
Inmitten dessen ...
Ich liebe dich ...
Was denkst du jetzt?
O weine nicht!
Nebelgewölke ...
Sahst du nie der Dämmrung ...
Augusttag
Septembertag
Vorabendglück
Abendkelch voll Sonnenlicht
Es gibt noch Wunder ...
Ein Wanderlied ...
Und wenn du nun ...
Mit diesem langen Kuss
Liebe, Liebste, in der Ferne
Und aber ründet sich der Kranz
Erster Schnee
Der Waldbach rauscht Erinnerung
Mir ist, als flösse ...
Was fragst du viel!
Blickfeuer
Vogelschau
Zum Leben zurück!
Maimorgen
Selige Leichtigkeit
Abend-Trunk
Dagny
An solch einem Vorabend der Liebe
Oh, um ein Leuchten ...
Brausende Stille
Dich zu singen
Von den heimlichen Rosen
»Das Wunder ist ...«
Lebensbild
Volksweise
Ich saß, mir selber feind ...
Seht in ihrem edlen Gange
Nun streckst du ...
Sie an ihn
Schweigen im Walde
Waldkonzerte
Leichter Vorsatz
Farbenglück
Der Hügel
Auf leichten Füßen
Genügsamkeit
Gute Nacht
Heimat
Schwalben
Holde Ungerechtigkeit
Wie mir der Abend das Grün ...
Was möchtest du ...
Hochsommerstille
Weiter Horizont
Wasser-Studie
Eine Nacht
Es rauscht der Wind
Abwehr und Bitte
Vergebliches Warten
Das Gebet
Nachtwind
Marguerite
Wind und Geige
Lied
Wandernde Stille
Mächtige Landschaft
Sturmnacht
Die Stimme
Ein andermal
Mit geschlossenen Augen
›Dich‹
Spruch zum Wandern
Vormittag-Skizzenbuch
Der Wind als Liebender
Meer am Morgen
Abend-Skizzenbuch
Herbst
Erster Schnee
Wintermondnächte
Waldgeist
Der Traum
Wie vieles ist denn Wort geworden ...
Stufen -- Autobiographisches
Autobiographische Notiz
In me ipsum
Natur
Kunst
Literatur
Theater
Sprache
Politisches Soziales
Kritik der Zeit
Ethisches
Lebensweisheit
Erziehung Selbsterziehung
Psychologisches
Erkennen
Weltbild: Anstieg
Weltbild: Episode, Tagebuch eines Mystikers
Weltbild: Am Tor
Nachwort
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Christian Morgenstern
Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern kommt am 6. Mai 1871 in München als Sohn des Landschaftsmalers Carl Morgenstern und dessen Frau Charlotte (geb. Schertel) zur Welt.
Die Mutter stirbt, als der Sohn 10 Jahre alt ist, an Tuberkulose. Als Kind genießt er nur unregelmäßigen Schulunterricht und kommt später in ein Landshuter Internat, das für Körperstrafen und Schikanen bekannt war.
Mit 18 Jahren lernt er auf dem Magdalenen-Gymnasium die Künstler Friedrich Kayssler und Fritz Beblo kennen, es entwickeln sich lebenslange, enge Freundschaften.
Der Vater wünscht für seinen Sohn eine Offizierskarriere, daher muss Morgenstern kurzzeitig eine Militärschule besuchen, verlässt diese jedoch, um ein Studium der Nationalökonomie beginnen zu können. Aber auch diese Ausbildung bricht er wieder ab.
Parallel zu seinen vergeblichen Studienbemühungen publiziert er mit Freunden die kulturkritische Zeitschrift »Deutscher Geist«.
1893 erkrankt Morgenstern so wie Jahre zuvor seine Mutter an Tuberkulose. Obwohl geheilt, wird er doch für den Rest seines Lebens unter den Folgeerscheinungen leiden. Im Jahre 1894 zieht Morgenstern nach Berlin, hier schreibt er regelmäßig Literatur- und Kulturkritiken für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, u.a. für »Tägliche Rundschau«, »Freie Bühne«, »Neue Deutsche Rundschau« und »Der Kunstwart«.
1895 veröffentlicht Morgenstern seinen ersten Gedichtband: »In Phantas Schloß. Ein Zyklus humoristisch-phantastischer Dichtungen«. Aufgrund seiner literarischen Ambitionen kommt es nun vollständig zum Bruch mit dem Vater. Trotzdem sollen zeit seines Lebens noch weitere 14 Bände mit Lyrik ihren Weg an die Öffentlichkeit finden.
Bekannt ist dem Publikum bis heute größtenteils seine leichte, humoristische Lyrik, obwohl Morgenstern selbst seiner »ernsten« Poesie mindestens ebenso viel Bedeutung zumisst.
Ab 1897 arbeitet Morgenstern auch als Übersetzer und Herausgeber von August Strindberg und Henrik Ibsen. 1905 veröffentlicht er die Gedichtbände »Galgenlieder« und »Melancholie«. Diese Werke zeigen Morgensterns Doppelbegabung zu ernster aber auch humoristischer, bis ins Groteske gehender Poesie.
Während weiterer krankheitsbedingter Schwächephasen findet er zum Glauben und zur Religion. Diese Überlegungen schlagen sich in der Gedichtsammlung »Einkehr« (1910) nieder. Morgenstern schließt sich dem engeren Kreis der anthroposophischen Gesellschaft um Rudolf Steiner an. 1910 heiratet er Margareta Gosebruch, die er zwei Jahre zuvor während eines weiteren Sanatoriumaufenthaltes kennenlernt. Die Ehe bleibt kinderlos.
Am 31. März 1914 stirbt Morgenstern im tirolischen Meran an den Spätfolgen seiner Krankheit. Bis 1921 werden weitere seiner Werke posthum veröffentlicht: »Palma Kunkel« (1916), »Der Gingganz« (1919) und der satirische Kommentar »Über die Galgenlieder« (1921).
Und er kommt zu dem Ergebnis: »Nur ein Traum war das Erlebnis. Weil«, so schließt er messerscharf, »nicht sein kann, was nicht sein darf.«
(»Die unmögliche Tatsache«)
Lyrik
Quellen
In Phanta’s Schloss Erstdruck: Berlin (Richard Taendler) 1895. Ausgabe letzter Hand.
Auf vielen Wegen Berlin (Schuster & Loeffler) 1911
Ich und die Welt Berlin (Schuster & Loeffler) 1898, 1911
Galgenlieder Berlin (B.Cassirer) 1905, 1914
Palmström Berlin (B.Cassirer) 1910, 1914
Melencolia Berlin (Cassirer) 1906
Wir fanden einen Pfad (posthum): München (Piper & Co.) 1914
Und aber ründet sich ein Kranz S. Fischer, Berlin, 1902
Ein Sommer S. Fischer, Berlin 1900
Dem Geiste Friedrich Nietzsches
Sei’s gegeben, wie’s mich packte, mocht es oft auch in vertrackte Bildungen zusammenschießen! Kritisiert es streng und scharf, -- doch wenn ich Euch raten darf: Habt auch Unschuld zum Genießen!
Prolog
Längst Gesagtes wieder sagen, hab ich endlich gründlich satt. Neue Sterne! Neues Wagen! Fahre wohl, du alte Stadt, drin mit dürren Binsendächern alte Traumbaracken stehn, draus kokett mit schwarzen Fächern meine Wunden Abschied wehn. Kirchturm mit dem Tränenzwiebel, als vielsagendem Symbol, Holperpflaster, Dämmergiebel, Wehmutskneipen, fahret wohl! Hoch in einsam-heitren Stillen gründ ich mir ein eignes Heim, ganz nach eignem Witz und Willen, ohne Balken, Brett und Leim. Rings um Sonnenstrahlgerüste wallend Nebeltuch gespannt, auf die All-gewölbten Brüste kühner Gipfel hingebannt. Schlafgemach --: mit Sterngoldscheibchen der Tapete Blau besprengt, und darin als Leuchterweibchen Frau Selene aufgehängt. Längst Gesagtes wieder sagen, Ach! ich hab es gründlich satt. Phanta’s Rosse vor den Wagen! Fackeln in die alte Stadt! Wie die Häuser lichterlohen, wie es kracht und raucht und stürzt! Auf, mein Herz! Empor zum frohen Äther, tänzergleich geschürzt! Schönheit-Sonnensegen, Freiheit- Odem, goldfruchtschwere Kraft, ist die heilige Kräftedreiheit, die aus Nichts das Ewige schafft.
Auffahrt
Blutroter Dampf . . Rossegestampf . . »Keine Szenen gemacht! Es harren und scharren die Rosse der Nacht.« Ein lautloser Schatte, über Wiese und Matte empor durch den Tann, das Geistergespann . . Auf hartem Granit der fliegende Huf . . Fallender Wasser anhebender Ruf . . Kältendes Hauchen . . Wir tauchen in neblige Dämpfe . . Donnernde Kämpfe stürzender Wogen um uns. Da hinauf der Hufe Horn! In die staubende Schwemme, hoch über den Zorn sich sträubender Kämme empor, empor! Aus klaffenden Wunden speit der Berg sein Blut gegen euch. Mit Wellenhunden fällt euch an der Haß der Höhe wider das Tal. Aber ihr fliegt, blutbespritzt, unbesiegt, empor, empor. Vor euch noch Farben verzuckenden Lebens, auf grünlichem Grau verrötender Schaum; hinter euch Schwarz und Silber, die Farben des Todes. Ein Schleier, an eure Mähnen geknüpft, schleppt geisterhaft nach. Wie ein Busentuch zieht ihr hinauf ihn über des Bergs zerrissene Brust. Müde sprang sich der Sturzbach. Nur mit den Lippen wehrt er sich noch. Und bald wird er zum Kind und hängt sich selber spielend an eure Schweife. Weiter! weiter! Da! Winkende Gipfel im Sicheldämmer! Langsamer traben die Rosse der Nacht. Heilige Sterne grüßen mich traut. Ewige Weiten atmen mich an. Langsamer traben die Rosse der Nacht, gehen, zögern, stehen still. Alles liegt nun florumwoben. Schlaf umschmiegt nun Unten, Oben. Nur die fernen Fälle toben. Leise Geisterhände tragen mich vom Wagen in des Schlummers Traumgelände. Aller Notdurft, alles Kummers ganz befreit, fühle ich ein höhres Sein mich durchweben. Wird die tiefe Einsamkeit mir auf alles Antwort geben?
Im Traum
Wer möcht am trägen Stoffe kleben, dem Fittich ward zu Weltenflug! Ich lobe mir den süßen Trug, das heitre Spiel mit Welt und Leben. In tausend Buntgewande steck ich, was geistig, leiblich mich umschwebt; in jedem Ding mich selbst entdeck ich: nur der lebt Sich, der also lebt. Mir ist, ich sei emporgestürmt über stürzende Wasserfälle. Mir engt’s die Brust, um mich getürmt ahn ich schützende Nebelwälle. Aus dumpfen Regionen, aus Welten von Zwergen, trieb’s mich fort, ob auf ragenden Bergen ein besserer Ort dem Freien, zu wohnen. Es weht mir um die Stirne ein Hauch wie von Frauengewand . . Folgte zum steilen Firne mir wer aus dem Unterland? Es beugt sich zu mir nieder ein liebes, schönes Gesicht . . Glaubst Du, ich kenne Dich nicht, Sängerin meiner Lieder? Du bist ja, wo ich bin, mein bester Kamerade! Bei Dir trifft mich kein Schade, meine Herzenskönigin! »Du flohest aus Finsternissen, mühsamen Mutes, ich weiß es. Du hast zerrissen Dein Herz, Dein heißes, und bei dem Leuchten Deines Blutes bist Du den dunklen Pfad weiter getreten, bis Du mich fandest und mit tiefen Gebeten mich an Dich bandest, daß ich Dich liebgewann, dem ringenden Mann ein treuer Kamerad. Du brachst uralte Ketten und kamst heute Nacht in mein Reich. Ich will Dich betten an meiner Brust warm und weich, in Träumepracht Deine Seele verzücken: der ganzen Welt Außen und Innen sei Deinem Sinnen preisgestellt. Magst sie schmücken mit lachender Lust, magst sie tausendfach deuten und taufen, mit Berg und Wald, mit Wiese und Bach, mit Wolken und Winden, mit Sternenhaufen Dein Spiel treiben, Deinen Spaß finden; brauchst nicht zu bleiben an einem Ort; magst die Welt bis zu Ende laufen; denn Hier oder Dort, wo Du auch seist, wo sich das Himmelszelt über die Erde spannt: das sei Deinem Geist Phanta’s Schloß genannt.« Schneller strömt des Blutes Fluß, Wonne mich durchschauert, auf meinen Lippen dauert sekundenlang Dein süßer Kuß. Nun nimm mich ganz, und trage mein Fragen mit Geduld! Für alles, was ich nun sage, trägst Du fortan die Schuld.
Phanta’s Schloß
Die Augenlider schlag ich auf. Ich hab so groß und schön geträumt, daß noch mein Blick in seinem Lauf als wie ein müder Wandrer säumt. Schon werden fern im gelben Ost die Sonnenrosse aufgezäumt. Von ihren Mähnen fließen Feuer, und Feuer stiebt von ihrem Huf. Hinab zur Ebne kriecht der Frost. Und von der Berge Hochgemäuer ertönt der Aare Morgenruf. Nun wach ich ganz. Vor meiner Schau erwölbt azurn sich ein Palast. Es bleicht der Felsenfliesen Grau und lädt den Purpur sich zu Gast. Des Quellgeäders dumpfes Blau verblitzt in heitren Silberglast. Und langsam taucht aus fahler Nacht der Ebnen bunte Teppichpracht. All dies mein Lehn aus Phanta’s Hand! Ein König ich ob Meer und Land, ob Wolkenraum, ob Firmament! Ein Gott, des Reich nicht Grenze kennt. Dies alles mein! Wohin ich schreite, begrüßt mich dienend die Natur: ein Nymphenheer gebiert die Flur aus ihrem Schoß mir zum Geleite; und Götter steigen aus der Weite des Alls herab auf meine Spur. Das mächtigste, das feinste Klingen entlauscht dem Erdenrund mein Ohr. Es hört die Meere donnernd springen den felsgekränzten Strand empor, es hört der Menschenstimmen Chor und hört der Vögel helles Singen, der Quellen schüchternen Tenor, der Wälder Baß, der Glocken Schwingen. Das ist das große Tafellied in Phanta’s Schloß, die Mittagsweise. Vom Fugenwerk der Sphären-Kreise zwar freilich nur ein kleinstes Glied. Erst wenn mit breiten Nebelstreifen des Abends Hand die Welt verhängt und meiner Sinne maßlos Schweifen in engere Bezirke zwängt -- wenn sich die Dämmerungen schürzen zum wallenden Gewand der Nacht und aus der Himmel Kraterschacht Legionen Strahlenströme stürzen -- wenn die Gefilde heilig stumm, und alles Sein ein tiefer Friede -- dann erst erbebt vom Weltenliede, vom Sphärenklang mein Heiligtum. Auf Silberwellen kommt gegangen unsagbar süße Harmonie, in eine Weise eingefangen, unendlichfache Melodie. Dem scheidet irdisches Verlangen, der solcher Schönheit bog das Knie. Ein Tänzer, wiegt sich, ohne Bangen, sein Geist in seliger Eurythmie. Oh seltsam Schloß! bald kuppelprächtig gewölbt aus klarem Ätherblau; bald ein aus Quadern, nebelnächtig, um Bergeshaupt getürmter Bau; bald ein von Silberampeldämmer des Monds durchwobnes Schlafgemach; und bald ein Dom, von dessen Dach durch bleiche Weihrauch-Wolkenlämmer Sternmuster funkeln, tausendfach! Das stille Haupt in Phanta’s Schoße, erwart ich träumend Mitternacht: -- da hat der Sturm mit rauhem Stoße die Kuppelfenster zugekracht. Kristallner Hagel glitzert nieder, die Wolken falten sich zum Zelt. Und Geisterhand entrückt mich wieder hinüber in des Schlummers Welt.
Sonnenaufgang
Wer dich einmal sah vom Söller des Hochgebirgs, am Saum der Lande emporsteigen, aus schwarzem Waldschoß emporgeboren, oder purpurnen Meeren dich leicht entwiegend -- wer dich einmal sah die bräutliche Erde aufküssen aus Morgenträumen, bis sie, von deiner Schwüre Flammenodem heiß errötend, dir entgegenblühte, in der zitternden Scham, in dem ahnenden Jubel jungfräulicher Liebe -- der breitet die Arme nach dir aus, dem lösest die Seele du in Seufzer tiefer Ergriffenheit, oh, der betet dich an, wenn beten heißt: zu deiner lebenschaffenden Glutenliebe ein Ja und Amen jauchzen wenn beten heißt: in den Ätherwellen des Alls bewußt mitschwingen, eins mit der Ewigkeit, leibvergessen, zeitlos, in sich der Ewigkeit flutende Akkorde -- wenn beten heißt: stumm werden in Dankesarmut, wortlos sich segnen lassen, nur Empfangender, nur Geliebter . . . Wer dich einmal sah vom Söller des Hochgebirgs!
Wolkenspiele
I.
Eine große schwarze Katze schleicht über den Himmel. Zuweilen krümmt sie sich zornig auf. Dann wieder streckt sie sich lang, lauernd, sprungharrend. Ob ihr die Sonne wohl, die fern im West langsam sich fortstiehlt, ein bunter Vogel dünkt? Ein purpurner Kolibri, oder gar ein schimmernder Papagei? Lüstern dehnt sie sich lang und länger, und Phosphorgeleucht zuckt breit über das dunkle Fell der gierzitternden Katze.
II.
Es ist, als hätte die Köchin des großen Pan –– und warum sollte der große Pan keine Köchin haben? Eine Leibnymphe, die ihm in Kratern und Gletschertöpfen köstliche Bissen brät und ihm des Winters Geysir-Pünsche sorglich kredenzt? -- Als hätte diese Köchin eine Schüssel mit Rotkohl an die Messingwand des Abendhimmels geschleudert. Vielleicht im Zorn, weil ihn der große Pan nicht essen wollte . . .
III.
Wäsche ist heute wohl, große Wäsche, droben im Himmelreich. Denn seht nur, seht! wie viele Hemdlein, Höslein, Röcklein, und zierliche Strümpflein die gute Schaffnerin über die blaue Himmelswiese zum Trocknen breitet. Die kleinen Nixen, Gnomen, Elben, Engelchen, Teufelchen, oder wie sie ihr Vater nennt, liegen wohl alle nun in ihren Bettchen, bis ans Kinn die Decken gezogen, und sehnlich lugend, ob denn die Alte ihren einzigen Staat, ihre weißen Kleidchen, nicht bald ihnen wiederbringe. Die aber legt ernst und bedächtig ein Stück nach dem andern noch auf den Rasen.
IV.
Wie sie Ballet tanzen, die losen Panstöchter! Sie machen Phoebus den Abschied schwer, daß er den Trab seiner Hengste zum Schritt verzögert. Schmiegsam, wiegsam werfen und wiegen die rosigen Schleier sie zierlich sich zu, schürzen sie hoch empor, neigen sie tief hinab, drehn sich die wehende Seide ums Haupt. Und Phoebus Apollo! Bezaubert vergißt er des heiligen Amts, springt vom Gefährt und treibt das Gespann, den Rest der Reise allein zu vollenden. Er selber, gehüllt in den grauen Mantel der Dämmrung, eilt voll Sehnsucht zurück zu den lieblichen, lockenden Tänzerinnen. Zügellos rasen die Rosse von dannen. Der Gott erschrickt: Dort entschwindet sein Wagen, und hier -- haben die schelmischen Töchter des Pan sich in waschende Mägde verwandelt. Durch riesige Tröge ziehen sie weiße, dampfende Linnen und hängen sie rings auf Felsen und Bäumen zum Trockenen auf und legen sie weit gleich einem Schutzwall auf Wiesen und Felder. Ratlos steht der gefoppte Gott. Und leise kichern die Blätter im Winde.
V.
Düstere Wolke, die du, ein Riesenfalter, um der abendrotglühenden Berge starrende Tannen wie um die Staubfäden blutiger Lilien schwebst: Dein Dunkel redet vom Leid der Welt. Welchen Tales Tränen hast du gesogen? Wie viel angstvoller Seufzer heißen Hauch trankst du in dich? Düstere Wolke, wohin schüttest die Zähren du wieder aus? Schütte sie doch hinaus in die Ewigkeit! Denn wenn sie wieder zur Erde fallen, zeugen sie neue aus ihrem Samen. Nie dann bleiben der Sterblichen Augen trocken. Ach! da wirfst du sie schon in den Abgrund . . . Arme Erde, immer wieder aufs Neue getauft in den eigenen Tränen!
VI.
Oh, oh! Zürnender Gott, schlage doch nicht Deine himmlische Harfe ganz in Stücke! Dumpfe Donnerakkorde reißt herrisch Dein Plektron. Zick, zack schnellen die springenden Saiten mit singendem Sausen silbergrell über die Himmel hin. Holst Du auch manche der Flüchtlinge wieder zurück, viele fallen doch gleißend zur Erde nieder, ragenden Riesen des Tanns um den stöhnenden Leib sich wirbelnd, oder in zischender Flut sich für ewig ein Grab erkiesend. Zürnender Gott! Wie lange: Da hast Du Dein Saitenspiel kläglich zerbrochen, und kein Sterblicher denkt mehr Deiner, des grollenden Rhapsoden Zeus-Odhin-Jehovah.
Sonnenuntergang
Am Untersaum des Wolkenvorhangs hängt der Sonne purpurne Kugel. Langsam zieht ihn die goldene Last zur Erde nieder, bis die bunten Falten das rotaufzuckende Grau des Meeres berühren. Ausgerollt ist der gewaltige Vorhang. Der tiefblaue Grund, unten mit leuchtenden Farben breit gedeckt, bricht darüber in mächtiger Fläche hervor, karg mit verrötenden Wolkenguirlanden durchrankt und mit silbernen Sternchen glitzernd durchsät. Aus schimmernden Punkten schau ich das Bild einer ruhenden Sphinx kunstvoll gestickt. Eine Ankerkugel, liegt die Sonne im Meer. Das eintauchende Tuch, schwer von der Nässe, dehnt sich hinein in die Flut. Die Farben blassen, mählig verwaschen. Und bald strahlt vom Himmel zur Erde nur noch der tiefe, satte Ton blauschwarzer Seide.
Homo Imperator
Gewandert bin ich auf andere Gipfel, deren Riesenfüße, das Meer, wie ein Hund, demütig leckt; an deren Knöcheln es wohl auch manchmal bellend hinaufspringt, den brauenden Nebeln nach, als seien diese warme Dämpfe aus leckeren Schüsseln. Wär ich der Mond, der Hunden verhaßte, ich hilfe herauf dir auf den Berg. Doch Ich bin der Mensch, lasse dich lächelnd unten kläffen und übe an dir Meinen göttlichen Spott. Denn sieh, du armes, krauses Meer! was bist du denn ohne Mich? Ich gebe dir Namen und Rang und Bedeutung, wandle dich tausendfalt nach Meinem Gelüst. Meine Schönheit, Meinen Witz hauch Ich als Seele dir ein, werf Ich dir um als Kleid: und also geschmückt wogst du und wiegst du dich vor deinem König, ein trefflicher Tänzer, brausköpfiger Vasall! In Meine hohle Hand zwing Ich hinein dich und schütte dich aus, einem Kometen, der grade vorbeischießt aufs eilige Haupt. Wie einen Becher faß Ich dein Becken und bringe dich als Morgentrunk Meinem Liebchen Phanta. In dein graues Megärenhaar greift Mein lachender Übermut und hält es gegen die Sonne: Da wird es eitel Goldhaar und Seide. Und nun wieder nenn Ich dich Jungfrau und Nymphe und Göttin, und deiner dämonischen Leidenschaft sing Ich ein Seemanns-Klagelied. Oder Ich deute den donnernden Prall dir aus als stöhnende Sehnsucht um Himmelsglück, als wühlenden Groll, als heulenden Haß: So redet Schwermut, flugohnmächtig, wenn sie der Krampf der Verzweiflung zu jagenden Fieberschauern schüttelt. Aber du drohst: »Eitler Prahler, breite die Arme nur aus, und komm an mein nasses Herz! Dann wirst du kunden, wer größer und mächtiger, du oder ich!« Drohe mir immer, doch wisse: Die Stunde, da du Mich sinnlosen Zornes verschlingst, tötet auch dich. Ein kaltes, totes Nichts, wertlos, namenlos, magst du dann in die Ewigkeit starren, entseelt, entgöttert. Denn Ich, der Mensch, bin deine Seele, bin dein Herr und Gott, wie Ich des ganzen Alls Seele und Gottheit bin, Mit Mir vergehen Namen und Werte. Leer steht die Halle der Welt, schied Ich daraus. Gleich unermeßlichem Äther füllt Mein Geist den Raum: In Seinen Wellen allein leuchtend, tönend, schwingt der unendliche Stoff. Eine Harfe bin Ich in tausend Hauchen. Zertrümmere Mich: das Lied ist aus.
Kosmogonie
Ewiges Firmament, mit den feurigen Spielen deiner Gestirne, wie bist du entstanden? Du blauer Sammet! Welch fleißige Göttin hat sich auf dir mit goldnen und silbernen Kreuzstichmustern verewigt? Wie! oder wären die Sterne Perlen, tagesüber in Wolkenmuscheln gebettet: Aber des Nachts tuen die Schalen sich auf, und aus den schwarzen, angelspottenden Tiefen empor lachen und funkeln die schimmernden Schätze des Meers Unendlichkeit? Oft auch ist mir, ein mächtig gewölbter kristallener Spiegel sei dieser Himmel, und was wir staunend Gestirne nennen, das seien Millionen andächtiger Augen, die strahlend in seinem Dunkel sich spiegeln. Oder wölbt eines Kerkers bläuliche Finsternis feindlich sich über uns? Von ungezählten Gedankenpfeilen durchbohrt, die von empörter Sehne der suchende Menschengeist rings um sich gestreut: Das Licht der Erkenntnis aber, die Sonne der Freiheit, quillt leuchtend durch die zerschossenen Wände. Nein, nein! . . Mit spottenden Augen blinzt die Unendlichkeit auf den sterblichen Rätselrater . . . Und dennoch rat ich das tiefe Geheimnis! Denn bei Phanta ist nichts unmöglich. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– In der leeren, dröhnenden Halle des Alls rauschte der Gott der Finsternis mit schwarzen, schleppenden Fittichen grollend dahin. So flügelschlug der düstere Dämon schon seit Aonen: An seiner Seele fraß das Nichts. Umsonst griffen die Pranken seines wühlenden Schaffenswahnsinns hinaus in die unsägliche Leere. Vom eigenen Leibe mußte er nehmen, wollte er schaffen --: das hatte ihn jüngst quälend durchzuckt. Und nun rang und rang er gegen sich selber, der einsame Weltgeist, daß er sich selbst verstümmle. Bis sein Wollen, ein Löwe, in seiner Seele aufstand und ihm die Hand ans Auge zwang, daß sie es ausriß mit rasendem Ruck. Ströme Blutes schossen nach. Der brüllende Gott aber krampfte in sinnloser Qual die Faust um das Auge, daß es zwischen den Fingern perlend herausquoll. Den glänzenden Tropfenregen rissen die fallenden Schleier des Bluts in wirrem Wirbeltanze hinab, hinaus in die eisigen Nächte des unausgründlichen Raums. Und die perlenbesäten blutigen Schleier kamen in ewigem Kreislauf wieder, schlangen erstickend sich um des flüchtenden Gottes Haupt, zerrten ihn mit sich, warfen ihn aus, ein regelloses, tobendes Chaos. Tiefer noch zürnte der gramvolle Gott. Nicht Schöpfer und Herrscher, Spielball war er geworden, weil er, vom Schmerz bewältigt, den heiligen Lebensstoff, statt ihn zu formen, zerstört. Äonen hindurch trug er die Marter der glühenden Schleier, litt er in seiner eigenen Hölle. Dann aber stand zum anderen Male sein Wollen, ein Löwe, in seiner Seele auf. Sieben Kreisläufe des Chaos rang er und rang er noch, und dann gab er den Arm dem Wollen frei. Und er nahm sich auch noch das andere Auge aus dem unsterblichen Gotteshaupt und warf die blutüberströmte, unversehrte Kugel mitten hinein ins unendliche All. Da stand sie, glühend, in unermeßlicher Purpurründung, und sammelte um sich die tanzenden Blutnebel, daß sie, ein einziger Riesenring von Flammenschleiern, um den gemeinsamen Kern sich wanden und kreisten. Der blinde Gott aber saß und lauschte dem Sausen der Glut. Äonen kreiste der Ring: Dann zerriß er. Und um die glasigen Perlen des zerkrampften Auges ballten sich Bälle kochenden Bluts, glühende, leuchtende Blutsonnen, und andere Bälle, die unter roten Dampfhüllen langsam gerannen. Durch die Unendlichkeit schwangen sich zahllose Reigen zahlloser Welten in tönender Ordnung um das geopferte, heile Auge. Der blinde Gott aber lauschte dem Klang der Sphären, die seinen Preis jauchzten, den Preis des Schaffenden, und flog tastend mit seinen schwarzen, schleppenden Fittichen durch seine Schöpfung, ein Schrecken den Menschlein auf allen Gestimen, der große Lucifer.
Das Hohelied
Singen will ich den Hochgesang, den mit Sterngoldlettern der heilige Geist der Erkenntnis in den schwarzen Riesenschiefer mächtigen Firmaments leuchtend gegraben, den jauchzenden Hochgesang, des Kehrreim von zahllosen Chören von Weltengeschlechtern das All durchtönt: Auf allen Sternen ist Liebe! Siehe, ich maß auf dem Feuerfittich rascher Kometen die Bahnen der Ewigkeit, durch tausend Planetenreigen flog ich zitternden Geistes, spähte und lauschte hinab auf die kreisenden Bälle mit überirdischen Sehnsuchtsinnen. Und entgegen schwoll mir allewig aus unzählbarer Lebenden Brüsten: Auf allen Sternen ist Liebe! Sahst du je ein liebendes Paar sich vereinen zu seligem Kuß, sahst du je der Mutterlippe stummes Segengebet des Kindes reinen Scheitel inbrünstig weihen, sahst du je die stille Flamme heiliger Freundschaft im Kusse brennen -- oh dann sang auch deine Seele, stammelte schauernd die süße Gewißheit: Auf allen Sternen ist Liebe! Trunken bin ich von diesem Liede, das aus der Harfe der Ewigkeit hallt. Oh meine Brüder auf wandelnden Welten, deren Sonnen purpurne Kränze um die Muttersonne des Alls ewigen Rhythmus’ Sturmschwung reißt, grüßen laßt euch durch Äonen! Tausendgestaltiger Sterblicher Hymnen Ein’ ich des Menschengeschlechts Dithyrambe. Auf allen Sternen ist Liebe! Liebe! Liebe! durch die Unendlichkeit ausgegossen, ein Strom erlösenden Lichts, in das Nichts, die Nacht der Herzen deine glühenden Wogen schlagend -- hebend aus dem Dumpfen das Heilige -- aus dem Chaos rettend und schaffend den Gott -- Gottheit auf die Stirn dem Menschen prägend und ins schimmernde Aug ihm Gottheit senkend -- Liebe! Liebe! Auf allen Sternen ist Liebe! Liebe! Liebe! bist du die Mutter auch aller Schmerzen, aller der Lebensqual, wer erträgt um dich nicht alles, stolzen Mutes, ein Held, ein Ringer! Heilig sprechen wir Haß und Leid und Schuld, denn wir lassen von dir nicht, oh Liebe! Träges Verschlummern lockt uns nicht, Leben und Tod soll ewig dauern, denn wir wollen dich ewig, oh Liebe! Auf allen Sternen ist Liebe! Erden werden zu Eis erstarren und ineinander stürzen, Sonnen die eigene Brut verschlingen, tausend Geschlechter und aber tausend werden in Staub und Asche fallen: aber von Ewigkeit zu Ewigkeit bricht aus unzähliger Lebenden Brüsten dreimal heilig und hehr das hohe Lied, dreimal heilig des Lebens Preisgesang: Auf allen Sternen ist Liebe!
Zwischen Weinen und Lachen
Zwischen Weinen und Lachen schwingt die Schaukel des Lebens. Zwischen Weinen und Lachen fliegt in ihr der Mensch. Eine Mondgöttin und eine Sonnengöttin stoßen im Spiel sie hinüber, herüber. In der Mitte gelagert: Die breite Zone eintöniger Dämmerung. Hält das Helioskind schelmisch die Schaukel an, übermütige Scherze, weiche Glückseligkeit dem Wiege-Gast ins Herz jubelnd, dann färbt sich rosig, schwingt er zurück, das graue Zwielicht, und jauchzend schwört er dem goldigen Dasein dankbare Treue. Hat ihn die eisige Hand der Selenetochter berührt, hat ihn ihr starres Aug, Tod und Vergänglichkeit redend, schauerlich angeglast, dann senkt er das Haupt, und der Frost seiner Seele ruft nach erlösenden Tränen. Aschfahl und freudlos nüchtert ihm nun das Dämmer entgegen. Wie dünkt ihm die Welt nun öde und schal. Aber je höher die eine Göttin die Schaukel zu sich emporzieht -- je höher schießt sie auch drüben empor. Höchstes Lachen und höchstes Weinen,eines Schaukelschwungs Gipfel sind sie. Wenn die Himmlischen endlich des Spieles müde, dann wiegt sie sich langsam aus. Und zuletzt steht sie still und mit ihr das Herz des, der in ihr saß. Zwischen Weinen und Lachen schwingt die Schaukel des Lebens. Zwischen Weinen und Lachen fliegt in ihr der Mensch.
Im Tann
Gestern bin ich weit gestiegen, abwärts, aufwärts, kreuz und quer; und am Ende, gliederschwer, blieb im Tannenforst ich liegen. Weil’ ich gern in heitrer Buchen sonnengrünem Feierlichte, lieber noch, wo Tann und Fichte kerzenstarr den Himmel suchen. Aufrecht wird mir selbst die Seele, läuft mein Aug empor den Stamm: Wie ein Kriegsvolk, straff und stramm, stehn sie da, ohn Furcht und Fehle; ernst, in selbstgewollter Buße, nicht zur Rechten nicht zur Linken: wer der Sonne Kuß will trinken, hat im Dämmer keine Muße. Denksam saß ich. Moose stach ich aus des Waldgrunds braunem Tuch. Und der frische Erdgeruch tat mir wohl, und heiter sprach ich: Wahrlich, ich vergleich euch Riesen unerbittlichen Gedanken, die sich ohne weichlich Wanken Höhenluft der Wahrheit kiesen. Philosophin Mutter Erde hat euch klar und schlicht gedacht, jeglichem zu Lehr und Acht, wie man teil des Lichtes werde. Stolz aus lauem Dämmer flüchten, Rast und Abweg herb verachten, nur das eine Ziel ertrachten -- also muß der Geist sich züchten. Lang noch an den schlanken Fichten sah ich auf mit ernstem Sinn. Erde! Große Meisterin bist du mir im Unterrichten! Besser als Folianten lehren, lehrst mich du, solang mein Leben. Unerschöpflich ist dein Geben, doch noch tiefer mein Verehren.
Der zertrümmerte Spiegel
Am Himmel steht ein Spiegel, riesengroß. Ein Wunderland, im klarsten Sonnenlichte, entwächst berückend dem kristallnen Schoß. Um bunter Tempel marmorne Gedichte ergrünt geheimnisvoller Haine Kranz; der Seen Silber dunkle Kähne spalten, und wallender Gewänder heller Glanz verrät dem Auge wandelnde Gestalten. Wohl kenn ich dich, du seliges Gefild! . . Doch was in heitrer Ruh erglänzt dort oben, ist mehr als dein getreues Spiegelbild, ist Irdisches zu Göttlichem erhoben. Du zeigst ein friedsam wolkenloses Glück, um das umsonst die Staubgebornen werben . . . Und doch! Auch du bist nur ein Schemenstück! Ein Hauch --: Du schläfst im Grund in tausend Scherben. Ein Hauch! . . Von düstren Wolken löst ein Flug sich von der Felskluft Schautribünenstufen. Um meinen Gipfel streift ihr dumpfer Zug, als hätte sie mein fürchtend Herz gerufen. Hinunter weist beschwörend meine Hand, indes mein Aug nach oben bittet »Bleibe!« Umsonst! Ein Stoß zermalmt des Spiegels Rand, und donnernd bäumt sich die gewaltige Scheibe und stürzt, von tausend Sprüngen überzackt, mit fürchterlichem Tosen in die Tiefen. Der Abgrund schreit, von wildem Graun gepackt. Blutüberströmt die Wolken talwärts triefen. Fahlgrüner Splitterregen spritzt umher, den Leib der Nacht zerschneidend und zerfleischend. Mordbrüllend wühlt der Sturm im Nebelmeer und heult in jede Höhle, wollustkreischend. Der Berge Adern schwellen, brechen auf und schäumen graue Fülle ins Geklüfte. Ihr Flutsturz reißt verstreuter Scherben Hauf unhemmbar mit in finstre Waldnachtgrüfte. Es wogt der Forsten nasses Kronenhaar, durchblendet von demantnem Pfeilgewimmel . . Doch um die Höhen wird es langsam klar, durch Tränen lächelt der beraubte Himmel. Und bald verblitzt der letzten Scherbe Schein, zum Grund gefegt vom Sturm- und Wellentanze. Nur feiner Glasstaub deckt noch Baum und Stein und funkelt tausendfach im Sonnenglanze . . . Ich schau, ich sinne, hab der Zeit nicht acht --: Den Tag verscheuchte längst der Schattenriese. Und aus der Tiefe predigen durch die Nacht die Fälle vom versunknen Paradiese.
Das Kreuz
Die gestürzten Engel schweben um den Berg. Mit weißen, bleiernen Riesenfittichen schleicht ihr Flug aus den Talen, daß er die Höhen der Erde auch todeskältend überfinstere, daß im Schweigen der Nacht endlich das Leben sterbe. Lebendige Flammen entrief ich dem Fels zum Schutze. In goldenem Zorn leuchtet das Berghaupt. Aber die heißeste Stirn, das glühendste Aug ist nicht lange gefeit, wo solcher Flügel grabkalte Bahrtücher der Vernichtung eisige Schauer ins Haupt schatten. Und fahles Grauen würgt mir die Kehle und reißt einen Schrei mir aus der Brust und wirft ihn hinaus in die Finsternisse . . Vom grauen Fittichgewölbe fällt er ohnmächtig in mich zurück. Im Schein der mühsam kämpfenden Lohe trete ich, halb von Sinnen, zum Rande des Abgrunds und breite, wie prüfend, die Arme aus. Da zucken die Nebelgespenster grausengepackt zusammen. Ihr schnürender Reigen löst sich, zerstreut sich. In wildem Entsetzen rasen heulend die Satane um den Gipfel. Ich aber erkenne auf der zitternden Wand ihrer Flügelflucht ein mächtiges, schwarzes Kreuz. Meines Körpers kreuzförmiger Schatte quält triumphierend die Engel des Todes hinweg, hinab, zurück in ihr trauriges Reich. Ich stehe noch lange, die Arme gebreitet, doch nicht mehr in Angst noch als Wehr, nein! jetzt als Gruß und heilige Ehrung den tausend lächelnden Lichtaugen des unsterblichen Alls.
Die Versuchung
Der alte, ehrwürdige Herr mit dem großen Bart war heute bei mir. »Ich habe dich gestern gerettet!« sagte er freundlich. »Den Einfall, die Arme zur Kreuzform zu strecken, hab ich dir gesteckt.« Ich schüttelte dankbar die biedere Rechte. Er aber drohte mir mit dem Finger: »Ein Schelm bleibst du doch! Ich traue dir nicht. Doch höre!« Und er kniff mir den Arm und zeigte mir rings die Lande --: »Dies alles soll dein sein, wenn du hier hinfällst und mich anbetest.« Der Arme, er wußte nicht, daß Erde und Himmel durch Phanta längst mein war. »Nun, willst du nicht?« rief er halb ängstlich halb ärgerlich. Ich aber machte ihm schnell eine kalte Kompresse um die erhitzten Schläfen und führte ihn sorgsam den Berg hinunter. Auf halber Höhe traf ich den großen Pan. Er wollte gerade eine Windhosen-Orgel bauen. Doch ich entriß ihn dem kühnen Projekte und stellte ihm seinen greisen Kollegen vor. »Alte Bekanntschaft!«, rief Pan und zog die krumme Nase mißmutig noch krümmer. »Vielleicht hilft er dir bei der Windhosen-Orgel!« schlug ich begütigend vor. Das leuchtete ein. Arm in Arm zogen die beiden ab. Ich aber stieg, ein freier, glückseliger Mensch, singend wieder empor auf meine herrlichen, klaren, einsamen Höhen.
Der Nachtwandler
Sanfter Mondsegen über den Landen. Schlafstumm Berge, Wälder, Tale. In den Hütten erstorben die Herde; an den Herden eingenickte Großmütter, zu deren Knieen offne Enkel-Mäulerchen unter verhängten Auglein atmen. Auf Daunen und Strohsack schnarchendes Laster, schnarchende Tugend. Wachend allein: Diebe, Dichter, Wächter der Nacht, und auf Gassen, in Gärten und in verschwiegenen Kammern lispelnde Liebe. Sanfter Mond! du segnest, weil du nichts andres kannst. Aber am Herzen zehren dir Neid und Groll, weil die Menschen dich also mißachten, daß sie zu Bett gehn, wenn du kommst. Ärgerlich ziehn sie die Vorhänge zu: und du stehst draußen und -- segnest milde deine Verächter. Sanfter Mond! manchmal auch lugen Herrschergelüste gefährlich vor unter deiner Demut. Dann rufst du in verträumte Gehirne: »Auf! auf! Ich bin die Sonne! Kommt: es ist Tag!« Und der blöden Schläfer glaubt es dir mancher und steigt ernsthaft aus seinen Kissen und geht gravitätisch über die Dächer. Scheel sehen die Kater ihn an. Er aber wandelt und klettert, als hätt ihm sein Arzt die Alpen verschrieben. Wie? Freundchen! Hätt ich dich heut gar ertappt? Mir dünkt, da unten käm solch ein Wandler! Armer Fremdling, –– besser: Hemdling --, wer bist du? Welchem Bette entflohst du? Opferlamm mondlicher Lüsternheit, meilenweit mußt du gewandert sein! Redet er nicht im Schlaf? horch! »Wer ich bin? . . . Eine lebendige Litfaß-Säule Etikettiert von oben bis unten: -- Staatsbürger, Gemeindemitglied, Protestant, Hausbesitzer, Ehemann, Familienvater, Vereinsvorstand, Reserveleutnant, Agrarier, Christlicher Germane, Antisemit, Deutschbündler, Sozialmonarchist, Bimetallist, Wagnerianer, Antinaturalist, Spiritist, Kneippianer, Temperenzler --« »Wie!«, ruf ich, »und nie Mensch?« Aber da reißt der Schläfer die Augen auf, und -- »Mensch?« von verzerrten Lippen heulend, stürzt er, fehltretend, die Felswand hinab, von Zacke zu Zacke im Bogen geschleudert. Ich aber, ich »Mörder«, muß unbändig lachen. Ich kann nicht anders -- Gott helfe dem Armen! Amen!
Andre Zeiten, andre Drachen
Immer nicht an Mond und Sterne mag ich meine Blicke hängen --: Ach man kann mit Mond und Sternen, Wolken, Felsen, Wäldern, Bächen allzuleichtlich kokettieren, hat man solch ein schelmisch Weibchen stets um sich wie Phanta Sia. Darum senk ich heut bescheiden meine Augen in die Tiefe. Hier und da ein Hüttenlichtlein; auch ein Feuer, dran sich Hirten nächtliche Kartoffeln braten -- wenig sonst im dunklen Grunde. Doch! da drunten seh ich eine goldgeschuppte Schlange kriechen . . . Hochromantisches Erspähnis! Kommst du wieder, trautes Gestern, da die Drachen mit den Kühen friedlich auf den Almen grasten, wenn sie nicht grad Flammen speien oder Ritter fressen mußten -- da der Lindwurm in den Engpaß seinen Boa-Hals hinabhing und mit grünem Augenaufschlag Dame, Knapp und Maultier schmauste -- kommst du wieder, trautes Gestern? Eitle Frage! Dieses Schuppen- Ungetüm da drunten ist ein ganz modernes Fabelwesen, unersättlich zwar, wie jene alten Schlangen, doch auch wieder jenem braven Walfisch ähnlich, der dem Jonas nur auf Tage seinen Bauch zur Herberg anbot. Feuerwurm, ich grüße froh dich von den Stufen meines Schlosses! Denn ob mancher dich auch schmähe, als den Störer stiller Lande, und die gelben Humpeldrachen, die noch bliesen, noch nicht pfiffen, wiederwünschte, -- ich bekenne, daß ich stolz bin, dich zu schauen. Höher schlägt mir oft das Herze, seh ich dich auf schmalen Pfaden deine Wucht in leichter Grazie mit dem Flug der Vögel messen und mit Triumphatorpose hallend durch die Nächte tragen. Sinnbild bist du mir und Gleichnis Geistessiegs ob Stoffesträgheit! Gleichnis bist du neuer Zeit mir, die, jahrtausendalter Kräfte Erbin, Sammlerin, sie spielend zwingt und formt, beherrscht und leitet! Andre Zeiten, andre Drachen, andre Drachen, andre Märchen, andre Märchen, andre Mütter, andre Mütter, andre Jugend, andre Jugend, andre Männer --: Stark und stolz, gesund und fröhlich, leichten, kampfgeübten Geistes, überwinder aller Schwerheit, Sieger, Tänzer, Spötter, Götter!
Die Weide am Bache
Weißt du noch, Phanta, wie wir jüngst eine Nyade, eine der tausend Göttinnen der Nacht, bei ihrem Abendwerk belauschten? Einer Weide half sie, sorglich wie eine Mutter, ins Nachthemd, das sie zuvor aus den Nebel-Linnen des Bachs kunstvoll gefertigt. Ungeschickt streckte der Baum die Arme aus, hineinzukriechen ins Schlafgewand. Da warf es die Nymphe lächelnd ihm über den Kopf, zog es herab, strich es ihm glatt an den Leib, knöpfte an Hals und Händen es ordentlich zu und eilte weiter. Die Weide aber, in ihrem Nachtkleid, sah ganz stolz empor zu Luna. Und Luna lächelte, und der Bach murmelte, und wir beide, wir fanden wieder einmal die Welt sehr lustig.
Abenddämmerung
Eine runzelige Alte, schleicht die Abenddämmerung, gebückten Ganges durchs Gefild und sammelt und sammelt das letzte Licht in ihre Schürze. Vom Wiesenrain, von den Hüttendächern, von den Stämmen des Walds, nimmt sie es fort. Und dann humpelt sie mühsam den Berg hinauf und sammelt und sammelt die letzte Sonne in ihre Schürze. Droben umschlingt ihr mit Halsen und Küssen ihr Töchterchen Nacht den Nacken und greift begierig ins ängstlich verschlossene Schurztuch. Als es sein Händchen wieder herauszieht, ist es schneeweiß, als wär es mit Mehl rings überpudert. Und die Kleine, längst gewitzt, tupft mit dem niedlichen Zeigefinger den ganzen Himmel voll und jauchzt laut auf in kindlicher Freude. Ganz unten aber macht sie einen großen, runden Tupfen -- das ist der Mond. Mütterchen Dämmerung sieht ihr mit mildem Lächeln zu. Und dann geht es langsam zu Bette.
Augustnacht
Stille, herrliche Sommernacht! Silberfischlein springen lustig in dem himmlischen Meer. Hochauf schnellen die zierlichen Leibchen sich, blitzschnell wieder verschwindend. Hinter grauen Wolkenklippen gleißt es verdächtig. Da kauert arglistig der Mann im Mond -- und fischt. Verstohlene, seidene Angelschnüre wirft er hinab in die arglose Flut. Ach! und nun zappelt auch schon ein armer Weißling am Haken und fliegt in weitem Bogen hinauf zu den grauen, häßlichen Klippen . . . mir ist, ich höre ein leises, behäbiges Lachen.
Mädchentränen
Die schönen, blauen Augen des Himmels hängen voll trüber Nebelschleier, und unter verstohlenen Schluchzern strömen graue Güsse zur Erde nieder. Auf traurigen Häuptern tragen die Bäume das schwere Tränenweh, die Bäche hetzen verstört sich talwärts, mürrisch vermummt sich der Berg in weißer Wolle. Und das alles? Weil mit allzuglühender Lippe der liebesrasende, ungestüme Sonnengott des Morgenhimmels reine, kühle Mädchenunschuld bestürmt und die tief errötende Geliebte mit allzuversengenden Küssen in ihrer jungfraustillen Seele fassungslos aufgewühlt. Wie ein Krampf packte die Leidenschaft den überwältigten Herzensfrieden . . . Und all die verwirrten Gefühle lösten und schütteten sich aus in einem großen Weinen. Mählig verebben die Seufzer. Versöhnlicher, weicher wird das Herz. Und schon sehe ich wieder ein halbes Lächeln, ein warmes Winken undämmbar aufdrängender Liebe in den schönen, blauen Augen.
Landregen
Auf der Erde steht eine hohe, gewaltige, tausendsaitige Regenharfe. Und Phanta greift mit beiden Händen hinein und singt dazu --: Monoton, wie ein Indianerweib, immer dasselbe. Die Lider werden mir schwer und schwerer. Nach langem Halbschlaf erwach ich wieder, -- reibe verstört mir die trägen Augen --: auf der Erde steht eine hohe, gewaltige, tausendsaitige Regenharfe.
Der beleidigte Pan
Auf der Höhlung eines erstorbenen Kraters blies heute Pan, wie Schusterjungen auf Schlüsseln pfeifen. Er pfiff »die Welt« aus, dies sonderbare, zweideutige Stück eines Anonymus, das Tag für Tag uns vorgespielt wird und niemals endet. Oh pfeife doch minder, teuerer Waldgott! Halt Einkehr, Pan! Wer hieß Dich denn unter Menschen gehen? . .
Mondaufgang
In den Wipfeln des Walds, die starr und schwarz in den fahlen Dämmerhimmel gespenstern, hängt eine große, glänzende Seifenblase. Langsam löst sie sich aus dem Geäst und schwebt hinauf in den Äther. Unten im Dickicht liegt Pan, im Munde ein langes Schilfrohr, dran noch der Schaum des nahen Teiches verkrustet schillert. Blasen blies er, der heitere Gott: die meisten aber platzten ihm tückisch. Nur eine hielt sich tapfer und flog hinaus aus den Kronen. Da treibt sie schimmernd, vom Winde getragen, über die Lande. Immer höher steigt die zerbrechliche Kugel. Pan aber blickt mit klopfendem Herzen -- verhaltenen Atems -- ihr nach.
Mondbilder
I.
Der Mond steht da wie ein alter van Dyck: ein rundes, gutmütiges Holländergesicht mit einer mächtigen, mühlsteinartigen, crêmefarbenen Halskrause. Ich möcht ihn wohl kaufen, den alten van Dyck! Aber ich fürchte, er ist im Privatbesitz des Herrn Zebaoth. Ich mußte den Ablaß wieder in Schwang bringen! Vielleicht ließ er ihn dafür mir ab . . . Hm. Hm.
II.
Eine goldene Sichel in bräunlichen Garben, liegt der Mond im bronzenen Gewölk. Mag da weit die Schnitterin sein? Ich meine, die Schwaden bewegen sich -- oh, ich errate alles! Ins Ährenversteck zog wohl ein Gott die emsige Göttermaid, -- irgend ein himmlischer Schwerenöter der Liebe, Jupiter-Don Juan oder Wodan-Faust . . In frohem Schreck ließ sie die Sichel fallen . . . Oh, Ihr königlich freien, heiter genießenden, seligen Götter!
III.
Groß über schweigenden Wäldern und Wassern lastet der Vollmond, eine Ägis, mit düsterem Goldschein alles in reglosen Bann verstrickend. Die Winde halten den Atem. Die Wälder ducken sich scheu in sich selbst hinein. Das Auge des Sees wird stier und glasig --: als ob eine Ahnung die Erde durchfröre, daß dieser Gorgoschild einst ihren Leib zertrümmern werde . . Als ob eines Schreies sie schwanger läge, eines Schreies voll Grausen, Voll Todesentsetzen Essetai êmar!
IV.
Durch Abendwolken fliegt ein Bumerang, ein goldgelbes Bumerang. Und ich denke mir: Heda! Den hat ein Australneger-Engel aus den seligen Jagdgründen dorthin geschleudert -- vielleicht aus Versehen!? Der arme Nigger! Am Ende verwehrt ihm ein Cherub, über den himmlischen Zaun zu klettern, damit seine Waffe er wieder hole . . . Oh, lieber Cherub, ich bitte für den Nigger! Bedenke: es ist solch ein schönes, wertvolles, goldgelbes Bumerang!
Erster Schnee
Die in Wolkenkukuksheim zerreißen ihre Manuskripte, und in unzähligen, weißen Schnitzelchen flattert und fliegt es mir um die Schläfen. Die Unzufriednen! Nie noch blieben der Lieder sie froh, die im Lenz ihnen knospeten, nie noch der dithyrambischen Chöre, die durch glühende Julinächte von ihren Munden wie Donner brachen. Immer wieder zerstören gleichmütig sie, was sie gedichtet: und in unzähligen, weißen Stückchen flattert es aus dem grauen Papierkorb, den sie schelmisch zur Erde kehren. Große, redliche Geister! Ich, der Erde armer Poet, versteh Euch. Wenn wir uns selbst genügen wollen, ehrlich Schaffende wir, müssen wir unsren Gedanken wieder all die bunten Hüllen ausziehn. Ach! Allein in der Maske des Worts wird unser Tiefstes dem Nächsten sichtbar! Ihr Stolzen verschmäht es, den Wortewerken, die Ihr erschuft, Dauer zu leihen, und Ihr könnt es -- denn Ihr seid Götter! Keiner von Euch will Trost, will Erlösung, weiß von dem Wahnsinn Glückes und Leides: in Euch selbst seid Ihr Euch ewig genug! Aber wir Menschen, wir Selig-Unseligen, tief in gemeinsame Lose verstrickten, müssen einander die Herzen erschließen, müssen einander fragen, belehren, trösten, befreien, stärken, erheitern, und zu all Dem raten und planen, formen und bauen, rastlos, mühvoll, an dem Menschheitstempel »Kultur«. Ich stehe stumm in den wirbelnden Flocken und denke mit Schwermut meines Stückwerks. Doch streue ich selbst nichts in den lustigen Tanz. Meine Werke, Ihr Götter, stürben wie roter Schnee, wollt ich sie opfern! Ich schrieb mit Herzblut . . . Homo sum.
Talfahrt
Die du im ersten jungfräulichen Schnee dort am fallenden Hang ahnungsvoll schläfst, talbrünstige Lawine! Wach auf! Und trage mich! wildestes Roß, wieder hinab in der Menschen Gefilde! . . . . . . . . . . . . . Die zierliche Flocke bewegt sich . . wächst . . Und stürmt immer toller von Fels zu Fels . . . Ich springe ihr nach und fasse beherzt in ihr weißes, wehendes Mähnenhaar, indessen Phanta den Renner lenkt, wie auf rollender Kugel die Göttin des Glücks, hochaufgerichtet und furchtlos. . . . . . . . . . . . . . Wir sind am Ziel. Vom Laufe ruht im Bach des Tals das Rößlein aus. Ich flieg auf weichen Wiesenplan, und lächelnd hilft mir Phanta auf. Und dann -- zerbricht sie ihren Stab. . . . . . . . . . . . . .
Epilog
Am Schreibtisch finde ich mich wieder, als wie aus krausem Traum erwacht . .: Vor mir ein Buch seltsamer Lieder, und um mich stille Mondesnacht. Ich schaue auf den kleinen Ort, aus dem mein Geist im Zorn geflohn: -- Nachtwächter ruft sein Hirtenwort zu greiser Turmuhr biedrem Ton . . Wie knochige Philisterglatzen erglänzt des Pflasters holprig Beet . . Und auf den Giebeln weinen Katzen um ein versagtes tête-à-tête. Euch also, winklige Gemäuer, durchschnarcht von edlen Atta Trolls, bewarf ich einst mit wildem Feuer aus den Vulkanen meines Grolls! Ich sah in eurer Kleinlichkeit die Welt, die in mir selbst ich trug: es war ein Stück Vergangenheit, das ich in eurem Bild zerschlug. Von oben hab ich lachen lernen auf euer enges Kreuz und Quer! Wer Kurzweil trieb mit Sonn und Sternen, dem seid ihr kein Memento mehr! In tiefentzückten Weihestunden fernab dem Staub der breiten Spur, hab ich mich wieder heimgefunden zum Mutterherzen der Natur! In ihm ist alles groß und echt, von gut und böse unentweiht: Schönheit ist Kraft ihm, Kraft ihm Recht, sein Pulsschlag ist die Ewigkeit. Wen dieser Mutter Hände leiten vom Heut ins Ewige hinein, der lernt den Schritt des Siegers schreiten, und Mensch sein heißt ihm König sein!
Ich hebe Dir mein Herz empor
Ich hebe Dir mein Herz empor als rechte Gralesschale, das all sein Blut im Durst verlor nach Deinem reinen Mahle, o CHRIST! O füll es neu bis an den Rand mit Deines Blutes Rosenbrand, daß: DEN fortan ich trage durch Erdennächt’ und -tage, DU bist!
Hymne
Wie in lauter Helligkeit fließen wir nach allen Seiten ... Erdenbreiten, Erdenzeiten schwinden ewigkeitenweit ... Wie ein Atmen ganz im Licht ist es, wie ein schimmernd Schweben Himmels-Licht -- in Deinem Leben lebten je wir, je wir -- nicht? Konnten fern von Dir verziehen, flohen Dich, verbannt, verdammt Doch in Deine Harmonien kehren heim, die Dir entstammt.
Überwinde!
Überwinde! Jede Stunde, die du siegreich überwindest, sei getrost, daß du im Pfunde deines neuen Lebens findest. Jede Schmach und jede Schande, jeder Schmerz und jedes Leiden wird bei richtigem Verstande deinen Aufstieg mehr entscheiden. Ohne Erbschuld wirst du funkeln, abermals vor Enkeln rege, ungezähltem Volk im Dunkeln weist ein Sieger Sonnenwege.
Wer vom Ziel nicht weiß...
Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben, wird im selben Kreis all sein Leben traben; kommt am Ende hin, wo er hergerückt, hat der Menge Sinn nur noch mehr zerstückt. Wer vom Ziel nichts kennt, kann’s doch heut erfahren; wenn es ihn nur brennt nach dem Göttlich-Wahren; wenn in Eitelkeit er nicht ganz versunken und vom Wein der Zeit nicht bis oben trunken. Denn zu fragen ist nach den stillen Dingen, und zu wagen ist, will man Licht erringen: wer nicht suchen kann, wie nur je ein Freier, bleibt im Trugesbann siebenfacher Schleier.
O gib mir Freuden
O gib mir Freuden, nicht mit dem verstrickt, was ich als niedres Ich in mir empfinde, gib solche Freuden mir zum Angebinde wie Geist sie Geist, der Seele Seele schickt. O nicht mehr dieser schalen Freuden Pein, die doch erkauft nur sind von fremden -- Leiden! Schenk Herzen mir, die sich für DICH entscheiden, so wird auch meines wahrhaft fröhlich sein.
Die zur Wahrheit wandern
Die zur Wahrheit wandern, wandern allein, keiner kann dem andern Wegbruder sein. Eine Spanne gehn wir, scheint es, im Chor ... bis zuletzt sich, sehn wir, jeder verlor. Selbst der Liebste ringet irgendwo fern; doch wer’s ganz vollbringet, siegt sich zum Stern, schafft, sein selbst Durchchrister, Neugottesgrund - und ihn grüßt Geschwister Ewiger Bund.
Geschöpf nicht mehr...
Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken, des Willens Herr, nicht mehr in Willens Frone, der flutenden Empfindung Maß und Meister, zu tief um an Verneinung zu erkranken, zu frei, als daß Verstocktheit in ihm wohne: So bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister: So findet er den Pfad zum Thron der Throne.
Da nimm
Da nimm. Das laß ich dir zurück, o Welt ... Es stammt von dir. Es sei von neuem dein. Da, wo ich jetzo will hinaus, hinein, bin ich nicht mehr auf dich gestellt. Da gilt der blasse Geist allein, den ich mir formte über dir ach, nur wie einen blassen Opferrauch, - da gilt nur noch der ach, so schwache Hauch, der von dem CHRISTUS lebt in mir.
Wie macht’ ich mich von DEINEM Zauber los
Wie macht’ ich mich von DEINEM Zauber los und tauchte wieder nieder in die Tiefe und stiege wieder in des Dunkels Schoß, wenn nicht auch dort DEIN selbes Wesen riefe, an dessen Geisterlicht ich hier mein Sein, als wie der Schmetterling am Licht, erlabe, doch ohne daß mir die vollkommne Gabe zum Untergang wird und zur Todespein. Wie könnte ich von solcher Stätte scheiden, wo jeder letzte Glückestraum erfüllt, verharrte nicht ein ungeheures Leiden, sogar von diesem Himmel nur -- verhüllt. Und da mir dessen Stachel ist geblieben, wie könnt’ ich nun, als brennend von DIR gehn, um DICH in jener Welt noch mehr zu lieben, in der sie DICH, als Sonne, noch nicht sehn. Von Liebe so von DIR hinabgezwungen vom Himmel auf die Erde, weiß ich doch: nur immer wieder von DIR selbst durchdrungen, ertrag’ ich freudig solcher Sendung Joch. DU mußtest DICH als Quell mir offenbaren, der unaufhörlich mir Erneuung bringt. Nun kann ich auch gleich DIR zur Hölle fahren, da mich DEIN Himmel ewiglich verjüngt.
Im Baum, du liebes Vöglein dort
Im Baum, du liebes Vöglein dort,