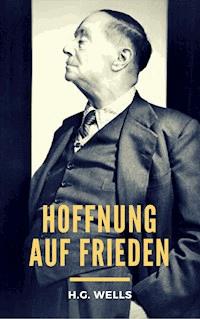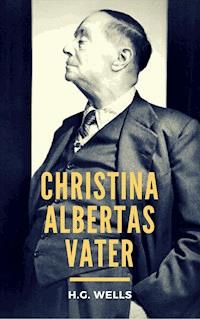
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herbert George Wells (meist abgekürzt H. G. Wells; geboren 21. September 1866 in Bromley; gestorben 13. August 1946 in London) war ein englischer Schriftsteller und Pionier der Science-Fiction-Literatur. Wells, der auch Historiker und Soziologe war, hatte seine größten Erfolge mit den beiden Science-Fiction-Romanen (von ihm selbst als "scientific romances" bezeichnet) "Der Krieg der Welten" und "Die Zeitmaschine". Wells ist in Deutschland vor allem für seine Science-Fiction-Bücher bekannt, hat aber auch zahlreiche realistische Romane verfasst, die im englischen Sprachraum nach wie vor populär sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christina Albertas Vater
Erster Teil. Die Wiederkunft Sargons, des Königs der Könige Erstes Kapitel. Herrn Preembys Jugend 1 2 3 4 5 Zweites Kapitel. Christina Alberta 1 2 3 4 5 6 7 Zweiter Teil. Die Welt weist Saragon, den König der Könige, zurück Erstes Kapitel. Inkognito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zweites Kapitel. Die Berufung der Jünger 1 2 3 4 5 6 7 Dritter Teil. Die Auferstehung Sargons, des Königs der Könige Erstes Kapitel. Christina Alberta auf der Suche nach einem Vater 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zweites Kapitel. Wie Bobby einen Irrsinnigen stahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ImpressumErster Teil. Die Wiederkunft Sargons, des Königs der Könige
Erstes Kapitel. Herrn Preembys Jugend
1
Dies ist die Geschichte eines gewissen Herrn Preemby, eines Wäschereibesitzers und Witwers, der sich zurückgezogen und sein ganzes aktives Interesse an der Wäscherei ‹Zum klaren Bach› in der Gemeinde Sankt Sebastian Weißnichtwo in der Nähe von Woodford Wells mit dem Tode seiner Frau im Jahre des Heils 1920 aufgegeben hatte. Er erlebte einige äußerst merkwürdige Dinge. Diese Geschichte ist im wesentlichen eine zeitgenössische Geschichte: eine Geschichte Londons im Zeitalter des Herrn Arthur Conan Doyle, des Radio und der ersten Arbeiter-Peers. Das geschichtliche Element darin ist unwesentlich und zum Teil unrichtig, und die Zukunft, wenn auch stillschweigend gegenwärtig, wird in Wirklichkeit nicht beachtet.
Da das Waschen in London, so wie der Milchhandel und das Backen, der Schnittwarenverschleiß und noch manch anderer Geschäftszweig, sich spezialisiert hat, erblich geworden und für Außenstehende ein bißchen schwierig zu verstehen ist, ist es notwendig zu erklären, daß Herr Preemby nicht ein geborener Wäscher war. Er hatte wenig vom Geist und Gehaben eines echten Londoner Wäschereibesitzers an sich. Er heiratete in die Wäscherei. 1899 traf er in Sheringham ein gewisses Fräulein Hossett, eine Erbin und junge Dame von großer Entschiedenheit des Charakters; er warb um sie, gewann sie und heiratete sie, wie man noch hören wird, fast ohne zu wissen, was er tat. Die Hossetts sind große Leute in der Wäschereiwelt, und die Firma ‹Zum klaren Bach›, die bald in die fähigen Hände einer Frau Preemby fallen sollte, war nur eines aus einer Reihe von verschwägerten und verbündeten Geschäften im Nord-, Nord-Ost- und Süd-West-Bezirke Londons.
Herr Preemby stammte, was übrigens Fräulein Hossetts Familie ganz frei und unverhohlen gar bald herausfand, aus einem etwas minder praktischen Geschlecht als sein Weib. Sein Vater war Künstler gewesen, reizend und unpünktlich, ein Kunstphotograph, der in Sheringham wohnte und, wie man es in den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts nannte, ‹Gemmenbilder› von den Sommergästen dieses Ortes machte. In jenen Achtzigerjahren war er eine stadtbekannte Sheringhamer Figur, dunkel und schön, manchmal ein wenig ungekämmt; er trug eine braune Samtjacke und einen breitkrempigen, weichen, grauen Filzhut. Er liebte es, sich am Strande mit den Badegästen in Gespräche einzulassen, und ein gewisses vornehmes Aussehen pflegte ihm eine genügende Anzahl dieser Leute in sein Atelier zu bringen, um ihm den Lebensunterhalt zu verschaffen. Seine Frau, unseres Herrn Preemby Mutter, war eine geduldige, unterentwickelte Persönlichkeit, die Tochter eines Landwirtes aus der Nähe von Diss. Als Herr Preemby senior bald aus dem Leben seines Sohnes verschwand – er wurde im Sommer 1887 höchst romantisch in eine Varieté-Gesellschaft verstrickt und verschwand mit ihr im Herbst mit möglichst wenig Aufheben, um nie mehr nach Sheringham zurückzukehren –, da wurde Frau Preemby senior der arbeitende Teilhaber an einem kleinen Miethause und starb in ungefähr einem Jahre, wobei sie ihre Möbel, ihre Interessen an dem Miethaus und ihren einzigen Sohn ihrer Base und Teilhaberin, Frau Witcherly, hinterließ.
Jung Albert Eduard Preemby war damals ein hübscher, schlanker Jüngling von sechzehn Jahren, mit seines Vaters Lockenkopf, seiner Mutter blonden Haaren und himmelblauen Augen, träumerisch und zu regelmäßiger Beschäftigung nicht veranlagt. Schon als Kind hatte er sich der Träumerei hingegeben; in der Schule saß er da, vor sich die vergessenen Rechenaufgaben oder Bücher, über die hinaus er nach unsichtbaren Dingen blickte; im Geschäft mißglückten schon seine ersten Versuche, eben wegen dieser Geistesabwesenheit. Nach einer Anzahl erfolgloser Bemühungen, seine Talente an irgendeiner passenden Stelle der komplizierten Maschinerie unserer Zivilisation anzubringen, fand er schließlich für einige Jahre im Büro eines Hausagenten und Kohlenhändlers, eines entfernten Verwandten seiner Mutter, in Norwich Zuflucht.
Unvergessene Gefühlsbande aus vergangener Zeit verhalfen Albert Eduard zu dieser Stelle und bewahrten jede unvollkommene Ausführung seiner Arbeit vor allzustrenger Kritik. Und er zeigte sich auf einmal viel brauchbarer, als irgendjemand hätte erwarten können. Der Beruf des Hausagenten unterscheidet sich von den meisten anderen Berufen dadurch, daß die nötige treibende Energie vollständig von der Kundschaft geliefert wird, und im Vermieten größerer Häuser fand die schlafende Einbildungskraft des jungen Preemby etwas, das sie anregte. Er offenbarte eine natürliche Gabe für anziehende Beschreibungen und ward infolgedessen mit der Aufgabe betraut, von aussichtsreichen Vermietern nähere Einzelheiten einzuholen. Er besaß eine recht nützliche Hoffnungsfreudigkeit. Ja sogar die Kohle entpuppte sich wider Erwarten als interessant, sobald er einmal herausgefunden hatte, daß sie nicht von ihm ausgetragen werden müsse. Er konnte niemals glauben, daß all die goldenen Schüppchen, die man darin findet, Schwefelkies seien. Er nährte im geheimen den Traum eines großen kaufmännischen Unternehmens, aus Schlackenhaufen rückständiges Gold zu gewinnen. Er erzählte niemandem von diesem Projekt, unternahm keine Schritte, es zu verwirklichen, doch es durchwärmte mit seinem Versprechen von Freiheit und Wohlstand die Eintönigkeit seiner täglichen Arbeit. Und wenn am frühen Nachmittage das Geschäft flau ging und er allein die Aufsicht führte, dann pflegte er sich an den Ladentisch zu setzen, die Kohlenstücke herauszusuchen, die als Muster auf kleinen Blechtellern liegen sollten, sie um- und umzudrehen, unter verschiedenen Winkeln zu betrachten und in seiner Hand zu wägen, wobei er in die herrlichsten Visionen verfiel.
Und wenn Kunden hereinkamen, die nach Häusern suchten, pflegte er sie mit einer Höflichkeit zu empfangen, die beinahe königlich war.
In Norwich wurde er Mitglied des ‹Vereines Christlicher Jünglinge›, doch war es mehr dessen literarische als religiöse Seite, die ihn interessierte, und er nahm an jeder ihm zugänglichen politischen Debatte teil. Niemals freilich sprach er in diesen Debatten, sondern er saß hinten und dachte darüber nach, wie doch diese Politiker im großen und ganzen nichts andres als Drahtpuppen in den Händen der stummen reichen Männer seien, die hinter der Szene sitzen. In Norwich war es auch, wo er sich seinen ersten beim Schneider gemachten Anzug kaufen konnte, in einem äußerst gefälligen Grau. Als er nach Sheringham fuhr, um dort bei Frau Witcherly seinen vierzehntägigen Sommerurlaub zu verbringen, war diese von der vorteilhaften Veränderung in seinem Aussehen entzückt, und die lebhafte Hoffnungsfreudigkeit, die an Stelle der früheren Lethargie getreten war, machte einen tiefen Eindruck auf sie. Auf der Strandpromenade, so nachmittags in seinem grauen Anzug, mochte ihn wohl jeder, der ihn nicht kannte, für irgendeinen vielversprechenden Sommerbadegast halten.
Es scheint erst gestern gewesen zu sein, und doch scheint es wiederum Ewigkeiten zurück, daß unser dicker und kurzer Herr Preemby jener schlanke, blonde Jüngling war, der seinen Stock im Kreise schwang und verstohlen, aber sehnsüchtig nach den weiblichen Badegästen in ihren weiten Baderöckchen und Badehauben schielte, wenn er auf der Strandpromenade von Sheringham dahinschlenderte. Das war in jenen Tagen, da Automobile nicht viel mehr waren als ein Witz, Gestank, Lärm und Reparaturen am Straßenrand und man es für unmöglich hielt zu fliegen. Die Königin Viktoria hatte bereits ihr diamantenes Regierungsjubiläum gefeiert, und kein Mensch dachte daran, daß Albert Eduard, der Prinz von Wales, sie jemals überleben würde, um König zu werden. Der Krieg in Südafrika, der sechs Monate dauern und 40.000 Mann beschäftigen sollte, war gerade für diesen Sommer angesetzt worden. Und es war am dritten Tage seiner Ferien im grauen Anzug zu Sheringham, daß Herr Preemby von seinem zukünftigen Weibe, Fräulein Hossett, die auf einem Fahrrad saß, angerannt und gegen ihre Freundin, Fräulein Meta Pinkey, gestoßen wurde, so daß er von dieser beinahe überfahren worden wäre.
Nämlich weil, so unglaublich das auch dem modernen Leser erscheinen mag, die Leute in jenen fernen Neunzigerjahren, bevor die dazu geeigneteren Automobile aufkamen, sogar mit den schwerfälligen Geräten, die einem damals zu Gebote standen, wie Fahrrädern, Pferdewagen und dergleichen, es zustande brachten, andere Leute umzurennen und zu überfahren.
2
Fräulein Meta Pinkey war ein leicht erregbares, blondes Mädchen, und sie fiel anmutig und natürlich von ihrem Rad gerade in Herrn Preembys Arme, als er gegen sie geschleudert wurde. Es mochte so scheinen, als ob es die ursprüngliche Absicht des Schicksals gewesen wäre, dies zum Anfang einer dauernden Beziehung zu machen, aber in diesem Falle hatte das Schicksal seine Rechnung ohne Fräulein Hossett gemacht. Fräulein Meta Pinkey war gerade damals so reif für die Liebe, wie trockenes Schießpulver für den Knall, und sie war bereits heiß in Herrn Preemby verliebt, noch ehe er sie wieder sicher auf ihre Füße gestellt hatte. Sie stand errötet, mit großen Augen und atemlos da, und Herr Preemby sah, nachdem er ihr Fahrrad mit der Würde eines Retters aufgeklaubt hatte, recht hübsch und männlich aus.
Nachdem Fräulein Hossett an Herrn Preemby gestoßen war, schwenkte sie zur Seite, stieg ab und stand nun zu einem Wortwechsel bereit da. Der Zusammenstoß hatte die bereits lockere Lenkstange des vollkommen unverläßlichen, gemieteten Fahrzeuges, auf dem sie gesessen war, noch mehr gelockert. Diese Lockerung war die Ursache des Unglücks gewesen. Ihre Aufmerksamkeit schien in gleicher Weise zwischen diesem Umstand und einer möglichen Beschwerde Herrn Preembys geteilt zu sein. »Ich klingelte«, sagte sie.
Sie stand errötet und aufrecht da: ein Mädchen mit rundem Gesicht, langem, dünnem Hals und guter heller Hautfarbe, mit Gläsern über ihrer schmalen Nase und einem entschlossenen, scharfgezeichneten Munde.
»Ich hab' alles getan, um auszuweichen«, sagte sie.
»Es war ungeschickt von mir«, sagte Herr Preemby entwaffnend. »Ich war in Träumereien verloren.«
»Sie sind doch nicht etwa verletzt –?« fragte Meta.
»Nur erschrocken,« sagte Herr Preemby, »besonders wie mich das Rad getroffen hat. Dieser Ort ist voller Ecken.«
»Ich wäre umgefallen,« sagte Meta, »wenn Sie mich nicht aufgefangen hätten.«
Fräulein Hossett hatte sich nun betreffs jedes mit Herrn Preemby möglichen Konfliktes beruhigt. Offenbar hatte er die Absicht, den Unfall freundlich hinzunehmen. »Die Lenkstange da war so locker wie nur etwas«, sagte sie. »Schaun Sie her! Man kann sie herumdrehen wie auf einem Drehring. Die Leute sollten bestraft werden dafür, daß sie solche Räder vermieten. Eines schönen Tages wird einer von ihnen schon noch einmal wegen Fahrlässigkeit draufzahlen. Dann werden sie ein bißchen vorsichtiger sein. Skandalös nenn' ich das.«
»Sie können jetzt natürlich nicht mehr damit fahren«, sagte Herr Preemby.
»Nein«, gab sie zu. »Ich muß es den Leuten zurückbringen.«
Es schien Herrn Preemby nur recht und billig, ihr das Rad durch die Stadt zurückzuschieben, dorthin, wo sie es gemietet hatte, und wo Fräulein Hossett den Vermieter zur Rede stellte, sich weigerte, etwas zu zahlen, und die Rückgabe ihrer Anzahlung mit ein paar wohlgewählten Worten durchsetzte. Fräulein Pinkey zahlte für ihr Rad die Miete für eine angefangene Stunde. Danach schien es für die kleine Gesellschaft zu dritt nur natürlich, beieinander zu bleiben. So blieben sie denn, mit einem leisen Gefühl von Abenteuerlust, beisammen, und Herr Preemby benahm sich ganz wie ein regelrechter Zimmermieter in Frau Witcherlys Haushalt und ein Sommergast am Meer. Seine neuen Bekannten waren Londoner, und er selbst machte Andeutungen über Norwich und die Verwaltung von Häusern. Es war recht amüsant, ihn über Sheringham sprechen zu hören. Er sagte, es sei »eine liebe kleine halb fort-, halb rückschrittliche Stadt« und es sei eine wahre Wohltat herzukommen, um frische Seeluft zu atmen.
»Ich kann so richtig elegante Plätze nicht leiden«, sagte Herr Preemby. »Ich bin zu zerstreut.«
3
In späteren Jahren versuchte Herr Preemby oft, sich die verschiedenen Stadien, die ihn dazu geführt hatten, Fräulein Hossett zu heiraten, ins Gedächtnis zurückzurufen, aber dabei hatte er stets das unbestimmte Gefühl, etwas auszulassen, obzwar er nie recht wußte, was es war oder wo es hingehörte.
Im Anfang hatte es nicht im mindesten den Anschein, daß er Fräulein Hossett heiraten würde. Ja wirklich, es sah garnicht danach aus, daß er überhaupt jemals heiraten würde, und wenn jemand das Wort Heirat als die mögliche Folge dieses Zusammentreffens ihm ins Ohr geflüstert hätte, so wäre er heftig erschrocken. Er merkte wohl, daß seine Gesellschaft den Mädchen angenehm war, aber soweit er sehen konnte, bildete Meta das Band, das die beiden mit ihm verknüpfte. Bald gesellte sich eine vierte Person zu ihnen, die auf den Namen Wilfred hörte, und es schien Herrn Preemby eine unantastbare Tatsache, daß Wilfred und Fräulein Hossett zusammengehörten.
Das junge Volk wanderte so in kleiner Gesellschaft an der Strandpromenade entlang bis dorthin, wo die Promenade aufhörte und sie eine geschützte und verhältnismäßig sichere Nische in einem Vorsprung der niedrigen Klippen fanden, allwo sie sich den Freuden des ‹Sponsierens› hingeben konnten; und da sponsierte Meta mit Herrn Preemby und Wilfred mit Fräulein Hossett. Noch über den Golf eines Vierteljahrhunderts hinüber war Herrn Preembys Gedächtnis sicher, daß esso gewesen war und nicht anders.
Die Lebensgewohnheiten ändern sich von Geschlecht zu Geschlecht. Das Wissen hat sich verbreitet, die Verfeinerung zugenommen, und eine Generation von jungen Leuten mit mehr Selbstzucht, mehr Sophistereien oder mehr Entschlossenheit als ihre Vorfahren hat von der Welt Besitz ergriffen. Dieses Sponsieren war ein harmloses, ungeschicktes Liebkosen, das in jenen verschwundenen Tagen in hoher Gunst stand, ein Liebkosen, das – wann immer es notwendig wurde – vonseiten der Dame durch Schreie wie ‹Hör' auf› oder ‹Hör' auf, sag' ich› in den Grenzen des strengen Dekorums gehalten wurde. Sie umarmten sich, küßten sich und steckten ihre dummen jungen Köpfe zusammen und vertrieben sich so die lange Wartezeit, bis die Liebe sie fortriß. Die Sommerkurorte Englands waren rings von jungen Leuten übersät, die diesen armseligen, dummen und unwürdigen Liebesvorgefühlen huldigten. Herr Preemby war, soviel wurde klar, von Natur aus der geborene Sponsierer.
»Es ist allerliebst, wie Sie mich quetschen«, sagte Fräulein Meta.
Herr Preemby quetschte noch mehr und wagte es, ihr heißes Ohr zu küssen.
»Nicht, nicht!« sagte Fräulein Meta, mit einer Stimme voll Lust. »Ihr kleiner Schnurrbart da – der kitzelt.«
Gerötet von Mut und ganz von Ideen für weitere Unternehmungen eingenommen, bemerkte Herr Preemby nicht, daß der Handel zwischen Fräulein Hossett und ihrem Wilfred einen etwas trübseligeren und weniger befriedigenden Verlauf nahm. Wilfred gehörte nicht zu der Art, die Herrn Preemby zusagte. Trotz der Tatsache, daß er viel weniger sorgfältig gekleidet war als Herr Preemby – er trug graue Flanellhosen, eine alte Phantasieweste, eine Norfolk-Jacke aus Tweed und niedrige braune Halbschuhe mit hellen Socken –, machte er auf Herrn Preemby den Eindruck, als sei er sich bewußt, einer höheren Gesellschaftsklasse anzugehören. Er war jung – der Jüngste der ganzen Gesellschaft –, und doch beherrschte er sie. Er hatte große rote Hände und große Füße, eine Menge unordentlichen Haars, unregelmäßige Züge, die später vielleicht einmal schön werden mochten, und ein heiser wieherndes Lachen. Er schaute Herrn Preemby an, als ob er ihn durch und durch kenne und darum von ihm nur umso schlechter denke, aber für den Augenblick nicht die Absicht habe, an seiner Gegenwart positiven Anstoß zu nehmen. Er sei, flüsterte Meta, Medizinstudent in Cambridge und sein Vater ein Arzt aus der Harleystraße, der noblen Ärztestraße in London, der zum Ritter geschlagen worden war. Er sponsierte nicht mit Hingabe; er schien des Sponsierens überdrüssig, er hatte vielleicht ein paar Tage lang sponsiert, und aus seiner Unterhaltung mit Fräulein Hossett fühlte man den unterdrückt streitsüchtigen Ton heraus. Er saß ein wenig abseits von ihr zwischen dem Sand und dem rauhen, bläulichen Gras, und sie war errötet. Was sie sagten, konnte unser umschlungenes Paar nicht hören.
»Christine und Wilfred kommen nicht so gut miteinander aus wie wir«, sagte Meta leise. »Die sind dumm.«
»Er ist wie alle Männer,« sagte Meta, »außer einem vielleicht. Haben möchten sie alles und geben nichts.«
»Er würde nicht einmal zugeben, daß sie verlobt sind«, sagte sie. »Vermeidet es, ihren Vater kennen zu lernen.«
Es entstand eine nachdenkliche Pause und dann ein neuer Sturm von Liebkosungen.
»Ich bin ganz vernarrt in dich«, sagte Meta. »Ich bin schön vernarrt in dich. Du hast die blauesten Augen, die ich je gesehen habe. Porzellanblau sind sie.«
4
So getrennt verbrachten Herr Preemby und sein zukünftiges Weib ihren ersten Nachmittag miteinander. Er erinnerte sich daran, wie an die meisten tatsächlichen Ereignisse, nur undeutlich, in einem Nebeneinander von heißem Sand und Sonnenschein, blaugrauem Gras und einer Reihe von Mohnblumen, die gegen einen dunkelblauen Himmel nickten. Und dann schien über diese sich öffnenden Erinnerungen Christine Hossett auf ihn loszuspringen, mit geröteten Wangen und glühenden Augen, die durch ihre Gläser noch vergrößert wurden.
Zwei oder drei Tage vergingen jedoch, bis es zu jenem leidenschaftlichen Überfall kam. In seiner Eigenschaft als gelegentlicher Besucher Sheringhams hatte Herr Preemby keine Verpflichtung, einen gesellschaftlichen Hintergrund aufzuweisen, dagegen aber stellte ihn Fräulein Pinkey zwei breiten, freundlichen Tanten von einer gewissen seßhaften Art als einen jungen Verwandten des Fräuleins Hossett vor, der sie vor einem gefährlichen Fall vom Rade gerettet habe; er und sie gingen miteinander zu Christine Hossetts ‹Leuten› zum Tee. Der alte Herr Hossett war ein äußerst kränklicher Mann, ungewöhnlich dick und reizbar; seitdem sein Sohn gestorben war, war er nicht mehr derselbe gewesen, was immer auch ‹derselbe› gewesen sein mag; und Frau Hossett, eine energische, hagere Warnung vor dem, was ihre Tochter noch werden mochte, hatte Herrn Hossett wie ein kleines Kind zu bedienen. Anstelle von Christines Zwicker trug sie Brillen, ihre Augen waren abgehärmt, ihr Teint bleifarben, ihr Hals dünn. Es waren da auch noch ein verheirateter Vetter und seine Frau, Herr und Frau Widgery, zugegen, die unter dem Eindruck zu stehen schienen, daß Herr Preemby ein Verwandter des Fräulein Pinkey sei. Herr Widgery hatte ein langes, pockennarbiges Gesicht und die dümmsten braunen Augen, die Herr Preemby je gesehen hatte. Es gab zum Tee nichts Schwieriges zu essen, und so gelang es Herrn Preemby recht gut, einer ausführlichen Rede der Frau Hossett zu folgen, und zwar über die Mißlichkeit und Unsicherheit von Herrn Hossetts Existenz infolge eines Herzfehlers, und wie unbefriedigend und beunruhigend es doch sei, fortzugehen und die Wäscherei in den Händen des Verwalters zu lassen. Wilfred war nicht zum Tee gekommen. Er war eingeladen worden, war aber nicht gekommen.
Am nächsten Tage traf Herr Preemby Wilfred am Strande, wie er gerade den beiden Mädchen zuschaute, die von einem Badekarren aus badeten. Nachher gingen alle vier spazieren, um ein einsames Plätzchen zu suchen, und da wurde es offenbar, daß Fräulein Hossett nicht mehr mit Wilfred sponsieren wollte. Offenbar war es zu einem gründlichen Krach zwischen Christine und Wilfred gekommen. Die beiden sprachen kaum miteinander, als man wieder zur Stadt zurückkehrte; und noch bevor man die Strandpromenade erreicht hatte, sagte Wilfred ‹Auf Wiedersehn›, ganz plötzlich, drehte sich um und verschwand auf einer Straße, die landeinwärts führte. Damit verlor sich Wilfred aus Herrn Preembys Welt; Herr Preemby erfuhr niemals, was aus ihm geworden war, und wünschte auch niemals, es zu erfahren; und am nächsten Tage wurde er zum erstenmal der vergrößerten Augen Fräulein Hossetts gewahr, die ihn mit einem Interesse und einer Herausforderung ansahen, daß ihm beinahe unbehaglich zumute wurde.
Fräulein Hossett wurde ein ernstliches Hindernis für die Zärtlichkeiten Metas. Das Quartett war nun zu einem Trio zusammengeschmolzen, und Herr Preemby sah sich selbst als den Scheitelpunkt, sozusagen, eines Dreieckes, des unsterblichen Dreieckes, in einer außergewöhnlich akuten Form. Wann immer Meta auf der einen Seite war, Christine war auf der anderen. Sie nannte ihn ‹unser Teddy›, sie ließ ihm keine Ruhe; sie ging so weit, sein Haar zu streicheln. Metas Liebkosungen verloren in gewissem Grade angesichts dieser Konkurrenz, doch erhob sie keinen ausdrücklichen Einspruch dagegen.
Tief in der Natur des menschlichen Männchens liegt ein Quell polygamischen Stolzes. Herr Preemby benahm sich unter diesen neuen Umständen stolz und unaufrichtig. Er glaubte, selbst mit zwei Mädeln zugleich ‹anzubandeln›, und es schien ihm, als befinde er sich in einer wirklich großartigen Lage. Aber in Wahrheit war es nicht so sehr ein Fall des Anbandelns als des Angebandelt-Werdens. In der Welt der amerikanischen Gefühlsvorstellungen gibt es ein Ideal, der ‹Höhlenmensch› genannt, das sehr gerne von ruhigen, wenig aggressiven Frauen gehegt wird, weil seine Verwirklichung so wenig Umstände von ihrer Seite aus verlangt. Der ‹Höhlenmensch› soll bloß zugreifen, festhalten, die Braut heimführen und anbeten. In dieser einfachen Liebesgeschichte Herrn Preembys spielte Fräulein Hossett die Rolle des ‹Höhlenmenschen›, wenigstens bis zu dem Punkte des Heimführens. Bei der ersten Gelegenheit, da sie miteinander allein waren, zog sie ihn an sich, küßte ihn auf den Mund, und das mit einer Wärme, Heftigkeit und Gründlichkeit, die Herrn Preemby erstaunte und überwältigte. Es war ganz anders als Metas schüchterne Großtaten oder irgendetwas, das er rings um Norwich angetroffen hatte. Er hatte nicht gewußt, daß es solche Küsse gab.
Und in dem warmen Sommerzwielicht fand sich Herr Preemby an eine einsame Stelle des Meeresstrandes hingeleitet, um dort mit Christine Hossett zu sponsieren. Das Licht des aufgehenden Vollmondes mengte sich mit dem Abendglühen; einzelne Kiesel glitzerten gleich Edelsteinen und Sternen. Er hielt sich tapfer, zitterte aber am ganzen Körper. Er wußte, daß diesmal die Unternehmungen nicht von seiner Seite kommen würden. Und Christine Hossetts Sponsiererei war der Metas nicht ähnlicher als Ofenglut dem sanften Mondlicht.
»Ich liebe dich«, sagte Christine, als ob das alles rechtfertigte, und als sie spät nachts heimwärtsstolperten – ‹fürchterlich spät›, wie Herr Preemby meinte –, da sagte sie: »Du wirst mich also heiraten, nicht? Du mußt mich übrigens jetzt heiraten. Und dann können wir uns wirklich lieben. Sooft wir nur wollen.«
»Ich kann nicht ehrlich sagen, daß ich jetzt schon in der Lage bin, eine Frau zu erhalten«, sagte Herr Preemby.
»Ich hab' es doch wirklich nicht nötig, mich nach einem Mann umzuschaun, der mich erhält«, sagte Fräulein Hossett. »Du bist großartig, Teddy, auf jeden Fall, und ich werde dich heiraten. Es muß eben sein, und damit basta.«
»Aber wie kann ich dich denn heiraten?« fragte Herr Preemby beinahe kläglich – denn er war furchtbar müde.
»Du redest, als ob früher noch nie jemand geheiratet hätte«, sagte Christine Hossett. »Und außerdem – nach dem allen – du mußt.«
»Denk daran, daß ich nächsten Dienstag nach Norwich zurück muß«, sagte Herr Preemby.
»Daran hättest du früher denken sollen«, sagte sie.
»Aber ich werde meine Stellung verlieren.«
»Vater wird natürlich was Besseres für dich finden. Wir sind keine armen Leute, Teddy. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen ...«
In solchen Redewendungen ward Christine Hossett von Herrn Preemby gefreit und gewonnen. Er war beängstigt, fürchterlich beängstigt, fühlte sich aber ebenso gewaltig erhoben. Das Ganze machte auf ihn den Eindruck, als wäre es eine wildromantische Affäre und sehr schrecklich und ein bißchen hart für Meta Pinkey. Aber er wurde zu rasch vorwärtsgedrängt, um viel über Meta Pinkey nachdenken zu können. Am nächsten Tage wurde er den Eltern Hossett noch einmal und diesmal als ihrer Tochter Verlobter vorgestellt, und sie gab ihm heimlich drei Goldstücke, damit er ihr zur Überraschung einen Verlobungsring kaufe. Frau Hossett benahm sich erst so, als ob sie Herrn Preemby zwar nett finde, aber die Heirat mißbillige, und dann, nach einer stürmischen Szene mit ihrer Tochter im ersten Stock, benahm sie sich, als ob sie die Heirat höchlichst billige und Herrn Preemby für eine ganz und gar nicht einwandfreie Person halte. Herr Hossett sprach zwar nicht direkt mit Herrn Preemby, aber er sprach von ihm zu seiner Frau und zu nicht vorhandenen Zuhörern in Herrn Preembys Gegenwart als von einem ‹Schuft, der sein Mädel drangekriegt› habe. Doch auch er schien die Heirat für wünschenswert zu halten und niemand machte irgendeinen Einwand gegen seine obiter dicta.
Das alles war für Herrn Preemby sehr verwirrend und erhebend zugleich. Er tat nichts, als was man ihn zu tun hieß. Er wurde über seine Heirat hinübergetragen, wie ein Mann etwa über ein Wehr getragen werden mag. Frau Witcherly gegenüber hob er jede Erklärung der Ereignisse für eine bessere Gelegenheit auf. Am Dienstag zog er mit seinem kleinen Ranzen fort, als ob er nach Norwich zurückgehen wollte. Er schrieb einen einfachen Brief an den Hausagenten und Kohlenhändler, worin er seinem Bedauern Ausdruck gab: Privatangelegenheiten dringender Natur, so sagte er, verhinderten ihn, auf seinen Posten zurückzukehren. Frau Hossett und ihre Tochter fuhren dann mit ihm nach London. Sie alle nahmen in einem Hotel für Abstinenzler in Bloomsbury Zimmer, und Herr Preemby wurde ‹mit besonderer Erlaubnis› zu St. Martin am Trafalgar-Platz getraut.
Dann fuhr er in die Wäscherei ‹Zum klaren Bach›, um dort mit seinen Schwiegereltern zu leben und die Pflichten eines Hilfsverwalters, Kundenwerbers und öffentlichen Agenten zu erfüllen. Herr Hossett redete niemals mit ihm und sprach manchmal ziemlich unfreundlich über ihn, wenn er im Zimmer war, indem er Anklagen erhob, auf die man besser gar nicht hörte, aber Frau Hossett wurde ihm nach und nach wieder von Herzen gut gesinnt. Und bald traf Herrn Hossett ein Herzschlag, und er starb, und wenige Monate später war Herr Preemby Vater. Als er seine Tochter und, wie es sich erwies, sein einziges Kind, zum ersten Male zu Gesicht bekam, dünkte sie ihn ein äußerst häßliches, kleines, rotes Ding. Hatte er doch niemals zuvor ein Baby in so frühem Alter gesehen. Sie hatte eine Menge ganz feinen, feuchten, dunklen Haares, das in der Folge einem Nachwuchs Platz machte; sie zeigte breite, unbestimmte Züge, und ihre Füße und Hände waren auffallend groß. Herr Preemby hatte den seltsamen Eindruck, daß er sie schon früher einmal irgendwo gesehen und nicht gern gehabt habe. Nach ein oder zwei Tagen jedoch wurde sie ein ganz gewöhnliches rosa Baby, und die Verwunderung machte nun der Zuneigung Platz.
Nach der Mutter und Herrn Preemby wurde sie Christina Alberta getauft.
5
Mit der Zeit verschmolzen all diese Erlebnisse in Herrn Preembys Gedächtnis zu einer verschwommenen, glorreichen, romantischen und abenteuerlichen Vergangenheit. Er blieb auch weiterhin ziemlich verträumt und zerstreut, aber im großen und ganzen gab er einen pflichteifrigen, treuen Gatten ab und kam mit seinem gebieterischen und tüchtigen Weibe sehr gut aus.
Wie er am Tage der Hochzeit entdeckt hatte, war sie ihm drei Jahre im Alter voraus, und bis zu ihrem Todestage blieb sie ihm in jeder Hinsicht voraus. Doch behandelte sie ihn mit der Zuneigung, die man für sein Eigentum fühlt; sie wählte alle Kleider für ihn aus, erzog ihn zu guten Manieren, achtete auf seine Haltung und ergriff gegen alle anderen Leute für ihn Partei. Was die Kleidung betraf, so zog sie ihn wie einen Golf-Champion an, weit mehr als er es selbst getan haben würde, hätte er in der Angelegenheit etwas zu sagen gehabt. Einige Jahre lang wollte sie nicht, daß er ein Fahrrad besitze, sie war etwas pedantisch in Bezug auf Wäschereirechnungen und die Art, wie er sie führte, sie setzte sein Taschengeld auf zehn Shilling die Woche fest und war geneigt, alle günstigen Gelegenheiten zu einer Unterredung mit den weiblichen Angestellten der Wäscherei möglichst einzuschränken. Er jedoch erhob keinen sichtlichen Protest gegen diese geringen Abweichungen vom üblichen Gehorsam der Hausfrau. Allmählich tat sich eine Neigung zur Wohlbehäbigkeit kund, und beträchtliche Mengen blonden Schnurrbarts wuchsen ihm ohne sichtliche Anstrengung seinerseits.
Ihr Heim war angenehm, und das umsomehr, als Frau Hossett ihrem Gatten zur sanften Ruhe unter einem Marmorkreuz, mit einer Taube und einem Ölzweig an der Kreuzungsstelle der Arme, auf den Friedhof zu Woodford Wells nachgefolgt war. Herr Preemby wurde ein großer Bücherleser, indem er nicht nur romantische Novellen las – er hatte eine große Abneigung gegen ‹Realismus› in jeder Form –, sondern auch Geschichte des Altertums, astronomische, astrologische und mystische Werke. Ein tiefes Interesse an dem Problem der Pyramiden und an der wahrscheinlichen Geschichte des verlorengegangenen Kontinents Atlantis erwachte in ihm. Auch die okkulte Wissenschaft zog ihn an, und ganz besonders die Möglichkeit, die Willenskraft zu stählen. Manchmal pflegte er Willensübungen vor seinem Spiegel im Schlafzimmer zu machen, wenn Frau Preemby nicht in der Nähe war. In der Nacht wiederwollte er manchmal einschlafen, anstatt in der gewöhnlichen Weise einzuschlafen. Beträchtliche Aufmerksamkeit schenkte er auch Prophezeiungen und der Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen. Er entwickelte eigene Anschauungen über das Jüngste Gericht, die zu einem Bruch mit der bestehenden Kirche geführt haben könnten, hätte Frau Preemby nicht gemeint, daß so ein Bruch eine ungünstige Rückwirkung auf die Wäscherei haben könnte. Mit der Zeit hatte er eine Bibliothek von über tausend Bänden mit einem sehr beträchtlichen Wortschatz zusammengehäuft.
Seine Frau sah auf diese intellektuelle Nebenbeschäftigung mit Wohlwollen, zeitweise sogar mit Stolz, nahm aber selbst wenig daran teil. Für sie war die Wäscherei gut genug. Sie liebte die Wäscherei immer mehr; liebte ihre aufgestapelten reinen und gestärkten Hemden und Kragen, ihre zusammen- und übereinandergelegten Leintücher, liebte das Surren der Maschinen und die seifige, nasse, wirre Geschäftigkeit im Waschraum. Sie liebte es, wenn alles ordentlich und richtig im Gange war; wenn man fühlte, wie alles durch die Waschtröge und Waschapparate und Wringmaschinen ging, alles wohlbehalten, sicher und richtig, und am Ende kein Stück fehlte. Wenn sie herumging, wurden die Stimmen leiser und das Waschen aus purer Hochachtung emsiger. Und sie hatte es gern, wenn sich die Arbeit bezahlt machte.
An Sonntagnachmittagen oder an Tagen, da die Wäscherei seine Dienste nicht benötigte, unternahm Herr Preemby weite Spaziergänge. Bei schönem Wetter pflegte er in den Eppinger Wald zu gehen oder nach Ongar oder sogar so weit, bis er in den ländlichen Frieden der Roothings kam, aber bei trübem Wetter ging er londonwärts. Nach einiger Zeit wurde die Straßenbahn bis zu der jetzigen Endstation in Woodford ausgedehnt, und so ward es möglich, recht bequem gerade bis ins Herz Londons zu fahren, durch die Seven-Sistersstraße und über Camden-Stadt oder, wenn man ein kleines Stück zu Fuß gehen wollte, durch die Leabridgestraße, den Angel und Holborn.
Die Größe und menschenreiche Geschäftigkeit Londons störte schlummernde Gestade in Herrn Preembys Phantasie auf. Er pflegte in ein A. B. C.-Café zu gehen und dort Mittag zu essen – eine Buttersemmel mit einer Tasse Kakao und vielleicht noch einem Fruchttörtchen – und lange Stunden damit zu verbringen, in die Schaufenster zu gucken und manchmal sogar kleine Einkäufe zu machen. Er liebte die Charing-Cross-Straße mit ihren Bücherläden, die Tottenham-Court-Straße, Holborn, Clerkenwell und die Whitechapelstraße, aber Piccadilly, die Bond Street und Regent Street schienen teuer zu sein und bar allen wahren geistigen Interesses; außerdem kam er sich mit seinen bauschigen Golfhosen und seiner Sportmütze an diesen feinen Plätzen etwas unpassend vor. Manchmal ging er auch ins Britische Museum und schaute sich sehr genau alle Gegenstände an, die mit den Pyramiden zusammenhingen. Große öffentliche Ereignisse zogen ihn immer nach London. Ob ein großer Mord oder ein großes Feuer, eine königliche Hochzeit oder ein königliches Begräbnis, man konnte sicher sein, unter den Zuschauern Herrn Preemby zu sehen, da, wo sich die Menge am dichtesten drängte, oft mit einem netten Paket Eßsachen in der Hand, einem belegten Brötchen, einer Apfelsine und so weiter – was Frau Preemby zurechtgemacht hatte. Doch sah er niemals Illuminationen oder Feuerwerke, weil Frau Preemby ihn zu Hause haben wollte, wenn das Tagewerk getan war. Den Großen Krieg von 1914–18 genoß er ernst und gründlich. Einmal kam er an einem Mann vorüber, den er nachher beinahe mit Bestimmtheit für einen deutschen Spion hielt. Dieser Gedanke machte ihn einige Tage lang schaudern. Er hatte ihn sich auf jeden Fall genau angesehen. Er machte eine Menge Luftangriffe mit und sah, wie der Zeppelin in Potters Bar heruntergeschossen wurde. Als die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde, war er gute vier Jahre zu alt, und Frau Preemby wollte ihn nicht in die Bürgerwehr einrücken lassen, weil sie dachte, er könne sich einen Schnupfen holen.
Herrn Preembys Arbeit im Kontor war nicht sehr beschwerlich, doch widmete er seine Gedanken und seine Aufmerksamkeit auch der Ausdehnung des Geschäftes nach außenhin. Er dachte sich verschiedene anziehende Rundschreiben aus. Seine Erfahrungen als Hausagent hatten ihn darin geübt, das Vorhandensein großer, wohnlich aussehender Häuser zu bemerken, die sonst wohl seiner Beobachtung entgangen wären, und sich zu vergewissern, ob sie bewohnt seien; daraufhin pflegte er nachzuschauen, ob die Wäscherei ‹Zum klaren Bach› für solche Häuser Wäsche wasche, und wenn das nicht der Fall war, dann sandte er ein Zirkular dorthin, das er oft sogar mit einem persönlichen Schreiben begleitete. Auch um die Wirtschaftsgebäude kümmerte er sich ein wenig. So ging er manchmal und betrachtete sich lange Zeit die Öfen oder die Kundenwagen oder irgendeine neue Maschine, wie etwa die neue Kalander-Maschine, bevor er damit vertraut wurde. Wenn er dabei aber irgendwo herumstand, wo Mädchen an der Arbeit waren, pflegte Frau Preemby irgendeine Ausrede zu erfinden, um ihn wieder ins Büro zurückzubringen, weil, wie sie erklärte, sie der Ansicht sei, daß es die Arbeit der Mädchen ungünstig beeinflusse, wenn ein Mann herumstehe. Er bezog und las auch manchmal den ‹Britischen Wäscher› und die ‹Färber- und Putzer-Gazette›.
Gelegentlich hatte er glückliche Einfälle. So war es seine Idee, die Kundenwagen hellblau streichen zu lassen und sie mit einem Hakenkreuz zu zieren und genau dieselbe Farbe und dasselbe Zeichen an die Hausfassade der Wäscherei zu malen und auf die Rechnungen zu drucken. Als er aber dann auch die Kutscher in Hakenkreuzkappen stecken und die Wäschekörbe blau anmalen lassen wollte, sagte Frau Preemby, sie sei der Ansicht, daß die Sache jetzt weit genug gegangen sei. Es war auch Herr Preemby, der bereits im Jahre 1913 anregte, Fordautos anstelle von Pferdewagen zu halten. Diese Änderung wurde 1915 vorgenommen.
Und zuhause zwischen ihrem friedvollen Vater mit seinen vielseitigen Interessen und ihrer geschäftigen, gelegentlich ziemlich strengen Mutter, wuchs Christine Alberta zum Mädchen und zur Frau heran.
Zweites Kapitel. Christina Alberta
1
Diese Geschichte, das wurde bereits im ersten Abschnitt des ersten Teiles des ersten Kapitels klar dargelegt, ist Herrn Preembys Geschichte in den späteren Jahren, den Witwerjahren, seines Lebens. Diese Feststellung hat die volle Gültigkeit einer ordentlichen kaufmännischen Garantie, und wir werden uns unter keinen Umständen jemals weit von Herrn Preemby entfernen. Doch das Leben seiner Tochter war mit dem seinigen während dieser Zeit so innig verwoben, daß es notwendig ist, vieles von ihr unterschiedlich und ausführlich zu erzählen, bevor wir mit unserer eigentlichen Geschichte richtig beginnen können. Und sogar, wenn diese bereits begonnen hat und während sie fortläuft und schließlich zu Ende geht, wird sich Christina Alberta immer wieder eindrängen.
Sich einzudrängen lag ja in ihrer Natur. Sie war niemals ein sogenanntes reizendes Kind gewesen. Doch hatte sie stets eine große Vorliebe für ihren Vati und er die größte Zuneigung und Achtung für sie gehegt.
Sie besaß wenig oder gar keinen Takt, und stets war etwas Fremdartiges und Sonderbares um sie, etwas von dem sagenhaften Wechselbalg. Sogar ihre persönliche Erscheinung war taktlos. Sie hatte eine hervorstehende Nase, welche noch größer werden zu wollen schien, während doch Frau Preembys Nase klein und glänzend zwischen ihren Gläsern eingeklemmt saß und die ihres Vaters, geschmackvoll gemeißelt, ganz wie ein wackeres kleines Boot über einer Schnurrbartkaskade hervorschoß; sie war schwarz und ihre beiden Eltern blond. Als sie heranwuchs, zauberten die magischen Kräfte der Jugend einen schönen Ausdruck auf ihre Züge, aber sie war niemals wirklich hübsch. Ihre Augen waren braun, hell und hart. Sie hatte ihrer Mutter scharfgezeichneten, entschlossenen Mund und deren maßvoll energisches Kinn und ihrer Mutter klare, feste Haut und helle Hautfarbe. Sie war ein summendes, schreiendes, stoßendes und schlagendes Kind, mit der Neigung, Ermahnungen nicht zu hören, und besaß eine beinahe instinktive Geschicklichkeit, plötzlichen Kläpsen auszuweichen. Sie flitzte nur so herum. Jetzt war sie auf der Trockenwiese, jetzt unter einem Bett. Das einzige, was man tun konnte, war, sich zu bücken und nachzuschauen.
Sie tanzte. Weder Herr Preemby noch Frau Preemby tanzten, und dieses ununterbrochene Herumhopsen machte beide nervös und ängstlich. Ein Klavier oder irgendeine entfernte Musik konnte sie zum Tanzen bringen, oder sie tanzte zu ihrem eigenen Gesumme; sie tanzte zu Chorälen und am Sonntag. Herr Preemby hatte einen Sechser dafür ausgesetzt, wenn sie einmal fünf Minuten lang ruhig säße, aber es kam niemals dazu.
In ihrer ersten Schule, einer gemischten Tagesschule in Buckhurst-Hill, war sie anfangs äußerst beliebt und dann äußerst unbeliebt und am Ende wurde sie ausgeschlossen. Nachher führte sie sich halbwegs gut in der ‹Mädchenschule der Gastwirte› auf, wo sie von Anfang an als Spaßvogel erkannt wurde. Eine Schwierigkeit lag stets darin, sie bei einem anderen Namen als Christina Alberta zu rufen. Die Leute versuchten alle möglichen Namen, aber keiner außer ‹Christina Alberta› wollte hängen bleiben. ‹Babs›, ‹Baby› und ‹Berti› wurde sie zu Hause gerufen, auch ‹Allie› und ‹Tina›, und in der Schule versuchte man ‹Langnase›, ‹Preemy› und ‹Prim›. Auch ‹Struwwelkopf› wegen ihres Haares beim Hockeyspiel. All diese Namen kamen wieder außer Gebrauch und ließen den ursprünglichen Namen allein übrig.
Mit ihren Aufgaben war sie geschwind, besonders in Geschichte, Geographie und Zeichnen, aber sie brachte ihren Lehrerinnen nicht die gehörige Achtung entgegen; beim Schulhockey spielte sie den rechten Stürmer mit bemerkenswertem Erfolg. Laufen konnte sie wie der Wind und schien dabei niemals außer Atem zu geraten. Ihr Kneifen war einfach entsetzlich. Außerdem konnte sie mit ihrer Nase plötzlich Grimassen schneiden, die die Schwächlicheren in Krämpfe versetzten. Sie hatte die besondere Neigung, dies beim Schulgebet zu tun.
Zwischen ihrer Mutter und ihr bestand Feindseligkeit. Nicht gerade offene Feindseligkeit, aber immerhin erkennbar. Ihre Mutter schien etwas gegen sie auf dem Herzen zu haben, was sie nicht mitteilen konnte. Dies hinderte Frau Preemby nicht, an dem Kinde ihre Pflicht zu tun, ließ aber zwischen ihnen keine wahre, warme Zuneigung aufkommen. Schon von Kindheit an war es immer Vati, der die Küsse bekam, über den hinübergeklettert und der herumgezerrt wurde. Er erwiderte diese Zuneigung. Er nannte sie ‹mein liebes kleines Mädel›, und manchmal ging er sogar so weit, zu behaupten, sie sei ein ‹Wunder›. Er nahm sie mit sich auf Spaziergänge und erzählte ihr viele geheimnisvolle Dinge, die er im Kopfe hatte, über die ‹verlorene Atlantis›, die Lamas von Tibet und die Grundlagen der Astrologie, die unentzifferbar in den Maßverhältnissen der Pyramiden aufbewahrt seien. Er habe oft gewünscht, sagte er, sich die Pyramiden etwas genauer anzuschauen. Manchmal sehe der eine Dinge, die der andere nicht sehen könne. Sie hörte meist aufmerksam zu, obzwar nicht immer ganz im richtigen Geiste.
Er erzählte ihr etwa von der Tugend und Wissenschaft der Atlantis. »Sie gingen in langen weißen Gewändern umher«, sagte er. »Eher wie Bibelgestalten denn menschliche Wesen.«
»Gut für die Wäschereien, Vati«, sagte Christina Alberta.
»Alles, was wir von Astrologie wissen, sind bloße Fragmente von dem, was sie wußten. Sie kannten Vergangenheit und Zukunft.«
»Schade, daß sie alle untergegangen sind«, bemerkte sie ohne sichtliche Ironie.
»Vielleicht sind sie aber nicht alle untergegangen«, sagte er geheimnisvoll.
»Du glaubst doch nicht, daß es heutzutage noch Atlantiker gibt?«
»Einige mögen entronnen sein. Ihre Abkömmlinge mögen näher sein, als du annimmst. Warum, du und ich, Christina, wir könnten beide atlantisches Blut in uns haben!«
Sein Ton drückte Überzeugung aus.
»Was kann uns das schon nützen?« sagte sie.
»Mehr, als du denkst. Verborgene Schätze. Einsicht! Und dergleichen Dinge. Wir sind keine gewöhnlichen Menschen, Christina Alberta.«
Ein paar Augenblicke lang verfolgten die beiden voneinander unabhängige Träumereien.
»Auf jeden Fall wissen wir nicht, daß wir Atlantiker sind«, sagte Christina Alberta.
2
Nachdem sie sich bis zur fünften Klasse in der Schule der Gastwirte durchgekämpft hatte, wurde der weitere Studiengang Christina Albertas durch zwiespältige Meinungen sowohl innerhalb als außerhalb der Schule beunruhigt. Die Lehrerschaft hatte geteilte Ansichten über sie; ihr Betragen war schlecht, der allgemeine Fortgang mittelmäßig oder schlecht, doch kam sie bei Prüfungen durch, und mit besonders auffallendem Erfolg bei externen Prüfungen durch außenstehende Prüfende. Der Wunsch, sie außerhalb der Schule zu haben, war allgemein vorhanden; ob das aber durch eine Freistelle an der Universität bewerkstelligt werden solle oder einfach dadurch, daß man ihre Eltern ersuchte, sie herauszunehmen, das war eine strittige Frage. Die Turnlehrerin war geneigt, Mord als dritte Möglichkeit hinzustellen, und zwar wegen der Schülerin äußerster Mißachtung aller Regeln bei den Spielen, ihrer ganz unsportmäßigen Tricks, auf regelwidrige und unerwartete Art zu gewinnen, und ihrer Tendenz, Freiübungen und Geräteturnen als Gelegenheit für platte Witze zu benützen, die viel besser in das gewöhnliche Klassenzimmer gepaßt hätten. Die Englisch- und Literaturlehrerin war derselben Meinung – obwohl Christina Alberta stundenlang mit ihren Aufsätzen zu verbringen pflegte, indem sie Sätze und ganze Abschnitte aus Pater, Ruskin und Hazlitt so zusammenstellte, daß sie als ihr eigenes Machwerk durchgehen konnten. War es da Christina Albertas Schuld, wenn diese Girlanden aus literarischem Gold immer und immer wieder mit roter Tinte angestrichen waren: ‹Ungeschickt› oder ‹Könnte besser ausgedrückt werden› oder ‹Zu blumig›? Nur die Schulleiterin hatte ein wirklich gutes Wort für Christina Alberta übrig. Doch die Schulleiterin war, wie es ihrer Stellung geziemte, stets bemüht, schwierigen Schülerinnen Verständnis entgegenzubringen.
Und Christina Alberta war gegen die Schulleiterin stets ruhig und respektvoll und konnte sich ihr gegenüber mit höchst verwirrender Plötzlichkeit von einer besseren Seite zeigen, wann immer die Schulleiterin hereingerufen wurde.
Christina Alberta entschied sich, sobald sie von der Angelegenheit erfahren hatte, für die Freistelle. Sie besserte sich beinahe aufdringlich; sie wurde ordentlich, sie hörte auf, Späße zu machen, sie verlor wie eine kleine Sportlerin ganze Spiele beim Tennis gegen die Turnlehrerin; sie widersprach nicht mehr und wurde der entfremdeten Englischlehrerin gegenüber ein emsiger Affe Stevensons. Doch war es vergebliche Mühe. In ihrem reformierten Tennisspiel lag ein bißchen zu großmütige Herablassung, und ein bißchen zu viel Parodie in ihrem baumwollsamtenen Englisch. Die Aussicht also, jemals zu jener glücklichen Klasse von Mädchen zu gehören, die aus den Vororten nach London in die Schule gehen und jenes höhere Leben, das über die väterliche Aufsicht hinaus ist, führen – manchmal bis spät in die Nacht hinein in Ateliers, Laboratorien und Universitäts-Hörsälen –, war eine sehr unwahrscheinliche, sogar wenn sie nicht mit dem stillen, aber entschiedenen Widerstand ihrer Mutter rechnete.
Denn Frau Preemby war nicht die Frau, sich eine Tochter zu wünschen, die über ihre Herkunft und ihren Stand hinaus erzogen wurde. Sie bereute schließlich ihre Nachgiebigkeit, Christina Alberta nicht in der Wäscherei untergebracht zu haben, wie sie selbst im Alter von vierzehn Jahren darin untergebracht worden war. Dann hätte sie das Geschäft von Grund auf erlernt und sich dazu ausgebildet, ihrer Mutter zu helfen und ihr zuletzt nachzufolgen, genau so wie Frau Preemby Frau Hossett geholfen hatte und ihr nachgefolgt war. Aber die Schule mit ihrem Tennis, ihrer Musik, ihrem Französisch und so weiter hatte das Mädel gegen dieses reine und reinigende Leben voreingenommen. Sie war nun bald siebzehn, und je früher sie diese Dinge aufgab, die geradewegs zur Schullehrerin, zur alten Jungfer, zu Ferien in Italien, ‹Künstler›-Kleidern und protzigem Nichtskönnen führten, desto besser für sie und jedermann. Sie unternahm einen Feldzug gegen Christina Albertas Gewohnheit, in ganz unweiblichen Stellungen herumzusitzen und zu lesen; und als Herr Preemby einen ganz ungewohnten und kühnen Anlauf nahm, zu behaupten, sie sei ein bißchen zu streng gegen das Mädchen, und daß er an einem Buch hin und wieder nichts Schlechtes finden könne, da nahm ihn Frau Preemby mit hinauf in Christina Albertas eigenes kleines Zimmer, damit er sehen solle, wohin das führe, und im besonderen, damit er sich die Sorte Bilder anschaue, die sie dort aufgehängt hatte. Doch selbst als er sich einer großen photographischen Reproduktion von Michelangelos ‹Erschaffung Adams›, wie der Meister dies Ereignis an die Decke der Sixtinischen Kapelle zu Rom gemalt hat, gegenübergestellt sah, zeigte er einen schwachen Schimmer von Widerstand, indem er sagte, das sei ‹Kunst›.
»Du würdest alles dulden, was sie tut, glaub' ich«, sagte Frau Preemby. »Schau dir's an. Kunst! Schau dir diese Bücher an! Darwins ‹Entstehung der Arten›! Das ist ein nettes Buch für ein Mädel, um darin herumzuschnüffeln.«
»Höchstwahrscheinlich sieht sie gar nichts Schlechtes daran«, sagte Herr Preemby.
»Was? Sie!« sagte Frau Preemby bedeutungsvoll. »Und schau dir das an!«
‹Das› war Howes ‹Biologischer Atlas›. Sie schlug ihn auf, um seine großen Seiten, die mit Bildern der Einzelteile eines zerlegten Frosches angefüllt waren, zum besten zu geben.
»Wirklich, meine Liebe!« sagte Herr Preemby. »Das ist eins ihrer Schulbücher. Da ist wirklich aber schon gar nichts drin, was manungehörig nennen könnte. Das ist Wissenschaft. Und übrigens ist's ja nur ein Frosch.«
»Hübsche Sachen lernt man heutzutage in der Schule. Mit eurer Kunst und eurer Wissenschaft da! Ihr laßt nicht gerade viel für die Phantasie übrig. Was! Wie ich ein Mädel war, wenn ich da Ma gefragt hätte, was in irgendeinem Tier drin ist, hätte sie mich geschlagen, fest geschlagen. Und mit Recht! Es gibt Sachen, die mit Recht vor uns verborgen sind – und sollen verborgen bleiben. Gott zeigt uns gerade soviel, als gut ist für uns. Mehr sogar. Ganz unnötig, die Tiere aufzuschneiden. Und hier – hier ist ein Buch, französisch!«
»Hm«, sagte Herr Preemby etwas nachgiebiger. Er nahm den zitronengelben Band in die Hand und drehte ihn um.
»Die viele Leserei!« sagte Frau Preemby und zeigte auf drei Regale mit Büchern.
Herr Preemby nahm seinen Mut zusammen. »Du kannst von mir nicht verlangen, daß ich gegen das Lesen bin, Christine,« sagte er, »es ist ein Vergnügen und belehrend. Es gibt Dinge in Büchern ... Wirklich, Christine, ich glaub', du würdest glücklicher sein, wenn du ein bißchen lesen würdest. Christina Alberta ist zum Lesen geschaffen, ob du's glaubst oder nicht. Sie hat's von mir, vermute ich.«
Frau Preemby stutzte und bemerkte den in ihm aufwallenden Widerstand; der Zorn in ihren Augen wurde durch ihre Gläser noch vergrößert. »Es ist wunderbar,« sagte sie nach einer kurzen Pause, »einfach wundervoll, wie Christina Alberta es anstellt, alles zu kriegen, was sie will.«
3
Fräulein Maltby-Neverson, die Leiterin der ‹Schule der Gastwirte›, besuchte Frau Preemby und erschütterte sie in ihrem Entschluß ziemlich stark. Sie war offensichtlich eine richtige Dame, und während der Schulzeit brachte die Schulwäsche bis zu zwanzig Pfund Sterling die Woche. Es wurde ihr das skandalöse Bild gezeigt, und sie sagte: »Sehr schön, in der Tat. Eines der wirklich großen Bilder in der Welt. Tie-ief religiös. Es sind wahrhaftig die Worte der Bibel zu einem Bild geformt. Was finden Sie daran auszusetzen, Frau Preemby?«
Woraufhin, wie durch einen Zauber, das Bild aufhörte, skandalös zu sein, und Frau Preemby sich vor sich selbst schämte. Jetzt sah sie ein, daß an dem Bild niemals etwas Schlimmes gewesen war.
Fräulein Maltby-Neverson sagte, daß Christina Alberta ein schwieriger Typus, aber eine durchaus interessante Persönlichkeit sei, eine wirkliche Persönlichkeit. Sie sei für Liebe sehr empfänglich.
»Ich hab' das nicht gefunden«, sagte Frau Preemby.
»Sie ist ein Typus, den ich studiert habe«, sagte Fräulein Maltby-Neverson einfach, aber entschieden.
Sie erklärte, daß Christina Alberta zu dem aktiven Typus gehöre. Sich selbst überlassen, ohne eine Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten ausnützen könne, werde sie leicht auf schlechte Wege geraten. Nicht daß irgend etwas wesentlich Schlechtes in ihr wäre. Es sei bloß Energie. Bei guter, ernster Arbeit und einem Ziel für ihren Ehrgeiz könne sie eine sehr tüchtige Frau werden, in der Tat – möglicherweise sogar eine hervorragende Frau.
»Ich hab' keine Verwendung für hervorragende Frauen«, sagte Frau Preemby kurz.
»Aber die Welt«, sagte Fräulein Maltby-Neverson sanft.
»Ich fürchte, ich bin von der altmodischen Art«, sagte Frau Preemby.
»Christina Alberta eben nicht.«
»Laßt den Mann draußen hervorragend sein und die Frau im Hause«, sagte Frau Preemby. »Es tut mir leid, daß ich andrer Meinung bin als Sie, Fräulein Maltby-Neverson, aber niemand kann was für seine eigenen Meinungen.«
»Das hängt von uns selbst ab«, sagte Fräulein Maltby-Neverson.
»Es tut mir leid, aber ich bin dafür, daß die Männer herrschen«, sagte Frau Preemby. »Die Frau hat ihre eigene Stellung in der Welt, und das ist nicht die des Mannes.«
»Aber ich dachte doch, Herr Preemby begünstige die Idee mit der Freistelle.«
Frau Preemby wurde verwirrt. »Das tut er auch«, sagte sie, als ob sie nicht ganz klar sehen könne, was das mit der ganzen Sache zu tun habe.
»Lassen Sie es auf eine Probe ankommen«, sagte Fräulein Maltby-Neverson. »Schließlich und endlich, vielleicht erlangt sie die Freistelle gar nicht.«
Aber Christina Alberta errang sie sich und noch dazu mit Leichtigkeit. Sie riskierte dabei nichts. Es war eine Freistelle für zwei Jahre, die ein Wohltäter mit fortschrittlichen Anschauungen an der Londoner Schule für Nationalökonomie gestiftet hatte. Sobald sich Christina Alberta derselben sicher wußte, ging sie, ohne ihre Mutter oder irgend jemand zu befragen, zu einem Friseur und ließ sich einen Bubikopf schneiden. Für Frau Preemby war das beinahe ein noch härterer Schlag als die Freistelle. Sie betrachtete ihre struwwelköpfige, großnasige Tochter in ihrem kurzen Turnröckchen mit einer Anwandlung aufrichtigen Hasses.
Sie hätte gewünscht, ihre Tochter könnte sich selbst so sehen, wie sie sie sah. »Ich möchte nur, daß du dich einmal selber sehn könntest«, sagte sie mit verhaltener Bitterkeit.
»Ach, ich weiß schon«, sagte Christina Alberta.
»Es kommt mir vor, als ob ich durch dich gestraft werden sollte«, sagte Frau Preemby.
4
Christina Alberta hatte erst ein Jahr lang an der Londoner Schule für Nationalökonomie studiert und begann gerade mit dem zweiten, als ihre Mutter sie zwang, auf die Freistelle zu verzichten. Christina Alberta war eines Abends lange in London geblieben, ohne ihrer Mutter vorher etwas davon zu sagen – sie war nämlich zu einer Diskussion über die Bevölkerungsfrage im ‹New Hope Club› in der Fitzgeraldstraße gegangen –, und als sie nachhause kam, hatte sie so stark nach Tabak gerochen, daß ihre Mutter alle Zugeständnisse, die sie hie und da der ‹Moderne› gemacht hatte, bereute und widerrief.
Sie hatte auf diesen Augenblick schon seit Monaten gewartet.
»Jetzt ist es aus«, sagte sie, als sie ihre Tochter einließ.
Christina Alberta sah, daß es augenblicklich keinen Weg rund um oder mitten durch diese Entscheidung gab. Vergeblich bearbeitete sie ihren Vater und Fräulein Maltby-Neverson. Jedoch anstatt die Freistelle geradewegs aufzugeben, wie sie geheißen worden war, suchte sie um eine Verlängerung nach und begründete ihre Abwesenheit durch einen unbestimmten Hinweis auf Familienangelegenheiten.
Mit Frau Preembys Gesundheit stand es in jenen Tagen bereits sehr schlecht, aber dieser Umstand war sowohl in ihrer Tochter als in ihres Gatten Augen vollständig durch den viel dringlicheren überschattet, daß sie jetzt beständig sehr gereizt war. Alles hatte sich verschworen, sie zu quälen – Herrn Preemby ausgenommen, der sich hütete, das zu tun.
Die letzten Jahre des Großen Krieges und mehr noch das erste Jahr des enttäuschenden Friedens waren Jahre äußerst großer Schwierigkeiten für das Wäschereigeschäft. Die Munitionsfabriken bezahlten die Wäschermädchen besser, als es ihre eigene Branche tat, und es ließ sich nichts mehr mit ihnen anfangen. Kohle, Seife, alles stieg ins Ungemessene, und es war unmöglich, bei den Kunden die erhöhten Ausgaben hereinzubringen. Die Leute, selbst die besten unter ihnen, gaben die Reinlichkeit auf. Herren von Rang zogen ihre Frackhemden drei- oder viermal an, und ihre Unterhemden und Unterhosen mußten vierzehn Tage lang aushalten. Die Hauswäsche wurde dementsprechend lange benützt. Die Leute wechselten ihren Wohnsitz; die Offiziersgattin kam und ging, war heute da und morgen dort und ließ unbezahlte Rechnungen zurück. Niemals hatte Frau Preemby eine solche Menge böser Schulden gekannt. Die Wagenkutscher kamen so überreizt und so militarisiert aus der Armee zurück, daß sie aus purer Nervosität und Gewohnheit veruntreuten. Die Einkommensteuer wurde zu einem Nachtmahr. Äußerlich und innerlich war Frau Preembys Leben ein Kampf. Sie hielt zwar die Wäscherei ‹Zum klaren Bach› diese ganze fürchterliche Zeit hindurch aufrecht, weil sie ein Verwaltungsgenie war, doch tat sie es mit einem schrecklichen Verlust an Lebenskraft.
Sie begann bitter darüber zu klagen, daß ihr Herr Preemby und ihre Tochter nicht halfen; wenn sie ihr aber zu helfen versuchten, dann schimpfte sie über ihre Unfähigkeit. Sie richteten mehr Schaden als Nutzen an.
Die Mahlzeiten waren schrecklich. Sie pflegte mit gerötetem Gesicht und durch ihre Gläser starrend dazusitzen, offenbar von einer leidenschaftlichen Erkenntnis der Ungerechtigkeit dieser Welt niedergedrückt, und sehr wenig zu essen. Herrn Preembys Versuche, eine fröhliche Unterhaltung anzuknüpfen, waren selten erfolgreich. Sogar Christina Alberta fürchtete sich.
»Na, die Sachen gehen wohl ein bißchen besser heute morgen?« versuchte Herr Preemby.
»Kann ich nicht einmal beim Essen Ruhe vom Geschäft haben?« beklagte sich die arme Frau.
Oder: »Sieht aus, als ob es schönes Wetter geben würde fürs Derby.«
»Wirklich schade, daß du nicht hin kannst. Du hast wohl nicht gehört, was mit dem Wagen Numero zwei passiert ist?«
»Nein!« sagte Herr Preemby.
»Natürlich nicht. Der hintere Kotschützer ruiniert. Schon seit Wochen. Und niemand weiß, wer's getan hat. Man sollte glauben, um so was müßte sich der Mann wenigstens kümmern, aber nein – mir wird es überlassen, den Schaden zu entdecken. Und dafür zu zahlen. Wie überhaupt alles in dieser Wirtschaft.«
»Da werde ich wohl Nachforschungen anstellen müssen.«
»Deine Nachforschungen, die kenn' ich schon. Besser, du läßt die ganze Geschichte sein, wie sie ist. Lachen und sagen, es war nichts ...«
Das Schweigen der Mahlzeit pflegte damit wiederhergestellt zu sein.
Sie schien besonderen Wert auf dieses schreckliche Schweigen zu legen. Sie beklagte sich sogar, daß er seinen Käsezwieback hörbar esse. Aber wie anders kann man denn einen Käsezwieback essen? Christina Alberta war aus härterem Holze und wurde streitlustig. Da pflegte ihre Mutter gegen ihre Frechheit loszufahren und zu erklären: »Entweder verläßt du den Tisch oder ich.«
»Ich geh' hinauf, lesen«, sagte Christina Alberta. »Es ist ja nicht mein Wunsch, daß ich hier zu Mittag esse.«
Vor dem jähen Abbruch von Christina Albertas akademischer Laufbahn war sie nur beim Frühstück und Abendbrot anwesend gewesen; das Abendbrot war, was die Stimmung betraf, nicht halb so schrecklich wie das Frühstück, und beim Frühstück wiederum konnte man leicht aufstehen und verschwinden; aber nach der Katastrophe mit dem ‹New Hope Club› war sie bei allen Mahlzeiten anwesend, eine Art Blitzableiter für ihren Vater und eine Art Hemmnis und zugleich auch eine neue Quelle der Erbitterung für ihre Mutter. Sie nahm es als eine ausgemachte Sache an, daß sie, da ihre akademische Laufbahn zu Ende war, in die Wäscherei eintreten müsse; aber sie bestand hartnäckig darauf, daß man, wenn man dies unter modernen Verhältnissen auch nur mit einiger Aussicht auf Erfolg tun wolle, eine ‹kaufmännische Spezialbildung› haben müsse. Wenn sie schon nicht in die Londoner Schule für Nationalökonomie gehen könne, so müsse sie wenigstens in Tomlinsons ‹Schule für kaufmännische Ausbildung› in Chancery Lane gehen und Buchhaltung, Stenographie, Maschineschreiben, Geschäftskorrespondenz, knappe Ausdrucksweise, kaufmännisches Französisch und so weiter lernen. Und nach drei Wochen peinlicher Mittagessen wurde dieser Vorschlag unter verschärften Bedingungen angenommen und ihre Monatsfahrkarte nach London erneuert. So arbeitete sie sich noch einmal einen Winter lang recht erträglich durch, wobei sie Tomlinson als ihre Schule, den größten Teil Londons aber als ihren Spielplatz benutzte. Sie lernte alles mögliche. Eine neue Reihe von Freundinnen und Bekanntschaften – einige mit Bubikopf und andere ohne – höchst verschiedener Herkunft und Gesellschaftsklasse kam zu dem Kreis hinzu, den sie sich bereits an der Londoner Schule für Nationalökonomie erworben hatte.
Als Frau Preemby bald darauf von einem stechenden Schmerz, der sie bedrücke, zu sprechen anfing, hielten es ihr Gatte wie ihre Tochter zuerst für eine neue Auswirkung der allgemeinen Unzufriedenheit mit ihnen und legten dem weiter keine besondere Bedeutung bei. Herr Preemby sagte, er sei der Ansicht, sie solle zu einem Arzt gehen, um sich Rat zu holen, oder ihn kommen lassen; doch diesen Vorschlag behandelte sie einige Tage lang mit Verachtung. Wenn sie den Doktor einmal im Haus hätte, sagte sie, dann würden sie sich nach jemand anderem umschauen müssen, der die Wäscherei führen könne. Die Doktoren schicken einen ins Bett und geben einem Sachen, die einem das Aufstehen unmöglich machen. Wie könnten sie denn sonst leben?
Dann plötzlich wurde sie andern Sinnes. Eines Morgens gab sie zu, daß sie sich ‹elend› fühle. Sie ging wieder zu Bett, und Herr Preemby trottete mit bösen Vorahnungen, daß die Welt nun dem Ende entgegengehe, fort nach einem Doktor. Das Fieberthermometer zeigte eine Temperatur von 38.5 Grad Celsius. »Es tut weh. Die Seite tut mir so weh«, sagte Frau Preemby. »Ich hab's schon früher einmal gehabt, aber nicht so stark.«
Christina Alberta kam an diesem Abend nachhause, um zu entdecken, daß sie zu Furcht, Reue und Zärtlichkeit fähig war.
Sie erlebte einige seltsame Augenblicke mit ihrer Mutter, zwischen Phasen von schwachem Delirium und Empfindungslosigkeit. Frau Preemby schien schmaler und hübscher geworden zu sein; die Fieberröte auf ihren Wangen ließ sie jünger erscheinen. Sie war nicht mehr böse oder ärgerlich, sondern pathetisch freundlich. Und Christina Alberta hatte sie seit Jahren nicht im Bett gesehen. »Gib acht auf deinen Vati«, sagte Frau Preemby. »Du bist ihm mehr schuldig – und auch wieder weniger –, als du denkst. Was ich getan habe, hab' ich tun müssen. Gib acht auf ihn, sorg' für ihn. Er ist sanft und gut und leicht zu überreden, und man darf ihn nicht allein lassen in der Welt.
Ich bin nie ganz so zu dir gewesen, wie eine Mutter hätte sein sollen. Aber du warst auch schwierig, Christina. Ich hab' großen Respekt vor dir gehabt ...
Ich bin froh, daß du nicht meine Augen hast. Gläser sind ein Fluch ...«
Sorge um die Wäscherei nahm einen großen Teil ihrer Gedanken in Anspruch.
»Diese Frau Smithers im Waschraum ist eine Diebin, und ich möchte den neuen Mann da, Baxandale, gern loswerden. Ich weiß wirklich nicht, warum ich die Frau Smithers so lang behalten hab' ... Schwäche ... Ich bin nicht sicher wegen ihm, es ist ihm noch gar nichts Positives nachzuweisen, aber ich spür's, er ist nicht ehrlich ... Ich fürchte sehr, wir haben Frau von Badgers Rechnung zu lang laufen lassen. Titel heutzutage – man muß aufpassen. Sie hat mich irregeführt. Sie hat mir einen Scheck versprochen ... Aber ich halte nicht viel von euch beiden in der Wäscherei, ganz und gar nicht. Er kann es nicht und du willst es nicht. Du hättest es leisten können ... Na, das macht ja jetzt nichts mehr.
Den ganzen Betrieb verkaufen? Die Widgerys könnten herkommen. Er ist habgierig, aber ehrlich. Die möchten wahrscheinlich ganz gern herkommen ...
Ich hab' nie daran gedacht, daß ich jetzt schon nicht mehr weiter rackern würde können! ... Ich wollte, der Doktor ließe das Operieren sein. Es wird doch nichts helfen.«
Sie wiederholte viele ihrer Sätze.
»Mir graut davor, aufgeschnitten zu werden«, sagte sie. »Wahrscheinlich ... Wie die Frösche in deinem Buch ...
Es ist doch alles in einem Körper wie in einem gut gepackten Koffer. Sie werden nichts mehr an seinen rechten Platz kriegen ...
Man wird einen Wäschekorb oder sowas brauchen, damit alles zusammenhält.«
Dann wandte sich ihr Geist Dingen zu, die außerhalb Christina Albertas Verständnis lagen.
»Schleicht sich weg und läßt mich damit ... Ich möchte wissen, was er jetzt treibt ... Wenn ich mir vorstelle ... Komisch, wenn er mich zu operieren hätte ... Operieren ...
Wir waren ja noch Kinder.«
Sie schien sich wieder zu besinnen und betrachtete ihre Tochter mit streng forschendem Auge. Irgendein Instinkt in Christina Alberta riet ihr, eine gleichgültige Miene zu machen. Doch schlugen diese Worte bei ihr ein, setzten sich fest und keimten wie eine Saat. Kinder waren sie gewesen, und er war davongeschlichen? Sonderbar, und doch ließ es sich mit so vielem Unerklärlichen in Einklang bringen.
5
Herr Preemby sah ungewöhnlich schmal, aber auch ungewöhnlich würdevoll in seinen Trauerkleidern aus. Auch Christina Alberta war äußerst schwarz und glänzend. Ihre Röcke reichten zum erstenmal in ihrem Leben bis zu den Knöcheln, ein Opfer, das, wie sie fühlte, dem Geist der Verstorbenen besonders angenehm sein würde.
Etwas Neues war in Christina Albertas Leben gekommen – Verantwortlichkeit. Sie empfand, daß sie aus irgendwelchen unerforschlichen Gründen für Herrn Preemby verantwortlich war.
Es war klar, daß der plötzliche Tod seiner Frau unter des Chirurgen Messer ein furchtbarer Schlag für ihn gewesen war. Er brach weder zusammen, noch weinte er oder gab sich übermäßigen Ausbrüchen des Kummers hin, aber er war unendlich still und traurig. Seine runden, porzellanblauen Augen und sein Schnurrbart schauten mit trauervoller Feierlichkeit in die Welt. Der Leichenbestatter hatte kaum jemals einen so zufriedenstellenden Witwer gesehen. »Alles vom Besten«, sagte Herr Preemby. »Alles, was sie haben kann, muß sie haben.« Unter den herrschenden Umständen zeigte der Leichenbestatter, der übrigens ein Freund der Familie war, und beide, Herrn und Frau Preemby, ziemlich oft beim Whistspiel getroffen hatte, lobenswerte Mäßigung.
»Du kannst dir nicht vorstellen, was das alles für mich bedeutet«, sagte Herr Preemby zu Christina Alberta immer wieder. »Es war reine Liebe,« sagte er, »reine Romantik. Sie hatte nichts zu gewinnen durch die Heirat. Aber keiner von uns dachte an niedrige Dinge.« Er schwieg für eine kurze Weile, indem er mit jäh aufsteigenden Erinnerungen kämpfte. Er unterdrückte sie. »Wir trafen uns eben,« sagte er leise lächelnd, »und es sah so aus, als ob es so seinmüßte.«
‹Schleicht sich weg und läßt mich damit allein›, flüsterte es leise in Christina Albertas Gedächtnis.
6
In jenen Tagen der Trauer gab es eine Menge zu tun. Christina Alberta gab sich alle Mühe, Herrn Preemby zu helfen, ihn zu bewachen und zu führen, ganz so wie es ihre Mutter gewünscht hatte, aber sie war sehr erstaunt, bei ihm auf gewisse, gänzlich unerwartete Entscheidungen zu stoßen, die offenbar innerhalb weniger Stunden nach ihrer Mutter Tod ins Leben gesprungen waren. Eine von diesen war der klare Entschluß, daß er und sie sich von der Wäscherei trennen müßten, entweder durch Verkaufen oder Vermieten oder, falls sie gar nicht anzubringen wäre, indem man sie niederbrannte oder in die Luft sprengte, so rasch wie nur möglich. Er sprach gar nicht darüber; er betrachtete das als eine unvermeidliche Notwendigkeit. Er gab keiner Feindseligkeit gegen die Wäscherei Ausdruck; er übte keine gehässige Kritik an dem Leben, das er dort geführt hatte, aber jeder seiner Gedanken verriet seine grundsätzliche Abneigung. Und ebenso müßten sie fort von hier – ganz fort – weg von Woodford Wells, und niemals wieder dahin zurückkehren. Sie war auf eigene Rechnung so ziemlich zu denselben Entscheidungen gelangt, hatte aber nicht erwartet, sie bei ihm in solch ruhiger Stärke anzutreffen.
Als sie am Abend des Begräbnisses beim Nachtmahl saßen, ließ er sich über die Zukunft deutlicher aus.
»Der Vetter deiner Mutter, Samuel Widgery,« sagte er, »hat mit mir gesprochen.«
Er kaute einen Augenblick; sein Schnurrbart ging auf und nieder und seine porzellanblauen Augen starrten durch das Fenster hinaus auf den Abendhimmel. »Er möchte sie übernehmen.«
»Die Wäscherei?«
»Als einen laufenden Betrieb. Und weil er sozusagen unser nächster Verwandter ist, möchte ich lieber, er bekäme sie als irgendwer anderer. Alles andre bleibt sich ja gleich ... Ich möchte wissen, wieviel ich von ihm verlangen soll. Ich möchte nicht eben zu wenig von ihm verlangen. So habe sie gesagt, es sei mir nicht angenehm, diese Sache beim Begräbnis zu besprechen. Er täte besser, morgen wieder herzukommen. Sein jetziges Geschäft geht nicht gerade glänzend. Walthamstow liegt gar so abseits. Er möchte das Geschäft aufgeben und den Boden als Baugrund verkaufen. Er hat freilich nicht sehr viel Geld ... Aber er möchte die Wäscherei haben. Er möchte sie wirklich gern haben.«
Seine blauen Augen leuchteten, als ob er Visionen hätte.
»Ich weiß nicht, ob ihr in der Schule für Nationalökonomie etwas davon gelernt habt, wie man Gesellschaften gründet. Ich bin ein Kind in allen diesen Dingen. Er spricht von Teilhaberschaft oder einer Hypothek oder dergleichen, aber was wir brauchen – was wir brauchen, ist eine Aktiengesellschaft. Und was wir brauchen, ist so etwas wie Schuldscheine oder eigentlich mehr wie Prioritätsaktien. Wir müssen es so einrichten, daß wir, was er auch aus dem Geschäft herausschlägt, berechtigt sind, noch mehr herauszuschlagen. Denn sonst kann dir die Gesellschaft die Sicherheit für deine Schuldscheine entziehen, indem sie zuviel Dividenden an die gewöhnlichen Aktionäre zahlt.Er soll die gewöhnlichen Aktien haben. Er und seine Frau. Ich sag' ja nicht, daß er sowas mit Absicht tun würde, aber er könnte ganz leicht dazu gebracht werden. Man muß auf ihn aufpassen. Wir müssen es so abmachen, daß, wenn er mehr für seine Aktien zahlt, als wir für unsere Aktien kriegen, unsere Zinsen gleich sind. Es ist alles recht schwierig und kompliziert, Christina Alberta.«
Christina Alberta betrachtete Herrn Preemby mit neuem, wachsendem Respekt. Niemals zuvor hatte sie ihn eine solche Rede bei den Mahlzeiten halten hören, aber er war auch niemals zuvor vor Unterbrechungen und Verbesserungen sicher gewesen.
»Wir werden alles von unseren Anwälten gehörig festsetzen lassen müssen«, sagte Herr Preemby.
»Wir dürfen nicht schlecht wegkommen«, fuhr er fort und nahm sich ein Stück Käse. »Wir haben etliche Hypotheken und ein paar Häuser in Buckhurst Hill. Es ist komisch, aber deine arme teure Mutter hatte eine Art Vertrauen in meinen Blick für Häuser. Oft ließ sie sich in dem Punkt von mir bestimmen. Und ich habe immer ein Gefühl gehabt, daß wir irgendeine Reserve außerhalb des Geschäftes anlegen sollen ... Höchstwahrscheinlich will Samuel Widgery den größten Teil der Möbel in diesem Haus mitübernehmen. Es ist ein größeres Haus als das seine.«
»Wo gedenkst du denn dann zu leben, Vati?« fragte Christina Alberta.
»Ich weiß noch nicht recht«, sagte Herr Preemby nach kurzem Nachsinnen. »Ich denke vorläufig noch an verschiedene Orte.«
»London«, sagte sie. »Wenn ich weiterstudieren könnte – ehe es zu spät ist.«
»London,« sagte er, »kann sein.«
Er zögerte weiterzusprechen – war er es doch gewöhnt, daß seine Vorschläge immer verworfen wurden. »Hast du jemals von Pensionen gehört, Christina Alberta?« fragte er mit verstellter Gleichgültigkeit. »Hast du jemals daran gedacht, daß wir zwei in einer Pension leben könnten?«
»In London?«
»Pensionen gibt's fast überall. Weißt du, Christina Alberta, wir könnten unsere Möbel hier verkaufen, bis auf meine Bücher und ein paar kleine Stücke, und auch davon könnten wir das meiste für eine Zeit abstellen – Taylors Möbelmagazin würde die Sachen übernehmen – und wir könnten losziehn und bald hier, bald dort in einer Pension leben. Dann könntest du studieren und brauchtest nicht die Wirtschaft zu führen, und ich könnte lesen und mir alles mögliche anschaun und Notizen über verschiedene Theorien machen, über die ich nachgedacht habe, und mit allerlei Leuten sprechen und die Leute sprechen hören. Alle möglichen Leute kommen in Pensionen – alle möglichen interessanten Leute. Diese letzten Nächte hab' ich unaufhörlich über das Leben in Pensionen nachgedacht. Ich komm' von dem Gedanken nicht los und dreh' und wende ihn nach allen Seiten. Es wäre ein neues Leben für mich – als ob ich von vorne anfinge. Das Leben hier ist so ruhig gewesen, so regelmäßig. Alles ganz schön, solange deine arme, teure Mutter noch am Leben war, aber nun brauche ich Zerstreuung, ich möchte herumkommen und alle möglichen Dinge und verschiedene Arten von Menschen sehen. Ich muß vergessen. Schau, in mancher dieser Pensionen, da gibt's Chinesen und Inder und russische Prinzessinnen, Professoren und Schauspieler und allerhand Leute. Die erzählen zu hören, denk nur!«
»In Bloomsbury gibt es Pensionen voll von Studenten.«
»Jeder Art«, sagte Herr Preemby.
»Ein Ort, der mich anzieht,« sagte Herr Preemby, indem er den letzten Tropfen des Bieres einschenkte, »ist Tumbridge Wells.«
»Heißt das nicht Tunbridge, Vati?«