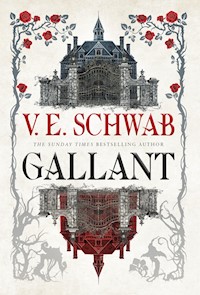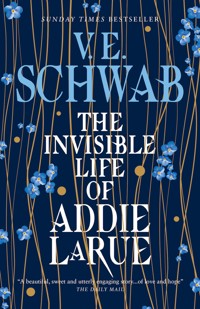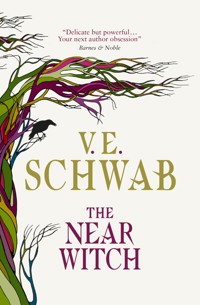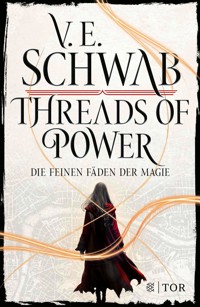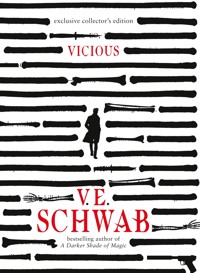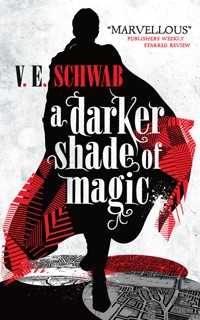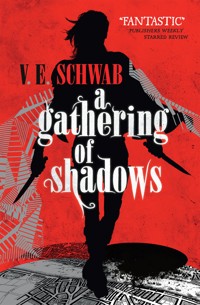9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die City of Ghosts-Reihe
- Sprache: Deutsch
Spannung, Grusel und Humor – eine unwiderstehliche Mischung
Geisterjägerin Cassidy Blake und ihr gespenstischer bester Freund Jacob stürzen sich in das Getümmel von New Orleans: eine Stadt voller Magie, dunkler Botschaften und Geister. Mit der Fernsehshow ihrer Eltern geht es an die schaurigsten Orte der Stadt, doch dort wartet ein besonders gefährlicher Gegner auf Cassidy: der Bote aus der Dunkelheit. Ist Cassidy dieser Herausforderung gewachsen?
Das fesselnde Finale der Geister-Trilogie von Bestsellerautorin V. E. Schwab.
Alle Bände der City-of-Ghosts-Reihe:
Die Geister, die mich riefen (Band 1)
Im Reich der vergessenen Geister (Band 2)
Der Bote aus der Dunkelheit (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Autorin
Victoria Schwab hat ihre Leidenschaft schon früh zum Beruf gemacht und ihre Romane stehen seitdem regelmäßig auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Wenn sie nicht gerade durch die Straßen von Paris schlendert oder sich in einem Café in Edinburgh neue Monster ausdenkt, lebt sie in Nashville, Tennessee.
Übersetzerin
Tanja Ohlsen studierte klassische Archäologie und Anglistik in Heidelberg und Berlin. Neben ihrer Tätigkeit auf verschiedenen Ausgrabungen machte sie ihre staatliche Übersetzerprüfung im Fachgebiet Geisteswissenschaften und hat mittlerweile über 150 Titel aus dem Englischen, Norwegischen und Dänischen übersetzt. Wenn sie nicht gerade übersetzt, unternimmt sie mit Vorliebe lange Expeditionen mit dem Seekajak an der norwegischen Küste.
In der Reihe »City of Ghosts« sind bei cbj diese Bände erschienen:
Die Geister, die mich riefen (Band 1, 17 653)
Im Reich der vergessenen Geister (Band 2, 17 713)
Der Bote aus der Dunkelheit (Band 3, 17 940)
V.E. Schwab
Der Bote aus der Dunkelheit
Aus dem Englischenvon Tanja Ohlsen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2021 by Victoria Schwab
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Bridge of Souls« bei Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc.
Published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe bei
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Tanja Ohlsen
Lektorat: Michelle Landau
Karte von New Orleans: © 2021 Maxime Plasse
Coverillustration und – gestaltung: Melanie Korte
mk · Herstellung: BO
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-28041-3V001
www.cbj-verlag.de
Für die Kinder, die sich in die Dunkelheit wagen, auch wenn sie ihnen Angst macht.
»Konnt’ ich nicht halten für den Tod,war er zum Halten doch bereit.«
Emily Dickinson
Teil I
Zuckerzeug und Totenkopf
Kapitel 1
Es gibt so viele schöne Arten, aufzuwachen.
Im Sommer kann man vom Duft nach Pfannkuchen geweckt werden, im Herbst von der ersten kühlen Brise. An einem trägen Wintertag kann die ganze Welt unter einer Bettdecke vergraben sein. Dann wacht man leicht und friedvoll auf, ein sanfter Übergang vom Traum zum Tageslicht.
Und dann gibt es das: Ruckartig werden die Vorhänge vor der grellen Sonne weggezogen und auf meiner Brust landet ein sehr großer Kater.
Stöhnend bemühe ich mich, die Augen zu öffnen, und sehe, wie mich Grim anstarrt, eine schwarze Pfote direkt über meinem Gesicht.
»Runter von mir«, knurre ich und drehe mich um, sodass der Kater zur Seite aufs Bett kippt. Er wirft mir einen griesgrämigen Blick zu, stößt einen leisen Katzenseufzer aus und lässt sich noch tiefer in die Federn sinken.
»Einen schönen guten Morgen!«, zwitschert Mum viel zu fröhlich, wenn man bedenkt, dass wir gestern Abend erst angekommen sind und mein Körper keine Ahnung hat, ob es Tag oder Nacht ist. In meinem Kopf dröhnt es dumpf und ich weiß nicht, ob das am Jetlag oder an den Geistern liegt.
Die Klimaanlage des Hotels, die die ganze Nacht gebrummt hat, sorgt für eine künstliche Kälte, die mich die Bettdecke wieder hochziehen lässt. Als Mum das Fenster aufmacht, dringt keine kühle Brise ins Zimmer, sondern ein Schwall Hitze.
Es ist die stickige Hitze des Sommers.
Unten auf der Straße singt jemand mit schräger Stimme, zu der sich die leisen Töne einer Trompete gesellen. Irgendjemand lacht laut. Jemand anderes lässt etwas fallen, das scheppert wie ein leerer Topf.
In New Orleans ist es schon um 10 Uhr morgens laut.
Ich setze mich auf. Meine Locken sind total wirr und ich sehe mich müde um. Hm.
Als wir gestern Abend angekommen sind, habe ich kaum etwas wahrgenommen, sondern mir nur das Gesicht gewaschen und bin sofort ins Bett gegangen. Aber jetzt stelle ich fest, dass unser Hotelzimmer alles andere als normal ist. Nicht dass irgendein Stopp auf dieser Reise bisher »normal« gewesen wäre, aber das Hotel Kardec ist besonders merkwürdig.
Mein Bett steht in einer Ecke auf einem kleinen erhöhten Podest. Zwischen meinem Nest und dem großen Himmelbett, das meine Eltern auf der anderen Seite des Zimmers bezogen haben, befindet sich eine Sitzecke. Aber das ist nicht das Merkwürdige. Nein, merkwürdig ist, dass das ganze Zimmer in Rot und Dunkelblau dekoriert ist, mit goldenen Akzenten, und dass überall seidene oder samtene Stoffe drapiert sind, wie im Zelt einer Wahrsagerin. Die Schubladengriffe und Wandhaken sind geformt wie Hände, deren Finger verschränkt sind oder nach oben greifen.
Unsere Koffer liegen noch aufgetürmt mitten im Zimmer und drum herum sind die Kleider verstreut, die wir gestern einfach herausgezerrt haben, um nach dem Flug so schnell wie möglich ins Bett fallen zu können. Und mitten in diesem Chaos, zwischen dem Kosmetikkoffer meiner Mutter und meiner Kameratasche, sitzt Jacob Ellis Hale, mein bester Freund und mich stets begleitender Geist.
Jacob verfolgt mich seit dem letzten Frühjahr, als ich in einen Fluss gefallen bin und er mir das Leben gerettet hat. Gemeinsam haben wir uns seitdem den Gespenstern von Schottland und den Poltergeistern, Friedhöfen und Katakomben von Paris gestellt.
Er sitzt im Schneidersitz, hat die Ellbogen auf die Knie gestützt und blättert in einem aufgeschlagenen Comicheft.
Es könnte ein Luftzug sein, aber meine Mutter hat das Fenster schon wieder geschlossen.
Außerdem blättern die Seiten nur in eine Richtung und etwa so schnell, wie ein Junge lesen würde.
Wir wissen beide, dass er dazu nicht in der Lage sein sollte.
Vor einer Woche hätte er das noch nicht gekonnt und jetzt …
»Los, Cass«, ruft meine Mutter. »Hopp, hopp!«
Ich will schon protestieren, da wir erst heute Abend zu filmen beginnen, als Dad einwirft: »Wir treffen uns mit unserem Stadtführer im Café du Monde.«
Neugierig sehe ich auf. In jeder Stadt, in die wir für die Show meiner Eltern reisen, bekommen wir einen anderen Führer, jemanden, der den Ort – und seine Geheimnisse – besonders gut kennt. Ich frage mich, wie unser Führer hier sein wird. Ob er ein Zweifler ist oder tatsächlich an Geister glaubt.
Auf der anderen Seite des Zimmers machen sich meine Eltern fertig. Mum wischt Dad einen Streifen Rasierschaum von der Wange und er hilft ihr mit dem Verschluss ihres Armbands.
Im Moment sind sie einfach nur meine Eltern. Ungeschickt, streberhaft und nett. Aber heute Abend, wenn die Kameras eingeschaltet werden, verwandeln sie sich in etwas anderes: die Inspecters, die weit gereisten, Geister jagenden Erforscher des Paranormalen – überlebensgroß.
»Dabei ist dein Leben doch schon ziemlich groß«, stellt Jacob fest, ohne aufzusehen. »Oder zumindest ganz schön merkwürdig. Ich habe nie verstanden, wie ein Leben groß sein kann …«
Jacob Ellis Hale, bester Freund und Geist an meiner Seite – und ständiger Lauscher.
Abwehrend hebt er die Hände. »Ist doch nicht meine Schuld, dass du so laut denkst.«
Ich glaube, seine Fähigkeit, meine Gedanken zu lesen, hat etwas damit zu tun, dass er mich aus dem Reich der Toten zurückgeholt hat und ich ihn ins Reich der Lebenden gezogen habe. Dabei sind wir irgendwie aneinander kleben geblieben wie Haare an Kaugummi.
»Bin ich etwa der Kaugummi?«, fragt Jacob stirnrunzelnd.
Ich verdrehe die Augen. Ich finde, es wäre nur fair, wenn ich seine Gedanken auch lesen könnte.
»Vielleicht sind meine Gedanken ja nur leiser«, vermutet er.
Vielleicht ist dein Kopf ja auch leer, denke ich und strecke ihm die Zunge raus.
Er sieht mich finster an.
Ich kichere.
Meine Eltern drehen sich zu mir um.
»Sorry«, sage ich achselzuckend. »Ist nur Jacob.«
Mum lächelt, doch Dad zieht eine Braue hoch. Mum glaubt mir, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie an Jacob, den Geist, glaubt, oder an Jacob-den-eingebildeten-Freund-und-die-bequeme-Ausrede-für-ihre-Tochter-wenn-sie-mal-wieder-in-Schwierigkeiten-steckt. Dad ist definitiv kein Gläubiger in Sachen Geister und findet, dass ich langsam zu alt werde für eingebildete Freunde. Finde ich auch. Aber Jacob ist nicht eingebildet, sondern nur unsichtbar, und es ist nicht meine Schuld, dass meine Eltern ihn nicht sehen können.
Noch nicht.
Ich denke es so leise wie möglich, aber Jacob hört mich trotzdem. Die Furcht, die mit diesem Gedanken einhergeht, scheint er jedoch nicht zu bemerken, denn er steht auf und lächelt.
»Weißt du«, sagt er und haucht auf die Fensterscheibe, »vielleicht sollte ich …«
Er drückt den Zeigefinger auf die beschlagene Stelle und runzelt konzentriert die Stirn, während er ein »J« zeichnet. Zu meiner Überraschung – und zu meinem Entsetzen – zeigt sich der Buchstabe tatsächlich auf dem Glas.
Ich springe aus dem Bett und wische ihn fort, bevor meine Eltern ihn sehen.
»Spielverderber«, murmelt er, doch ich kann es jetzt wirklich nicht gebrauchen, dass meine Eltern erkennen, dass Jacob real ist, oder dass ich fast gestorben wäre, oder dass ich in meiner Freizeit Geister jage. Ich glaube kaum, dass ihnen das gefallen würde.
Bleib hier sitzen, befehle ich ihm und gehe ins Bad, um mich anzuziehen.
Mein Haar binde ich zu einem wirren Knoten hoch und versuche, nicht daran zu denken, dass mein bester Freund absolut unbestreitbar stärker wird.
Ich hole meine Kette unter dem Ausschnitt meines T-Shirts hervor und betrachte den baumelnden Spiegelanhänger. Ein Spiegel, der die Wahrheit sagt. Ein Spiegel, der den Geistern bewusst macht, dass sie tot sind. Ein Spiegel, der sie erstarren lässt, sodass ich ihren Lebensfaden zerreißen und sie weiterschicken kann.
Mein Spiegelbild sieht mir unsicher entgegen und ich versuche, nicht an den Schleier zu denken oder an die Gründe, warum die Geister auf der anderen Seite bleiben sollten. Ich versuche, nicht daran zu denken, was mit Geistern geschieht, die real genug werden, um unsere Welt zu berühren. Und ich versuche, nicht an Lara Chowdhury zu denken, die mir gesagt hat, es sei meine Aufgabe, Jacob weiterzuschicken, bevor er zu gefährlich wird, bevor, bevor …
Ich versuche, nicht an die Träume zu denken, in denen Jacobs Augen rot glühen und die Welt um ihn herum in Trümmern versinkt, in denen er nicht mehr weiß, wer ich bin oder wer er ist, und in denen ich mich entscheiden muss, ob ich meinen besten Freund rette oder alles andere. Ich versuche, an nichts davon zu denken.
Stattdessen ziehe ich mich schnell fertig an, und als ich wieder aus dem Bad komme, liegt Jacob vor Grim auf dem Boden und trägt offenbar einen Anstarr-Wettbewerb mit ihm aus. Ich rufe mir in Erinnerung, dass Jacob eben Jacob ist. Er ist kein gewöhnlicher Geist. Er ist mein bester Freund.
Plötzlich hebt Jacob den Blick und sieht mich an, und da ich weiß, dass er meine Gedanken hören kann, konzentriere ich mich stattdessen auf Grim.
Der schwarze Schwanz des Katers wischt träge hin und her und nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob Katzen – selbst völlig nutzlose Faulpelze wie Grim – mehr sehen als gewöhnliche Augen, ob sie den Schleier und die Geister dahinter so wahrnehmen können wie ich.
Ich hebe die Kamera auf, hänge mir den roten Riemen um den Hals und lege eine neue Filmrolle ein. Meine Eltern haben mich gebeten, ihre Show hinter den Kulissen zu dokumentieren. Als hätte ich nicht schon genug damit zu tun, böse Geiser daran zu hindern, Chaos zu verbreiten.
Aber schließlich braucht jeder ein Hobby.
»Ich empfehle Videospiele«, meint Jacob.
Ich sehe ihn durch den Sucher meiner Kamera an und stelle das Bild abwechselnd scharf und unscharf. Das Zimmer um ihn herum verändert sich, doch Jacob ist immer klar und deutlich zu sehen.
Wie alles andere in meinem Leben ist auch diese Kamera ein wenig merkwürdig. Ich hatte sie dabei, als ich fast ertrunken wäre, und seitdem sieht sie einfach mehr.
So wie ich.
Meine Eltern, Jacob und ich gehen den Hotelflur entlang, der genauso dekoriert ist wie unser Zimmer: in tiefem Rot und Blau und mit Wandleuchtern, die wie Hände geformt sind. Die meisten von ihnen halten Lampen. Aber hier und da ist immer wieder eine leere Hand dazwischen.
»Geister-Five!«, sagt Jacob und schlägt in eine der leeren Handflächen. Sie wackelt ein wenig, droht zu fallen, und ich werfe ihm einen vernichtenden Blick zu. Er grinst mich verlegen an.
Auf dem Weg nach unten kommen wir an einem bedrohlich wirkenden schmiedeeisernen Aufzug vorbei. Da der aber nur Platz für eine Person bietet, nehmen wir stattdessen die geschwungene hölzerne Treppe.
An der Decke in der Lobby ist ein Gemälde mit einem Tisch und leeren Stühlen zu sehen. Der Effekt ist schwindelerregend, als würde man kopfüber hängen.
Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden, und als ich mich umsehe, entdecke ich in einer Nische einen Mann, der hinter einem Vorhang hervorsieht. Erst als ich näher komme, erkenne ich, dass es kein Mensch ist, sondern eine Büste, eine Bronzeskulptur von einem Kopf und den Schultern. Er hat einen Ziegenbart und lange Koteletten und starrt mich intensiv an.
Der Name auf der Büste sagt mir, dass es sich bei dem dargestellten Mann um Mr Allan Kardec handelt.
Jacob lehnt sich an den Sockel der Büste.
»Der sieht ja griesgrämig aus«, findet Jacob, aber ich bin anderer Meinung. Mr Kardec runzelt zwar die Stirn, allerdings auf ähnliche Weise, wie es auch Dad manchmal tut, wenn er angestrengt nachdenkt. Mum nennt das sein Uhrwerkgesicht, weil sie behauptet, sie könne sehen, wie sich hinter seinen Augen die Zahnräder drehen.
Aber im Blick der Statue liegt noch etwas anderes, etwas Schauriges. Die Augen sind nicht aus Bronze, sondern aus Glas, wie mir jetzt auffällt, dunkle Murmeln, von grauen Adern durchzogen.
Mum ruft nach mir und ich sehe sie mit Dad am Hoteleingang stehen. Jacob und ich weichen vor dem geisterhaften Blick der Statue zurück.
»Bereit?«, fragt Dad und macht die Tür auf.
Dann treten wir hinaus ins Sonnenlicht.
Die Hitze trifft mich wie eine Abrissbirne.
In New York, wo wir normalerweise wohnen, ist es im Sommer zwar auch heiß, aber im Schatten bleibt es kühl. Hier ist die Sonne wie flüssige Hitze und selbst im Schatten steht die Luft wie Suppe. Wenn ich meinen Arm schwinge, spüre ich, wie die Feuchtigkeit daran kleben bleibt.
Doch die Hitze ist nicht das Einzige, was mir auffällt.
Eine Pferdekutsche rattert an uns vorbei und in die andere Richtung fährt ein Leichenwagen.
Dabei bin ich nicht mal hinter dem Schleier. Das hier ist das lebende, atmende New Orleans.
Wir wohnen im Französischen Viertel, wo die Straßen Namen haben wie Bourbon und Royal, wo die Häuserblöcke klein und niedrig sind und von schmiedeeisernen Balkonen wie von Efeu überrankt werden. Es ist ein Zusammenprall von Farben, Stilen und Geräuschen. Kopfsteinpflaster und Beton, knorrige Bäume und Moosflechten. Ich war noch nie an einem Ort, der so voller Widersprüche steckt.
Edinburgh, die erste Stadt, in die wir für die Show gereist sind, war feucht und grau, eine Stadt aus kaltem Stein mit verborgenen Pfaden, die ihre Geschichte offen zur Schau trug. Paris war hell und sauber, voll goldener Schnörkel und breiter Alleen und hatte seine Geheimnisse im Untergrund verborgen.
New Orleans ist – anders.
Es ist kein Ort, den man in einem Foto festhalten kann.
Es ist laut und voller Menschen und Dinge, die nicht zusammenpassen. Das Klappern von Pferdehufen mischt sich mit der Hupe einer Limousine und dem Klang eines Saxophons. Es gibt viele Restaurants und Tattoo-Läden und Boutiquen, dazwischen aber auch Schaufenster mit Kerzen, Steinen und Heiligenbildern sowie Neonschilder mit nach oben gewandten Handflächen und Kristallkugeln. Ich weiß nicht, wie viel davon nur Show für die Touristen ist und wie viel echt.
Und noch dazu – oder besser gesagt dahinter – ist der Schleier hier voller Geister, die darauf warten, gesehen und gehört zu werden.
Manchmal sind Geister im Schleier gefangen, sie stecken sozusagen in einer Dauerschleife ihres letzten Augenblicks fest. Es ist meine Aufgabe, sie weiterzuschicken.
»Darüber lässt sich streiten«, meint Jacob, der lieber so tut, als wäre es für ein Mädchen völlig normal, das ständige Klopfen der Geister zu hören und immer den Druck der anderen Seite zu spüren, der sie durch den Schleier ziehen will. »Ich meine ja nur, wann hat es dein Leben bitte schon mal leichter gemacht, Geister weiterzuschicken?«
Damit hat er zwar recht, aber darum geht es nicht.
Es geht darum, zu tun, was richtig ist.
Trotzdem wünsche ich mir ab und zu, ich könnte die andere Seite verstummen lassen.
Eine Kutsche mit roten Federbüscheln und goldenen Troddeln fährt vorbei und ich laufe hinterher, um ein gutes Foto zu bekommen.
»He, Cass, pass auf!«, ruft Jacob noch, als ich schon mit jemandem zusammenstoße.
Ich taumle zurück und blinzle die plötzliche Schwärze vor meinen Augen weg. Ich will schon zu einer Entschuldigung ansetzen, als ich aufschaue und ein Skelett in einem rabenschwarzen Anzug vor mir sehe.
Und einfach so bleibt die Welt stehen.
Ich kann nicht mehr atmen, New Orleans verschwindet und ich stehe wieder auf dem Bahnsteig in Paris, am Tag, als wir abgereist sind, starre den Fremden auf der anderen Seite der Schienen an und frage mich, wieso außer mir niemand den glatten weißen Totenschädel unter der breiten Hutkrempe bemerkt. Ich bin in meiner Haut gefangen, kann nicht atmen, nicht denken, kann nur in diese leeren Augen starren, als der Fremde die Maske abnimmt und dahinter nichts als Dunkelheit ist.
Ich falle, ich falle durch diese leeren Augen zurück nach New Orleans, wo das Skelett auf mich zutritt und seine knochige Hand nach mir ausstreckt.
Und dieses Mal schreie ich.
Kapitel 2
Das Skelett weicht zurück.
»He, he, he!«, sagt er abwehrend. »Sorry, Kleine.« Er hebt entschuldigend die Hände, die gar nicht aus Knochen bestehen, sondern aus Fleisch und Blut, und deren Fingerspitzen aus abgeschnittenen Handschuhen ragen. »Ich wollte dich nicht erschrecken.«
Die Stimme ist warm und menschlich und als er die Maske absetzt, ist ein Gesicht dahinter, herzlich, freundlich und real.
»Cassidy!« Mum nimmt mich am Ellbogen. »Was ist denn los?«
Ich schüttle den Kopf und höre mich sagen, dass alles in Ordnung ist, dass es meine Schuld ist, dass er mir keine Angst gemacht hat. Aber mein Herz klopft so laut, dass es mir in den Ohren dröhnt, und ich muss mich zwingen zu atmen, als der Mann weitergeht. Niemand hier scheint es merkwürdig zu finden, am frühen Vormittag einen als Skelett verkleideten Mann zu sehen. Niemand sieht ihm auch nur nach, als er pfeifend die Straße entlangschlendert.
»Cass«, sagt Jacob leise.
Ich sehe nach unten und bemerke, wie meine Hände zittern. Ich lege sie um die Kamera und drücke fest zu, bis das Zittern nachlässt.
»Alles in Ordnung, Kleines?«, fragt Dad und meine Eltern sehen mich an, als wäre mir plötzlich ein Schnurrbart oder Flügel gewachsen, als hätte sich ihre Tochter in etwas Fremdes verwandelt, etwas Empfindliches und Zerbrechliches.
Ich kann es ihnen nicht verdenken.
Ich bin Cassidy Blake.
Ich war noch nie zart besaitet. Nicht mal, als ein Mädchen an der Schule Nasenbluten hatte und aussah, als hätte sie sich mit einem Eimer Blut übergossen.
Nicht mal, als ich zum ersten Mal in die Brust eines Geistes gegriffen und die verrotteten Reste seines Lebens herausgezogen habe.
Nicht mal, als ich in ein offenes Grab gestiegen oder fünf Stockwerke unter der Erde durch einen Haufen morscher Knochen gefallen bin.
Aber das Skelett im schwarzen Anzug, das war anders. Schon der Gedanke daran lässt mich schaudern. Als mich der Fremde mit der Totenschädelmaske in Paris vom anderen Gleis aus angestarrt hat, hat es sich angefühlt, als hätte er einfach durch mich hindurchgeschaut. Als wäre ich in einem warmen Raum gewesen, bis der Fremde die Fenster aufgerissen hat und alles eiskalt geworden ist. Ich habe mich noch nie so furchtbar schlecht, verängstigt und allein gefühlt wie in diesem Moment.
»Wie ein Dementer«, sagt Jacob.
»Wie bitte?« Ich schrecke auf.
»Du weißt schon, diese grusligen Geisterdinger aus Harry Potter, die dir das Leben aussaugen, all dein Glück fressen und dich ganz kalt zurücklassen.«
Oh. Er meint Dementor.
Jacob hat die Bücher nie gelesen, seine Kenntnisse beschränken sich daher auf Filmausschnitte und meine ständigen Erwähnungen. Aber dieses Mal hat er beinahe recht.
Es war wirklich wie in den Büchern beschrieben. Als hätte ich der Dunkelheit ins Auge gesehen und sie hätte alles Licht in mir verlöschen lassen. Aber Dementoren sind nicht echt und was auch immer das Ding in Paris war, es war sehr echt. Glaube ich zumindest.
Niemand sonst hat es gesehen.
Nicht mal Jacob.
Aber mir kam es eindeutig real vor.
»Ich glaube dir«, sagt Jacob und stößt mit der Schulter an meine. »Aber vielleicht solltest du mal mit Lara reden.«
Das ist das Letzte, was ich aus seinem Mund erwartet hätte.
»Ich weiß, ich weiß«, sagt er und schiebt die Hände in die Hosentaschen.
Jacob und Lara kommen nicht wirklich gut miteinander aus. Man könnte sagen, es liegt am unterschiedlichen Temperament – Jacob ist Gryffindor, während Lara zweifelsfrei Ravenclaw ist. Aber die Sache ist komplizierter. Lara ist wie ich ein Zwischenweltler und ihre Aufgabe – wie auch meine – ist es, Geister auf die andere Seite zu schicken. Und Jacob ist unbestreitbar hier, auf der falschen Seite.
Er räuspert sich.
Wo er auch hingehört, denke ich ganz explizit.
»Also«, meint er, »Lara weiß vielleicht nicht alles, aber sie weiß eine ganze Menge und vielleicht hat sie so einen Skelettmann schon mal gesehen.«
Ich muss schlucken. Was auch immer ich in Paris gesehen habe, war kein Mann. Mit dem schwarzen Anzug und dem breitkrempigen Hut sah er mehr oder weniger aus wie einer, aber ein Mensch besteht aus Fleisch und Blut. Ein Mensch hat hinter der Maske ein Gesicht. Ein Mensch hat Augen.
Was habe ich gesehen?
Es war nicht menschlich, so viel steht fest.
Während meine Eltern vorauslaufen, ziehe ich mein Telefon aus der Tasche. Ich gehe davon aus, dass Lara noch bei ihrer Tante ist, und in Schottland ist es jetzt Nachmittag. Ich schicke ihr eine Nachricht.
Ich: Hi! Kannst du chatten?
Nur Sekunden später schreibt sie zurück.
Lara: Was hat Jacob jetzt wieder angestellt?
»Unverschämt!«, murrt Jacob.
Ich sehe auf den Bildschirm und überlege, wie ich nach dem, was ich am Bahnsteig gesehen habe, fragen kann.
Während ich nach Worten suche, beiße ich mir auf die Unterlippe.
»Ich glaube, die Worte, die du suchst, sind gruseliger, gut angezogener, seelensaugender Skelettkerl«, bietet Jacob mir an, aber ich scheuche ihn weg.
Ich: Es gibt noch andere paranormale Erscheinungen, nicht wahr? Außer Geistern?
Lara: Du musst dich schon klarer ausdrücken.
Ich fange ein paar Nachrichten an, lösche sie aber immer wieder. Ich weiß nicht, was mich zurückhält. Oder vielleicht doch.
Ich kann nicht immer zu Lara rennen. Das sollte ich nicht müssen. Ich bin schließlich auch ein Zwischenweltler. Ich sollte wissen, was zu tun ist. Und wenn nicht, sollte ich es selbst herausfinden können.
»Klar doch«, meint Jacob. »Aber du hast keinen toten Onkel, der sein Leben lang das Paranormale erforscht hat und jetzt den Ledersessel in deinem Wohnzimmer heimsucht.«
»Nein«, erkläre ich langsam. »Aber ich habe dich.«
Jacob lächelt ein wenig unsicher. »Na ja, sicher.« Er scharrt mit dem Fuß. »Aber ich habe das Skelettdings nicht gesehen.«
Noch etwas anderes lässt mich zögern. Die Wahrheit ist, dass ich nicht darüber sprechen will, was ich gesehen oder was ich dabei gefühlt habe. Ich will es nicht in Worte fassen, weil es dann real wird.
Lara: Cassidy?
Ich sehe mich nach etwas um, was ich sie fragen kann. Von einer Mauer starrt mir ein lächelnder Mund aus Sprühfarbe entgegen, aus dessen Oberkiefer zwei Fangzähne ragen. Ein Pfeil mit der Aufschrift »Durstig?« zeigt in eine Gasse.
Ich mache ein Foto mit dem Handy und sende es ihr.
Ich: Real?
Gleich darauf antwortet Lara.
Lara: Nein, Cassidy. Vampire sind nicht real.
Ich kann ihren vornehmen britischen Akzent förmlich hören und stelle mir vor, wie sie die Augen verdreht. Für ein Mädchen, das zwischen den Welten der Lebenden und der Toten wandelt, ist Lara bemerkenswert skeptisch.
Wieder summt mein Telefon.
Lara: Bist du in New Orleans? Da wollte ich schon immer mal hin. Der älteste Zweig der Gesellschaft der schwarzen Katze hat da nämlich sein Hauptquartier.
Es ist nicht das erste Mal, dass Lara die Geheimorganisation erwähnt. Als ich sie in Edinburgh kennengelernt habe, hat sie bei ihrer Tante und dem Geist ihres Onkels gewohnt. Sie hat mir erzählt, dass ihr Onkel zu Lebzeiten ein Mitglied der Gesellschaft gewesen sei, einer mysteriösen Vereinigung, die alles Mögliche über das Paranormale weiß.
Lara: Wenn ich da wäre, könnte ich persönlich bei der Gesellschaft vorsprechen und sie bitten, mich aufzunehmen.
Lara: Sag Bescheid, wenn du das Hauptquartier findest.
Ich sehe mich um und erwarte fast, irgendwo hier an der Bourbon Street einen Wegweiser zur Gesellschaft zu finden.
Ich: Wo soll das denn sein?
Lara: Weiß ich nicht genau. Die machen nicht gerade Reklame für sich.
Vor uns studiert Dad gerade die Öffnungszeiten eines Museums für Gifte, während Mum sich für ein Plakat interessiert, auf dem Séancen angeboten werden. Ich gehe zu ihr und betrachte das Symbol mit der offenen Hand, über deren Handfläche eine Kristallkugel schwebt. Ich mache ein Foto davon und schicke es Lara.
Ich: Was ist damit? Real?
Ich beobachte die drei blinkenden Punkte, die mir sagen, dass Lara schreibt. Und schreibt. Und immer noch schreibt. Ich weiß nicht, warum ich eine einfache Antwort erwartet habe, aber als sie schließlich kommt, füllt sie den kompletten Bildschirm aus.
Lara: Es gibt zwar Hellseher, aber Séancen fallen normalerweise in die Kategorie Unterhaltung. Das liegt daran, dass Hellseher anders als Zwischenweltler auf dieser Seite des Schleiers bleiben und ihn nur zurückziehen, um mit jemandem dahinter zu sprechen. Séancen behaupten hingegen, diese Geister über die Schwelle bringen zu können. Wenn Geister stark genug sind, kommen sie aber für gewöhnlich allein raus.
Jacob sieht mir kopfschüttelnd über die Schulter.
»Sie hätte auch einfach Nein sagen können.«
Er hebt den Kopf und betrachtet im Fenster eines Cafés ein Spiegelbild, das nur wir beide sehen können. Er fährt sich mit der Hand durchs Haar, doch es bewegt sich nicht. Es steht immer ab, genauso wie sein Superhelden-T-Shirt immer zerknittert ist. Nichts an ihm verändert sich, nichts kann sich verändern. Seit dem Tag, an dem er ertrunken ist, hat sich nichts mehr geändert.
Ich bin froh, dass er mir erzählt hat, was am Fluss geschehen ist. Wirklich.
Ich kann nur nicht aufhören, daran zu denken. An den Jacob, den ich nie kennenlernen werde. Den Jacob mit zwei Brüdern und einer Familie und einem Leben. Seufzend sieht er mich an und mir wird klar, dass ich mal wieder zu laut denke. Ich beginne leise zu summen und er verdreht die Augen.
Mum und Dad gehen weiter und ich folge ihnen mit Jacob. Gerade will ich meine Aufmerksamkeit wieder Laras Nachrichten widmen, als Jacob an einer offenen Ladentür vorbeigeht. Der Laden dahinter ist voller Kerzen, Tinkturen und Amulette und Jacob beginnt zu niesen.
»Dämliche …«
Hatschi!
»… Geister…«
Hatschi!
» …abwehr …«
Hatschi!
Zumindest glaube ich, dass er das sagt.
Die gleiche Reaktion hat er in Paris gezeigt, als Lara mir Talismane zum Schutz gegen Poltergeister geschickt hat. Anscheinend wirken diese Talismane gegen alle Arten von Geistern, sogar gegen immer körperlicher werdende beste Freunde.
Ich mache ein Foto von dem Laden – auf dessen Scheibe das Wort VOODOO steht – und schicke es Lara.
Ich: Real?
Während ich auf die Antwort warte, erregt etwas anderes meine Aufmerksamkeit.
Eine schwarze Katze.
Sie sitzt vor einem Laden, der sich Thread & Bone nennt, und putzt sich ein Bein. Einen Moment lang frage ich mich, ob Grim ausgebüxt ist. Aber natürlich kann das nicht Grim sein – den habe ich noch nie dabei erwischt, dass er sich auch nur eine Pfote geleckt hätte. Und als die Katze den Kopf hebt, sehe ich, dass ihre Augen nicht grün, sondern lavendelfarben sind. Ich beobachte, wie sie sich streckt, gähnt und dann die Gasse entlangschlendert. In einer Stadt wie dieser gibt es sicher haufenweise schwarze Katzen, aber ich muss an die Gesellschaft denken und frage mich, ob das vielleicht ein Hinweis ist. Mum würde das sicher »ein bisschen weit hergeholt« finden, aber sicherheitshalber mache ich ein Foto von der Katze, bevor sie verschwindet. Ich will es schon an Lara schicken, als gerade ihre Antwort zum Voodoo-Laden eintrifft.
Lara: Sehr real!
Unter dem Text steht XO. Erst glaube ich, sie meint damit Küsse und Umarmungen, was gar nicht zu ihr passt. Doch dann erklärt sie, dass das ein Totenschädel mit gekreuzten Knochen ist, wie auf einer Giftflasche. Lass die Finger davon!
Die Erwähnung des Totenschädels erinnert mich wieder an das Skelett im Anzug. Vielleicht sollte ich Lara doch erzählen, was passiert ist. Aber bevor ich das tun kann, schreibt sie, dass sie einen Flieger erwischen muss, und dann ist sie weg.
Ich stoße den Atem aus und sage mir, dass es gut so ist. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Nur weil ich einmal einen totenköpfigen Fremden gesehen habe, heißt das ja nicht, dass ich ihn wiedersehen werde. Einmal ist ein Ausrutscher, ein Zufall. Kein Grund zur Sorge.
»Genau«, meint Jacob skeptisch. »Es wird sicher alles gut.«
Kapitel 3
Im Café du Monde schmeckt selbst die Luft nach Zucker.
Das Café liegt am Rand des Jackson Squares, eines großen Platzes voller Menschen – Touristen sowie Darstellern.
Auf einem umgedrehten Eimer steht eine Frau, die von Kopf bis Fuß silbern angemalt ist. Sie ist gekleidet wie eine Tänzerin, aber sie bewegt sich erst, als ihr jemand eine Münze in die Hand drückt. Im Schatten spielt jemand Saxofon und vom anderen Ende des Platzes ertönt eine Trompete. Es klingt, als würden sich die beiden Instrumente unterhalten.
Wir setzen uns an einen Tisch unter der grün-weiß-gestreiften Markise. Mum und Dad bestellen Kaffee und ich einen Eistee, der in einem großen, beschlagenen Plastikbecher kommt. Er ist herrlich eiskalt, aber so süß, dass mir die Zähne wehtun.
Über unseren Köpfen kreisen träge ein paar Ventilatoren, die die Luft aufwirbeln, ohne sie zu kühlen. Doch trotz der Hitze ist Dad voll in seinem Element.
Er betrachtet den belebten Platz.
»New Orleans ist ein Wunder«, erklärt er. »Es wurde von den Franzosen gegründet, an die Spanier übergeben, von Piraten und Schmugglern genutzt …«
Jacob und ich sehen gespannt auf, doch Dad fährt fort: »… es wurde an die Vereinigten Staaten verkauft, von der Sklaverei schwer mitgenommen, niedergebrannt, von Überschwemmungen heimgesucht und doch immer wieder aufgebaut. Und das alles merkt man heute noch. Wusstet ihr, dass es in der Stadt zweiundvierzig Friedhöfe gibt und die längste Brücke der USA? Die Pontchartrain-Brücke ist so lang, dass man nicht von einem Ende zum anderen sehen kann.«
»Heb dir noch was für die Show auf, Liebling«, meint Mum und tätschelt ihm den Arm. Doch Dad ist nicht zu bremsen.
»Diese Stadt hat mehr Geschichte als Geister«, erklärt er. »Zum einen ist sie die Geburtsstätte des Jazz.«
»Und des Voodoos und der Vampire«, meint Mum.
»Und von realen Menschen«, fährt Dad fort. »Zum Beispiel Pere Antoine und Jean Lafitte …«
»Und dem Axtmörder von New Orleans«, fügt Mum fröhlich hinzu.
Jacob wirft mir einen Blick zu. »Der hat doch wohl nicht …«
»Der hat eine ganze Menge Menschen zerhackt«, erläutert Mum.
»War ja klar«, seufzt Jacob.
»Er hat 1918 sein Unwesen in der Stadt getrieben«, erzählt Dad.
»Keiner fühlte sich mehr sicher«, ergänzt Mum.
Sie sind jetzt in ihrem Fernseh-Rhythmus, auch wenn es hier gar keine Kameras gibt, nur mich und Jacob, die ihren Worten lauschen.