
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mixtvision
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Brief aus der Vergangenheit mit mysteriösen Codes, ein Internet-Zwischenfall und ein Rutenkind mit Hippiemuytter: Malin und Orestes haben alle Hände voll zu tun, das Geheimnis um einen Wissenschaftler aus dem vorigen Jahrhundert zu lösen, und stoßen dabei auf Fragen, die sich mit Logik nicht erklären lassen. Geheimnisvoll und atemlos – was kann Wissenschaft? Und sind bei allem, was passiert, nicht vielleicht auch andere Kräfte beteiligt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Papa im Himmel.
Für Mama auf Erden.
Für Emma und Elin,
immer in meinem Herzen.
1.
Als ich Orestes zum ersten Mal sah, war ich enttäuscht.
Er kam – ohne zu klopfen – ins Klassenzimmer gestiefelt und blieb mitten vor dem Bildschirm stehen, auf dem uns unsere Lehrerin gerade Bilder von Kriegern des antiken Griechenlands zeigte. Innerhalb einer Sekunde verschmolzen sie, Orestes und der Krieger, zu einem lebenden Schatten mit Schild und Speer. Mein Herz begann zu flattern.
Dann machte unsere Lehrerin das Licht an, der Schatten löste sich auf und Orestes stand da. Er hatte keinen Speer. Und auch keinen Schild. Dafür hatte er eine braune Aktentasche. Wir gehen in die Siebte und ich schwöre: Keiner hier hat eine Aktentasche.
Alle, die die Gelegenheit genutzt hatten, vor sich hinzuträumen, während das Licht aus und die Vorhänge zugezogen waren, wachten schlagartig auf. Was war denn das für ein Typ?
Er trug nicht nur eine Aktentasche, sondern auch ein Hemd. Aber kein zerknittertes, schlabbriges Hemd, was vielleicht okay gewesen wäre, sondern ein langweiliges, glatt gebügeltes weißes Hemd. Dazu war es auch noch bis ganz oben zugeknöpft. Das Hemd hatte er in eine Stoffhose mit Gürtel gesteckt – keine Jeans. Glatt gekämmtes dunkles Haar. Ernste Miene. Er sah aus wie ein kleiner Erwachsener.
Jetzt glaubt ihr bestimmt, ich mache mir viel zu viel aus Klamotten, oder? Tue ich nicht. Ich hatte nur einfach so lange darauf gewartet, dass Orestes endlich kam. Und ich hatte gedacht, er würde anders sein, bloß anders auf eine andere Art.
In meinem Rucksack lag ein Brief für ihn. Ein alter Brief in einem schmutzigen Umschlag. Ich hatte über hundert Tage gelogen und mich herumgedrückt, um ihn geheim zu halten. Seinetwegen hatte ich einen ewig langen Streit mit meiner Mama gehabt und befürchtet, dass er sich genauso lange hinziehen würde wie der Cellokrieg oder der Internet-Zwischenfall. (Unsere ehemals allergrößten Streite.) Mit anderen Worten: Dieser Brief hatte mich schon eine Menge gekostet.
Und ich wusste, der Brief war für Orestes, obwohl ich ihn noch gar nicht kannte. Wie konnte das sein? Wie konnte etwas derart Geheimnisvolles und Spannendes für so jemanden sein? Einen Jungen mit Aktentasche?
Er verzog keine Miene, wie er so dastand, ganz vorne im Klassenzimmer, und antwortete so knapp wie möglich auf die Fragen der Lehrerin.
»Bist du Orestes Nilsson?«
»Ja.«
»Und du sollst ab heute in diese Klasse gehen?«
»Ja.«
»Willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir hier! Du …«
»Danke.«
Unsere Lehrerin öffnete den Mund, um noch mehr Fragen zu stellen, aber Orestes ließ sie einfach stehen. Einfach so. Er stiefelte zwischen den Tischen hindurch zu dem leeren Platz ganz hinten. Alle drehten sich nach ihm um. Sein Gesicht war fast weiß, ein blasses Wintergesicht, obwohl wir fast schon Mai hatten. Es ließ seine Augen schwarz erscheinen. Aber er hielt den Blick stur vor sich gerichtet, als ob er uns gar nicht wahrnahm.
Die ganze Klasse starrte ihn nur mit offenem Mund an. Klar kommt es mal vor, dass ein Schüler den Lehrer ignoriert, aber vielleicht nicht gleich am ersten Tag an einer neuen Schule. Es wurde so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können.
Orestes legte seine Aktentasche mit einem weichen Wums auf die Bank und holte einen Karoblock und einen blauen Füller heraus. Lautlos rutschte er mit dem Stuhl heran, öffnete den Block und schraubte den Füller auf. Dann saß er regungslos da und starrte die Lehrerin an. Den Stift schreibbereit auf dem Papier.
Unsere Lehrerin starrte ihn an, genau wie der Rest der Klasse.
»Ja, dann machen wir am besten da weiter, wo …«, meinte sie, als sie sich nach einem kurzen, aber peinlichen Augenblick wieder gefasst hatte. »Die Künstler der Antike …« Orestes begann mitzuschreiben. Meine Augen brannten vor Enttäuschung.
Ich werde gar nicht erst so tun, als wüsste ich nicht, was in dem Brief stand. Das tat ich, obwohl er nicht für mich bestimmt war. Aber ich hatte ihn seit hundert Tagen. Hundert Tage! Wer könnte schon einen geheimnisvollen Brief so lange in der Tasche haben, ohne ihn aufzumachen?
Daher wusste ich, dass in dem alten Umschlag zwei spröde Blätter vergilbtes Papier steckten, die dicht an dicht mit schwarzem Text beschrieben waren. Aber den Brief zu öffnen war die Schuldgefühle wert gewesen, die mich seitdem plagten. Der Text war nämlich ganz und gar, komplett, phänomenal unverständlich!
Das Einzige, was mir blieb, war den Rest der hundert Tage abzuwarten, bis derjenige auftauchen würde, für den der Brief bestimmt war. Dann würde ich endlich erfahren, was es mit dem Brief auf sich hatte. Ich hatte ihn mir als jemand ganz Besonderes vorgestellt. Als jemanden, der alles verändern würde.
An seinem ersten Schultag sprach ich Orestes nicht an. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ihm den Brief auf dem Heimweg zu geben, denn wir waren so was wie Nachbarn. Aber ich habe ihn weder auf dem Radweg noch auf dem Pfad durch den Wald gesehen.
Am nächsten Tag war ich bereit. Ich ließ ihn schon im Klassenzimmer nicht aus den Augen und folgte ihm über den Schulhof. Vor mir sah ich den Rücken seiner blauen Jacke, die Anzughose und die Aktentasche. Er schien gar nicht zu merken, dass die Buschwindröschen im Eichenwäldchen neben dem Radweg wie Schnee leuchteten und dass das Gras auf der Pferdekoppel gegenüber endlich zu sprießen begann. Er starrte nur stur geradeaus wie ein viel beschäftigter Erwachsener, der dringend irgendwohin musste.
Ich holte ihn ein, als wir auf den Waldweg eingebogen waren, der durch den Eichenhain hinter unseren Häusern führt. Erst kommt man an Orestes’ Haus vorbei, dann an meinem.
»Orestes!«, rief ich. »Warte!«
Orestes blieb stehen, sagte aber nichts. Und er wirkte nicht mal überrascht. Als ob er gewusst hätte, dass ich die ganze Zeit hinter ihm hergegangen war.
»Wir sind Nachbarn«, sagte ich. »Oder fast, jedenfalls … Ich bin Malin.«
Orestes erwiderte nichts. Er starrte mich bloß an, ohne eine Miene zu verziehen. Das Frühlingslicht schimmerte auf seinem Gesicht, das beinahe genauso weiß war wie die Buschwindröschen um uns herum.
»Cool, dass du hergezogen bist«, sagte ich, auch wenn es sich gerade gar nicht so anfühlte. »Ich hab was für dich.«
Ich nahm den Rucksack ab und zog den Brief heraus. Er war ein bisschen verknautscht.
»Hier, nimm ihn!« Orestes rührte sich immer noch nicht. Er stand nur da, stocksteif. Es war, als würde ich gar nicht existieren. Da hatte ich nun so lange auf ihn gewartet, und dann tat er so, als wäre ich Luft! Aber ich musste ihm den Brief geben!
»Nun nimm ihn schon!«, fauchte ich. Ich griff nach seiner kalten, widerwilligen Hand und drückte den Brief hinein, während ich die ganze Geschichte herunterratterte, wie ich an den Brief gekommmen war und über hundert Tage auf ihn gewartet hatte.
Als ich von dem Auftrag erzählte, den ich bekommen hatte, riss Orestes sich von mir los und wich zurück. Seine Augen verfinsterten sich. Ein kalter Frühlingswindhauch fuhr zwischen uns hindurch und ich erschauerte.
»Bist du nicht mehr ganz bei Trost?«, zischte Orestes. Er hielt den Brief so fest, dass das brüchige Kuvert völlig zusammengeknüllt wurde.
»Pass auf!«, rief ich. Aber stattdessen riss er den Umschlag in der Mitte durch. Der schöne alte Brief, der mir so viel Kopfzerbrechen bereitet hatte. Er zerriss ihn, als ob es irgendein Werbescheiß sei! Es fühlte sich so an, als ob mein Herz ebenfalls entzweigerissen würde.
»Neeeein!«, schrie ich, aber er riss ihn noch mal durch, und noch mal. Hunderte weißer Papierschnipsel, dünn wie Blütenblätter, segelten durch die Luft.
Ich ließ mich auf die Knie fallen und versuchte sie zu fangen, aber dieser eisige Wind blies sie mir aus den Fingern und biss in meinen Augen. Jetzt würde ich nie erfahren, was der Brief zu bedeuten hatte! Als ich aufsah, war Orestes weg.
Ich ging nach Hause und legte mich auf mein Bett. Ich versuchte, nicht loszuheulen.
Hier, in den sechs Häusern in der Sackgasse zwischen dem Eichenwäldchen und dem Almekärrsväg, wohnen keine anderen Kinder. Nur Rentner. Ich hatte immer gehofft, es würde jemand herziehen, am liebsten natürlich ein Mädchen in meinem Alter. Vielleicht eines mit einer großen Schwester. Dann hätten wir Freundinnen werden und manchmal im Zimmer ihrer großen Schwester sitzen und Musik hören können.
Orestes war kein Mädchen und er hatte auch keine große Schwester. Gut, dafür konnte er nichts. Aber es war schon blöd, dass er so ein Idiot sein musste.
2.
Jetzt erzähle ich euch, warum ich überhaupt hundert Tage lang einen uralten, völlig unverständlichen Brief in der Schultasche mit mir rumschleppte und ihn dann Orestes gab, der ihn in tausend kleine Fetzen riss.
Es begann an einem Winterabend, als Mama und ich einen Gugelhupf backen wollten und feststellen mussten, dass wir nicht genug Zucker im Haus hatten.
»Kannst du mal schnell zu den Nachbarn rübergehen und welchen borgen?«, bat Mama mich. Also zog ich los – ohne Jacke, dafür mit einem Kaffeebecher in der Hand.
Draußen war es kalt und verschneit. Der Himmel war schwarz. Aber es war sternenklar, so klar, dass es einem den Atem verschlug, weil alles ringsum so groß und gleichzeitig so klein wirkte, obwohl man bloß zu Hause auf der Treppe stand.
Ich wollte erst zu den Larssons gehen, weil die am nächsten wohnen und nicht so neugierig sind, aber bei ihnen sah alles so dunkel und verlassen aus, dass ich stattdessen zu Roséns schräg gegenüber ging. Deren Einfahrt war natürlich ordentlich geräumt, aber sie war lang und vereist und hohe Büsche verschluckten das Licht der Straßenlaterne. Es gab zwar am Haus auch eine Lampe, aber die hatten Roséns für gewöhnlich nicht eingeschaltet. Auf jeden Fall waren ihre Fenster erleuchtet und ich stapfte im Dunkeln darauf zu, obwohl ich meine eigenen Füße kaum sehen konnte.
Inga öffnete die Tür. Sie füllte Zucker in meinen Becher und dieses Mal kam ich mit nur vier Fragen davon:
»Ach, ihr backt noch so spät am Abend?« (Offensichtlich.)
»Dass du gar nicht frierst?« (Doch.)
»Deine Mama hätte dir sagen sollen, dass du eine Jacke anziehen sollst?« (Vielleicht.)
»Ist dein Papa schon wieder zu Hause?« (Nee.)
Als Inga endlich keine Fragen mehr einfielen, schlitterte ich vorsichtig die Einfahrt wieder hinunter. Das war jetzt noch schwieriger, denn nun musste ich mich ja auch noch auf den randvollen Becher mit Zucker konzentrieren. Auf der anderen Straßenseite konnte ich durchs Küchenfenster sehen, wie Mama mit den Backzutaten hantierte. Ein warmer Schein fiel durchs Fenster, hinaus in die Winterglitzerwelt.
Ich hatte nur noch wenige Schritte in der Dunkelheit zurückzulegen, musste nur noch an den letzten tief verschneiten Büschen vorbei, bis ich wieder auf der laternenbeschienenen Straße wäre. Und genau da kam er aus dem Gebüsch neben dem Briefkasten der Roséns geklettert. Ich erschrak so, dass ich die Hälfte des Zuckers verschüttete.
Er war groß und hager und er trug einen riesigen altmodischen Wintermantel und eine gigantische Pelzmütze. Sein Gesicht konnte ich in der Dunkelheit kaum erkennen, aber ich glaube, er hatte einen Schnurrbart.
»Warte!«, sagte er. »Bleib stehen! Warte! Du musst keine Angst haben!«
Angst? Mein Herz schlug wie wild und ich überlegte, ob es klüger wäre, zurückzurennen und zu hoffen, dass Inga Rosén noch mal die Tür aufmachen würde, oder ob ich besser direkt nach Hause zu Mama rennen sollte.
»Es ist wichtig«, fuhr er fort. »Es geht um die Zukunft! Es geht um alles … Leben und Tod! Du musst mir zuhören!« Er legte eine Hand schwer auf meinen Arm. Ich gefror zu Eis.
»Entschuldige«, sagte er und zog die Hand wieder weg. »Ich wollte dich nicht erschrecken … aber … aber es ist so wichtig! Ich muss dich einfach fragen … Bist du vielleicht Fisc?«, lispelte er.
»Ja«, wisperte ich mit einer seltsam heiseren Stimme, die kaum zu verstehen war. Aber ich bin tatsächlich Fisch. Ich habe am vierzehnten März Geburtstag, im Sternzeichen Fische, und ich trage eine Kette mit einem kleinen silbernen Anhänger in Form von zwei Fischen um den Hals. Die habe ich von Papa bekommen.
»Dann stimmt es also«, sagte der Mann ernst. Er sah rasch in den Himmel hinauf. »Es ist sternenklar heute Nacht«, meinte er.
Jetzt war ich wirklich sicher, dass er so richtig nicht ganz richtig im Kopf war. Ich sollte nach Hause gehen – schleunigst!
Ich hatte grade mal zwei Schritte getan, da rief der Mann:
»Warte! Ich habe einen Auftrag für dich!« Er legte mir noch mal eine Hand auf den Arm. In der anderen hielt er etwas. Einen Brief. Er sah winzig aus in seinem dicken Handschuh.
»Du musst diesen Brief hier an dich nehmen«, sagte er, »und du musst ihn jemandem geben, der genau hierherkommen wird.« Er deutete auf das Haus der Roséns. »Es handelt sich um ein besonderes Kind, ein Rutenkind. Ihr werdet einander in hundert Tagen begegnen und dann musst du dem Rutenkind diesen Brief hier geben. Du darfst ihn niemand anderem geben. Du darfst auch niemandem davon erzählen. Der Brief ist nur für das Rutenkind, das in hundert Tagen ankommt. Hast du das verstanden?«
Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, es wurde vom Schatten der Pelzmütze verdeckt. Aber seine Stimme klang ernst und sein Griff um meinen Arm wurde immer fester. Er streckte mir den Brief entgegen.
»Nimm ihn«, sagte er. »Bitte, Liebes, nimm ihn.« Und da nahm ich ihn. Der Brief fühlte sich dick und glatt und warm in meiner Hand an.
»Es geht um die Zukunft! Es ist wichtig! Du musst ihn dem Kind geben. In hundert Tagen! Du wirst das schaffen, das weiß ich …«
»Maaaliiin!«
Mamas Stimme hallte über den Wendeplatz und ich konnte sie draußen auf der Treppe stehen sehen. Der Mann nickte mir zu und wich in den Schatten der Büsche zurück. Dann war er verschwunden. Ich weiß noch, dass ein Grollen zu hören war, als er verschwand. Das muss ein Güterzug gewesen sein, der unten an der Bahnlinie vorbeifuhr.
»Malin! Komm!«, rief Mama. Sie war schon halb über die Straße, mit kleinen, unsicheren Schritten in ihren Hausschuhen.
Schnell wie der Blitz stopfte ich den Brief in das, was am nächsten war: Roséns Briefkasten.
»Wer war das? Was wollte er? Hat er dir Angst gemacht?«, wollte Mama wissen.
»Er … er hat nach dem Rydsbergsväg gefragt«, antwortete ich.
»Aha?«, meinte Mama. »Und was hast du gesagt?«
»Ich ha… hab ihm erklärt, wie man zum Ry… Rydsbergsväg kommt, natürlich.« Ich klapperte mit den Zähnen, als ob die Kälte plötzlich tief in mich gekrochen wäre.
Mama hielt mich ganz fest umschlungen, als wir gemeinsam über die vereisten Stellen auf der Straße zurück zu unserem Haus gingen. Dreimal krachte sie in mich hinein, weil sie in ihren Hausschuhen ausrutschte, und jedes Mal spürte ich die Wärme ihres Armes stärker. Von unserer Haustür, die offen stand, fiel ein warmer Lichtschein der Winterkälte entgegen.
Als wir die Tür hinter uns zugezogen hatten, wunderte sich Mama, warum ich nur so wenig Zucker geliehen hatte.
In den ganzen vierzig Minuten, die der Gugelhupf im Ofen war, konnte ich an nichts anderes mehr denken als an diesen Fremden, den Brief und wie von all dem die Zukunft abhängen konnte. Ich konnte immer noch seinen Griff um meinen Arm spüren.
Mama war auch nachdenklich, nur dass sie natürlich nichts von dem Brief wusste. Sie fragte sich, wer der Mann gewesen war und wie er hatte glauben können, der Rydsbergsväg liege bei Roséns Einfahrt. Und sie nutzte auch gleich die Gelegenheit, mich an alle Gründe zu erinnern, aus denen ich nicht mit Fremden reden durfte. Ich stimmte ihr in allem zu – ich fühlte mich immer noch ganz zittrig. Aber als der Kuchen fertig war und wir am Küchentisch saßen und uns die Finger an den ersten Stücken verbrannten, beruhigten wir uns beide wieder.
»Es ist sternenklar heute Nacht«, sagte Mama und sah aus dem Küchenfenster. Ich zuckte zusammen, denn genau das hatte der Mann da draußen auch zu mir gesagt. Aber Mama fügte hinzu: »Da sieht man die Konjunktion besser.«
Sie drehte sich wieder zu mir und erklärte: »Heute Nacht gibt es eine Planetenbegegnung, eine Konjunktion«, sagte sie. »So nennt man es, wenn sich die Bahnen zweier Planeten kreuzen. Aber von der Erde sieht es so aus, als ob die Planeten an derselben Stelle stünden. Als ob sie sich treffen würden.«
Es war typisch für Mama, dass sie solche Sachen wusste. Sie weiß alles über Supernovae, Schwarze Löcher und so. Letztes Jahr standen wir stundenlang auf einer Wiese, weil es einen Meteorschauer gab.
»Einst glaubte man, dass das magische Begebenheiten waren. Wenn sich die Planeten trafen, waren ihre Eigenschaften besonders ausgeprägt. Die Planeten verschmolzen und merkwürdige Dinge konnten geschehen.«
Magische Begebenheiten? Ich hörte auf, auf dem Gugelhupf rumzukauen. Wenn unsere Familie etwas brauchen konnte, dann war es Magie.
»Schau nicht so«, meinte Mama. »Das ist natürlich alles nur alter Aberglaube. Es geschieht bald wieder, im Sommer nämlich, aber sonst ist das ziemlich selten. In Wirklichkeit kann man berechnen, wann Planetenbegegnungen stattfinden, wenn man …« Und dann erzählte sie mir so ziemlich alles, was es über Winkelberechnungen im Weltraum und in komplexen Gravitationssystemen zu wissen gibt.
Ich nickte die ganze Zeit, grübelte aber in Wirklichkeit darüber nach, ob die magische Planetenbegegnung vielleicht mit dem mysteriösen Brief zusammenhängen könnte, den mir der noch mysteriösere Mann da draußen in der Winterfinsternis gegeben hatte. Ich hatte ein bisschen Angst, war aber gleichzeitig auch froh. Stellt euch nur vor, ich hatte einen Auftrag bekommen. Einen wichtigen Auftrag. Einen, von dem die Zukunft abhing.
Erst nachdem ich ins Bett gegangen war, fiel mir wieder ein, dass der Brief ja immer noch im Postkasten der Roséns lag und Inga ihn sicher finden würde, wenn sie am Morgen die Zeitung holte. Also musste ich den Brief vor sechs aus dem Briefkasten holen, denn dann standen Inga und ihr Mann normalerweise auf.
Ich stellte den Wecker auf halb drei. Aber das war total unnötig, denn ich konnte sowieso nicht schlafen. Stunde um Stunde lag ich wach und dachte die ganze Zeit an das, was der Mann gesagt hatte: »Es geht um die Zukunft! Es geht um Leben und Tod!« Als es zwei Uhr nachts war, zog ich meinen Bademantel an und schlich die Treppe runter in den Flur.
Ich steckte die Füße in meine Winterstiefel, ließ aber die Jacke hängen. Ich würde ja nur den Brief holen, ganz schnell, und gleich wieder reinkommen.
Draußen war es superkalt und eine dünne Schicht Neuschnee war gefallen. Alles sah wie überzuckert aus. Der Mond stand hoch am Himmel und warf ein silbriges Licht über den Schnee. Es knirschte unter meinen Stiefeln, während ich den Wendeplatz überquerte.
Mondlicht ist schön, aber auch unheimlich. Es machte die Nacht so groß und die Schatten so lang, und ich musste den Büschen den Rücken zukehren, aus denen der fremde Mann gekommen war, wenn ich den Briefkasten der Roséns öffnen wollte. Was, wenn er immer noch da draußen war? Was, wenn er wirklich verrückt war? Was, wenn er aus dem Gebüsch gesprungen käme und mich wieder festhielt?
Roséns hatten einen von diesen riesigen Briefkästen mit einem schmalen Einwurfschlitz ganz oben und einer großen Klappe an der Seite, durch die man seine Post herausholen kann. Diese Briefkastenklappe aufzubekommen war unmöglich. Vermutlich festgefroren. Oder abgeschlossen. Meine Finger rutschten nur von dem eiskalten Riegel ab.
Ich lief zurück nach Hause, um zwei Dinge aus der Küche zu holen: einen Zollstock und eine Tube Sekundenkleber. Es kostete mich Überwindung, noch einmal hinaus in die Dunkelheit zu gehen. Jetzt musste ich noch einmal allein über die dunkle Straße gehen und noch einmal dem Gebüsch den Rücken zukehren und mich noch einmal über den Briefkasten beugen. Ich fing an zu zittern und konnte nicht sagen, ob es vor Kälte oder vor Angst war.
Aber mein Plan ging auf! Ich gab einen Klecks Sekundenkleber auf den Zollstock, steckte ihn durch den Briefschlitz und schon konnte ich den Brief mit meinen eiskalten Fingern herausfischen. Endlich!
Als ich die Haustür gerade hinter mir zugemacht hatte und meine Stiefel im dunklen Flur ausziehen wollte, knarzte die Treppe. Ich konnte mich nicht rühren, bis etwas Weiches, Schweres in mich hineinrumste.
»Huch! Was machst du hier?«, hörte ich Mama rufen. Dann ging das Licht an. Mama blinzelte in das Licht, mit zerzausten Haaren und ihrer dicken Kuschelstrickjacke an.
»Hab ich dich erschreckt?«, fragte sie dann, obwohl ich mir sicher war, dass sie den größeren Schrecken bekommen hat, als wir in der Dunkelheit zusammengestoßen sind. »Ich will nicht, dass du von meinem Wecker aufwachst! Ich wollte mir nur die Konjunktion anschauen«, erklärte sie weiter. »Man müsste sie jetzt am besten sehen können.« Sie öffnete die Haustür und ging hinaus auf die Treppe. Ich stopfte den Brief schnell ganz tief in die Tasche meines Bademantels.
»Ja, da ist sie!«, fuhr Mama fort. »Jupiter und Venus. Jetzt kann man die beiden Planeten nicht mehr auseinanderhalten. Sie sehen aus wie ein einziger, riesiger Stern.«
Ich schaute hinauf in den Himmel. Da war tatsächlich ein riesiger Stern zu sehen, funkelnd hell. Zwei Planeten wie ein einziger Lichtpunkt am finsteren Himmel. Und alles fühlte sich in dem Moment tatsächlich magisch an, als Mama und ich mitten in der Nacht zusammen draußen auf der Treppe standen.
Gerade als ich die Haustür öffnen wollte, um wieder reinzugehen, fragte Mama: »Was ist denn das da?« Keine Spur mehr von Freude in ihrer Stimme.
Ich drehte mich um. Mama deutete mit dem Kinn auf den Wendeplatz. Der Schnee glitzerte sanft im Mondschein, eine glatte, unberührte Decke. Außer da, wo meine Fußstapfen die Oberfläche aufgerissen hatten. Alle Schritte hin und zurück, zweimal über den Wendeplatz von unserer Haustür rüber zum Briefkasten der Roséns.
»Keine Ahnung«, antwortete ich ein bisschen zu schnell.
Mama hörte gar nicht zu. Sie starrte auf meine Füße.
Ich schaute runter auf meine Winterstiefel. Genau in dem Moment löste sich ein kleiner Schneeklumpen vom Stiefelschaft und fing auf der Fußmatte an zu schmelzen.
»Ich … ich dachte, von da könne man die Konjunktion besser sehen …«, sagte ich langsam.
»Aber Malin …«, meinte Mama besorgt. »Was machst du nur?« Jetzt fiel ihr Blick auf meinen Bauch. Ich sah an mir herab. Die Sekundenklebertube hing knapp unterhalb des Bademantelgürtels festgeklebt.
Am Ende gab sie auf und meinte, ich solle ins Bett gehen.
Sie selbst setzte sich allein in die Küche.
Meine Mama ist die liebste Mama der Welt. Ein wenig seltsam vielleicht, aber lieb. Es ist bloß so, dass sie seit den unglücklichen Vorkommnissen im Internet (auch »der Internet-Zwischenfall« genannt, weil es vollkommen unnötig ist, mehr darüber zu erzählen) auch die besorgteste Mama der Welt ist. Mittlerweile reicht die kleinste Kleinigkeit aus, dass sie sich wieder Sorgen macht. Dabei habe ich den Brief doch genau deshalb versteckt, damit sie es nicht muss!
Ich hab’s gleich am nächsten Morgen gemerkt, als Mama nicht gefragt hat, was ich geträumt, sondern bloß, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Das ist typisch für die besorgte Mama. Dann wird sie so unheimlich schweigsam. Sie kann dann gewissermaßen nicht sprechen vor lauter Gedanken, die ihr durch den Kopf schwirren, und wenn sie dann doch was sagt, geht es um Hausaufgaben oder Termine oder Regeln oder alles, vor dem ich mich in Acht nehmen soll.
Die ganze Zeit während ich gefrühstückt habe, saß sie nur da und hat mich angeschaut. Als die heiße Schokolade alle war, seufzte sie:
»Malin, ich dachte, wir wären uns einig. Keine Geheimnisse?«
Ich nickte. Ich habe kein Wort rausgebracht. Mama fügte hinzu:
»Du hast keine Geheimnisse vor mir, ich hab keine Geheimnisse vor dir. Wie wir es beschlossen haben.«
Ich bekam einen Kloß im Hals. Trotzdem murmelte ich ein: »Wann kommt Papa nach Hause?« Weil jetzt Keine-Geheimnisse-Zeit war.
»Das weiß ich wirklich nicht«, sagte Mama und streichelte mir über die Wange, wie sie es immer macht. »Das weiß niemand so genau.«
Sie sah traurig aus und ich wünschte, ich hätte ihr alles erzählen können. Aber das hätte natürlich alles nur noch schlimmer gemacht. Außerdem durfte ich mit niemand anderem als dem Rutenkind über den Brief sprechen. Stattdessen habe ich Mama umarmt. Und dann habe ich beschlossen, alles zu tun, damit sie wieder ruhig und froh sein konnte.
Ich hab direkt damit angefangen:
1. Ich schrieb ihr, wenn ich morgens in der Schule angekommen war.
2. Ich schrieb ihr, wenn ich nachmittags von der Schule losging.
3. Ich schrieb ihr, wenn ich zu Hause angekommen war.
Und ich brauche grade mal fünf Minuten, um von der Schule nach Hause zu gehen, also versteht ihr vielleicht, dass das Ganze ziemlich übertrieben war.
Ich versuchte kein einziges Mal, abends rauszugehen, und ich surfte auch nicht heimlich mit ihrem Smartphone, selbst wenn sie es unbeaufsichtigt auf dem Küchentisch liegen gelassen hatte. Als Extrabonus tat ich so, als würde ich Bücher lesen, die Mama mag. (Wusstet ihr, dass Der Herr der Ringe genau in den Schutzumschlag von DerKosmos – eine kurze Geschichte passt? Auf diese Weise musste sie sich keine Sorgen darum machen, dass ich zu viel fantasiere, wo sie sich doch schon immerzu um alles andere Sorgen machte.) Aber ich erzählte ihr nichts von dem Mann mit der Pelzmütze, dem Brief oder meinem Auftrag.
Es dauerte ganz schön lange, genauer gesagt drei Tage, bis Mama sich wieder beruhigt hatte. Aber als sie während des Abendessens summte und dann anfing, über den Unterschied von »oder« und »entweder – oder« (leicht) zu reden, wusste ich, die Gefahr ist vorbei. Mama war wieder normal.
Einige Monate später, als der Schnee zu tauen begann, verkauften die Roséns ihr Haus auf der anderen Straßenseite. Sie wurden langsam alt und schafften solche Sachen, wie die lange Auffahrt frei zu schippen, nicht mehr. Also kauften sie sich ein Reihenhaus in der Stadtmitte. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich sie vermissen werde.
Am Tag der Walpurgisnacht zog eine neue Familie ein. Mama und ich sahen den Umzugswagen vorfahren, als wir zum Maifeuer gingen. Wir dachten kurz drüber nach, zu Hause zu bleiben, weil wir so neugierig auf die neue Familie waren, überlegten es uns dann aber doch anders. Ein Maifeuer ist schließlich ein Maifeuer! Das brennt nur einmal im Jahr.
Deswegen hatte ich auch Orestes noch nicht gesehen, bevor er am Montag nach dem Walpurgiswochenende in der Schule auftauchte. Und da waren es ziemlich genau hundert Tage seit dieser sternenklaren Nacht, in der sich die Planeten gekreuzt hatten und ich diesen merkwürdigen Brief in die Hand gedrückt bekommen hatte. Hundertfünf, genauer gesagt.
3.
Seit Orestes den geheimnisvollen Brief in wertlose Schnipsel gerissen hatte, ohne ihn vorher auch nur einmal angesehen zu haben, haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Und er redete auch mit sonst niemandem aus der Klasse, wenn es nicht sein muss.
Trotzdem habe ich bereits in der ersten Woche zwei Dinge über Orestes gelernt. Na ja, nicht nur ich, die ganze Klasse hat es mitbekommen.
Erstens: Er war absurd gut in Mathe.
Also, richtig, richtig gut! Und ich kann das beurteilen, denn bevor er aufgetaucht ist, war ich nämlich Klassenbeste. Ich war die, die immer als Erste mit allen Kapiteln im Buch fertig war und Zusatzaufgaben bekam, in denen man ausrechnen sollte, wie oft man Hände schütteln musste, wenn sich die ganze Klasse gegenseitig begrüßen würde und so. Aber Orestes war quasi bereits über die Mittelstufe hinaus. Und die Oberstufe auch, glaube ich. Das Lehrbuch, das unsere Lehrerin für ihn herausgesucht hatte, sah verdächtig erwachsen aus. Also sterbenslangweilig.
Und zweitens: Er war irrsinnig schnell.
Am Donnerstag der ersten Woche kreuzte Orestes in einem dunkelgrünen Trainingsanzug auf, der wie aus dem zwanzigsten Jahrhundert aussah. Er wirkte, als sei ihm äußerst unwohl. Ante, der es schon die ganze Woche auf Orestes abgesehen hatte, ohne auch nur die geringste Reaktion zu bekommen, lästerte natürlich. Er selbst stand in seinen supercoolen, nagelneuen Sportklamotten da und war sicher davon überzeugt, dass es spannend werden würde zu sehen, wie der hölzerne Orestes den Sportunterricht hinter sich bringen würde. Und das fragte ich mich ehrlich gesagt auch.
Wir sollten uns bei einem Kleinkinderspiel aufwärmen, keine Ahnung, wie es heißt. Man bekommt unterschiedlich farbige Bänder, die man sich in den Hosenbund stopft, dass sie wie ein Schwanz heraushängen. Dann rennt man wild auf dem Sportplatz herum und versucht, sich gegenseitig die Schwänze abzureißen. Sobald der eigene Schwanz geklaut ist, ist man raus aus dem Spiel. Und der, der am Schluss noch übrig ist, hat gewonnen.
Ich war ziemlich schnell raus und am Schluss waren nur noch zwei Kinder im Spiel: Ante und Orestes.
Ante gewinnt eigentlich immer, aber jetzt wurde allen klar, dass er keine Chance hatte – obwohl er so schnell rannte, dass er eine Staubwolke aufwirbelte. Es war seltsam, Orestes in seinem hässlichen grünen Trainingsanzug da draußen auf dem Sportplatz zu sehen. Er lächelte und war kaum wiederzuerkennen. Und er rannte schneller als der Wind. So in Fahrt rief er irgendwas Ante zu. Wir konnten nicht genau verstehen, was, aber er pflaumte Ante ganz eindeutig an. Und Ante wurde immer wütender. Er ist es sozusagen gewohnt, der zu sein, der andere hänselt. Irgendwann blieb Ante urplötzlich auf dem Platz stehen und keuchte, den Kopf zwischen den Knien. »Du bist ja verdammt noch mal irrsinnig schnell!«, rief er.
Ich kenn mich mit Jungs nicht aus. Die stänkern und spielen und sind Freunde und Feinde, alles gleichzeitig. Und wenn man grade glaubt, sie werden einander umbringen, werden sie plötzlich Freunde. Oder so.
Bloß dass Orestes nicht lachte. Er lächelte nur schwach.
Tags darauf kam Orestes nicht zur Schule. Unsere Lehrerin bat mich, ihm seine Schulbücher nach Hause zu bringen. »Weil ihr ja ohnehin Nachbarn seid«, meinte sie und sah mich mit ihrem unvermeidlichen Lehrerinnenblick an. Ich erwiderte nichts, sondern stopfte nur Orestes’ Bücher in meinen Rucksack.
Ich habe natürlich den Trampelpfad durch das Eichenwäldchen genommen, wie immer. Der Himmel war wolkenverhangen und die Luft kalt, deswegen hatten die Buschwindröschen ihre Blüten zusammengefaltet und sahen aus wie Knospen. Als ich sie erblickte, musste ich wieder an die Briefschnipsel denken und wollte eigentlich nur noch heimgehen. Um zu mir nach Hause zu kommen, muss man den Trampelpfad hinter Orestes’ Haus weitergehen, bis man auf der Rückseite von unserem Haus ist.
Ich entdeckte einen winzigen Steig, der von dem breiten Pfad im Wald abzweigte und den Hügel hinunter zu Orestes’ Garten führte. Es fühlte sich natürlich ein bisschen blöd an, über die Hintertür zu ihm nach Hause zu gehen, irgendwie so, als würde ich mich anschleichen. Aber es war der kürzeste Weg.
Als die Roséns noch in dem Haus gewohnt haben, war immer alles superordentlich. Der Rasen war sorgfältig gemäht, die Rosen in den Beeten wuchsen alle in dieselbe Richtung und die Gartenmöbel standen in Reih und Glied neben dem Haus.
Ich bemerkte sofort, dass sich jetzt alles verändert hatte. Jemand hatte den Rasen und die Blumenbeete umgegraben und das Grundstück in einen großen Acker verwandelt. Hellgrüne Schösslinge sprossen bereits daraus hervor. Ich entdeckte eine große blaue Glaskugel am einen Ende des Beetes und eine identische in Weiß, ein bisschen näher am Haus.
Hier und da steckten kleine Schilder im Boden. Darauf standen Dinge wie »Wie der Mond, beständig im Wandel«, »Nachtwache« oder »Digitalis«. Ich wusste nicht, was das bedeuten sollte.
Auf einmal kam es mir so vor, als ob mich jemand beobachtete. Ich sah zu, dass ich von der Rückseite des Hauses wegkam, und hastete um die Hausecke zur Eingangstür auf der anderen Seite. Dort war Ingas Rosenbusch radikal zurückgeschnitten worden und anstelle der Rosen hing da ein Schild.
HELIONAUTICA
Alternative zu allem.
Heilung durch Gesang, Kristalltherapie,
Aromatherapie, Magnettherapie,
Horoskop, Tarot, Traumdeutung, Numerologie,
Reinkarnationsberatung, spirituelle Anleitung.
Behandlung und Gespräch.
Mensch und Tier.
Früher oder später.
Das Schild war schlampig aus alten Brettern, die so lange draußen gelegen hatten, bis sie ganz grau geworden waren, zusammengezimmert. Es sah aus, als könnte es jederzeit herunterfallen. Aber die Buchstaben, die darauf gemalt waren, waren schön geformt, mit schnörkeligen Pinselstrichen in allen Farben des Regenbogens.
Ich hatte gerade die letzte Textzeile gelesen, da ging die Tür auf. Eine kleine Frau in einem weißen Kleid, das bis zu ihren Füßen hinunterreichte, trat heraus auf die Treppe. Sie hatte eine aufrechte Körperhaltung und ihr Haar fiel lang und hell um sie herum wie ein Schleier. Sie trug ein silbernes Diadem auf der Stirn, das zu glitzern begann, als sie den Kopf drehte und mich erblickte.
»Hallo«, sagte sie mit einer warmen, freundlichen Stimme. »Wie kann ich dir helfen?«
Unsere Nachbarinnen tragen für gewöhnlich keine strahlend weißen Kleider oder Diademe. Sie haben normalerweise Jeans und Pullis an und tragen Pferdeschwanz.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Es fühlte sich so an, als hätte ich gerade eine Elfenkönigin getroffen.
Sie fragte nichts weiter, sondern sah mich nur forschend an. Dann lächelte sie und genau in dem Augenblick brach ein schmaler Sonnenstrahl zwischen den Wolken hervor. Es ist schwer zu erklären, aber es fühlte sich so an, als ob mich ihr Lächeln mit genauso viel Wärme berührte wie dieser Sonnenstrahl. So, als ob sie froh war, dass ich gekommen war, und sie sich wirklich für mich interessierte. Fast so, als hätte sie auf mich gewartet. Trotzdem wusste sie nicht, wer ich war.
Schließlich stammelte ich hervor:
»Ich will bloß Bücher abgeben. Also Schulbücher. Für Orestes. Ich … Er … Wir gehen in dieselbe Klasse.«
»Das ist aber nett von dir!«, sagte sie. »Wie heißt du?«
»Malin«, erwiderte ich. Jetzt erkannte ich, dass ihre langen Haare ziemlich verstrubbelt waren und sie kleine, feine Fältchen auf der Stirn hatte. Sie war vielleicht nur ein kleines bisschen jünger als Mama. Ihre Augen waren blau und ihr Blick war so hell, wie der von Orestes finster war. Aber die blasse, fast weiße Haut hatten alle beide.
»Malin«, wiederholte Orestes’ Mutter. Ohne zu fragen, nahm sie mir den Rucksack von der Schulter und gleichzeitig griff sie nach einer Strähne meines Haares. Meine Haare sind ganz gewöhnlich, weder hell noch dunkel, und normalerweise schenkt ihnen niemand Beachtung. Nicht mal ich selbst. Sie hielt die Haarsträhne zwischen den Fingern, vielleicht eine Sekunde oder so. Dann leuchteten ihre Augen auf und sie ließ meine Haare los.
»Komm mit rein«, meinte sie und ging vor mir mit meinem Rucksack die Treppe hoch. »Orestes ist in seinem Zimmer.« Mit ihren nackten Füßen ging sie fast lautlos. An einem Fuß trug sie einen Ring, einen Zehenring. Sie lächelte mich noch mal an. »Ich glaube, du brauchst ein bisschen Gelbwurz«, sagte sie.
Es hing ein intensiver Geruch im Flur. Nach Kräutern und Gewürzen, glaube ich. Und noch was anderem, Rauch vielleicht? Von der Decke hingen lauter kleine glänzende Metallstückchen und Glasscherben an langen Fäden.
»Hast du ein Handy?«, wollte Orestes’ Mutter wissen.
»Ich hab eins im Rucksack«, antwortete ich.
»Das kannst du da hineinlegen«, meinte sie und nickte in Richtung eines kleinen schwarzen Kastens mit einem Schloss dran, der im Flur an der Wand hing. Ich bekam den Rucksack zurück, kramte das Handy hervor und legte es in den Kasten. Genau wie in der Schule.
Hinter der Diele war das Wohnzimmer. Ich kann mich nur noch vage dran erinnern, wie es vorher ausgesehen hat, als die Roséns noch hier gewohnt haben; blank polierte Tische und Polstermöbel.
Jetzt war alles anders.
Jetzt war es farbenfroh und gemütlich. Und … unordentlich!
Das Erste, was mir auffiel, waren die Farben – Rot und Grün und Braun –, in denen die gemusterten Teppiche leuchteten, die kreuz und quer über den Fußboden verteilt lagen, sodass man von dem blanken Parkett darunter nicht mehr das Geringste sehen konnte. Und das Rot und das Grün wiederholten sich in den weichen Kissen, die auf den Sesseln und Sofas verteilt lagen, hier und dort auch auf dem Boden. Ich bekam richtig Lust, mich in sie hineinzuwerfen. Alle Möbel waren alt und ein Teil davon, wie der Couchtisch und das große Bücherregal, waren zerkratzt und hatten hier und da Flecken im Holz Aber sie waren trotzdem schön, fand ich. Alles wirkte ein wenig verschlissen und chaotisch, aber auch irgendwie heimelig.
Die lange Fensterbank raus auf den Garten war vollgestopft mit Topfpflanzen, deren grüne und rot-grüne Blätter die Fensterscheiben zuwucherten, sodass man kaum noch rausschauen konnte.
Und dann waren da noch all diese Sachen. Oder Dinge, Gegenstände, Kram. Ich wusste nicht, als was ich sie bezeichnen sollte. Ein Teil davon war vielleicht Dekoration, wie die ganzen glänzenden Götterstatuen mit jeder Menge Armen, die auf dem Couchtisch standen, oder die Holzmasken an der Wand neben dem Bücherregal. Glänzende Uhren aus Metall und Bündel getrockneter Pflanzen hingen über der Terrassentür und auf einer Kommode neben dem Sofa standen im Halbkreis aufgestellte Spiegel gegenüber einem gräulichen Stein. Überall, auf jeder Tischplatte und jedem Regalbrett, standen solche seltsamen kleinen Dinge verstreut. Unbrauchbare Gegenstände. Und unbegreiflich viele davon.
Das hier sollte Mama mal sehen, dachte ich. Das sollte ihr zu denken geben, wenn sie sich das nächste Mal beklagt, dass ich so viel Kleinkram sammle.
Ich hatte das Gefühl, dass all diese unbrauchbaren Gegenstände vielleicht etwas bedeuteten, aber ich begriff nicht, was. Ich kam aber auch nicht dazu zu fragen, denn Orestes’ Mutter wartete schon am Ende eines kurzen Flurs neben dem Wohnzimmer auf mich.
»Hier ist Orestes’ Zimmer«, sagte seine Mutter. »Ihm geht es schon wieder viel besser.« Sie klopfte an die verschlossene Tür. Neben der Tür hing ein Stoffbild mit einem großen blauen Auge.
»Orestes, du hast eine Freundin zu Besuch!«
Die Tür ging einen Spaltbreit auf, aber es kam niemand heraus. Durch den Spalt sah ich, dass der Raum dahinter fast im Dunkeln lag.
»Geh schon rein«, sagte seine Mutter nickend. Zuerst zögerte ich, aber dann tat ich, was sie sagte.
Die Tür schlug sofort hinter meinem Rücken zu. Orestes ruckelte an der Türklinke, um sich zu versichern, dass die Tür ordentlich verschlossen war. Sein Gesicht leuchtete bleich im Halbdunkel, seine Augen blickten mich finster und ernst an.
Es war seltsam, wie ähnlich sich Orestes und seine Mutter waren. Und wie unterschiedlich.
4.
In Orestes’ Zimmer war es deswegen so schummrig, weil die Rollos runtergelassen waren. Orestes wandte sich gleich zu den Fenstern um und begann, sie hochzuziehen. Ich kam mir blöd vor, wie ich dastand, hinter seinem Rücken. Er hatte nicht mal Hallo gesagt.
Die Wände in Orestes’ Zimmer waren weiß und sein Bett war ordentlich gemacht, mit einem blauen Überwurf. Auf dem Boden lag nichts, kein Teppich und nicht mal die kleinste Staubflocke. Definitiv keine unbrauchbaren Gegenstände. Er war blitzeblank.
Das hier sollte Mama auch sehen, dachte ich, denn das würde ihr gefallen.
»Und?«, fragte Orestes und drehte sich zu mir um. Er strich sich mit den Händen über die Hosenbeine. Er trug wie immer eine Stoffhose, aber einen langärmligen Pulli anstelle eines Hemdes. Glatt gebügelt, versteht sich.
»Und?«, wiederholte er. Er hatte leicht rosige Wangen, sah aber ansonsten wie immer aus. Also nicht unbedingt so, als sei ich willkommen. Ich hatte ja gehofft, dass es dieses Mal besser laufen würde, dass ich mich vielleicht sogar zu fragen trauen würde, warum er den Brief zerrissen hatte. Aber das sah nicht besonders vielversprechend aus.
»Ich habe Bücher für dich«, sagte ich.
»Bücher?«, wiederholte er verständnislos.
»Na ja, Schulbücher«, erklärte ich.
Das artete in einen extrem peinlichen Moment aus und ich wollte grade den Rucksack aufmachen und ihm die Bücher geben, als es an der Tür klopfte. Orestes zuckte zusammen. Er sah unglaublich verlegen aus, als ob er sich am liebsten in seinem Pulli verkrochen hätte. Es klopfte noch mal.
»Was ist?«, rief Orestes.
»Bloß ein bisschen Tee für Malin«, ließ sich die unbekümmerte Stimme seiner Mutter durch die Tür hindurch vernehmen.
Orestes starrte mich an, ohne eine Miene zu verziehen.
Ich zuckte mit den Schultern.
»Dann komm rein«, meinte Orestes.
Orestes’ Mutter bekam nichts von der merkwürdigen Stimmung zwischen Orestes und mir mit. Sie lächelte mich nur wieder so freundlich an und reichte mir einen großen Becher aus Ton, aus dem es scharf roch.
»So, bitte schön«, meinte sie. »Gelbwurz. Genau, was du brauchst.«
»Danke«, antwortete ich und nahm den Becher entgegen. Er war randvoll mit heißem, gelblichem Tee.
»Bist du sicher, dass du nicht noch ein bisschen Minze vertragen könntest, Orestes?«, fragte sie und tätschelte ihm die Wange.
»Ganz sicher«, antwortete Orestes. »Mir geht’s wieder gut.«
Seine Mutter ging raus und Orestes schloss die Tür nachdrücklich hinter ihr. Er starrte den Becher in meinen Händen an.
»Du musst das wirklich nicht trinken«, meinte er. »Sie ist verrückt. Total verrückt!«
Verrückt? Mir fiel keine gute Antwort darauf ein, deswegen schnupperte ich stattdessen am Tee. Er hatte einen stechenden Geruch, ein bisschen wie Heu. Der Becher lag warm und rund in meiner Hand. »Was ist das hier?«, fragte ich.
»Heißes Wasser mit Gelbwurz«, antwortete Orestes. Er setzte sich aufs Bett, absolut kerzengerade wie auf einen Küchenstuhl. »Sie mischt gern allerlei zusammmen. Meint, das sei gut fürs Herz oder den Magen oder die Seele oder den kleinen Finger. Was auch immer. Das ist alles völliger Unsinn.«
»Es schmeckt jedenfalls ganz gut«, stellte ich fest und nahm einen Schluck. Das hätte ich tun sollen, bevor ich behauptet habe, es schmecke gut. Der Tee war so stark, dass er im Hals brannte. So stark, dass ich ein paarmal blinzeln musste.
Orestes strich mit der Hand über die Tagesdecke, als ob sie dadurch noch glatter werden könnte.
»Das würdest du nicht finden, wenn du so was ständig bekämst! Wenn alles, was du bräuchtest, eine Schmerztablette ist. Jedes Mal, wenn ich Kopfweh habe, wünschte ich, ich würde einfach ein Aspirin oder Paracetamol oder so kriegen. Und was gibt sie mir? Pfefferminztee!«
»Aber wozu?«, wollte ich wissen. »Warum bekommst du keine Schmerztablette?«
»Weil Mama nicht an Medikamente glaubt …«, murmelte er. »Obwohl sie sonst an fast alles glaubt.«
Wie jetzt, glaubt? Ich wusste nicht, was ich erwidern sollte, also nahm ich noch einen Schluck Gelbwurztee, nur um nichts sagen zu müssen. Orestes stand auf und ging hinüber zum Schreibtisch. Er fing an, die Stifte in der Stiftablage zu ordnen, obwohl sie bereits perfekt nach Größe sortiert waren. Er fuhr fort:
»Also dieses Schild da draußen vor der Tür. Das ist nichts, mit dem ich mich aufhalten würde!« Er hörte auf, mit den Stiften herumzufummeln, und drehte stattdessen einen Globus, der neben der Stiftablage stand.
»Wo wir auch hinkommen, hängt Mama ihr Schild auf, und dann haben wir das Haus voller Spinner, die mit ›Heilung duch Gesang‹ und ›Reinkarnation‹ experimentieren … Das Einzige, woran sie nicht glaubt, ist alles, was tatsächlich wahr ist! Was wirklich funktioniert!«
Orestes’ Stimme wurde auf einmal höher und schneller. Ich hatte ihn noch nie zuvor so viel reden hören! Er drehte sich zu mir um, aber ich wusste immer noch nicht, was ich sagen sollte. Also war ich gezwungen, noch einen Schluck Gelbwurztee zu nehmen. Er brannte in meinen Augen.
»Sie glaubt, dass man mit Wünschelruten Gold finden kann und dass es Glück bringt, wenn man das Sofa in eine bestimmte Ecke des Wohnzimmers stellt … Sie glaubt daran, dass man sein Haus kraft seiner Gedanken schützen und Krankheiten durch Handauflegen heilen kann. Aber an normale Dinge wie Rauchmelder oder Medizin, an so was glaubt sie nicht!«
Also, ich mag es ja nicht, wenn Leute wütend sind. Sie müssen nicht mal sauer auf mich sein, darum geht es gar nicht. Ich kann es einfach nur nicht leiden. Jetzt hatte ich schon drei Schlucke Tee getrunken, meine Augen tränten vom Gelbwurz und Orestes machte keine Anstalten, sich wieder zu beruhigen. So konnte das nicht weitergehen. Ich streckte mich nach meinem Rucksack aus und wollte gerade von unseren Hausaufgaben anfangen, als Orestes fortfuhr:
»Ich hasse dieses idiotische Schild, das sie neben der Haustür angebracht hat! Ich dachte, das hättest du gesehen. Damals, als du mit diesem Brief ankamst und irgendwas von Sternen und auserwählten Kindern geredet hast … Ich dachte, dass … dass du mich verarschst. Das macht doch immer irgendwer … Und dann dachte ich, du bist auch eine von diesen Spinnern, die hierherkommen, du auch.«
Er sank auf den Schreibtischstuhl nieder. Er sah erschöpft aus. Und plötzlich fiel mir wieder ein, dass er ja Kopfweh gehabt hatte.
»Manchmal ist es etwas ruhiger«, sagte er, viel gefasster als zuvor. »Jedenfalls immer dann, wenn wir gerade mal wieder umgezogen sind.«
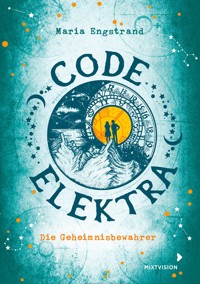













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














