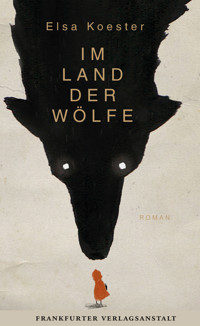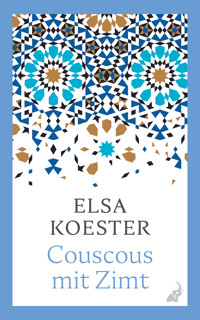
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Debütromane in der FVA
- Sprache: Deutsch
Elsa Koester porträtiert drei charakterstarke Frauen, deren Schicksale von gesellschaftlichen Umbrüchen und Krisen gezeichnet sind. Die hinreißende Leichtigkeit, mit der sie die Perspektiven von drei Generationen verwebt, die gewinnende Eigenwilligkeit ihrer Figuren und der gesellschaftlich-scharfsichtige Blick der Autorin machen »Couscous mit Zimt« zu einer mitreißenden Lektüre, ein Familienroman voller emotionaler Wärme, Empathie und einer sprühenden Lust am Erzählen. Zigaretten, Cognac und Bücher – ihre letzten Jahre verbringt die über hundertjährige Lucile am liebsten lesend im Bett ihrer Pariser Wohnung. Als kurz nach Luciles Tod auch ihre Tochter Marie stirbt, erbt Lisa das Appartement in der Avenue de Flandre. Ihr bleiben nur noch die Erinnerungen an die zwei eigenständigen, vom Leben gezeichneten Frauen der Familie. Das Verhältnis von Mutter und Großmutter war explosiv. Die starke, aber auch selbstbezogene Französin Lucile musste nach der Unabhängigkeit Tunesiens mit ihren Töchtern überstürzt nach Frankreich fliehen, ein Heimatverlust, den die in Tunesien geborene, temperamentvolle Marie nie verwunden hat. »Fische haben empfindliche Füße«, pflegte Marie zu sagen, die immer wieder ins Straucheln geriet bei dem Versuch, im neuen Land Fuß zu fassen. Der schmerzhafte Abschied von Tunesien, die erste dramatische Liebe im Pariser Mai 1968, die Flucht vor den Übergriffen Luciles nach Berlin, wo Lisa Jahre später zur Welt kam – von all dem hat Marie ihrer Tochter erzählt. Doch kann Lisa den Erzählungen ihrer Mutter trauen? »Elsa Koester lässt aus den Geschichten von Frauen aus drei Generationen ein Bild entstehen, das von der französischen Kolonialherrschaft in Tunesien über die Unruhen der 1968er-Jahre bis ins Paris der Gegenwart reicht. Ein intimer und kulissenreicher Roman.« Sacha Verna, annabelle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Elsa Koester porträtiert drei charakterstarke Frauen, deren Schicksale von gesellschaftlichen Umbrüchen und Krisen gezeichnet sind. Die hinreißende Leichtigkeit, mit der sie die Perspektiven von drei Generationen verwebt, die gewinnende Eigenwilligkeit ihrer Figuren und der gesellschaftlich-scharfsichtige Blick der Autorin machen »Couscous mit Zimt« zu einer mitreißenden Lektüre, ein Familienroman voller emotionaler Wärme, Empathie und einer sprühenden Lust am Erzählen.
Zigaretten, Cognac und Bücher – ihre letzten Jahre verbringt die über hundertjährige Lucile am liebsten lesend im Bett ihrer Pariser Wohnung. Als kurz nach Luciles Tod auch ihre Tochter Marie stirbt, erbt Lisa das Appartement in der Avenue de Flandre. Ihr bleiben nur noch die Erinnerungen an die zwei eigenständigen, vom Leben gezeichneten Frauen der Familie. Das Verhältnis von Mutter und Großmutter war explosiv. Die starke, aber auch selbstbezogene Französin Lucile musste nach der Unabhängigkeit Tunesiens mit ihren Töchtern überstürzt nach Frankreich fliehen, ein Heimatverlust, den die in Tunesien geborene, temperamentvolle Marie nie verwunden hat. »Fische haben empfindliche Füße«, pflegte Marie zu sagen, die immer wieder ins Straucheln geriet bei dem Versuch, im neuen Land Fuß zu fassen. Der schmerzhafte Abschied von Tunesien, die erste dramatische Liebe im Pariser Mai 1968, die Flucht vor den Übergriffen Luciles nach Berlin, wo Lisa Jahre später zur Welt kam – von all dem hat Marie ihrer Tochter erzählt. Doch kann Lisa den Erzählungen ihrer Mutter trauen?
Inhalt
Prolog. Lucile
1. Lisa
2. Marie
3. Lisa
4. Marie
5. Lisa
6. Marie
7. Lisa
8. Marie
9. Lisa
10. Marie
11. Lisa
12. Solange
13. Lisa
14. Marie
15. Lisa
16. Marie
17. Lisa
19. Lisa
20. Lisa
21. Charlotte
22. Lisa
23. Lisa
24. Lisa
25. Marie
26. Lisa
27. Marie
28. Lisa
29. Marie
30. Lisa
31. Marie
32. Lisa
33. Marie
34. Lisa
35. Marie
36. Lisa
37. Lisa
38. Marie
39. Lisa
40. Marie
41. Lisa
für Eve
Prolog.Lucile
Ich habe Gott nie um Kinder gebeten. Es gibt so viele Frauen, mondieu, die Araberinnen machen richtige Hexentänze deshalb, knien nieder und flehen Allah an, er möge sie mit Kindern segnen. Segnen! Ich habe nie verstanden, was daran ein Segen sein soll. Erst bereiten sie dir Übelkeit, du kotzt dir die Seele aus dem Leib, jeden Morgen, dann tun dir alle Knochen weh und der Schweiß rinnt dir vor Anstrengung den Rücken hinunter, wenn du dich auch nur ein paar Meter bewegen willst. Kein Mann guckt dich mehr an, schon von Weitem sehen sie, wie dein Bauch, deine Hormone, deine monströsen Brüste deine Schönheit zerstört haben. Bei der Geburt reißen sie dir dann die Muschi auf, und nach stundenlangen Schmerzen, wenn du denkst, die Qual sei endlich vorbei, endlich das Balg raus aus deinem Bauch, wird es dir auf die Brust gelegt, wo ihm dann nichts anderes einfällt, als dich anzuschreien, knallrot in seinem hässlichen, zerknautschten, verklebten Gesicht, brüllt es dich an, und alle um dich herum schauen blöde, oh, wie niedlich, oh làlà, dieses niedliche kleine Wesen, putain, nehmt es weg!, habe ich gerufen, nehmt es weg, ich bin es doch gerade erst losgeworden.
Von wegen! Dann hängen sie monatelang an deiner Brust, als wären sie eigens dazu da, dir deinen Körper wegzunehmen. Du musst sie weiter mit dir rumschleppen, weil sie sich sonst gar nicht einkriegen vor Schreien, und das ist ein Gebrüll, so was hat man noch nicht gehört, etwas Lauteres habe ich überhaupt noch nie gehört als Babygebrüll. Sie sabbern und scheißen und machen Pipi, und von dir wird verlangt, dass du glücklich damit bist, diesen Schleim andauernd wegzuwischen, den ganzen Tag, du stopfst ihn ja auch immer wieder von oben in sie rein, und dann wischst du ihn weg, du kommst zu nichts anderem mehr, Schleim in allen Farben. Dann beruhigt sich die Lage, doch, ich würde sagen, nach ungefähr einem Jahr geht es. Sie können sogar manchmal ganz niedlich sein, wie sie herumglucksen, aber das Schreien und das Gezeter, das geht leider nie weg, auch Jahre später nicht. Und wenn sich mal eines beruhigt hat, bist du gleich wieder am Kotzen, weil schon das nächste unterwegs ist.
Ich weiß wirklich nicht, warum Allah mir das angetan hat, ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich kann mit Kindern nichts anfangen, und er beschert mir gleich vier. Vier! Versteht mich nicht falsch, ich habe sie immer geliebt, nicht nur meine zwei Söhne, es ist wahr, ich wollte keine Kinder, erst recht nicht nach Maurice und Antoine, aber bon, was soll man machen, dann kamen eben noch Marie und Solange, geliebt habe ich sie ja alle vier, aber wenn ich vor der Wahl gestanden hätte, ich hätte mich ganz bestimmt nicht für vier Kinder entschieden. Versteht das denn niemand, dass eine Frau es satthat, immer wieder wie ein Elefant durch die Gegend zu laufen, über neun Monate, um dann schon wieder jemanden an der Brust hängen zu haben, erst an der Brust und dann am Rockzipfel, über Jahre und Jahre? Wo gibt es das denn bitte sonst in der Natur, alle Tiere werden schneller selbstständig, einfach alle, nur diese kleinen Gören von Menschen nicht!
Bah non, ich wollte endlich ein bisschen was haben vom Leben! Ich wollte mich amüsieren, ich war jung, mondieu, ich wollte ins Kino und schick dinieren mit meinem Claude und lesen und mir ein schönes Leben machen, zwei Söhne, das reicht doch wohl! Aber nein, Marie hat sich an meiner Gebärmutter festgebissen, gleich von Anfang an, dagegen konnte selbst die stärkste Hexe nichts tun, so blieb sie eigentlich ihr Leben lang, die kleine Marie, sie biss sich fest und ließ nicht mehr los. Wie eine Zecke wollte sie die Energie aus mir heraussaugen. Aber auch eine Mutter muss Grenzen ziehen.
Ach, sie hat es mir nicht leicht gemacht. Sie war krank, meine Marie, sie muss wohl schon krank auf die Welt gekommen sein, sie war schon immer ein komplizierter Charakter, unselbstständig, eitel, rasend, wenn sich nicht alles um sie drehte. Und nie hat sie gelernt, mich in Ruhe zu lassen. Die Jungs hingegen, Maurice und Antoine, die waren einfacher. Schon früh standen sie auf eigenen Beinen, nur deshalb habe ich sie bei ihrem Vater in der tunesischen Wüste gelassen, sie kamen zurecht, sonst wäre ich doch nie weggegangen mit Claude. Ja, die beiden Jungs lieben ihre Mutter, sie waren mir nie böse deswegen, sie sind oft zu uns gekommen, auf unseren Hof, sogar in unsere kleine Wohnung nach Tunis habe ich sie mitgenommen, ich habe sie nicht verlassen. Bis zu meinem Tod waren sie voller Dankbarkeit für alles, was sie von mir bekommen haben, sie besuchten mich hier in der Rue de Flandre, sie sorgten für mich, oh ja, ich kann mich nicht beklagen, sie waren sogar etwas zu oft hier, wenn man mich fragt. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr Ruhe gebrauchen können in meinen letzten Jahren, nur ein bisschen Ruhe, mehr wollte ich doch nie vom Leben, und meinen Spaß natürlich, wozu kommt man denn sonst auf die Welt? Ein paar Jahre hat man hier, um Spaß zu haben, dann wird man wieder zu Staub, man sollte keinen so großen Wirbel darum machen.
Aber ich habe immer gewusst, wie ich mich aus dem Dreck ziehe. Vier Kinder habe ich großgezogen, und trotzdem habe ich meinen Weg gefunden, von der Tochter eines ausgewanderten Postboten zu einer Grundbesitzerin nahe Tunis, das kann sich doch sehen lassen, oder etwa nicht. In guter Gesellschaft haben wir diniert, wir waren bei den Baliers zu Gast, die haben in Tunis direkt für die französische Verwaltung gearbeitet, ganz direkt. Ich habe für ein gutes Umfeld gesorgt, aber meine Töchter wussten nie zu schätzen, was ich ihnen geboten habe, leicht war das nicht, nach der Rückkehr, ihnen einen guten Lebensstandard zu bieten in Frankreich. Sie waren verwöhnt, ja, das kann ich mir schon vorwerfen, ein bisschen verwöhnt habe ich sie, Marie und Solange. Ich habe alles von ihnen weggehalten, erst den Tod ihres Vaters, dann die Ängste, die ich in Tunesien ausstehen musste, als der Algerienkrieg näher kam, und Bizerte, nach Bizerte mussten wir einfach gehen, wir hatten keine Wahl mehr. Ich habe alles für sie organisiert, den ganzen Umzug nach Frankreich, ich habe sie zu meiner Schwester gebracht und sie hatten eine schöne Kindheit in Selles-sur-Cher, während ich mich um alles kümmerte, ich habe unseren Haushalt nach Frankreich geholt, ich habe uns eine Wohnung in Châteauroux gesucht, ich habe Marie erst auf die katholische Mädchenschule nach Tunis und dann fürs Abitur nach Paris gebracht, damit sie eine ordentliche Ausbildung bekommt. Und ich war es auch, die sie an die gute Literatur herangeführt hat, von mir hat sie die Klassiker bekommen, Proust, Flaubert, Thomas Mann, sonst hätte sie doch nie Literatur studiert, ohne mich. Und ihren Freund, ihren kleinen Freund habe ich mit offenen Armen empfangen in meiner Wohnung, diesen Alain, ich konnte gut verstehen, was sie an ihm fand, ja, Geschmack hatte sie! Er hatte etwas Verwegenes mit seiner Lederjacke, ein bisschen wie Alain Delon, der Schauspieler, er war hübsch anzusehen, das gebe ich zu. Sie hatte eine offene und moderne Mutter, meine Marie, da kann sie sich nicht beschweren.
Und als sie sich schwängern ließ mit ihren zwanzig Jahren! Natürlich, da habe ich alles drangesetzt, um sie zu retten, um ihr mein Schicksal zu ersparen. Alles habe ich drangesetzt! Die kleine Marie war ganz durcheinander, als sie zu mir kam, aber ich wusste, was zu tun ist, ich habe ihr da rausgeholfen, im Gegensatz zu mir hatte sie eine Mutter, die an ihrer Seite stand, ich musste da ganz alleine durch, aber meine kleine Marie kann von Glück sagen, dass wir ihr das Ding so schnell entfernen konnten. Meine Güte, wie am Spieß hat sie geschrien, als es da im Bidet lag, das kleine Stück Fleisch, was hat sie denn gedacht? Dass das Balg wie ein Engelchen in den Himmel fliegt, ein kleiner Hauch, der durch das Zimmer weht? Ein Stück Fleisch war es nach über zwei Monaten, ist doch klar, ist aber doch kein Drama, ein paar Zellen eben, jeden Tag stand ich in der Küche und schnitt und klopfte Fleischzellen, damit sie schön zart wurden, jahrzehntelang tat ich das für meine Mädchen, frisches Lamm oder Kalb, das haben Marie und Solange immer gerne gegessen, mit meinem berühmten Couscous, den mochten sie alle gerne, was macht sie da für ein Drama bei dem kleinen Hautläppchen, meine Güte. Aber natürlich habe ich sie wieder beschützt, wie ich es sonst auch getan habe, ich habe Marie in eine Decke gewickelt und ihr gut zugeredet, ich habe sie auf das Sofa gesetzt, bin zurück ins Bad und habe das Hautläppchen genommen und es ins Klo geworfen, einmal ziehen – und weg war es, mondieu, das machen wir doch jeden Tag mit unserer Scheiße und mit unserer halben Gebärmutter, wenn wir unsere Tage haben und ins Klo bluten, was macht das für einen Unterschied.
Ja, ich habe sie wohl ein bisschen zu sehr verwöhnt, und dafür strafte mich das Schicksal, dafür hatte ich sie weiter am Rockzipfel, sie wollten einfach nicht loslassen. Aber ich habe es wiedergutgemacht, als sie nach all der Zeit zu mir kam, um sich erneut an mich dranzuhängen, da habe ich ihr gezeigt, dass sie auf eigenen Beinen stehen muss, habe sie geschüttelt, wie sie es als kleines Mädchen schon gebraucht hätte, ordentlich geschüttelt, damit sie versteht, dass sie es alleine schaffen muss. Dass ich nicht ewig für sie da sein kann. Denn mondieu, waren fast sechzig Jahre etwa nicht genug? Fast sechzig Jahre lang musste ich mich um sie kümmern, immer wieder, wenn sie völlig am Ende hier auftauchte, betrunken, hysterisch, wo blieb denn da mein eigenes Leben? Maurice hat nur zehn gebraucht, zehn Jahre, dann war er alt genug, um für sich zu sorgen und für seinen kleinen Bruder gleich mit! Aber Marie, als reife Frau kam sie noch bei mir an, das konnte ich nun wirklich nicht akzeptieren, dann wäre ich ja wohl eine Rabenmutter, wenn ich eine Sechzigjährige wieder unter meinen Rock gelassen hätte. Und dann hätte sie mich noch ins Grab gebracht, oh ja, das hätte ihr gefallen, ihre Mutter zu beerdigen. Nein, den Gefallen tat ich ihr nicht, ich habe ihr deutlich gemacht, dass sie jetzt erwachsen werden musste. Dass sie sich nicht mehr an meine Brust hängen konnte. Vielleicht bin ich etwas grob geworden, vielleicht, aber ich denke, die Botschaft ist angekommen. Ja, es war erst einmal ein Drama, natürlich, wie es Maries Art war, musste sie die ganze Welt zusammenbrüllen, oh làlà. »Ich bringe mich um«, ich kann es nicht mehr hören, meine Töchter hatten aber auch einen Hang zur Melodramatik, alle beide, meine Güte, Solange auch, immer dieser Hang zu Tabletten und zum großen Drama. Aber richtig umgebracht hat es sie beide ja doch nie.
Nun habe ich endlich meine Ruhe, eine himmlische Ruhe ist das ohne die Kinder und ihr Gezeter, endlich bin ich wieder eine Frau, keine Mutter, nein, einfach eine Frau. Ich würde schon sagen, dass ich ein glücklicher Mensch war, oh ja, ich war immer zufrieden mit mir, ich wusste, was ich wollte, und ich wusste, wie ich es bekam, ich brauchte keine Hilfe. So ist das, wenn man in sich ruht: Wenn ich die Welt in Ruhe lasse, dann lässt sie auch mich in Ruhe, ganz einfach. Ich hatte gute Gene, ich wusste schon immer, dass ich viel Zeit haben würde auf dieser Erde, maktub, so stand es geschrieben. Vielleicht ist das Allahs Geschenk für die Qualen, die er mir mit den Kindern bereitete, er schickte mich durch diese schweren Prüfungen, damit ich mir mein kleines Leben erarbeite, und mondieu, das habe ich gemacht! Ich habe es mir hart verdient, meine letzte Zeit in der Rue de Flandre, den ganzen Tag nur lesen, schön in meinem Bettchen, während mein Kopf durch die Welt wanderte. Ich las Krimis aus England, Liebesromane aus Kolumbien, historische Romane aus Südfrankreich, ich wanderte durch die Schlösser der Loire, ich hungerte als Bäuerin und stürzte Louis XVI., ich hörte Gottes Stimme als die heilige Jeanne d’Arc, dazu eine feine Zigarette und einen guten Cognac, mehr wollte ich doch nie. Das machte mich glücklich, ja, es stimmt, ich bin glücklich gestorben. In Ordnung, ein bisschen Angst hatte ich schon davor, hier zu vergammeln und keiner merkt es, und dann würden sie meine Leiche nicht mehr finden, sondern nur noch ein paar Hautlappen und Knochen in stinkender Sauce, das ist nicht elegant, darauf konnte ich verzichten. Aber ich hatte einen Trick, einmal am Tag ließ ich mein Buch fallen, immer morgens, so hörte der Nachbar, dass ich noch am Leben war, meine Zigaretten holte mir der Concierge, er hat ganz schöne Augen, der Concierge, das muss ich sagen: diese Augen! Und einmal in der Woche ging ich selbst hinunter und holte mir mein Hühnchen auf dem Marché de Joinville, hmm, das aß ich mit den Fingern, ich löste das heiße Fleisch vorsichtig von den Knochen und lutschte die salzige Haut, wie gut das tat, mit den Kartoffeln, dem zerlaufenen Hühnerfett und ein bisschen Zitrone dazu, himmlisch, eine himmlische Ruhe.
1.Lisa
Die Luft ist voller winziger Nadeln, ganz feine, dünne Nadeln fliegen hinab auf den nassen Asphalt und stechen Lisa ins Gesicht, sie piksen ihr in die Stirn, in die Wangen, und sie würden ihr auch in die Augen stechen, wenn sie sie nicht zusammenkneifen würde, viele kleine Nadeln auf der gerunzelten Stirn. Wie gerne wäre sie im Hospiz geblieben. Im Hospiz mit den roten und blauen und grünen Decken, überall lagen Kissen und Decken herum, warm und weich, aber hier draußen ist alles steinig und kalt und nass, am liebsten würde Lisa in die Gebärmutter zurückkriechen, aus der sie gekommen ist, nur ganz kurz, nur einen Moment, einfach zurück durch die weiche Vagina, wieder im warmen Fruchtwasser schwimmen.
Im Hospiz fühlt sie sich wohl. Das versteht niemand. Lisa merkt es, man glaubt ihr nicht, Anne glaubt ihr nicht, ihre Mitbewohnerin, sie schaut immer so mitleidig, wenn sie nach Hause kommt, und, wie war es, fragt sie. Wie geht es deiner Mutter, das fragt sie lieber nicht. Dabei geht es ihr gut, Lisas Mutter und Lisa geht es wirklich gut, seit sie stirbt, ist alles irgendwie viel einfacher, und im Hospiz fühlt sie sich wohl, weil alle dort sterben oder weil sie Eltern und Freunde oder Kinder haben, die dort sterben, Sterben ist dort ganz normal, anders als hier draußen, hier draußen schauen alle so schockiert, wenn Lisa sagt, dass ihr Mutter stirbt, und alle tun so, als sei das komisch. Überall ist normaler Alltag und Lisa ist die Komische, aber es ist gar nicht komisch, dass ihre Mutter stirbt, es ist ganz normal, und sie ist gerne mit ihr zusammen dabei. Schön war es, sagt sie also, wenn Anne fragt, es war richtig schön, aber Anne glaubt ihr nicht, sie schaut mitleidig, und Lisa weiß, was sie eigentlich hören will. Dass es furchtbar war, will sie hören, so stellt sie es sich vor, das Hospiz, als furchtbaren Ort, an dem alle traurig sind, verzweifelt, weil sie sterben oder weil sie einen sterbenden Menschen besuchen, furchtbar, weil die kleinen sterbenden Kinder auf ihren kahlen Köpfen kleine Tücher tragen und mit ihrem seligen Lächeln wegen der Schokolade in der Hand irgendwie traurig aussehen, furchtbar, weil man alte, sterbende Männer durch die Wände heiser stöhnen hört, husten, stöhnen und rufen, aber das ist doch ganz normal, im Hospiz ist es normal. Es stimmt, das Hospiz bei ihrer Mutter ist der einzige Ort, an dem Lisa sich überhaupt noch wohlfühlt.
Hier draußen nicht, die Häuser, die Straßen, sie meinen es nicht gut mit ihr, sie muss nur eine Sekunde nicht aufpassen, nur ganz kurz nicht aufpassen und schon verrücken sie ein Stück, die Häuser, ganze Straßenschluchten, nur ein bisschen, wenige Zentimeter, sie verrücken und schon fühlt sich die Straße, die einmal Lisas Straße war, fremd an. Lisa ist sich sicher, dass sie das extra macht. Die Straße.
Am Hermannplatz spuckt die U-Bahn sie aus, die blaue 8, sie spuckt sie den gelben Kacheln entgegen und Lisa lässt sich von den anderen die Treppe hochschieben, und oben warten wieder die Nadeln auf sie. Lisa bleibt stehen, sie will da nicht raus, schon kommt der Stoß von hinten, »Ey, träumst du?«, und sie stolpert auf den grauen Platz und knautscht ihr Gesicht wieder unter dem Nieseln zusammen, wie alle hier, Kopfschmerzen und schlechte Laune unter den schwarzen Kapuzen.
Dabei kann Regen ganz anders sein. Oh ja, Regen kann auch weich sein, ganz weich und duftend, ein warmer Sommerregen, wie gut er riechen kann auf einer heißen, staubigen Straße, ach, wäre doch nur Sommer, im Sommer wäre das ganz sicher nicht passiert, niemals würde ihre Mutter sterben, während die Schwalben den Sonnenuntergang anschreien, da würde sie sicher nicht im Hospiz liegen, nein, da würde sie Richtung Süden fahren, bis ans Mittelmeer. Der Herbst ist schuld, mit seinen fallenden Blättern kam der Knoten, ohne diese Dunkelheit hätte sie doch nie an ihren Hals gefasst, die Kälte fuhr ihr in die Knochen, die Kälte und die Feuchtigkeit, keine Sonne weit und breit, um sie richtig zu trocknen, und dann dieser spitze Nieselregen hier, der ist doch einfach nur scheiße, überhaupt findet Lisa es nicht richtig, wie es gerade läuft, es läuft absolut nicht richtig. »Es läuft nicht richtig, Maman«, das wird sie ihr später sagen, das ist doch nicht richtig, mit der Bankkarte ihrer Mutter zur Sparkasse zu gehen, um Geld von ihrem Konto auf das Konto der toten Großmutter zu überweisen, für eine Wohnung, in der sie beide jetzt nicht mehr leben werden, Mamie nicht und Lisas Mutter auch nicht, das ist doch nicht richtig.
Lisa drückt die Tür zur Sparkasse auf, die warme Luft lässt ihre Brille beschlagen. Sie geht zum Automaten und holt die Karte aus ihrer Tasche, ihre Mutter hat sie noch immer in dieser Plastikhülle, die hat Lisa schon lange nicht mehr, sie schiebt die Karte aus der Hülle und in den Automaten, der nach der PIN fragt, sie tippt 6734 und klickt auf Überweisung, sie schreibt Citya Immobilier, sie tippt 946,57 Euro, meine Güte, 946,57 Euro Nebenkosten im Quartal, das macht ja über 300 Euro pro Monat, kein Wunder, dass sich ihre Mutter und Tata Solange immer wegen der Nebenkosten gestritten haben, über 900 Euro im Quartal, so viel zahlt Lisa ja Miete und Nebenkosten zusammen für ihr WG-Zimmer, wie viel müsste man wohl für die Rue de Flandre Miete zahlen, das kann sich doch keiner mehr leisten, eine so große Wohnung in Paris, und dann auch noch Innenstadt. Kein Wunder, dass ihre Mutter keine eigene Wohnung in Paris mieten wollte, sie wollte darauf warten, dass Mamie stirbt, über hundert war sie, da kann man wohl davon ausgehen, dass man die Wohnung bald übernehmen wird, seit zwanzig Jahren ging Lisas Mutter davon aus, seit es im Testament so geregelt war. Schon zu ihren Lebzeiten überschrieb Mamie die Wohnung an Lisas Mutter und Tante, und Tata Solange ließ sich von Lisas Mutter ihre Hälfte auszahlen, weil Lisas Mutter in die Wohnung einziehen wollte, nach Mamies Tod. Aber Mamie starb nicht, sie sagte es ja. »Wenn ich sterbe, dann nehme ich dich mit mir ins Grab«, das sagte sie zu ihrer Tochter, und jetzt passiert es also, jetzt ist Lisas Großmutter gestorben und nimmt Lisas Mutter mit sich ins Grab.
Der Zigarettenrauch kommt Lisa schon im Flur entgegen, im blau, gelb und rot bemalten Flur, sie kann riechen, hinter welcher Tür ihre Mutter wohnt. Sonst würde ihre Mutter hier auch keine fünf Minuten bleiben, wenn sie hier nicht rauchen dürfte, keine fünf Minuten. »Marie Bellanger« steht an der Tür, vorher stand hier ein anderer Name, aber Lisa erinnert sich nicht mehr an ihn, es ist wie im Hotel, überlegt sie, sobald man ein Zimmer bezieht, kann man sich nicht mehr vorstellen, dass jemand anderes dieses Bett vor einem beschlief, dass ein anderer Kopf auf dem Kissen lag, man ist Herrscherin des Zimmers, Herrscherin der Gegenwart, alles andere existiert nicht, weder Vergangenheit noch Zukunft. Marie Bellanger. Herrscherin der Gegenwart.
Lisa öffnet die Tür und taucht in den Rauch ein. »Maman, ich finde, es läuft gerade falsch«, sagt sie, »irgendwas läuft hier falsch. Ich kann doch nicht das Geld meiner sterbenden Mutter auf das Konto meiner toten Großmutter überweisen. Das ist doch scheiße.« Ihre Mutter lacht, ihre braunen Augen sprühen noch immer, wenn sie lacht, sie werden ganz feurig und sprühen rebellische Funken, »oh ja«, lacht sie, schlurft zu ihrem Nachttisch, um sich eine neue Zigarette zu holen, »oh ja, ma chérie, ich sage dir, es läuft absolut nicht richtig.« Wie sie darüber noch lachen kann. An Halloween vor ein paar Wochen wurde sie am Hals operiert, die Chirurgen schnitten einen Teil des Knotens heraus, um zu sehen, ob es Krebs ist. Sie saß auf ihrem Bett, im weißen Krankenhaushemd, die Haare abstehend, kalkweiß im Gesicht, um die Augen dunkle Ringe, aus ihrem Hals kam ein Schlauch voller Blut, der in einem kleinen Fläschchen endete, es baumelte vor ihrer Brust hin und her, halb mit Blut gefüllt, so saß sie auf dem Bett, als Lisa reinkam, und strahlte sie an. Sie beugte sich nach vorne, rieb ihre Hände gegeneinander und sagte: »Happy Halloween, Lisa! Na, wie gefällt dir mein Kostüm?« Beim Lachen rutschte ihr ein Auge zur Seite weg, wie immer, wenn sie müde oder krank war, da musste auch Lisa lachen, sie setzte sich zu dieser Untoten auf das Bett und lachte mit ihr, »meine Maman.«
Jetzt hat sie sich daran gewöhnt, an den neuen Anblick ihrer Mutter, das Gesicht aufgequollen von den Medikamenten, der Körper im Gegenteil zusammengeschrumpft, ganz klein der dünne Körper, den Lisa nicht mehr anfassen darf, nur ihre Hand darf sie manchmal nehmen, ihre Finger sehen aus wie immer, schöne, zarte Finger hat sie, ganz kleine Hände. Lisa gibt ihr einen Kuss auf die Wange und setzt sich an den Tisch am Fenster, das wie immer geschlossen ist, Lisa versucht gar nicht erst, darüber zu diskutieren, sie weiß schon, was ihre Mutter sagen würde, bist du wahnsinnig, würde sie sagen, es ist Winter, draußen herrscht eine riesige Kälte, willst du mich umbringen, geht es dir nicht schnell genug?
»Hier, Maman, die Quittung«, sagt Lisa und holt den zerknitterten Zettel aus ihrer Hosentasche. Ihre Mutter setzt sich gegenüber an den Tisch, lehnt sich zurück, schlägt ihre Beine übereinander, legt ihren Bademantel auf ihren Knien zurecht und zündet sich ihre Zigarette an. »Aber nein, Lisa«, sagt sie, dann fängt sie an zu husten, eine trockene Aschelawine, sie hustet, ohne Luft zu holen, bis die Lunge zusammengeklebt ist, bis sie anfängt zu würgen, gleich kommt die ganze verdammte Lunge raus, so hört es sich an, als würde gleich die ganze schwarze, verteerte Lunge aus ihrem Hals springen. Sie läuft rot an, dann schafft sie es, Luft zu holen, tief holt sie Luft und hustet dann weiter, »aber nein«, hustet sie, »behalte du das alles!«
Lisas Magen wird ein Knoten, er zieht sich zu einer Erbse zusammen, das kennt sie schon, das tut er immer, wenn er eine Information verstanden hat, die ihr Kopf noch gar nicht kapiert, er faltet sich zusammen wie die Lunge ihrer Mutter, ihr Kopf aber schnallt es einfach nicht, »aber nein«, sagt sie, »nein, wieso, hier, das muss zu den Unterlagen für die Wohnung, das muss in deinen Ordner!« Ihre Mutter nimmt sich das Glas Wasser vom Tisch und trinkt ein paar Schluck, ihre Hand zittert dabei. Sie räuspert sich, sie schaut Lisa an, ihre braunen Augen sind ganz groß und klar, sie will ihr etwas sagen mit diesen Augen, aber Lisas Kopf hört weg, noch immer. »Mach es mir doch nicht so schwer«, flüstert sie. »Du musst dich jetzt um die verdammte Rue de Flandre kümmern. Mamie ist tot, ich sterbe bald, sie gehört jetzt dir. Du musst die Unterlagen sammeln. Du musst den Überweisungsschein behalten. Du musst den Ordner aus meiner Wohnung holen.« Lisa lässt den Zettel sinken. Jetzt versteht sie. Ihre Mutter kümmert sich ab jetzt nicht mehr um die Wohnung, weder sie noch ihre Großmutter, beide kümmern sie sich nicht mehr darum, denn jetzt ist nur noch Lisa da, jetzt gibt es nur noch sie. Diese verdammte Wohnung überspringt einfach eine Generation und landet bei ihr, alles landet bei ihr, auch der verdammte Ordner mit den Papieren, einfach alles, was Mamie gehörte und was ihrer Mutter gehörte, gehört bald Lisa, und jetzt versteht sie, was ihr Magen sagen wollte, merde, wollte er sagen, putain de merde.
Die Rue de Flandre hieß immer nur »verdammte Rue de Flandre«, seit Lisa denken kann. Irgendwann stieg sie zur Avenue de Flandre auf, aber so wird sie nicht genannt, »diese verdammte Rue de Flandre, Mamie hat mich damit übers Ohr gehauen!«, das sagte Lisas Mutter immer. »Sie macht nur Ärger, diese Wohnung!« »Du hattest nur Ärger mit der Wohnung, und jetzt habe ich sie an der Backe«, sagt Lisa, und ihre Mutter lacht, »stimmt!«, lacht sie, »das stimmt, und weißt du, wer mir das vorhergesagt hat?« Lisa lacht jetzt auch, es stimmt, es trifft alles ganz genau ein. »Ja«, sagt sie, »weiß ich. Mamie hat es vorausgesagt. Sie hat gesagt, dass du nicht mit dieser Wohnung planen sollst.« Denn mit Mamies Worten ist Lisa aufgewachsen, immer wieder hat ihre Mutter sie zitiert. »Plane nie mit dieser Wohnung, ma chérie«, hat Mamie gesagt. »Plane nie mit dieser Wohnung, denn wenn ich sterbe, nehme ich dich mit mir ins Grab.«
»Sie wollte nie, dass ich darin wohne, ich bin mir sicher, dass sie deshalb so alt geworden ist, hunderteins, wer wird denn sonst noch hunderteins, und noch dazu rauchend und trinkend? Sie wollte partout nicht, dass ich in ihrer Wohnung wohne, das hat sie mir nicht gegönnt, und als sie erfahren hat, dass ich sterben werde an diesem verdammten Krebs, da hat sie sich fallen lassen, ich sage dir, das hat sie extra gemacht.« Lisas Mutter zündet sich noch eine Zigarette an.
Mamie ist hingefallen und hat sich die Hüfte gebrochen, und dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht und operiert, sie haben die über hundert Jahre alte Frau noch einmal operiert, und sie ist tatsächlich wieder aufgewacht nach der OP, aber dann war sie zu schwach. »Wenn du sie noch einmal besuchen willst, solltest du das jetzt machen«, schrieb Tata Solange an Lisa. »Es geht ihr nicht gut, lange macht sie nicht mehr.« Aber Lisa war es egal, ihre Mutter lag im Krankenhaus und ob ihre Großmutter nun ebenfalls starb oder nicht, das war ihr egal. Ein paar Tage später kam dann die zweite Mail aus Paris, »Mamie ist gestorben«, schrieb Tata Solange, »gestern ist sie eingeschlafen, sie ist einfach eingeschlafen. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung deine Mutter ist, entscheide du, ob du es ihr sagst. Alle sterben, meine Mutter, meine Schwester, wer weiß, wann ich geholt werde.«
Eigentlich hat Lisa immer gedacht, dass sie erleichtert sein würde, wenn Mamie endlich gestorben ist. Sie würde erleichtert sein, weil ihre Mutter dann endlich frei wäre, weil sie sich nicht mehr vor dem Tod von Mamie fürchten würde, sondern endlich in die Rue de Flandre ziehen und nicht mehr auf Mamie warten würde. Aber dann war es Lisa einfach egal.
»Mamie ist gestorben«, hat sie ihrer Mutter am nächsten Tag gesagt. Es ist nicht lange her, sie saßen hier am kleinen Tisch im Hospiz, und ihre Mutter zuckte nur mit den Schultern. »Natürlich«, sagte sie und zündete sich eine Zigarette an. »Natürlich ist sie jetzt gestorben. Weil auch ich jetzt sterbe.« Und Lisa nickte.
»Weißt du, du kannst mit der Wohnung machen, was du willst, Lisa«, sagt ihre Mutter jetzt, sie drückt ihre Zigarette im Aschenbecher aus. »Es ist deine Entscheidung. Aber wenn du mich fragst, ich rate dir: Verkaufe sie. Verkaufe sie, so schnell es geht. Diese Wohnung hat immer nur Ärger gebracht.« Lisa lächelt. Das hat sie ihr selbst immer geraten: Verkaufe die Wohnung einfach, wenn Mamie stirbt. Sie tut dir nicht gut, und du willst doch nicht zwischen den Wänden deiner toten Mutter leben, die dich nie dort haben wollte, die sie dir nie gönnte, das kann dir doch nicht guttun. Werde die Wohnung los, so schnell es geht, hat sie ihr gesagt. Und jetzt muss sie es eben tun, sie muss sie verkaufen, vielleicht muss sie dafür nicht einmal nach Paris fahren, vielleicht geht das auch von Berlin aus. »Ja, ich werde sie verkaufen«, sagt Lisa. Ihre Mutter sagt nichts mehr, sie ist in Gedanken schon wieder woanders, sie wird müde, Lisa sieht es, die Hand, die ihre Zigarette hält, zittert, ihr rechtes Auge rutscht immer wieder zur Seite, sie starrt vor sich hin. Es ist Zeit zu gehen. Lisa steht auf und gibt ihr drei Küsse auf die Wange, »meine Maman, meine Maman, meine Maman.« Als sie aus dem Hospiz auf die Straße tritt, ist es dunkel geworden. Der Nieselregen hat sich in Schnee verwandelt, nicht in die schönen, dicken Flocken, sondern in kleine, harte, stechende Schneeflocken. Das ist nicht gut, denkt Lisa. Ihre Mutter hasst Schnee.
2.Marie
Es war mein Land. Ich kannte jeden Winkel der Felder, ich kannte die kleinen Schleichwege, die Wiesen, auf denen im Frühling besonders viele Mohnblumen wuchsen, ich wusste, wann der oued Wasser führte und wann er nur aus Sand bestand, ich kannte jeden Olivenbaum, Oleanderbusch und jedes Vogelnest, ich wusste immer, welcher Kaktus gerade reife Früchte trug und welche Katze gerade wo geworfen hatte, und ich kümmerte mich um die Kätzchen und die Vögelchen und die Jasminblumen, denn es würde ja alles mir gehören. So hat dein Großvater es mir gesagt. Es war ein warmer Sommerabend nach einem glühend heißen Tag, die Sonne ging gerade unter, und wir standen vor unserem Haus auf der Terrasse und schauten über die Hügel voller Weizen, breitbeinig auch ich, denn ich wollte ja mithalten. »Das alles wird einmal dir gehören, ma petite chérie«, sagte er mir, ich weiß es noch genau, und dann streichelte er mir mit seiner rauen Hand über den Kopf, »das wird alles einmal dir gehören.«
Ach, meine Lisa, ich weiß nicht, was willst du wissen? Es ist eine lange Geschichte, weißt du. Eine lange Geschichte. Ich hatte in Tunesien ein wildes Leben, ma petite chérie, ich stromerte allein über die Felder, ohne Aufsicht, und die meisten Abende verbrachte ich bei den Arabern, bei Ulimas Familie. Ulima war unsere Kinderfrau, unsere nounou, sie verbrachte die Tage bei uns, ich hatte sie sehr gerne, sie wickelte mich immer in ein Bettlaken und zog dann an einem Ende, sodass ich mich ganz schnell drehte und über das Bett herauskullerte, das machte mir viel Spaß, das spielten wir oft, bevor meine Schwester Solange geboren wurde. Die meisten Abende aß sie mit ihrer Familie bei uns, denn Mamie ließ es sich nicht nehmen, die großartigsten Gerichte zu kochen, poulet au citron, Kalbsbraten, Lammkoteletts, cassoulet, und natürlich ihren berühmten Couscous, wenn mein Vater die Glocke läutete, kamen die Arbeiter von den Feldern, wuschen sich und setzten sich zu uns an den Tisch.
Sie aßen gerne bei uns, meine nounou und ihr Mann Suleiman und die drei Kinder. Mit den beiden Jungs spielte ich nie, aber ich liebte Aisha, ihre älteste Tochter. Aisha war so alt wie ich, wir wuchsen wie Schwestern auf, schon mit drei zankten wir uns darum, wer mit den Kätzchen spielen durfte. Sie hatte glänzende, tiefschwarze Locken, die ich bewunderte, denn meine waren zwar auch schwarz, aber glatt und langweilig, und während Mamie mir meine Haare in Tunis immer kurz schneiden ließ, trug Aisha ihre ganz lang über ihren Rücken, oft fielen ihr die Locken ins Gesicht und dahinter blitzten mich ihre mandelförmigen Augen an. Wenn meine nounou am Freitag nicht zum Abendessen kam, lief ich zu ihnen in das kleine Häuschen am Ende des Chilifeldes, denn mein Vater baute Chili und Weizen an. Ich lief also unseren Hügel hinunter, dann den kleinen Pfad am Weizenfeld entlang, nicht den langweiligen breiten Weg, den unser Auto immer nahm, sondern den schmalen Pfad, der an den Olivenbäumen der Nachbarn vorbeiführte, und ich begann zu rennen, rechts Oliven, links Chilischoten, unter mir fühlte sich die rote Erde so wunderbar fest an, dass ich glaubte zu spüren, wie ich auf der Weltkugel tanzte, während sie sich drehte. Manchmal blieb ich stehen, pflückte eine reife Schote und brachte sie Aisha mit, wohl wissend, dass sie von mir verlangen würde, hineinzubeißen. Natürlich biss ich hinein, ich musste ihr ja beweisen, dass ich eine echte Tunesierin war wie sie, dann brannte die Schärfe mir auf der Zunge und im Rachen, doch niemals fragte ich nach Baguette und Wasser zum Löschen, niemals, ich zeigte es ihr, ich war eine von ihnen.
Meistens gab es Couscous bei Ulima, und nie hätte ich es laut gesagt, aber ich fand, er schmeckte fast besser als Mamies, weil wir Kinder bei Aisha mit den Händen essen durften und auch mit den Fingern schmeckten, ich stopfte mir den mit Sauce vollgesogenen Couscous in den Mund und biss von der Merguez ab, dann leckte ich mir die rote, fettige Sauce von den Fingern und lachte Aisha an, deren Mund auch ganz rot war. Aisha brachte mir auch etwas Arabisch bei, das meiste habe ich vergessen, khobz heißt Brot, siehst du, das weiß ich noch. Ich war immer neidisch darauf, wie Aisha und Ulima fließend vom Französischen ins Arabische fielen, mitten im Satz wechselten sie plötzlich die Sprache und ich verstand nichts mehr, bis sie genauso plötzlich wieder Französisch sprachen. Aisha hatte Mitleid, man könne doch nicht nur mit Französisch durchs Leben kommen, das sei ja traurig, sagte sie, also setzten wir uns auf unsere zwei Steine unter den Zitronenbaum, den Mamie im Hof gepflanzt hatte, und lernten. Manche Worte trieben mir noch lange den süßen Duft der Zitronenblätter in die Nase, sie duften so gut, wenn man sie zwischen den Fingern reibt, weißt du, ich konnte sogar einige Sätze, aber das habe ich alles vergessen, bof, das ist so lange her.
Mamie fand gut, dass ich so viel mit meiner nounou und Aisha beschäftigt war, »mit den Arabern«, wie sie sagte, das war ihr recht. Hauptsache, ich war aus dem Haus, nur ein bisschen zu dreckig fand sie mich immer, wenn ich nach Hause kam, mit roten Saucenfingern und Füßen voller Erde, »warst du wieder bei den Arabern, du Dreckspatz«, sagte sie dann und schickte mich ins Bad.
Weißt du, ich glaube, Mamie hat das Leben dafür verflucht, ihr ausgerechnet dann eine Tochter verpasst zu haben, als sie sich endlich von ihrem ersten Mann und ihren zwei Söhnen befreit hatte. Nicht, dass der Mann, mit dem sie vor deinem Großvater zusammengelebt hatte, nicht in Ordnung gewesen wäre, das war er eigentlich schon. Jedenfalls hat sie nie erzählt, dass er sie geschlagen hätte oder so, und sie hat nie ein Geheimnis für sich behalten, wenn er sie schlecht behandelt hätte, dann hätten wir diese Geschichte gehört, wieder und wieder. Nein, er muss in Ordnung gewesen sein, ihr erster Mann, aber trotzdem war sie mit ihm unglücklich, es war wohl die Langeweile. Ihr erster Hof lag im südtunesischen Nirgendwo, fast schon an der algerischen Grenze, die Gegend habe ich dir nie gezeigt, ma chérie, das ist eine sehr triste Region, keine Berge, kein Grün, selbst das Meer ist weit, alles ist trocken und staubig und irgendwie beige. Niemals kam Besuch vorbei, niemals wurde Mamie zum Abendessen eingeladen, und zum nächsten Kino waren es Stunden mit dem Auto. Natürlich, sie hatte sich gesellschaftlich verbessert, wie sie es sich als junges Mädchen vorgenommen hatte, ihr Vater war Postbote gewesen und jetzt gehörte ihr immerhin ein kleiner Hof, aber sie fühlte sich einfach zu einsam in der Wüste. Sie hatte zwei Söhne dort, das weißt du ja, deinen Onkel Antoine und deinen Onkel Maurice, die verbrachten ihre Tage draußen auf den Feldern, und auch sie hatten eine Kinderfrau, die sich um sie kümmerte.
Mamie aber verbrachte ihre Tage depressiv im Bett, sie verging vor Langeweile in ihrem beigen Leben, bis mein Vater vorbeikam, also dein Großvater. Claude.
Claude war ein Freund der Familie, er wollte sich um die Geräte auf dem Hof kümmern, denn weißt du, dein Großvater hatte immer ein Händchen für Automobile, Traktoren und Maschinen, er konnte alles reparieren, das hatte er auf der Landwirtschaftsschule gelernt, und so wurde er von seinem Vater manchmal losgeschickt. Mamie verliebte sich auf der Stelle. Er sah gut aus, dein Großvater. Du kennst ja die Fotos, mit seinen pechschwarzen Haaren, elegant nach hinten gekämmt, dem starken Kinn und den ausgeprägten Wangenknochen. Sein feines Gesicht wirkte fast ein bisschen weiblich, aber keineswegs schwach. Seine Kleidung war elegant, er hatte eine gute Ausbildung in Tunis genossen und machte große Augen, als er Mamie erblickte.
Claude blieb zwei Wochen zu Besuch, dann wollte er auf den Hof seiner Eltern zurückkehren, gar nicht weit von Tunis, in der Nähe von Zaghouan. Als Mamie ihn am letzten Abend küsste, küsste er sie zärtlich zurück. »Zurückhaltend«, erzählte sie immer, er habe eben ihr die Entscheidung überlassen. »Ich möchte mit dir gehen«, sagte sie, und er lächelte, hievte ihren Koffer in sein Auto und nahm sie mit. So verließ Mamie ihren ersten Mann. Mir erzählte sie, dass Antoine und Maurice gar nicht traurig waren, als sie sich verabschiedete. Wenn du mich fragst, ich kann mir schon vorstellen, wie meine Brüder sie still angeschaut haben, ohne Regung, aber ich bin mir sicher, dass sie sich die Augen ausweinten, abends in ihren Betten, denn Mamie brachte uns schnell bei, unsere Traurigkeit nicht zu zeigen. Sie wurde immer wütend, wenn wir weinten. Also ließen wir es.
Auf dem Land von Zaghouan warteten einige Monate des Glücks auf Mamie. Das kleine Haus, das Claude von seinem Vater bekam, war bescheiden – nicht wie Bou da! Mondieu, Bou da, so hieß der prächtige Gutshof meiner Großeltern, was für eine Villa, an der Straße zu Depienne, ganz weiß gestrichen, mit ihrem Glockenturm strahlte die Villa kilometerweit über die Felder, die Fensterläden und die Tür waren ebenso blau wie der Himmel darüber. Zur Pforte führten ein paar Stufen, über sie gelangte man in einen großen Salon, von dessen hoher Decke ein Kronleuchter hing, das Haus hatte zwei Küchen, schließlich musste hier für zehn Arbeiter und eine große Familie gekocht werden, es gab zwei Bäder und sicher sechs Schlafzimmer, in jedem davon war ein kleiner Kamin, und wenn man die Treppe bis ganz hinauf auf das Dach stieg, konnte man die Felder bis ganz hinten zu unserem kleinen Hügel überblicken und auf der anderen Seite sogar bis zu den Bergen von Zaghouan sehen, die im Sommer in der Hitze flimmerten und im Winter von Wolken gestreichelt wurden. Wenn mein Großvater die große Glocke auf dem Dach von Bou da läutete, konnte man sie ganz bestimmt bis Depienne hören.
Das Haus, das Claudes Eltern ihm und Mamie überließen, hieß Mezreg, es war nicht halb so groß, es hatte gerade mal zwei winzige Schlafzimmer, eine kleine Küche und einen Salon – doch als Mamie dort einzog, hatte sie es geschafft. Sie gehörte nun zur Familie Bellanger, und die Familie genoss in Tunis einiges Ansehen. Dass Claudes Eltern Mamie von Anfang an als Neureiche ablehnten, war ihr egal. Sie hatte bekommen, was sie wollte: ein wenig Prestige, Zugang zu den guten Kreisen der französischen Gesellschaft und einen Mann, der sie nicht nur abgöttisch liebte, sondern der ihr auch ihre Freiheiten ließ.
Mein Vater verbrachte die Tage auf dem Feld oder im Büro und die Abende in der Garage, um an alten Automobilen und Traktoren herumzubasteln. Er liebte die Technik, diese enorme Potenz in seinen Händen, so sah er die Maschinen, als potenzierte Menschenkraft, »die uns den Göttern ein Stück näher bringt«, wie er sagte. Eines Tages kaufte er sich eine Kamera, die waren damals sehr selten, nur wenige konnten sie sich leisten. Er kaufte sie sich und fing an, das Pflügen der Felder aufzunehmen, in Nahaufnahme, von allen Seiten filmte er, wie der eiserne Pflug die satte rote Erde aufwühlte, wie er sich in sie hineingrub, wie Pflug und Erde miteinander spielten, ein Liebesspiel der Elemente. Er hatte einen beinahe pornografischen Blick auf die Landwirtschaft, dein Großvater, er stellte sich vor, die reife tunesische Erde zu befruchten wie den Körper seiner Frau. Und er liebte es, dass er durch die Technik sogar in die Luft aufsteigen konnte, er wollte den Himmel gar nicht erobern, es ging ihm nicht um Macht, ich glaube, er liebte es einfach, abzuheben, sich von der Erde zu entfernen, die ihn bannte, ihn festhielt, und er liebte es auch, die Kraft des Motors unter sich vibrieren zu spüren.
An den Wochenenden fuhr er zum Flugplatz und kreiste über unseren Ländereien. Seine Fliegermütze stand ihm gut, und jedes Mal, wenn Mamie ihn zum Flugplatz begleitete, verliebte sie sich von Neuem in ihn. Doch niemals stieg sie mit in das Flugzeug, niemals. Deine Großmutter zog es vor, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Sie las in ihren Büchern, bis Papa aus dem Himmel zurückkehrte.
Es war ein glückliches Leben, erzählte Mamie immer, bis sie eines Morgens mit einem elenden Gefühl im Magen aufwachte. Alles in ihr zog sich zusammen. Sie hielt sich erschrocken die Hand vor den Mund, sprang aus dem Bett und rannte zur Toilette. Heftig musste sie sich übergeben. Mit wackeligen Beinen stakste sie zurück ins Bett und zog sich die Decke über ihre Nase. Sie wusste bereits, was das bedeutete. Die Übelkeit hielt an, und auch ihre Tage wollten einfach nicht kommen. Mamie wollte nicht schwanger sein, auf keinen Fall. Sie hasste ihren Bauch dafür, dass er langsam größer wurde, abends trommelte sie wütend mit ihren Fäusten auf ihn ein, was soll ich sagen, sie hatte damals schon Spaß dran, mich zu schlagen.
Aber ich muss auch sagen, ich verstehe sie ein bisschen, Lisa, wirklich, ich verstehe sie. Sie bekam es mit der Angst zu tun. Sie wollte endlich das Leben genießen, allein, sie wollte keine Kinder mehr, sie wollte ein Leben führen, das sich um sie drehte, und darauf hatte sie ja eigentlich ein Recht, oder nicht? Die Verhütung war damals nicht so einfach wie heute, weißt du. Das Gefühl, eine fremde Macht habe von ihrem Körper Besitz ergriffen, muss überwältigend gewesen sein. Mamie fühlte sich dem fremden Wesen in ihrem Unterleib ausgeliefert, das sich dort gegen ihren Willen eingenistet hatte. Sie wollte in ihrem Körper alleine sein, über ihn verfügen können, sie wollte ihre Ruhe haben und ihr kleines Leben mit deinem Großvater genießen, und auf keinen Fall wollte sie ihn mit einem unwillkommenen Geschöpf teilen, das ihr ruhiges Leben schreiend und brüllend zunichtemachen würde. Sie verfluchte den Samen meines Vaters, und sie verfluchte ihre eigene Fruchtbarkeit.
3.Lisa
Lisa hatte sich vorgenommen, in die Wohnung zu gehen. Einfach reingehen, hat sie sich gesagt. Sie hat die Métro bis Crimée genommen, die Linie 7, diese rosa Linie, von Châtelet über Stalingrad bis Crimée konnte sie einfach durchfahren, sie hat die Stationen gezählt, wie sie es als Kind so gerne mochte, es sind vierzehn, und dann ist sie bei Crimée ausgestiegen, in Fahrtrichtung die Treppe hochgestiegen, dann nach links, wieder die Treppe hoch, und oben stand sie schon direkt vor dem Monoprix, nur wenige Meter von dem großen grünen Tor entfernt, das mit diesem glatten, vollen Klacken aufging und sie in das verwinkelte Gebäude einließ. Sie ist an dem Steinfeld vorbei durch den kleinen Hof mit den eckigen Bäumen gelaufen, die erste Treppe zur Zwischenebene hoch auf die Galerie, dann hat sie den Weg nach rechts zu Mamies Aufgang genommen, falsch, hat sie sich gesagt, falsch, es ist nicht mehr Mamies Aufgang, es ist jetzt deiner, sie ist also links abgebogen und hat an der Zwischentür geklingelt, um in den Wohnturm zu kommen, und dann hat sich nicht Mamies krächzende Stimme gemeldet, Mamie hat nicht »allô?« gekrächzt, sondern Larissa hat sie reingelassen, Larissa, die Freundin von Lisas Mitbewohnerin Anne, Lisa fand sie nett, als sie sie in Berlin getroffen hat, »Hallo« hat sie gesagt, auf Deutsch, mit H, und hat Lisa reingelassen, und dann hat sie den Fahrstuhl genommen bis hoch in den siebten Stock, und nun steht sie hier vor der Wohnung, vor Larissa, und irgendwie kann sie doch nicht einfach in die Wohnung gehen, weil sie etwas aufhält, und Lisa fragt sich, was das ist. Vielleicht der Geruch. Lisa hatte nicht an den Geruch gedacht, denn natürlich, die Wohnung riecht nach Piment, Paprika und Zimt, gemischt mit abgestandenem Zigarettenqualm und modrigem Moschus, nach alter Frau in ungewaschenem Hauskleid mit Blümchenmuster. Natürlich, die Wohnung riecht nach Mamie.
Larissa öffnet die Tür ein Stück weiter. »Komm doch rein«, sagt sie und lächelt dabei, »komm doch rein, willkommen in deiner Wohnung!« Lisa macht einen Schritt nach vorne. »Salut, schön, dass du endlich hier bist!«, sagt Larissa und macht die Tür hinter ihr zu, und Lisa steht in der Rue de Flandre.
Die noch helle Abendsonne scheint von links durch das große Balkonfenster, Staubteilchen tänzeln im gelben Licht, das den alten Möbeln einen goldenen Schimmer verleiht. Und rechts, rechts liegt der dunkle Flur, der an den Bücherregalen und dem großen schwarzen Wandschrank vorbei zur Küche führt, dann zu den Schlafzimmern weiter hinten in der Wohnung, und zum Bad. Lisa blickt in den Flur und wundert sich, denn eigentlich müsste doch ihre Großmutter gleich aus diesem Flur kommen, Mamie, eine Zigarette im Mundwinkel, eigentlich müsste sie kommen und »Lisa!« krächzen, Lisa, ma petite fille, aber da kommt niemand. Nur Larissa, Larissa steht noch immer neben der Tür, schaut Lisa an und wartet. »Salut«, sagt Lisa, und Larissa lächelt, ihre Augen werden ganz groß und braun, groß, braun und besorgt. Lisa schaut weg, sie schaut sich das Wohnzimmer an.
Larissa hat die Tapete abgerissen. Die Möbel stehen noch an ihrem Platz, links die Anrichte, rechts die Truhe, geradeaus der große Esstisch vor dem Balkon. Aber die Tapete ist abgerissen, so genau weiß Lisa nicht mehr, wie sie ausgesehen hatte, braun vielleicht, oder gelb, aber jetzt ist sie weg. »Ihr habt die Tapete abgerissen«, sagt sie, »ja«, sagt Larissa, »ja, ich hoffe, das war okay, aber die Wohnung war in einem krassen Zustand, ehrlich gesagt, sie war ganz schön verdreckt, und die Tapete … sie war sehr alt, deine Oma, oder?« »Sie hieß Mamie«, sagt Lisa und schiebt hinterher, weil es ja nicht stimmt, weil sie ja Lucile hieß eigentlich, »wir haben sie Mamie genannt.« Larissa nickt: »Ja, stimmt, hier heißt das Mamie.« Sie sagt es richtig, Mamie, mit Betonung auf der letzten Silbe. Nicht wie im Deutschen, Mami.
Lisa setzt sich an den Tisch, an den massiven Holztisch im Wohnzimmer. Sehr alt, ja, sehr alt war Mamie wirklich. »Sie ist über hundert Jahre alt geworden«, sagt sie, »aber ich habe sie lange nicht mehr gesehen«, viele Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal in Paris war, sie erinnert sich noch genau, das war bei diesem Couscousessen. »Willst du einen rouge?«, fragt Larissa, und Lisa lächelt, jetzt lächelt sie doch. Weil Larissa es so schön sagt. Einen rouge. »Ja, einen rouge hätte ich jetzt wirklich gerne.«
Früher traf sich die Familie hier jeden Sonntag zu Mamies Couscous. Einmal war Lisa dabei, vor sechzehn Jahren. Sie legt ihre Wange auf das Holz, das sich gut anfühlt, schön fest, und es riecht auch gut. Lisa atmet tief ein, Holz und Gewürze. Ras el-Hanout, ja, der Tisch riecht nach Couscousgewürz. Lisas Mutter war immer so streng mit der richtigen Mischung, nicht zu viel Zimt, erinnert sie sich, Paprika, ein bisschen Piment, und was noch? Maman, wie sie die Gewürze im Mörser mischt, Lisa sieht sie genau, Maman, lächelnd und mit roten Wangen, »und jetzt kommt das Wichtigste«, sagt sie, »das Geheimnis jedes guten Couscous, nicht leicht zu bekommen in Deutschland!« Mist. Sie kommt nicht drauf. Aber dieses Holz. Dieses Holz tut gut. Unter diesen Tisch ist sie immer gekrochen, als sie noch klein war, die kleine Lisa ist hier unter den Tisch gekrochen und ist um die Beine der Erwachsenen gestrichen wie eine Katze, und dann hat Tata Solange die Tischdecke gehoben und sie angelacht, »oh, kleine minou, da ist ja ein Kätzchen!«, hat sie gerufen und Lisas Kopf gestreichelt, und Lisa hat geschnurrt.
Mit zwei Gläsern Rotwein in der Hand kommt Larissa aus der Küche. Dabei hüpft sie leicht, als hätte sie kein Gewicht, Lisa ist es, als würde Larissa durch die Wohnung tanzen, oder nein, als würde sie wehen, als würde sie durch die Rue de Flandre geweht werden wie einer dieser Steppenläufer in der Wüste. »Was für einen Wein hast du besorgt?«, fragt Lisa, »ein Touraine kann sehr gut schmecken«, hat ihre Mutter ihr oft gesagt, »wenn man den richtigen erwischt, aber Vorsicht, das kann schnell danebengehen. Der Jahrgang zählt! Es gibt Jahre, da kann man den Wein direkt wegkippen. Anders ist es bei Bordeaux. Bei einem Bordeaux kann man eigentlich nichts falsch machen.« »Bordeaux«, sagt Larissa, und Lisa nimmt einen Schluck und muss lächeln. »Ich hatte vergessen, wie gut der Wein in Paris schmeckt!«, sagt sie, und jetzt lächelt auch Larissa wieder. »Komm«, sagt sie, »komm, noch besser schmeckt er auf dem Balkon.«
Draußen das Rauschen der Großstadt, kühles, frisches Rauschen, der Wind fährt Lisa durch die Haare, sie hält sie ihm hin, ja, wehe mir Mamies Hauskleidgestank aus den Haaren. Die Sonne geht gerade unter, der Himmel ist gelb und rot gefärbt, gemischt mit dem Braun und Grau der Smogwolke, die stets über Paris hängt, dreckig, das schon, aber ein schöner, anonymer Großstadtdreck. Unten das Hupen auf der Avenue de Flandre, Lisa beugt sich über die Balustrade, schade, die Autos kann sie nicht sehen, sie sind von den großen Platanen verdeckt, aber die Menschen, sie sind so klein, winzige Figuren, ganz schnell schwirren sie umher, man kann ihre Hektik gar nicht ernst nehmen von hier oben, sie sehen lustig aus, wie sie unter die Platanen rennen, oder ins Monoprix unten im Haus, oder in die Métro hinein, einfach verschluckt vom Pariser Untergrund. Wie oft stand Mamie hier oben und blickte über Paris. Wie sie von hier oben wohl aussahen, Lisa und ihre Mutter, wenn sie hier ankamen aus Berlin, ganz klein da unten, »schau mal, Mamie erwartet uns schon, schau, sie winkt dir zu!«, sagte Lisas Mutter und zeigte hoch auf den Balkon, auf eine winzige Mamie, Blümchenhauskleid und wilde weiße Haare, eine winzige Mamie hoch oben im siebten Stock.
Larissa beugt sich ebenfalls über die Balustrade, sie blickt nach rechts, da steht der Tour Montparnasse, ein schwarzer Koloss am anderen Ende der Stadt. Sie ist so klein, dass ihre Füße den Boden fast nicht mehr berühren, als sie sich über die Balustrade beugt. In der Abendsonne sieht ihr Gesicht jugendlich aus, die blonden Locken wehen über ihre Stirn und ihren Nacken, eine junge Studentin in Paris. Fast wie Lisas Mutter damals, fast wie Marie, als sie hier stand als Studentin der Sorbonne, Simone de Beauvoir und Albert Camus im Kopf, etwas jünger sogar als Larissa jetzt mit ihren Anfang zwanzig, wie sie sich die blonden Locken aus dem Gesicht streicht, mit ihrer kleinen, ganz kleinen Hand, eine beeindruckend kleine und zierliche Hand, findet Lisa. Natürlich, weil Anne diese Zierlichkeit so mag, sie hat meistens sehr zierliche Freundinnen, obwohl sie selber nun wirklich nicht zierlich ist mit ihrem dicken, runden Gesicht, Apfelbacken sagt man wohl, bayerisch sieht sie aus, ihre Anne, bayerisch und mit ihren beiden starken Beinen fest auf dem Boden stehend, dabei kommt sie gar nicht aus Bayern, sondern von der Nordsee, die kann keiner umhauen, aber ihre Freundinnen, die sind klein und zierlich, als würde sie sie ganz leicht hochheben und durch die Welt tragen können.
Es war sonnig, Lisa weiß noch genau, wie sonnig es war, Vogelgezwitscher und Sonnenstrahlen an der Küchenwand, wie sie es hasste. Winter war doch gut, tote Bäume, totes Gras, alles tot, das fand Lisa gut, als sie das Leben ihrer Mutter auflösen musste, ihre Wohnung, ihre Papiere, ihre Steuern, ihre Krankenkasse, ihre Versicherungen. Und als Lisa damit fertig war, war da noch Mamies Leben. Mamies Wohnung, Mamies Papiere, Steuern, Krankenkasse warteten auf Lisa, in Paris. Lisa wollte nicht nach Paris. »Ich will nicht nach Paris«, sagte sie Anne. »Ich kann nicht, diese scheiß Wohnung, ich kann da nicht hin, aber sie kostet mich über dreihundert Euro im Monat, nur die Nebenkosten, das kann ich nicht bezahlen, was soll ich denn jetzt machen.« Und Anne fing an zu lächeln, zwischen ihren dicken Backen lächelte sie: »Ich glaube, ich habe eine Idee.« Larissa kannte sie noch aus der Schule, sie war ihre erste Freundin gewesen, »meine erste richtige Freundin«, sagte Anne, »sie sucht eine Wohnung in Paris, für ihr Auslandssemester, sie ist sehr nett, du wirst sie mögen.« Und voilà. Nun wohnt sie hier, in dieser klebrigen Wohnung, hier in Mamies Sachen, auch in Mamies Dreck, »ich schwöre dir, sie macht das extra«, sagte Lisas Mutter immer, »sie macht das extra, sie verschmiert ihre Scheiße auf dem Klo und hat einen riesigen Spaß dabei, Lisa, so werden die Alten, sie werden zu kleinen Babys, wenigstens werde ich nicht so alt.«
»Und war sie sehr dreckig, die Wohnung?«, fragt Lisa. Larissa dreht sich um und zuckt mit den Schultern, »na ja, als ich die Tapeten ab hatte und einmal ordentlich durchgeputzt, ging es«, sagt sie, »die Wohnung ist ja wunderschön, das Parkett ist sehr gut erhalten, es wurde nur sehr lange nicht renoviert, das merkt man, und geputzt auch nicht«, Larissa lächelt. »Eine tolle Wohnung, so groß, aber es ist komisch, hier zu wohnen«, sagt sie, »inmitten der Sachen deiner Großmutter, ich frage mich oft, wie sie so war. Ich habe schon mit dem Nachbarn von unten gesprochen, er mochte sie sehr, eine außergewöhnliche Frau war das, hat er gesagt, und dass er sich Sorgen um sie gemacht hat, weil sie allein in der Wohnung war. Jeden Morgen hat sie ein Buch fallen lassen, damit er hörte, dass es ihr gut ging, hat er erzählt.«
Lisa nimmt ihr Glas und geht wieder rein. Die Wohnung ist in Larissas Blond getaucht. Blond strahlt die Sonne auf das helle Fischgrätparkett, den dunklen Holztisch, auf die Holztruhe und die hellen Wände und auf die Bücher, all die Bücher im Regal, bis es sich im Dunkel des Flurs verliert, verschluckt von dem großen schwarzen Wandschrank im Eingang. Oh, an den Wandschrank kann sich Lisa sehr gut erinnern. Darin gab es eine Schatztruhe, Lisa weiß noch, wie Mamie daraus immer Neues hervorzauberte, einen kleinen Esel, den mochte Lisa besonders gerne, den kleinen Esel mit dem struppigen Fell, und es gab dort auch ganz kleine Puppen, die sich verwandeln konnten, wenn man ihre Röcke umdrehte, dann verschwand die Puppe unter dem Rock und wurde ein Muffin, ja, ein nach Erdbeer riechender Muffin. Lisa schiebt die schwere Schranktür zur Seite. Es riecht nach Flohmarkt, nach alten Klamotten, Mänteln, aber nein, da unten ist keine Spielzeugkiste mehr, nur Regenschirme und alte Hüte.
Sie geht weiter, sie geht in die Küche, ihre Schuhe bleiben an den kleinen blauen Fliesen kleben, wie früher, denkt sie, der Boden ist ganz genauso dreckig wie damals, aber der Boden war ihrer Mutter egal. »Bof«, hat sie gesagt, »bof, Mamie ist eine alte Frau, wen kümmert schon der Boden, weißt du, in Deutschland gibt man gerne damit an, dass man vom Boden essen kann, uns war er immer egal, der Boden.« Hier hat Mamies Geruch sich auf die Wände gelegt, eine dicke gelbe Schicht auf den Wänden, auf dem Küchenschrank, Fett vermutlich, eine dicke Fettschicht, gemischt mit Nikotin und Piment, es riecht nach Mamie mit Piment.
Lisa geht zum Fenster, jetzt braucht sie keinen Stuhl mehr, um rauszuschauen, sie kann sich einfach davorstellen und rausgucken, »tu vois, siehst du Sacré-Cœur?«, hat Mamie die kleine Lisa gefragt, und Lisa hat sich auf den blauen Küchenstuhl gestellt und gestreckt, bis sie die weiße Basilika sehen konnte, Lisa streckt den Kopf aus dem Fenster, wo war die Kathedrale denn noch mal, sie blickt nach links, ja, da hinten, zwischen den Hochhäusern strahlt die Kuppel von Sacré-Cœur über der Stadt.
»Willst du sehen, wie die Zimmer jetzt aussehen?« Lisa zieht den Kopf wieder rein und schlägt dabei gegen den Fensterrahmen. »Ich habe auch da die Tapete abgerissen und den Schimmel entfernt«, sagt Larissa, »komm, schau sie dir an, sie sind viel heller so, finde ich.« Und schon geht sie los, sie geht raus aus der Küche, und Lisa bleibt erst kurz stehen, aber dann kommt sie hinterher, durch den schmalen Flur folgt sie Larissa, durch die Tür in den Schlafbereich der Wohnung, rechts Mamans und Mamies Zimmer, geradeaus die kleine Toilette, links das Badezimmer, das Badezimmer mit dem Bidet.
»Hier schlafe ich jetzt«, sagt Larissa, sie steht vor Mamies Zimmer, nur dass es jetzt nicht mehr Mamies Zimmer ist, sondern Larissas. Blümchendecke, Kleider, ein Plakat, das eine Demonstration für den 31. März ankündigt, nuit debout steht darauf. Darunter, auf dem alten Sekretär, Bücher und Zettel und Stifte. Das Zimmer ist kleiner, als Lisa es in Erinnerung hatte, klein und quadratisch, aber das Fenster ist groß, es erstreckt sich fast über die ganze Wand. Die anderen Wände wirken tatsächlich heller, weiß gestrichen, außer über dem Bett, da prangt ein großer gelber Fleck. Ein großer, runder Fettfleck. »Wir haben ein paarmal drübergestrichen, er ging nicht weg«, sagt Larissa, die Lisas Blick gefolgt ist, »ich glaube, deine Oma hat ihren Kopf immer an dieser Stelle gegen die Wand gelehnt, wenn sie im Bett lag, der Fleck geht nicht mehr weg.« Mamies ranziges Überbleibsel. Ihr Kopf. Ihr Kopf an die Wand gelehnt, Zigarette im Mundwinkel, ein Buch auf den Bauch gestützt. Immer mit Zigarette, ohne Filter, »die Verrückte raucht ohne Filter!«, hat Lisas Mutter gesagt, »es wird sie noch umbringen.« »Sie ist kaum mehr aufgestanden«, erklärt Lisa, »meine Großmutter hat ihre letzten zwanzig Jahre mehr oder weniger lesend hier im Bett verbracht, vermutlich hast du recht, vermutlich hat ihr lesender Kopf über die Jahre diesen Fleck hinterlassen.«
»Was liest du so?«, hat sie Mamie gefragt, als sie das letzte Mal hier war, da konnte sie schon ein bisschen Französisch, »was liest du so?« »Alles, ma petite fille