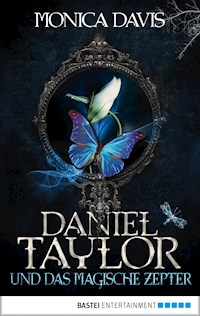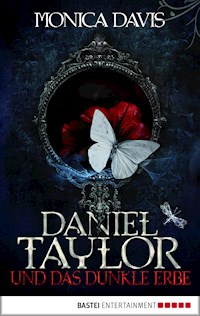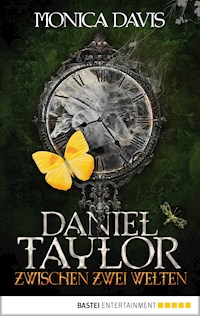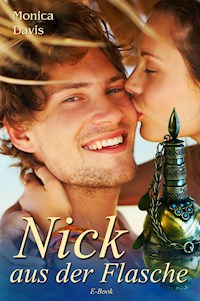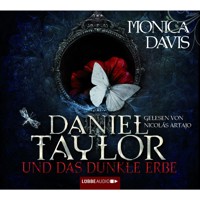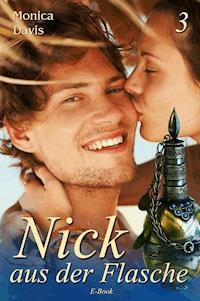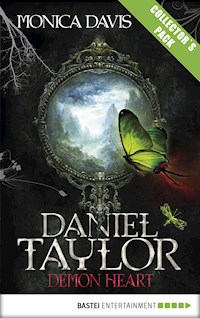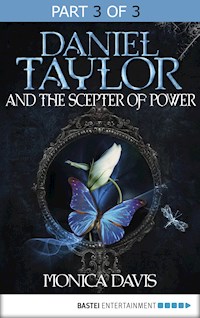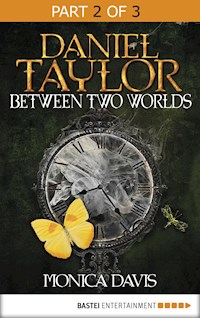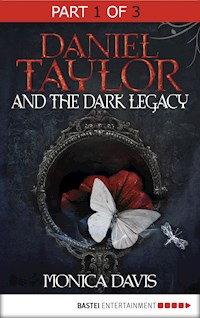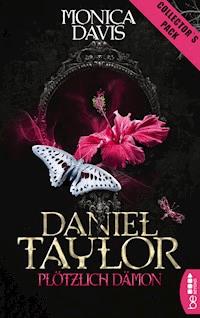
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Daniel Taylor
- Sprache: Deutsch
Daniel, der als Außenseiter an der Highschool nicht viel zu lachen hat, entdeckt plötzlich Gefühle für seine attraktive Klassenkameradin Vanessa. Und als ob das nicht bereits verwirrend genug wäre, geschehen auf einmal seltsame Dinge in seinem Leben.
Seine Welt steht kopf, als er von seiner wahren Herkunft erfährt. Daniel wird von den Schatten eines dunklen Erbes eingeholt - ein Erbe, das ihm die Tür zu einer anderen Welt öffnet, der Welt der Dämonen ...
Die Geschichte um Daniel Taylor ist bereits als digitaler Roman in drei Teilen erschienen (Daniel Taylor und das dunkle Erbe, Daniel Taylor zwischen zwei Welten, Daniel Taylor und das magische Zepter). Mit dem Collector's Pack, Daniel Taylor "Plötzlich Dämon", erhalten Sie nun alle drei Teile in einem E-Book.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was ist Daniel Taylor - Plötzlich Dämon?
Die Autorin
Titel
Impressum
Daniel Taylor und das dunkle Erbe
Daniel Taylor zwischen zwei Welten
Daniel Taylor und das magische Zepter
Was ist Daniel Taylor – Plötzlich Dämon?
Daniel Taylor – Plötzlich Dämon ist ein zeitgenössischer Fantasy-Jugendroman, der bereits in drei Teilen erschienen ist (Daniel Taylor und das dunkle Erbe, Daniel Taylor zwischen zwei Welten, Daniel Taylor und das magische Zepter). Die Geschichte spielt in Little Peak, einer typischen Kleinstadt in Kalifornien. Es geht um spannende Abenteuer, große Gefühle und eine folgenschwere Entscheidung.
Mit diesem Collector’s Pack erhalten Sie nun alle drei Teile in einem E-Book. Die dämonische Trilogie ist zudem als Audio-Download erhältlich.
Die Autorin
Monica Davis ist eines der Pseudonyme einer deutschen Autorin, deren bürgerlicher Name Monika Dennerlein lautet. 1976 in Berchtesgaden geboren, verschlug es sie nach dem Abitur nach München, wo sie ein paar Jahre als Zahntechnikerin arbeitete, jedoch nie ihre Leidenschaft fürs Schreiben verlor. Seit sie sich voll und ganz der Schriftstellerei widmet, sind von ihr 26 Bücher, 6 Hörbücher und zahlreiche E-Books erschienen, die regelmäßig unter den Online-Jahresbestsellern zu finden sind.
PLÖTZLICH DÄMON
Alle drei Teile in einem Band
beBEYOND
Digitale Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stella Diedrich
Lektorat/Projektmanagement: Sarah Pelekies
Titelillustration: © shutterstock/Slava Gerj, © shutterstock/majcot, © shutterstock / Pan Xunbim, © shutterstock / Barnaby Chambers
eBook-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3917-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
PROLOG
»Ich hab echt keinen Bock mehr«, murmelte James. Mit dem Handrücken wischte er sich Schweiß und Staub von der Stirn, bevor er sich auf einen Steinquader setzte. In der Pyramide war es stickig und dunkel, seine Nase juckte ständig und er hatte Durst. Bisher hatten sie nicht gefunden, wonach sie alle suchten. Bis jetzt hatten sie noch rein gar nichts gefunden, nichts, außer einer Menge Dreck. Vielleicht lag das Zepter gar nicht in dieser Grabstätte. Ja, vielleicht war es nicht einmal in der Nähe von Kairo! Die Gilde musste sich bei der Entzifferung der Hieroglyphen geirrt haben. Wer glaubte schon, was auf einem jahrtausendealten Tontopf stand?
Ein Zepter, mit dem man sich jeden untertan machen könnte, hätte allerdings was, überlegte James. Als Erstes würde er seinen Archäologieprofessor zur Hölle schicken, der seine Studenten hier schuften ließ, als wären sie Sklaven des alten ägyptischen Reiches. Im Moment wünschte James sich ins Hotel, besonders unter die Dusche und in sein Bett. Ihm tat jeder Muskel weh.
Er hatte sich von ihrer kleinen Gruppe abgesetzt, um in Ruhe seine Mittagspause zu genießen, und befand sich jetzt in einer leeren Kammer abseits der anderen. Draußen in der Sonne war es ihm zu heiß. James wollte keinen in seiner Nähe haben, wenn er in seinen Erinnerungen schwelgte.
Ächzend zog er den Handstrahler, der ein grelles Licht verbreitete, näher zu sich, nahm den letzten Schluck aus seiner Wasserflasche und holte mehrere gefaltete Zettel aus seiner Brusttasche. Es waren Briefe von Anne. James kannte sie schon auswendig, so oft hatte er sie gelesen. Es vermittelte ihm einen Eindruck von Normalität, von Heimat, wenn er sie nur berührte. Anne und er hatten als Kinder Tür an Tür gewohnt und James musste oft an seine Freundin denken. So lang lag das nicht zurück, erst wenige Jahre. Er wünschte, er könne die Zeit zurückdrehen, dann hätte er vieles anders gemacht.
Stell dir vor, las er, in Kürze heiraten Peter und ich. Bald heiße ich Mrs. Taylor und bin die Frau eines zukünftigen Arztes! Es wäre schön, wenn du zu unserer Hochzeit kommen könntest …
Wie immer gab es seinem Herz einen Stich. Seufzend ließ er die Papiere sinken. Anne war nun endgültig vergeben. Seit ihrer Heirat schrieb sie ihm kaum noch. James liebte Annes Briefe. Sie waren seine einzige Verbindung zu einer Welt, in der es keine Dämonen, Wächter oder anderen seltsamen Geschöpfe gab –außer in Mythen.
Als James sich am Kopf kratzte, rieselten Sand und Staub aus seinem Haar, das durch den Dreck mehr grau als braun aussah. James hasste diese trockene, karge Gegend und sehnte sich zurück nach Little Peak. Obwohl das Städtchen mitten in Kalifornien lag, wo es auch oft flirrend heiß war, gab es in der kleinen Stadt wenigstens Grünflächen, Wasser und vor allem Menschen, die er vermisste. Seine Eltern lebten ebenfalls dort. Sie arbeiteten wie er für die Wächtergilde, nahmen aber nicht mehr aktiv an Einsätzen teil. Das überließen sie den Jüngeren oder solchen, die eine Spezialausbildung genossen hatten. Die Aufgabe der Gilde war es, die Menschheit vor allem Übel zu beschützen. Die Wächter waren gewöhnliche Menschen, allerdings so etwas wie Engel auf Erden: verwundbar wie jeder andere Mensch, hatten sie jedoch besondere Fähigkeiten. Sie konnten sogar Energiebälle erscheinen lassen, um sich zu verteidigen. Das Beste war, dass sie sich von einem Ort zum anderen »beamen« konnten. Dematerialisierung und Rematerialisierung nannten sie es, auch Translokation oder einfach Teleportation.
»Du fehlst mir, Annie«, flüsterte James. Er wünschte, er hätte Anne sagen können, wer er wirklich war, stattdessen hatte er ihr stets das verwöhnte Millionärssöhnchen vorspielen müssen, das nur wegen des Reichtums seiner Eltern auf ein Internat ging anstatt auf die Little Peak High. In Wahrheit hatte er in der kalifornischen Stadt Avalon, auf der Insel Santa Catalina vor der Küste von Los Angeles, die Gildenschule besucht. Dort erhielt ein zukünftiger Wächter die bestmögliche Ausbildung. Die Insel war im Besitz der Gilde und lebte von Touristeneinnahmen. In einem großen, umzäunten Gelände, fern von neugierigen Augen, lag die Einrichtung gut geschützt und bewacht zwischen Wäldern und Hügeln, getarnt als Militärbasis.
James war nur in den Ferien zu Hause gewesen. Und nur weil er ein Wächter war, saß er jetzt hier, in dieser dunklen, stickigen Pyramide, um nach dämonischen Artefakten zu suchen. Es gehörte zu seinem Studium.
Die Schüler dürfen die Drecksarbeit erledigen, dachte er. Sie suchten schon seit Monaten nach diesem Zepter. Es würde wohl nie auftauchen.
Schnaubend hielt er einen anderen Brief vor das Licht und betrachtete Annes schöne Handschrift. Peter hat gute Aussichten auf eine Praktikumsstelle im Little Peak Hospital. Wir werden im selben Krankenhaus arbeiten!
James stieß erneut die Luft aus. Peter – warum ausgerechnet Peter Taylor, der Junge mit den Sommersprossen, der in derselben Straße gewohnt hatte wie sie? Der passte überhaupt nicht zu Anne.
Langsam beschlich ihn das Gefühl, dass seine miese Laune nichts mit seinem Job zu tun hatte – der oft ziemlich cool war, wie er zugeben musste –, sondern damit, dass er Anne nicht für sich haben konnte. Gut, das hatte dann doch mit seinem Job zu tun. Wächter sollten unter ihresgleichen bleiben, denn wenn sie mit normalen Menschen Kinder zeugten, schwächten sich ihre magischen Fähigkeiten mit jeder Generation ab. Außerdem war die Organisation streng geheim und gewährte nur selten Außenstehenden Zutritt.
Ein schabendes Geräusch ließ James aufspringen und herumfahren, sein Herzschlag beschleunigte sich. Er hob seine Lampe in die Höhe, um besser in den engen Gang sehen zu können, der zu dieser Kammer führte. Gebannt hielt er die Luft an – aber da war niemand. Lächerlich von ihm zu glauben, er würde tatsächlich einmal auf einen Dämon treffen, zumindest im Rahmen seiner Ausbildung. Normalerweise ließen sich die Unterweltler nicht so einfach blicken, sondern hielten sich bedeckt. Diese Kreaturen mieden Wächter wie die Pest.
Plötzlich stürmte ein Schatten auf ihn zu. »Buh!«
James ließ die Briefe und den Strahler fallen und bildete zeitgleich in seiner Handfläche eine knisternde Energiekugel, bereit, sie gegen den Feind zu schleudern. Sein Puls klopfte wild in seinen Schläfen und ihm stockte erneut der Atem. »Ruben!« Im letzten Augenblick zerdrückte James den Energieball und fluchte: »Verdammt, du Vollidiot! Ich hätte dich beinahe umgebracht!«
Der junge Italiener, dessen blondes Haar genauso staubig war wie das von James, lachte. »Glaubst du wirklich, deine Glitzerbällchen könnten mich verletzen?«
Auch Ruben interessierte sich nicht aus normalen Gründen für Archäologie und Ägyptologie; wie James gehörte er ebenfalls der Wächtergilde an.
»Ich geb dir gleich mal ’ne Kostprobe von meinen Glitzerbällchen«, murrte James. Ihre Energiegeschosse waren tatsächlich nicht besonders stark – wenn man es allerdings schaffte, eine richtig große Kugel geballter Elektrizität zu erzeugen, sollten damit Dämonenangriffe abgewehrt werden können. James würde viel lieber seine Kampfeskraft trainieren, anstatt hier im Dreck zu wühlen. In zwei Wochen würde er zurück nach Kalifornien fliegen, um endlich das letzte Kapitel seiner Wächterausbildung zu beginnen: Verteidigung und Transportation! Ihre Gruppe war zwar schon in gewissen Fertigkeiten ausgebildet worden, aber manche Studenten – so wie er leider auch – brauchten noch ein wenig Nachhilfe in Sachen Magie.
Ruben schlenderte auf ihn zu. »Was machst du hier, Jimmy, amico mio? Heimlich die Briefe deiner Liebsten lesen, anstatt zu arbeiten?« Als er »Amore mio« zu singen begann, verdrehte James die Augen und sagte grollend: »Das geht dich gar nichts an. Außerdem hab ich jetzt Pause.«
James mochte Ruben, doch er hasste es, wenn der ihn Jimmy nannte. Er war immerhin zwei Jahre älter als sein Kommilitone.
»Uh, Liebeskummer.« Ruben grinste.
James schenkte ihm einen finsteren Blick, der Ruben rückwärts aus der Kammer drängte.
Abwehrend hob er die Hände. »Sì, sì, ich gehe in mein eigenes Loch zurück. Du weißt ja, wo du mich findest, Jimmy.« Ruben zwinkerte. »Wenn du mal drüber reden willst …«
»Nein!« Jetzt musste selbst James lachen. Reden – ja, das konnten sie am besten, die Italiener. »Aber falls du ’ne Flasche Wasser übrig hast, überleg ich’s mir.«
»Ich hab ’ne ganze Kiste!«, hallten Rubens Worte durch den dunklen Gang. »Ich mach dir auch ’nen Sonderpreis!«
»Lügner!«, rief James schmunzelnd zurück. Er sah seinen Kollegen längst nicht mehr, sondern hörte nur noch dessen Schritte. Ruben hatte einen schmalen Zugang zu einer Belüftungskammer gefunden, wo er Getränke und »andere Dinge« bunkerte, die er den Studenten für teures Geld verkaufte. Wenn ihr Professor das herausbekam, würde Ruben fliegen. Er schien es richtig drauf anzulegen …
Sie waren zu fünft im Team, plus der Professor, und sie alle arbeiteten immer zusammen an einer Stelle, unter den Argusaugen des alten Mannes. Damit bloß niemand auf Dummheiten kam, sollte jemand auf ein Artefakt stoßen. Offiziell wusste natürlich keine der ägyptischen Behörden, wer sie waren. Sie hatten sich als Wissenschaftler ausgegeben und eine Sondergenehmigung bekommen, für ein paar Wochen »Messungen« durchführen zu dürfen.
Mithilfe modernster Apparaturen hatte die Gilde einen konstanten, aber sehr schwachen Energieimpuls gemessen, der sich nicht genau lokalisieren ließ. Deshalb folgerten ihre Gelehrten, dass sich dunkelmagische Relikte in dem Bau befinden mussten, die eine schwache elektromagnetische Strömung absonderten. Jetzt arbeiteten sie mit Hochdruck daran, in der kurzen Zeit etwas zu finden.
Es war schon unheimlich im Bauch einer Pyramide. Manchmal wurde die Stille von leisen, unerwarteten Geräuschen unterbrochen, einem Rascheln, Rieseln, Poltern. Auch wenn er sich sagte, dass vermutlich kleine Tiere oder bröckelnde Steine die Ursache waren, konnte das selbst James noch eine Gänsehaut einhauchen, und dabei arbeitete er bereits drei Monate fast jeden Tag hier drin.
Als von seinem Freund nichts mehr zu hören war, machte sich James daran, die Briefe aufzusammeln. Er schnappte sich die Lampe, die zum Glück so robust war, dass sie den Sturz überlebt hatte, und pustete von jedem Zettel den Staub, bevor er ihn faltete und in seiner Brusttasche verschwinden ließ.
Das letzte Papier lag an einer Seitenwand der Kammer. James stutzte, als er es aufhob. Da war deutlich etwas auf dem unteren Mauerstein eingraviert. James zog die Lampe näher, dann fegte er mit einem dicken Pinsel den Sand von der Stelle und sog die Luft ein.
»Das Horusauge«, flüsterte er und kniete sich auf den Boden, um es besser erkennen zu können. »Das gibt’s doch nicht.« Dieses Symbol stand für Schutz und Macht. Hier wurde eindeutig etwas Bedeutendes versteckt …, hoffte James. Das war keine Grabkammer, deshalb hatten sie an diesem Ort noch nicht gesucht. Eigentlich schien dieser Raum unbedeutend zu sein. Er stand ziemlich weit hinten auf der Liste des Professors.
Ehrfürchtig fuhr James mit dem Zeigefinger die eingeritzte Augenbraue und die ovale Spur nach, die einem Falkenauge nachempfunden war. Danach richtete er sich auf. Sollte er die anderen holen?
Nein, diese Entdeckung wollte er ganz allein machen. Das würde ein perfekter Abschluss werden, da seine Ausbildung ohnehin in drei Monaten beendet war.
James holte sein Werkzeug und begann, mit einem dünnen, scharfen Instrument den Zement zwischen den Fugen des Steins herauszuschaben. Normalerweise war der Zement extrem hart, auch nach so vielen Jahrtausenden, aber zu James’ Überraschung ließ er sich leicht beseitigen. Das Material war völlig anders. Hier hatte also jemand nach dem Bau der Pyramide etwas versteckt.
Mit einem Keil lockerte er den Stein, bis er ihn herausziehen konnte. Das kratzende Geräusch des kleinen Quaders jagte James eine Gänsehaut über den Körper, und immer wieder blickte er sich um, ob keiner kam. Sein Puls klopfte laut in den Ohren.
Er legte sich auf den Bauch und spürte sein Herz hart gegen die Rippen schlagen. Den Strahler hielt er genau vors Loch. James sah nichts außer Staub. Allerdings erblickte er weiter hinten eine Kante. O Mann, er musste da hineingreifen! Was, wenn ihn nun gleich eine knochige Hand packen oder eine Horde Skarabäen über ihn herfallen würde, so wie er das aus Horrorfilmen kannte? Das hier ist aber die Realität, machte er sich Mut und streckte den Arm aus, bis er mit der Schulter an der Wand anstieß. Er tastete sich an der Kante abwärts und zuckte zurück, als er etwas Raues und Nachgiebiges fühlte. Da lag wirklich etwas!
»Komm schon«, zischte er und führte seine Hand erneut in den Hohlraum. Schweiß lief ihm aus dem Haar und tropfte von seiner Nase auf den staubigen Boden. Die Zähne fest aufeinandergepresst und mit angehaltenem Atem griff James zu. Das Bündel war sperrig, und er musste es erst drehen, bevor er es herausholen konnte. Das Ding war richtig schwer! Es bestand aus einem grob gewebten Stück Stoff, in dem sich ein harter, länglicher Gegenstand befand – soweit James das ertasten konnte. Obwohl seine Hände heftig zitterten, wickelte James ihn behutsam aus. Als ein goldener Stab zutage kam, an dessen Spitze ein Schlangenkopf saß, der ebenfalls aus Gold war, konnte James sein Glück kaum glauben. Das Zepter, das musste es sein!
Mann, das war heute sein großer Tag; unbegreiflich! Das Blut rauschte so heftig durch seinen Schädel, dass ihm schwindlig wurde. Er musste den anderen Bescheid geben, aber erst wollte er wirklich sicher sein, dass er das echte Artefakt gefunden hatte. Er wollte sich keine Blöße geben.
Nichts anfassen, holt mich sofort, wenn ihr etwas gefunden habt!, hallten die Worte des Professors durch James’ Kopf.
Klar, damit du die Lorbeeren einheimsen kannst, Alter.
James warf das Tuch auf den Boden. Als er das blanke Metall berührte, kam es ihm so vor, als würde es vibrieren. Die Schwingungen durchdrangen all seine Zellen. Phänomenal!
James drehte das Zepter herum und erkannte eine Inschrift, die sich vom Kopf bis zum Ende des armlangen Stabes zog. Es waren Hieroglyphen, die James mühelos lesen konnte. Altgriechisch, Latein, Hebräisch, Sumerisch und natürlich auch die Bedeutung der Hieroglyphen wurden an der Gildenschule gelehrt. Die Gilde, die schon seit Jahrtausenden existierte, hatte die alten Sprachen nie vergessen, während die normalen Menschen erst seit der Entschlüsselung des »Steins von Rosetta« die Zeichen lesen konnten. Wie hatte er also daran zweifeln können, dass Mitglieder der Gilde, die die alten Sprachen bis zur Perfektion beherrschten, sich geirrt hatten?
James las von oben nach unten und wisperte die alten Worte: »Peret … em-bah netjer …« Ein Kribbeln lief über sein Rückgrat; die Härchen auf seinen Armen stellten sich auf. Der Stab in seiner Hand wurde wärmer, vibrierte stärker und begann zu leuchten! Eine dunkle Macht ging auf James über, nistete sich in seinem Herzen ein und ließ es schneller und kräftiger schlagen.
»Wahnsinn«, flüsterte er ehrfürchtig und dachte: Verdammt, was hab ich getan? Aber schon wenige Sekunden später waren die Warnungen des Professors vergessen. Wer war schon der Professor? Er, James, war jetzt allen überlegen!
Es hieß, die Götter der alten Pharaonen seien Dämonen gewesen. In genau diesem Moment bezweifelte James das nicht. Die meisten Pharaonen waren fähige Herrscher gewesen, die für ihr Volk gesorgt und Handel und Kultur gefördert hatten. Aber die Dämonen hatten die Herrscher gelenkt. Zuerst hatten sie die ägyptische Kultur zur Weltmacht erhoben, um Macht über viele zu erringen, dann hatten sie die Pharaonen verdorben oder sich selbst für sie ausgegeben, um Kriege heraufzubeschwören, Menschen zu unterjochen und zu versklaven – um Elend herbeizuführen und daraus ihre Kraft zu beziehen. Denn Dämonen nährten sich von negativer Energie oder von Seelen.
Dazu hatten sie auch verschiedenste Artefakte geschaffen, mit denen sie die Menschen leichter manipulieren konnten. Das Zepter der Macht sollte eines der mächtigsten Gegenstände sein. Und nun hielt er es in seiner Hand!
Die Stimme der Vernunft, die ihm irgendwo aus den entlegensten Windungen seines Gehirns zuflüsterte, dass er unwahrscheinlich dumm gehandelt hatte, das Zepter zu aktivieren, verstummte ebenfalls. James hatte nicht anders gekonnt, dieses Artefakt hatte ihn regelrecht dazu »gezwungen«! Und er bereute nichts.
Das Glühen verebbte, doch das Gefühl der Macht blieb. James fühlte sich fantastisch!
Als er diesmal ein Geräusch hinter sich hörte, zuckte er nicht zusammen. Er wusste, dass er schier unbesiegbar war.
James drehte sich um. »Ruben, du wirst es nicht glau …«
Aber da stand nicht sein Kollege, sondern eine wunderschöne Frau mit schwarzem Haar, das ihr in Wellen über die Schulter floss. Sie trug ein Gewand aus weißem Leinen und an ihre Brust hielt sie ein Bündel gedrückt. Sie hätte eine erstklassige Ägypterin aus der alten Zeit abgegeben.
Was suchen Sie hier?, wollte er fragen, doch dann glühten ihre Augen kurz auf.
James wich zurück. »Was …« Er roch Ozon. Sie war eine Dämonin! Ja, es bestand kein Zweifel. Der Geruch deutete darauf hin, dass sie soeben durch ein Dämonenportal gekommen sein musste. Wenn die Unterweltler mit der Hand einen Kreis auf einen festen Gegenstand zeichneten, entstand in einem bläulichen Ring aus Energie ein Tor, durch das sie überallhin reisen konnten.
Wow, war sie schön! James war wie gelähmt. Vor ihm stand tatsächlich eine waschechte Dämonin, und er starrte sie nur wie ein Geisteskranker an.
Die dunklen Augen, die ihm fast so schwarz erschienen wie ihr Haar, waren aufgerissen. »Lass es sofort los!«, befahl sie ihm.
Schlagartig kehrte sein klarer Verstand zurück. »Willst du etwa das hier?« Demonstrativ hielt James den Stab vor sich. Meine Güte, er konnte nicht begreifen, wie fantastisch er sich fühlte! Er hatte auch nicht die geringste Angst vor der schönen Unterweltlerin, die ihn wohl am liebsten mit ihren Blicken getötet hätte.
Ein Energieball formte sich in James’ Hand, der so unwahrscheinlich groß und hell strahlte, dass er die junge Frau sicherlich damit vernichten könnte. Sogar seine Kräfte hatten sich vervielfacht! Seine Kugel wuchs in der Hand an. Cool. Das Zepter musste ihn mit zusätzlicher Energie versorgen, und James fühlte bereits wieder, dass er der Macht des Artefaktes verfiel.
Trotz der Gefahr, die von James ausging, trat die Frau einen Schritt auf ihn zu. »Leg es hin oder deaktiviere es, aber mach schnell!« Obwohl ihre Stimme scharf klang, ließ sie wohlige Schauer über seinen Körper rieseln.
»Wieso sollte ich darauf hören, was mir eine Dämonin befiehlt?«, grollte er und wollte eben sein Geschoss auf die Frau werfen, als eine Bewegung in ihrem Bündel seinen Blick ablenkte.
Sofort drückte sie es fester an ihre Brust. Was trug sie bei sich? Erst als James ein Büschel schwarzen Haares aus dem Stoff hervorlugen sah, erkannte er: Es war ein Baby.
Er konnte doch unmöglich ein Kind töten!
Die Dämonin stand einfach nur vor ihm, ohne jeden Versuch, ihn anzugreifen oder das Zepter an sich zu reißen, und … Moment, das mit dem Baby konnte ebenso gut ein Trick sein!
Plötzlich murmelte sie einen Spruch, und keine Sekunde später waren sie von einer schillernden Kugel umschlossen, die aussah wie eine überdimensional große Seifenblase.
James wirbelte herum. »Was hast du gemacht?«
»Ich gebe uns mehr Zeit«, sagte sie. »Ich habe uns in eine Kapsel eingeschlossen, in der die Zeit viel langsamer abläuft.«
Wow, die Dämonin besaß außerordentliche Fähigkeiten!
»Wie konntest du das Zepter aktivieren?«, fragte sie. »Kein normaler Mensch kann das, und du bist auch kein Dämon!«
Sie starrte auf den Energieball, der in James’ Hand weiter anwuchs. Er spürte seine unheilvolle, todbringende Macht.
»Du bist ein Wächter!« Ihr Gesichtsausdruck entspannte sich. Nun schaute sie nicht mehr wie ein Racheengel aus. Leider wirkte sie auf James dadurch noch anziehender. Sie verkörperte das absolut Böse, sah aber so gar nicht danach aus. Sie beide waren sich so ähnlich, und doch vertrat jeder von ihnen eine andere Seite.
Vor vielen Jahrtausenden hatte sich ihre Art geteilt. Eine Gruppe von magiebegabten Druiden hatte sich in zwei Lager gespalten. Die einen hatten die Auffassung vertreten, mit ihren Kräften nur Gutes zu bewirken, die anderen nutzten ihre Macht lediglich zum eigenen Vorteil. Sie hatten sich in ihre eigene düstere Welt zurückgezogen, um fortan die Menschheit zu verderben und zu unterjochen.
Die Dämonin deutete auf das Zepter. »Du musst die Aktivierung rückgängig machen! Lies die Inschrift von unten nach oben, schnell!«
»Wieso?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf, als würde er die Antwort kennen, wäre aber zu dumm, sie zu begreifen. »Weil du sonst nicht mehr lange leben wirst. Sie werden die Macht des Artefakts spüren und sofort herkommen!«
James brauchte nicht nachzufragen, wen die Dämonin mit »sie« meinte. »Woher weißt du das alles?«
»Ich bin die Hüterin dieses Zepters.«
Die Hüterin? Das wurde ja immer besser: eine Dämonin, die ein schwarzmagisches Artefakt bewachte, anstatt es für sich zu nutzen? Doch da lag ein Ausdruck in ihren Augen, etwas Gütiges, was ihn tatsächlich dazu veranlasste, ihr zu glauben. Der gewaltige Energieball verpuffte in seiner Hand, was die Dämonin mit einem erleichterten Seufzen zur Kenntnis nahm.
James las die Inschrift rückwärts und fühlte sofort, wie die Macht von ihm abfiel und durch seinen Arm regelrecht in das Zepter zurückgesogen wurde.
James erschauderte. Er konnte jetzt wieder völlig klar denken … und er war der Dämonin schutzlos ausgeliefert.
Die Blase waberte gefährlich. Plötzlich zuckte die Frau zusammen und runzelte die Stirn. Sie schien in sich hineinzuhören. Ihre Miene verfinsterte sich. »Sie sind in Aufruhr! Bald weiß Xandros Bescheid!«
Wer ist Xandros?, überlegte er, doch da fiel es ihm ein: »Der Herrscher der Unterwelt!«
»Und auch … mein Vater«, flüsterte sie.
Das Baby in der Tuchschlinge begann leise zu weinen. Die Dämonin streichelte sein Köpfchen und flüsterte beruhigende Worte, bevor sie sich erneut an James wandte: »Ich muss weg. Ich kann die Zeit nicht ewig ausdehnen.« Schweiß glitzerte auf ihrer Stirn. Der Zauber kostete wohl ungeheuer viel Energie. »Sie werden bald hier sein. Die Erschütterung der Macht war bis in die Unterwelt spürbar.«
James wusste als Wächter natürlich, dass sich die Dämonen mental untereinander verständigen konnten. Sie waren alle kognitiv miteinander vernetzt. Mit nur einem Gedanken könnte die Dämonin sie hierherführen.
Sie bückte sich nach dem Tuch, in das das Artefakt eingewickelt gewesen war, und streckte die Hand aus. »Gib mir nun das Zepter.«
»Ganz bestimmt nicht«, sagte er, nur klang es nicht sehr überzeugend.
O Himmel, sie war so wunderschön! Aber hatte er nicht gelernt, dass die meisten Dämonen wunderschön aussahen, weil sie so die Menschen leichter verführen und manipulieren konnten?
»Dann wirst du sterben. Es ist deine Entscheidung. Je länger du wartest, desto schneller werden sie es finden. Es strahlt immer noch Restenergie ab. Ich muss es an einen sicheren Ort bringen, bevor sie da sind.«
James ließ den Stab nicht los. »Ich kann das Zepter der Gilde übergeben. Sie werden darauf aufpassen.«
»Nein!« Ihre Augen wurden wieder groß. Sie trat so nah an ihn heran, dass sie sich beinahe berührten. »Du kannst dort niemandem trauen.«
Er zuckte mit den Schultern. »Wieso? Wir sind doch die Guten. Warum sollte ich dir trauen?«
Ihr Blick verdüsterte sich. »Auch bei euch gibt es Abtrünnige.«
James hatte die Macht des Artefakts gespürt. Es konnte durchaus sein, dass ein Wächter dieser dunklen Kraft verfiel, daran hatte er keinen Zweifel.
Sie hielt ihm die Hand mit dem Tuch hin. »Bitte, gib es mir.«
Warum holte sie es sich nicht einfach? Es schien, als hätte sie Angst, es zu berühren. Oder machte sie sich um das Baby Sorgen? James warf einen Blick auf das Köpfchen. Dunkle Kulleraugen blinzelten ihm entgegen. Das Kleine war genauso hübsch wie seine Mutter.
Die Dämonin wurde zusehends unruhiger, die Blase zog sich enger zusammen. »Ich habe keine Zeit, sie dürfen mich und das Baby nicht finden.«
Er lag mit seinen Überlegungen wohl richtig. »Warum?«
Mit einer Hand umfasste sie seinen Arm, und ihre Nähe raubte ihm den Atem. Sein Herz pochte wie verrückt, und in seinem Magen tobte ein Orkan. Was machte diese Frau nur mit ihm?
»Sie werden uns töten«, wisperte sie. James erkannte die Angst in ihren Augen, sodass er ohne weiteres Zögern und weitere Fragen sagte: »Dann komme ich mit dir.«
Er würde seinen Job ehrenhaft erledigen und dafür sorgen, dass das Zepter tatsächlich nie gefunden wurde. Die Fürsorge ihrem Kind gegenüber und ihr gütiger Blick überzeugten ihn; außerdem hatte James da ein Gefühl. So verrückt das auch klang: Er vertraute einer Dämonin!
Sie nickte und lächelte leicht. »Und ich vertraue dir.«
»Kannst du etwa meine Gedanken lesen?«
Erneut huschte ein Lächeln über ihre Lippen. »Wir sind uns ähnlicher, als du denkst.«
James fuhr sich durchs Haar und schulterte den Rucksack mit seinen Habseligkeiten. Vertraute sie ihm, weil er ein Wächter war oder weil sie wusste, was in ihm vorging? »Ich muss erst die anderen warnen.«
Mit einem leisen »Plopp« verschwand die Zeitkapsel plötzlich. Die Dämonin schloss die Augen und schwankte, als würde sie ohnmächtig werden. James nahm sie ohne Zögern in die Arme, wobei er darauf achtete, das Kind nicht zu erdrücken.
Wie weich sich ihr Körper anfühlte und wie gut sie roch. Fasziniert schaute er in ihr wunderschönes Gesicht. Wie rot ihre leicht geöffneten Lippen waren … James hätte sie am liebsten geküsst.
»O nein!« Sie riss die Augen auf, und das Baby fing erneut an zu weinen.
James klopfte das Herz bis zum Hals. »Was ist?«
»Sie wissen Bescheid! Jetzt weiß Xandros, dass das Zepter existiert. Er wird alles tun, um es zu bekommen!« Hastig löste sie sich aus seinem Griff und schaute sich um. Noch hatte sich kein Portal geöffnet.
»Dann muss ich meine Gruppe erst recht warnen!« Das war alles seine Schuld. Seinetwegen durfte keiner sterben! Übelkeit stieg in ihm hoch, und seine Knie fühlten sich butterweich an.
Die Dämonin packte ihn wieder am Arm. »Für die interessieren sie sich nicht. Keine Zeit mehr, komm endlich! Ich kann sie auf eine falsche Fährte lenken, damit sie nie hier auftauchen!«
Während sie mit ihrer Hand einen Kreis auf die nächste Wand zog, sagte er: »Vielleicht sollten wir uns erst mal einander vorstellen. Ich bin James Carpenter.« Er hatte eine Scheißangst. Sein Herz klopfte heftig, und sämtliche Muskeln zitterten.
Es knisterte, als sich ein Ring aus blauem Feuer auf der Mauer materialisierte. Ein Loch bildete sich darin, aber James sah nicht in die dahinterliegende Kammer, sondern … Du liebe Güte, war das der Eiffelturm?
»Ihr Wächter seid wirklich seltsam.« Die junge Frau reichte ihm die Hand. »Kitana.« James ergriff sie und schritt mit ihr in eine ungewisse Zukunft.
19 JAHRE SPÄTER …
Daniel schreckte aus seinem Tagtraum und fuhr sich hastig durch sein schwarzes Haar. Wieso begann sein Herz immer zu rasen, wenn er ein blaues Licht sah? Aber es war nur die Reflexion einer Dose, die auf dem Pausenhof lag und ihn blendete. Daniel stand an einem offenen Fenster im Gang, der zu seinem Klassenzimmer führte, und nahm einen tiefen Zug der warmen Luft. Irgendwie glaubte er heute zu ersticken.
Als das schrille Klingeln der Schulglocke die nächste Stunde ankündigte, schob sich Daniel durch den überfüllten Flur. Wie so oft schienen ihm seine Mitschüler automatisch auszuweichen, wenn er sich ihnen näherte; andere begafften ihn wie eine Jahrmarktsattraktion.
Normalerweise zog Daniel instinktiv den Kopf ein, aber heute fühlte er sich kampfeslustig. Ihm war plötzlich egal, was die anderen über ihn dachten. Mit der schwarzen Kleidung, die er ständig trug, fiel er natürlich auf. Nicht wegen der Farbe, denn auch andere Teens trugen gerne dunkle Sachen, sondern weil er selbst bei der größten Hitze lange Kleidung anhatte.
Er liebte seine dunklen, weiten Klamotten. In ihnen fühlte er sich gegen den Rest der Welt abgeschottet. Als würde ihn das Schwarz unsichtbar machen. Leider war er wegen seiner außergewöhnlichen Körpergröße einfach nicht zu übersehen. Wenigstens gab es auf der Little Peak High keine Schuluniform, sonst würde er noch eingehen. Nun gut, er musste zugeben: Er hatte keine Lust, sich anzupassen, denn die Leute hier nervten ihn einfach. Dennoch verstand er nicht, was sie alle gegen ihn hatten.
Als er sich weiterschob, seinen Rucksack in der Hand, und durch seine Haarsträhnen die anderen Kursteilnehmer betrachtete, verspürte er ein beklemmendes Gefühl in der Brust. Daniel hatte in den zwei Monaten, in denen er die Kurse vom letzten Jahr wiederholen musste, keine neuen Freundschaften geschlossen. Hier gab es alte Hierarchien und feste Cliquen, wie die coolen Jungs mit den teuren Klamotten und den aufgestylten Haaren – aber die rissen nur blöde Sprüche über ihn. Sie standen an die Spinde gelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt, kauten Kaugummi und beobachteten ihn mit abschätzig hochgezogenen Brauen.
Noch bevor die Jungs den Mund aufmachten, beschleunigte sich Daniels Puls, weil er genau wusste, was gleich kam. Es war, als ob er hören könnte, was sie dachten.
»Hey, Taylor, wenn du das nächste Mal deine Klamotten wegwirfst, lass sie an!«, rief Sebastian Woolridge durch das Stimmengewirr.
Seine Freunde grölten über diesen Witz, und Jason, sein bester Kumpel, setzte so laut hinzu, dass es jeder hörte: »Bastian, ich weiß, dass Taylor nicht so blöd ist, wie er aussieht, deswegen wird er uns wohl länger erhalten bleiben!«
Daniel ignorierte das prustende Gelächter und schlenderte weiter, die Hände zu Fäusten geballt, wobei er versuchte, die schwelende Wut in seinem Inneren unter Kontrolle zu halten. Wenn er wollte, könnte er diese Idioten alle fertigmachen. Warum lenkte er nur immer alle Aufmerksamkeit auf sich? Er tat keinem etwas und hielt sich aus allem raus.
In seiner Faust kribbelte es, als würde er eine Armee Ameisen zerquetschen. Dieses elektrisierende Gefühl hatte er jetzt öfter. Es war keineswegs unangenehm. Manchmal glaubte er, Funken zu erkennen, die über seine Fingerspitzen hüpften. Er veränderte sich.
Vielleicht werde ich ja ein Superheld, die sind im echten Leben alle Loser. Er überlegte scharf. War er von einem radioaktiv verseuchten Insekt gebissen worden oder hatte er einen Stromschlag abbekommen? Das war ja nicht mehr normal, was er in den letzten Wochen erlebt hatte. Die immer deutlicheren Stimmen in seinem Kopf, dieses Mädchen aus der Hölle …
Zuerst hatte Daniel geglaubt, er leide an einer Geistesstörung. Er hatte die Medizinbücher seiner Eltern gewälzt und im Internet recherchiert, aber nichts gefunden, was seine Symptome erklärte. Superheld – das ist die einzige Lösung, dachte er schmunzelnd und hätte am liebsten irre gelacht. Einer von den bösen …
Leider sprach alles gegen den Helden.
Das nächste Grüppchen vor dem Klassenzimmer bildeten die Sportskanonen. Die Football-Spieler hatten sich um die Cheerleaderinnen geschart, um mit ihnen herumzualbern und über das letzte Spiel zu reden. Sie ließen ihn wenigstens in Ruhe. Da Daniel jedoch an Sport nie sonderliches Interesse gezeigt hatte, wollte er sich in deren Reigen nicht einreihen, obwohl der Trainer ständig versuchte, ihn zu überreden. »Du hast genau die richtige Statur und Ausdauer, um das Zeug zum Profi zu haben«, hatte Coach Wilkes schon mehr als einmal zu ihm gesagt.
Mal sehen, diese Option blieb ihm ja immer noch.
Natürlich existierte, wie auf jeder anderen Schule, auch auf der Little Peak High eine Strebergruppe, der er um nichts auf der Welt angehören wollte. Dazu waren seine schulischen Leistungen ohnehin zu mies. Diese Jungs und Mädchen hatten sich längst im Klassenzimmer versammelt und diskutierten über ihren aufgeschlagenen Büchern aktuelle politische Geschehnisse, wofür sich Daniel nicht im Mindesten interessierte.
Ja, was interessierte ihn eigentlich, außer seinen Computerspielen? Kein Wunder, dass er nirgendwo hineinpasste. Ich bin sowieso viel lieber allein und mag meine Ruhe, dachte er halbherzig.
Als er mitten durch die Streberversammlung lief, wichen die Schüler zurück und verstummten kurz, doch sobald er an ihnen vorbei war, redeten sie weiter, als wären sie nie unterbrochen worden.
Einzig eine Gemeinschaft ständig kichernder Mädchen schenkte ihm Aufmerksamkeit. Aber was wollte er als Hahn in einem Korb voll gackernder Hühner? Was für ein Albtraum!
Kaum einer hatte ihn richtig akzeptiert, und auch seine Mitschüler vom letzten Jahr hielten sich weitgehend von ihm fern.
Daniel hatte Glück, weil er sich einen der begehrten Fensterplätze sichern konnte, denn es war brütend heiß im Klassenzimmer. So hatte er außerdem die Uhr vom Pausenhof vor Augen. Er warf sein Geschichtsbuch auf den Tisch, schleuderte die Tasche darunter und setzte sich, wobei seine Knie fast die Platte berührten.
»Noch eine Stunde, dann ist endlich Wochenende«, sagte er leise zu sich, obwohl gerade erst die Herbstferien hinter ihm lagen.
Daniel hasste die Schule. Es war das erniedrigendste Ereignis seines Lebens, diesen Jahrgang wiederholen zu müssen. Jetzt war er als Ältester im Geschichtskurs zusätzlichem Gespött ausgeliefert.
Eine trockene Brise wehte durch das geöffnete Fenster, aber sie brachte nur mehr Hitze in das Zimmer. Zum x-ten Mal verfluchte Daniel das alte Schulgebäude, in dem keine Klimaanlage eingebaut war. Vermutlich waren sie die einzigen Schüler in Kalifornien, die unter der Hitze zu leiden hatten! Daniel konnte es kaum erwarten, bis er endlich draußen war. Er glaubte immer noch zu ersticken, zudem suchte ihn seit Wochen dieses innere Glühen, gleich einem Fieber, heim. Im kalifornischen Hinterland war es auch im Oktober oftmals unerträglich warm, weshalb die kühlen Nächte mehr nach Daniels Geschmack waren. Wenn er die Schule hinter sich hatte, wollte er an die Küste ziehen, das hatte er bereits letztes Jahr beschlossen. San Francisco oder Los Angeles fände er cool, da wurde es wenigstens nie so heiß und es ging stets ein frischer Wind. Sein Onkel Max lebte in L.A., der würde ihn bestimmt eine Weile bei sich wohnen lassen.
Widerwillig zog er sich den Kapuzenpullover aus und atmete auf. Sosehr er lange Klamotten liebte, heute ertrug er sie nicht.
Daniel hasste Little Peak! In drei Monaten wurde er achtzehn und dann hielt ihn keiner mehr auf. Er brauchte nur diesen verdammten Abschluss!
Tief in seinem Inneren war Daniel von einer eigenartigen Unruhe befallen. Bald würde in seinem Leben etwas Sonderbares geschehen, da war er sich sicher.
Superhelden existierten allerdings leider nur in Comics; es musste eine Begründung für seine körperlichen Symptome geben. Er war nichts Besonderes und sein Leben schon gar nicht.
Dennoch: Etwas war seltsam, außergewöhnlich seltsam sogar, wenn er von den Hitzewallungen und dem seltsamen Gefühl in den Fingern einmal absah, die kribbelten, als ob die Nerven dort vergeblich auf einen Befehl warteten. Da war oft dieses Pochen im Schädel, und ständig hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Zudem gab es da diese verrückte junge Frau und Stimmen in seinem Kopf …
»Ich sitze zu oft vor dem Computer, das ist alles«, murmelte er gedankenverloren.
Meine Güte – er führte schon Selbstgespräche!
»Hi!«, sagte plötzlich ein Mädchen, das an ihm vorbeiging und ihn kurz an der Schulter berührte, was ein angenehmes Prickeln an der Stelle zurückließ. Daniel hatte nur ihre schlanken Beine und den dunklen Rock gesehen, aber er wusste sofort, wer sie war. Außerdem roch sie unvergleichlich, wie die süßen Blumen, die seine Mutter diesen Frühling im Garten angepflanzt hatte.
Er blickte auf und drehte sich um. Das Mädchen mit dem schulterlangen braunen Haar hatte sich direkt hinter ihn gesetzt, und er musste ihm einfach zulächeln. Sein Herz schlug schneller. »Hi, Nessa.« Wenigstens ein Lichtblick.
Vanessa lächelte ebenfalls, doch leider fanden sie keine Zeit mehr, um miteinander zu reden, da ihre Geschichtslehrerin in den Raum marschierte.
Die nächste halbe Stunde verbrachte Daniel damit, die Uhr auf dem Pausenhof anzustarren und sich frische Luft zuzufächeln, denn Mrs. Kuwalskis Unterricht zu folgen war in etwa so aufregend wie einem Rind beim Kauen zuzusehen. Irgendwie hatte sie auch Ähnlichkeit mit einer Kuh.
Dieser Gedanke brachte ihn zum Schmunzeln.
»Daniel Taylor, wenn du nicht von der Schule fliegen möchtest, tätest du gut daran, im Unterricht besser aufzupassen!«, drang ihre schrille Stimme bis in sein Gehirn vor.
Daniel fuhr herum und strich sich eine Strähne aus der Stirn. Mist, hat sie mich was gefragt? Mit zitternden Fingern blätterte er in seinem Geschichtsbuch, damit er der Kuwalski nicht in die Augen sehen musste. Sie hatte ihm angedroht, ihn von der Schule zu verweisen, sollte er noch einmal durchfallen. Das kann sie nicht, sie will mich nur fertigmachen!
»Da heute so ein wunderschöner Tag ist«, sagte seine Lehrerin sarkastisch, »werde ich die Frage ein weiteres Mal stellen: Wer war der erste Präsident der Vereinigten Staaten und wann wurde er gewählt?«
Der erste Präsident? Daniels Gehirn lief auf Hochtouren, bevor er erwiderte: »George Washington.«
»Und weiter?« Die Kuwalski ließ nicht locker. »Wann … wurde … er … gewählt?«, fragte sie gedehnt.
Verdammt, er wusste es nicht!
Die anderen grinsten ihn an. Jedes Kind wurde bereits von klein auf mit der amerikanischen Geschichte geimpft und kannte die wichtigsten Daten auswendig, aber die Kuwalski brachte ihn dazu, alles zu vergessen! Außerdem interessierte Daniel weder die Geschichte noch die Politik seines Landes.
Warum musste die Kuwalski ausgerechnet immer auf ihm herumtrampeln? Aus jeder Pore brach ihm der Schweiß aus. Als ob ihm nicht heiß genug wäre! Die anderen aus seiner Klasse kicherten über seine Dummheit. Mann, wie sehr er das alles hier hasste!
»Die Antwort, Daniel!« Seine Lehrerin hatte die Hände in ihre schlanken Hüften gestemmt, während sie ihn mit ihrem Raubtierblick musterte.
Nein – verbesserte sich Daniel: mit ihrem Kuhblick. Die Kuwalski hatte riesige Augen, genau wie ein Rind. Ansonsten hätte sie richtig gut aussehen können, wenn sie ihr Haar nicht zu einem strengen Knoten gebunden tragen und so grimmig dreinschauen würde. Eine verbitterte Jungfer, hatte seine Mutter sie genannt, und Daniel gab ihr vollkommen recht.
Die Kuwalski hasst mich. Nur wegen dieser blöden Kuh bin ich durchgerasselt! Ich hatte die bessere Note durchaus verdient!, dachte er hektisch atmend. Etwas Gewaltiges braute sich in ihm zusammen, das kurz vor dem Ausbruch stand. Unter seinem Pult krallte er die Finger in den Stoff seines T-Shirts, wobei seine Sicht langsam verschwamm. Daniels Puls klopfte laut in den Ohren und sein Herz raste, als plötzlich ein leichtes Beben das Klassenzimmer erschütterte. Das war in dieser Gegend nichts Ungewöhnliches, schließlich glich der Untergrund Kaliforniens einer gesprungenen Glasscheibe. Die Forscher mutmaßten, dass »The Big One« kurz bevorstand, aber danach fühlte es sich nicht an.
Nachdem die Erschütterung, die keine zwei Sekunden gedauert hatte, vorbei war, waren Daniels körperliche Symptome auf einen Schlag verschwunden. Seltsam, ihm war auf einmal gar nicht mehr heiß!
Die Aufregung hatte sich schnell gelegt, doch die Kuwalski wartete immer noch auf Daniels Antwort.
»1789«, flüsterte Vanessa hinter ihm, worauf er beinahe vom Stuhl aufgesprungen wäre. Es hatte sich angehört, als hätte sie direkt in sein Ohr gesprochen, obwohl sie mindestens einen Meter hinter ihm saß. Was würde ich nur ohne dich machen, Nessa! Zum Glück hast du auch Geschichte belegt! Vanessa war der einzige Grund, warum er noch nicht schreiend gegen eine Wand gelaufen war. Sie beide besuchten einige Kurse gemeinsam, und Nessa half ihm, wo sie konnte.
»1789«, wiederholte er schnell, um sich seine Verwirrung nicht anmerken zu lassen. Natürlich war die Antwort richtig. Vanessa wusste immer alles, schließlich war sie die Jahrgangsbeste. Dennoch schien sie bei ihren Mitschülern beliebt zu sein. In jeder Gruppe war sie gern gesehen, besonders bei den »coolen Jungs«, was Daniel ungemein wurmte. Es ist mir egal, dass mich keiner mag und sogar Dad mich im Stich gelassen hat, dachte er trotzig, bis auf Nessa kann ich sowieso keinen von ihnen ausstehen.
»Das ist dir unmöglich selbst eingefallen, Daniel!« Die Kuwalski schritt zwischen den Tischen hindurch und blickte sich um, so, als ob sie etwas suchte. »Also, wer von euch hat ihm vorgesagt?«
Daniel glaubte, Vanessas beschleunigten Herzschlag zu hören und das leise Seufzen, das sie immer von sich gab, wenn sie aufgeregt war. Das musste an dieser extremen Hitze liegen, die Little Peak seit Wochen heimsuchte. Die hatte sein Hirn angebrutzelt. Oder er wurde langsam verrückt.
Superheldengehör, hoffte er insgeheim.
»Ich frage noch einmal: Wer hat ihm vorgesagt? Wenn ich nicht bald eine Antwort bekomme, lest ihr alle das Kapitel zu Ende und ich lasse morgen darüber eine Arbeit schreiben!«
Im Klassenzimmer herrschte Totenstille. Aus den Augenwinkeln bemerkte Daniel, wie Toby unruhig wurde. Der Junge mit dem kupferfarbenen Haar kaute an seinem Bleistift, als würde er an einem Hundeknochen nagen. Ja, du würdest Nessa gerne eins auswischen, du Ekel! Tobias Rafton war praktisch Vanessas größter Konkurrent, doch immer noch Streber Nummer zwei. Gegen Nessa kommst du nie an, sie ist viel zu schlau für dich!
Ein Kribbeln in den Haarwurzeln verriet Daniel, dass dieses Wiesel gleich seine Klappe aufmachen würde. Warum das so war, wusste Daniel nicht, aber es würde passieren, da war er sich sicher. Außerdem kannte er Toby mittlerweile recht gut. Er liebte es, den Lehrern in den Allerwertesten zu kriechen, um sich so einen zusätzlichen Bonus einzuheimsen. Er war in die Kuwalski verknallt, das erkannte ein Blinder. Für die Kuh tat er alles, er hielt ihr sogar die Türen auf.
Schon räusperte sich der sommersprossige Junge. »Ähem.«
»Ja, Tobias?« Mrs. Kuwalski fuhr herum und hob ihre schmalen Brauen.
Wut stieg in Daniel auf. Mit zusammengekniffenen Augen taxierte er von seinem Platz aus Tobias Rafton. Vanessa war Daniels Kumpel, seit sie zusammen im Sandkasten gespielt hatten; er würde nicht zulassen, dass sie seinetwegen Ärger bekam. Immerhin war die Kuwalski bekannt für ihre extrafiesen Strafen. Auch wenn Daniel jetzt nicht mehr so engen Kontakt zu Vanessa hatte wie früher, würde er alles dafür tun, um sie zu verteidigen. Sie war wie eine Schwester für ihn!
Tobias setzte gerade zum Sprechen an, als sich Daniel bis ins kleinste Detail vorstellte, wie er diesem Schleimscheißer seine Finger um den Hals legte und zudrückte. Zur selben Zeit hustete Toby los. Er griff sich an die Kehle, die Augen weit aufgerissen, und wedelte mit der anderen Hand wild in der Luft herum. Ein Aufruhr ging durch den Raum, und die Kuwalski stürzte an seinen Tisch, um ihm heftig auf den Rücken zu klopfen. »Junge, was hast du, ist dir nicht gut? Hast du dich verschluckt?«
Tobias schüttelte den hochroten Kopf, da er immer noch nicht sprechen konnte. Dafür war er zu sehr mit Luftholen beschäftigt.
Als er wieder zu Atem kam, liefen ihm Tränen über die Wangen. Er warf einen flüchtigen Blick auf Daniel, der selig vor sich hingrinste.
Die allgemeine Aufregung hatte dafür gesorgt, dass Toby den Mund hielt und die Kuwalski ihr Vorhaben mit der Klassenarbeit vergessen hatte.
Wow, telepathische Fähigkeiten! Aufatmend lehnte sich Daniel im Stuhl zurück und hoffte insgeheim, dass der Erstickungsanfall von Toby kein Zufall gewesen war.
»Hey, Danny, warte!«, rief Vanessa hinter ihm. Sie war die einzige Person, die ihn mit seinem Kosenamen ansprechen durfte. Sogar bei seiner Mutter rastete er jedes Mal aus, wenn sie ihn »Danny« nannte, doch Daniel mochte Vanessa. Deshalb ließ er ihr das durchgehen.
Er bremste sein Fahrrad leicht ab, da die Straße abschüssig war, bis Vanessa zu ihm aufschloss. Sie beide hatten keinen weiten Schulweg und fuhren meistens gemeinsam nach Hause, aber irgendwie verspürte Daniel heute den Wunsch, allein zu sein. Gerade geschahen in seinem Leben so viele merkwürdige Dinge, und er hatte keine Ahnung, warum das so war.
»Mensch, bin ich froh, dass Toby plötzlich diesen Hustenanfall bekommen hat. Ich hatte nämlich null Bock, das ganze Wochenende über den Strafaufgaben zu sitzen«, sagte Vanessa.
»Nicht auszudenken, wie das deinem Image geschadet hätte!« Daniel grinste zu Nessa hinüber, doch das Lächeln wollte nicht seine Augen erreichen. Er fühlte sich total erledigt. Er brauchte unbedingt eine eiskalte Dusche und eine Mütze voll Schlaf. Dennoch musste er ständig zu Vanessa sehen, die mit ihrem Mountainbike dicht neben ihm fuhr, wobei ihr langes, kastanienfarbenes Haar auf ihren Schultern flatterte. Sie trug eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock, unter dessen Saum beim Treten immer ein Knie hervorspitzte. Wie lang und schlank ihre Beine waren …
»Kommst du mit zum Baden, Danny? Ich wollte nachher an den Waldsee.«
Daniel hatte heute keinen Bedarf an Gesellschaft, obwohl ihm Vanessas Anwesenheit irgendwie guttat und ihr Angebot verlockend klang, besonders weil ja sonst nie jemand etwas mit ihm unternehmen wollte. Trotzdem sagte er: »Nee, zu heiß heute.«
»Na, du bist mir ja einer, deswegen will ich doch an den See.« Ihr Blick bohrte sich in ihn wie eine Schraube in weiches Holz. Vanessa besaß eine außergewöhnliche Iris: Sie war von solch einem intensiven Braun und mit goldenen Punkten gesprenkelt, dass Daniel für eine Weile nicht den Kopf abwenden konnte, weshalb er beinahe vom Weg abkam. Natürlich war ihm längst aufgefallen, was für ein hübsches Mädchen sie war, daher wunderte er sich, denn sonst hatte er ihr immer nur brüderliche Gefühle entgegengebracht. Aber da war auf einmal mehr. Etwas Neues, Aufregendes, das er nie zuvor verspürt hatte.
»Ich will erst meine Hausaufgaben machen.«
»Logisch!« Die Lippen gekräuselt, sah Nessa zum Himmel und verdrehte die Augen. »Du bist ja schon süchtig.«
»Hä?« Vanessa war eine Meisterin darin, das Thema zu wechseln, weshalb er ihren Gedankengängen manchmal nicht folgen konnte.
»Na, ich meine dich und deinen Computer. Gib doch zu, dass du ihm hoffnungslos verfallen bist. Selbst wenn die Welt um dich herum in Schutt und Asche versinken würde, wärst du nicht fähig, von ihm zu lassen.«
Nessa kannte ihn einfach schon zu lange, aber so extrem war er auch wieder nicht. Er schmunzelte. »Du übertreibst maßlos.« Daniel flüchtete sich tatsächlich gern in seine künstlichen Welten, in denen er sich vorstellte, ein Held zu sein, doch jetzt war er ein Held … oder würde bald einer sein. Hoffte er. Nur ein heimlicher Held, so wie Superman, der ansonsten sein einfaches Leben lebte. Daniel wollte nicht wirklich im Rampenlicht stehen. Ihm würde schon reichen, wenn die anderen ihn in Ruhe ließen.
Trotzdem sagte er: »Okay, ich geb’s zu, ich hab da so ein neues Spiel, total cool.«
Ihr Lächeln verschwand. »Schade, ein bisschen Sonne hätte dir mal gutgetan. Du bist so weiß um die Nase.«
»Das machen die schwarzen Klamotten.« Daniel konnte Vanessas Enttäuschung beinahe greifen, was ihn ein wenig traurig machte. Doch mit ihm ging gerade etwas vor sich, das er sich nicht erklären konnte, und das Letzte, was er brauchte, war eine andere Person, die das mitbekam. Daniel stieg in die Pedale, aber Vanessa hielt mit ihm mit.
»Kommst du wenigstens morgen mit mir zu Rebeccas Halloween-Party?«, fragte sie.
Sie ließ einfach nicht locker! Daniel seufzte innerlich. »Ich bin nicht eingeladen.«
In Vanessas Augen stahl sich ein Funkeln. »Ich schon, und ich darf jemanden mitbringen.«
»Warum nimmst du nicht Colleen mit zur Party? Ich dachte, sie ist deine beste Freundin?« Daniel staunte über ihre Hartnäckigkeit. Als Kinder hatten sie öfter etwas gemeinsam unternommen, doch in den letzten Jahren unterhielten sie sich fast nur noch auf dem Schulweg. Manchmal redete Nessa noch in der Pause mit ihm oder vor dem Unterricht, was er ihr hoch anrechnete, auch wenn er sich dann bemitleidet vorkam. Dass sie sich überhaupt mit einem Außenseiter wie ihm abgab, wunderte ihn.
»Coll fliegt mit ihren Eltern ins Disney World.«
Aha, daher wehte der Wind! Er sollte den Lückenbüßer spielen. »Und was ist mit Mary?«
»Mary darf nicht. Ihre Mom glaubt, Becky hätte einen schlechten Einfluss auf sie.«
»Ich weiß nicht …« Sie brauchte ihn ja nur, weil sonst niemand mitkam. Er hätte es sehr schön gefunden, wenn Nessa ihn einfach so irgendwohin eingeladen hätte.
Sie hat dich doch gerade gefragt, ob du mit zum See kommen willst, du Idiot, schalt er sich. Du hättest nur Ja sagen müssen. Egal was er tat, er machte es falsch. Die anderen sollen bloß nicht denken, wir hätten ein Date, redete er sich heraus. Daniel wollte nicht, dass Vanessa seinetwegen ebenfalls zur Außenseiterin wurde, dafür hatte er sie viel zu gern.
Obwohl der Weg vor ihnen abschüssiger wurde, gab Daniel weiterhin Gas. Dennoch klebte Vanessa wie eine Klette an ihm. »Es schadet dir bestimmt nicht, wenn du mal am Leben teilnimmst, anstatt den ganzen Tag in deiner dunklen Dachkammer zu sitzen!«, rief sie gegen den Fahrtwind an.
Vanessa hatte ja recht, aber im Moment ging es wirklich nicht. Zudem kündigten sich schon wieder diese quälenden Kopfschmerzen an, die ihn seit Wochen heimsuchten. Sie begannen mit einem harmlosen Pochen im Hinterkopf und verschlimmerten sich, je mehr er der Sonne ausgesetzt war. In seinem düsteren Zimmer überstand er die Anfälle noch am schnellsten. Der Fahrtwind, der sein Haar wild durcheinanderwirbelte und unter sein Shirt wehte, brachte kaum Linderung.
Daniel atmete auf, als sie in ihre Straße einbogen. Die typische Vorortsiedlung von Little Peak mit den klassischen Reihenhäusern und den tiefgrünen Rasenflächen war seine Heimat. Hier kannte Daniel jeden Winkel und jeden Nachbarn. Hier hätte er sich wohlfühlen können, aber etwas in seinem Inneren sträubte sich dagegen. Daniel lehnte sich in die Kurve und genoss die Geschwindigkeit, dann ließ er das Rad ausrollen.
Parallel zur Grayson Street, gleich hinter der Häuserreihe, lag ein kleines Waldstück, in dem Vanessa und er als Kinder viel Zeit verbracht hatten. Ihr altes Baumhaus existierte noch immer. Dorthin zog sich Daniel manchmal zurück, wenn sich der Rest der Welt anscheinend wieder gegen ihn verschworen hatte und er einen ruhigen Ort zum Nachdenken brauchte.
Nessa hatte ihn eingeholt, bremste und stieg vom Mountainbike ab. Auch Daniel blieb vor Vanessas Haus stehen, um sich von ihr zu verabschieden. Die Häuser ihrer Familien lagen direkt nebeneinander und glichen sich wie ein Ei dem anderen: Nummer 24 und 26 waren in einem hellen Beige gestrichen und bestanden aus zwei Stockwerken mit einem spitzen Dach, unter dem Daniel und Vanessa ihre Zimmer hatten. Vor der Veranda lag ein kleiner Garten, und in das Holzgebäude war eine Doppelgarage integriert, deren Tor weiß getüncht war.
Jetzt, wo der Wind nicht mehr für Abkühlung sorgte, schwitzte Daniel umso mehr. Sein Gesicht glühte, ein Schweißtropfen lief ihm ins Auge. Aus einem Reflex heraus hob er sein T-Shirt hoch, um sich mit dem Stoff über das Gesicht zu wischen, während er mit der anderen Hand sein Rad am Lenker festhielt.
»Der Wahnsinn«, flüsterte Vanessa, woraufhin er sein Shirt fallen ließ. Vanessa starrte auf seine Körpermitte, hob jedoch sofort den Blick.
Daniel räusperte sich. »Was?« Plötzlich war es ihm peinlich, dass sie seinen Bauch gesehen hatte. Ihm wurde noch heißer.
Vanessas Gesicht rötete sich. »Ich hab nichts gesagt.«
Daniel seufzte leise. Wahrscheinlich war er schon verrückt. Ihn verfolgte manchmal ein seltsam aussehendes Mädchen und er hörte Stimmen.
Dann lieber Superheld – allerdings war Daniel so weit bei Verstand, dass ihm diese Möglichkeit nicht sehr wahrscheinlich erschien.
Vanessa öffnete ihre Gartentür und hob die Hand. »Also, wir sehen uns.« Sie wirkte betrübt, und das verursachte in Daniels Magen ein unangenehmes Grummeln.
»Bye«, sagte er bloß, als er auf sein Rad stieg. Er fuhr eine Einfahrt weiter und direkt in die Garage hinein. Das Tor stand immer offen, wenn seine Mutter nicht zu Hause war. Seit Kurzem arbeitete sie wieder als Krankenschwester im Schichtdienst. Das war Daniel nur recht. Je weniger Menschen er um sich hatte, desto besser. Wenn seine Andersartigkeit aufflog, würden sie ihn bestimmt wegsperren.
So weit wird es nicht kommen, dachte er mit grimmiger Entschlossenheit, vorher hau ich ab. Dann sehe ich L.A. eben schon eher.
Vanessa stand vor ihrem Ankleidespiegel und ließ sich von einem Ventilator erfrischen. Kopfschüttelnd probierte sie den dritten Badeanzug an. »Nein, darin sehe ich ja aus wie ein Skelett!« Ihre Beckenknochen zeichneten sich leicht durch den Stoff ab. Ich bin viel zu dünn. Das macht mich kein bisschen weiblich, dachte sie frustriert. Schnell schlüpfte sie aus dem elastischen Material und entschied sich schließlich für den weißen Bikini. Der ließ ihre Brüste wenigstens ein bisschen größer wirken. »Wahrscheinlich möchte mich Danny deswegen nicht zum See begleiten«, murmelte sie. »Ich bin flach wie ein kleines Mädchen.« Dabei war es ihr so schwergefallen, ihn überhaupt zu fragen.
Seufzend schaute sie zum Fenster, vor dem sie zuvor die Jalousie heruntergelassen hatte, damit Daniel ihr nicht beim Umziehen zusehen konnte. Vanessa fand es äußerst praktisch, dass sie beide ihre Zimmer im Dachgeschoss hatten und sich die Häuser so gegenüberlagen, dass sie ihn immer beobachten konnte. Als Kinder hatten sie sich vor dem Schlafengehen Morsezeichen mit der Taschenlampe geschickt, aber diese Zeiten waren vorbei.
Schweren Herzens schüttelte sie den Kopf. Zur Party will er auch nicht mit mir, ach, verdammt, wenn ich nicht so schüchtern wäre, hätte ich ihn so lange gelöchert, bis er zugesagt hätte!
Vanessa beugte sich über ihren Schreibtisch, um eine Lamelle der Jalousie anzuheben. Als sie Danny entdeckte, der ebenfalls an seinem Tisch saß, der sich wie ihrer vor dem Fenster befand, griff sie nach dem Fernglas. Sie erkannte ihn auch ohne Vergrößerung über die paar Meter Entfernung, aber er hatte sein T-Shirt ausgezogen und da musste sie schließlich genau hinsehen! Sie hatte vorher schon eine Kostprobe von seinem muskulösen Bauch bekommen und war jetzt neugierig. Anscheinend war Danny gerade aus der Dusche gekommen, denn sein schwarzes Haar schimmerte feucht. Die dunklen Strähnen hingen wirr in sein Gesicht und ließen ihn verdammt gut aussehen. Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen lehnte er lässig in seinem Drehstuhl und starrte an die Decke.
Bei seinem Anblick bekam Vanessa weiche Knie und Herzrasen. »Wow!« So gefesselt war sie von seinem Anblick, dass es sie nicht einmal störte, als sich eine Büroklammer in ihren Ellbogen drückte. Jetzt die Nase in sein rabenschwarzes Haar vergraben und diesen schlanken Hals küssen, fantasierte sie und ließ den Feldstecher weiter an Daniel hinabwandern. Für seine siebzehn Jahre besaß er ungewöhnlich viele Muskeln, die ihr noch nie so deutlich aufgefallen waren wie heute. Zuletzt hatte sie ihn nackt gesehen, als sie beide als Fünfjährige im Planschbecken gesessen hatten. Schade, dass er nicht mit zum See kommen wollte, da hätte sie ihn sich genauer betrachten können. Vanessa freute sich, weil er einmal nicht vor dem Computer saß, sondern sich ihr derart freizügig präsentierte. Meistens war vor seinem Fenster den ganzen Tag die Jalousie heruntergelassen.
Früher waren sie öfter zusammen ein Eis essen gewesen, aber in letzter Zeit hatte sich ihre Beziehung verändert. Sie waren eben keine Kinder mehr. Leider. Da war irgendwie alles unkomplizierter gewesen.
Jeden Morgen, wenn Daniel zur Schule fuhr, passte sie ihn ab, und auf dem Pausenhof ließ sie ihn nie aus den Augen, da Vanessa am liebsten ständig in seiner Nähe sein wollte. Seit der Junior High ging das schon so. Immer wenn sie ihn sah, verkrampfte sich ihr Magen vor Aufregung, sodass sie deshalb oft nichts essen konnte. Beim Einschlafen dachte sie ebenfalls an Danny, an seine dunkelgrünen Augen und die Grübchen in den Wangen, wenn er mal lächelte. Was für ein Glück, dass ihr das Lernen so leichtfiel, sonst hätte sie bestimmt schon viele schlechte Noten mit nach Hause gebracht, weil sie Danny nicht mehr aus dem Kopf bekam.
»Was hast du nur mit mir angestellt?«, murmelte sie und seufzte.
Gerade als sie das Fernglas sinken lassen wollte, bewegte sich Daniel. Er drehte sich zu seinem Tisch und schien etwas aufzuschreiben.
Macht der tatsächlich schon seine Hausaufgaben? Seit wann ist er unter die Streber gegangen?
Als er ein großes Blatt Papier ans Fenster hielt, auf dem in dicken schwarzen Buchstaben stand: »Ich weiß, dass du mich beobachtest!«, blieb ihr fast das Herz stehen. Sie ließ die Lamelle der Jalousie los und fiel beinahe rückwärts vom Tisch. Ihr Puls raste. Mit seinen katzenhaften Augen schien er sie direkt anzusehen!
Wie konnte er das wissen? Danny besaß die Instinkte eines Raubtiers!
Unruhig lief sie in ihrem Zimmer auf und ab, wobei sie in ein helles T-Shirt und einen geblümten Rock schlüpfte. Wie peinlich, Danny hält mich bestimmt für einen Spanner! Oder er hat Verdacht geschöpft. O nein, was ist, wenn er jetzt vermutet, dass ich in ihn verknallt bin? Und was ist, wenn er das überhaupt nicht mag und von nun an kein Wort mehr mit mir spricht? Ihr wurde abwechselnd heiß und kalt. Aber ihre Neugier war einfach zu groß.
Vorsichtig schob sie wieder eine Lamelle nach oben, doch Daniel saß nicht mehr an seinem Schreibtisch. Dafür hatte er ein anderes Blatt ans Fenster geklebt, auf dem stand: »Okay, ich komme mit auf die Party.«
»Ja! Ja! Ja!« Freudestrahlend hüpfte Vanessa vom Tisch und tanzte im Zimmer herum wie ein verrückt gewordener Kobold.
Vanessa fühlte sich immer noch wie im siebten Himmel, als sie sich auf das Badetuch legte, um ihren nassen Bikini von der Sonne trocknen zu lassen. Der kleine See mit dem angrenzenden Wald war eine Freizeitoase für die Bewohner von Little Peak und lag am Fuße der Anhöhe, auf der die Stadt erbaut war. Im Sommer traf man hier beinahe jeden Einwohner, der nicht arbeiten musste oder anderweitig beschäftigt war, und auch jetzt – Ende Oktober – war es in diesem Teil Kaliforniens zum Baden warm genug. Fahrende Eisverkäufer und Imbissbuden luden zu einem Snack ein; es wurde Beachvolleyball, Basketball und Tennis angeboten. Außerdem gab es eine Minigolfanlage sowie einen großen Abenteuerspielplatz. Im weitläufigen Wald war erst letztes Jahr ein Weg für Rollschuhfahrer und Skater frisch geteert worden, und Little Peak konnte sich mit einem hochmodernen Trimm-dich-Pfad rühmen. Ein paar Mal hatte Vanessa das Angebot genutzt, um eine Runde zu joggen, doch weil sie fürchtete, dadurch noch dünner zu werden, hatte sie den Sport aufgegeben. Das war natürlich Unsinn, denn mit ein paar Muskeln mehr würde sie nicht so zierlich wirken. Vielleicht sollte sie die Ausreden nicht mehr gelten lassen und wieder mit dem Laufen anfangen.
Ein Marienkäfer turnte auf einem Gänseblümchen. Vanessa beobachtete verträumt, wie er versuchte, den nächstgelegenen Grashalm zu erreichen, während ihr die Sonne den Rücken wärmte.
Colleen berührte ihre Schulter. »Sieh mal, Nessa, ist das da hinten nicht Daniel, der grad ins Wasser geht? Der mit der blauen Badehose.« Colleen nickte unauffällig an das gegenüberliegende Ufer, wobei sie sich das feuchte, blonde Haar abtrocknete.
Sofort schlug Vanessas Herz schneller. Sie zog ihr Käppi tiefer in die Stirn und taxierte den großen Jungen mit den dunkelblauen Shorts. Obwohl er sich weiter weg befand, hatte sie ihn ebenfalls gleich erkannt. Er ist beinahe schon ein Mann, und ich hab nur so einen Minibusen, dachte sie. Das Ziehen hinter ihrem Brustbein zeigte ihr wieder, wie sehr sie in Danny verknallt war. »Er hat doch gesagt, er wolle nicht herkommen«, murmelte sie und spürte eine enorme Enttäuschung in sich aufsteigen. Er schämte sich wahrscheinlich, mit ihr gesehen zu werden.
»Er ist süß, hm?« Nachdem Colleen eine Brille aus ihrem Strohkorb gekramt hatte, blickte sie unverhohlen zum anderen Ufer. »Ja, er hat schon was, zumindest einen süßen Knackarsch.«
Nessa zuckte mit den Schultern und schob die plötzliche Hitze in ihrem Gesicht auf die gnadenlose Sonne. Obwohl Colleen ihre beste Freundin war, hatte Vanessa ihr bis jetzt nichts erzählt. Das mit Danny war ihr ganz persönliches Geheimnis.
»Schade, dass er so ein komischer Typ ist«, sagte Colleen, bevor sie ihre Brille in den Korb zurücklegte.
Nessa fuhr zu ihr herum. »Wie meinst du das?«
»Na ja, er ist irgendwie so … anders, und dann die langen schwarzen Schlabbersachen, die er immer anhat. Er sieht aus wie der Bruder von Gevatter Tod oder einer von diesen Gothic-Freaks.«
»Viele stehen auf schwarze Klamotten. An unserer Schule gibt es auch ein paar Goths. Ich finde die ganz nett. Die tun keinem was.«
»Wieso ist dann Daniel nicht bei ihnen? Er ist immer allein.« Colleen runzelte die Stirn. »Früher war das doch auch nicht so.«
Vanessa erinnerte sich ebenfalls, dass er ab und zu mit anderen Jungs unterwegs gewesen war. Wann hatte sich das geändert?
Colleen senkte die Stimme. »Ich kann es nicht genau erklären, aber ich finde ihn ein wenig unheimlich. Er guckt oft so finster, ist irgendwie … na anders.«
Nessa machte nur »hmm«, da sie Coll überhaupt nicht zustimmen konnte. Na ja, fast