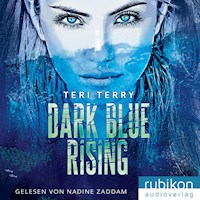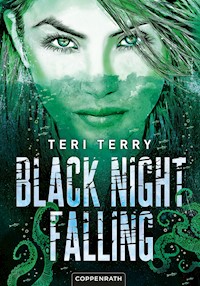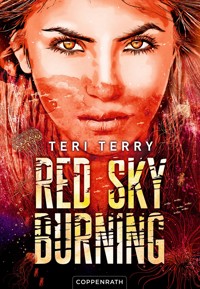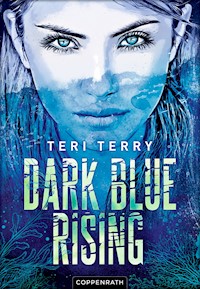
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Coppenrath Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Klima-Thriller Trilogie
- Sprache: Deutsch
Traue niemandem, das wurde Tabby immer wieder eingebläut. Und: Hüte dich vor dem Kreis! Mit ihrer Mutter Cate ist sie ständig unterwegs, zieht viel um – bis Cate plötzlich verhaftet wird und für Tabby eine Welt zusammenbricht: Cate war nie ihre Mutter, sondern hat sie als Kleinkind entführt! Die 16-Jährige versucht sich in ihrem neuen Leben mit ihren echten Eltern zurechtzufinden. Doch der einzige Ort, an dem sie sich wirklich zu Hause fühlt, ist das Meer. Eine innere Stimme lockt Tabby in die Tiefe und sie stellt fest, dass sie unglaublich lange tauchen kann. Haben Cates Hinweise auf den Kreis damit zu tun? Und ist sie wirklich die einzige, der es so geht? Tabby beginnt zu begreifen, dass ein ungeheuerliches Geheimnis in ihr schlummert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
eISBN 978-3-649-64092-9
© 2021 für die deutschsprachige Ausgabe
Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
First published in Great Britain in 2020 by
Hodder & Stroughton
Text copyright © Teri Terry, 2020
The moral right of the author has been asserted.
All characters and events in this publication, other than those clearly in the public domain, are fictitious and any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.
© 2020 by Teri Terry
Originalverlag: Hodder Children’s Books, an Imprint of Hachette Children’s Group, part of Hodder & Stroughton Originaltitel: Dark Blue Rising
Aus dem Englischen von Wolfram Ströle
Umschlaggestaltung: Frauke Schneider
Lektorat: Sara Falke
Satz: Sabine Conrad, Bad Nauheim
www.coppenrath.de
Die Print-Ausgabe erscheint unter der ISBN 978-3-649-63871-1.
Teri Terry
DARK BLUERISING
Aus dem Englischen von Wolfram Ströle
Täuscht euch nicht: Was uns bevorsteht, ist
eine Katastrophe nie da gewesenen Ausmaßes.
Danach muss unser Handeln beurteilt werden.
Seraphina RoseWissenschaftliche ChefberaterinDer Kreis
Zweifeln und Hoffen sind menschlich.
Wer nicht beides tut, macht es sich zu leicht.
Cassandra PennÄlteste und SeherinDer Kreis
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
DER KLIMA-THRILLER GEHT WEITER: »RED SKY BURNING« ERSCHEINT IM FRÜHJAHR 2022
1
Ich atme das Meer.
Mit geschlossenen Augen ziehe ich die Luft ganz langsam in mich hinein, bis die Welle, der ich folge, am Strand ausläuft. Als das Wasser wieder abfließt, entspanne ich mich und lasse die angehaltene Luft entweichen. Das Ausatmen dehne ich so lange aus, bis das Wasser mit der nächsten Welle zurückkehrt. Der Gleichklang meiner Atemzüge mit dem Auf und Ab des Wassers ist so perfekt, dass ich in eine Art Trance gerate und wie schlafend auf das Wasser hinaustreibe.
Ein Teil von mir ist allerdings noch wach, bei Bewusstsein. Zwar höre ich weiter nur das melodische Rauschen des Meeres, aber hat sich nicht soeben der Luftzug verändert, der über meine Haut streicht – ist da jemand?
Meine Lider flattern, ich schaue nach oben. Warme braune Augen erwidern meinen Blick. Ich lächle, strecke mich und setze mich auf.
»Ich dachte, du wärst eingeschlafen«, sagt Jago.
»Bin ich auch fast. Und ich dachte, du könntest heute nicht kommen.«
»Ich habe mir eine Ausrede einfallen lassen und bin früher gegangen.«
»Um mich zu sehen?«
Er grinst und wie durch Zauberei tauchen die Grübchen in seinen Wangen auf. »Richtig.«
Er setzt sich auf den feuchten Sand, dicht neben mich, aber ohne meinen nackten Arm mit seinem zu berühren. »Ich muss dir nämlich unbedingt was sagen.«
»Was denn?«
»Du wolltest mir deinen Namen ja nicht verraten, aber ich habe ihn herausgefunden. Ich habe dich gestern aus der Bibliothek kommen sehen. Die Bibliothekarin meinte, du würdest Tabitha heißen.«
Sofort regt sich in mir das schlechte Gewissen. Die einzige Bibliothek, die ich von hier aus erreichen kann, ist der Bücherbus in Boscastle, und der kommt nur alle vier Wochen. Und ich kann schlecht im Bus sitzen und lesen. Damit ich Bücher ausleihen durfte, brauchte die Frau allerdings meinen Namen, und ich wollte sie so unbedingt lesen, dass ich ihr meinen echten gesagt habe, obwohl ich das nicht sollte. Und jetzt kennt Jago ihn auch.
»So heißt du doch? Tabitha?«
»Sie hat mir versprochen, ihn an niemand weiterzugeben, solange ich die Bücher pünktlich zurückbringe.«
»Es ist nicht ihre Schuld. Ich habe sie ausgetrickst und so getan, als würde ich ihn schon kennen. Da hat sie ihn gesagt.«
»Ach so.« Ich blicke zu ihm auf und überlege, was ich antworten soll. Aber wenn ich in diese Augen sehe, kann ich nichts anderes als die Wahrheit sagen. »Ja, ich bin Tabitha – oder eigentlich Tabby. Aber verrate es niemand.«
An seinen Augenwinkeln bilden sich Fältchen. »Okay, Tabby, Vorschlag: Ich sage es niemand, aber du gibst mir dafür deine Nummer.«
Meine Nummer? Ich bin einen Moment lang verwirrt, dann begreife ich, was er meint. »Du meinst, meine Handynummer? Ich habe keins.«
»Kein Handy?« Er reißt überrascht die Augen auf.
»Nein.«
»Dann eine Festnetznummer.«
Ich schüttle den Kopf.
»Heißt das, du willst sie mir nicht sagen oder du hast kein Festnetz?«
»Ich habe keins.«
Er sieht mich verblüfft und zweifelnd an, als sei der Umstand, kein Telefon zu haben, mit dem man erreichbar ist, so unglaublich, dass es eine Lüge sein muss.
»Ehrlich«, sage ich. »Wir haben so was nicht. Aber wir könnten uns morgen Nachmittag wieder hier treffen.«
»Und wenn etwas dazwischenkommt und du nicht kommen kannst? Nimm meine Nummer, nur für den Fall.«
Ich schüttle den Kopf, denn mir fällt nichts ein, das mich daran hindern sollte, morgen hier zu sein. Das Gefühl, einen Freund für mich zu haben, jemanden, der lächelt, wenn er mich sieht, der sich mit mir unterhält und mich jeden Tag treffen will, ist noch so neu. Ich könnte gar nicht wegbleiben. Aber er besteht darauf. Als ich einwende, dass ich nichts zum Schreiben habe, sagt er mir die Nummer so oft, bis ich sie richtig wiederholen kann. Ob ich ihn je anrufen werde? Ob ich mich das traue?
Die Sonne wandert weiter über den Himmel. Bald kommt Cate von ihrem zweiten Putzjob zurück, und wenn ich dann nicht zu Hause bin und sie fragt, wo ich gewesen bin und was ich getan habe – also, was sage ich dann? Einfach so mit einem Fremden zu reden, verstößt gegen zu viele Regeln. Wenn sie es erfahren würde, würde sie es sofort verbieten.
»Ich muss gehen«, sage ich und klaube meine Sportschuhe aus dem Sand. Aber als ich Jago wieder ansehe, ist sein Lächeln verschwunden und sein Blick auf etwas hinter mir gerichtet. Ich höre Schritte, Stimmen. Lachen.
Ich drehe mich um und da kommen vier von ihnen auf uns zu – drei Jungen und ein Mädchen. Sie starren mich an wie Abfall, den die Flut an Land gespült hat. Hinter ihnen lungern in einiger Entfernung noch mal zwei Jungen herum.
Hastig stehen wir auf.
»Wirklich, Jago, wie kannst du so tief sinken?«, fragt das Mädchen. Aus ihrem Blick spricht Empörung, Geringschätzung und noch etwas. Eifersucht?
»Das geht dich nichts an«, erwidert Jago.
»Wer ist das?«, fragt einer der Jungen und mustert mich auf eine Art, die mir überhaupt nicht gefällt.
»Niemand«, antwortet ein anderer. »Sie kommt von den Wohnwagen, die da oben auf dem Hügel stehen. Die dürfen bestimmt nicht lange bleiben.«
»Am besten, man jagt sie möglichst schnell weg. Dad meint, wenn sie bleiben, fallen die Immobilienpreise.«
Sie lachen. Jago verteidigt mich nicht, bleibt stumm. Vielleicht hat er nicht gewusst, dass ich von den Wohnwagen komme, und verschwindet jetzt gleich. Dabei dachte ich, er sei mein Freund und ich könnte ihm vertrauen. Aber Stadtmenschen sind doch überall gleich. Und er ist auch einer, obwohl er mir anders vorkam.
In meinem Kopf höre ich Cates Stimme. Lass dich nicht von dummen Leuten provozieren, Tabby. Beachte sie einfach nicht. Und ich befolge ihren Rat ausnahmsweise einmal, wende mich ab und gehe über den Sand zu der steilen steinernen Treppe, die zum Küstenpfad hinaufführt.
Schritte folgen mir.
»Die ist irgendwie niedlich.«
»Komm ihr nicht zu nah, sonst fängst du dir noch was ein.«
»Wir können sie ja erst mal gründlich waschen.«
In ihren Stimmen schwingt eine Schärfe mit, die über Spott hinausgeht. Wo ist Jago? Warum hat er nichts zu ihnen gesagt oder warum kommt er jetzt nicht mit mir mit? Während ich noch darüber nachdenke, weiß ich schon, was ich tun muss:
Weglaufen!
Ich erreiche die Treppe und versuche, die stechenden Schmerzen der spitzen Steine unter meinen nackten Füßen zu ignorieren, aber sie machen mir meinen Fehler bewusst: Ich bin keine gute Läuferin. Ich hätte mich in Richtung Meer wenden sollen. Dann wären sie mir nicht gefolgt, und selbst wenn, könnten sie doch niemals so schnell schwimmen wie ich.
Ich komme oben an und laufe Richtung Straße.
Noch ein Schritt und noch einer und noch einer – dann packt mich jemand von hinten am Arm und reißt mich zu sich herum.
»Lass mich los!«, rufe ich und füge noch einige Worte hinzu, die Cate nicht gerne hören würde. Schon dass ich sie überhaupt kenne, würde ihr missfallen. Aber der Junge dreht mir den Arm auf den Rücken.
»Igitt, was für ein Dreckstück! Wir müssen ihr den Mund auswaschen«, sagt ein zweiter. Auch die anderen haben uns eingeholt, nur Jago nicht und die beiden Jungen, die weiter weg waren. Ich wehre mich verzweifelt, aber da hält plötzlich einer eine Flasche in der Hand und zieht meinen Kopf nach hinten. Ich huste und spucke, weil etwas ganz widerlich schmeckt – irgendwas mit Alkohol –, und die Jungen lachen.
Ich drehe mich um und stoße dem, der mich festhält, mit aller Kraft den Ellbogen in den Bauch. Er geht zu Boden.
Das Mädchen packt mich an den Haaren, aber ich bin jetzt außer mir, hole mit der Faust aus und treffe sie seitlich gegen das Gesicht. Sie stolpert rückwärts gegen die anderen beiden.
Noch mal: Lauf! Vor lauter Adrenalin und Angst spüre ich meine Füße nicht mehr. So schnell wie möglich renne ich zum Ende des Wegs, zur Straße und dann –
Scheinwerfer –
Kreischende Bremsen –
Etwas trifft mich mit voller Wucht und ich fliege durch die Luft.
2
»Sie ist aus dem Nichts aufgetaucht. Es ist nicht meine Schuld.« Eine körperlose Stimme dringt durch die Nacht.
Hände berühren mich, und ich öffne die Augen, will mich dagegen wehren, aber mit der Bewegung kommen Schmerzen, wie ich sie noch nie gespürt habe, und jetzt weine ich.
»Bleib liegen«, sagt eine Frau und ich konzentriere mich auf sie und auf ihre Stimme statt auf die Schmerzen. »Alles ist gut, wir sind Sanitäter. Wir kümmern uns um dich. Wie heißt du?«
»Tabby«, bringe ich flüsternd heraus, bevor mir einfällt, dass ich das ja gar nicht sagen darf.
»Wo tut es weh, Tabby?«
»Überall«, sage ich. Dann reiße ich mich zusammen. Mein linker Arm brennt, als stünde er in Flammen, mein Kopf dröhnt. »Am Arm. Am Kopf.«
Sie befestigen etwas an meinem Hals und Rücken.
»Wir müssen dich hochheben.« Da ist noch jemand, ein Mann, auf der anderen Seite. Ich bewege mich und in meinem Arm explodieren die Schmerzen. Ich schreie.
»Riechst du das?«, sagt der Mann. »Wahrscheinlich betrunken.«
»Nein!«, versuche ich zu protestieren. Der Geschmack ist immer noch da und mir ist übel.
»Pst!«, sagt die Frau. »Das ist jetzt nicht wichtig.«
Der Krankenwagen ist innen hell erleuchtet und ich schließe die Augen. Mit eingeschalteter Sirene fahren wir schlingernd die holprige Straße hinauf und ich schreie wieder.
Eine Nadel sticht in meinen Arm. »Jetzt müsste es gleich besser sein, Liebes«, sagt die Frau. »So, wie heißt du noch gleich? Wo wohnen deine Eltern?«
Erzähl Fremden nichts von uns, sagt Cate immer. Aber wie soll sie mich finden, wenn ich es nicht tue?
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also halte ich die Augen geschlossen und schweige.
Grelle Lampen ziehen flackernd und schwankend über mich hinweg, während ich einen Gang entlanggerollt werde, und mir ist wieder, als würde ich dahintreiben wie vorhin am Meer. Ist das ein Krankenhaus? Ich war noch nie in einem.
Ich höre Stimmen. Sprechen sie über mich?
Eine Frau – nicht die Sanitäterin, eine andere – tritt neben mich. »Hi, Tabby, richtig? Wie heißt denn deine Mutter, Liebes?«
»Cate«, antworte ich, wieder ohne es zu wollen, und die Angst kehrt zurück. Sag niemand unsere Namen. Niemand. Ich habe diese Regel jetzt schon so oft gebrochen. Was wird passieren?
»Und mit Nachnamen?«
Aber vor lauter Angst antworte ich nicht und sage auch nichts mehr.
»Wir nehmen dir jetzt Blut ab und röntgen dich«, sagt eine andere Stimme munter. Ich spüre wieder einen schmerzhaften Stich, in meinem rechten Arm. Ein Röhrchen wird an den Arm gehalten und füllt sich rot. Dann ein zweites.
Ich werde auf meinem Wagen weitergeschoben und schließe die Augen.
Die Zeit vergeht. Jemand reinigt einen Schnitt an meinem Fuß. Es brennt. Die Frau, die sich an mir zu schaffen macht, spricht mit jemand anders über meine Füße. Sie wundert sich, warum man sie nicht gerichtet hat. Was meint sie damit? Als sie fertig ist, ziehe ich die Füße verlegen unter die Decke.
Als Nächstes sitze ich halb im Bett und sehe zu, wie ein Mann nasse Binden um meinen Arm wickelt. Er redet darüber, was er tut, sagt, dass es ein vorläufiger Gips ist und ich, sobald die Schwellung abklingt, noch einmal für den endgültigen kommen muss.
Dann sagt er: »So, alles fertig, Tabby. Der Gips braucht ein paar Tage, um durchzutrocknen, also pass gut darauf auf.« Mein Arm liegt auf Kissen hochgestützt, und er meint, ich muss ihn hochhalten, die Hand höher als den Ellbogen, und ab und zu die Finger bewegen, um sicherzustellen, dass der Gips aufgrund der Schwellung nicht zu eng wird.
Dann höre ich Stimmen hinter uns und eine davon kenne ich. Cate? Ich bin erleichtert, als sie eintritt, und zugleich habe ich Angst, dass sie kommen musste, weil ich ihren Namen angegeben habe. Denn das hier ist offiziell, eine staatliche Einrichtung. Wir sollten nicht hier sein.
»Tabby! Was ist passiert? Was machen Sie mit ihr?«
»Es tut mir leid«, flüstere ich.
»Sie wurde von einem Auto angefahren«, sagt der Mann. »Sie hat den Arm gebrochen – ein glatter Bruch, der keine Probleme machen dürfte –, außerdem hat sie eine leichte Gehirnerschütterung und ein paar kleinere Kratzer und Schnitte an den Füßen.«
Eine andere Frau ist hinter Cate hereingekommen. »Sie sind Tabbys Mutter?« Cate nickt. »Wir brauchen noch ein paar Angaben. Können Sie einen Moment mitkommen?«
Die wollen Dinge über mich wissen? Das gibt Ärger.
»Was brauchen Sie denn? Warum?«, fragt Cate.
»Nur das Übliche – Name, Adresse und so weiter – und wir müssen Tabbys Akte finden. Ihr Blut zeigt eine Anomalie …«
Ich schreie auf, als hätte ich schreckliche Schmerzen, und Cate wendet sich von dem Mann ab und kommt zu mir. »Ach, Schatz. Können Sie uns bitte einen Moment allein lassen?«
»Natürlich.« Die anderen verschwinden hinter einem Vorhang.
Cate berührt mit der Hand meine Wange und küsst mich auf die Stirn, und ich wünsche mir, dass sie mich in die Arme nimmt. Aber sie richtet sich wieder auf und späht durch den Vorhang auf die andere Seite. »Wir müssen verschwinden«, flüstert sie. »Glaubst du, du kannst gehen?«
»Ich weiß nicht«, sage ich und habe Angst, dass die Schmerzen wieder so schlimm sind wie vorher, wenn ich mich bewege. Ich will mich aufsetzen, aber in meinem Kopf dreht sich alles. »Mir ist schwindlig. Ich habe eine Spritze mit irgendwas bekommen.«
Cate hilft mir dabei, mich ganz aufzusetzen. Es ist schwierig, wenn ich den linken Arm nicht verwenden kann, und ich starre ihn an. Der Knochen da drin ist gebrochen? Schon beim Gedanken daran wird mir übel.
»Es war nicht meine Schuld«, sage ich.
»Erzähl es mir später.«
Ich schwinge meine nackten Füße über die Seite des fahrbaren Betts. Cate stützt mich erneut, als ich mein Gewicht nach vorn verlagere und aufstehe. Alles dreht sich um mich und ich falle fast vornüber. Dann trete ich vorsichtig mit dem verbundenen Fuß auf. Er ist wund, aber es geht. Ich sehe mich nach meinen Schuhen um, aber sie sind nicht da. Ich muss sie beim Laufen fallen gelassen haben.
»Ich helfe dir«, sagt Cate. »Schnell jetzt.«
Sie legt den Arm um mich und ich stütze mich auf sie. Wir schlüpfen durch den Vorhang gegenüber von dem, durch den die Leute vom Krankenhaus verschwunden sind, und umrunden ein anderes Bett. Die Patientin, die darin liegt, eine alte Frau, sieht uns mit hochgezogenen Augenbrauen an, sagt aber nichts.
Wir laufen an einigen weiteren Betten mit Vorhängen vorbei, zu einer Tür und dann in einen Gang.
Meine Schritte werden sicherer und wir beschleunigen und kommen schließlich zum Eingang des Krankenhauses. Cate wendet das Gesicht ab und bedeutet mir mit einem Stups, dasselbe zu tun – weg von einigen Überwachungskameras. Dann gehen wir nach draußen in die Dunkelheit. Es ist Nacht? Ich war länger hier, als ich dachte.
Wir überqueren den Parkplatz zu unserem Auto. Cate hat mir gerade beim Einsteigen geholfen, da fährt ein Polizeiauto an uns vorbei. Am Krankenhausportal bleibt es stehen. Angst steigt in mir auf. Ist die Polizei wegen uns da?
Cate schimpft leise und steigt ein. »Das war knapp«, sagt sie und fährt rückwärts aus der Parklücke.
»Was würde passieren, wenn wir jetzt noch drinnen wären?«
»Keine Sorge, wir sind es ja nicht. Vielleicht hat das auch gar nichts mit uns zu tun.« Aber daran, wie sie es sagt, merke ich, dass sie es selbst nicht glaubt.
»Und jetzt?«, frage ich, obwohl ich es weiß. Das hier passiert schließlich immer wieder – nur normalerweise ohne Krankenhaus und gebrochenen Arm. Und ohne Jago. In meiner Verwirrung und vor Schmerzen schiebe ich jeden Gedanken an ihn vorerst weit weg.
»Es ist Zeit, wieder aufzubrechen«, sagt Cate. »Wir sind schon viel zu lange hier, wenn jemand dich namentlich kennt und zu mir kommt, um mir zu sagen, dass du einen Unfall hattest – obwohl das in diesem Fall sehr hilfreich war. Zum Glück habe ich das Auto erst heute aufgeladen.« Unter sorgfältiger Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung verlassen wir den Parkplatz. Beim Kreisverkehr fährt Cate links ab, dann beschleunigt sie.
»Und unser Wohnwagen – holen wir den noch?«
»Er hat uns gebremst, findest du nicht auch?«
Ich seufze. Die Wirkung der Spritze scheint nachzulassen. Meine Kopfschmerzen kehren allmählich zurück und der Arm pocht.
»Können wir in Cornwall bleiben? Oder wenigstens irgendwo am Meer?«
»Mal sehen. Versuch jetzt zu schlafen, Tabby.«
Trotz meiner Angst, der Schmerzen und des Ruckelns des Autos – oder vielleicht auch deswegen – dämmere ich allmählich ein. Beliebige Gedanken und Bilder schießen mir durch den Kopf und verschwinden gleich wieder.
Warum können wir nicht bleiben? Nicht nur hier, sondern irgendwo?
Weil sie uns dann holen würde, die Polizei. Genau wie Cate immer gesagt hat – und heute Abend ist sie gekommen. Cate hatte recht.
Gesichter. Die Sanitäterin, sie war nett. Die freundliche Frau im Krankenhaus mit der Spritze. Der Mann, der meinen Arm eingegipst hat.
Komm fremden Leuten nicht zu nah, sie sind gefährlich. Die Warnung geht mir durch den Kopf, obwohl Cate gar nichts sagt. Anscheinend habe ich sie so oft gehört, dass sie zu einem Teil von mir geworden ist und immer in mir nachklingen wird.
Vielleicht hatte sie auch mit Jago recht. Aber die Sanitäter und die Ärzte und Schwestern im Krankenhaus haben mir doch geholfen, oder?
Doch sie haben mir auch etwas weggenommen. Leuchtend rote Röhrchen mit Blut, das sie ohne Erlaubnis aus meinem Arm geholt haben. Anomalie? Was ist das?
Sie werden keine alte Akte über mich finden – es gibt keine –, aber sie haben noch einen Teil von mir: mein Blut.
Meine Bücher und Notizbücher sind noch in unserem Wohnwagen. Weg. Muscheln, die ich gesammelt habe, ein paar glatt geschliffene Holzstücke. Sonst war da nichts Wichtiges, aber trotzdem, es waren meine Sachen und jetzt sind sie es nicht mehr.
Später fahren wir auf der Autobahn und mich überkommt eine andere Art von Schmerz. Nicht körperlich, viel schlimmer. Wir fahren vom Meer weg. Ich spüre, wie es sich immer weiter von uns entfernt, und mit jeder Kurve, die unser Auto fährt, stirbt ein Teil von mir.
Sonne … Meer … Erde … Himmel …
Sonne … Meer … Erde … Himmel …
Unablässig gehen mir diese Worte durch den Kopf, gesprochen von einem vielstimmigen Chor der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft:
Sonne … Meer … Erde … Himmel …
3
Ein Teil von mir wacht, der Rest ist in einem Traum gefangen. Ich will mich in einer imaginären, unwirklichen Welt verlieren und nicht in das Hier und Jetzt zurückkehren. Ich habe Schmerzen.
Je angestrengter ich versuche einzuschlafen, desto wacher werde ich, bis ich schließlich aufgebe und die Augen öffne. Das Auto hat angehalten und Cate ist weg. Wir stehen vor einem heruntergekommenen Gebäude. An seiner Längsseite sind Türen mit Nummern darauf und dazwischen Fenster. Ein Hotel?
Schritte ertönen und da ist Cate wieder. Sie schließt das Auto auf und öffnet die Tür auf meiner Seite.
»Wir bleiben hier?«, frage ich.
»Nur für heute Nacht. Lass mich dir helfen.«
Es ist schwierig mit dem gebrochenen Arm auf derselben Seite wie die Tür. Zuerst schwinge ich die Beine hinaus und stöhne. Alles tut weh. Wenn man von einem Auto angefahren wird, ist das vermutlich so. Dann rutsche ich auf dem Sitz vor und Cate beugt sich zu mir herunter und nimmt meine rechte Hand. Es gelingt mir, mein Gewicht so weit nach vorn zu verlagern, dass ich aussteigen kann.
Es ist warm, aber ich fröstle trotzdem. Cate hilft mir. Zum Zimmer sind es nur ein paar Schritte.
Drinnen stehen zwei schmale Doppelbetten. Eine Tür führt offenbar zum Klo. Cate bugsiert mich auf das nächstgelegene Bett.
»Ich bin gleich wieder da«, sagt sie und verschwindet nach draußen. Bei ihrer Rückkehr hält sie in der einen Hand einen Koffer, in der anderen ein paar Tüten. »Ich habe einige Sachen mitgenommen. Nur für den Fall«, sagt sie. Dabei war im Grunde schon alles klar, als sie erfuhr, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Schon da wussten wir beide, dass wir verschwinden mussten.
Sie zieht den Reißverschluss des Koffers auf, und ich muss lächeln, als ich auf einigen Kleidern den blauen Umschlag eines Notizbuchs von mir sehe – eins, an dem mir besonders viel liegt. Cate hat es letztes Jahr zu meinem fünfzehnten Geburtstag für mich gemacht, aus dickem Recyclingpapier. Auf den Einband hat sie das Bild Die große Welle von Hokusai kopiert, auf den Rücken mit einem Kalligrafiestift Tabbys Notizbuch geschrieben. Ich liebe es so sehr, dass ich es noch nicht übers Herz gebracht habe, etwas hineinzuschreiben.
»Danke, dass du es mitgenommen hast«, sage ich.
»Dafür habe ich nicht an Ersatzschuhe gedacht«, sagt Cate. »Wir besorgen dir welche. Willst du etwas essen?«
Ich schüttle den Kopf und zucke zusammen. »Ich will nur wieder schlafen.«
»Gut.« Sie hilft mir behutsam, mich hinzulegen, deckt mich zu und bettet meinen Arm vorsichtig auf einige Ersatzkissen. Die Matratze ist wulstig, aber es ist immer noch besser, als im Auto zu schlafen.
Ich schließe die Augen.
»Du bist nicht allein«, sagt Cate und beginnt zu singen, ein Lied ohne Worte, einen Heilgesang. Ihre Hände berühren mich ganz leicht an Arm und Kopf, während sie singt, und als Reaktion darauf breitet sich Wärme in mir aus.
Ich frage mich, was die im Krankenhaus wohl von so was halten würden.
Vor gar nicht so vielen Jahren wurde mir erst klar, wie sehr wir uns von den Menschen in unserer Umgebung unterscheiden. Sogar der Name, den ich für Cate habe, ist anders – Cate, nicht Mum. Auf meine Frage hat sie mir erklärt, wir seien Mutter und Tochter, Tochter und Mutter, Schwestern, beste Freundinnen. Egal, was für eine Bezeichnung wir verwenden würden, wir seien alles zugleich füreinander. Und sie hat recht. Äußerlich mögen wir verschieden aussehen – meine langen Haare sind schwarz, die Augen graugrün, während Cate das Gegenteil ist, blond und blauäugig –, aber so wie die Nacht den Tag braucht und der Tag die Nacht, um überhaupt zu existieren, so sind wir beide eins. Unsere Herzen schlagen zusammen, als würden wir in derselben Haut stecken.
Die Wärme breitet sich immer weiter aus, ich höre Cates Stimme, und der Schlaf kommt – diesmal für den Teil von mir, der im Auto wach gewesen ist. Der Teil, der jetzt noch wach bleibt, ist meine wilde Hälfte, die, die keine Worte verwendet. Sie hält Wache, während Cate singt, und meine Verletzungen beginnen zu heilen.
4
Hunger holt mich aus meinem Traum. Ich will mich strecken, aber der Gips an meinem Arm verhindert es – es fühlt sich seltsam fremd an, etwas an mir befestigt zu haben, das eigentlich nicht zu mir gehört. Wenigstens sind die Schmerzen nicht mehr so stark wie gestern Abend.
»Guten Morgen. Tee?« Cate hält mir eine Tasse hin.
»Ja, bitte.«
Als ich mich aufsetze und sie mir die Tasse reicht, knurrt mein Magen so laut, dass sie es hört, und wir lachen beide. »Wieder Appetit?«, fragt sie.
»Ich habe einen Mordshunger.«
»Ein gutes Zeichen.«
Sie ist schon angezogen und greift in eine Einkaufstasche aus Leinen. Offenbar war sie schon einkaufen, während ich geschlafen habe. Es gibt Orangensaft, Obst, Nüsse – sogar vegane Sandwichs hat sie aufgetrieben. Das meiste essen wir rasch auf. Ich merke, wie Cate auf die Uhr blickt und dann aus dem Fenster späht. Sie will los, deshalb beeile ich mich. Ob sie fürchtet, dass die Polizei uns hier findet?
Nach einer Katzenwäsche am Waschbecken, bei der Cate mir hilft, den Gips trocken zu halten, machen wir uns zum Aufbruch fertig. Wir tragen heute andersfarbige T-Shirts als gestern. Cate steckt mir die Haare hoch und bindet ein Tuch um ihre. Sie sorgt dafür, dass wir anders aussehen, und das macht mich noch nervöser, als ich sowieso schon bin. Hastig suchen wir unsere Sachen zusammen, wobei ich mit nur einem Arm keine große Hilfe bin. Schließlich treten wir durch die Tür nach draußen.
»Wo ist unser Auto?«
»Ich habe es verkauft«, antwortet Cate. »Jetzt haben wir dafür das hier.« Sie geht zu einer alten Karre in einem nichtssagenden Grau unter viel Dreck und Rost. Ich mache große Augen. Hat sie unser Auto verkauft, weil womöglich jemand es gesehen und den Behörden gemeldet hat?
Vorsichtig steige ich ein, während Cate unsere Sachen auf den Rücksitz stellt. Ich habe unser Auto geliebt und weiß, dass Cate es auch geliebt hat. Und weil es ein Elektroauto war, war es auch so viel umweltfreundlicher. Ich habe geholfen, es auszuwählen – das leuchtende Blau, meine Lieblingsfarbe –, und habe es noch vor ein paar Tagen gewaschen und poliert. Es ist einfach so unfair! Dieses Auto ist so alt, dass es natürlich nur mit fossilen Brennstoffen fährt, und es sieht aus, als sei es seit Jahren nicht mehr gewaschen worden.
Cate lässt den Motor an. Er röhrt ohrenbetäubend laut, wie ich finde, aber wahrscheinlich auch nicht lauter als die meisten Autos, die nicht elektrisch betrieben werden. Cate fährt auf die Straße hinaus und schon bald haben wir den kleinen Ort hinter uns gelassen und sind auf der M6, hinter uns eine Spur von giftigen Auspuffgasen.
»Ich weiß, dass es nicht das richtige Auto für uns ist«, sagt Cate. »Aber wir müssen diesen Kompromiss vorläufig eingehen. So kommen wir schnell voran und können weite Strecken fahren. Das geht nicht, wenn wir ständig zum Aufladen anhalten müssen.«
»Wohin fahren wir?«
»Kurzer Zwischenstopp im Lake District, dann sehen wir weiter.«
Ich blicke aus dem Fenster. Die Straße fliegt an uns vorbei, und die Anziehungskraft des Meeres wird abwechselnd schwächer und stärker, je nachdem, wie weit die Autobahn gerade davon entfernt ist. Es ist wie ein Jucken tief in mir, an einer Stelle, an der ich mich nicht kratzen kann.
»Erzählst du mir, was gestern passiert ist?«, fragt Cate.
Ich seufze voller Unbehagen, will aber auch reden. »Soll ich wirklich?«
»Nur wenn du willst.« Sie wirft mir einen seitlichen Blick zu. »Ein Junge namens Jago kam zu mir und hat mir gesagt, wo du warst. Er kannte deinen Namen.«
Ich beiße mir auf die Lippen.
»Er war ein netter, lieber Junge, ich konnte das spüren und verstand, warum du ihm vertraut hast. Aber du musst vorsichtig sein, Tabby. So jemand kann auch gegen seinen Willen von den Behörden dazu benutzt werden, uns eine Falle zu stellen.«
»Ich weiß. Es tut mir leid.«
»Es ist schwer, fremde Leute je ganz zu kennen und zu wissen, wozu sie fähig sind. Sie sind anders als wir.«
Das stimmt wirklich. Ich verstehe das jetzt besser als vorher, auf eine tiefere, persönlichere Art. Jago hat mich nicht verteidigt und nichts gesagt, er hat nicht einmal versucht, mir zu helfen. Vielleicht hat er nachträglich erfahren, was mir passiert ist, ein schlechtes Gewissen bekommen und Cate ausfindig gemacht, um ihr zu sagen, wo ich bin.
»Jago ist dafür das beste Beispiel«, sagt Cate. »Er wirkt nicht wie jemand, der sich prügelt, aber er hat es offenbar doch getan.«
»Wie meinst du das?«
»Er hatte Schrammen und Schnitte am Auge und an der Wange. Und eine aufgeplatzte Lippe.«
Ich starre sie entgeistert an. Jago muss zu Cate gelaufen sein, kurz nachdem ich ins Krankenhaus gebracht wurde. Was ist ihm in der Zwischenzeit zugestoßen? Als die Jugendlichen kamen, waren da noch zwei Jungen weiter weg. Später, als ich verfolgt wurde, waren sie nicht mehr da. Hat Jago sich mit ihnen geprügelt? Vielleicht hat er mir nicht geholfen, weil er nicht konnte. War ich so mit Weglaufen beschäftigt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass eigentlich er Hilfe gebraucht hätte?
»Aber die Verletzungen waren nicht schlimm?«
»Sie werden schneller heilen als deine«, sagt Cate. »Willst du mir jetzt von ihm erzählen?«
»Ja.« Ich mache eine Pause. »An den Nachmittagen, an denen du geputzt hast, bin ich immer zum Strand gegangen.«
»Okay. Bei Tintagel?«
»Anfangs ja. Aber dann habe ich einen Strand unterhalb des Küstenwegs entdeckt – Bossiney Cove. Man kommt da nicht so leicht runter, deshalb ist er ziemlich leer. Jedenfalls habe ich dort vor ein paar Wochen Jago getroffen. Er hat mich angesprochen, aber beim ersten Mal bin ich weggelaufen.«
»Und dann?«
Und dann: Ich erinnere mich und erzähle Cate, was passiert ist. Ich habe mich irgendwie verloren gefühlt, einsam und angezogen vom Meer, auf der Suche nach etwas, das ich brauchte, ohne zu wissen, was es war. Die Nähe des Meeres hat mich nicht beruhigt wie sonst, sondern meine Sehnsucht noch verstärkt. Aber ich konnte auch nicht von ihm wegbleiben.
Und dann war da plötzlich Jago. Als hätte ich ihn gerufen – jemand aus einer anderen Welt.
Beim ersten Mal bin ich vor ihm weggelaufen. Dann habe ich mir gewünscht, ich hätte es nicht getan und er würde wiederkommen.
Was er auch tat, gleich am folgenden Tag. Diesmal bin ich geblieben, habe ihm zugehört – bis seine Stimme mit dem melodischen Rauschen des Meeres zu einem Geräusch verschmolz.
Dann begann ich, auch mit ihm zu sprechen. Es war ganz leicht, obwohl er so anders war. Weil ich nicht über mich sprechen wollte, erzählte er mir von sich, von seinem Leben, seinen Eltern und seinen beiden Schwestern. Wo sie wohnten, was sie taten und worüber sie zu Hause stritten. Zum Beispiel benutzte seine kleine Schwester immer sein Handy für Spiele. Er fand das alles langweilig, aber das war es nicht für mich: Für mich war es ein Einblick in eine andere Art zu leben.
»Wann hast du ihm deinen Namen gesagt?«
»Gar nicht.« Ein weiteres Geständnis ist fällig. »Ich habe ihn der Bibliothekarin in Boscastle gesagt, um Bücher ausleihen zu können. Jago hatte ihn von ihr.«
»Verstehe.« Jetzt seufzt Cate. »Also weiß nicht nur ein Junge mit schönen Augen Bescheid, sondern eine weitere Person. Das ist noch gefährlicher, Tabby. Deinen Namen in einer Bibliothek anzugeben, kommt dir vielleicht nur wie ein kleiner Ausflug in die Welt der anderen vor, aber er könnte sich auswachsen und dich mir für immer wegnehmen.«
Tränen steigen mir in die Augen. »Es tut mir leid. Ich hätte nie gedacht …«
»Bitte, Tabby, denk in Zukunft immer zuerst nach. Jetzt erzähl mir den Rest über Jago.«
»Wir haben uns täglich an derselben Stelle am Strand getroffen, am späten Nachmittag, wenn er mit der Schule fertig war und du beim Putzen warst. Gestern wollte er eigentlich gar nicht kommen. Seine Schwester hatte Geburtstag, hat er gesagt. Aber plötzlich war er doch da.«
»Und wie kam es, dass dich dann ein Auto angefahren hat?«
Ich erzähle ihr alles – von den anderen Jugendlichen und was sie gesagt haben. Was passiert ist, als sie mich verfolgt haben. Ich sehe, wie Cates Hände das Steuerrad immer fester umklammern, während ich rede.
»Das tut mir alles schrecklich leid, Tabby.«
»Es ist nicht deine Schuld.«
»Nein? Vielleicht hätte ich dich besser auf so etwas vorbereiten sollen. Manche Leute sind wirklich gemein. Aber du hast gut daran getan wegzulaufen. Vor ein Auto zu rennen war weniger gut. Wie geht es dir jetzt?«
Schlecht wegen Jago, vielleicht weil ich ihm zuerst zu viel und dann zu wenig vertraut habe. Und ich fühle mich schuldig, als hätte ich Cate im Stich gelassen, weil ich nicht besser auf mich aufgepasst habe. Aber ich weiß, dass sie etwas anderes meint. »Ganz gut. Der Arm pocht ein wenig. Die im Krankenhaus haben gesagt, er könnte noch mehr anschwellen. Außerdem tut mir der Fuß weh und ich habe Kopfschmerzen.«
»Du Arme. Ich bin froh, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist.«
Das Gespräch mit Cate über Jago und die Erinnerung daran, wie ich mich bei unserer Begegnung gefühlt habe, haben mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hatte das wunderbare Gefühl, in Jago einen Freund zu finden, nicht nur mit ihm zu tun, sondern auch mit dem Ort. Dem Meer, dem Strand und dass ich einen Platz für mich gefunden habe. Zu wissen, dass der Strand – und auch Jago – sich jetzt mit jeder Meile weiter von mir entfernen, tut mir innerlich weh.
»Wohin fahren wir?«, frage ich Cate wieder.
»Wir werden sehen«, sagt sie, dieselbe Antwort wie zuvor, aber diesmal gebe ich mich nicht damit zufrieden.
»Was heißt, wir werden sehen?«
»Also, das hängt davon ab.«
»Von was?«
»Davon, wo ich einen Job finde. Und von anderen Sachen, die eintreten oder auch nicht.«
Ich seufze, zuerst verärgert und dann wütend – nicht auf Cate, sondern auf alles: die ganze Welt und unser Leben in ihr. Zuzuhören, wie Jago von seiner Familie erzählt hat, hat mich auf den Gedanken gebracht, dass es gar nicht so schlecht wäre, einen festen Wohnort zu haben. Bei Jago klang es nicht so, als würden die Behörden ihm und seiner Familie ihr Leben vorschreiben, sondern als könnten sie tun, was sie wollten – oder als glaubten sie das zumindest – und ist das nicht im Grunde dasselbe?
Allerdings ist die Polizei nicht hinter ihnen her wie hinter uns. Liegt es daran, dass sie tun, was man von ihnen erwartet? Dann sind sie, wie Cate schon oft gesagt hat, nicht wirklich frei. Die Freiheit ist nur Schein, wenn man immer den Weg geht, der einem vorgeschrieben wird.
Aber wäre das so schlimm, solange man es nicht weiß?
»Ich will nicht woandershin, mir hat es dort gefallen«, sage ich leise. Meine Wut hat sich gelegt, ist dem Gefühl schmerzlichen Verlusts gewichen. Trotz dem, was gestern passiert ist, hat es mir an unserem letzten Wohnort wirklich gefallen. Ich hatte fast das Gefühl, als würde ich dort hingehören oder als gehörte der Ort zu mir.
»Das weiß ich, Tabby, und ich finde es ja auch schade. Aber nachdem du im Krankenhaus warst, hätte man uns nicht mehr in Ruhe gelassen. Wir mussten weg.«
Erschauernd sehe ich in Gedanken das Polizeiauto an uns vorbei zum Krankenhauseingang fahren und weiß, dass sie recht hat. Aber das macht es nicht leichter.
Wieder überkommt mich Müdigkeit und ich schließe die Augen. Meine Verletzungen, die jetzt anfangen zu heilen, sind der Grund, warum ich mehr Schlaf brauche. Ein Teil von mir döst ein, während der andere wacht. Meile für Meile zieht die Landschaft an uns vorbei und ich träume von Jago und dem Meer.
5
Was aus der Ferne zuerst wie Hügel aussieht, wird höher und wächst zu Bergen heran, die uns nach und nach umgeben. Wir fahren immer weiter, und das endlose tote, ausgedörrte Land, das wir in den von Trockenheit heimgesuchten Midlands durchquert haben, verblasst zu einer Erinnerung. Das üppige Grün des Lake District hebt meine Stimmung, was allerdings nicht nur an der veränderten Landschaft liegt. Ich habe das Gefühl, als würde ich die Gegend kennen, als sei ich schon einmal hier gewesen. Ich genieße das ungewohnte Gefühl des Nachhausekommens in vollen Zügen, das Grün und die Schönheit des Frühlings.
Nach einer Weile biegen wir auf eine schmale Straße ein, die um einen See führt. In meiner Gier nach Wasser – sogar Süßwasser – trinke ich ihn förmlich mit den Augen. Jetzt bin ich mir sicher: Ich kenne diese Gegend. Aber wir kehren nie an einen Ort zurück, zumindest haben wir das bisher noch nie getan.
»Wir waren schon hier, stimmt’s?«, sage ich.
»Ja.« Cate klingt überrascht. »Aber das war vor vielen Jahren – du warst noch klein. Du erinnerst dich daran?«
»Ja.« Eine angenehme Wärme erfüllt mich bei dem Gedanken, an einen Ort aus meiner Vergangenheit zurückzukehren – zu spüren, dass ich hier vor langer Zeit glücklich war. »Bleiben wir hier?«
»Nein, das geht nicht. Wir machen nur einen kurzen Besuch. Ich muss etwas abholen, bevor wir weiterfahren.«
Wir umrunden einen zweiten See, dann geht es bergauf, zwischen Bäumen hindurch. Schließlich biegt Cate in eine kleine Straße ein, die eigentlich nur ein Weg ist. Wir holpern sie entlang, und ich überlege, ob das Auto nicht gleich auseinanderfällt.
Schließlich halten wir an einem Haus, das von Bäumen verdeckt wird. Einem geheimen Versteck. Auf dem Dach und an der offenen Seite des Hauses sind Sonnenkollektoren angebracht – der Winkel, in dem das Dach sich zum Boden absenkt, macht deutlich, dass es für diesen Zweck gebaut wurde.
»Warte kurz«, sagt Cate. Sie öffnet die Tür und steigt aus. Zwei riesige Hunde springen bellend auf sie zu.
»Halt!«, sagt eine Stimme – ein Mann. Die Hunde bleiben stehen und starren Cate mit gesträubten Nackenhaaren an. Der Mann kommt um die Ecke des Hauses. Er hält eine Schrotflinte in den Händen, die auf Cate gerichtet ist, aber dann senkt er sie.
»Ist das die Möglichkeit? Ist das wirklich Catelyn?«, fragt er.
»Schön, dich zu sehen, Eli.«
Er schüttelt den Kopf, als könnte er seinen Augen nicht trauen, und gibt den Hunden ein Kommando. Sie setzen sich und wedeln mit dem Schwanz, während der Mann Cate umarmt. Cate sagt etwas zu ihm, das ich nicht hören kann, und er wendet sich zum Auto.
»Das kann doch nicht Tabby sein.« Er macht die Tür auf, sieht den Gips an meinem Arm. »Warst du im Krieg?« Ich starre ihn an und versuche, mich zu erinnern. Damals hatte er, glaube ich, einen Bart. Ich hatte zuerst Angst vor ihm und dem Haus, aber dann wurden wir Freunde. Er hat mich auf seinen Schultern herumgetragen.
Lächelnd steige ich aus. Ich kann mich schon besser bewegen als gestern. Er umarmt auch mich, wobei er auf meinen Arm aufpasst, und stellt mich den Hunden vor: Bear und Max. Sie sind jetzt, wo wir miteinander bekannt gemacht wurden, wie Riesenwelpen, die spielen wollen. Dabei fällt mir ein anderer Hund ein, sanft, aber größer als ich. Gem?
»Die beiden sind Gemmas Jungs«, sagt der Mann. Ich habe mich richtig an ihren Namen erinnert und das macht mich glücklich. »Könnt ihr zwei bleiben?«
»Nur heute Nacht«, sagt Cate.
Später liege ich gemütlich auf dem Sofa, an Bear geschmiegt und mit Max zu meinen Füßen. Zum Glück ist das Sofa groß. Im Kamin brennt ein Feuer und ich bin am Einschlafen. Cate und Eli sitzen am Küchentisch hinter mir, Kerzen werfen ihre Schatten an die Wände. Sie unterhalten sich vor allem über Politik. Eli glaubt, die Welt steuert auf eine Katastrophe zu und dass es, wenn der Staub sich gelegt hat, nur noch Leute wie ihn geben wird, die wissen, wie man überlebt und sich schützt. Er meint, wie sollten länger bleiben, und ich weiß schon, was Cate darauf antworten wird. Aber ich frage mich auch, ob ich das überhaupt will. Eine Weile ist es hier schön, mit den Hunden. Aber sonst ist hier niemand, niemand in meinem Alter. Und seit ich Jago kennengelernt habe, wird mir allmählich klar, wie wichtig das ist.
Und sowieso, warum sollte man überleben wollen, wenn man dann ganz allein ist?
6
Ich knie mich hin und vergrabe das Gesicht in Bears Fell, während Max mir die Ohren leckt. Vielleicht brauchen wir ja gar keine anderen Menschen.
Ich warte im Auto, während Cate und Eli sich auf ihre Weise verabschieden. Sie müssen sich wirklich nahestehen, wenn sie sich so umarmen, nach so vielen Jahren. Über Cates Schulter hängt eine weitere, kleine Tasche – sind wir deswegen gekommen? Sie geht zum Auto, öffnet den Koffer auf dem Rücksitz, legt die Tasche hinein und zieht den Reißverschluss wieder zu.
Sie schaut nicht zurück, als wir fahren, aber ich schon. Eli sieht uns nach und ich winke ihm. Im nächsten Moment ist er verschwunden.
Bei dem Blick, mit dem er Cate gestern Abend angesehen hat, kam mir eine Frage, und jetzt, wo wir allein sind, kann ich sie stellen. »War Eli dein Freund?«
»Könnte man wohl sagen. Es ist lange her.«
»Du hast gesagt, man dürfe niemandem trauen, aber du hast ihm doch wohl vertraut, wenn er dein Freund war?«
Ihre Lippen zucken. »Ich habe ihn verstanden und darauf vertraut, dass er so ist, wie ich ihn kannte. Das ist nicht dasselbe wie vollkommenes Vertrauen. Manche Dinge würde ich ihm nicht sagen. Konntest du dich an Eli erinnern?«
»Ein wenig. Und an seinen anderen Hund, Gem. Können wir auch einen Hund haben?«
»Ich glaube, das wäre nicht fair gegenüber dem Hund. Wir ziehen zu oft um.«
Und ich weiß, dass sie recht hat, aber ich habe Sehnsucht – nach einem Haus, einem Hund, einem Ort zum Bleiben.
Nach einem Leben, das ich nie hatte.
Stunden später halten wir an einer Raststätte. Wir finden Segeltuchschuhe, die mir einigermaßen passen, und ich bin froh, dass ich nicht mehr barfuß herumhumpeln muss.
Cate kauft Proviant. Ich sehe mir die Zeitungen eines Kiosks an. Jede zweite Schlagzeile klagt über das schmelzende Packeis, ertrinkende Inseln und den Tod des großen Korallenriffs in Australien. Die anderen verurteilen die Auswirkungen von Klimastreiks auf die Wirtschaft und fordern etwa, dass man keine Klimaflüchtlinge aufnehmen soll. Aber das sind auch nur Menschen wie wir, deren Land überschwemmt wurde oder verdorrt ist. Sie wollen bloß einen sicheren Ort zum Leben. Wenn alle sagen, dass sie draußen bleiben sollen, wohin sollen sie dann gehen?
Und was ist mit uns, Cate und mir? Sind wir wie Klimaflüchtlinge, die niemand will? Der Junge vom Strand sagte, wir dürften bestimmt nicht lange bleiben, und er hatte vermutlich recht.
»Du bist so still«, sagt Cate, als wir zum Auto zurückkehren. »Tut dein Arm weh?«
»Ein bisschen.« Ich zucke mit den Schultern. Er tut weh, aber ich habe nicht daran gedacht.
Wir steigen ein, und ich drehe mich auf dem Sitz zur Seite, um den Sicherheitsgurt mit der rechten Hand zu fassen zu bekommen.
»Warte noch«, sagt Cate. Sie schnallt sich nicht an und startet auch nicht den Motor. Stattdessen nimmt sie meine rechte Hand in beide Hände, und als hätte sie meine unausgesprochenen Gedanken gehört, die ich vor so vielen Meilen hatte, antwortet sie jetzt darauf.
»Es tut mir leid, Tabby. Es wird immer schwieriger für dich, aber du weißt genauso gut wie ich: Wenn wir nicht untertauchen und ständig in Bewegung bleiben, finden die Behörden uns. Das System hat bestimmte Steckplätze für Menschen und wir passen da nicht rein. Sie würden dich mir wegnehmen und du müsstest eine Uniform tragen, zur Schule gehen und immer wenn eine Glocke läutet, aufstehen und dich setzen. Das ist wie im Gefängnis.« Sie berührt meine Wange. »Das verstehst du doch, ja?«
Ich nicke. Schon der Gedanke, man könnte mich Cate wegnehmen, macht mir Angst. Wir gehören zusammen. Kein Junge oder Strand, kein Haus oder Hund könnte mir je wichtiger sein, als dass wir zusammen sind und frei.
»Sag es laut für mich, bitte.« Zwischen Cates Augen erscheinen Sorgenfalten, ihre Wangen wirken plötzlich eingefallen.
»Ich verstehe es.«
Sie lächelt. »Braves Mädchen. Ich hab dich lieb, Tabby. Egal was passiert, du darfst nie vergessen, dass ich dich lieb habe.«
Egal was passiert … wie zum Beispiel? Was könnte denn passieren? Mein Hals ist auf einmal merkwürdig eng und ich rücke näher zu ihr. Sie legt den Arm um mich.
»Ich hab dich auch lieb, Cate«, flüstere ich in ihre Haare.
Tochter, Mutter.
Mutter, Tochter.
Schwestern.
Beste Freundinnen.
Alles.
Immer.
7
Wir erreichen schließlich Manchester. Cate kennt dort einen Laden, wo sie vielleicht für Trinkgeld arbeiten kann. Sie will aber nicht, dass ich sie begleite. Es handelt sich um irgendeinen Club.
Ich warte im Auto bei eingeschaltetem Radio, aber egal wie oft ich durch die Kanäle zappe, ich finde keinen Song, der mir gefällt, und so schalte ich es bald wieder aus. Ich steige aus und setze mich auf den Rücksitz, ziehe den Reißverschluss des Koffers auf und entdecke mein Notizbuch mit der Großen Welle auf dem Einband. Aber noch bin ich nicht bereit, in die leeren Seiten einzutauchen und etwas darauf einzutragen, das dann für immer dort steht. Ich habe mich noch nicht entschieden, für was ich es verwenden will. Alles braucht einen Sinn und Zweck, damit es nicht verschwendet ist.
Und doch … eins könnte es sein: ein Ort der Erinnerung. Für Dinge, die ich aufschreibe, um sie nicht zu verlieren.
Ich schlage es auf, aber statt zur ersten Seite gehe ich gleich zur letzten. Ich zögere kurz, dann, bevor ich meine Meinung ändern kann, schreibe ich rasch eine Zahlenfolge hinein: die Nummer, die ich für Jago auswendig lernen musste. Jetzt brauche ich nicht mehr an sie zu denken. Ich muss nicht überlegen, ob ich ihn anrufe, oder fürchten, dass ich seine Nummer vergessen habe, wenn ich ihn später mal anrufen will. Sie ist da, wenn ich sie brauche.
Ich schließe das Notizbuch wieder und will es in den Koffer legen, da fällt mein Blick auf die Tasche, die Cate in den Koffer gesteckt hat, als wir von Eli abgefahren sind. Was wohl in ihr drin ist? Ich bin neugierig, zögere aber. Cate hat mir nicht verboten, hineinzusehen, oder?
Ich hole sie heraus. Sie ist schwer für ihre Größe und ziemlich prall gefüllt. Ich ziehe den Reißverschluss auf.
Sie steckt voller kleiner Filzbeutel und Schächtelchen – alle mit Schmuck gefüllt. Richtig teuer aussehendem Glitzerzeug. Ich nehme einen schweren goldenen Armreif in die Hand, ein dickes Teil, in das blaue und grüne Steine eingelegt sind. Das Gold ist wie Wellen geformt und die Farbe der Steine lässt mich an das Meer denken. Der Reif ist wunderschön. Außerdem gibt es Ohrringe, eine Uhr – die nicht die richtige Zeit anzeigt – und verschiedene Ketten und Ringe. Alles unglaublich, aber der Armreif ist mein Liebling.
Warum hatte Eli das alles? Hat er es für Cate aufbewahrt oder hat es ihm gehört und er hat es ihr geschenkt?
Ich schiebe den Reif über mein Handgelenk, halte ihn einmal so und dann so, um zu sehen, wie er an meinem Arm wirkt.
Plötzlich kriege ich Angst, jemand könnte vorbeikommen und den Schmuck entdecken. Ich vergewissere mich, dass die Türen abgeschlossen sind, und sehe mich um. Vom Ende der Straße kommt Cate auf mich zu. Schuldbewusst verstaue ich alles wieder im Koffer. Als sie das Auto erreicht, halte ich mein Notizbuch in Händen, so als ob ich deshalb hinten sitze.
Ich steige aus. »Wie ist es gelaufen?«
»Ich habe den Job.« Sie wirkt darüber nicht besonders froh. »Für eine Weile ist er gut. Aber jetzt brauchen wir noch ein Zimmer zum Übernachten.«
Später liege ich im Bett und Cate auf einem Sofa auf der anderen Zimmerseite – an ihren Atemzügen merke ich, dass sie schläft. Das Zimmer ist noch schlimmer als das, in dem wir nach der Flucht aus dem Krankenhaus abgestiegen sind. Cate hat einen Stuhl unter den Türgriff geschoben, als sei ihr das alles hier auch nicht ganz geheuer.
Mein Arm pocht und juckt unter dem Gips, und ich umklammere die linke Hand mit der rechten, als müsste ich sie nur fest genug drücken, damit das Bedürfnis, mich am Arm zu kratzen, aufhört. An meinem rechten Handgelenk habe ich erst vor ein paar Stunden den glänzenden Armreif getragen. Mit diesem Armreif hatte es etwas Besonderes auf sich, etwas, das ich nicht erklären kann. Als hätte er zu mir gesprochen. Ich sehne mich danach, ihn wieder in die Hand zu nehmen, wieder zu tragen.
Und das liegt nicht nur daran, dass er so hübsch war – obwohl er das war, anders als jedes andere Schmuckstück, das ich bisher gesehen habe. Da war mehr.
Ich spüre Arme um mich, die mich drücken. Ein dumpfes Pochen ertönt von dort, wo mein Kopf an ihrer Brust liegt. Eine Hand streicht mir die Haare aus dem Gesicht, und ich strecke den Arm aus und berühre, was die Hand am Handgelenk trägt.
Es glänzt und seine Farben leuchten wie das Meer. Meine Augen gehen zu, aber ich sehe ihn trotzdem noch, den feurigen Kreis, der durch meine Träume wirbelt.
8
»Ich dachte schon, du wachst überhaupt nicht mehr auf.« Als ich die Augen öffne, sitzt da Cate mit einer Teetasse in den Händen und sieht mich an.
»Alles in Ordnung?«, fragt sie. »Du bist blass.« Sie steht auf und legt mir die Hand auf die Stirn. Ihr Blick ist besorgt.
»Ich habe Kopfschmerzen«, gebe ich zu. »Ich konnte nicht einschlafen.«
Ich spüre ihre Nähe, ihre Wärme. Ihre Hände massieren meine Schläfen, mit einer beruhigenden Stimme singt sie leise die Schmerzen weg.
Ich blicke zu ihr auf und lächle. »Danke. Jetzt geht es mir schon viel besser.«
»Gut. Wir haben auch einiges vor.«
»Checken wir wieder aus?«
»Ja. Komm, es ist Zeit aufzustehen.«
Als ich kurz darauf aus dem Bad komme, hält Cate die Tasche aus dem Koffer in den Händen.
»Ich will dir etwas zeigen«, sagt sie. Sie zieht den Reißverschluss auf und kippt den Inhalt auf das Bett. Nacheinander holt sie heraus, was sich in den Samtbeuteln und kleinen Schachteln befindet. Es blitzt und funkelt noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Eigentlich sollte ich ihr jetzt sagen, was ich getan habe, aber ich tue es nicht, ohne dass ich einen Grund dafür nennen könnte.
Stattdessen frage ich sie, was mir gestern durch den Kopf gegangen ist: »Was sind das für Sachen? Hat Eli sie dir geschenkt?«
»Nein. Ich habe ihn vor langer Zeit gebeten, sie für mich für einen Regentag aufzubewahren. Im Moment scheint zwar die Sonne, aber da braut sich schon was zusammen. Ich dachte, wir könnten ein paar Sachen verkaufen und von dem Geld eine Weile in einem besseren Zimmer wohnen.«
Cate geht den Schmuck durch und sortiert aus, was sie verkaufen will. Sie hebt den Armreif hoch und hält ihn mir hin. Ich zögere. »Na los«, sagt sie und ich nehme ihn in die Hand.
Das kühle, schwere Metall auf meiner Haut lässt mich erschauern, aber nicht, weil mir kalt wäre. Ich habe das seltsame Gefühl, als würde ich ihn jetzt halten und zugleich damals, und mit damals meine ich nicht gestern im Auto. In meinem Traum hat er sich anders angefühlt – wärmer und größer. Oder lag es daran, dass meine Hand kleiner war? Wenn ja, dann muss es lange her sein.
»Alles in Ordnung, Tabby?«
»Ja. Ich meine, keine Ahnung. Ich glaube. Es ist nur etwas mit diesem Armreif.«
»Gefällt er dir?«
»Er ist wunderschön.«
»Probier ihn an.«
Ich zögere, dann schiebe ich ihn über das rechte Handgelenk, wie ich es gestern getan habe, und halte ihn in die Sonne am Fenster. Die blauen und grünen Steine fangen das Licht ein und spiegeln es, wie sie es in meinem Traum getan haben. Ich muss unwillkürlich lächeln.
Dann nehme ich ihn wieder ab und will ihn Cate zurückgeben. Sie schüttelt den Kopf und schließt mit ihren Händen meine Finger darum. »Er gehört dir.«
»Wirklich?«
»Ja. Wir können ein paar von den anderen Sachen verkaufen.«
»Bist du sicher?«
»Behalte ihn«, sagte Cate. »Trage ihn. Er passt zu einem hübschen Mädchen wie dir.« Ich lächle über das ungewohnte Kompliment. Nicht dass Cate mir nie Komplimente machen würde, aber ich glaube, hübsch hat sie mich noch nicht genannt. Sie sagt immer, die Leute seien zu sehr mit ihrem Aussehen beschäftigt und zu wenig mit ihren Gedanken.
Beim Anblick des Schmucks auf dem Bett frage ich mich unwillkürlich: Wo kommt das alles her? Beinahe spreche ich es laut aus, aber dann fällt mein Blick wieder auf den Armreif und ich sage nur: »Danke.«
9
Wie sich herausstellt, ist es ganz leicht, Schmuck zu verkaufen, wenn man weiß, wo man hingehen muss. Cate sagt, ich soll in ihrer Nähe bleiben und den Armreif unter meinem Ärmel verstecken. Wir besuchen ein Pfandhaus und dann noch eins. Der Trick, so erklärt Cate, ist, in jedem Laden nur einen Gegenstand zu zeigen und sich vorher umzusehen und zu überlegen, an welchem Stück man dort am ehesten interessiert ist. Wenn die Pfandleiher gleich mehrere Schmuckstücke sehen, wollen sie einen Preis für alles zusammen machen und zahlen weniger.
In jedem Geschäft ändert Cate ihren Namen und ihre Geschichte. Wenn man sie nach einem Ausweis fragt und sie sagt, er sei gestohlen worden oder sie hätte ihn zu Hause vergessen oder er sei in einem Brand verloren gegangen, glauben die Händler ihr nicht – das merke sogar ich – und wollen weniger zahlen. Aber wir kriegen in wenigen Stunden trotzdem so viel Geld zusammen, dass Cate zufrieden ist.
Wir essen einen schnellen Mittagssnack in einem veganen Café, dann breitet Cate Zeitungen vor sich aus und kreist Annoncen ein, in denen Zimmer vermietet werden. In der Nähe gibt es ein Münztelefon und Cate macht von dort aus ein paar Anrufe. Einige Annoncen streicht sie gleich aus, einige wollen wir uns ansehen. Wir fahren zu einer Adresse. Das Haus gefällt uns schon von außen so wenig, dass wir nicht einmal anhalten. Ein anderes schließt Cate aus, weil die Vermieterin zu viel wissen will.
»Aller guten Dinge sind drei«, sagt sie, als wir vor dem nächsten halten.
Sie klopft an die Tür des Bungalows und wir warten. Niemand kommt. Wir wollen gerade aufgeben, da geht die Tür auf. Eine weißhaarige Frau späht nach draußen.
»Ja bitte?«, fragt sie.
»Mrs Fulton? Guten Tag, ich bin Alison Smith«, sagt Cate. »Das ist meine Tochter Jenny. Ich hatte wegen des Zimmers angerufen, das Sie vermieten.«
Die Frau kommt heraus. »Es liegt hinter dem Haus«, sagt sie und wir gehen seitlich am Haus entlang und durch ein Tor. Im Garten dahinter liegt eine eigene, vom Haus abgetrennte Wohnung.