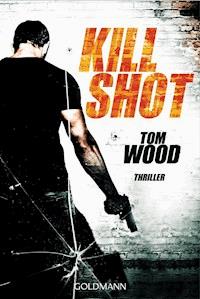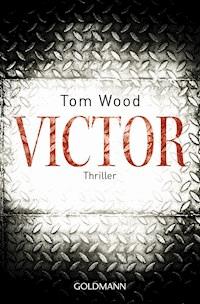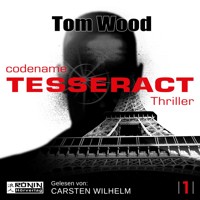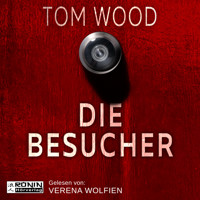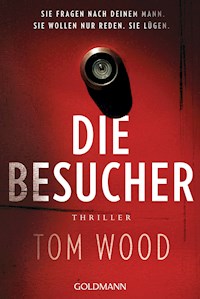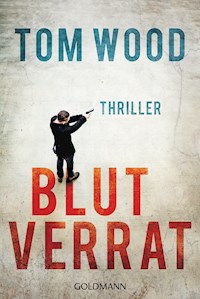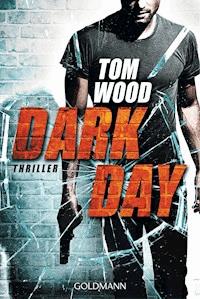
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Victor
- Sprache: Deutsch
Raven ist Profikillerin. Lautlos wie ein Schatten eliminiert sie ihre Opfer, bevor diese ihre Anwesenheit auch nur erahnen. Doch diesmal könnte sie das falsche Ziel im Auge haben: Victor. Ein Killer wie sie. Ein Profi so paranoid wie rücksichtslos und perfekt darin, jeden Verfolger auszuschalten. Er spürt Raven rund um den Globus nach, nicht nur, um die Gefahr zu beseitigen, sondern um herauszufinden, wer ihr den Auftrag zu seiner Ermordung gab. In New York treffen die beiden schließlich aufeinander – ausgerechnet, als dort ein Blackout die Stadt ins Chaos stürzt. Inmitten von Plünderungen und Gewalt kommt es zwischen Raven und Victor zu einem Katz-und-Maus-Spiel, das Manhattan nie mehr vergessen wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Im Auftrag der CIA soll Profikiller Victor einen Mann töten, der mit seinem Geld Terrorgruppen unterstützt. Doch Victor tappt in eine Falle: In Prag trifft er nicht auf sein Opfer, sondern auf eine Frau, die angeheuert wurde, ihn zu eliminieren. Der Anschlag auf ihn misslingt, doch die Auftragsmörderin kann Victor entkommen. Nun macht er sich auf die Jagd nach ihr: Constance Stone, Codename »Raven«. Sie ist ein Profi wie Victor selbst, mit undurchsichtiger Vergangenheit und unbekannter Agenda. Wenn Victor am Leben bleiben will, muss er herausfinden, wer Raven angeheuert hat. Will sie ihn wirklich töten? Oder zieht im Hintergrund jemand die Fäden, der hofft, dass die beiden sich gegenseitig ausschalten? In New York treffen sie schließlich aufeinander. Während ein Blackout die Stadt in Dunkelheit hüllt, müssen Victor und Raven herausfinden, wem sie vertrauen können, bevor ein tödlicher Plan Manhattan in den Abgrund reißt – und sie beide dazu …
Weitere Informationen zu Tom Wood
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
TOM WOOD
Dark Day
Thriller
Aus dem Englischen
von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»The Darkest Day« bei Sphere,
an imprint of Little, Brown Book Group, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung März 2016
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Tom Hinshelwood
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfoto: Nik Keevil/Arcangel Images; FinePic®, München
Redaktion: Gerhard Seidl
AB · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-17605-1V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag auch im Netz:
Kapitel 1
Alan Beaumont trat durch die Automatiktür seines Bürogebäudes und ging die breite Treppe zum Bürgersteig hinunter. Eine dichte graue Wolkendecke hing am Himmel über Washington, D.C. Es nieselte leicht, aber das bisschen Regen störte ihn nicht. Feuchte Kleidung? Na und? Eine zerzauste Frisur? Er hatte keine Haare, schon lange nicht mehr. Weder Pillen noch Wässerchen hatten den Verlust seiner einst so wunderschönen Lockenpracht verhindern können.
Er ließ mit Daumen und Mittelfinger sein Zippo aufschnappen und zündete die Zigarette an, die zwischen seinen Lippen klemmte. Rauchen war vielleicht das einzige wirkliche Vergnügen, das ihm noch geblieben war.
Er betrachtete den Verkehr in der Innenstadt, die vorbeihastenden Fußgänger. Alle hatten sie schlechte Laune. Tja. Sollten die anderen ruhig unzufrieden sein, Hauptsache, ihm ging es gut. Und keineswegs nur aus reinem Egoismus. Glück war ein Nullsummenspiel. Es war einfach nicht genug für alle da.
Er saugte den Rauch tief in die Lunge und hielt den Atem an, machte die Augen zu, legte den Kopf in den Nacken und atmete erst wieder aus, als die Regentropfen auf seine Wange, seine Stirn und seine Augenlider platschten.
»Sie sehen so aus, als würden Sie es wirklich genießen.«
Er schlug die Augen auf. Eine junge Frau stand neben ihm. Sie trug einen langen, cremefarbenen Regenmantel, einen Hut und braune Lederhandschuhe. Sie war blass und groß – fast so groß wie Beaumont – und hatte welliges blondes Haar. Ihre Lippen waren leuchtend rot geschminkt. Ein bisschen übertrieben für das Büro. Ein bisschen zu anzüglich. Das konnte nur bedeuten, dass sie neu war. Vermutlich eine der zahlreichen Arbeitsbienen der Firma. Zweifellos war er ihr schon hundert Mal oder noch öfter begegnet. Sie kannte höchstwahrscheinlich seinen Namen, wusste, welche Position er bekleidete, ja womöglich sogar, wie er seinen Kaffee trank. Aber für Beaumont war sie ein Niemand.
Achselzuckend wandte er sich ab. Er war nicht in Plauderstimmung, schon gar nicht mit einer Unbekannten, deren Gesicht er sich nicht zu merken brauchte. Obwohl, zugegeben, das Hingucken hätte sich gelohnt. Sie war ein Klasseweib. Üppig und wohlgeformt, genau dort, wo üppige Formen gefragt waren. Aber er wollte jetzt seine verdammte Zigarette genießen, und zwar alleine, genauso, wie der Schöpfer es gewollt hatte.
»Ich habe früher auch geraucht«, sagte die Frau, ohne seine Botschaft zu begreifen. Sie hatte einen leichten Südstaatenakzent. Stammte vermutlich aus irgendeinem Bundesstaat, an dessen Boden sich Beaumont glücklicherweise noch nie die Schuhsohlen schmutzig gemacht hatte.
»Tatsächlich?«, fühlte er sich genötigt zu sagen.
Er rückte noch ein Stück weiter von ihr ab. Das ist nicht unhöflich, sagte er sich. Die junge Frau hatte sich schließlich in seine einsamen fünf Minuten gedrängt.
Und jetzt tat sie es schon wieder, machte ein paar Schritte um Beaumont herum und stand ihm schließlich genau gegenüber.
»Ungefähr zehn Jahre lang«, fuhr sie unbeirrt fort. »Zwei Schachteln Marlboro am Tag. Ich hatte praktisch ständig eine Zigarette zwischen den Fingern. Habe schon als junges Mädchen angefangen, verstehen Sie? Aber irgendwann habe ich den Absprung geschafft. Jetzt genehmige ich mir gelegentlich eine Zigarre. Besser als nichts, hab ich recht? Aber manchmal überfällt mich der Gedanke an eine richtig schöne Zigarette, und dann werde ich fast verrückt.«
Sie lächelte, aber es war ein trauriges Lächeln, und Beaumont empfand so langsam ein wenig Mitleid mit ihr. Sie erinnerte ihn an seine Tochter.
»Sie sind neu hier, stimmt’s?«, sagte er.
Sie nickte. »Sieht man mir das so deutlich an?«
An der Art, wie sie lächelte, wurde deutlich, dass der Hexenzirkel sie nicht mit offenen Armen empfangen hatte. Er sah ihr die Einsamkeit an, und dann zuckten seltsame Bilder seiner eigenen Zukunft vor seinem inneren Auge auf – er in zwanzig Jahren, übergewichtig und geschieden, während sein Sohn und seine Tochter sich nicht bei ihm meldeten, weil er früher nie mit ihnen auf dem Spielplatz war. Würde auch er sich nach menschlicher Nähe sehnen, so sehr, dass er jeden Versuch eines Fremden, ihm die kalte Schulter zu zeigen, einfach ignorieren würde? Weil jede Form des Kontakts besser war als kein Kontakt?
»Wie kommen Sie klar?«
Sie rümpfte achselzuckend die Nase.
»So schlimm, hmm?«
Sie gab keine Antwort.
»Also«, fing Beaumont an. »Wollen Sie vielleicht eine rauchen? Um der alten Zeiten willen? Dann geht es Ihnen bestimmt gleich besser.« Er rang sich ein Lächeln ab.
Die junge Frau fing an zu strahlen, als hätte sie im Lotto gewonnen.
Beaumont empfand jetzt noch mehr Mitleid. Er steckte die Hand in die Tasche, um seine Schachtel herauszuholen.
»Nein«, sagte die Frau und hob die Hand. »Keine ganze Zigarette. Sonst fange ich bloß wieder an. Eine ist immer eine zu wenig, stimmt’s? Aber einen Zug, einen einzigen nur, den würde ich nicht ablehnen. Wenn Sie nichts dagegen haben.«
Sie deutete auf Beaumonts kostbare Zigarette. Beaumont folgte ihrem Blick. Er war nicht der Typ, der mit anderen teilte, auch nicht mit einer scharfen Braut, die halb so alt war wie er. Sein Blick wanderte zurück zu der groß gewachsenen jungen Frau. Zu ihren leuchtend roten Lippen. Sie schien nicht krank zu sein. Sie sah nicht so aus, als würde sie ein tödliches Retrovirus mit sich herumschleppen. Das hoffnungsvolle Strahlen in ihren Augen ließ seinen inneren Widerstand schmelzen und erinnerte Beaumont daran, dass er doch nicht ganz so herzlos war, wie er geglaubt hatte.
Wenn ein Mann ihn gefragt hätte, ob er seine Zigarette mit ihm teilen wollte, er hätte den Idioten zum Teufel gejagt. Aber sie war kein Mann.
Wenn er ihr gestattete, seine Zigarette zwischen ihre Lippen zu nehmen, vielleicht gestattete sie ihm dann …
Er reichte ihr die Zigarette. Die junge Frau klemmte sie zwischen Zeige- und Mittelfinger ihrer linken Hand. Führte sie an ihre roten Lippen, umschloss den Filter, spannte die Lippen … aber inhalierte nicht. Beaumont beobachtete sie fasziniert.
»Das war knapp«, sagte die junge Frau und nahm die Zigarette mit der rechten Hand aus dem Mund. »Ich wäre beinahe schwach geworden.« Bevor sie ihm die Zigarette zurückgab, rollte sie den Filter einen Augenblick lang zwischen ihren behandschuhten Fingerspitzen hin und her. »Das hat mir schon gereicht«, fuhr sie fort, während Beaumont sie immer noch musterte.
»Wie Sie wollen«, sagte er und nahm das kostbare Stück wieder an sich.
Ihr Lippenstift hatte auf dem Filter einen Streifen hinterlassen. Er nahm einen Zug.
Die junge Frau beobachtete ihn. Irgendetwas an ihrem Blick hatte sich verändert. Sie zog die Handschuhe aus und steckte sie in die Tasche ihres Regenmantels. Dann fing sie mit der ausgestreckten Hand ein paar Regentropfen auf und befeuchtete sich die Lippen, holte ein Taschentuch aus einer anderen Tasche und wischte sich den Mund ab.
»Wollen Sie den Geschmack loswerden?«, erkundigte sich Beaumont. Er war jetzt ein klein wenig erregt.
Die Frau lächelte ihn an, sagte aber nichts. Sie wirkte irgendwie selbstzufrieden. Fast schon überheblich.
»Also«, fing Beaumont an. »Wie heißen Sie?«
Sie gab keine Antwort. Starrte ihn nur an.
»Hallo? Ist jemand zu Hause?« Beaumont fuchtelte ihr mit der Hand vor der Nase herum und lachte.
Keine Reaktion. Kein Wunder, dass sie mit den Kolleginnen nicht zurechtkam, wenn sie so durchgeknallt war.
»Na, dann.« Er stieß vernehmlich den Atem aus. Seine Erektion verabschiedete sich, und er bedauerte bereits, dass er dieser merkwürdigen Figur gestattet hatte, ihm etwas von seiner Zeit zu stehlen. Er spürte den aufkommenden Ärger, spürte die Wut, und ihm wurde heiß, trotz des kühlen Regens, der auf seine Glatze tropfte.
»Also gut, Schätzchen. Jetzt habe ich mich lange genug mit dir abgegeben. Lass mich einfach in Ruhe und verzieh dich. Sei ein braves Mädchen.«
»Gleich«, erwiderte die Frau, ohne ihn aus den Augen zu lassen.
»Wie du willst.«
Beaumont wandte sich ab und lockerte seine Krawatte. Verdammt noch mal, wie ihn das Ganze ankotzte. Sein Herz wummerte wie wild. Er sagte sich, dass er nie wieder Mitleid mit einem anderen Menschen haben wollte. Nie wieder. Die Menschen waren Abschaum und immer nur auf ihren eigenen Vorteil erpicht.
Er wollte schlucken, aber seine Kehle fühlte sich an wie Schmirgelpapier. Das regte ihn gleich noch mehr auf. Durch den Rauch musste er husten. Mit rotem Kopf warf er die Zigarette weg. War das Schweiß auf seiner Stirn, zwischen den Regentropfen?
Er wandte den Blick zurück Richtung Büro, nur um festzustellen, dass die junge Frau sich nicht von der Stelle gerührt hatte.
»Hast du dich immer noch nicht verpisst?«
»Gleich«, wiederholte sie.
»Hör zu, du hast mir meine Pause ruiniert, also warum machst du nicht einfach …«
Beaumont wurde schwindelig. Er streckte die Hand aus und hielt sich an der Schulter der Frau fest.
»Ist alles in Ordnung?«, erkundigte sich die Frau ohne jede Spur von Mitgefühl. »Sie sehen mit einem Mal furchtbar blass aus.«
»Ich …«
Beaumont hatte keine Kraft mehr. Hätte er sich nicht an der Schulter der Frau festgehalten, er hätte sich gar nicht auf den Beinen halten können. Wasser lief ihm im Mund zusammen.
»Oh«, meinte die junge Frau. »Wenn man eine schwache Konstitution hat, dann kann das passieren. Daran sind bestimmt die Zigaretten schuld.«
Sie trat einen Schritt zurück und ließ Beaumont behutsam auf die Knie sinken. Beaumont übergab sich. Er sah, wie Erbrochenes und Blut vom Regen weggewaschen wurden.
»Was … hast du mit mir gemacht?«
»Leider kann ich nicht das ganze Lob für mich in Anspruch nehmen, so gerne ich das auch täte. Mein Chemiker ist wirklich ein Genie, oder etwa nicht?«
Beaumont gab keine Antwort. Er kippte nach vorn, landete mit dem Gesicht in einer Lache aus Erbrochenem und Blut. Sein Atem ging flach, sein Puls war schwach und ungleichmäßig.
»Ich verabschiede mich dann mal«, sagte die junge Frau. »Adieu.«
Das Letzte, was Beaumont sah, war seine erloschene Zigarette. Sie lag auf dem Bürgersteig und wurde vom Regen durchweicht.
Während Beaumont auf dem Bürgersteig lag und seine letzten Atemzüge tat, entfernte sich die groß gewachsene Frau. Als sie den Bereich, den das Weitwinkelobjektiv der Überwachungskamera vor dem Eingang erfassen konnte, verlassen hatte, zog sie ihren cremefarbenen Regenmantel aus und drehte ihn von innen nach außen – eine oft geübte Folge von Handgriffen, die genau fünf Sekunden in Anspruch nahm –, um anschließend in ihren neuen, feuerroten Mantel zu schlüpfen.
Einen halben Straßenzug weiter landete ihre auffällige Lederhandtasche in einem Abfalleimer. Und am Ende der Straße wanderte auch die blonde Perücke in den Müll.
Nachdem sie sich mehrmals entschlossen mit einem feuchten Baumwolltuch über das Gesicht gewischt hatte, war auch von dem blassen Make-up nichts mehr zu sehen. Dann waren die blauen Kontaktlinsen an der Reihe, gefolgt von den Ohrclips und den Polstern in ihrem BH und dem Hüftgurt. Dann blieb sie stehen und hob den Fuß bis an den Hintern, um den zehn Zentimeter langen Absatz ihres Schuhs abzuschrauben. Zum Schluss folgte der zweite Absatz.
Keine Minute, nachdem Beaumonts Herz aufgehört hatte zu schlagen, bestieg sie den Bus Nummer 1115 nach Arlington. Sie hatte sich vollkommen verändert.
Kapitel 2
Der Himmel über Prag sah aus wie ein blau-weißer Flickenteppich. Dünne Wolkenfetzen ließen die Sonne des späten Vormittags verblassen. Trotzdem reichte das Licht, um sich in den polierten Karosserien der Autos am Straßenrand und in den Pfützen, die sich im Rinnstein gebildet hatten, zu spiegeln. In dem gewundenen Kopfsteinpflastersträßchen reihten sich Boutiquen, Cafés und Stadthäuser aneinander. Um diese Tageszeit gab es hier nur wenige Passanten und noch weniger Verkehr.
Vor einem Café saß ein einzelner Mann an einem kleinen, runden Metalltisch. Er war groß und trug einen holzkohlegrauen Anzug unter einem schwarzen Wollmantel, dazu schwarze Oxford-Schuhe. Sein Hemd war weiß und seine einfarbige Krawatte burgunderrot. Die schwarzen Haare waren länger als sonst und reichten ihm bis zu den Ohren und, wenn er sie nicht zurückstrich, fast bis zu den Augenbrauen. Zwei Wochen ohne Rasur hatten ihm einen dichten Bart beschert, der sein Kinn etwas weicher wirken ließ und auch die Wangenknochen bedeckte. Die Fensterglasbrille war einfach und funktional und trug ihren Teil dazu bei, dass sein Gesicht konturlos und unauffällig wirkte. Um die Schultern hatte er sich einen braunen Wollschal gelegt, locker und nicht verknotet. Die Enden verschwanden in den Aufschlägen des offenen Mantels, der ihm bis zu den Oberschenkeln reichte. Er nippte an einem schwarzen Americano. Die feine Porzellantasse war ebenso dekorativ wie zart, und er musste sich konzentrieren, um nicht versehentlich den kleinen Henkel abzubrechen.
Sein Tisch war der mittlere von dreien, die draußen auf dem Bürgersteig aufgebaut waren, allesamt weiß lackiert und mehr oder weniger verbeult. An dem Tisch zu seiner Linken saßen zwei blonde Frauen, gut gekleidet und mit Schmuck behangen. Vermutlich Mutter und Tochter. Sie redeten über das Wetter und überlegten, wo sie nach der morgendlichen Shoppingtour zu Mittag essen sollten. Zu ihren Füßen standen viele große Tüten. Zur Rechten des Mannes unterhielten sich zwei ältere Männer mit faltigen Gesichtern und grauen Haaren darüber, wie sie sich bei ihren jüngeren, hipperen Mandanten beliebt machen konnten.
Der Mann im Anzug hätte lieber an einem der anderen Tische gesessen, um wenigstens nach einer Seite freie Bahn zu haben, doch die anderen waren schon vor ihm da gewesen, und beide Paare machten den Eindruck, als ob sie länger bleiben wollten als er selbst. Er tat so, als würde er die Blicke nicht bemerken, die die blonde Mutter ihm in regelmäßigen Abständen zuwarf.
Seine Hände und Ohren waren rot, und bei jedem Ausatmen bildete sich eine dicke Kondenswolke. Trotzdem ließ er den Mantel aufgeknöpft und den Schal ungebunden, trug auch weder Handschuhe noch eine Mütze, ganz so, wie er es gewöhnt war.
Auf die Mütze verzichtete er, weil jedes Mal beim Absetzen die Gefahr bestand, dass DNA-haltige Haarzellen in die Luft gewirbelt wurden. Und Handschuhe trug er keine, weil selbst die besten Handschuhe die Beweglichkeit der Finger einschränkten. Seine Fingerfertigkeit bedeutete ihm mehr als alles andere. Mit bloßen Händen konnte man sehr viel besser zupacken, man konnte besser jemandem die Augen ausstechen oder die Kehle zudrücken. Der Mantel war offen, weil sich dann eine versteckte Waffe leichter ziehen ließ. Er war jedoch unbewaffnet, wie meistens. Eine Waffe hatte nur dann einen Sinn, wenn er sie auch benutzen musste. Ansonsten war sie eher hinderlich. Aber er war ein Mann der Gewohnheit: Ein offener Mantel hatte den zusätzlichen Vorteil, dass er, wenn nötig, leicht abzustreifen war. Der ungebundene Schal sollte verhindern, dass ein eventueller Gegner ihn als Würgeschlinge nutzen konnte. Andererseits ließ er sich schnell abziehen und gegen einen Angreifer zum Einsatz bringen.
Er hatte sich im Lauf seiner beruflichen Karriere viele Feinde gemacht. Und für jeden Widersacher, den er sich vom Leib geschafft hatte, stand bald schon der nächste bereit. Er hatte gelernt, dass das Überleben von Kleinigkeiten abhing, ganz egal, wie unbedeutend sie zunächst auch scheinen mochten. Er hatte gelernt, niemals seinen Schutzschild herunterzufahren, ganz egal, wie sicher er sich fühlte. Diese Lektionen hatten sich tief in sein Fleisch eingegraben. Er würde sie niemals vergessen.
Er wartete. Warten machte mehr als die Hälfte seiner gesamten Arbeitszeit aus. Er war geduldig und blieb jederzeit konzentriert. Das musste er auch. Er war ein Mann, der sich Zeit ließ und dem Perfektion mehr bedeutete als Schnelligkeit. Nur wenn es unabdingbar war, beeilte er sich, aber das kam selten vor. Er hatte es zu einer gewissen Kunstfertigkeit gebracht und empfand dabei wenn schon nicht Freude, so doch zumindest eine gewisse Befriedigung.
Er nippte an dem Tässchen. Der Kaffee war hervorragend, doch die Qualität stand in keinem Verhältnis zu der Anstrengung, die es ihn kostete, die Tasse festzuhalten ohne sie zu zerbrechen. Bedauerlich, aber der Kaffee lieferte eine glaubhafte Begründung für seine Anwesenheit und war somit ein unverzichtbares Requisit.
Am hinteren Ende der Straße stand, eingeklemmt zwischen zwei Stadtvillen, ein schmal gebautes Hotel. Ein Vordach und der Portier waren die einzigen beiden sichtbaren Hinweise auf die Existenz dieses Hotels. Weder flatternde Fahnen noch prunkvolle Ornamente buhlten um die Aufmerksamkeit der Passanten. Die Gäste legten Wert auf Diskretion und Privatsphäre. Und da das Hotel ihnen beides bieten konnte, waren sie gerne bereit, die überhöhten Preise zu bezahlen.
Der Mann im Anzug interessierte sich für einen ganz bestimmten Hotelgast: ein Mitglied des Hauses Sa’ad, der weitverzweigten Königsfamilie Saudi-Arabiens. Es handelte sich um einen der vielen Prinzen der Familie, einen dekadenten, dreißig Jahre alten Mann, der den Reichtum seiner Familie fast ebenso schnell verprasste, wie er entstand. Hätte sein Vater seinen Etat nicht begrenzt, der Prinz hätte ihn innerhalb von achtzehn Monaten in den Ruin getrieben.
Al-Waleed bin Saud war auf einer ununterbrochenen Urlaubsreise rund um die Welt. Er zog immer weiter von Stadt zu Stadt, nur begleitet von einer bescheidenen, sechzehnköpfigen Entourage. Dazu gehörten zwei persönliche Assistenten, ein Buchhalter, ein Koch, eine neunköpfige Wachmannschaft und drei junge Frauen, die offiziell als Praktikantinnen geführt wurden, die aber nichts weiter zu tun hatten, als zu shoppen und ab und zu ein paar zweisame Stunden mit dem Prinzen zu verbringen. Er stieg nur in den teuersten Hotels ab, und zwar nur in solchen, die in der Lage waren, seine ganz speziellen Wünsche zu erfüllen. Trotz seines extravaganten, hedonistischen Lebensstils versuchte er, nach außen hin das Bild des respektablen, frommen und stolzen Saudis aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund – und um sicherzugehen, dass kein Wort über das Leben, das er führte, in seine Heimat drang – scheute er vor zu großen Hotels oder Häusern mit zu strikten Regeln zurück. Lieber stieg er irgendwo ab, wo das Personal bestechlich war und er gleich ein ganzes Stockwerk für sich und sein Gefolge mieten konnte. Und wo man auch in der Lage war, den anspruchsvollen Gast mit diversen Extras zu versorgen, beispielsweise mit Prostituierten und Betäubungsmitteln seiner Wahl.
Obwohl er sich mit Freuden jeder nur vorstellbaren westlichen Dekadenz hingab, unterstützte Al-Waleed die Aktivitäten zahlreicher Extremisten und Fundamentalisten von Mali bis Malaysia. Für den Prinzen waren diese Spendenbeträge kaum der Rede wert. Aber für etliche Gruppen, die bekanntermaßen bereits mehrere grauenhafte Anschläge durchgeführt und weitere geplant hatten, war dieses Geld eine unverzichtbare Finanzierungsquelle.
Der Prinz war bei Weitem nicht der einzige reiche Saudi, der den Terrorismus unterstützte, aber er war einer der umtriebigsten. Seine Spenden wurden oft in bar oder in Form von Edelsteinen übergeben, sodass sie nur schwer zu verfolgen und noch schwerer abzufangen waren. Aus diesem Grund war man zu der Entscheidung gelangt, seiner Spendentätigkeit ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.
Das Problem – nicht nur in diesem Fall, sondern ganz allgemein in Bezug auf die saudi-arabische Unterstützung des Terrorismus – bestand in der Abhängigkeit des Westens vom saudischen Öl. Eine Symbiose, die auf keinen Fall gefährdet werden durfte. Das Haus Sa’ad würde die Ermordung eines der Ihren genauso wenig hinnehmen wie die Tatsache, dass einer ihrer Angehörigen die Unterstützung des Westens gefährdete, die die Königsfamilie benötigte, um an der Macht zu bleiben.
Darum war man zu einem Kompromiss gelangt.
Der Prinz musste sterben. Allerdings durften weder die CIA, die für die Durchführung dieses Plans zuständig war, noch das Haus Sa’ad, das keine andere Wahl gehabt hatte, als dieser Maßnahme zuzustimmen, mit seinem Tod irgendwie in Verbindung gebracht werden.
Darum war Victor engagiert worden.
Kapitel 3
In dem psychologischen Gutachten, das im Dossier mit enthalten war, wurde behauptet, dass Al-Waleed durch die aktive Unterstützung von Terroristen versuchte, seinen exzessiven Lebensstil wieder mit seinem religiösen Gewissen in Einklang zu bringen. Victor hielt nicht viel von solchen Theorien. Er stützte sich lieber auf nützliche und verwertbare Fakten. Ihn interessierte das beweisbare Wo und das Wann, nicht das spekulative Wie und Warum. Es gab nur ein einziges Urteil, dem er vertraute, und das war sein eigenes.
Die beiden Männer zu seiner Rechten erhoben sich und machten sich zum Gehen bereit, obwohl sie ihr Frühstück kaum angerührt hatten. Dann blieben sie einen Meter von ihrem Tisch entfernt stehen und setzten ihre Diskussion fort. Einer setzte eine Sonnenbrille auf. Der andere kniff die Augen zusammen und hob zum Schutz vor den Sonnenstrahlen schützend die Hand. Sie blockierten Victors Blickachse.
Aber er brauchte den Hoteleingang gar nicht durchgehend im Auge zu behalten. Da bis jetzt kein Rolls-Royce vorgefahren war, würde der Prinz sich in nächster Zeit auch nicht sehen lassen. Die Buchungsdaten des Hotels, die Victors Auftraggeber ihm zur Verfügung gestellt hatte, zeigten, dass der Prinz noch mindestens drei Tage in der Stadt bleiben wollte. Wie zu erwarten gewesen war. Im Verlauf des letzten Jahres hatte er, abgesehen von den Sommermonaten, durchgehend europäische Städte bereist und es auf eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von vier Nächten gebracht. Gestern Abend nach seiner Ankunft hatte Al-Waleed bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, was zu zahlreichen Beschwerden der Gäste aus dem darunterliegenden Stockwerk geführt hatte. Victor rechnete nicht damit, dass er sich in nächster Zeit blicken lassen würde. Aber trotzdem musste er wachsam sein. Selbst beschaffte Informationen waren in jedem Fall besser als solche aus sekundären Quellen.
Er hatte auch gar nichts dagegen. Der Kaffee war gut, auch wenn das Porzellan etwas zu zerbrechlich war, und die Sonne wärmte ihm zumindest das Gesicht und bildete so ein Gegengewicht zu der Kälte in den anderen Körperteilen. Er hatte eine Zeitung vor sich liegen, aber nur zur Tarnung. Darum las er nicht darin, sondern blätterte sie lediglich oberflächlich durch. Für ihn war es selbstverständlich, wenig bis gar keine Aufmerksamkeit zu erregen, darum war das hier, abgesehen von dem beiläufigen Interesse der blonden Frau am Nebentisch, ein ganz normaler Vormittag. In aller Öffentlichkeit unsichtbar zu sein war eine der wichtigsten Fähigkeiten, die er sich angeeignet hatte. Je weniger Menschen Notiz von ihm nahmen, desto freier konnte er agieren und desto besser standen seine Chancen, im Anschluss unerkannt entkommen zu können.
Er hatte das Hotel schon vor der Ankunft des Prinzen ausgekundschaftet und sich zwei Tage lang in einer Suite auf demselben Stockwerk eingemietet, das der Prinz jetzt bewohnte. Diese Zeit hatte er genutzt, um die Flure und Korridore gründlich zu studieren und die zweidimensionalen Grundrisse, die er sich bereits angesehen hatte, mit seinen eigenen, dreidimensionalen Beobachtungen anzureichern. Er hatte die Gesichter und Namen und Dienstpläne des Personals ebenso auswendig gelernt wie die Positionen der verschiedenen Überwachungskameras, er wusste, wie lange der Zimmerservice brauchte, um eine Bestellung zu liefern, und wie lange ein Tablett unangetastet vor der Zimmertür stehen blieb, bevor es wieder abgeräumt wurde.
Es fiel ihm nicht weiter schwer, den regulären Gast zu spielen, da er – genau wie Al-Waleed – einen Großteil seines Lebens in Hotels zubrachte. Aber während der Prinz aus reiner Langeweile von Stadt zu Stadt zog, auf der Suche nach immer neuen und immer noch aufregenderen Erfahrungen, war es für Victor die schiere Notwendigkeit. Ein bewegliches Ziel war bedeutend schwerer zu treffen als ein stationäres.
Das Foyer des Hotels war mit bequemen Sesseln und Sofas ausgestattet, doch da er bereits einmal Gast gewesen war, kam die Lobby als Warteraum nicht infrage. Im besten Fall würde er von den Überwachungskameras erfasst, im schlimmsten Fall von einem Angestellten erkannt werden. Da sich im Lauf seiner Recherchen herausgestellt hatte, dass das Hotel ohnehin kein geeigneter Ort für ein Attentat war, würde er es nicht mehr betreten. Auch wenn die Gefahr einer Entdeckung minimal war. Aber er ging niemals Risiken ein, die nicht notwendig waren.
Die beiden grauhaarigen Männer beendeten ihr Gespräch, verabschiedeten sich mit einem Händedruck und gingen in unterschiedliche Richtungen auseinander. Ein Kellner nahm das Geld, das sie auf dem Tisch hinterlassen hatten, und fing an, die Teller einzusammeln.
Als schließlich ein silberfarbener Rolls-Royce vor dem Hotel vorfuhr, waren auch die beiden blonden Frauen bereits gegangen. Trotzdem war der Wagen früher da, als es das Dossier der CIA prophezeit hatte. Kein wirkliches Problem, aber eine erneute Bestätigung für Victor: Es war absolut sinnvoll, sich nur auf seine eigenen Recherchen zu verlassen.
Einen Augenblick später traten drei Leibwächter aus dem Hoteleingang auf die Straße und näherten sich dem Fahrzeug. Es waren Saudis in schicken Anzügen und mit Sonnenbrillen. Sie sahen aus, als wüssten sie genau, was sie zu tun hatten, aber über Personenschutz wussten sie kaum mehr als das, was man sich in einem zweiwöchigen Kurs aneignen konnte. Trotzdem stellten sie ein Problem dar, weil sie in Dreiergruppen arbeiteten, die sich alle acht Stunden abwechselten, sodass Al-Waleed rund um die Uhr gut geschützt war. Außerdem waren sie bewaffnet. Der Prinz besaß Diplomatenstatus und konnte daher alles, was er wollte, über die Grenze bringen. Auch Schusswaffen.
Nachdem die Leibwächter ein paar flüchtige Blicke in alle Richtungen geworfen hatten, kam der Prinz aus dem Hotel und stieg in den wartenden Rolls. Al-Waleed trug den traditionellen weiten Umhang der Saudis. Er war weder besonders groß noch besonders klein und besaß eine rundliche Taille. Nach ihm kam einer seiner Assistenten, und dann stiegen auch die Leibwächter in den Wagen. Der letzte setzte sich anstelle des Parkwächters, der den Wagen geholt hatte, hinter das Steuer.
Der Rolls-Royce fuhr los und bog um die nächste Ecke.
Victor wartete weiter. Erst als der Buchhalter des Prinzen fünf Minuten später das Hotel verließ, stand er auf. Es handelte sich um einen groß gewachsenen, hageren Mann Mitte fünfzig mit Glatze und einem schmalen, kerzengerade getrimmten Ziegenbärtchen. Auch er war ein Saudi, wie alle in der Entourage des Prinzen, und außerdem mit dessen Vater befreundet. Er war mit auf die Reise geschickt worden, um den verlorenen Sohn auf seinen Abenteuern zu begleiten und dafür zu sorgen, dass er sein Budget nicht überzog und keine Schulden anhäufte, die der Vater nicht gewillt war zu bezahlen.
Al-Waleed saß im Vorstand etlicher Unternehmen im Besitz der Familie Sa’ad, allerdings nur der Form halber. Seine ausgedehnten Urlaubsreisen wurden als Geschäftsreisen deklariert, auch wenn er niemals einen Geschäftspartner zu sehen bekam oder an irgendwelchen Sitzungen teilnahm. Selbst wenn er gewollt hätte, sein Vater hätte niemals zugelassen, dass sein unzuverlässiger Sohn die geschäftlichen Interessen der Familie in irgendeiner Weise gefährdete. Darum war der Buchhalter für alles zuständig. Der Prinz besaß keinerlei eigene Unternehmen und fand alles, was damit zusammenhing, langweilig und öde. Er gab sein großzügiges Taschengeld lieber für Dinge aus, die ihm wirklich Spaß machten. Und für die Unterstützung von Terrorgruppen.
Al-Waleed verabscheute den Buchhalter und alles, wofür er stand. Daher behandelte er ihn mit Verachtung und Geringschätzung. Es war wirklich abstoßend. Jede Aufgabe, die Al-Waleed als unter seiner Würde betrachtete, gab er an den Buchhalter weiter, oft genug nur, um ihn noch zusätzlich zu erniedrigen. So musste er auch Drogen kaufen, Callgirls engagieren und Treffen mit irgendwelchen Mittelsmännern von Terroristen arrangieren.
Solche Mittelsmänner waren notwendig. Für Terroristen gab es gute Gründe zur Vorsicht, und zur Geldbeschaffung wollte sich niemand aus der Deckung wagen. Da es sich als ausgesprochen schwierig erwiesen hatte, die zahlreichen sehr unterschiedlichen Terrorgruppen zur Strecke zu bringen – zumal aus der Asche der zerstörten in einem endlosen Kreislauf immer wieder neue Organisationen auferstanden –, hatte der Krieg gegen den Terror mittlerweile verstärkt die Quellen ins Visier genommen, die den Terrorismus finanzierten. Ohne Geld konnten weder Bomben gebaut noch Munition gekauft werden. Es ging nicht mehr primär um die Bekämpfung der Krankheit, sondern um Vorsorge. Eine Maxime, nach der übrigens auch Victor zu leben versuchte.
Einer dieser Mittelsmänner sollte im Verlauf des heutigen Tages in Prag ankommen. Es handelte sich um einen türkischen Banker namens Ersin Caglayan. Er verwaltete die Bankkonten mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen. Von dort wurden immer wieder Gelder an diverse Dschihadisten-Gruppen im Nahen Osten überwiesen. Der Prinz hatte sich schon öfter mit Caglayan getroffen und würde es auch jetzt wieder tun.
Victor beobachtete den Buchhalter und überlegte gleichzeitig, wie er den Prinzen ermorden konnte, ohne dass dabei die CIA in Verdacht geriet. Die Möglichkeit, einen »natürlichen Tod« zu arrangieren – zum Beispiel einen tödlichen Unfall oder einen Herzinfarkt –, schied von vornherein aus. Dazu mussten umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden, die bei einer Zielperson wie Al-Waleed nicht zu realisieren waren. Dazu war Al-Waleed zu viel unterwegs und viel zu gut bewacht.
Aber es bot sich eine einfache Lösung an: Man konnte Caglayan die Schuld in die Schuhe schieben.
Kapitel 4
In der Anzeige hatte die Frau ihr Alter mit fünfundzwanzig angegeben. In Wirklichkeit war sie mindestens zehn Jahre älter. Das sanfte Glimmen der schwachen Glühbirne begünstigte diese Lüge, indem es die leichten Falten in ihrem Gesicht glättete. Großzügig aufgetragenes Make-up überdeckte die dunklen Augenringe. Victor spielte das Spiel mit und ging auch mit keinem Wort darauf ein, dass die Fotos auf ihrer Webseite ausgiebig retuschiert worden sein mussten. Es gab keinen Grund, unhöflich zu sein.
Sie war schließlich immer noch eine attraktive Frau mit langen dunklen Haaren und blauen Augen, die Lebendigkeit und Ehrgeiz ausstrahlten. Sie öffnete die Tür ihrer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Pařížská, der unweit des Wenzelsplatzes gelegenen Pariser Straße. Sie trug einen seidenen Morgenmantel und hatte ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Ihre Zähne waren blendend weiß und viel zu gerade und zu perfekt, um ihre eigenen zu sein.
Sie hatte sich in der Anzeige als Escort-Dame bezeichnet. Es war ein sanftes, beinahe harmlos klingendes Wort. Victor verstand, warum das notwendig war, genauso wie er verstand, warum Menschen wie er sich gerne als Söldner oder Kunstschützen bezeichneten. Er selbst hielt sich für nichts anderes als einen professionellen Mörder. Er hatte nicht das Bedürfnis, seine berufliche Tätigkeit irgendwie schönzufärben, genauso wenig wie die Tatsache, dass er zu Prostituierten ging.
Sie ergriff seine Hand und führte ihn wortlos in ihre Wohnung. Während sie die Tür hinter ihm ins Schloss zog, deutete sie auf den Wohnzimmerbereich. Victor drehte nur ungern anderen Menschen den Rücken zu, aber in diesem Fall spielte er einen gewöhnlichen Kunden. Also wahrte er den Schein und ging voraus. Sein Alltag bestand zu einem erheblichen Teil aus Schauspielerei. Trotzdem war es nicht ganz einfach, einerseits den Normalbürger zu spielen und andererseits ununterbrochen wachsam zu bleiben. Er machte sich nur ungern verwundbarer, als unbedingt erforderlich, aber manchmal war es besser, ein bisschen mehr Verletzlichkeit in Kauf zu nehmen, um später bessere Chancen auf das Überleben zu haben. Und das hier war ein solcher Fall.
Er rieb sich die Hände, als Zeichen seiner Nervosität, aber auch, weil er dem Buchhalter des Prinzen einen Nachmittag lang durch die kalte Stadt gefolgt war.
Die Wohnung war klein, aber teuer möbliert, klar und modern – und so spartanisch, dass er sich fragte, ob sie nur für geschäftliche Zwecke genutzt wurde und die Frau vielleicht irgendwo anders wohnte. Doch die vollgepackten Bücherregale belehrten ihn eines Besseren. Vielleicht gefiel ihr die minimalistische Einrichtung einfach.
»Du kennst den Stundensatz, oder?«, fragte die Frau, während sie ihm ins Wohnzimmer folgte.
Sie sprach Englisch, aber mit einem starken tschechischen Akzent. Ihre hohen Absätze klickten über den nackten Fußboden. Damit war sie genauso groß wie er.
Er hatte sich bereits zu ihr umgewandt und stand jetzt dicht vor der westlichen Wand, seitlich neben den Fenstern, um einem Heckenschützen auf der gegenüberliegenden Straßenseite kein Ziel zu bieten.
»Ja«, erwiderte er.
»Dann würde ich jetzt gerne mein Geschenk entgegennehmen«, sagte sie mit einem Lächeln, das die Unschuld ihrer Bitte noch unterstrich.
»Selbstverständlich.«
Er zog sein Portemonnaie hervor und zählte ein paar brandneue Scheine ab.
Sie kam zu ihm und nahm sie ihm aus der Hand. Dabei lächelte sie immer noch. Aber als sie sich umdrehte, um das Geld zu zählen, und es anschließend zwischen zwei Bücher in ihrem Regal schob – historische Romane, wie er mit einem Blick feststellte –, verschwand das Lächeln.
»Ich gehe davon aus, dass du die Regeln gelesen hast«, sagte sie, ohne sich umzudrehen. »Du weißt also, was erlaubt ist und was nicht.«
»Ja.«
»Gut zu wissen. Ich wiederhole mich nicht gern. Damit vergeuden wir nur unsere Zeit.«
»Ich bin nicht hier, um Zeit zu vergeuden«, sagte er.
Sie drehte sich um und musterte ihn aufmerksam, als wolle sie aus der Art, wie er stand, und dem Schnitt seines Anzugs auf seine Sehnsüchte und Perversionen schließen. Vielleicht war es auch nur ein Spiel, das sie mit jedem ihrer Kunden spielte, weil sie schon längst ganz genau wusste, was die Männer von ihr wollten.
»Wie soll ich dich nennen?«, fragte sie ihn und spielte mit ihren Haaren.
Victor blieb stumm.
Die Frau sagte: »Du kannst mir ruhig sagen, wie du heißt, Schätzchen. Ich sage es bestimmt nicht weiter, ich schwöre. Diskretion gehört zum Service, versprochen.«
Victor erwiderte: »Schätzchen reicht.«
Sie neigte den Kopf zur Seite. »Hättest du gern, dass ich nachher im Bett laut Schätzchen schreie?«
»Sie müssen mir nichts vorspielen.«
Sie lächelte. »Ich glaube, bei dir wird das auch gar nicht nötig sein, hab ich recht?«
Er hatte diese Sätze natürlich schon öfter gehört. Es war nicht das erste Mal, dass er für Sex bezahlte. Manchmal war es einfach notwendig, da er sich keinerlei wirkliche Bindung mit anderen Menschen gestattete. Gleichzeitig konnte er es sich auch nicht leisten, von Sehnsüchten abgelenkt zu werden. Es war ein Trieb, der sich nur schlecht allein durch Willenskraft unter Kontrolle bringen ließ.
Er lächelte ebenfalls, weil sie genau das von ihm erwartete, und spielte weiter die Rolle des normalen Kunden – ein Geschäftsmann, der seine Frau betrog, vielleicht, oder ein Politiker, der die schäbigen Überreste seines Privatlebens auslebte, aber jedenfalls kein Auftragsmörder, der zu Huren ging, weil er keine persönlichen Beziehungen oder gar Freundschaften riskieren konnte. Persönliche Beziehungen schwächten seinen eigenen Schutzwall und brachten die andere Person zugleich automatisch ins Fadenkreuz derjenigen, die Victor schaden wollten. Das letzte Mal, als jemand seine Nähe gesucht hatte, hatte er die Betreffende davon überzeugt, dass ihre Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhten.
»Wollen Sie mir nichts zu trinken anbieten?«
Er deutete auf ein Beistelltischchen mit einem schweren Silbertablett, auf dem ein Dekanter aus Bleikristall stand. Er war mit einer blassgelben Flüssigkeit gefüllt, vermutlich Scotch.
»Nein«, erwiderte sie. »Ich fürchte, der Whisky war ein Geschenk eines sehr lieben Kunden. Es wäre unhöflich, ihn mit einem anderen zu teilen. Ich bin sicher, dass du das verstehst.«
Er nickte.
»Was magst du denn am liebsten?«, wollte sie dann wissen. Eine gewisse neugierige Spannung lag in ihrer Stimme. Sie wollte erfahren, ob sie mit ihrer ersten Einschätzung richtiggelegen hatte.
»Ich tue es lieber, anstatt darüber zu reden.«
Das schien sie zu überraschen. »Das klingt … vielversprechend.« Sie tippte sich mit einem langen roten Fingernagel gegen die Unterlippe. »Und ich habe schon gedacht, du wärst langweilig.«
»Ich kann Ihnen versichern, dass ich ein unerträglich uninteressanter Mensch bin.«
»In diesem Punkt würde ich mir gerne ein eigenes Urteil bilden.«
Einen Augenblick lang standen sie einander schweigend gegenüber.
Sie deutete mit gehobenen Augenbrauen – ausgezupft und wieder aufgemalt – in eine Richtung. »Das Badezimmer ist da drüben.«
»Ja, natürlich«, sagte Victor. »Jeder Kunde muss vorher duschen.«
»Genauso steht es auf meiner Liste.«
»Und wenn ich Ihnen sage, dass ich nur sehr ungern dusche?«
»Dann würde ich dich höflich, aber bestimmt bitten zu gehen.«
»Ohne Erstattung?«
Sie lächelte ohne Worte.
»Gibt es auch Kunden, die sich weigern?«, wollte er wissen.
»Ganz vereinzelt, ja. Aber die meisten Männer akzeptieren meine Regeln und verhalten sich wie Gentlemen.«
»Was passiert in diesen vereinzelten Fällen?«
»Ich zeige ihnen die Tür.«
»Auch, wenn es sich um sehr liebe Kunden handelt?«
Sie lächelte weiter, gab jedoch keine Antwort. »Nimm dir einen Bademantel.«
Er nickte und schlug einen Bogen, weil er nicht direkt vor den Fenstern entlanggehen wollte. Dabei kam er dicht an der Frau vorbei. Sie streichelte kurz seinen Arm.
Das Badezimmer ging vom Flur ab. Er trat ein und machte die Tür hinter sich zu. Schob den kleinen Messingriegel vor. Nicht, dass er gegen einen gewaltsamen Eindringling viel genützt hätte, aber Victor wollte nicht, dass die Frau hereinplatzte und ihn bei seinem Unterfangen störte.
Kapitel 5
Victor zog an der Schnur neben der Tür, und das Licht ging an. Ein Abluftventilator erwachte mit leisem Summen zum Leben. Victor drehte den Wasserhahn in der Dusche auf. Dann klappte er den Toilettendeckel herunter und stellte sich darauf, um den Ventilator zu erreichen, der hoch oben über dem kleinen Fenster in der Wand befestigt war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!