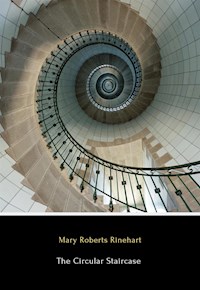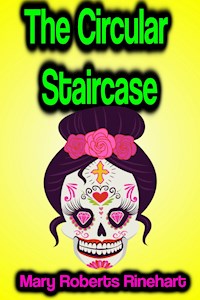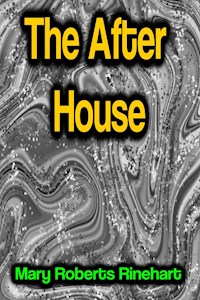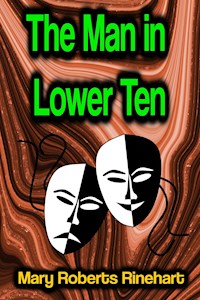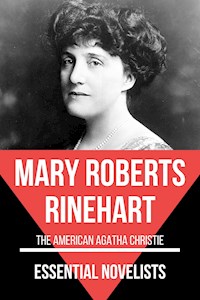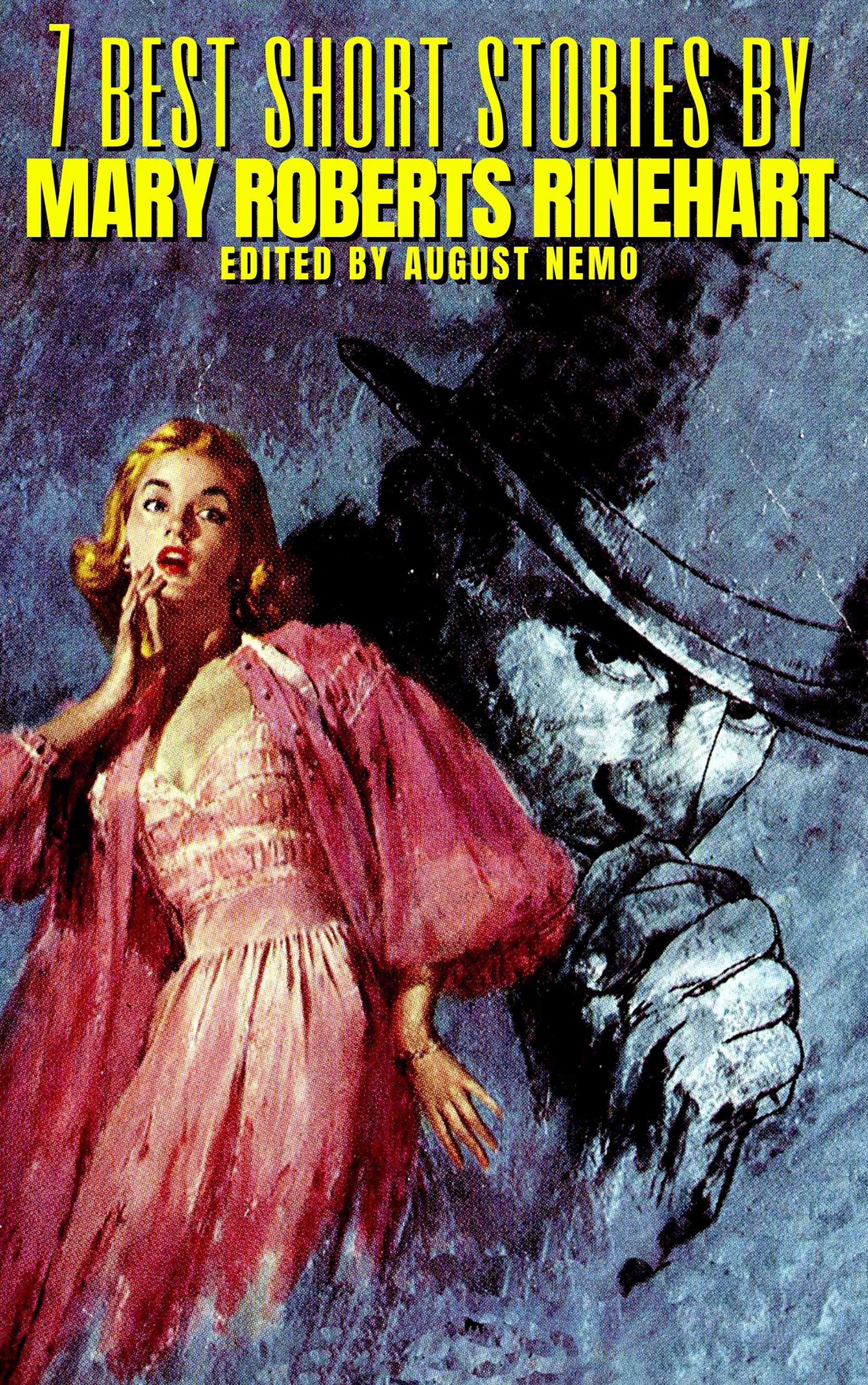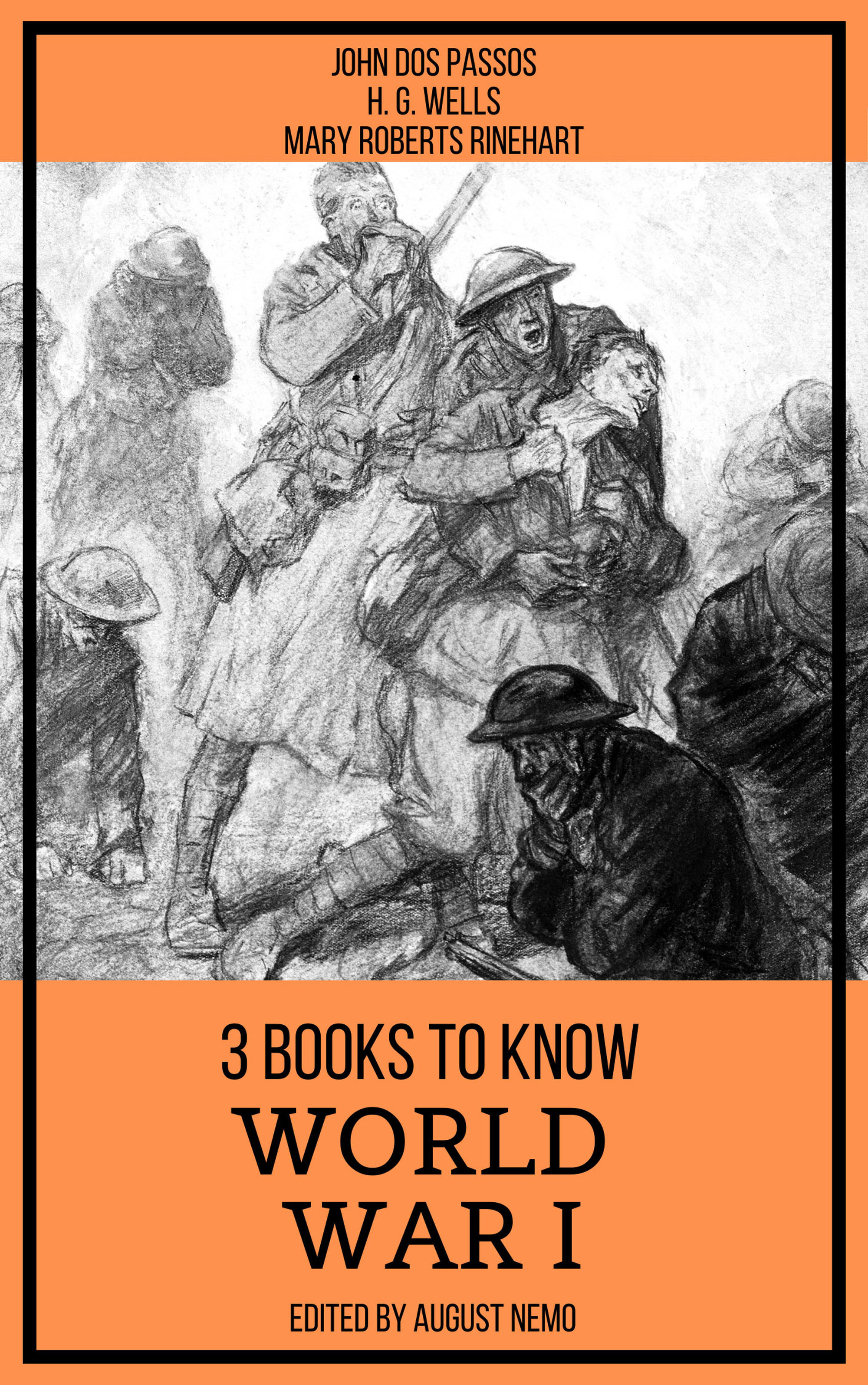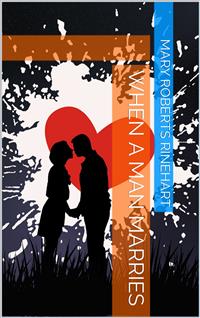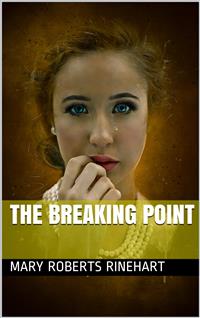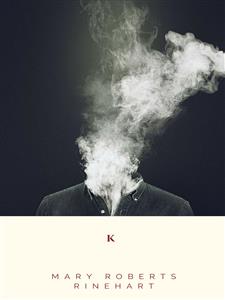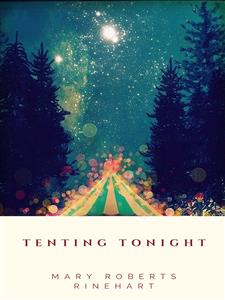3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Bis zu ihrer Scheidung in Reno fiel Judith alles in den Schoß: Reichtum, Schönheit, glückliche Liebe. Doch dann gerät sie in einen Strudel von mörderischen Vorfällen, und sie wird von Todesangst gepackt. Es muß ihr gelingen, die Ursachen in ihrer Vergangenheit zu finden. Doch der Preis, den Judith zu zahlen hat, ist unglaublich hoch … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Ähnliche
Mary Roberts Rinehart
Das Abgründige in Judith
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Carla Signorell
FISCHER Digital
Inhalt
1
Im vergangenen Herbst erteilte ich eines Tages den Auftrag, das Schwimmbassin mit allem Drum und Dran abzureißen. Denn wir standen im Begriff, vom Birkenhof, dem Landhaus, das unserer Familie viele Jahre lang als Sommersitz und später, nach dem großen Wirtschaftskrach, als ständiges Heim gedient hatte, fortzuziehen. Aus vielerlei Gründen hegten weder mein Bruder Phil noch ich den Wunsch, dort zu bleiben.
Doch als ich dort stand und den Arbeitern bei ihrem Zerstörungswerk zusah, erschien es mir unglaublich, daß ich erst wenige Monate zuvor, zu Beginn des Frühlings, das Schwimmbassin nach Jahren der Vernachlässigung wieder hatte instand setzen lassen.
Ich muß noch sehr klein gewesen sein, als das Schwimmbassin erstellt wurde, doch ich erinnere mich genau, wie mein Vater die Arbeiten beaufsichtigte, ohne jede Begeisterung, müde, fast widerwillig. Er hatte den kleinen Fluß geliebt, der das Schwimmbecken speisen sollte und den man zu diesem Zweck aus seiner gewohnten Bahn leitete, hatte ihn geliebt, wie er seinen wilden Garten in der Talsenke unterhalb der Stallungen liebte. Heckenrosen blühten dort, und Weißdorn und wilde Lilien – und keinem der Gärtner hatte mein Vater jemals gestattet, mit ordnender Hand in das kleine Stück zauberhafter Wildnis einzugreifen.
Ich erinnere mich auch an den Tag, da das Schwimmbecken endlich fertig war. Mein Vater stand neben dem Sprungbrett und sah zu, wie sich das Bassin langsam mit Wasser zu füllen begann. Er war ein hochgewachsener Mann, mit ernsten Zügen und ruhigen grauen Augen; meistens verhielt er sich schweigsam und zurückhaltend, und nur, wenn er mit mir allein war, ging er aus sich heraus.
An jenem Tag beim Schwimmbassin blickte er mit besorgten Augen auf mich herunter.
»Du mußt schwimmen lernen, Baby«, sagte er. »Wenn du ins Wasser fällst – und das wirst du bestimmt einmal –, mußt du auch wissen, wie du wieder herauskommst!«
Für ihn war ich immer das »Baby«, auch dann noch, als ich dem Kinderzimmer längst entwachsen war.
Ja, das Schwimmbassin enthielt viele Erinnerungen für mich, sehr viele – schöne und heitere, aber auch häßliche und grauenhafte. Und um der häßlichen, um der grauenhaften willen war ich froh, das Becken verschwinden zu sehen …
Es ist nicht leicht, sich heute die Extravaganz, den sorglosen Reichtum und Luxus jener längst vergangenen Tage vorzustellen. Mein Vater liebte den Birkenhof – benannt nach einer anmutigen Birkengruppe, die auf einem Hügel in der Nähe des Hauses stand –, und er freute sich immer auf den Tag, an dem die Familie das Stadthaus mit dem Birkenhof vertauschte. Alljährlich, in den ersten Junitagen, zogen wir hinaus.
Nun war es Herbst, ich stand da und sah den Arbeitern bei ihrem Zerstörungswerk zu – und dachte an jene längst vergangenen glücklichen Sommertage zurück. Es war in den späten zwanziger Jahren: wir verließen das Stadthaus und zogen nach dem Birkenhof hinaus – ein Umzug, der so eindrucksvoll und gewichtig war, daß er selbst einem kleinen Mädchen wie mir im Gedächtnis haften blieb. Sechs oder sieben Dienstboten, dazu noch ein Butler, wir vier Kinder mit unseren Kindermädchen und Gouvernanten, Mutter mit ihrer Zofe und drei oder vier Hunde. Das große Landhaus war wie jedes Jahr empfangsbereit und in tadelloser Ordnung. Mutter ging durch alle Räume – die Gesellschaftsräume und Salons, das riesige Wohnzimmer mit der anschließenden Halle, das Frühstückszimmer, die Bibliothek und Vaters kleines Studio. In den Wirtschaftsflügel, wo Helga und das Küchenmädchen sich bereits mit dem gewaltigen Kohlenherd herumschlugen, warf sie nur einen flüchtigen Blick – die Küche war Helgas Bereich.
Später ging sie hinauf in ihr großes Schlafzimmer über der vorderen Veranda – das Zimmer, in dem viele Jahre später meine Schwester Judith mit angstverzerrtem Gesicht die Fensterläden zunageln ließ – und beaufsichtigte ihre Zofe beim Auspacken der Koffer. Sie war eine stattliche Frau, meine Mutter, selbstsicher und gebieterisch und – wie mir heute klar ist – sehr stolz auf ihren Reichtum und ihre gesellschaftliche Stellung.
Heute verstehe ich, weshalb es mir nie gelang, die Liebe meiner Mutter zu erringen. Gewiß – sie kümmerte sich darum, daß ich alles hatte; niemand sollte jemals behaupten dürfen, daß eines der Maynard-Kinder vernachlässigt würde. Doch sie muß zutiefst erschrocken sein, als sie entdeckte, daß ich unterwegs war – zehn Jahre nach Judith. Meine Schwester Anne war damals vierzehn, Phil dreizehn. Ich war noch ein Kind – erst sechs Jahre alt –, als meine Schwester Anne im Sommer 1928 heiratete.
Es war eine glanzvolle Hochzeit – und dies, obwohl Anne, zumindest nach Mutters Ansicht, keineswegs eine glänzende Partie gemacht hatte. Martin Harrison war ein nicht sehr erfolgreicher Architekt, er sah auch nicht besonders gut aus – doch Anne liebte ihn.
Heute weiß ich, daß mein Vater solche Feste, solche Schaustellungen aus tiefstem Herzen verabscheute. Oftmals war er verschwunden; niemand wußte, wo er steckte, und wenn ich ihn dann suchen ging, fand ich ihn allein in seinem wilden Garten.
Heute weiß ich auch, daß es Judith war, die das Schwimmbassin haben wollte – Judith, der die Mutter nichts abzuschlagen vermochte. Vater setzte sich zur Wehr. Nicht um des Geldes willen, o nein! Doch bereits damals umschwärmten die Jungen Judith wie Fliegen einen Honigtopf; sie schienen den Birkenhof förmlich zu belagern, und oftmals zertrampelten sie im Ungestüm ihrer rücksichtslosen Jugend die kostbarsten Blumenbeete. Vater zitterte um seinen wilden Garten.
Judith war eine seltsame Mischung von Schönheit und Willenskraft. Jahre später behauptete Anne, sie wäre ein psychopathischer Störenfried und eine chronische Lügnerin. Ich wage es nicht, dieses Urteil zu bestätigen; ich weiß bloß, daß sie entweder bekam, was sie haben wollte, oder aber sich tagelang in finster gekränktes Schmollen zurückzog.
Doch wie dem auch sei: sie war ein bezauberndes Geschöpf! Für Judith hatte Mutter große Pläne; Judith sollte Annes Scharte hundertfach auswetzen, sollte sich Geld und eine hohe gesellschaftliche Stellung sichern, indem sie den richtigen Mann heiratete.
Um meine eigene Zukunft kümmerte sich vorläufig kein Mensch. Ich war noch immer das häßliche kleine Entlein mit glattem, schwarzem Haar und gewöhnlichen grauen Augen, meistens von einer oder zwei Zahnlücken entstellt – eine richtige Enttäuschung für meine stolze Mutter. Das war vermutlich der Grund, weshalb sie mich mehr oder weniger ungebunden aufwachsen ließ; ich durfte auf Bäume klettern, im kleinen Fluß waten und später, als das Schwimmbassin erstellt war, halbe Nachmittage im Wasser verbringen und schwimmen.
Ich hatte auch bald gelernt zu tauchen. Immer wieder kletterte ich auf das Sprungbrett hinauf und rief den andern mit meiner schrillen Kleinmädchenstimme zu:
»Schaut zu! Schaut doch zu, wie ich springe!«
Doch sie beachteten mich nicht. Alles, was sie sahen, war Judith – Judith, die lässig am Rande des Schwimmbassins saß und mit den Beinen baumelte. Selbst die Mädchen konnten den Blick nicht von ihr lösen.
Das kurze Haar schmiegte sich in kleinen blonden Locken dicht an ihren Kopf, und sie achtete stets sorgfältig darauf, daß es nicht naß wurde. Sie war eine schlechte Schwimmerin. In allen anderen Sportarten zeichnete sie sich aus: sie ritt sehr gut, spielte ausgezeichnet Tennis und Golf – doch sie haßte das Wasser.
An all diese Dinge dachte ich, während ich an jenem Herbsttag vor dem Haus stand und zum Schwimmbassin hinübersah. Seltsam genug: ich erinnerte mich nicht, Ridgely Chandler, den Mann, den Judith vor zwanzig Jahren heiratete, je mit ihr zusammen beim Schwimmbassin gesehen zu haben. Er war freilich älter als all die College-Jungen – er ging schon gegen vierzig. Doch wenn ich mich auch nicht erinnerte, ihn gesehen zu haben, so mußte er dennoch dabeigewesen sein, vor allem im Sommer des Jahres 1929.
Ich habe das Jahr 1929 erwähnt, weil dies unser letztes glückliches, sorgloses Jahr im Birkenhof war. Als wir nach dem großen Wirtschaftskrach dorthin zurückkehrten, taten wir es, weil wir dazu gezwungen waren und weil uns nichts anderes übrigblieb, als den Birkenhof zu unserem ständigen Wohnsitz zu machen.
In wenigen Tagen würden wir den Birkenhof für immer verlassen – und vielleicht würde es mir dann gelingen, die schrecklichen Ereignisse des letzten Sommers allmählich aus meinem Gedächtnis zu verbannen.
2
Es muß im Februar des letzten Jahres gewesen sein, als meine Schwester Anne zum Birkenhof herausgefahren kam. Der Tag war grau und naßkalt, Regen mischte sich mit großen, wäßrigen Schneeflocken, und ein unfreundlicher Wind rüttelte an den kahlen Ästen der Bäume. Anne war schlechter Laune. Sie trat ins Wohnzimmer und blickte sich angewidert um.
»Wie könnt ihr beide, du und Phil, es bloß in dieser schäbigen alten Ruine aushalten!« sagte sie. »Warum laßt ihr nicht zumindest die Wände neu streichen?«
»Womit?« fragte ich lakonisch. »Oder kannst du dir vielleicht Phil auf einer Leiter vorstellen, ein Aktenstück in der einen und einen Pinsel in der andern Hand?«
Phil war Anwalt – kein sehr erfolgreicher Anwalt – und da er sich in seinem Büro nur wenig Hilfe leisten konnte, nahm er abends häufig Arbeit mit nach Hause.
Anne zuckte die Achseln. Trotz ihrer zweiundvierzig Jahre war sie noch immer eine schöne Frau, wenn ihr auch die selbstverständliche, lässige Eleganz abging, die Mutter besessen hatte.
»Wie geht’s den Kindern?« fragte ich.
»Gut, soviel ich weiß. Sie sind beide fort – Bill im College und Martha im Internat. Hör mal, Lois« – sie zögerte und sah mir dann voll in die Augen – »was ist eigentlich mit Judith los?«
»Mit Judith? Keine Ahnung. Den Zeitungen nach zu schließen, ist sie noch immer außergewöhnlich fotogen und gehört nach wie vor zu den zehn bestangezogenen Frauen Amerikas.«
Anne runzelte die Stirn.
»Ja, ich weiß. Aber irgend etwas stimmt nicht mit ihr. Sie geht seit einigen Wochen zum Psychiater. Ridge hat mir’s erzählt. Und sie hat sich verändert. O mein Gott, Lois – wie sie sich verändert hat!«
»Was meinst du damit: sie hat sich verändert?«
»Erstens mal hat sie entsetzlich abgenommen. Und sie macht den Gesellschaftsrummel nicht mehr so leidenschaftlich mit wie früher. Ich traf sie kürzlich im Stork Club. Sie sah aus wie ihr eigenes Gespenst.«
»Vielleicht hängt das irgendwie mit dem Psychiater zusammen?«
»Ich glaube kaum. Er heißt Townsend und soll wirklich gut sein. Im übrigen geht es mir gar nicht um Judith. Es geht mir um Ridge Chandler. Sie hat dem armen Kerl lange genug auf der Nase rumgetanzt. Ist das vielleicht ein Leben für einen Mann wie Ridge? All diese verrückten Leute, mit denen sie sich herumtreibt, und die ewigen Gesellschaften und Parties und Bälle, und nie zu einer vernünftigen Zeit ins Bett! Er macht den Rummel schon seit Jahren nicht mehr mit.«
Ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Das glaube ich gerne. Schließlich ist Ridge ein echter Chandler, korrekt und tadellos und – schrecklich langweilig.«
»Red nicht so albern. Er hat einen guten Namen und eine Menge Geld geerbt, und Judith steht im Begriff, beides zum Fenster hinauszuwerfen. Ich will dir lieber gleich alles sagen: sie hat im Sinn, sich scheiden zu lassen.«
Ich starrte sie ungläubig an. Obwohl ich Judith nur selten traf, hatte ich sie doch seit Jahren beneidet. Nicht nur um ihre Schönheit, für die ich noch immer die Bewunderung der häßlichen kleinen Schwester hegte. Nein, ich hatte sie auch um all die glänzenden Vorteile beneidet, die ihre Ehe ihr bot: die riesige, luxuriöse Wohnung, die vielen Dienstboten, die Autos, Kleider, Schmucksachen. Daß Judith das alles aufgeben wollte, erschien mir unglaublich, ja geradezu grotesk.
»Warum?« fragte ich. »Warum in aller Welt? Sie hat doch alles, was sie sich wünscht. Und außerdem läßt man sich bei den Chandlers doch nicht scheiden! Oder doch?«
Anne zündete sich eine Zigarette an – ein sicheres Anzeichen, daß sie aufgeregt war.
»Sie hat ihn natürlich nie geliebt«, sagte sie. »Mutter hat das Ganze arrangiert. Ich erinnere mich – an ihrem Hochzeitsmorgen fand ich Judith in Tränen aufgelöst. Ihr Hochzeitskleid lag auf dem Boden, und sie trampelte mit beiden Füßen darauf herum. Ich mußte das Kleid erst aufbügeln, ehe sie es tragen konnte.«
»Aber sie hat ihn doch bestimmt freiwillig geheiratet. Mutter hätte sie niemals dazu gezwungen – Judith war ihr Liebling.«
»Vielleicht bedeutete er Sicherheit für sie«, sagte Anne nachdenklich. »Du weißt doch, wie scheußlich das alles war nach Vaters Tod …«
Minutenlang saßen wir schweigend beisammen. Ich hatte mich seit Jahren bemüht, nicht mehr an Vaters Tod zu denken, mich nur noch an seine Güte, seine Freundlichkeit zu erinnern. Es hatte lange gedauert, bis ich erfuhr, wie er gestorben war. Der Wirtschaftskrach hatte ihn ruiniert. Er hatte so viel von seinen Schulden bezahlt, als ihm möglich war, doch im Januar 1930 war er eines Abends in sein Büro zurückgegangen und hatte sich eine Kugel durch den Kopf geschossen.
Auch Annes Gedanken waren in die Vergangenheit abgeschweift. Sie blickte zu dem Porträt unserer Mutter auf, das über dem Kamin hing.
Hastig kehrte sie dann zu Judith zurück.
»Ridge sagt, sie hätte ihn um die Scheidung gebeten«, sagte sie. »Sie weigert sich, einen Grund zu nennen. Erklärt bloß, sie möchte verreisen – nach Europa oder Südamerika!«
Anne warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und griff dann nach ihrer Handtasche.
»Ich muß machen, daß ich nach Hause komme«, sagte sie. »Na, jedenfalls hielt ich’s für richtig, daß du wegen Judith Bescheid weißt. Du willst sie doch bestimmt nicht hier haben, nicht wahr?«
Ich begleitete sie hinaus und sah ihr nach, wie sie in ihrem alten Sedan die Auffahrt hinunterfuhr. Dann kehrte ich ins Haus zurück, zu meiner Schreibmaschine und zu dem Manuskript, das – so hoffte ich – sich bald zu einem großen Roman auswachsen sollte. Doch meine Arbeit machte keine großen Fortschritte. Das Gespräch über Judith hatte ein unbehagliches Gefühl in mir zurückgelassen.
Nachdem ich eine Weile untätig an der Schreibmaschine herumgetrödelt hatte, stand ich auf und ging ins Wohnzimmer hinüber. Vor Mutters Porträt blieb ich stehen und blickte zu dem schönen, stolzen Antlitz empor. Ich dachte an meine Mutter, so wie ich sie gekannt hatte, ehe sie starb. Wie sie die ungewohnte Armut, das Sparen und Rechnen gehaßt hatte, zu dem sie nach Vaters Tod verurteilt gewesen war! Doch irgendwie hatte sie es zustande gebracht, für Judith eine große Hochzeit zu geben – obwohl damals noch kein Jahr seit Vaters Tod vergangen war.
Woher hatte sie sich das nötige Geld verschafft?
Noch etwas anderes fiel mir ein. Bis zu ihrem Tod – fünf Jahre nach Judiths Hochzeit – bezog Mutter regelmäßig eine kleine Rente aus irgendeiner unbekannten Quelle. Sie sprach nie darüber, und keiner von uns machte sich deswegen Gedanken – doch nun begann ich mich zu fragen, ob Ridge Chandler ihr diese Rente bezahlt hatte.
Einige Wochen vor ihrem Tod bat mich Mutter, ich möchte mich Judiths annehmen, falls ihr etwas zustoßen sollte. Ich war damals erst dreizehn Jahre alt, und ich erinnerte mich, wie ich sie mit verblüffter Miene anstarrte.
»Was in aller Welt könnte ihr denn zustoßen, Mutter?«
Sie sah mich lange an, und in ihren Augen lag ein seltsamer Ausdruck.
»Sie ist nicht von derselben Art wie ihr andern«, sagte sie langsam, »sie gehört zu den Menschen, die früher oder später in Schwierigkeiten geraten. Ich habe sie allzusehr verwöhnt«, murmelte sie. »Ja, ich habe manchen Fehler begangen – ich wollte sie glücklich machen – doch ich wußte, daß sie Ridgely nicht liebte, als sie ihn heiratete. Ich dachte, Judith müsse einen Menschen haben, der sich um sie kümmert. Die Männer waren allzusehr hinter ihr her –«
Da saß ich nun, gebunden durch jenes alte Versprechen, mich Judiths anzunehmen – einer Judith, die ich kaum je traf – einer Judith, die sich nach zwanzigjähriger Ehe entschlossen hatte, ihren Gatten zu verlassen und nach Reno zu fahren.
3
Zwei Tage später erhielt ich abermals Besuch. Ich saß an meiner Schreibmaschine, und als ich einmal zufällig den Kopf hob und zum Fenster hinausblickte, sah ich Ridgelys Wagen in unsere Auffahrt einbiegen.
Jennie hatte ihren freien Tag; deshalb ging ich selbst hinunter und öffnete ihm die Haustür. Während er seinen Mantel ablegte, beobachtete ich ihn heimlich. Er sah elend aus, fast krank. Ich hatte Ridgely nie besonders sympathisch gefunden, doch heute tat er mir leid.
»Tut mir leid, daß ich dich störe«, sagte er. »Vermutlich bist du am Schreiben? Ach – ich sehe, ihr habt das Porträt behalten: Ein fabelhaftes Bild …« Er schwieg sekundenlang, dann fügte er hinzu, und etwas wie Bitterkeit schwang in seiner Stimme mit: »Sie war eine starke Persönlichkeit, deine Mutter – stark und eine richtige Herrschernatur. Das Bild ist ihr sehr ähnlich.«
»Ja«, sagte ich. »Möchtest du einen Drink? Die Fahrt hier heraus muß bei diesem Wetter ziemlich scheußlich gewesen sein.«
»Danke, vorläufig nicht. Vielleicht später.«
Er wartete, bis ich mich gesetzt hatte; erst dann ließ er sich selber in einen Stuhl sinken.
»Ich will keine langen Umwege machen, Lois«, sagte er. »Ich nehme an, du weißt ohnehin, weshalb ich hier bin. Habe ich recht?«
Ich nickte. »Anne hat mir alles erzählt. Es geht um Judith, nicht wahr?«
»Ja. Es geht um Judith. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie ist – sie ist nicht mehr die Judith, die sie früher war. Seit einigen Wochen ist sie gänzlich verändert.«
Ich stellte mich unwissend. »Wie meinst du das? Ist sie krank?«
»O nein, sie ist völlig gesund … Sag mir, Lois: hältst du es für möglich, daß sie sich in jemanden verliebt hat?«
»Sie hat immer eine ganze Meute von Anbetern um sich herum gehabt«, sagte ich, »das geht allen Frauen so, die aussehen wie Judith. Aber ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, Ridge. Sie – nun ja, sie macht sich im Grunde genommen nichts aus Männern, verstehst du?«
»Ja, ich weiß«, versetzte er trocken. »Sie macht sich nur aus einem einzigen Menschen etwas – aus sich selbst. Als sie mich heiratete, hatte ich ein bißchen Hoffnung, doch alles kam anders, als ich dachte … Schon eine Woche nach der Hochzeit wußte ich, daß ich ihr niemals auch nur das geringste bedeutet hatte.«
»Dann hast du’s aber erstaunlich lange ausgehalten«, entfuhr es mir.
Er betrachtete mich mit seinem kühlen Lächeln.
»Was blieb mir anderes übrig? Ich stamme aus einer alten, konservativen Familie – aus diesem Grunde nehme ich eine ganze Menge in Kauf. Was nun die Scheidung betrifft – ich habe ihr keinen Grund dazu gegeben. Ich habe mir all die Jahre hindurch eine ganze Menge bieten lassen. Das heißt nicht etwa, ich glaubte, sie hätte mich betrogen – doch sie ist seit langem nicht mehr richtig meine Frau gewesen. Seit langem. Hat sie – je mit dir darüber gesprochen?«
»Nein. Ich treffe sie nur äußerst selten, Ridge.«
Er zögerte unschlüssig, dann zog er ein kostbares goldenes Etui aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an.
»Sie schleuderte mir die Neuigkeit beim Frühstück entgegen – vor zwei, drei Tagen war es. Meistens steht sie erst gegen zehn Uhr auf – ich war überrascht, sie so früh schon unten zu sehen, denn abends zuvor war sie erst spät nach Hause gekommen. Na – am besten erzähle ich dir wohl, was sich in der Nacht vor diesem Frühstücksgespräch abspielte. Es ist zwar kein Ruhmesblatt für mich – doch vielleicht kannst du dir einen Vers auf das Ganze machen.«
Er fuhr fort zu sprechen, ziemlich rasch und mit eintöniger, fast gefühlloser Stimme. Er hatte sich bereits zu Bett gelegt, als sie an jenem Abend, früher als gewöhnlich, von einer Party nach Hause zurückkehrte. Im Halbschlaf lag er da und lauschte auf die vertrauten Geräusche aus dem Nebenzimmer – sie hatten seit Jahren getrennte Schlafzimmer –, und ganz plötzlich wurde ihm klar, daß sie sich nicht wie sonst nach den üblichen Vorbereitungen ins Bett begab. Sie schien im Zimmer auf und ab zu gehen – er konnte das Klicken ihrer hohen Absätze auf dem Parkett zwischen den Teppichen hören. Dann blieb es sekundenlang still, und im nächsten Augenblick hörte er, wie sie sich am Safe zu schaffen machte, in dem sie ihren Schmuck aufbewahrte.
Da sich Judith sonst nie die Mühe nahm, die Schmuckstücke, die sie getragen, noch am selben Abend wegzuschließen, horchte er überrascht auf.
Endlich raffte er seinen Mut zusammen, stand auf und ging zu ihr. Sie hörte ihn nicht kommen. Sie hatte alles herausgenommen, was sie besaß: die Brillantarmbänder, die Perlen, die Smaragdohrringe und das Smaragdcollier, die vielen, vielen Broschen und Clips und Nadeln – und eben streifte sie noch den riesigen, zehnkarätigen Solitär vom Finger, den ihr Ridgely vor zwanzig Jahren als Verlobungsgeschenk geschenkt hatte. Sie hob die kostbaren Gegenstände hoch, Stück um Stück, und betrachtete sie prüfend im Schein der verhängten Lampe –
«– ganz so, als wollte sie sie auf ihren Wert hin einschätzen!« sagte er.
Er hatte sich zurückgezogen, ohne mit ihr zu sprechen. Selbstverständlich war sein erster Gedanke gewesen, Judith müsse einem Erpresser in die Hände gefallen sein.
»Doch es scheint, daß ich mich täuschte«, sagte er. »Als sie von Scheidung zu sprechen begann, fragte ich sie, ob sie sich in irgendwelchen Schwierigkeiten befände, und wenn ja, würde ich ihr gerne helfen. Ich würde ihr jede Summe zur Verfügung stellen, die sie brauchte. Weißt du, was sie daraufhin sagte?«
»Nein.«
»Sie hätte nur einen einzigen Wunsch: Amerika so rasch als möglich zu verlassen.«
»Hat sie diesen Wunsch irgendwie begründet?«
»Nein – mit keinem Wort. Weiß der Himmel – ich begann mich zu fragen, ob sie am Ende jemanden umgebracht hätte …«
»Und heute? Vermutest du das immer noch?«
»Nein. Sie ist keineswegs eine Frau, die irgendwelcher Leidenschaften fähig ist. Gewiß, sie hat ein jähes Temperament – doch meistens hält sie sich eisern im Zügel. Sie würde niemals ein solches Risiko eingehen. Sie liebt es, ein bißchen herumzuspielen, Bewunderung und Triumphe zu ernten, doch niemals würde sie sich um eines Mannes willen ernstlich in Gefahr begeben. Und selbst wenn sie es schließlich doch einmal getan hätte – wäre das ein ausreichendes Motiv für ihren Wunsch nach Scheidung? In solch einem Augenblick würde sie doch viel eher bei mir bleiben wollen, denn ich kann ihr Sicherheit und Schutz bieten.«
»Vielleicht hat sie’s gar nicht ernst gemeint«, sagte ich. »Du kennst doch Judith. Ab und zu kriegt sie eine verrückte Laune, und dann sagt und tut sie die unglaublichsten Dinge. Das war schon immer so …«
»Diesmal ist es keine Laune«, erwiderte er, und seine Stimme klang hart. »Sie will nach Reno fahren, sobald es sich machen läßt.
Ich stehe vor einem Rätsel. Ich weiß nicht, weshalb sie sich in den letzten Wochen derart verändert hat. Wovor fürchtet sie sich, Lois?«
»Ist es möglich, daß sie irgendeinen Unfall gehabt hat?« fragte ich.
»Ich meine – wenn sie jemanden überfahren hätte – getötet vielleicht – dann hätte sie vermutlich den Kopf verloren und wäre einfach weitergesaust.«
»Und warum dann diese lächerliche Idee mit der Scheidung?«
»Natürlich muß es irgendwie mit Erpressung zusammenhängen«, sagte ich. »Erpressung ist die einzige Erklärung für den Vorfall mit dem Schmuck, nicht wahr?«
Er zuckte die Achseln. Der Ausdruck seines blassen Gesichtes hatte sich wieder ein wenig belebt, und als er nun weiterzusprechen begann, klang seine Stimme nicht mehr so hart und brüchig wie zuvor. Die Scheidung war bereits in die Wege geleitet, sagte er. Ja, er hatte sogar schon die Höhe der Alimente festgelegt, die er ihr bezahlen würde – überraschenderweise hatte Judith sonst keinerlei Forderungen gestellt.
Und dann kam etwas, das mich auffahren ließ, als wäre ich von einer Tarantel gestochen …
»Eigentlich bin ich hergekommen, um dich um etwas zu bitten, Lois«, sagte er. »Ich bin überzeugt, daß sich Judith wirklich fürchtet, daß sie nicht bloß Theater spielt. Vermutlich droht ihr zwar ernstlich keine Gefahr, doch ich dachte mir, wenn du sie nach Reno begleiten würdest, könntest du – nun ja, du könntest sie ein bißchen im Auge behalten, falls –«
Mir blieb buchstäblich die Luft weg. Als ich endlich wieder sprechen konnte, sagte ich mühsam:
»Unsinn, Ridge – sie würde mich nicht haben wollen. Sie hat mich nie besonders gemocht, das weißt du doch. Und in einer wirklichen Krisis könnte ich ihr bestimmt nicht helfen.«
»Ich erwarte keine Krisis, wie du dich auszudrücken beliebst«, sagte er scharf. »Ich erwarte bloß, daß sie sich vernünftig benimmt. Außerdem habe ich ein Recht zu wissen, wovor sie sich fürchtet und warum sie die Staaten verlassen will.«
»Mit anderen Worten – du brauchst einen Bernhardinerhund mit einem Kognakfäßchen um den Hals. Nein, danke, Ridge – such dir eine andere, die für dich spionieren geht.«
Er warf mir einen ärgerlichen Blick zu. Dann erhob er sich.
»Hör mal zu, Lois«, sagte er. »Wenn du ein bißchen zurückdenkst, wirst du zugeben müssen, daß du mir etwas schuldest. Das Geld, mit dem dein Studium bestritten wurde – es war mein Geld. Und solange deine Mutter lebte, bezahlte ich ihr eine kleine Jahresrente. Nun komme ich zu dir und bitte dich um Hilfe – und du weist mich ab. Ist das fair?«
Ich dachte an den Kriminalroman, an dem ich eben arbeitete. Es würde nicht mehr lange dauern, und die Story war so weit, daß ich einen Vorschuß verlangen konnte – und wir brauchten das Geld dringend … allzu dringend.
Vermutlich wußte Ridge meinen Gesichtsausdruck richtig zu deuten, denn er fügte hastig hinzu:
»Selbstverständlich bin ich bereit, dir deine Zeit zu vergüten, wenn du Judith begleitest. Sagen wir mal – tausend Dollar plus sämtliche Spesen. Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, daß du auch in Reno weiterarbeiten kannst. Sie will nicht in der Stadt wohnen, sondern auf einer Ranch außerhalb von Reno.«
»Wann fährt sie?« fragte ich mit schwacher Stimme.
»Morgen oder übermorgen.«
Morgen oder übermorgen! Du lieber Himmel – wenn Judith es derart eilig hatte, mußte wirklich etwas schiefgegangen sein …
»Aber, Ridge – ich bin sicher, sie wird mir gar nichts anvertrauen. Du weißt doch – wir standen uns nie wirklich nahe. Und was soll ich tun, wenn sie mich nicht haben will?«
»Sie wird dich haben wollen«, sagte er, und seine Stimme klang noch immer hart. »Ich hab’s ihr zur Bedingung gestellt – und sie hat sich einverstanden erklärt.« Er legte mir die Hand auf die Schulter. »Du tust mir den Gefallen, nicht wahr, Lois? Es wäre eine große Beruhigung für mich, dich in ihrer Nähe zu wissen. Sie ist so anders als sonst … ich möchte nicht, daß sie eines Tages zuviel Schlaftabletten schluckt oder so was Ähnliches …«
Erst da wurde mir klar, daß es sich nicht um einen Scherz, sondern um bittere Wirklichkeit handelte. Denn in diesem Augenblick begriff ich, daß Ridge nicht nur ein gekränkter verlassener Ehemann war – nein, er war auch ein Mensch, der sich selber fürchtete. Er war reizbar, nervös, hatte Angst – wovor? Irgend etwas stimmte nicht …
Als sich Ridge verabschiedet hatte, stieg ich langsam die Treppe hinauf. Hatte meine Mutter Judith wirklich gezwungen, Ridge zu heiraten? Und warum – warum in aller Welt – hatte sich Judith zwingen lassen?
Ich holte Phil wie üblich vom Bahnhof ab; ich brannte darauf, mich auszusprechen, doch nach einem Blick auf sein müdes Gesicht entschloß ich mich, meine Berichterstattung auf später zu verschieben.
Phil hatte sich umgezogen und war eben dabei, sich einen Whisky-Soda zu mixen, als ich mich zu ihm setzte.
»Morgen oder übermorgen fahre ich nach Reno«, sagte ich.
Er ließ beinahe den Cocktail-Shaker fallen.
»Du lieber Himmel – du wirst mir doch nicht am Ende erklären wollen, du seist all die Jahre heimlich verheiratet gewesen?«
»Unsinn! Ich fahre mit Judith zusammen. Sie läßt sich von Ridge scheiden.«
Er starrte mich ungläubig an. »Sag mir bloß nicht, Judith sei bereit, freiwillig auf zehn Millionen Dollar zu verzichten! Ich glaube es nicht. Nicht unsere liebe Judith!«
»Ridge war heute nachmittag hier. Es ist schon so, wie ich dir sage, Phil!«
Er ließ sich in seinen Sessel fallen …»Ich versteh’s ganz einfach nicht«, murmelte er. »Und aus welchem Grund hat sie’s so verdammt eilig? Hat sie etwas Besseres in Aussicht?«
»Ridge behauptet, nein.«
»Hmm –« Er starrte nachdenklich in sein Glas. »Es wird ihm bestimmt nicht das Herz brechen, weißt du. Unsere liebe Schwester ist nicht eben ein ideales Eheweib … Aber eines kann ich dir sagen: wenn sie sich wirklich entschließen sollte, ihr weiches Nest zu verlassen, so nur, weil sie weiß, daß irgendwo schon ein anderes, noch weicher gepolstertes auf sie wartet …«
Ich nickte zustimmend – wir hatten beide keine Ahnung, wie sehr wir uns täuschten.
4
Als ich mich mit Judith in New York im Bahnhof traf, sah ich auf den ersten Blick, daß sie sich verändert hatte. Ihr schönes Gesicht war schmal geworden, und sie schien die Menschenmenge auf dem Bahnsteig mit fiebrig ängstlichen Augen zu beobachten. Ihr flüchtig hingeworfenes »Hallo, Lois« klang nicht besonders liebevoll – doch da wir seit Jahren kaum miteinander verkehrten, hatte ich nichts anderes erwartet.
Zu meiner Überraschung reiste sie ohne Zofe, und – was mich noch mehr überraschte – sie war beinahe schäbig gekleidet. Sie trug auch ihr Haar anders als sonst. Das Ganze wirkte wie ein schwacher Versuch, sich zu verkleiden. Erst als wir im Zug saßen, schien ihre Spannung nachzulassen.
Sie warf mir einen halb spöttischen, halb ärgerlichen Blick zu.
»Was versprichst du dir eigentlich davon, daß du mitfährst?« fragte sie. »Du hast zwar das Abteil neben dem meinen, doch du brauchst dich nicht um mich zu kümmern. Ich will bloß schlafen und lesen.«
Und wirklich: Judith verbrachte fast die ganze Reise allein in ihrem Abteil, hinter verriegelten Türen. Erst nach Chicago öffnete Judith die Tür zwischen unseren Abteilen, und einmal begleitete sie mich sogar in den Speisewagen.
Sie sah besser aus als zu Beginn der Reise, und von der halben Verkleidung, die mich in New York verblüfft hatte, war nichts mehr zu merken. Als wir uns zu unserem Tisch begaben, folgten ihr die Leute mit den Blicken – so wie es immer und überall der Fall war. Es ist nicht leicht, Judith zu beschreiben oder gar zu erklären, worin der besondere Charme ihrer Schönheit besteht. Sie ist groß und blond und wunderbar gewachsen, und die äußeren Augenwinkel sind leicht nach oben gezogen, was ihrem Gesicht einen fremdartigen, überraschenden Reiz verleiht. Vermutlich ist es nicht Judiths Gesicht allein, das ihre Schönheit ausmacht, auch nicht ihr Lächeln, das so bezaubernd sein kann, wenn sie will, oder ihr lässig anmutiger Gang, ihre Bewegungen, ihre Stimme – nein, es ist die Vereinigung, das Zusammenspiel all dessen, und noch etwas mehr, etwas, das ich nicht beschreiben kann.
An jenem Abend im Speisewagen war es, daß mich Judith nach dem Birkenhof fragte.
»Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr dort«, sagte sie. »Wie ist’s denn jetzt bei euch? Noch immer so still und abgelegen?«
»Stiller denn je«, erwiderte ich. »Das Dorf ist langsam im Absterben begriffen, da fast alle großen Landhäuser geschlossen sind. Aber Phil und mir gefällt’s – das ist die Hauptsache. Ich lasse in diesem Frühling das alte Schwimmbassin in Ordnung bringen; bei heißem Wetter sind wir froh darüber.«
»Und Helga? Ist sie noch immer bei euch?«
»Aber ja – Gott sei Dank! Sie wird freilich immer älter; außerdem hat sie Arthritis.«
Den Rest der Reise verbrachten wir in leidlich gutem Einvernehmen. Wenn auch keine herzliche Freundschaft oder gar schwesterliche Zuneigung zwischen uns bestand, so begann ich doch einzusehen, daß ihr anfänglich so kalt ablehnendes Wesen nichts mit mir zu tun hatte. Sie war ganz einfach mit sich selbst und ihren Problemen beschäftigt.
In Reno ließ es sich ganz angenehm leben. Wir wohnten auf einer Ranch außerhalb der Stadt. Judith ritt häufig aus; wenn ich sie sah, war sie meistens von einigen Cowboys oder von den Männern umgeben, die Gäste der Ranch waren, und ich begann mich zu fragen, weshalb ich eigentlich hier wäre und ob sich Ridge die ganze Geschichte nicht hätte ersparen können.
Weder Judith noch ich erwähnten jemals die Scheidung, doch soviel ich feststellen konnte, wickelte sich alles programmgemäß ab.
Und dann, kurz vor unserer Heimfahrt, kam sie in mein Zimmer und erklärte mir kurz und bündig, sie hätte sich entschlossen, zu uns in den Birkenhof zu ziehen und dort zu bleiben, bis sie sich über ihre Zukunft klargeworden wäre.
»In den Birkenhof!« wiederholte ich fassungslos. »Warum in aller Welt in den Birkenhof? Du hast nie besonders viel dafür übrig gehabt, und so wie er heute ist, würde er dich zum Wahnsinn treiben.«
»Darf ich dich vielleicht daran erinnern, daß ein Teil des Hauses mir gehört«, sagte sie kalt. »Ich habe nie verlangt, daß du und Phil mir Miete zahlen, doch es ist mein volles Recht, dort zu wohnen, wenn ich Lust habe.«
»Ich dachte, du wolltest ins Ausland fahren –«, begann ich verzweifelt.
»Später vielleicht«, unterbrach sie mich, »Erst will ich mich eine Weile im Birkenhof ausruhen.«
Ich starrte sie ungläubig an, doch offensichtlich sprach sie in vollem Ernst.
»Nun sei schon vernünftig, Judith … du kannst ganz einfach nicht bei uns wohnen. Der größere Teil des Hauses ist geschlossen, wir benützen nur wenige Zimmer. Und ich muß mir mein Leben verdienen. Mit Schreiben – das weißt du doch. Dazu brauche ich Ruhe.«
Aber Judiths Entschluß stand fest; sie steckte bereits mitten in den Reisevorbereitungen, und wieder zwei Tage später traten wir die Heimfahrt an. Wie üblich wurde Judith von einigen Bewunderern zur Bahn begleitet; sie war glänzender Laune, und sie sah bildschön aus. Ich stand neben ihr auf der Plattform, von einem Abglanz der schwesterlichen Glorie beschienen; der Zug setzte sich in Bewegung, die Männer winkten, Judith lächelte …
Und dann drehte ich mich um, um Judith ins Innere des Wagens zu folgen – und sah, daß sie nicht fähig war, sich zu rühren.
Regungslos, wie erstarrt, stand sie da; ihre Rechte hielt krampfhaft das eiserne Geländer umklammert, und selbst das raffinierteste Make-up der Welt hätte die jähe Totenblässe nicht zu verbergen vermocht, die sich über ihre Züge gebreitet hatte. Sie war nahe daran, in Ohnmacht zu fallen. Ich versuchte, sie festzuhalten, doch unter meinem Griff gab ihr starrer Körper nach, wurde schlaff und drohte mir zu entgleiten. Ein hochgewachsener Mann, der hinter uns stand, erfaßte blitzschnell die Situation und kam mir zu Hilfe; in gemeinsamer Anstrengung gelang es uns, Judith in ihr Abteil zu bringen. Dort sank sie in ihrem Sitz zusammen – wie eine Kerzenflamme, die lautlos erlöscht. Der hochgewachsene Mann stand unter der Tür des Abteils und machte ein besorgtes Gesicht.
»Soll ich nicht lieber einen Arzt rufen?« fragte er.
»Nein. Sie wird sich gleich wieder erholen – ganz bestimmt. Aber trotzdem: vielen Dank!«
Er verbeugte sich leicht und verschwand, und wenige Sekunden später öffnete Judith die Augen. Ich stand mit einem Glas Wasser vor ihr.
»Was um Himmels willen ist denn passiert?« fragte ich unwillig, denn der jähe Schrecken hatte mich ärgerlich gemacht. »In dem einen Augenblick bist du eitel Lächeln und Strahlen und so weiter – und im nächsten sinkst du wie ein Häufchen Elend zusammen. Was soll das bedeuten?«
Sie richtete sich langsam auf und fuhr sich mit zitternden Händen durch das kurzgeschnittene blonde Haar.
»Mir wurde schwindlig«, sagte sie kurz. »Weiter nichts. Stell das alberne Wasserglas weg – ich bin nicht krank. Und hör gefälligst auf, mich mit offenem Mund anzustarren. Du siehst nicht eben intelligent aus …«
Von diesem Augenblick an benahm sich Judith mehr als seltsam. Sie bestand beispielsweise darauf, daß die Türen des Abteils während der ganzen Reise abgesperrt blieben; nur am ersten Tag durfte ich den Schlafwagensteward einlassen, der das Bett richten mußte. Soviel ich weiß, verließ sie ihr Bett erst wieder, als wir in New York einfuhren.
Die ganze Lage war äußerst peinlich und widerwärtig und lästig – und trotzdem tat mir Judith leid. Sie lag einfach in ihrer Koje, teilnahmslos, bleich wie der Tod, und weigerte sich, eine Erklärung abzugeben.
»Warum sagst du mir’s nicht, Judith?« fragte ich wieder und wieder. »Du fürchtest dich vor irgend etwas, nicht wahr?«
Sie schüttelte den Kopf. »Laß mich in Ruhe, Lois«, murmelte sie. »Kann ich nicht mal ein paar Tage krank sein, ohne daß man mich immerzu belästigt?«
»Ich glaube nicht, daß du krank bist, Judith. Du hast Angst. Diese ganze Einschließerei ist doch lächerlich. Was in aller Welt sollte dir in einem Zug zustoßen?«
»Es ist schon vorgekommen, daß jemand in einem Zug ermordet wurde«, flüsterte sie, und ein jäher Schauer durchlief ihren Körper.
Das war alles, was ich aus ihr herauskriegen konnte. Mit gerunzelter Stirn saß ich in meinem Abteil nebenan und dachte nach. Das Rätselhafte mußte sich in jenem Augenblick ereignet haben, als der Zug zur Abfahrt bereit war. Ich versuchte mir den Bahnsteig zu vergegenwärtigen – eine Gruppe winkender, lächelnder Männer, ein oder zwei Schaffner in roten Mützen, ein Steward, der Zugführer. In der letzten Minute waren noch zwei Taxis vorgefahren, doch nichts Unheimlicheres war ihnen entstiegen als zwei fröhliche junge Mädchen und eine ältere Dame, die an einem Stock ging.
Mit dem besten Willen konnte ich an unserer ganzen Abfahrt nichts Bedrohliches entdecken. Ich begann mich zu fragen, ob einer der Mitpassagiere Judith erschreckt haben könnte, und am zweiten Tag entschloß ich mich, den Zug zu durchsuchen. Aber wenn einer der Passagiere etwas Unheimliches an sich hatte, so konnte ich es jedenfalls nicht entdecken.
5
Erst am zweiten Tag der Reise traf ich wieder mit dem Mann zusammen, der mir bei Judiths Schwächeanfall geholfen hatte.
Er saß mir im Speisewagen schräg gegenüber und schien mich kaum zu beachten, doch als ich mir eine Zigarette zwischen die Lippen steckte und in meiner Handtasche zu wühlen begann, beugte er sich über den Tisch und bot mir Feuer.
»Wie geht es Ihrer Begleiterin?« fragte er.
»Danke, besser«, erwiderte ich. Der Ausdruck seiner Augen blieb mir verborgen, denn er trug eine Brille mit dunklen Gläsern.
»Hat Sie – der übliche Grund nach Reno geführt?«
»Ich bin nicht verheiratet«, sagte ich kühl.
Er ließ sich nicht so leicht abschrecken.
»Ich sah Sie vorhin durch den Zug gehen«, fuhr er fort. »Suchten Sie jemanden?«
»Ja. Ich habe nach der Nemesis Ausschau gehalten«, erwiderte ich kurz angebunden.
Er lachte. »Du lieber Himmel – und weshalb sollte eine hübsche junge Dame wie Sie vor der Nemesis zittern?«
Während er sprach, wurde mir klar, daß er Irländer sein mußte.
Vermutlich nur der amerikanische Nachkomme irischer Vorfahren – doch das irische Element war da, unverkennbar, in seiner Redeweise, seiner raschen Reaktion, seinem Lachen. Irgendwie hatte ich jedoch gleichzeitig das unbehagliche Gefühl, daß er mich hinter seinen dunklen Brillengläsern hervor mit seltsamer Eindringlichkeit beobachtete – und sekundenlang fragte ich mich, ob er es gewesen war, der Judith erschreckt hatte. Doch nein – das war unmöglich. Er hatte hinter ihr gestanden, und sie hatte auf den Bahnsteig hinausgeblickt, als es geschah …
Mit gespielter Gleichgültigkeit sagte ich: »Sie waren doch gestern dabei, als meine Schwester – ich dachte, sie hätte vielleicht etwas – oder jemanden – gesehen, verstehen Sie? Sie ist sonst nicht besonders zimperlich.«
Er nickte. »Mir ist immer, als hätte ich sie schon irgendwo mal gesehen«, murmelte er. »Entweder sie selbst – oder ihr Bild.«
»Vermutlich ihr Bild«, erwiderte ich mit leiser Bitterkeit. »Die New Yorker Zeitungen können es nicht oft genug bringen.«
»Ja – natürlich«, stimmte er zu. »Sie sieht fabelhaft aus. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt: sie ist Mrs. Ridgely Chandler, nicht wahr?«
»Judith Chandler, ja. Sie waren sehr freundlich zu uns. Ich wollte mich nochmals bei Ihnen bedanken.«
Er schien meine Worte nicht gehört zu haben. Ein nachdenklicher Ausdruck lag auf seinem Gesicht.
»Was kann ihr bloß einen solchen Schrecken eingejagt haben?« fragte er. »Oder ist das Ganze nichts als ein Hirngespinst? Schließlich – all die Anstrengungen, die mit den Formalitäten einer Scheidung zusammenhängen – das ist keine Kleinigkeit für eine Frau!«
»In Judiths Fall verlief die ganze Prozedur glatt und schmerzlos«, erklärte ich. »Nein – es war bestimmt kein Hirngespinst.«
»Sind Sie ganz sicher?«
»Ganz sicher.«
»Schön … Wäre es also nicht eine gute Idee, wenn ich an Ihrer Stelle nochmals den Zug durchsuchte? Und wenn Sie nichts dagegen haben, mich heute abend um sieben hier zu treffen, kann ich Ihnen beim Dinner berichten, ob und was ich rausgefunden habe.«
Er gefiel mir – gefiel mir sogar sehr gut – und außerdem fühlte ich mich einsam und ein wenig verloren, so daß ich seinem Angebot ohne Zögern zustimmte. Er begleitete mich zu Judiths Abteil zurück und blieb neben mir stehen, während ich das vereinbarte Klopfzeichen gab.
Er lächelte zu mir herunter. »Ganz wie in einem Kriminalroman, nicht wahr?« sagte er.
Ich schüttelte den Kopf. »Aber nein – ich würde mich hüten, in einem meiner Bücher solchen Unsinn zu schreiben.«
Er starrte mich entgeistert an. »Sie wollen doch nicht sagen – daß Sie Bücher schreiben?«
»Ab und zu«, erwiderte ich bescheiden. »Nicht sehr viele, bis heute waren es bloß drei oder vier.«
»Allmächtiger!« murmelte er und ließ mich dann unvermittelt stehen.
Von diesem Augenblick an erfüllte mich die Aussicht auf ein gemeinsames Abendessen mit höchst zwiespältigen Gefühlen.
Er saß wartend an einem kleinen Tisch und begrüßte mich mit einem strahlenden Lächeln. Eben kam der Kellner herbeigeeilt und stellte zwei gefüllte Cocktailgläser vor ihn hin.
»Hoffentlich mögen Sie Martinis?« sagte er. »Ich möchte nämlich mit Ihnen auf den unschuldigsten und harmlosesten aller Eisenbahnzüge trinken.«
»Sie haben also niemanden gefunden?«
»Niemanden. Kein Grund, sich Sorgen zu machen.«
Ich atmete erleichtert auf, doch gleichzeitig musterte ich meinen Begleiter mit neugierigen Augen.
»Sie scheinen eine ganze Menge von solchen Dingen zu verstehen«, sagte ich endlich einladend.
Vielleicht war es der Cocktail. Oder vielleicht ist eine Bahnfahrt ähnlich wie der Aufenthalt auf einem Überseedampfer: man trifft mit anderen Passagieren zusammen, man schließt Bekanntschaft, und weil man sich langweilt, weil man weiß, daß diese Bekanntschaft nur kurze Zeit dauern wird, geht man mehr aus sich heraus, spricht mehr, als man eigentlich sollte. So wußte ich, noch ehe eine volle Stunde vergangen war, daß mein großer Freund Terrence O’Brien hieß, daß man ihn im allgemeinen den »Irländer« nannte, daß er Detektivleutnant bei der New Yorker Kriminalpolizei gewesen und im Krieg verwundet worden war.
»Nun denke ich daran, mich irgendwo auf dem Land zur Ruhe zu setzen«, sagte er. »Vielleicht kaufe ich mir ein kleines Gut oder auch bloß ein Häuschen und züchte Hühner. So was Ähnliches. Genau weiß ich’s noch nicht.«
Ich wollte ihn ein bißchen eingehender über seine Verletzung befragen, denn im stillen wunderte ich mich, daß er sich zur Ruhe setzen wollte: Wenn ich je einen Mann gesehen hatte, der von Gesundheit und Kraft zu strotzen schien, so war er es. Doch er kam mir zuvor und brachte das Gespräch wieder auf Judith.
»Sie können ihr von mir ausrichten, daß sich keine gefährlichen Dunkelmänner im Zug befinden«, sagte er. »Da fällt mir übrigens ein, daß ich noch immer nicht weiß, wie Sie heißen. Vermutlich sollte ich Ihren Namen kennen, wo Sie doch – Schriftstellerin sind?«
»Sie mögen wohl schriftstellernde Frauen nicht?«
»Ich hatte bisher nie das Vergnügen, welche kennenzulernen«, erwiderte er trocken. Als ich ihm meinen Namen nannte und mich als Verfasserin von Kriminalromanen vorstellte, schüttelte er betrübt den Kopf.
»Sie brauchen mir gar nichts weiter zu erzählen«, sagte er, »ich weiß schon alles. Der Held ist natürlich ein Privatdetektiv. Er trinkt mehr Whisky, als ein vernünftiger Mensch vertragen kann, boxt sich mit Gangstern herum, und wenn sie ihn zusammengeschlagen haben und er eigentlich ins Krankenhaus gehört, steht er seelenvergnügt auf und macht sich an seine Arbeit. Die Polizei besteht aus lauter Dummköpfen, die immerzu im Kreis herumrennen und nichts herauskriegen, während unser Privatdetektiv auf eigene Faust vorgeht und eines Tages mit des Rätsels Lösung aufwartet. Na, hab’ ich recht?«
Gegen meinen Willen mußte ich lachen.
»Nicht ganz«, sagte ich. »Mein Privatdetektiv ist eine ›sie‹!«
»Du lieber Himmel!« knurrte er angewidert, doch da in diesem Augenblick das Essen serviert wurde, ließen wir das umstrittene Thema fallen.
Während der ganzen restlichen Reise sah ich ihn nur noch ein einziges Mal. Das war am selben Abend, nachdem ich Judiths schmerzenden Rücken massiert, ihr zwei Schlaftabletten gegeben und dann ihr Abteil verlassen hatte, um mich zu einem Schlummertrunk in den Speisewagen zu begeben. Er hatte diesmal die Brille abgelegt, was ihn viel jünger erscheinen ließ. Als er mich erblickte, stand er auf.
»Ich hoffte, Sie würden nochmals kommen«, sagte er. »Geht es Ihrer Schwester heute abend besser?«
»Ungefähr noch immer gleich«, sagte ich. »Das heißt – sie schließt sich noch immer ein, wenn es das ist, was Sie meinen!«
»Und Sie haben nach wie vor keine Ahnung, warum?«
»Gar keine.«
Er betrachtete mich schweigend, dann zog er ein goldenes Etui aus der Tasche und bot mir eine Zigarette an.
»Ich habe über Sie nachgedacht«, versetzte er dann unvermittelt.
»Ihre Schwester ist wirklich eine Schönheit, und da hat man Sie vermutlich im Glauben erzogen, eine solche Frau sei ein Gottesgeschenk für die Welt. Doch in Wirklichkeit ist das alles ganz anders. Halten Sie mal ein bißchen Umschau – wie mancher Mann heiratet eine häßliche Frau! Das soll natürlich nicht heißen, daß Sie –«
Unwillkürlich mußte ich lachen, und es dauerte nicht lange, bis ich ihm alles zu erzählen begann … Ich sprach von meiner Kindheit, vom Birkenhof und von den Gründen, die uns zwangen, dort zu wohnen, ich sprach von Phil und Helga und Jennie, ja sogar von unserem alten Schwimmbassin und vom Gärtnerhaus am Eingangstor, das ich hatte instand setzen lassen und das ich seither vergeblich zu vermieten suchte.
Wir plauderten bis gegen Mitternacht zusammen, und als ich endlich in mein Abteil zurückkehrte, war Judiths Verbindungstür verschlossen und abgesperrt, so daß ich sie schlafend wähnte. Doch eine knappe Stunde später riegelte sie die Tür auf, trat dicht an meine Koje und rüttelte mich wach.
»Ich will überhaupt nicht in New York bleiben«, sagte sie. »Wir können doch gleich umsteigen, wenn wir ankommen, nicht wahr? Ich möchte direkt zum Birkenhof fahren.«