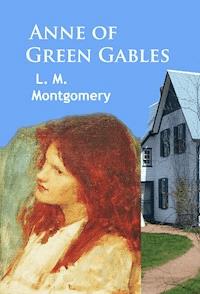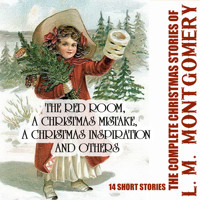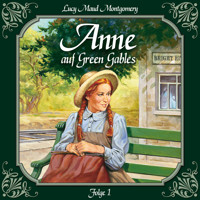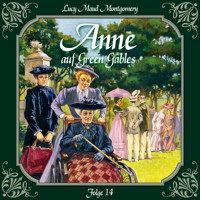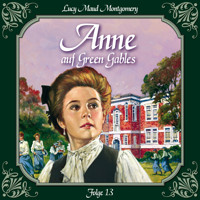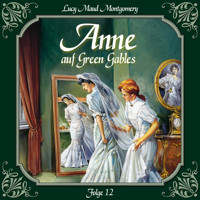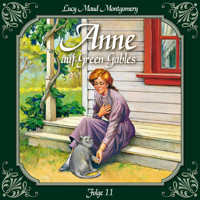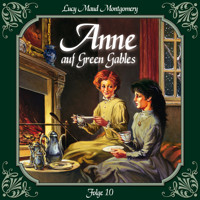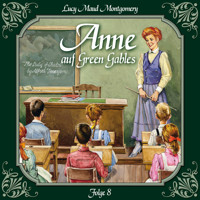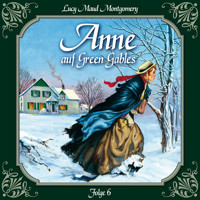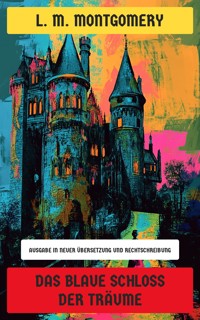
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Das blaue Schloss der Träume" entführt L. M. Montgomery die Leser in die bezaubernde Welt der Phantasie und des persönlichen Wachstums. Die Geschichte folgt der jungen Protagonistin, die in einem strengen Umfeld lebt und sich nach Freiheit und Liebe sehnt. In einem stilistisch eleganten und bildhaften Schreibstil schafft Montgomery eine atmosphärische Kulisse, die die emotionalen und psychologischen Konflikte ihrer Figuren eindrucksvoll widerspiegelt. Der Roman ist nicht nur ein Erzeugnis der zeitgenössischen Literatur, sondern reflektiert auch die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen der frühen 1900er Jahre, die die Rolle der Frauen und ihren Zugang zur Selbstverwirklichung thematisieren. L. M. Montgomery, bekannt durch ihre zeitlosen Werke, insbesondere die "Anne auf Green Gables"-Reihe, war eine kanadische Schriftstellerin, deren Schriften oft autobiografische Elemente und ihre persönlichen Erfahrungen widerspiegeln. Ihre eigenen Kämpfe mit Identität und gesellschaftlicher Erwartung flossen in die Erschaffung des "blauen Schlosses" ein, wo sie Themen wie Träume, Sehnsucht und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben verarbeitet. Montgomerys einzigartiger Blick auf die menschliche Natur und ihre tiefgründige Erzählweise machen jedes ihrer Werke zu einem wertvollen Beitrag zur Literatur. "Das blaue Schloss der Träume" ist eine fesselnde Lektüre für alle, die die Verflechtungen von Traum und Realität sowie die Komplexität der menschlichen Emotionen schätzen. Dieses Buch bietet nicht nur eine Flucht aus dem Alltag, sondern auch wertvolle Einsichten darüber, wie wir unsere Träume verwirklichen können. Leserinnen und Leser werden ermutigt, sich auf diese Reise der Selbstentdeckung einzulassen und die wunderschöne, ifeaturen Atmosphäre Montgomerys zu genießen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das blaue Schloss der Träume
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Wenn es an einem bestimmten Morgen im Mai nicht geregnet hätte, wäre Valancy Stirlings Leben völlig anders verlaufen. Sie wäre mit dem Rest ihres Clans zu Tante Wellingtons Verlobungspicknick gegangen und Dr. Trent wäre nach Montreal gefahren. Aber es regnete und ihr sollt erfahren, was ihr deswegen widerfahren ist.
Valancy erwachte früh, in der leblosen, hoffnungslosen Stunde kurz vor Tagesanbruch. Sie hatte nicht sehr gut geschlafen. Manchmal schläft man nicht gut, wenn man am nächsten Tag neunundzwanzig und unverheiratet ist, in einer Gemeinschaft und Verbindung, in der die Unverheirateten einfach diejenigen sind, die keinen Mann abbekommen haben.
Deerwood und die Stirlings hatten Valancy schon lange in die hoffnungslose alte Jungferlichkeit verbannt. Aber Valancy selbst hatte nie ganz aufgegeben, eine gewisse erbärmliche, beschämende, kleine Hoffnung, dass die Romantik doch noch ihren Weg zu ihr finden würde – nie, bis zu diesem nassen, schrecklichen Morgen, als sie mit der Tatsache erwachte, dass sie neunundzwanzig war und von keinem Mann begehrt wurde.
Ja, darin lag der Stachel. Valancy machte es nicht so viel aus, eine alte Jungfer zu sein. Schließlich, so dachte sie, konnte es nicht so schrecklich sein, eine alte Jungfer zu sein, wie mit einem Onkel Wellington oder einem Onkel Benjamin oder sogar einem Onkel Herbert verheiratet zu sein. Was ihr wehtat, war, dass sie nie eine Chance gehabt hatte, etwas anderes als eine alte Jungfer zu sein. Kein Mann hatte sie jemals begehrt.
Die Tränen stiegen ihr in die Augen, als sie allein in der schwach grauen Dunkelheit dalag. Sie wagte es nicht, so heftig zu weinen, wie sie es wollte, und zwar aus zwei Gründen. Sie hatte Angst, dass das Weinen einen weiteren Anfall dieses Schmerzes im Herzen auslösen könnte. Sie hatte einen Anfall davon gehabt, nachdem sie ins Bett gegangen war – schlimmer als alle, die sie bisher gehabt hatte. Und sie hatte Angst, dass ihre Mutter ihre roten Augen beim Frühstück bemerken und sie mit minutiösen, hartnäckigen, mückenartigen Fragen nach dem Grund dafür löchern würde.
„Stell dir vor“, dachte Valancy mit einem grässlichen Grinsen, „ich würde mit der reinen Wahrheit antworten: “Ich weine, weil ich nicht heiraten kann.„ Wie entsetzt Mutter wäre – obwohl sie sich jeden Tag ihres Lebens für ihre alte Jungfer von einer Tochter schämt.“
Aber natürlich sollte der Schein gewahrt werden. „Es ist nicht“, konnte Valancy die strenge, diktatorische Stimme ihrer Mutter hören, „es ist nicht mädchenhaft, an Männer zu denken.“
Der Gedanke an den Gesichtsausdruck ihrer Mutter brachte Valancy zum Lachen – denn sie hatte einen Sinn für Humor, den niemand in ihrer Sippe ahnte. Im Übrigen gab es eine ganze Menge Dinge an Valancy, die niemand ahnte. Aber ihr Lachen war sehr oberflächlich, und bald lag sie da, eine zusammengekauerte, nutzlose kleine Gestalt, lauschte dem Regen, der draußen herabströmte, und beobachtete mit einer üblen Abneigung, wie das kalte, gnadenlose Licht in ihr hässliches, schmutziges Zimmer kroch.
Sie kannte die Hässlichkeit dieses Zimmers auswendig – kannte sie und hasste sie. Der gelb gestrichene Boden, mit einem einzigen scheußlichen „gehäkelten“ Teppich neben dem Bett, auf dem ein grotesker, „gehäkelter“ Hund prangte, der sie stets angrinste, wenn sie erwachte; die verblichene, dunkelrote Tapete; die Decke, verfärbt von alten Wasserschäden und durchzogen von Rissen; das schmale, kümmerliche Waschbecken; die braune Papiergardine mit violetten Rosen darauf; der fleckige alte Spiegel mit dem Sprung, der auf dem unzureichenden Frisiertisch lehnte; das Gefäß mit uraltem Potpourri, das ihre Mutter während ihrer sagenumwobenen Flitterwochen gemacht hatte; die mit Muscheln verzierte Schachtel, deren eine Ecke aufgebrochen war und die Cousine Stickles in ihrer ebenso sagenhaften Jugend gefertigt hatte; das mit Perlen bestickte Nadelkissen, von dem die Hälfte der Perlenfransen fehlte; der eine steife, gelbe Stuhl; das verblichene alte Motto „Fort, aber nicht vergessen“, in bunten Garnen um das grimmige Antlitz von Urgroßmutter Stirling gestickt; die alten Fotografien längst verbannter Verwandter, die aus den unteren Räumen verbannt worden waren. Es gab nur zwei Bilder, die keine Verwandten zeigten. Eines war ein altes Chromolithografie-Bild eines Welpen, der auf einer regennassen Türschwelle saß. Dieses Bild machte Valancy immer unglücklich. Dieser trostlose kleine Hund, der auf der Schwelle im strömenden Regen kauerte! Warum öffnete niemand die Tür und ließ ihn herein? Das andere Bild war ein verblichenes, passepartoutgerahmtes Kupferstichbild von Königin Luise, die eine Treppe hinabstieg, das Tante Wellington ihr großzügig zu ihrem zehnten Geburtstag geschenkt hatte. Neunzehn Jahre lang hatte sie es angesehen und gehasst, diese schöne, selbstgefällige, selbstzufriedene Königin Luise. Aber sie wagte es nie, es zu zerstören oder zu entfernen. Mutter und Cousine Stickles wären entsetzt gewesen oder, wie Valancy es in ihren Gedanken respektlos ausdrückte, hätten einen Anfall bekommen.
Natürlich war jedes Zimmer im Haus hässlich. Aber unten wurde der Schein einigermaßen gewahrt. Für Räume, die niemand jemals sah, war kein Geld da. Valancy hatte manchmal das Gefühl, dass sie selbst etwas für ihr Zimmer hätte tun können, auch ohne Geld, wenn man es ihr erlaubt hätte. Aber ihre Mutter hatte jeden noch so zaghaften Vorschlag abgelehnt, und Valancy ließ es bleiben. Valancy ließ es immer bleiben. Sie hatte Angst davor. Ihre Mutter konnte keinen Widerspruch ertragen. Frau Stirling schmollte tagelang, wenn sie beleidigt war, mit der Miene einer gekränkten Herzogin.
Das Einzige, was Valancy an ihrem Zimmer gefiel, war, dass sie nachts allein darin sein und weinen konnte, wenn sie wollte.
Aber, was machte es letztlich schon aus, wenn ein Zimmer, das man ausschließlich zum Schlafen und Ankleiden nutzte, hässlich war? Valancy durfte niemals allein in ihrem Zimmer bleiben, um es für irgendeinen anderen Zweck zu nutzen. Menschen, die allein sein wollten, so glaubten Frau Frederick Stirling und Cousine Stickles, konnten dies nur aus einem finsteren Grund wünschen. Doch ihr Zimmer im Blauen Schloss war alles, was ein Zimmer sein sollte.
Valancy, die im wirklichen Leben so eingeschüchtert, unterdrückt, übergangen und zurechtgewiesen wurde, pflegte sich in ihren Tagträumen auf geradezu großartige Weise gehen zu lassen. Niemand im Stirling-Clan oder seinen Verzweigungen ahnte etwas davon, am allerwenigsten ihre Mutter und Cousine Stickles. Sie wussten nicht, dass Valancy zwei Heimstätten hatte – das hässliche, rote Backsteinkasten-Haus in der Elm Street und das Blaue Schloss in Spanien. Valancy hatte geistig im Blauen Schloss gelebt, solange sie sich erinnern konnte. Sie war noch ein sehr kleines Kind gewesen, als sie sich erstmals im Besitz dieses Schlosses fand. Immer, wenn sie die Augen schloss, konnte sie es deutlich sehen, mit seinen Türmen und Fahnen auf der mit Kiefern bewachsenen Bergeshöhe, gehüllt in seine zarte, blaue Anmut, vor den Sonnenuntergangshimmeln eines schönen und unbekannten Landes. Alles Wunderbare und Schöne war in diesem Schloss. Juwelen, die Königinnen hätten tragen können; Gewänder aus Mondlicht und Feuer; Lager aus Rosen und Gold; lange Reihen flacher Marmorstufen, mit großen, weißen Urnen und schlanken, nebelverhüllten Jungfrauen, die sie hinauf- und hinabstiegen; Höfe mit Marmorsäulen, in denen schimmernde Brunnen plätscherten und Nachtigallen zwischen den Myrten sangen; Säle voller Spiegel, die nur stattliche Ritter und schöne Frauen widerspiegelten – sie selbst die Schönste von allen, für deren Blick Männer starben. Das Einzige, was sie durch die Langeweile ihrer Tage trug, war die Hoffnung, nachts auf eine Traumreise zu gehen. Die meisten, wenn nicht alle, der Stirlings wären vor Entsetzen gestorben, hätten sie auch nur die Hälfte der Dinge gewusst, die Valancy in ihrem Blauen Schloss tat.
Zum einen hatte sie eine ganze Reihe von Liebhabern. Oh, aber immer nur einen auf einmal. Einen, der sie mit all der romantischen Leidenschaft des Rittertums umwarb und sie nach langer Hingabe und vielen Heldentaten gewann und mit Pomp und Prunk in der großen, mit Bannern geschmückten Kapelle des Blauen Schlosses mit ihr vermählte.
Mit zwölf Jahren war dieser Liebhaber ein hübscher Junge mit goldenen Locken und himmelblauen Augen. Mit fünfzehn war er groß und dunkel und blass, aber immer noch unbedingt gutaussehend. Mit zwanzig war er asketisch, verträumt, spirituell. Mit fünfundzwanzig hatte er einen markanten Kiefer, leicht grimmig, und ein Gesicht, das eher stark und zerklüftet als gutaussehend war. Valancy wurde in ihrem Blauen Schloss nie älter als fünfundzwanzig, aber vor kurzem – vor sehr kurzer Zeit – hatte ihr Held rötliches, gelbbraunes Haar, ein verschmitztes Lächeln und eine geheimnisvolle Vergangenheit.
Ich sage nicht, dass Valancy diese Liebenden absichtlich ermordet hat, als sie ihnen entwachsen ist. Das eine verblasste einfach, als ein anderes kam. In dieser Hinsicht sind die Dinge in Blauen Schlössern sehr bequem.
Aber an diesem Morgen ihres Schicksalstages konnte Valancy den Schlüssel zu ihrem Blauen Schloss nicht finden. Die Realität drängte sich ihr auf und bellte sie wie ein verrückter kleiner Hund an. Sie war neunundzwanzig, einsam, unerwünscht, hässlich – das einzige unscheinbare Mädchen in einer schönen Sippe, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Soweit sie zurückblicken konnte, war das Leben eintönig und farblos, ohne einen einzigen roten oder violetten Fleck. Soweit sie in die Zukunft blicken konnte, schien es, dass es genauso bleiben würde, bis sie nichts weiter als ein einsames, kleines, verwelktes Blatt war, das an einem winterlichen Ast hing. Der Moment, in dem eine Frau erkennt, dass es nichts gibt, wofür es sich zu leben lohnt – weder Liebe, Pflicht, Sinn noch Hoffnung – ist für sie so bitter wie der Tod.
„Und ich muss einfach weiterleben, weil ich nicht aufhören kann. Vielleicht muss ich achtzig Jahre leben“, dachte Valancy in einer Art Panik. „Wir sind alle schrecklich langlebig. Der Gedanke daran macht mich krank.“
Sie war froh, dass es regnete – oder besser gesagt, sie war trostlos zufrieden, dass es regnete. An diesem Tag würde es kein Picknick geben. Dieses jährliche Picknick, bei dem Tante und Onkel Wellington – man dachte immer an sie in dieser Reihenfolge – unweigerlich ihre Verlobung bei einem Picknick vor dreißig Jahren feierten, war für Valancy in den letzten Jahren ein wahrer Albtraum gewesen. Durch einen schelmischen Zufall fiel es auf denselben Tag wie ihr Geburtstag, und nachdem sie fünfundzwanzig geworden war, ließ sie niemand mehr vergessen.
So sehr sie es auch hasste, zu dem Picknick zu gehen, wäre es ihr nie in den Sinn gekommen, sich dagegen aufzulehnen. Es schien nichts Revolutionäres an ihr zu sein. Und sie wusste genau, was jeder auf dem Picknick zu ihr sagen würde. Onkel Wellington, den sie nicht mochte und verachtete, obwohl er den höchsten Wunsch der Stirlings erfüllt hatte, nämlich „Geld zu heiraten“, würde ihr mit leiser Stimme sagen: „Noch nicht ans Heiraten gedacht, meine Liebe?“ Und dann in schallendes Gelächter ausbrechen, mit dem er seine langweiligen Bemerkungen stets beendete. Tante Wellington, vor der Valancy in tiefer Ehrfurcht stand, erzählte ihr von Olives neuem Chiffonkleid und Cecils letztem liebevollen Brief. Valancy musste so erfreut und interessiert aussehen, als ob das Kleid und der Brief ihr gehörten, sonst wäre Tante Wellington beleidigt. Und Valancy hatte vor langer Zeit beschlossen, dass sie lieber Gott als Tante Wellington beleidigen würde, denn Gott könnte ihr vergeben, Tante Wellington aber niemals.
Tante Alberta, die enorm fett war und die liebenswerte Angewohnheit hatte, ihren Ehemann immer mit „er“ anzusprechen, als wäre er das einzige männliche Wesen auf der Welt, und die nie vergessen konnte, dass sie in ihrer Jugend eine große Schönheit gewesen war, würde Valancy auf ihrer fahlen Haut ihr Beileid aussprechen –
„Ich weiß nicht, warum alle Mädchen von heute so sonnenverbrannt sind. Als ich ein Mädchen war, war meine Haut rosig und cremefarben. Ich galt als das hübscheste Mädchen in Kanada, meine Liebe.“
Vielleicht würde Onkel Herbert gar nichts sagen – oder vielleicht würde er scherzhaft anmerken: „Wie dick du geworden bist, Doss!“ Und dann würden alle über die überaus humorvolle Vorstellung lachen, dass der arme, dürre kleine Doss dick werden könnte.
Der gutaussehende, ernste Onkel James, den Valancy nicht mochte, aber respektierte, weil er als sehr klug galt und daher das Orakel des Clans war – da es in der Stirling-Familie nicht allzu viele kluge Köpfe gab –, würde wahrscheinlich mit dem eulenartigen Sarkasmus, der ihm seinen Ruf eingebracht hatte, bemerken: „Ich nehme an, du bist dieser Tage mit deiner Aussteuertruhe beschäftigt?“
Und Onkel Benjamin würde einige seiner abscheulichen Rätsel stellen, zwischen keuchendem Kichern, und sie selbst beantworten.
"Was ist der Unterschied zwischen Doss und einer Maus?
„Die Maus möchte dem Käse schaden und Doss möchte die Leute bezaubern.“
Valancy hatte ihn dieses Rätsel fünfzig Mal stellen hören und jedes Mal wollte sie etwas nach ihm werfen. Aber sie tat es nie. Erstens warfen die Stirlings einfach keine Dinge; zweitens war Onkel Benjamin ein wohlhabender und kinderloser alter Witwer, und Valancy war in der Furcht und Ermahnung seines Geldes erzogen worden. Wenn sie ihn beleidigte, würde er sie aus seinem Testament streichen – vorausgesetzt, sie stand darin. Valancy wollte nicht aus Onkel Benjamins Testament gestrichen werden. Sie war ihr ganzes Leben lang arm gewesen und kannte die quälende Bitterkeit, die damit einherging. Also ertrug sie seine Rätsel und lächelte sogar gequält über ihn.
Tante Isabel, die so direkt und unangenehm wie ein Ostwind war, kritisierte sie auf irgendeine Weise – Valancy konnte nicht vorhersagen, wie, denn Tante Isabell wiederholte nie eine Kritik – sie fand jedes Mal etwas Neues, womit sie einen stechen konnte. Tante Isabel war stolz darauf, zu sagen, was sie dachte, aber sie mochte es nicht so sehr, wenn andere Leute sagten, was siezu ihr dachten. Valancy sagte nie, was sie dachte.
Cousine Georgiana – benannt nach ihrer Ururgroßmutter, die wiederum nach George IV. benannt worden war – zählte mit schmerzlicher Miene die Namen aller Verwandten und Freunde auf, die seit dem letzten Picknick gestorben waren, und fragte sich, „wer von uns wohl als Nächstes sterben wird“.
Erdrückend tüchtig, sprach Tante Mildred endlos über ihren Ehemann und ihre abscheulichen Wunderkinder zu Valancy, weil Valancy die Einzige war, die sich das gefallen ließ. Aus demselben Grund beschrieb Cousine Gladys—genauer gesagt, eigentlich Erste Cousine Gladys einmal entfernt, gemäß der strengen Art, in der die Stirlings Verwandtschaftsverhältnisse katalogisierten—eine große, dünne Dame, die zugab, eine empfindsame Natur zu haben, mit größter Genauigkeit die Qualen ihrer Neuritis. Und Olive, das Wunderkind des gesamten Stirling-Clans, die alles hatte, was Valancy nicht besaß—Schönheit, Beliebtheit, Liebe—präsentierte ihre Schönheit, spielte auf ihrer Beliebtheit herum und schwenkte ihr diamantbesetztes Abzeichen der Liebe vor Valancys geblendeten, neidischen Augen.
All das würde es heute nicht geben. Und es würde auch kein Einpacken von Teelöffeln geben. Das Einpacken wurde immer Valancy und Cousine Stickles überlassen. Und einmal, vor sechs Jahren, war ein silberner Teelöffel aus Tante Wellingtons Hochzeitsservice verloren gegangen. Valancy hatte seitdem nie wieder Ruhe vor diesem silbernen Teelöffel. Sein Geist tauchte, wie Banquos Schatten, bei jedem nachfolgenden Familienfest auf.
Oh ja, Valancy wusste genau, wie das Picknick aussehen würde, und sie dankte dem Regen, der sie davor bewahrt hatte. Dieses Jahr würde es kein Picknick geben. Wenn Tante Wellington nicht am heiligen Tag selbst feiern konnte, würde sie überhaupt nicht feiern. Sie dankte allen Göttern dafür.
Da es kein Picknick geben würde, beschloss Valancy, dass sie, wenn der Regen am Nachmittag anhielt, in die Bibliothek gehen und sich ein weiteres Buch von John Foster besorgen würde. Valancy war es nie erlaubt, Romane zu lesen, aber John Fosters Bücher waren keine Romane. Es waren „Naturbücher“ – so sagte der Bibliothekar zu Frau Frederick Stirling – „über Wälder, Vögel, Käfer und solche Dinge, weißt du?“ Also durfte Valancy sie lesen – unter Protest, denn es war nur allzu offensichtlich, dass sie sie zu sehr genoss. Es war erlaubt, ja sogar lobenswert, zu lesen, um seinen Geist und seine Religion zu verbessern, aber ein Buch, das Spaß machte, war gefährlich. Valancy wusste nicht, ob ihr Geist verbessert wurde oder nicht; aber sie hatte das vage Gefühl, dass ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn sie schon vor Jahren auf John Fosters Bücher gestoßen wäre. Sie schienen ihr Einblicke in eine Welt zu gewähren, in die sie einst hätte eintreten können, obwohl die Tür für sie jetzt für immer verschlossen war. Erst im letzten Jahr waren John Fosters Bücher in die Bibliothek von Deerwood gekommen, obwohl der Bibliothekar Valancy erzählte, dass er seit mehreren Jahren ein bekannter Schriftsteller war.
„Wo lebt er?“, hatte Valancy gefragt.
„Das weiß niemand. Seinen Büchern nach zu urteilen, muss er Kanadier sein, aber mehr Informationen gibt es nicht. Sein Verlag gibt keinen Kommentar ab. Wahrscheinlich ist John Foster ein Pseudonym. Seine Bücher sind so beliebt, dass wir sie gar nicht alle im Bestand haben können, obwohl ich wirklich nicht verstehe, was die Leute an ihnen so toll finden.“
„Ich finde sie wunderbar“, sagte Valancy schüchtern.
„Oh – nun ja ...“ Fräulein Clarkson lächelte auf eine herablassende Art, die Valancys Meinung in den Hintergrund drängte: „Ich kann nicht behaupten, dass ich selbst viel für Insekten übrig habe. Aber Foster scheint wirklich alles über sie zu wissen.“
Valancy wusste nicht, ob sie auch viel für Insekten übrig hatte. Es war nicht John Fosters unheimliches Wissen über wilde Kreaturen und Insekten, das sie in seinen Bann zog. Sie konnte kaum sagen, was es war – eine verlockende Verlockung eines nie gelüfteten Geheimnisses – ein Hinweis auf ein großes Geheimnis, das nur ein Stück weiter lag – ein schwaches, schwer fassbares Echo schöner, vergessener Dinge – John Fosters Magie war undefinierbar.
Ja, sie würde sich ein neues Buch von Foster besorgen. Es war ein Monat vergangen, seit sie Dornenernte gelesen hatte, also konnte Mutter doch sicher nichts dagegen haben. Valancy hatte es viermal gelesen – sie kannte ganze Passagen auswendig.
Und – fast hätte sie sich dazu durchgerungen, Dr. Trent wegen dieser seltsamen Schmerzen im Herzen aufzusuchen. In letzter Zeit traten sie ziemlich häufig auf, und das Herzklopfen wurde immer lästiger, ganz zu schweigen von gelegentlichem Schwindel und einer seltsamen Kurzatmigkeit. Aber konnte sie zu ihm gehen, ohne es jemandem zu sagen? Es war ein äußerst gewagter Gedanke. Keiner der Stirlings konsultierte jemals einen Arzt, ohne einen Familienrat abzuhalten und die Zustimmung von Onkel James einzuholen. Dann gingen sie zu Dr. Ambrose Marsh in Port Lawrence, der die Cousine zweiten Grades Adelaide Stirling geheiratet hatte.
Aber Valancy mochte Dr. Ambrose Marsh nicht. Außerdem konnte sie nicht nach Port Lawrence, fünfzehn Meilen entfernt, ohne dorthin gebracht zu werden. Sie wollte nicht, dass jemand von ihrem Herzproblem erfuhr. Es würde so viel Aufhebens gemacht werden und jedes Familienmitglied würde kommen und darüber reden und sie beraten und sie ermahnen und sie warnen und ihr schreckliche Geschichten von Großtanten und Cousins erzählen, die vierzig Mal entfernt waren und „einfach so tot umgefallen sind, ohne eine Sekunde Vorwarnung, meine Liebe“.
Tante Isabel würde sich daran erinnern, dass sie immer gesagt hatte, Doss sehe aus wie ein Mädchen, das Herzprobleme haben würde – „so schmal und spitz immer“; und Onkel Wellington würde es als persönliche Beleidigung auffassen, wo doch „noch nie ein Stirling eine Herzkrankheit hatte“; und Georgiana würde in perfekt hörbarem Beiseitesprechen voraussagen, dass „die arme, liebe kleine Doss nicht mehr lange auf dieser Welt sein wird, fürchte ich“; und Cousine Gladys würde sagen: „Aber mein Herzschon seit Jahren so“, und das in einem Ton, der implizierte, dass niemand sonst überhaupt ein Herz haben sollte; und Olive – Olive sah einfach nur wunderschön und überlegen und widerlich gesund aus, als wollte sie sagen: „Warum all diese Aufregung um einen verblassten Überfluss wie Doss, wenn ihr mich habt?“
Valancy hatte das Gefühl, dass sie es niemandem sagen konnte, es sei denn, sie müsste es. Sie war sich ziemlich sicher, dass mit ihrem Herzen alles in Ordnung war und es keinen Grund für den ganzen Aufstand gab, der folgen würde, wenn sie es erwähnte. Sie würde einfach still und leise zu Dr. Trent gehen und ihn noch am selben Tag aufsuchen. Was seine Rechnung anging, so hatte sie die zweihundert Dollar, die ihr Vater am Tag ihrer Geburt für sie auf die Bank gebracht hatte, aber sie würde heimlich genug herausnehmen, um Dr. Trent zu bezahlen. Sie durfte nicht einmal die Zinsen dafür verwenden.
Dr. Trent war ein schroffer, unverblümter, zerstreuter alter Mann, aber er war eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Herzkrankheiten, auch wenn er nur ein Allgemeinarzt im abgelegenen Deerwood war. Dr. Trent war über siebzig und es gab Gerüchte, dass er bald in Rente gehen wollte. Keiner aus dem Stirling-Clan war jemals zu ihm gegangen, seit er Cousine Gladys vor zehn Jahren gesagt hatte, dass ihre Nervenentzündung nur eingebildet sei und dass sie es genieße. Man konnte einen Arzt nicht unterstützen, der seine Cousine ersten Grades so beleidigte – ganz zu schweigen davon, dass er Presbyterianer war, während alle Stirlings in die anglikanische Kirche gingen. Aber Valancy dachte, dass sie es mit dem Teufel der Untreue gegenüber dem Clan und dem tiefen Meer aus Aufregung, Getöse und Ratschlägen riskieren könnte.
Kapitel II
Als Vetter Stickles an ihre Tür klopfte, wusste Valancy, dass es halb acht war und sie aufstehen musste. Solange sie sich erinnern konnte, hatte Vetter Stickles um halb acht an ihre Tür geklopft. Vetter Stickles und Frau Frederick Stirling waren seit sieben Uhr auf, aber Valancy durfte aufgrund einer Familientradition, dass sie empfindlich sei, eine halbe Stunde länger liegen bleiben. Valancy stand auf, obwohl sie das Aufstehen heute Morgen mehr hasste als je zuvor. Wofür sollte man aufstehen? Für einen weiteren tristen Tag wie alle Tage zuvor, voller bedeutungsloser kleiner Aufgaben, freudlos und unwichtig, von denen niemand profitierte. Aber wenn sie nicht sofort aufstand, wäre sie um acht Uhr nicht fertig zum Frühstück. Feste Essenszeiten waren in Frau Stirlings Haushalt die Regel. Frühstück um acht, Mittagessen um eins, Abendessen um sechs, jahrein, jahraus. Verspätungen wurden nie geduldet. Also stand Valancy zitternd auf.
Der Raum war bitterkalt, mit der rauen, durchdringenden Kälte eines nassen Mai-Morgens. Das Haus würde den ganzen Tag kalt sein. Es war eine von Frau Fredericks Regeln, dass nach dem 24. Mai kein Feuer mehr nötig war. Die Mahlzeiten wurden auf dem kleinen Ölofen auf der hinteren Veranda gekocht. Und obwohl der Mai eisig und der Oktober frostig sein könnte, wurde bis zum 21. Oktober kein Feuer angezündet. Am 21. Oktober begann Frau Frederick, auf dem Küchenherd zu kochen, und entzündete abends ein Feuer im Ofen im Wohnzimmer. Es wurde gemunkelt, dass der verstorbene Frederick Stirling sich erkältet hatte, was zu seinem Tod in Valancys erstem Lebensjahr führte, weil Frau Frederick am 20. Oktober kein Feuer machen wollte. Sie entzündete es am nächsten Tag – aber das war ein Tag zu spät für Frederick Stirling.
Valancy zog sich ihr Nachthemd aus grober, ungebleichter Baumwolle mit hohem Kragen und langen, engen Ärmeln an und hängte es in den Schrank. Sie zog Unterwäsche ähnlicher Art an, ein Kleid aus braunem Vichykaro, dicke, schwarze Strümpfe und Stiefel mit Gummistiefeln. In den letzten Jahren hatte sie sich angewöhnt, sich mit heruntergezogenem Fensterladen vor dem Spiegel die Haare zu machen. Die Falten in ihrem Gesicht waren dann nicht so deutlich zu sehen. Aber an diesem Morgen zog sie die Jalousie ganz nach oben und betrachtete sich im Spiegel, der von Lepra befallen war, mit der leidenschaftlichen Entschlossenheit, sich so zu sehen, wie die Welt sie sah.
Das Ergebnis war ziemlich schrecklich. Selbst eine Schönheit hätte das harte, ungeschwächte Seitenlicht als anstrengend empfunden. Valancy sah glattes schwarzes Haar, kurz und dünn, immer glanzlos, obwohl sie es jede Nacht ihres Lebens hundertmal mit der Bürste kämmte, nicht mehr und nicht weniger, und Redferns Haarwasser getreu in die Wurzeln einrieb, das in seiner morgendlichen Rauheit glanzloser war als je zuvor; feine, gerade, schwarze Augenbrauen; eine Nase, die sie immer für viel zu klein gehalten hatte, selbst für ihr kleines, dreieckiges, weißes Gesicht; einen kleinen, blassen Mund , der immer ein wenig über kleinen, spitzen weißen Zähnen offenstand; eine dünne Figur mit flachem Brustkorb, eher unterdurchschnittlich groß. Sie hatte sich irgendwie den hohen Wangenknochen der Familie entzogen, und ihre dunkelbraunen Augen, zu weich und schattig, um schwarz zu sein, hatten einen fast orientalischen Schliff. Abgesehen von ihren Augen war sie weder hübsch noch hässlich – nur unbedeutend aussehend, schloss sie verbittert. Wie deutlich waren die Linien um ihre Augen und ihren Mund in diesem gnadenlosen Licht! Und noch nie hatte ihr schmales, weißes Gesicht so schmal und so weiß ausgesehen.
Sie trug ihr Haar als Pompadour. Pompadours waren schon lange aus der Mode gekommen, aber sie waren in Mode gewesen, als Valancy ihr Haar zum ersten Mal hochgesteckt hatte und Tante Wellington beschlossen hatte, dass sie ihr Haar immer so tragen musste.
„Das ist die einzige Frisur, die dir steht. Dein Gesicht ist so klein, dass du es durch einen Pompadour-Effekt vergrößern musst “, sagte Tante Wellington, die Binsenweisheiten immer so aussprach, als würde sie tiefgründige und wichtige Wahrheiten verkünden.
Valancy hatte sich schon immer gewünscht, ihr Haar tief in die Stirn gekämmt zu tragen, mit Haarknoten über den Ohren, so wie Olive es trug. Aber Tante Wellingtons Diktum hatte eine solche Wirkung auf sie, dass sie es nie wieder wagte, ihre Frisur zu ändern. Aber dann gab es so viele Dinge, die Valancy nie wagte.
Ihr ganzes Leben lang hatte sie vor irgendetwas Angst gehabt, dachte sie bitter. Schon seit den frühesten Erinnerungen, als sie sich so schrecklich vor dem großen schwarzen Bären gefürchtet hatte, der, wie Cousine Stickles ihr erzählte, im Schrank unter der Treppe lebte.
„Und das werde ich immer sein – ich weiß es – ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich vor nichts Angst hätte.“
Angst vor den Launen ihrer Mutter – Angst, Onkel Benjamin zu beleidigen – Angst, Zielscheibe für Tante Wellingtons Verachtung zu werden – Angst vor Tante Isabels beißenden Kommentaren – Angst vor Onkel James' Missbilligung – Angst, die Meinungen und Vorurteile des ganzen Clans zu verletzen – Angst, den Schein nicht zu wahren – Angst, zu sagen, was sie wirklich von etwas hielt – Angst vor Armut im Alter. Angst – Angst – Angst – dem konnte sie nie entkommen. Es fesselte sie und umschloss sie wie ein Spinnennetz aus Stahl. Nur in ihrem Blauen Schloss konnte sie vorübergehend Erlösung finden. Und an diesem Morgen konnte Valancy nicht glauben, dass sie ein Blaues Schloss hatte. Sie würde es nie wieder finden können. Neunundzwanzig, unverheiratet, unerwünscht – was hatte sie mit der feenhaften Schlossherrin des Blauen Schlosses zu tun? Solch kindischen Unsinn würde sie für immer aus ihrem Leben verbannen und sich der Realität unerschrocken stellen.
Sie wandte sich von ihrem unfreundlichen Spiegel ab und blickte hinaus. Der Anblick war immer wieder wie ein Schlag für sie: der schäbige Zaun, das heruntergekommene alte Kutschengeschäft auf dem Nachbargrundstück, das mit plumper, grellbunter Werbung zugekleistert war; der schmutzige Bahnhof dahinter, mit den schrecklichen Pennern, die selbst zu dieser frühen Stunde immer dort herumlungerten. Bei strömendem Regen sah alles noch schlimmer aus als sonst, vor allem die abscheuliche Werbung „Behalte diesen Schulmädchen-Teint“. Valancy hatte sich ihren Schulmädchen-Teint bewahrt. Das war ja gerade das Problem. Nirgendwo ein Schimmer von Schönheit – „genau wie mein Leben“, dachte Valancy traurig. Ihre kurze Verbitterung war verflogen. Sie akzeptierte die Tatsachen genauso resigniert, wie sie sie immer akzeptiert hatte. Sie gehörte zu den Menschen, an denen das Leben immer vorbeigeht. Daran ließ sich nichts ändern.
In dieser Stimmung ging Valancy zum Frühstück hinunter.
Kapitel III
Das Frühstück war immer dasselbe. Haferbrei, den Valancy verabscheute, Toast und Tee und ein Teelöffel Marmelade. Frau Frederick fand zwei Teelöffel zu viel – aber das war Valancy egal, die Marmelade auch hasste. Das kühle, düstere kleine Esszimmer war kühler und düsterer als sonst; der Regen prasselte draußen gegen das Fenster; die verstorbenen Stirlings, in grauenhaften vergoldeten Rahmen, die breiter als die Bilder waren, blickten finster von den Wänden herab. Und doch wünschte Vetter Stickles Valancy alles Gute zum Geburtstag!
„Setz dich gerade hin, Doss“, war alles, was ihre Mutter sagte.
Valancy setzte sich aufrecht hin. Sie unterhielt sich mit ihrer Mutter und Cousine Stickles über die Dinge, über die sie immer sprachen. Sie fragte sich nie, was passieren würde, wenn sie versuchte, über etwas anderes zu sprechen. Sie wusste es. Deshalb tat sie es nie.
Frau Frederick war sauer auf Providence, weil es einen Regentag geschickt hatte, an dem sie eigentlich zu einem Picknick gehen wollte, und so aß sie ihr Frühstück in schmollendem Schweigen, wofür Valancy ihr ziemlich dankbar war. Aber Christine Stickles jammerte wie immer endlos weiter und beschwerte sich über alles – das Wetter, das Leck in der Speisekammer, den Preis für Haferflocken und Butter – Valancy hatte sofort das Gefühl, dass sie ihren Toast zu dick mit Butter bestrichen hatte – die Mumps-Epidemie in Deerwood.
„Doss wird sich sicher anstecken“, ahnte sie.
„Doss darf nicht dorthin gehen, wo sie sich wahrscheinlich mit Mumps ansteckt“, sagte Frau Frederick kurz und knapp.
Valancy hatte nie Mumps – oder Keuchhusten – oder Windpocken – oder Masern – oder irgendetwas, was sie eigentlich hätte haben sollen – nichts außer schrecklichen Erkältungen jeden Winter. Doss’ Wintererkältungen waren eine Art Familientradition. Es schien nichts zu geben, das sie davon abhalten konnte, sich diese einzufangen. Frau Frederick und Cousine Stickles gaben ihr heldenhaftes Bestes. Einen Winter hielten sie Valancy von November bis Mai im warmen Wohnzimmer eingesperrt. Sie durfte nicht einmal zur Kirche gehen. Und Valancy bekam eine Erkältung nach der anderen und endete im Juni mit einer Bronchitis.
„Keiner aus meiner Familie war jemals so“, sagte Frau Frederick und deutete damit an, dass es eine Veranlagung der Stirlings sein müsse.
„Die Stirlings erkälten sich selten“, sagte Cousine Stickles verärgert. Sie war eine Stirling gewesen.
„Ich denke“, sagte Frau Frederick, „wenn eine Person sich vornimmt, keine Erkältungen zu bekommen, wird sie auch keine bekommen.“
Das war also das Problem. Es war alles Valancys eigene Schuld.
Aber an diesem Morgen war Valancys unerträglicher Groll, dass sie Doss genannt wurde. Sie hatte es neunundzwanzig Jahre lang ertragen, und auf einmal hatte sie das Gefühl, dass sie es nicht länger ertragen konnte. Ihr voller Name war Valancy Jane. Valancy Jane war ziemlich schrecklich, aber sie mochte Valancy, mit seinem gelegentlichen, fremdartigen Klang. Es war für Valancy immer ein Wunder, dass die Stirlings ihr erlaubt hatten, so getauft zu werden. Man hatte ihr gesagt, dass ihr Großvater mütterlicherseits, der alte Amos Wansbarra, den Namen für sie ausgesucht hatte. Ihr Vater hatte den Namen Jane hinzugefügt, um ihn zu zivilisieren, und die ganze Verbindung kam aus der Schwierigkeit heraus, indem sie sie Doss nannte. Sie bekam Valancy nie von jemandem außer von Außenstehenden.
„Mutter“, sagte sie schüchtern, „würdest du mich danach Valancy nennen? Doss scheint so ... so ... ich mag es nicht.“
Frau Frederick schaute ihre Tochter erstaunt an. Sie trug eine Brille mit enorm starken Gläsern, die ihren Augen ein besonders unangenehmes Aussehen verliehen.
„Was ist mit Doss los?“
„Es wirkt so kindisch“, stotterte Valancy.
„Oh!“ Frau Frederick war eine Wansbarra gewesen, und das Wansbarra-Lächeln war kein Pluspunkt. „Ich verstehe. Nun, dann sollte es zu dir passen. Du bist nach bestem Wissen und Gewissen kindisch genug, mein liebes Kind.“
„Ich bin neunundzwanzig“, sagte das liebe Kind verzweifelt.
„Ich würde es an deiner Stelle nicht an die große Glocke hängen, Liebes“, sagte Frau Frederick. „Neunundzwanzig! Ich war neun Jahre verheiratet, als ich neunundzwanzig war.“
„Ich war mit siebzehn verheiratet“, sagte Cousin Stickles stolz.
Valancy betrachtete sie verstohlen. Mrs. Frederick, abgesehen von diesen schrecklichen Brillengläsern und der Hakennase, die sie mehr wie einen Papagei aussehen ließen, als ein Papagei selbst je aussehen könnte, war nicht unansehnlich. Mit zwanzig Jahren mochte sie sogar recht hübsch gewesen sein. Aber Cousine Stickles! Und doch war Christine Stickles einst in den Augen eines Mannes begehrenswert gewesen. Valancy empfand, dass Cousine Stickles, mit ihrem breiten, flachen, runzligen Gesicht, einem Leberfleck direkt auf der stumpfen Nasenspitze, borstigen Haaren am Kinn, einem faltigen, gelben Hals, blassen, hervorquellenden Augen und einem dünnen, zusammengekniffenen Mund, dennoch diesen Vorteil über sie hatte—dieses Recht, auf sie herabzusehen. Und selbst jetzt war Cousine Stickles für Mrs. Frederick unentbehrlich. Valancy fragte sich mitleidig, wie es wohl wäre, von jemandem gewollt zu werden—von jemandem gebraucht zu werden. Niemand auf der ganzen Welt brauchte sie oder würde irgendetwas im Leben vermissen, wenn sie plötzlich daraus verschwände. Sie war eine Enttäuschung für ihre Mutter. Niemand liebte sie. Sie hatte nicht einmal je eine Freundin gehabt.
„Ich bin nicht einmal ein guter Freund“, gestand sie sich einmal selbst mitleidsvoll ein.
„Doss, du hast deine Krusten nicht gegessen“, sagte Frau Frederick tadelnd.
Den ganzen Vormittag über regnete es ununterbrochen. Valancy nähte eine Steppdecke zusammen. Valancy hasste es, Steppdecken zusammenzunähen. Und es war nicht nötig. Das Haus war voller Steppdecken. Auf dem Dachboden standen drei große Truhen, die mit Steppdecken gefüllt waren. Frau Frederick hatte angefangen, Steppdecken einzulagern, als Valancy siebzehn war, und sie lagerte sie weiter ein, obwohl es unwahrscheinlich war, dass Valancy sie jemals brauchen würde. Aber Valancy musste arbeiten und edle Arbeitsmaterialien waren zu teuer. Müßiggang war eine Todsünde im Hause Stirling. Als Kind hatte Valancy jeden Abend in ein kleines, verhasstes schwarzes Notizbuch alle Minuten eintragen müssen, die sie an diesem Tag mit Müßiggang verbracht hatte. Sonntags ließ ihre Mutter sie zusammenzählen und darüber beten.
An diesem besonderen Vormittag dieses schicksalhaften Tages verbrachte Valancy nur zehn Minuten in Müßiggang. Zumindest hätten Frau Frederick und Cousine Stickles es als Müßiggang bezeichnet. Sie ging in ihr Zimmer, um einen besseren Fingerhut zu holen, und schlug Distelernte schuldbewusst an einer beliebigen Stelle auf.
„Die Wälder sind so menschlich“, schrieb John Foster, „dass man mit ihnen leben muss, um sie zu kennen. Ein gelegentlicher Spaziergang durch sie hindurch, auf den ausgetretenen Pfaden, wird uns niemals in ihre Intimität einweihen. Wenn wir Freunde sein wollen, müssen wir sie aufsuchen und sie durch häufige, ehrfürchtige Besuche zu jeder Tageszeit gewinnen; morgens, mittags und abends; und zu allen Jahreszeiten, im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter. Andernfalls können wir sie nie wirklich kennenlernen, und jeder Versuch, das Gegenteil zu behaupten, wird ihnen niemals auferlegt werden. Sie haben ihre eigene effektive Art, Fremde auf Distanz zu halten und ihr Herz vor bloßen Gelegenheitsbesuchern zu verschließen. Es nützt nichts, den Wald aus einem anderen Grund als der reinen Liebe zu ihm zu suchen; sie werden uns sofort durchschauen und all ihre süßen Geheimnisse der alten Welt vor uns verbergen. Aber wenn sie wissen, dass wir zu ihnen kommen, weil wir sie lieben, werden sie sehr freundlich zu uns sein und uns solche Schätze an Schönheit und Freude schenken, wie sie auf keinem Marktplatz gekauft oder verkauft werden können. Denn wenn die Wälder überhaupt etwas geben, dann geben sie es ohne Einschränkung und halten nichts von ihren wahren Verehrern zurück. Wir müssen liebevoll, demütig, geduldig und wachsam auf sie zugehen, und wir werden erfahren, welch ergreifende Schönheit in den wilden Orten und stillen Tälern lauert, die unter Sternenlicht und Sonnenuntergang liegen, welche Kadenzen überirdischer Musik auf alten Kiefernästen erklingen oder in Tannenwäldern gesungen werden, welche zarten Düfte von Moosen und Farnen in sonnigen Ecken oder auf feuchten Bachauen ausströmen, welche Träume, Mythen und Legenden einer älteren Zeit sie heimsuchen. Dann wird das unsterbliche Herz des Waldes gegen unseres schlagen und sein subtiles Leben wird sich in unsere Adern stehlen und uns für immer zu seinem eigenen machen, so dass wir, egal wohin wir gehen oder wie weit wir wandern, immer wieder in den Wald zurückkehren werden, um unsere beständigste Verwandtschaft zu finden.“
„Doss“, rief ihre Mutter aus dem Flur unten, „was machst du ganz allein in diesem Zimmer?“
Valancy ließ Dornenernte fallen wie eine heiße Kohle und floh hinunter zu ihren Flickarbeiten; doch sie spürte die seltsame Erhebung des Geistes, die sie immer für einen Moment überkam, wenn sie in eines von John Fosters Büchern eintauchte. Valancy wusste nicht viel über Wälder – außer den verwunschenen Hainen aus Eichen und Kiefern rund um ihr Blaues Schloss. Aber sie hatte sich immer heimlich nach ihnen gesehnt, und ein Foster-Buch über Wälder war das Nächstbeste nach den Wäldern selbst.
Mittags hörte es auf zu regnen, aber die Sonne kam erst um drei heraus. Dann sagte Valancy schüchtern, sie würde gerne in die Stadt gehen.
„Warum willst du nach Uptown gehen?“, fragte ihre Mutter.
„Ich möchte ein Buch aus der Bibliothek holen.“
„Du hast dir erst letzte Woche ein Buch aus der Bibliothek geholt.“
„Nein, das war vor vier Wochen.“
„Vier Wochen. Unsinn!“
„Wirklich, Mutter.“
„Du irrst dich. Es können unmöglich mehr als zwei Wochen gewesen sein. Ich mag keine Widersprüche. Und ich verstehe sowieso nicht, wofür du ein Buch haben willst. Du verschwendest zu viel Zeit mit Lesen.“
„Was ist meine Zeit wert?“, fragte Valancy bitter.
„Doss! Sprich nicht in diesem Ton mit mir .“
„Wir brauchen etwas Tee“, sagte Cousin Stickles. „Sie könnte ihn holen gehen, wenn sie Lust auf einen Spaziergang hat – obwohl dieses feuchte Wetter schlecht für Erkältungen ist.“
Sie stritten noch zehn Minuten weiter und schließlich stimmte Frau Frederick eher widerwillig zu, dass Valancy gehen könnte.