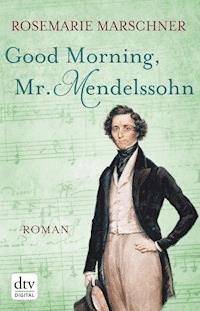9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein anrührendes und überzeugendes Frauenbild vor dem Hintergrund einer widrigen Zeit. Ein anrührendes und überzeugendes Frauenbild vor dem Hintergrund einer widrigen Zeit. Einem unehelichen Kind stehen nicht alle Türen offen in der österreichischen Provinz. Die vierzehnjährige Marie muss froh sein, dass sie Dienstmädchen in der großen Stadt Linz werden darf. Aber am leichten Leben der Stadtmenschen, die ihre Tage mit Zeitunglesen, Tennisspielen und Reisen zubringen, darf das Mädchen nicht teilhaben. Ihr Leben ist von harter Arbeit und strengen Regeln geprägt, die von der betagten Haushälterin eisern durchgesetzt werden. Nur ganz allmählich eröffnen sich Freiräume, nur ganz allmählich zeigen die »gnädige Frau« und der »gnädige Herr« auch einmal menschliche Züge. Und dann beginnt sich der Franz für das junge Mädchen zu interessieren, ein fescher Bursche, der Sohn eines gutverdienenden Bäckers, der sogar ein Motorrad besitzt. Nach zähem Ringen mit den Eltern wird Marie seine Frau. Die Hochzeitsreise führt nach Wien, und nun könnte eigentlich alles gut werden, wenn da nicht die Politik wäre. Man schreibt das Jahr 1938, Österreich ist annektiert worden, in Linz wird ein riesiges Stahlwerk gebaut und alle, die den neuen Herren im Weg stehen, werden beseitigt. Da wird dann auch manche private Rechnung beglichen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Rosemarie Marschner
Das Bücherzimmer
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte Ausgabe © 2004 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40174-6 (epub) ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21099-7
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Die alte Dame
Ein Mädchen vom Lande
Der Abschied
Eine wohlhabende Familie
Bilder einer fremden Stadt
Das Bücherzimmer
Die Dinnerparty
Heimkehr
Unruhige Jahre
Zu vermieten
Vier Tage im Februar
Platzkonzert
Amalie
Ferdinand und Miranda
Der Griff nach dem Glück
St. Peter
Die Bank im Park
Dezember
Das falsche Leben
Das Riesenspielzeug
Die Flutwelle
Der Anschluss
Die Reise nach Shanghai
Brot und Eisen
Die Botschaft des Fortschritts
In des Vaters Hand
Marie Zweisam
Die alte Dame
Die alte Dame
Der junge Mann parkte sein Auto vor der pompösen Außentreppe der Villa und sprang hastig die Stufen zum Eingang empor. Dann besann er sich und verlangsamte seine Schritte. Es bestand kein Grund mehr, sich zu beeilen. Er wandte sich um und blickte hinunter auf den gepflegten, weitläufigen Park. Mächtige Bäume und Rhododendrengehölze, Kieswege und Blumenrabatten umgaben das Anwesen. Über den Rasen vor der Fensterfront flanierte ein fetter Fasan, als wäre dies alles sein ureigener Besitz.
Das Gebäude stammte aus der Jahrhundertwende, der vorvorigen, als neureiche Bürger anfingen, sich dem Adel gleich zu fühlen. In jüngerer Zeit hatte man das Haus aufwendig renoviert und es damit in die Gegenwart geholt. Bis auf ein paar erlesene Ausnahmen waren die vergilbten Tapeten, das knarrende Parkett und die alten Möbel durch weißgekalkte Wände, glänzende Granitböden und kühles Designermobiliar ersetzt worden. Wenn man nun die Freitreppe hinaufstieg wie eben jener junge Besucher, hallten die Schritte auf den glatten Steinstufen wie in einer Kirche, und das Sonnenlicht brach ungefiltert durch die hohen Fenster wie ein schimmernder Wasserfall. Alles makellos, geradlinig und klar. Wie geschaffen, dachte der junge Mann, wie geschaffen für die alte Dame mit den beherrschten Gesichtszügen, ihrer eleganten, ungebeugten Gestalt und dem energischen Tonfall, mit dem sie sich bis vor kurzem, trotz ihrer Jahre, in jeder Umgebung Gehör verschafft hatte.
Bis vor kurzem. Ein Gefühl von Unbehagen beschlich den jungen Mann, während er nun einen Schlüsselbund aus der Rocktasche zog. Ihren Schlüsselbund, den er so oft in ihrer Hand gesehen hatte. Es gehört sich nicht, dachte er, daß jetzt er ihn umklammert hielt, als hätte er ein Recht darauf, und daß nun er die Tür aufschloß, durch die er noch nie ungeladen getreten war. Bis vor kurzem.
Er war ihr Enkel, und er kam, weil sie ihn zu ihrem Erben bestimmt hatte.
»Wollen Sie sie noch einmal sehen?« hatte ihn der Polizeibeamte gefragt, der ihn telefonisch benachrichtigt und in sein Büro bestellt hatte. Der Enkel– Thomas – hatte abgelehnt. Aus irgendeinem Grund war er überzeugt, daß seine Großmutter unmittelbar hinter der Tür neben dem Schreibtisch des Beamten lag: aufgebahrt auf einem Behelfsbett und entstellt durch die Einwirkungen des gewaltsamen Todes, dem sie erlegen war. Keine Krankheit, wie man es bei ihrem hohen Alter erwartet hätte, oder ein sanftes Einschlafen und Nicht-mehr-Aufwachen. Nein, die alte Dame war dem Tod der Jungen zum Opfer gefallen. Dem Tod durch einen Unfall. Mitten im Leben. In der Nacht, in einem Meer von Nebel, hatte ein Sattelschlepper ihr Auto in voller Geschwindigkeit von hinten gerammt und es mit einem einzigen gnadenlosen Ruck in ein anderes, vor ihm fahrendes, gebohrt. »Nein!« wiederholte Thomas und kämpfte gegen ein Schluchzen, das ihm die Kehle zusammenschnürte. »Nein, ich möchte sie nicht mehr sehen.« Er erinnerte sich plötzlich daran, daß seine Großmutter es immer gehaßt hatte, eingeengt zu werden.
Er fühlte sich wie ein Dieb, als er nun von Zimmer zu Zimmer ging und seine Schritte auf dem Steinboden widerhallten. Die warme Morgensonne, die durch die gardinenlosen Scheiben drang, machte die Luft stickig und schwer. Thomas öffnete ein Fenster und atmete tief ein. Während er sich umsah, fiel ihm auf, daß alles an seinem Platz lag, als hätte die alte Dame damit gerechnet, daß er vielleicht bald diese Räume durchstreifen und es keine Diskretion mehr geben würde. Jeder Schrank würde geöffnet werden, jedes Schriftstück geprüft, jedes Geheimnis enthüllt. Mit musterhafter Ordnung hatte sie sich gegen die Vereinnahmung gewehrt. Thomas war sicher, daß er kein überflüssiges oder vernachlässigtes Kleidungsstück entdecken würde, keine Spuren unentschlossenen Verwahrens oder sentimentalen Gedenkens.
Thomas beschloß, sich auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken: die Dokumente sicherzustellen, die er für die Behörden benötigte und die vielleicht auch als Grundlage für einen Nachruf nützlich sein konnten. Bis zuletzt war die alte Dame in der Öffentlichkeit gestanden, hatte gelehrt und publiziert und war immer wieder auch persönlich in den Medien aufgetreten. Man schätzte ihre klare Analyse, die Unabhängigkeit ihres Denkens und ihren scharfen Witz, der ihrer Kritik alles Belehrende nahm. Thomas wußte nicht, ob seine Großmutter die Menschen geliebt hatte, ganz sicher aber hatte sie sich für sie interessiert und sie durchschaut. Ihr Urteil war ohne Bosheit gewesen, doch zumeist auch ohne Nachsicht.
Im Arbeitszimmer fand Thomas schließlich die Mappe mit den Dokumenten. Zu Hause würde er sie in Ruhe durchsehen. Doch als er sie aus dem Regal zog, fiel ein großer, weißer Umschlag zu Boden. Thomas hob ihn auf und suchte vergeblich nach einer Beschriftung. Nachdenklich wog er das Kuvert in der Hand. Dann setzte er sich in den hohen, lederbezogenen Drehsessel, der bisher ausschließlich seiner Großmutter vorbehalten gewesen war, und schnitt mit ihrem – ihrem! – Brieföffner den Umschlag auf.
Heraus fielen zwei amtlich aussehende Dokumente und ein altes Foto, braunstichig und voller Flecken, ein Hochzeitsbild, wie auf den ersten Blick zu erkennen war: ein Brautpaar, ernst und würdevoll. Junge Menschen, die Braut beinahe noch ein Kind, trotz des strengen, dunklen Kleids mit dem großen Kragen, der viel zu mächtig für den schlanken, weißen Hals und das schmale Gesicht mit den zarten Zügen war. Schwere, zu einem Knoten hochgesteckte Zöpfe mit einem kleinen Blütenkranz trug sie. Dazu ein paar Ohrgehänge – auf dem Bild reglos und starr, doch in der Realität jenes Tages wahrscheinlich voller Bewegung: ein heimliches Versprechen im Glitzern der Juwelen und in ihrem unhörbaren Klirren, das das Blut des Bräutigams in Wallung versetzt haben mochte, als sich am Abend die Türen hinter den Liebenden schlossen.
Der Bräutigam war ein stämmiger junger Mann, ein paar Jahre älter als die Braut, mit schwarzen, welligen Haaren dicht wie Zobelfell. Geschwungene Brauen über dunklen Augen, die sich um einen besonders wachen Ausdruck bemühten, auch wenn sie sonst vielleicht eher träge und verschleiert blicken mochten. Eine gerade, gefällige Nase und über den vollen Lippen ein schwarzer Schnurrbart nach der Mode der Zeit – das Ergebnis, ganz sicher, einer allnächtlich getragenen Bartbinde. Ein schöner Mensch im großen und ganzen, wenn auch zur Üppigkeit neigend und ein wenig kleiner als die schmale, hellhäutige Braut. Kaum merklich wandte er ihr den Kopf zu und drängte seine Schulter gegen die ihre, während sie sich an ihrem Brautstrauß festhielt, als wäre sie sich ihres Entschlusses nicht mehr sicher.
Thomas musterte diese Gesichter aus einer anderen, versunkenen Zeit, doch er fand keine Ähnlichkeit mit Personen, die ihm bekannt waren. So legte er das Bild beiseite, bereit, es für immer zu vergessen.
Die beiden Dokumente im Umschlag erwiesen sich als eine Heiratsurkunde und ein Scheidungsurteil. Keine Kopien, wie Thomas befremdet feststellte. Als sein Blick auf den Geburtsnamen der Braut fiel, erschrak er und glaubte zuerst, sich zu irren: Es war der Name der alten Dame, der Name seiner Großmutter, den sie bis zu ihrem Tode getragen hatte, weil sie es ablehnte, ihren Lebensgefährten, Thomas’ Großvater, zu heiraten. Sie war selbständig und prominent genug, sich eine solche Extravaganz leisten zu können, auch wenn man sich in den bürgerlichen Kreisen der Hauptstadt zu Beginn darüber entrüstet hatte und ihr vorwarf, der Jugend ein schlechtes Beispiel zu geben. Da sich die Verbindung des Paares jedoch als fest und harmonisch erwies und der Zeitgeist sich wandelte, geriet der Skandal von einst immer mehr in Vergessenheit und wurde höchstens noch hin und wieder als ein Zeichen früher feministischer Unabhängigkeit gepriesen.
Marie Zweisam war nicht verheiratet gewesen. Unmöglich, dachte Thomas, die Braut auf dem Foto und der Name auf der Urkunde: Das konnte nicht seine Großmutter sein. Es mußte sich um eine zufällige Namensgleichheit handeln.
Noch einmal nahm Thomas das Bild zur Hand und studierte es aufmerksam. Doch je länger er es ansah, um so unruhiger wurde er. Als ihm bewußt wurde, daß seine Hände zitterten, warf er das Bild auf den Schreibtisch, als wäre es Gift, und schob hastig die beiden Dokumente darüber. Er hatte auf einmal das gleiche Gefühl wie nach der Frage des Beamten: Wollen Sie sie noch einmal sehen?… Nein! dachte er und wich zurück. Nein, ich will sie nicht mehr sehen!
Erstes Buch
Ein Mädchen vom Lande
Der Abschied
1
Sie hieß Marie, zählte nur wenig mehr als vierzehn Jahre und befand sich doch bereits auf der Reise in ein neues Leben. Vor Stunden schon war sie aufgebrochen in ihrem dunkelblauen Sonntagskleid, das ihr viel zu lang war und zu weit um die Brust, damit es auch im kommenden Jahr noch paßte. Zuerst hatte ihre Mutter sie ja noch begleitet auf dem langen Fußmarsch über die Felder und Wiesen, doch dann, als sich das Land nach unten senkte und die Stadt plötzlich wie buntes Holzspielzeug zu ihren Füßen lag, war die Mutter stehengeblieben und hatte Abschied genommen. Keine Umarmung, das war nicht die Art, wie man hier miteinander umging, aber hilflose Tränen in den Augen und ein verhaltenes Schluchzen, das den Hals zusammenschnürte und das Marie nie vergessen würde. Es war ihr erster Abschied und der schwerste, weil sie auf einmal fürchtete, er könnte für immer sein. Dann drehte sich die Mutter abrupt um und ging zurück, woher sie gemeinsam gekommen waren und wo sich alles befand, was Marie kannte und woran sie hing. Sie wartete, daß die Mutter noch einmal zurückblicken und ihr zuwinken würde oder sie gar wieder zu sich rief und ihr erlaubte, doch noch mit ihr heimzugehen, das Köfferchen wieder auszupacken und weiterzuleben wie bisher. Doch die Mutter hielt nicht inne, sah nicht zurück, hob nicht einmal mehr die Hand zum Gruß: eine zerbrechliche Gestalt in einem schwarzen, bäuerlichen Kleid, jung noch, viel zu jung, um schon eine Tochter zu haben, die ihr eigenes Leben begann. Mit schnellen Schritten, als wäre sie auf der Flucht, eilte sie über die Schotterstraße, die Füße bis zu den Knöcheln im aufgewirbelten Staub, immer weiter, bis sie nur noch ein kleiner dunkler Punkt war, der sich schließlich in der Ferne verlor.
Da begriff Marie, daß sie nun allein auf sich gestellt war. Am liebsten hätte sie sich ins Gras gesetzt und geweint. Doch sie wußte, daß niemand kommen würde, um sie zu trösten oder ihr ihr bisheriges Leben zurückzugeben. So nahm sie ihr Köfferchen wieder auf und wanderte die weit geschwungenen Serpentinen hinunter zu der kleinen Stadt, die ihr vertraut war. Hierher war sie alle paar Wochen mit ihrer Mutter gekommen, um einzukaufen. Immer nur das Nötigste: Flanell oder Baumwollstoff für ein neues Kleid, weil das alte nicht mehr zu retten war. Neue Schuhe, weil sich in den alten die Zehen schon schmerzhaft krümmten. Wolle für eine Winterweste, für Socken, Strümpfe und sogar Unterwäsche. Nie etwas Überflüssiges. Trotzdem konnte man zufrieden sein, denn man hatte genug zu essen und im Winter eine warme Stube und ein dickes Federbett. Auch jetzt noch, vierzehn Jahre nach dem Krieg, klopften jeden Tag Bittsteller an die Tür, um etwas zu hamstern oder gar zu betteln. Im Vergleich zu ihnen waren Marie und ihre Mutter reich. Sie besaßen ein kleines Haus, und die Mutter verdiente, was sie brauchten, auf dem Hof des eigenen Bruders, der gut zu ihr war, obwohl er nie aufhörte sie daran zu erinnern, daß sie eine ganz andere Position hätte haben können, wenn sie am entscheidenden Punkt ihres Lebens nicht so stur und stolz gewesen wäre und von den reichen Eltern des jungen Nichtsnutzes das Geld für die Engelmacherin angenommen hätte.
Marie erreichte den Fluß und überquerte die eiserne Brücke. Immer mehr Menschen begegneten ihr. Autos fuhren durch die Straßen, Motorräder, Fahrräder, Pferdewagen. Nicht weit von der Brücke sah Marie den roten Boden des Tennisplatzes und die weißgekleideten Spieler, die – so hätte man es im Haus von Maries Onkel beurteilt – ihre Kräfte sinnlos vergeudeten. Dennoch fühlte sich Marie zu ihnen hingezogen. Auch ihre Mutter war manchmal nach dem Einkaufen mit ihr zu dem hohen Zaun gepilgert und hatte den sorglosen Geschöpfen da drinnen zugesehen, wie sie hin- und herrannten, lauernd vorgebeugt auf den Ball warteten, ihr Gegenüber auszutricksen suchten und lachend das eigene Mißgeschick oder den Sieg akzeptierten. Hier war das Leben nicht ernst und bedeutungsschwer. Hier existierte die Zeit nicht, um mit Arbeit verbracht zu werden. Hier bedeutete Zeit Muße und Vergnügen. Voll Zärtlichkeit mußte Marie plötzlich an ihre Mutter denken, die ihr vor Jahren als Belohnung für ein gutes Schulzeugnis zwei hölzerne Schläger gebastelt hatte und einen Ball aus Stoffresten, den sie von da an abends hinter dem Haus, wo niemand sie beobachten konnte, hin- und herprügelten, schreiend und lachend, als wäre auch die Mutter noch ein Kind.
Die Sonne stieg höher. Es wurde heißer, als es die dichten Morgennebel hatten erwarten lassen. Immer öfter wechselte Marie das Köfferchen von einer Hand in die andere. Manchmal stellte sie es nieder, rieb sich die schmerzenden Schultern und wischte sich mit dem Knöchel des Zeigefingers den Schweiß von den Nasenflügeln. Sie war froh, als sie endlich den Bahnhof erreichte, und atmete auf, als sie sah, daß sie nicht zu spät gekommen war. Sie kaufte sich eine Fahrkarte und trat hinaus auf den Bahnsteig, wo es nach Vulkangestein roch und nach Rauch.
»Hier Wels, Bahnhof Wels!« dröhnte es aus dem Lautsprecher. Unter Dampfen und Zischen fuhr der Zug in den Bahnhof ein und kam mit einem herzzerreißenden Kreischen zum Stillstand. Die Reisenden stürzten aufgeregt zu den Türen, behinderten die Aussteigenden und zogen sich dann in panischer Hast die hohen Stufen hinauf, wobei die Damen ihre engen Röcke bis über die halben Schenkel hochschieben mußten, um den ersten Riesenschritt zu bewältigen.
Marie fand einen Platz am Fenster. Noch bevor sich der Zug wieder in Bewegung setzte, holte sie aus ihrem Köfferchen einen Apfel, den ihr der stumme Knecht ihres Onkels mitgegeben hatte. Reitinger war der einzige Hausgenosse Maries und ihrer Mutter, und sein Herz war so groß wie seine erzwungene Schweigsamkeit. Er hatte der Mutter geholfen, als Marie geboren wurde, und Marie dachte beruhigt, daß er immer da sein würde, wo ihre Mutter war.
Die Reisenden verstauten ihr Gepäck und ließen sich erschöpft auf die Holzbänke fallen. Sie beobachteten durch die Fenster, wie der Zug den Bahnhof verließ und die Häuser draußen immer spärlicher wurden. Marie schloß ihre Hände um den warmen, saftigen Apfel und wußte nicht, ob sie Angst haben sollte oder neugierig sein auf das, was sie erwartete.
2
»Du bist zu frech, zu jung und zu mager!« lautete das vernichtende Urteil der dicken Frau in der Stadtvilla, an deren schmiedeeisernem Gartentor Marie über eine Viertelstunde gewartet hatte, weil keiner auf ihr Schellen antwortete. Sie meinte schon, es wäre niemand zu Hause, und drückte schließlich in resignierter Verzweiflung nochmals den weißen Klingelknopf, läutete Sturm, als könnte sie damit das Schicksal zu einer Entscheidung zwingen.
Erst jetzt öffnete sich das Eingangstor der Villa, und besagte Frau stürzte heraus, schimpfte Unverständliches, schrie Marie an, Bettler seien hier unerwünscht und man habe auch nicht vor, irgend etwas zu kaufen. Damit drehte sie sich mit einer geringschätzigen Bewegung zum Haus um und knallte das Tor hinter sich zu, ohne Marie anzuhören, die nun ihrerseits die Geduld verlor und der Frau nachschrie, wer sie war und daß sie berechtigt sei, hier zu läuten und um Einlaß zu bitten.
Da nichts darauf hindeutete, daß sich das Tor zur Villa ohne Nötigung erneut öffnen würde, drückte Marie mit ihrem Zeigefinger nun auf den Klingelknopf, als wollte sie ihn für immer versenken. Sie war zornig, obwohl ihr zugleich bewußt war, daß man ihr hier ihre Verbitterung nicht zugestehen würde. Sie kannte dieses Gefühl nur zu gut. Es befiel sie nicht oft. Meist war sie ruhig und besonnen. Doch manchmal, im Angesicht einer wahren oder vermeintlichen Ungerechtigkeit, schoß ihr das Blut zu Kopf, und sie ging zum Angriff über. Ihre Mutter hatte diesen Charakterzug oft beklagt. Auch der Pfarrer hatte Marie deswegen ermahnt und bei jeder Beichte eindringlich gefragt, ob sie wieder einmal explodiert sei. Nur der Lehrer hatte Maries Wesen mit Gleichmut toleriert und einmal sogar vor sich hin gemurmelt, sie könne froh sein, daß ihr der Himmel diese Waffe mitgegeben habe. Wer weiß, wozu sie ihr in ihrer schwierigen Lage noch nützlich sein würde.
Ein wahrer Machtkampf fand statt: draußen Marie an der Klingel, drinnen die Hüterin des Hauses, bebend vor Wut. Nach einer für beide Seiten unerträglichen Ewigkeit stürmte die Frau heraus, einen Besen in der Hand. Mit dem Humpeln einer Gichtkranken eilte sie über den Kiesweg und machte Anstalten, Marie durch das Gitter hindurch mit dem Besenstiel am weiteren Schellen zu hindern. Dabei schrie sie ununterbrochen auf Marie ein, die nun, ernüchtert, die Hand zurückzog und immer wieder ihren Namen nannte und daß sie das neue Hausmädchen sei.
Erst nach einer Weile wurde sie verstanden. Schwer atmend ließ die Frau ihre Waffe sinken, starrte Marie an, als wäre sie der böse Feind, und riß schließlich mit einer trotzigen Bewegung ihre Schlüssel vom Schürzenbund. Sie schloß auf, ohne das Tor zu öffnen, ließ aber immerhin zu, daß sich Marie durch einen schmalen Spalt zwängte, sperrte hinter ihr wieder ab, als wollte sie zumindest den Schlüssel erwürgen, und stampfte dann ohne ein weiteres Wort oder einen Blick für den Eindringling ins Haus zurück. Marie mit ihrem Köfferchen folgte ihr.
»Du bist zu frech, zu jung und zu mager!« knurrte die Frau und bohrte ihren Zeigefinger in Maries Brust. »Wenn die Herrschaft zurück ist, wirst du dieses Haus wieder verlassen. Mit einer wie dir kann ich nicht arbeiten. Du hast keinen Respekt und keine Erziehung. Da könnten wir uns ja gleich ein Sozimensch ins Haus holen. Ich dachte immer, die Kinder vom Land hätten noch Anstand. So etwas wie du ist mir jedenfalls noch nie untergekommen.«
Marie stellte ihr Köfferchen ab. »Es tut mir leid«, sagte sie versöhnlich. »Aber ich bin schon so lange unterwegs, es ist heiß, und ich bin müde.«
Die Frau zog ihren Zeigefinger zurück. »Auch noch schwächlich«, murrte sie. »Entschuldigst du dich?«
Außer in Kirchen hatte Marie noch nie so hohe Räume gesehen. Trotzdem wirkte das ganze Gebäude finster, was an den alten Bäumen liegen mochte, deren kräftige Äste die hohen, schmalen Fenster berührten, so daß man die Hitze eines Sommertags hier drinnen nicht einmal ahnte und die trübe Jahreszeit wohl nur überstand, wenn man von morgens bis abends die Lichter brennen ließ – eine Verschwendung, die Maries Onkel die Röte der Empörung ins Gesicht getrieben hätte.
Auch sonst schienen die Bewohner der Villa nicht viel von Sparsamkeit zu halten. Überall prangten Gegenstände aus Silber– Leuchter, Kannen, Schalen – oder aus buntem Glas, wie Marie es noch nie gesehen hatte. Die Vorhänge waren aus schwerer Seide, die Marie zwar nicht als solche erkennen, deren Kostbarkeit sie aber ahnen konnte. Es war kein frohes, helles Haus mit viel Licht und Luft, wie man es beim offensichtlichen Wohlstand seiner Besitzer hätte vermuten können, sondern ein Gebäude, das mit den Jahren zugewachsen war und das keiner jung erhalten hatte. Ein gealtertes Haus, das nicht lächelte. Eine Gruft, dachte Marie und wünschte sich fort in das bescheidene Heim ihrer Mutter, wo in diesem Augenblick ganz bestimmt die Fenster weit offenstanden und vom Küchentisch ein Strauß Wiesenblumen grüßte.
Marie aß die beiden Schmalzbrote, die ihr die Frau auf einem Schneidebrett hingeschoben hatte – mürrisch, aber schon versöhnlicher, als sie sah, wie hungrig Marie war und wie gierig sie das Wasser hinunterstürzte, das die Frau aus einem Hahn über der Spüle hatte laufen lassen.
»Sie haben Wasser direkt im Haus?« fragte Marie ungläubig.
»Wasser und auch ein Bad und in jedem Stockwerk ein englisches Klosett«, erklärte die Frau voller Stolz. Sie stammte selbst vom Land und wußte, womit die jungen Dinger zu beeindrucken waren, wenn sie aus ihren rückständigen Bauernkaten in die Großstadt kamen.
Sie heiße Amalie, sagte sie, um die Situation zu klären. So nannten sie die Hausbewohner, »auch das gnädige Fräulein«. Von Marie allerdings wünsche sie »Frau Amalie« genannt zu werden. Jeder Mensch habe seine gottgewollte Stellung im Leben, und die müsse gewürdigt werden. Sie, Frau Amalie, sei die Köchin und Wirtschafterin hier in der Villa. Eine verantwortungsvolle Position. Sollte Marie trotz ihrer offenkundigen Unzulänglichkeiten vielleicht doch im Hause bleiben dürfen – »zumindest vorläufig«–, dann habe sie die Autorität ihrer Vorgesetzten respektvoll anzuerkennen und ihr aufs Wort zu gehorchen. »Geschlagen wird bei uns nicht!« fügte Amalie mit bedauerndem Unterton hinzu. »Das erlaubt der Herr Notar leider nicht. Aber gefolgt werden muß trotzdem, sonst fliegst du.«
3
Gegen Abend kehrten die Herrschaften nach dreiwöchigem Aufenthalt in den Bergen zurück. Ununterbrochen hupend hielt das große, braune Auto, wie Marie noch nie eines aus der Nähe gesehen hatte, vor dem Gartentor. »Da sind sie! Da sind sie!« schreiend humpelte Amalie hinaus und öffnete keuchend die beiden Gitterflügel. Marie folgte ihr zögernd. Amalie schien sich über die Ankunft der Herrschaften aufrichtig zu freuen. Marie fragte sich, ob dies aus Zuneigung geschah oder aus einem Pflichtbewußtsein, das der Hauswirtschafterin inzwischen so sehr ins Blut übergegangen war, daß sie automatisch fühlte, wovon sie meinte, daß sie es fühlen sollte.
Erst jetzt, da seine Bewohner es wieder in Besitz nahmen, gewann das große Haus sein Gesicht. Die Räume füllten sich mit der Aufregung und dem Echo gerade erst vergangener Ferientage, die noch auf den Wangen und in den Augen der Heimgekehrten nachzuglühen schienen, wenn sie wie Schauspieler in einer turbulenten Komödie hektisch hin und her rannten und das Stück inszenierten: »Wir haben die Welt gesehen, und ihr wart bloß zu Hause!« Amalie spielte den Part des anbetenden Publikums, und sogar Marie wurde auf der Stelle eine Rolle zugewiesen, wenn auch nur die eines ahnungslosen Eindringlings, der beeindruckt und auf seinen Platz verwiesen werden sollte.
Es blieb kaum Zeit, die Ankömmlinge näher zu betrachten oder ihnen vorgestellt zu werden. »Einen Knicks!« zischte Amalie und stieß Marie mit der Faust in den Rücken. Doch Marie blieb aufrecht stehen, weil sie noch nie im Leben vor irgend jemandem einen Knicks gemacht hatte und auch gar nicht wußte, wie dies zu bewerkstelligen war. So nickte sie höflich und sagte vorsichtig »Grüß Gott!«, was niemand hörte außer Amalie, die sie mahnte, es hieße zumindest »Grüß Gott, gnädige Frau!« oder »gnädiger Herr!«, je nachdem. Damit griff Amalie nach dem größten der Koffer, die ein hochgewachsener Mann – wahrscheinlich der »gnädige Herr«, dachte Marie – aus dem Wagen hob und in der Einfahrt abstellte, die sich bald mit weiteren Koffern und Reisetaschen füllte, während es die Herrschaften den beiden Bediensteten überließen, die Gepäckstücke ins Haus zu schaffen und in die Räume ihrer jeweiligen Besitzer zu befördern.
Marie glaubte, noch nie ein solches Chaos von überflüssigen Wünschen und Anweisungen erlebt zu haben. Jeder der Hausbewohner schien ihr oder Amalie etwas zuzurufen. Wollte ein Getränk. Einen kleinen – klitzekleinen! – Imbiß vor dem Abendessen. Hilfe beim Auspacken. Unterstützung bei der Suche nach irgend etwas, das sich schließlich zwischen den Gepäckstücken fand, nachdem die Suche längst aufgegeben und der Verlust der Unfähigkeit der Dienstboten zugeschrieben worden war. Man wollte baden. Wollte zum zweiten Mal eine Tasse Tee – nein, lieber doch eine Limonade! Suchte den Morgenrock, der ja wohl innen an der Schlafzimmertür zu hängen habe. Forderte Hilfe beim Öffnen der Knöpfe an der Rückseite des Kleides. Verlangte die Post, die während der Abwesenheit eingegangen war. Konnte die Blumen auf dem Tisch im Salon nicht ausstehen. Nahm denn keiner diesen unerträglichen Grabgeruch wahr, den sie verströmten, und der umgehend eine heftige Migräne auslösen würde?
Ein Narrenhaus! dachte Marie und hastete hin und her, ohne sich zurechtzufinden. Es dauerte Stunden, bis endlich alle verköstigt waren und sich hinter die hohen Türen ihrer Schlafzimmer zurückgezogen hatten. Ein Hüsteln noch hie und da; das Quietschen einer Schublade; Gardinen, die auf- und zugezogen wurden; ein Fensterladen, der im Nachtwind klapperte. Dann war es still in dem großen, dunklen Haus. Nur in der Küche brannte noch Licht, wo Amalie und Marie das Geschirr spülten und die Reste des Abendessens wegpackten, damit nur ja nichts verschwendet wurde, denn die Zeiten waren schlecht, und in manchen Teilen der Stadt – so erzählte Amalie – hungerten die Menschen.
Marie konnte kaum noch aus den Augen schauen, so müde war sie. Als endlich alles aufgeräumt und abgewischt war, mußte noch der Frühstückstisch gedeckt werden, wobei Amalie nur mit einer Hand zulangte und sich mit der anderen den schmerzenden Rücken hielt. Trotzdem schien sie zufrieden, daß das Haus, das ihr anvertraut war, mit der Heimkehr seiner Bewohner nun wieder zu seiner normalen Routine zurückgekehrt war und ihr eigenes Leben seine Berechtigung und seinen Sinn zurückgewonnen hatte. »Dein Zimmer ist ganz oben«, erklärte sie Marie. »Nimm dir einen Krug Wasser mit zum Waschen. Auf dem Nachttisch steht ein Wecker. Stell ihn auf halb sechs, und komm morgen gleich herunter! Der Herr Notar braucht um sechs seinen Tee. Keine Minute später; da ist er eigen.«
Marie holte sich ihr Wasser und stieg die Stufen empor, den Kopf gesenkt, die Augen halb geschlossen. Sie öffnete die Tür zu der Kammer, die künftig ihr eigenes kleines Heim sein sollte. Nach den hohen, überladenen Räumen in den unteren Stockwerken wirkte sie niedrig und kahl, als hätte man vergessen, sie einzurichten. Doch Marie war zu erschöpft, um sich darüber Gedanken zu machen. Sie stellte den Krug auf den Tisch zu der kleinen Waschschüssel und bemerkte fast mit Rührung, daß jemand – es konnte nur Amalie gewesen sein – ein sauberes, ordentlich gefaltetes Handtuch daneben gelegt hatte und auf einen kleinen Teller ein unbenutztes Stück Kernseife. Sie war also doch erwartet worden. Kein ungebetener Eindringling.
Als sie ihr Kleid aufgeknöpft hatte, merkte sie, daß ihr Köfferchen noch immer unten in der Halle stehen mußte. Seufzend stieg sie die Treppe wieder hinab, stolpernd vor Müdigkeit. Der Koffer lag unter dem Treppenabsatz, halb offen und so unpassend und verlassen in dem fremden Haus wie Marie selbst, die nur noch ihr Bett sah, als sie in das Zimmer zurückkam. Sie ließ den Koffer an der Tür stehen, löschte das Licht auf dem Flur und im Zimmer und ließ sich in die Kissen fallen. Sie hörte, wie die Standuhr unten in der Diele zweimal schlug, und dachte, daß sie noch den Wecker stellen mußte. Aber da war sie auch schon eingeschlafen, zum ersten Mal in einem fremden Bett. Jahre später, als sie sich angewöhnt hatte, die Ereignisse ihres Lebens und die Vorgänge ringsum zu analysieren und zu bewerten, dachte sie, daß in dieser Nacht ihre Kindheit zu Ende gegangen war.
Eine wohlhabende Familie
1
Eine neue Welt tat sich ihr auf. Viel kleiner und begrenzter, als sie es erwartet hatte, nachdem ihr der Onkel zu Hause eröffnet hatte, es biete sich ihr die vielversprechende Gelegenheit, in die weite Welt hinauszugehen. Erst einmal »in den Dienst«. Was sie daraus mache, liege bei ihr. Die Chancen seien unermeßlich. In der Stadt gebe es keine Grenzen für einen jungen Menschen, der fleißig sei und bereit, im Interesse seiner Zukunft auf Bequemlichkeiten und Vergnügungen der Gegenwart zu verzichten.
Mehr als einmal wies der Onkel auf die Karriere einer Bauerntochter aus dem Nachbardorf hin – ein fünftes Kind, was bedeutete, daß sie mit keiner Mitgift zu rechnen hatte außer dem unbefleckten Namen ihrer alteingesessenen Familie und der eigenen Sittsamkeit. In die Schweiz hatte man sie geschickt, was anfangs problematisch schien, weil die Bevölkerung dort – so hieß es – einer ketzerischen Sekte angehörte, der man ein unberührtes katholisches Mädchen eigentlich nicht anvertrauen durfte. Da jedoch in dem Brief der künftigen Dienstherrin immer wieder das beruhigende Wort »Haustochter« auftauchte und das Mädchen anfing, überfällig zu werden, setzte man sich über die religiösen Bedenken hinweg und schickte den Sorgenfall mit einem schmalen Bündel und etwas Reisegeld in das ferne, reiche Land, das es sich leisten konnte, junge Menschen aus der Heimat fortzulocken und die Kraft ihrer Hände für sich zu beanspruchen.
Nach einem Jahr starb die schweizerische Hausherrin. Nach einem weiteren tauchte das ehemals mitgiftlose Kind in einem großen Auto bei seiner Familie auf, im Schlepptau den einstigen Dienstgeber, nun der Ehemann, der zwar die besten Jahre schon weit hinter sich gelassen hatte, von dem die Mutter der jungen Ehefrau jedoch im Dorf schwärmte, er knie jeden Morgen vor dem Kruzifix nieder und danke dem Herrgott, daß er ihm diese wunderbare Frau geschenkt habe. Bei der männlichen österreichischen Verwandtschaft der so Verehrten machte ihn diese Behauptung zum Trottel, die Frauen jeden Alters aber erfaßten die Romantik der Situation, und einige der unverheirateten Mädchen bemühten sich nun ebenfalls, eine Stellung als Haustochter in der Schweiz zu finden, um später auch in einem offenen Auto mit einer Sonnenbrille auf der Nase und einem Chiffontuch um den ondulierten Kopf im Dorf vorzufahren und den ehemaligen Freundinnen und der neidgelben Verwandtschaft einen reichen Ehemann zu präsentieren, der zwar vielleicht weder Mumm noch Muskeln hatte und ein Heide sein mochte, der aber immerhin seine Frau zu schätzen wußte, was man von den gleichaltrigen, rechtgläubigen Landsleuten nicht behaupten konnte, die den herben Apfelwein der Gegend und derbe Späße im Wirtshaus dem Minnedienst an ihren sehnsüchtigen Gattinnen oder Verlobten vorzogen.
Für Marie mit ihren vierzehneinhalb Jahren stellte ein sie vergötternder Ehemann reiferen Alters kein Lebensziel dar. Als sie zu Beginn ebenjenen Sommers die Volksschule ihres Dorfes mit den besten Noten abschloß, die jemals ein Schüler oder eine Schülerin dort bekommen hatte, stand sie vor dem Nichts. Ihr Lehrer, der acht Jahre lang ihren Lebensweg begleitet hatte und sie im vertraulichen Gespräch mit dem Pfarrer als den talentiertesten jungen Menschen bezeichnete, der ihm jemals unter die pädagogischen Finger gekommen war, mußte resigniert erkennen, wie wenig eine Begabung nutzen konnte, wenn sie dem falschen Boden entsprossen war. Über den Pfarrer versuchte er, Marie im nahe gelegenen Kloster der Ursulinen unterzubringen. Doch als man dort von Maries unehelicher Geburt erfuhr und vom unbußfertigen Gemütszustand ihrer Mutter, die niemals versucht hatte, die eigene Schande in eheliche Bahnen zu lenken, winkte man ab: Man könne es den ehrbaren Eltern der anderen Schülerinnen nicht zumuten, ihr argloses Kind auf der gleichen Schulbank zu wissen wie eine Frucht der Sünde, mochte sie noch so begabt sein. Auch Luzifer war intelligent und verführerisch gewesen. Und doch hatte der Herr ihn verdammt. Wer die Sünde nicht energisch von sich wies, wurde von ihr angesteckt wie von einer Krankheit. Erbarmen mit einer Sünderin war Komplizenschaft mit dem Bösen und dem Herrn ein Greuel.
Es gab keinen Platz für Marie, der ihr auch nur die leiseste Hoffnung erlaubt hätte, dem Haus ihrer Mutter in eine Umgebung zu entfliehen, in der sie mit ihrer Begabung sich selbst und der Welt von Nutzen sein konnte. In einem letzten, fast schon resignierten Versuch ging der Lehrer zu Maries Mutter und fragte sie nach Namen und Verbleib ihres einstigen Liebhabers, mit dem sie meinte den Himmel entdeckt zu haben und doch nur die Realität gefunden hatte.
»Bellago«, antwortete die Mutter leise. Der Name war kein Geheimnis im Dorf. Noch immer kam im Herbst der alte Dr.Bellago mit seinen Freunden für ein paar Tage in das Jagdhaus am Waldrand in Sichtweite des kleinen Hauses der verachteten Kindsmutter. Die gnädige Frau und der junge Sohn ließen sich jedoch nicht mehr blicken, seit »dieser peinliche Unfall passiert war«, wie es die Mutter des verführten Jungen zu formulieren pflegte.
»Könnte diese Familie Marie denn nicht helfen?« drängte der Lehrer. »Ganz diskret, wenn Sie wollen. Wenn Sie es erlauben, kümmere ich mich darum.«
Doch Maries Mutter musterte ihn mit einem Blick so kalt wie die Behandlung, die sie selbst erfahren hatte. »Wagen Sie bloß nicht, sich einzumischen!«
So erwirkte er schließlich nur, daß Marie eine Stellung in der Stadt bekam. In Linz, wo, wie der Lehrer wußte, ihr Vater lebte, mochte das etwas bewirken oder nicht. Nur fort von hier! dachte er. Alles, was sie hier erreichen kann, ist, die Magd ihres eigenen Onkels zu werden und zu guter Letzt einen rotgesichtigen Bauerntölpel zu heiraten, der ihre Vorzüge so lange als Fehler brandmarken wird, bis sie sich selbst mit seinen Augen sieht und haßt, was in Wahrheit wunderbar an ihr ist.
Zu seiner Erleichterung stimmte Maries Mutter seinem Vorschlag zu. Auch der Onkel war einverstanden. Nur Marie selbst wehrte sich zuerst. Sie konnte sich nicht vorstellen, ihre Mutter zu verlassen. Der Radius ihres bisherigen Lebens hatte nie weiter gereicht als zwei Gehstunden von ihrem Dorf. Ihre einzige Reise hatte sie nach Salzburg geführt: zur Firmung mit ihrem Onkel als Paten. Doch die Erinnerung daran war getrübt. Am Abend des großen Tages war der Onkel so betrunken gewesen, daß sie ihn nur mit Mühe zu dem Zug zerren konnte, der sie beide zurückbrachte. Erst gegen Morgen endete der Marsch vom Bahnhof zu seinem Anwesen. Die Uhr, die er Marie zur Feier des Tages und zum ewigen Angedenken geschenkt hatte, war unterwegs verlorengegangen. In einer ersten Aufwallung von Reue versprach der Onkel Ersatz, doch dann vergaß er es, und Marie war zu stolz, ihn daran zu erinnern. Manchmal, an langen Winterabenden, ließ sie mit ihrer Mutter jenen Tag und jene Nacht noch einmal aufleben. Wenn sie dann in pathetischen Worten schilderte, wie sie den Onkel vom Bahnhof nach Hause geschleppt und er ihr schluchzend geklagt hatte, wie schwer er es doch im Leben habe, konnten sich Marie und ihre Mutter ausschütten vor Lachen, und sie kamen sich reich und glücklich vor, ohne daß sie erklären konnten, warum.
Erst jetzt, in der großen Villa in der großen Stadt, begriff Marie, daß es die Liebe zwischen ihr und ihrer Mutter gewesen war, die sie beide damals so froh gestimmt hatte. Ein wärmendes Gefühl der Eintracht, das sie nie erwähnten, weil es ihnen nicht einmal bewußt war. Trotzdem fehlte es Marie, wenn sie nun in ihrem schwarzen Kleid mit dem weißen Kragen leichtfüßig durch die Räume des fremden Hauses eilte und für das Wohl von Menschen sorgte, denen sie gleichgültig war. Ein blütenweißes, gestärktes Häubchen umschloß ihre Stirn, damit nur ja keine widerspenstige Locke nach vorne falle. Die Dienstbotenhaube – das schmückende Diadem der kleinen Hausmädchen, das Krönchen ihrer Selbstverleugnung und ihres Verzichts, das sie vom Trost der Gleichrangigkeit ausschloß: so eng um die Stirn, das Tor zur Welt!
Zwölf Schilling im Monat bezahlte man Marie als Lohn, gerade so viel, daß sie sich nach einem Jahr für ihren ersten Besuch bei der eigenen Familie anständige Kleider und Schuhe kaufen konnte. Viel mehr würde sie nicht benötigen, denn ihre neue Welt war das Haus ihres Dienstherrn, und der bot ihr ein sicheres Dach über dem Kopf und genug zu essen. In einer Zeit, in der die Bettler an den Hauswänden lehnten und die ausgesteuerten Arbeitslosen vor den Suppenküchen Schlange standen, war das schon viel und mußte dem Dienstherrn mit Dankbarkeit, Gehorsam und Fleiß vergütet werden.
»Du mußt dir deinen Zopf abschneiden!« bemerkte die gnädige Frau schon am ersten Morgen. »Du hast viel zu viele Haare. Wie willst du die in deiner kleinen Waschschüssel da oben im Zimmer waschen? Und gepflegt müssen sie sein. In diesem Haus ist alles gepflegt.«
Marie machte einen Knicks, wie Amalie es ihr inzwischen beigebracht hatte. Sie schwieg. Am nächsten Morgen steckte sie ihr langes Haar zu einem straffen Knoten auf, der die gnädige Frau glauben lassen sollte, die störrische Fülle wäre nun ordnungsgemäß entfernt, wie es sich bei einem einfachen Dienstmädchen gehörte.
2
Der Name der Familie lautete Horbach. Sie bestand aus vier Personen, die für Marie eigentlich keines Namens bedurft hätten. Für sie hatten sie nur der gnädige Herr zu sein, die gnädige Frau, das gnädige Fräulein und der Herr Notar, der allerdings anders hieß als die anderen, weil er der Vater der gnädigen Frau war. Er war zu alt, um noch zu praktizieren, doch sein Titel war ihm geblieben als Erinnerung, Trostpflaster und Unterscheidungsmerkmal zu Gleichaltrigen, die auch nicht mehr in der Lage waren, mit ihrer Arbeitskraft nützlich zu sein, die aber in den Jahren der Jugend und der Energie einen weniger prominenten Platz in der Gesellschaft eingenommen hatten.
Für Amalie und Marie war der Herr Notar kein gnädiger Herr. In ihrer Welt gab es nur einen einzigen gnädigen Herrn: den Herrn des Hauses, der – das fand Marie erst nach einigen Wochen heraus – ebenfalls Notar war, ja sogar der unmittelbare Nachfolger seines Schwiegervaters. In späteren Jahren würde auch er vielleicht in der Obhut seiner Tochter und eines notariellen Schwiegersohns leben und in der Hierarchie des Haushalts vom gnädigen Herrn zum Herrn Notar absteigen – eine Gesetzmäßigkeit, die Marie von ihrem ländlichen Hintergrund her vertraut war, wo auch der vermögendste und stolzeste Bauer im Auszugshaus endete, um jeden Morgen das Pflaster im Hof zu fegen und in der schläfrigen Hitze der Sommernachmittage die Wiegen der Enkelkinder zu schaukeln, während sich die jungen Leute draußen auf dem Feld abrackerten und, wenn sie zurückkehrten, es im Bewußtsein der eigenen Kraft den Daheimgebliebenen fühlen ließen, daß jetzt sie die Herren waren, die nicht vergessen hatten, daß der große Mann von einst sie nicht immer mit Güte behandelt hatte.
Der Herr Notar war der erste, der am Morgen Maries Dienste beanspruchte. Er lag noch im Bett, wenn sie sein Zimmer betrat, die Vorhänge zurückzog und den rechten Fensterflügel öffnete. Mit einem raschen Knicks und einem höflichen »Guten Morgen, Herr Notar!« postierte sie das Frühstückstischchen über seinen mageren Körper im weiß-blauen Nachthemd, zog das Kissen hinter seinem Rücken hoch, damit er sich bequem dagegenlehnen konnte, und beantwortete kurz und sachlich seine allmorgendliche Frage nach dem Wetter, das hinter den Blättermassen der Platane vor dem Fenster vom Bett aus nicht einzuschätzen war.
Zu dieser frühen Stunde schien der Herr Notar ein uralter Mann zu sein. Dünnes, weißes Haar umgab zerzaust sein blasses, verschlafenes Gesicht. Mit einer Hand tastete er unsicher den Nachttisch nach seiner Brille ab. Er war noch müde genug, zuzulassen, daß Marie seine Suche unterbrach, ihm mit einer nachsichtigen Bewegung die Brille auf die Nase setzte und die Bügel hinter seinen Ohren verankerte. Während sie sich über ihn beugte, fiel ihr jeden Morgen der ranzige Geruch des Alters auf, den er verbreitete, der aber nach dem morgendlichen Bad und dem ausgiebigen Gebrauch von Rasierwasser tagsüber nicht mehr zu bemerken war. Unter den Freunden der Familie galt der Herr Notar als unverwüstlich und trotz seiner schwachen Augen als immer noch rüstig. Vor Marie, die ihm den Morgentee brachte, weil erst sein Kreislauf in Gang gesetzt werden mußte, bevor er das Bett verlassen konnte, enthüllte sich schon an ihrem ersten Arbeitstag sein wahrer Zustand. Sie nahm es mit dem stoischen Gleichmut hin, mit dem die Landbevölkerung den steten Verfall allen Lebens ertrug.
Wenn sich um Punkt sieben die Familie im Speisezimmer versammelte, war der Herr Notar nicht mehr wiederzuerkennen. Sein weißes Haar, noch feucht vom Bade, zeigte die Spuren des Kamms in schmalen Streifen, die vom Scheitel ausstrahlten, als wären sie mit dem Lineal gezogen worden, um zu demonstrieren, daß auch darunter noch Zucht und Ordnung herrschten. Obwohl er das Haus nicht verlassen würde, war er sorgfältig, beinahe dandyhaft gekleidet. Anstelle einer Krawatte trug er einen locker gebundenen Seidenschal, der seinen Hals bedeckte, dessen Falten ihn beschämten. Jeden Morgen ein anderer Schal, aber immer in kräftigen, fast grellen Farben. Er frühstückte ausgiebig – zwei Tassen Tee, ein frisches Brötchen mit Butter und Marmelade und ein weiches Ei – und fragte seinen Schwiegersohn, der sich, hinter der Zeitung vergraben, mit einer einzigen Tasse Kaffee begnügte, ständig nach den neuesten Nachrichten. Er selbst konnte die Zeitung nur noch mit Hilfe einer Lupe lesen und verbrachte seine Vormittage damit, sich mühsam über den Schreibtisch gebeugt über die Welt zu informieren, mit der er außer bei den allmonatlichen Treffen seiner Studentenverbindung keinen direkten Kontakt mehr pflegte.
Der Schwiegersohn – der gnädige Herr – gab nur unwillig Antwort. Er hatte es eilig, die Zeitung auszulesen. Eigentlich, fand Marie, hatte er es immer eilig. Eilig, das Haus zu verlassen. Eilig, das Essen serviert zu bekommen, wenn er zu Mittag heimkehrte, Hut und Aktentasche auf den Stuhl neben der Tür warf und sich von Amalie aus dem Mantel helfen ließ. Danach hatte er es eilig, das Essen, das in stundenlanger Mühe zubereitet worden war, hinunterzuschlingen, wobei Amalies schlimmste Stunde schlug, wenn die Suppe einmal zu heiß geraten war und die notarielle Zunge Schaden nahm. Mit seiner Ungeduld gelang es ihm, die ganze Familie in Trab zu halten, wobei ihn seine Frau immer wieder besorgt an seinen schwachen Magen erinnerte, der ihm bereits zwei tiefe Furchen in den Wangen eingetragen hatte und einen ständigen Druck im Oberbauch, den er mit einer Handvoll hastig eingeworfener Tabletten bekämpfte. Mit dem Glas Wasser dafür stand Amalie nach jedem Mittagessen schon hinter der Tür. Dann half sie ihm schnell wieder in den Mantel, als wäre er ein Kind, reichte ihm die Aktentasche und sah ihm kopfschüttelnd nach, wie er die Treppe hinuntersprang und hinaus zu seinem Auto eilte.
Das Aufatmen seiner Familie folgte ihm. Die gnädige Frau und das gnädige Fräulein ließen sich die abgeräumten Teller des Nachtischs noch einmal bringen, naschten hier und da, entspannten sich und kicherten leise über den Herrn Notar, der immer wieder einnickte. Zum Schluß zündete sich die gnädige Frau noch eine Zigarette an und rauchte sie in einer langen, sündigen Spitze aus Elfenbein. Alles ging jetzt langsam und behaglich vor sich, während der gnädige Herr zweifellos zur gleichen Zeit seine Angestellten erbarmungslos in der Kanzlei hin und her scheuchte.
Mutter und Tochter gingen miteinander um wie Freundinnen. Sie hatten die gleichen Interessen– Kino vor allem, Mode und Kosmetik. Die Tochter, Elvira, besuchte die gleiche Schule wie früher ihre Mutter. Zwei von Elviras Lehrern waren sogar ehemals Lehrer der gnädigen Frau gewesen und erklärten übereinstimmend, die Horbach-Tochter sei kein bißchen anders als ihre Mutter – was diese erfreut als Kompliment auffaßte und bei jeder sich bietenden Gelegenheit zitierte. Es entzückte sie, wenn ein Schmeichler galant behauptete, man könne sie für Elviras Schwester halten, und sie scheute keine Kosten und Mühen, den Glanz ihrer Jugend zu pflegen und zu bewahren.
Obwohl ihr Ehemann Bedenken äußerte, behandelte sie ihre weiße, makellose Gesichtshaut jeden Abend mit einer Flüssigkeit, die sich »Radium-Skin-Water« nannte und in der Tat 0,008Milligramm Radium enthielt. Der Beipackzettel versprach, daß der Inhalt der Flasche – deren Preis Maries Jahresverdienst bei weitem überstieg – bis zum letzten Tropfen seine Strahlenenergie beibehalten würde. Wie bei einem heiligen Ritual tränkte Beate Horbach jeden Abend vor dem Schlafengehen zwei Wattekompressen mit dem edlen Saft, der eigens für sie aus England geschickt wurde, und betupfte damit ihre Haut – unter den Augen vor allem, wo sich nach längeren Abenden und mehreren Zigaretten die ersten Spuren der Erschöpfung zeigten. Um die Wirkung des Radiums noch zu verstärken, bedeckte sie bei ihrem gewohnheitsmäßigen Nachmittagsschlaf ihr Gesicht auch noch mit einer sogenannten »Radium-Silk-Mask«, einem Radium ausstrahlenden Seidentuch – ebenfalls aus England, was ihr besonderes Vertrauen einflößte, da die britischen Damen doch in aller Welt für ihren makellosen Teint gerühmt wurden. Fast glaubte sie, die jung erhaltende Wirkung des Radiums zu spüren, dessen Strahlungskraft wie durch Zauberei in ihr Hautgewebe drang. Wenn sie sich nach einer Stunde wieder erhob, lief sie gleich zum Spiegel. Jedesmal meinte sie dann, den erhofften Effekt erzielt zu haben, und gewann so die Überzeugung, dem Alter für immer trotzen zu können: ein Gefühl, das sie stolz machte und sie über die dummen Frauen mitleidig lächeln ließ, die solche Mittel nicht benutzten und längst alte Weiber sein würden, wenn sie selbst immer noch aussah, als wäre sie ihre eigene Tochter. Den Einwänden ihres Mannes begegnete sie mit Spott und missionarischem Eifer. Wenn er behauptete, die Mittel wären Humbug und bestenfalls nutzlos, bewies sie ihm mit Hilfe eines der Packung beigefügten radiumempfindlichen Papiers, daß das kostbare Element bereits tief in ihre Haut eingedrungen war und sich dort festgesetzt hatte, so daß diese schon selbst eine Strahlung aussandte und so auf immer dem Alter widerstehen würde.
Als Ehefrau war sie ihrem Mann nützlich. Sie liebte es, auszugehen und Kontakte zu pflegen. Einmal in der Woche wurden abends Gäste geladen. Für diese Aufgabe führte Frau Horbach einen Zettelkasten, in dem sie dokumentierte, wer wann und mit wem eingeladen worden war, welches Menü man serviert und welche Garderobe und welchen Schmuck sie selbst bei diesem Anlaß getragen hatte. Dieser Zettelkasten war in der ganzen Stadt berühmt und trug der Frau Notar den Ruf einer disziplinierten Hausfrau und kompetenten Gastgeberin ein. Die übrigen Arbeiten wurden von Amalie erledigt und nun auch von Marie.
Elvira, in der Tat zierlich und blond wie ihre Mutter, war bei den Einladungen der Eltern nicht zugegen. Ihre Einführung in die bürgerliche Gesellschaft der Stadt stand erst noch bevor. Wie Marie zählte Elvira noch nicht ganz fünfzehn Jahre. Im Winter sollte sie einen Tanzkurs besuchen, der von ihrer Schule gemeinsam mit dem Knabengymnasium veranstaltet wurde, damit schon in frühen Jahren die richtigen Jungen mit den richtigen Mädchen zusammentrafen. Frauenoberschule hieß das Institut, in dem Elvira fürs Leben lernte. »Kochlöffelakademie« nannte es der Herr Notar und beklagte, daß die Schülerinnen dort nicht einmal in Latein unterrichtet wurden, der Grundlage aller Bildung und allen logischen Denkens. Bei diesen Worten horchte Marie auf. Sie wußte nicht warum, aber auf einmal hätte sie am liebsten geweint. Mit Abneigung und Neid blickte sie auf die Gleichaltrige, die sich rühmte, während ihrer gesamten Schulzeit noch keine Zeile mehr gelesen oder geschrieben zu haben als unbedingt nötig. »Möglichst viel durch möglichst wenig!« sei ihr Motto, sagte sie einmal gähnend zu Marie, während diese ihre am Vorabend abgelegten Kleider vom Boden aufsammelte. »Warum bist du ausgerechnet Hausmädchen geworden? Ist dir wirklich nichts Besseres eingefallen?«
Bilder einer fremden Stadt
1
Es regnete. Ein warmer Sommerregen mit schweren Tropfen, die sich auf den trocknen Pflastersteinen vor der Horbach-Villa schon im Augenblick ihres Auftreffens zu münzgroßen Tupfen ausbreiteten. Für kurze Zeit schien die Auffahrt von einem gepunkteten Teppich bedeckt zu sein. Dann flossen die Kreise ineinander zu einer einheitlichen, vor Wärme dampfenden Fläche.
Marie, die zum ersten Mal seit ihrer Ankunft das Haus ihrer Dienstgeber verließ, erwog kurz, umzukehren und Amalie um einen Schirm zu bitten; doch dann ging sie weiter. Dies war ihr freier Tag. »Morgen nachmittag hast du Ausgang«, hatte ihr die gnädige Frau am Vorabend mitgeteilt. Der Ton ihrer Stimme ließ keinen Zweifel daran, daß es sich bei diesem sogenannten Ausgang nicht um ein Recht handelte, sondern um eine Pflicht. Man erwartete, daß der fremde Hausgenosse an diesem halben Tag keinen der legitimen Bewohner mit seinem Anblick oder auch nur mit seiner versteckten Gegenwart oben im Mädchenzimmer behelligte. Ausgang: das hieß, der sonst so Unentbehrliche gehörte für ein paar Stunden nicht mehr dazu. Niemand rechnete mit ihm. Er hatte zu verschwinden, selbst wenn er nicht wußte, wohin eigentlich.
Aus der ruhigen Platanenallee, deren schläfrige Abgeschiedenheit nur selten durch Fahrzeuglärm gestört wurde, trat Marie hinaus in den Trubel einer breiten Straße, die so lang war, daß ihr Ende weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu erkennen war. Hohe Bürgerhäuser säumten sie; Geschäftsgebäude mit Auslagen im Erdgeschoß; Gaststätten und Konditoreien mit Tischen und Stühlen auf dem Gehsteig und voll mit Menschen, die aßen, tranken und sich unterhielten; über den Dächern in einiger Entfernung ein paar barocke Kirchtürme. In der Mitte der Straße verliefen die Schienenstränge einer elektrischen Straßenbahn, an denen all die Gebäude und vielleicht sogar die ganze Stadt aufgereiht schienen wie – so hatte der Herr Notar es einmal formuliert – wie die Zähne an einem falschen Gebiß. Die Tramway hatte Amalie das großstädtische Verkehrsmittel genannt, das Linz von Norden nach Süden zugleich durchschnitt und verband. Ratternd und klingelnd und zu jeder Tageszeit vollgestopft mit Menschen, rumpelten die Waggons von Haltestelle zu Haltestelle. Manchmal legten sie einen Zwischenstop ein, um einzelnen Passagieren den Weg abzukürzen.
Auch an ihrem ersten Tag in der Stadt war Marie, vom Bahnhof kommend, durch diese Straße gegangen, die Landstraße, wie den Schildern unter den Hausnummern zu entnehmen war. Diesmal schlug sie jedoch die entgegengesetzte Richtung ein, wobei sie sich immer wieder bestimmte hervorstechende Gebäude oder einzelne Geschäfte einprägte, um den Weg zurück ganz sicher wiederzufinden und sich mit der neuen Heimat nach und nach vertraut zu machen.
Es hatte aufgehört zu regnen. Die Sonne befreite sich aus den Wolken. Innerhalb weniger Minuten verdampfte alle Feuchtigkeit auf den Pflastersteinen. Marie öffnete die beiden obersten Knöpfe ihres schwarzen Kleides und rollte die Ärmel hoch. Zum ersten Mal seit einer Woche, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, war sie frei. Erst um acht Uhr wurde sie zurückerwartet, nicht früher und nicht später. Sie fragte sich, was sie mit den vielen Stunden dieses Nachmittags anfangen sollte, wo sie doch niemanden hier kannte, den sie hätte besuchen oder mit dem sie sich hätte treffen können.
In den vergangenen Tagen hatte sie kaum einen Augenblick Ruhe gefunden, um über ihr neues Leben nachzudenken. Abends war sie zu müde dafür gewesen. Kaum hatte sie sich das rot-weiß gewürfelte Federbett über die Ohren gezogen, war sie auch schon eingeschlafen. Wenn am Morgen der Wecker schrillte, schreckte sie hoch, bedrückt von einer vagen Erinnerung an schlechte Träume, von denen sie nicht einmal mehr den Inhalt wußte. »Vielleicht wirst du Heimweh bekommen«, hatte ihre Mutter sie vorgewarnt, als sie zum letzten Mal mit Marie über die Felder ging. »Gib nicht auf! Es wird schon wieder aufhören. Man gewöhnt sich an alles, und hier hast du keine Zukunft.«
Damals hatte Marie diesen Worten entnommen, daß in der fremden Stadt sehr wohl eine Zukunft auf sie wartete, was auch immer das bedeuten mochte. Eine Veränderung ihres Lebens zum Guten wahrscheinlich, zu Erfüllung und Glück. Während sie aber nun, nach sieben Tagen Dienst und Nichtbeachtung, die endlose, schnurgerade Straße entlangschlenderte und der Durst sie zu plagen begann, fragte sie sich, was das für eine Zukunft sein sollte, in der sie Tag für Tag die gleichen Handgriffe ausführte und es nichts gab, was sie besser verstehen lernte.
Wohl war sie einer neuen Lebensweise begegnet. Bürgerliche Menschen, wie sie sie bisher nie getroffen hatte, ließen sie ins Innerste ihres Alltags blicken. Es machte ihnen nichts aus, sich vor ihr Blößen zu geben, denn eigentlich zählte sie nicht. Schon diese eine Woche, dachte Marie, hätte ausgereicht, sich ein Bild von der Wesensart dieser Menschen zu machen. Daß sie sich in nächster Zeit wahrscheinlich all die Handgriffe und Kniffe der Haushaltsführung aneignen würde, begeisterte sie nicht. Kochen, Putzen, Flicken… Da fiel ihr das Bücherzimmer ein, in dem der Herr Notar seine schwachen Augen marterte, und sie dachte, daß dies der Platz wäre, an dem sie glücklich sein könnte. Ein Raum, nur zum Lesen gedacht, zum Schreiben und zum Nachdenken. Ein Raum voller Bücher, in dem es nach altem Papier roch und seltsamerweise nach vertrockneten Blumen.
Daheim, bei ihrer Mutter, war sie bisher noch zur Schule gegangen. Der Lehrer hatte ihr erlaubt, sich in der Schulbibliothek und auch in seiner eigenen, viel freigeistigeren, zu bedienen, wann immer sie wollte. Wenn sie die Bücher dann zurückbrachte, fragte er, was ihr aufgefallen sei und welche Erkenntnisse sie daraus gezogen habe. Während sie redete – glücklich, sich austauschen zu dürfen–, reichte er ihr aus einer Blechdose einen der Butterkekse, die ihm seine Mutter einmal im Monat schickte: handtellergroße, runde Fladen mit gezacktem Rand, auf die mit Kirschmarmelade ein Teigring geklebt war, der in der Mitte einen glänzenden Klecks der Marmelade frei ließ. Obenauf eine dicke Schicht Puderzucker, die ihre Spuren auf Maries Oberlippe hinterließ. Der Lehrer beobachtete Marie, wie sie den Keks in kleinen Bissen genußvoll verzehrte. Er selbst mochte keine Süßigkeiten, aber das hatte seine Mutter auch nach dreißig Jahren noch nicht herausgefunden.
In der Auslage einer Konditorei entdeckte Marie auf einem mit Papierspitze bedeckten Glasteller ein Häufchen genau dieser Kekse, nur daß sie schöner und professioneller aussahen als die der Lehrersmutter. Linzer Augen stand in Zierschrift auf einem Schild davor. Marie wäre am liebsten hineingegangen, um sich wenigstens einen der Kekse zu kaufen, doch das Preisschild neben dem Namen schreckte sie ab. Ein andermal, dachte sie. Nicht gleich beim ersten Ausgang Geld verschwenden!
2
In der strahlenden Sommersonne erschien ihr die Stadt friedlich und heiter – ganz anders, als sie es sich zu Hause vorgestellt hatte. Dort kamen immer noch fast täglich verhärmte, schlechtgekleidete Menschen aus der Stadt mit Rucksäcken und großen Taschen und boten den Bauern Ringe, Halsketten und Armbänder an. Angeblich alles Erbstücke und von hohem, zumindest ideellem Wert; Geschenke aus einer glücklicheren, helleren Zeit, die nun gegen einen Ranken Speck oder ein saftiges Stück Frischfleisch eingetauscht werden sollten; gegen goldene Butter, goldenen Honig, goldenes Brot oder goldenes Sauerkraut. Mit schmalen, beschämten Händen ließen die Fremden die letzten Reste ihrer guten Jahre auf den Stubentisch der Bauern gleiten und priesen an, was sie sich aus dem Herzen reißen mußten. Bittsteller, die in Wahrheit die Gebetenen verachteten. »Diese Ohrringe hat meine Mutter zu ihrer Hochzeit bekommen.« – Als ob das die bedächtigen Kinder der Scholle interessiert hätte!
Trotzdem wechselten die Juwelen ihren Besitzer. Kaum ein Bauer, der nicht oben, im ungeheizten Schlafzimmer, Schuhschachteln voll mit Schmuckstücken aufbewahrt hätte, ineinander verschlungen wie ein Nest von Nattern. Wenn man hineinfaßte, fühlte es sich an wie billiger Draht. Kein Leben darin. Keine Wärme. Keine Erinnerung an zärtliche Blicke, Dankbarkeit oder schlechtes Gewissen.
Manchmal, im Winter, wenn es wenig zu tun gab, holten die jungen Bauersfrauen die Schachteln herunter in die Stube und probierten die Juwelen der Stadtleute an: die Ringe, die zu klein waren für ihre kräftigen Finger; die Armbänder aus Gold; die Uhren, die sich nicht mehr in Gang setzen ließen; die Halsketten aus perlenden Tränen und die Ohrringe dazu, die den sonnengegerbten Gesichtern nicht schmeichelten, sondern ihnen einen harten, vulgären Zug entlockten, der ihnen sonst nicht zu eigen war. Schwielige Hände drehten das glitzernde Diadem einer kleinen Ballkönigin hin und her und legten es dann ratlos beiseite, um nach einem goldbestickten Fächer zu greifen, der einst verborgen hatte und enthüllt, gelockt und abgewiesen. Ein Orden des toten Kaisers fiel zu Boden und blieb unter dem Tisch liegen, unbeachtet, trotz der Gefahren und der Opfer an Leib und Leben, für die er verliehen worden war.
Zeugnisse der Begierde und der Prahlerei. Beweise von Liebe und Sehnsucht, Verehrung und Tapferkeit. Die Not hatte sie zum Tauschmittel herabgesetzt, genauso wie die kostbaren Teppiche aus Persien und China, die nun keinen städtischen Salon mehr zierten, sondern wie riesige Stoffwürste in den Ecken dämmriger Scheunen aufgeschichtet lagen, lästig, weil sie den Arbeitsgeräten den Platz wegnahmen. Oben auf dem Dachboden dann die Pelze, aus denen noch der verwirrende Duft französischer Parfüms emporstieg, so betäubend, daß keine der Bauersfrauen ihn aushalten konnte. Zusammen mit einem Säckchen Lavendel verbannten sie die stinkenden Tierhäute in eine Kiste unter dem Dach und froren im Winter lieber, als sich in eines der teuren Stücke zu wickeln, das soviel wert gewesen war wie ein kleiner Topf Schmalz und eine Flasche Kornschnaps.
Auch für die Gläser und das Geschirr fand sich keine sinnvolle Verwendung. Nichts davon paßte in die bodenständige Umgebung; alles störte, weil es daran erinnerte, daß man sich darauf eingelassen hatte, gute, eßbare Werte herzugeben für den Tand einer untergegangenen Kaste, die den Sturz der Monarchie und den Krieg mitzuverantworten hatte und die eigene Armut danach. Waren es nicht immer nur die Stadtleute, die Politik machten? Die sich im Parlament herumzankten und sich nebenbei mit unehrenhaften Geschäften bereicherten? Die Parteien bildeten und das Volk aufhetzten, bis es sich in den Straßen zusammenrottete und Blut floß? Die Stadtleute, die so klug daherzureden verstanden, daß man keine Antwort darauf wußte. Die Stadtleute, die sich mit fremden Regierungen einließen und dann zerstritten, bis es wieder einmal Krieg gab. Krieg: Dann erinnerte man sich auf einmal wieder an die Bauern. Die Requirierungskommandos zogen durch die Dörfer, bemächtigten sich der jungen Söhne, auf deren Arbeitskraft die Alten angewiesen waren, und schickten sie vor die Kanonen der Feinde, als ob nicht schon der dreijährige Militärdienst als Tribut ans Vaterland ausgereicht hätte. Wenn zuletzt alles vorbei war, wollte man es nicht gewesen sein, kam mit Rucksäcken angekrochen und bettelte um Brot. Kam mit ausgebrannten Augen, die die Macht gesehen hatten, den Luxus und nun das Elend. Kam und bestach mit eitlem Tand, Zeichen des Reichtums, wo es doch schon in der Bibel hieß, eher käme ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel.
Nun erst, da sie selbst im Besitz der Symbole des Reichtums waren, fühlten die Bauern, daß diese in ihrer Welt keinen Wert besaßen. Für sie zählte der ewige Wechsel der Jahreszeiten und die eigene Beständigkeit in der Bestellung der Felder und der Aufzucht des Viehs.
Von einem Tag auf den anderen ließen sie sich auf keine Hamstergeschäfte mehr ein. Sie hetzten ihre Hunde auf die Herren von einst und aßen ihren Speck lieber selbst. Die Kostbarkeiten, die nun einmal da waren, bewahrten sie auf. Seit 1914 hatte man gelernt, daß sich die Zeiten ändern konnten. Vielleicht erholten sich die Hungerleider von heute irgendwann einmal wieder und wollten ihren Krempel zurückhaben. Dann ließ sich vielleicht doch noch ein lohnendes Geschäft damit machen, und es würden endlich einmal die dummen Bauern sein, die zuletzt lachten!
3
Dort, wo einst ein Stadttor gestanden hatte, verengte sich die Straße und öffnete sich nach ein paar Schritten wieder zu einem weiten Platz, der am anderen Ende den Blick auf einen grünen Hügel freigab, den eine zweitürmige Kirche krönte. Obwohl Marie den Platz zum ersten Mal betrat, erkannte sie ihn wieder nach den Bildern, die der Lehrer in der Schule gezeigt hatte. Sie wußte noch, daß der Platz mehr als zweihundert Meter lang und sechzig Meter breit war und daß die hohe, barocke Säule in der Mitte die Heilige Dreifaltigkeit darstellte und vor zweihundert Jahren nach der Ausrottung der Pest von den Überlebenden zum Dank errichtet worden war.
Alles war wie auf den Bildern in der Schule, dachte Marie, und doch auch wieder ganz anders. Viel höher und weiträumiger. Kein Motiv eines Malers, der die Schönheit seiner Stadt rühmen wollte, sondern ein Platz voller Menschen, voller Bewegung, voller Lärm und Gerüche. Die linke Seite lag im Schatten. Auf die rechte brannte die Sonne nieder, so daß sich die Auslagen hinter ihren herabgerollten Markisen zu verkriechen schienen und die Passanten entweder auf die Schattenseite flüchteten oder sich an den Hauswänden entlang von Sonnendach zu Sonnendach drückten. Sie alle schienen genau zu wissen, wohin sie wollten, und keiner von ihnen sah aus wie die Stadtleute, die Marie zu Hause kennengelernt hatte. Vielleicht war es der Sommer, dachte sie, der für ein paar Monate das Elend verbarg. Wer nicht fror, war schon viel weniger arm.
Sie ließ sich treiben. Die Menschenmenge schob sie vorwärts, hinaus aus der Geschlossenheit des Platzes bis zur Donaubrücke. Noch nie hatte Marie ein solches Verkehrsgewühl erlebt, und noch nie hatte sie einen so mächtigen Strom gesehen. Stahlblau glänzte das Wasser unter der Brücke und schien Maries Blicke und dann auch sie selbst zu sich hinunterzusaugen, während sie sich übers Geländer beugte und die Strudel und Wirbel an den Brückenpfeilern betrachtete. In einiger Entfernung näherte sich mit dumpfem Tuten ein mit Kohle beladener Lastkahn. Für Marie war es wie ein Blick aus der Enge ihres bisherigen Lebens hinaus in die weite Welt. Sie atmete den Geruch des Wassers und wagte kaum, sich zu bewegen, als sich eine Schwalbe ganz dicht neben ihrer Hand auf das Geländer setzte und ein paar Schritte hin- und hertrippelte, bevor sie sich zum Wasser hinunterschwang.
»Was macht ein so hübsches Mädchen ganz alleine?«