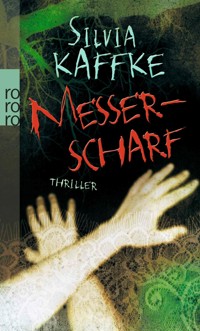9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lina-Kaufmeister-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Dunkle Zeiten im Land von Stahl und Kohle Ruhrort 1861: Lina hat es geschafft: Wie viele hat sie die Aufbruchstimmung genutzt und sich selbständig gemacht. Ihr kleiner Modesalon ist in aller Munde. Doch dann werden plötzlich gleich zwei Morde verübt. Und während des traditionellen Maiballs plündert jemand die Villen reicher Bürger. Die Taten betreffen ausschließlich Linas Kunden. Misstrauen schlägt ihr entgegen. Gestern noch eine angesehene Bürgerin Ruhrorts, muss Lina nun ihre Ehre verteidigen. Doch nicht nur ihr Ruf steht auf dem Spiel ... «Mit angenehmer Leichtigkeit präsentiert Silvia Kaffke umfangreiches historisches Hintergrundwissen. Ihre Beschreibungen sind so plastisch, dass man sich unversehens mitten in den engen Gassen der Ruhrorter Altstadt wiederfindet. Die Mischung aus Atmosphäre, historischen Fakten und krimineller Handlung sorgt für vergnügliche Lesestunden.» (Krimi-Couch) «Dynamisch und ohne Pause treibt Silvia Kaffke den Roman zum Höhepunkt, die Auflösung kommt danach in kleinen Dosen.» (Observer)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Ähnliche
Silvia Kaffke
Das dunkle Netz der Lügen
Historischer Kriminalroman
Für die Alte Schmiede am Werfthafen – eines der ältesten Gebäude des Ruhrorter Hafens – und die Gründer des Vereins «KulturWerft Ruhrort e.V.» Norbert van Ackeren, Wolfgang van Ackeren, Dirk Grotstollen, Heinz Martin, Eckart Pressler, Prof.Dr.Sabine Sanio und Prof.Dr.Jochen Zimmer, die auch nach dem verheerenden Brand und dem Teilabriss versuchen, sie zu retten und zu erhalten
Prolog
Eine mondlose Nacht hatte sich über die Altstadt von Ruhrort gesenkt, nur wenige Laternen erleuchteten die Gassen. Der Frühling ließ auf sich warten, Ende Februar hatte noch einmal starker Frost eingesetzt, und in den Nächten wurde es empfindlich kalt.
Vielleicht war das der Grund dafür, dass es gegen zehn Uhr abends bereits still wurde auf den Straßen. Nur in den zahlreichen Kneipen drängten sich noch die Gäste, kaum einer hatte Lust auf den kalten Heimweg.
Aus einer Kneipe stolperte ein Betrunkener, ein kleiner Mann ohne Jacke mit zerbeulter Mütze. Ihm folgte ein stattlicher Kerl, der seinen Schlapphut tief ins Gesicht gezogen hatte. «Nicht hier», knurrte er den Betrunkenen an. «Du kennst den Treffpunkt.» Dann verschwand er um die nächste Ecke.
In der eisigen Nachtluft wurde der Mann mit der Mütze gleich ein wenig nüchtern. Er fror erbärmlich und ging über den Hof zurück in den Gastraum. Das Bier, das ihm von seinen johlenden Freunden angeboten wurde, verschmähte er, griff sich seine Jacke und machte sich auf den Weg.
Kurz darauf hatte er bereits die Deichstraße überquert und war in die Ludwigstraße eingebogen. Über die Fabrikstraße ging es weiter Richtung Norden aus der Stadt heraus, und bald hatte er die beleuchteten Straßen der Neustadt hinter sich gelassen.
Er fluchte, weil er keine Laterne bei sich hatte. Die unbefestigte Straße mit ihren Löchern und vereisten Pfützen im Finstern zu gehen war nicht ganz ungefährlich, aber ihm blieb nichts anderes übrig. Vorsichtig lief er auf die Lichter des Phoenix-Werkes zu, dann vorbei am Hebeturm und am Bahnhof, bis er schließlich wieder in völliger Dunkelheit am Rheindeich stand. In der Ferne sah er noch ein paar Lichter im Dorf Laar.
Schweigend wartete er an der verabredeten Stelle. Kälte kroch an ihm hoch. In seiner Jackentasche fühlte er ein paar eiskalte Münzen, nur Pfennige, wie er wusste. Heute Abend hatte er in der Kneipe sein letztes Geld versoffen. Aber vielleicht konnte er hier heute Nacht noch etwas verdienen. Er trat mit den Füßen und schlug die Arme um sich. Langsam könnte der Kerl kommen…
Und dann, wie aus dem Nichts, stand der Mann mit dem Schlapphut plötzlich neben ihm, breitschultrig und mindestens einen Kopf größer als er. Er hatte eine Laterne bei sich, die er aber kurz zuvor gelöscht haben musste.
«Du willst also unser Geld?», sagte der Mann leise.
«Was muss ich dafür tun?», fragte der Kleine zaghaft.
Da waren Schritte zu hören. Der andere schaute sich um, doch als er merkte, dass keine Gefahr drohte, flüsterte er dem Kleinen etwas zu.
«Aber ich muss niemanden töten, oder?»
Der Schlapphut lachte heiser. «Wenn du gesehen wirst – ja. Wir können nicht riskieren, dass man uns entdeckt.»
Dem Kleinen schien das nicht recht zu sein.
«Wir können auch jemand anders fragen», sagte der Schlapphut und wandte sich zum Gehen.
«Nein, nein, schon gut.» Der Kleine hielt ihn am Arm zurück. «Ich mache es. Natürlich kostet das ein wenig», schob er etwas unsicher nach.
«Hundert Gulden ist uns das wert.»
Der Schlapphut verstand das Schweigen des Kleinen richtig. «Das sind nicht ganz dreißig von euren Thalern.»
«Das ist viel Geld», sagte der Kleine.
«Bist du einverstanden?» Die Stimme des Schlapphuts klang abwartend.
In diesem Moment begann auf dem Phoenix der nächtliche Hochofenabstich und tauchte alles in hellrotes Licht. Die beiden konnten einander deutlich erkennen.
Der Schlapphut streckte die Hand aus, und der Kleine schlug ein. Dann gab er ihm den Beutel mit dem Geld. «Das ist die erste Hälfte, die zweite gibt es nach erledigter Arbeit. Sieh zu, dass es in den nächsten Tagen passiert. Wir warten nicht gern. Und vor allem: Halt den Mund!»
Als würde er das rote Licht des Abstichs scheuen, zog er sich in den Schatten des Deichs zurück und sah dem Kleinen nach, der sich langsam auf den Weg zurück in die Stadt machte. Noch erhellte der Schein des geschmolzenen Eisens seinen Weg.
Als er erloschen war, trat auch der Schlapphut wieder aus dem Schatten. Er entzündete seine Laterne. Um seinen Mund spielte ein zufriedenes Lächeln. Nun konnte es losgehen.
5.März 1861
1. Kapitel
Es war ein kalter Märzmorgen, der Frühling schien noch sehr weit hin zu sein, denn es hatte seit vier Wochen kräftigen Nachtfrost gegeben. Das war auch der Grund, warum der seltsame kleine Leichenzug, der die Altstadt Richtung Friedhof verließ, erst heute unterwegs war, obwohl die verrückte Kätt schon am Freitag der Schlag getroffen hatte. Zum zweiten und zum letzten Mal.
Manch einer, der den roh zusammengezimmerten Holzsarg sah und die dicke Martha mit dreien ihrer «Wäscherinnen» und zwei Mägden dahinter, hätte sich gewundert, dass es Kätt war, die zu Grabe getragen wurde. Denn seit sie vor mehr als drei Jahren zum ersten Mal der Schlag getroffen hatte, war die alte Säuferin und Bettlerin nicht mehr auf Ruhrorts Straßen gesehen worden. Diese letzten Jahre hatte sie in einem Bett verbracht, das man in einem Verschlag hinter Marthas Haus aufgestellt hatte. Hier kümmerten sich Martha und einige der Mädchen um die Kranke.
Offiziell wuschen Marthas Mädchen die dreckige Wäsche von Ruhrort, und um diese Fassade aufrechtzuerhalten, taten manche von ihnen diese Arbeit wirklich. Aber eigentlich war der Betrieb das beste und feinste Bordell der Stadt, und dies schon seit vielen Jahren. Auch Kätt hatte einmal zu Marthas Huren gehört, bevor sie zu trinken anfing und später verrückt wurde. Martha, die ihre Geschäfte stets mit der nötigen Härte betrieb, hatte sich erweichen lassen, Kätt, die manchmal in der Küche und beim Wischen der Gastzimmer ausgeholfen hatte, aufzunehmen. Seit einigen Jahren bereits war Kätt nicht mehr verrückt, ihr Wahn war einer stillen Melancholie gewichen, seit sie begriffen hatte, dass ihr Kind zwölf Jahre zuvor wirklich im Rhein ertrunken und tot war. Doch vom Branntwein hatte sie nicht mehr lassen können.
Als der Zug an der Einmündung der Ludwigstraße angekommen war, warteten dort der katholische Pfarrer Mancy mit einem alten Messdiener, der ein Kreuz trug, und daneben Polizeicommissar Robert Borghoff mit seiner Frau Lina. Der Pfarrer ging voran, und die Borghoffs schlossen sich an. Lina nickte Martha kurz zu, die nickte in stillem Einverständnis zurück. Beiden war es wichtig, dass Kätt ein würdiges Begräbnis bekam.
Einen Tag nach dem Tod der Bettlerin, am frühen Samstagabend, gleich nach Sonnenuntergang, war die dicke Martha zum Haus der Borghoffs in der Harmoniestraße gekommen. Das Hausmädchen Antonie hatte ihr geöffnet und sie gebeten, im Salon des Geschäftes zu warten. Die meisten Kleidermacher in der Stadt weigerten sich, für eine Hure zu schneidern. Aber Lina hatte da keine Bedenken, solange Martha sich diskret verhielt.
Als Lina in den Salon kam, fiel ihr auf, dass Martha sich nicht einmal hingesetzt hatte.
«Sie wollen sie einfach an der Friedhofsmauer verscharren…», begann sie ohne Begrüßung. In ihren Augen standen Tränen.
Lina runzelte die Stirn. «Wovon sprechen Sie? Wen wollen sie verscharren?»
«Sie haben es noch nicht gehört, Frau Borghoff? Die Kätt ist gestern Abend gestorben. Meine Magd wollte sie füttern, aber dann hat sie die Augen verdreht und war tot.»
«Nun hat die arme Seele Ruh.» Lina sagte das sehr ernst.
«Sie soll ein Armenbegräbnis bekommen. Eingenäht in einen Sack direkt in die Erde, ohne christlichen Segen…» Martha blickte auf den Boden. «Ich würde die zwei Thaler für einen Sarg und die drei Silbergroschen für den Pfarrer ja zahlen, aber in diesen Zeiten muss auch ich auf mein Geld sehen.»
«Wie wir alle, liebe Frau Bromann.» Lina war eine der wenigen in Ruhrort, die Martha mit Nachnamen ansprach.
«Zwei Silbergroschen kann ich zahlen. Sie haben doch auch immer zu Kätts Lebensunterhalt beigetragen, seit sie nicht mehr betteln konnte…»
Lina seufzte. «Auch mein Geschäft geht nicht gut, seit die Wirtschaftskrise begonnen hat. Ich muss sehen, wie ich mich und meine Angestellten durchbringe.» Sie griff in ihren Rock und zog ein kleines Geldtäschchen heraus. «Vier Silbergroschen von mir.» Sie zählte sie Martha in die Hand. «Welcher Pfarrer soll sie denn beerdigen?»
Martha zuckte die Schultern. «Kätt war wohl katholisch.»
«Ich werde meinen Mann bitten, mit Pfarrer Mancy zu sprechen, sie kennen sich gut.» Commissar Borghoff ersetzte seit einiger Zeit den verstorbenen dritten Mann in der wöchentlichen Skatrunde der beiden Ruhrorter Pfarrer.
«Und wo soll ich das übrige Geld herbekommen?», fragte Martha.
Lina überlegte kurz. «Ich schicke jemanden zu Levin Heinzmann.»
Martha sah sie völlig verblüfft an. «Heinzmann? War er etwa…»
Lina schüttelte den Kopf. «Nein, wegen ihm hat Kätt nicht angefangen zu trinken. So blauäugig zu glauben, dass der Sohn eines reichen Kohlenhändlers sie heiraten würde, war selbst sie damals nicht. Aber er hat sie sehr gemocht, das müssten Sie doch noch wissen.»
Martha nickte versonnen. «Das ist alles so lange her.» Sie griff Linas Hand. «Ich hoffe, dass Sie das Geld von ihm bekommen. Sie mag ja eine Hure und Säuferin gewesen sein. Aber einfach verscharrt zu werden hat sie nicht verdient.»
«Das hat niemand.» Lina drückte ihr die Hand und sah ihr fest in die Augen. Trotz der traurigen Umstände musste sie lächeln, und Martha lächelte zurück. Wenn das die braven Ruhrorter wüssten, dass sich die Inhaberin des feinsten Damensalons am Ort, noch dazu die Gattin des hiesigen Polizeichefs, mit der geschäftstüchtigsten Bordellwirtin verbündet hatte, um einer stadtbekannten Bettlerin und ehemaligen Hure ein würdiges Begräbnis zu bereiten! Sollen sie es doch wissen, dachte Lina. Mir ist das herzlich egal.
«Frau Bromann, bitte geben Sie mir Bescheid, wann die Beerdigung stattfindet. Ich möchte daran teilnehmen», hatte sie entschlossen gesagt. Und nun ging sie hinter den Huren und Bordellmägden her, die trotz aller Versuche, dezente Kleidung zu tragen, für das protestantische Ruhrort immer noch wie Paradiesvögel aussahen. Levin Heinzmann hatte das restliche Geld ohne zu zögern dazugegeben, als ihr Hausmädchen Finchen ihn in ihrem Namen darum bat.
Bald standen sie an dem ausgehobenen Grab, das die Friedhofsdiener am gestrigen Nachmittag unter Mühen aus dem gefrorenen Boden gekratzt hatten, und lauschten dem kurzen Gebet des Pfarrers und den paar Sätzen, die er über arme Sünderinnen und Sünder zu sagen hatte. Sie warfen mit einem Schippchen etwas Erde auf den Sarg, und dann war alles vorbei. Die kleine Trauergesellschaft zerstreute sich schnell. «Wir sollten noch einen Schnaps auf sie trinken, und dann gehen alle zurück an die Arbeit!», hörte sie Martha sagen, die rasch mit ihren Mädchen verschwand. Lina konnte es ihr nicht verdenken.
Polizeiinspektor Ebel stand mit dem jungen Polizeidiener Kramer an der Fähre nach Duisburg im Ruhrorter Westen. Kramer hatte vor zwei Wochen seinen Dienst begonnen, und Commissar Borghoff hatte Ebel damit betraut, ihn einzuweisen. Sie ließen sich die Papiere der Fährgäste zeigen. Um diese Zeit am Morgen waren die Handwerker und Arbeiter, die auf der anderen Seite der Ruhr wohnten und zur Arbeit im Phoenix-Stahlwerk oder einem der anderen Ruhrorter Betriebe unterwegs waren, längst an ihren Arbeitsplätzen, und die Bauern aus Neudorf, Duissern, Huckingen und Kaßlerfeld standen auf dem Markt. Mit geschultem Blick sortierte Ebel die Fahrgäste des Bootes vor: ein, zwei betuchte Geschäftsleute, drei junge Männer in schon leicht verschossenen Anzügen mit Mappen unter dem Arm, die wohl auf einem Botengang waren, zwei Hausmädchen mit adretten Hauben, die Besorgungen für ihre Herrschaften erledigten, und ein paar Damen und Herren, die vermutlich Freunde und Familie in Ruhrort besuchten.
Aber das war nur die Minderzahl. Die meisten Passagiere schienen Ebel weitaus weniger rechtschaffen. Ein paar wandernde Handwerker, die langsam zur Plage wurden, und auch einige junge Männer, die wohl auf der Suche nach Arbeit im Stahlwerk waren, der Rest der Ankömmlinge waren recht zerlumpte Gestalten, darunter eine Familie, deren hohlwangige Gesichter ihre Armut schon von weitem kündeten. Der Familienvater hatte eine Geige geschultert.
Ebel winkte die meisten der braven Bürger durch, sie waren ihm persönlich bekannt, einen der Boten fragte er nur nach seinem Dienstherrn. «Ich arbeite für Herrn Carstanjen aus Duisburg, ich bin neu», sagte der und lief hochrot an.
Ebel winkte ihn durch und wandte sich an Kramer: «Kontrollieren Sie die Papiere der Handwerker. Wenn sie keine Arbeit finden, müssen sie die Stadt binnen drei Tagen wieder verlassen. Dasselbe gilt für die Arbeiter. Sagen Sie ihnen, wenn sie zum Phoenix wollen, ist es das Beste, wenn sie sich in Laar melden und nicht in Ruhrort bleiben. Ich glaube kaum, dass der Phoenix schon wieder Leute einstellt.»
Wegen der großen Krise war das Werk, das erst wenige Jahre in Betrieb war, in Schwierigkeiten geraten und hatte im letzten Jahr fast die Hälfte der Belegschaft entlassen müssen.
Mit größter Strenge besah sich Ebel nun die Papiere derjenigen, die er als Bettler, Hausierer und Gesindel zu erkennen glaubte. Er ließ sich viel Zeit damit, schärfte jedem der Ankömmlinge ein, dass die Polizei sie im Auge behalten würde. Jeden Namen trug er in ein kleines Notizbuch ein.
Schließlich war er bei der Familie angekommen. «Wo kommt ihr her?»
«Ursprünglich aus Coesfeld, ich habe in einer Tanzkapelle gespielt», erklärte der Mann.
«Mit der ganzen Familie?»
Der Mann sah betreten zu Boden. «Als ich kein Geld mehr schicken konnte, wurden sie aus dem Haus geworfen. Da habe ich sie zu mir geholt.»
«Und zuletzt wart ihr in Cöln?»
Der Mann nickte. «Es sind schlechte Zeiten. Da wird nicht viel getanzt.» Er sah Ebel bittend an. «Hören Sie, wir durften nur einen Tag in Düsseldorf bleiben und nur zwei in Duisburg. Wir brauchen ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Ich spiele ein bisschen für die Leute, dann können wir uns schon ernähren.»
«Wir haben selber genug Bettelvolk hier in Ruhrort.»
«Sie geben den Arbeitern und Handwerkern doch auch drei Tage Zeit! Vielleicht gehe ich auch ins Stahlwerk!»
Ebel lachte: «Mit diesen Geigerhänden?»
«Ich habe mal als Maschinenschlosser gearbeitet. In einer Textilfabrik mit Näherei. Da braucht man auch feine Hände.»
«Wenn du bis morgen Abend nichts gefunden hast, zieht ihr weiter. Und glaubt nicht, dass ich nicht herausbekomme, wo ihr euch aufhaltet.»
Die Familie zog an ihm vorbei, neun Personen. Bei der letzten, einer Frau oder einem Mädchen, das sich dicht hinter der Ehefrau hielt, streckte Ebel die Hand aus. «Halt! Gehört die zu euch?»
Die Frau des Geigers schüttelte nur stumm den Kopf. «Nur meine Frau und ich und die sechs Kinder.»
Auf den ersten Blick hätte die junge Frau gut als Kind der Geigerfamilie durchgehen können, und genau das hatte sie wohl auch beabsichtigt, als sie sich den großen braunen Schal über den Kopf geworfen hatte. Doch der schreiend bunte Rock, jede Stufe in einer anderen Farbe, gehörte wohl kaum zu der durch und durch grauen Schar der Geigerkinder. Ebel zog ihr das Tuch herunter und sah, dass sie auch kein Kind mehr war. Für hiesige Verhältnisse war ihre Haut recht dunkel, die Augen kastanienbraun und die wilden Locken, die sie nur durch ein buntes Kopftuch gebändigt hatte, kringelten sich tiefschwarz darunter hervor.
«Sieh einer an. Zigeunerin, was?»
Die kleine Person schüttelte energisch den Kopf. «Mein Vater war Italiener, ich bin keine Zigeunerin.» Das war sauberes Deutsch mit einem weichen, südlichen Unterton, der an die Tiroler Wanderarbeiter erinnerte, die jedes Jahr hier durchkamen.
Ebels Blick fiel auf das Mieder, das eine nicht sehr saubere weiße Bluse zusammenhielt. Sie verdeckte weitaus weniger, als es in Ruhrort üblich und schicklich war. «Warum wolltest du dich der Kontrolle entziehen?», fragte er. «Wir haben in Ruhrort weiß Gott genug Huren.»
Hastig griff die Frau in ihren Ausschnitt und zog dann den braunen Schal über der Brust zusammen. «Ich habe Papiere, hier. Ich bin keine Hure.»
Sie gab Ebel mehrere zusammengefaltete Blätter. Der las und runzelte die Stirn. «Zita Fredowsky, geborene Cattani. Fredowsky, was ist denn das für ein Name?»
«Mein Mann war Pole.»
«War?»
«Er ist tot.»
Die Fähre hatte wieder abgelegt. Ebel holte seine Taschenuhr heraus und warf einen Blick darauf. Commissar Borghoff wollte heute später zum Dienst kommen, was bedeutete, dass Ebel bis dahin das Kommando hatte. Und diese kostbare Zeit wollte er nicht an der Fähre vertun. «Kramer, Sie machen hier allein weiter. Immer schön freundlich zu den ordentlichen Leuten und streng mit dem Gesindel!»
Er griff Zita am Arm. «Du kommst mit. Diese Papiere muss ich mir genauer ansehen.»
Lina und Robert hatten sich vom Pfarrer verabschiedet und waren nun auf dem Weg nach Hause. Trotz ihres Gehstockes hatte sie sich noch bei Robert eingehakt, auf dem buckligen Pflaster drohte sie leicht zu stolpern. «Ich bin dir sehr dankbar, dass du mitgekommen bist, Robert.»
Als sie ihm ihren Entschluss mitteilte, zusammen mit der dicken Martha und ihren Huren an der Beerdigung teilzunehmen, hatte er mit keinem Wort protestiert, dass seine Ehefrau etwas derart Skandalöses tun wollte. «Ich hätte dich ja ohnehin nicht davon abhalten können, Lina.»
Täuschte sie sich, oder schmunzelte er? «Ich habe mir gedacht, es ist weniger schlimm, wenn ich öffentlich zeige, dass ich das Tun meiner Frau billige.»
Lina schwieg. Ihr Mann, das wusste sie, hatte ohnehin schon darunter zu leiden, dass sie selbständig ein Geschäft führte, das ihr ein Vielfaches von dem einbrachte, was er verdiente. Und sie ahnte, dass hinter ihrer beider Rücken viel darüber getuschelt wurde, wer im Hause Borghoff die Hosen anhatte. Robert schien das nicht zu stören. Solange er den Respekt des Bürgermeisters, der Honoratioren und seiner Untergebenen hatte, war ihm der Ruhrorter Tratsch gleichgültig. Dafür liebte ihn Lina umso mehr.
«Ich wäre nicht gegangen, wenn du mich darum gebeten hättest, das weißt du hoffentlich.»
«Ja, das weiß ich sehr gut.»
Sie waren in die Ludwigstraße eingebogen, die inzwischen endlich befestigt worden war. Auf der Höhe der Carlstraße, wo sich Linas Elternhaus befand, winkte ihnen Lotte, das Hausmädchen ihres Bruders, zu, das offenbar zum Altstadtmarkt wollte. Und dann waren sie bereits in der Harmoniestraße vor ihrem Haus und gingen an den Auslagen ihres Ladens vorbei, wo es immer noch Stoffe, Tuche und Kurzwaren gab. Aber eines der Fenster war nun Linas neuestem Entwurf vorbehalten. Gerade gestern hatte sie das zartblaue Sommerkleid auf die Schneiderpuppe gezogen. «Nach der neuesten Pariser Mode» stand auf dem kleinen Schild. Die Reifenkrinoline war so voluminös, dass der Rock das ganze Fenster einnahm.
Robert schloss die Tür auf, und sie gingen ins Haus.
Er half ihr aus dem warmen Cape, hängte seinen zivilen Wintermantel an die Garderobe und griff sich seinen Helm, die Uniformjacke und den Säbel.
Lina stellte ihren Stock in den Ständer neben der Tür und gab ihm einen Kuss auf die Wange. «Bis heute Mittag, Robert.»
«Bis heute Mittag, Lina.»
Sie sah ihm nach, wie er das Haus verließ, nahm dann seinen Mantel wieder vom Haken und rief Finchen aus der Küche. Die trug ihr jüngstes Kind, die zweijährige Sophie, auf dem Arm. «Bring den bitte nach oben, lass ihn aber noch auslüften.»
Finchen nickte und nahm den Mantel. «In Ihrem Büro wartet ein junger Mann, Frau Borghoff. Er sagt, der Baron von Sannberg schickt ihn.»
«Ja gut. Ich sehe aber erst bei den Näherinnen nach dem Rechten.»
Finchen war schon fast mit Kind und Mantel die Treppe hinauf, da drehte sie sich noch einmal um. «Fast hätte ich es vergessen: Da ist ein Brief angekommen – von Frau Dahlmann… Frau Verwerth, meinte ich.»
Lina schmunzelte und griff nach dem Brief, der verschlossen auf der Flurkommode lag. Clara Verwerth, die Vorbesitzerin des Stoffladens und einige Jahre Linas Geschäftspartnerin, war vor zwei Jahren mit ihrem langjährigen Ladengehilfen Wilhelm in dessen Heimatort Marl gezogen. Sie hatten geheiratet und brauchten ihr Verhältnis dort nicht wie in Ruhrort geheim zu halten. Den Laden und das Haus hatte Clara Lina gegen Zahlung einer jährlichen Leibrente überlassen.
In ihrem langen Brief erzählte Clara von den Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage auf das kleine Marl. Zwar waren die meisten Einwohner Bauern oder Landarbeiter, aber die zahlreichen Lohnweber dort hatte es hart getroffen. Clara fragte auch besorgt, ob die jährliche Rentenzahlung, die zum ersten April bevorstand, für Lina nicht zu hoch sei, und bot an, sie um ein paar Thaler zu verringern oder in zwei oder mehr Raten zu zahlen.
Doch das war nicht nötig, Lina hatte das Geld dafür längst beiseitegelegt. Dies und die Löhne für ihre Näherinnen und Angestellten waren das Letzte, woran sie sparen wollte. Es hingen ganze Familien daran. So hatte sie nur die großzügige Verköstigung eingeschränkt, es gab eben öfter dicke Suppen, seltener Fleisch und mehr Kartoffeln und Rüben aus dem eigenen Garten, den sie unterhalb der Woy gepachtet hatte.
Bei den teuren Kleidern nach Linas eigenen Entwürfen hatte es zwar weniger Aufträge gegeben als in den letzten Jahren, aber sie war sich nie zu schade dafür gewesen, Kleider umzuarbeiten und zu ändern, sodass ihr Geschäft immer noch genug einbrachte, um alle satt zu bekommen. Trotzdem wollte sie nun, wie früher Clara, die Räume unter dem Dach vermieten, um eine weitere Einnahmequelle zu haben. Sie hatte ihrem Freund Baron von Sannberg davon erzählt und vermutete, dass der junge Mann wegen eines Zimmers kam.
Das zweite Ladenlokal im Haus nebenan, das sich Lina von ihrem Erbe gekauft hatte und das mit Claras ehemaligem Haus durch einen Durchbruch verbunden war, wurde als Modesalon genutzt. Hier lagen alle bekannten Modezeitschriften, die man beziehen konnte, dazu, schön gebunden, Linas Entwürfe, und es waren sogar einige Modelle zur Ansicht ausgestellt. In den schlichten, aber gemütlichen Räumen konnten die Kundinnen bei einem Kaffee oder Tee ihre Wünsche mit Lina besprechen und Stoffe aussuchen, die der neue Ladengehilfe Christian von nebenan oder aus dem Lager holte. Vor den beiden kleinen Schaufenstern, in denen Lina nur Oberteile präsentieren konnte, standen innen elegante weiße Paravents, die die Kundinnen vor neugierigen Blicken schützten, und im kleinen Hinterzimmer fanden die Anproben statt.
Dahinter, im ehemaligen Lager, befand sich die Nähwerkstatt. Zu Linas alter Nähmaschine waren drei weitere aus Amerika gekommen. Lina beschäftigte vier Näherinnen, von denen eine die reinen Handarbeiten übernahm, vor allem die Perlenstickereien. Es gab einen großen Arbeitstisch für die Zuschnitte, einen Bügelplatz und einen Ofen, in dem die eisernen Ochsenzungen für das Bügeleisen erhitzt wurden.
Mit prüfendem Blick ging Lina an den Nähtischen vorbei. «Das ist sehr schön geworden, Anna», lobte sie eine der jungen Frauen. Dann strich sie dem Säugling, der friedlich in einem Weidenkorb lag und mit einer kleinen Rassel spielte, sanft über den Kopf. Das Spielzeug hatte sie ihm geschenkt, als Anna nach der Geburt zurück an ihren Arbeitsplatz kam. Auf Anna Jansen hielt sie große Stücke. Die junge Frau arbeitete sehr sorgfältig, war geschickt mit der Nähmaschine und verstand sich sogar aufs Zuschneiden. Deshalb bekam sie immer die anspruchsvolleren Arbeiten mit wertvollen Stoffen aufgetragen und durfte ihr Kind mit zur Arbeit bringen.
Die beiden anderen Näherinnen, Susanna und Grete, machten ihre Sache gut, doch manchmal ließen sie der Maschine ihren Lauf, und die Nähte wurden schief oder unsauber. Die vierte, Maria, war die älteste unter den Näherinnen, sie stammte aus einer verarmten Bürgerfamilie und hatte als junge Frau die feinen Handarbeiten ihres Standes gelernt. Ihr Mann war früh verstorben, und eine Weile hatte sie sich mit Handarbeitsunterricht durchgeschlagen. Als Lina ihr anbot, die feinen Stickereien und Näharbeiten in ihrem Geschäft zu übernehmen, hatte sie sofort eingewilligt. Jetzt hatte sie ein kleines, aber sicheres Einkommen und wohnte in einem gemütlichen Zimmer neben dem des Hausmädchens Antonie. Vor ein paar Jahren hatte noch der Commissar diese beiden Räume bewohnt, bevor er und Lina geheiratet hatten.
In diesen schweren Zeiten war jede der Frauen froh, Arbeit bei Lina Borghoff gefunden zu haben. Susanna und Grete hatten in einer kleinen Textilfabrik gearbeitet, bevor sie zu Lina kamen, und dort Uniformen genäht. Inzwischen hatte die große Krise auch dieses Unternehmen erreicht, die staatlichen Aufträge waren spärlich geworden, und da man die Frauen der entlassenen Stahlarbeiter für immer geringere Löhne einstellen konnte, die kaum zum Überleben reichten, hätten auch Grete und Susanna nicht mehr genug verdient, um ihre Lieben durchbringen zu können. Grete war jungverheiratet, sie und ihr Mann, der Gelegenheitsarbeiten machte, mussten aber noch den kranken Schwiegervater und den achtjährigen Bruder mit durchfüttern. Susanna hatte zehn Geschwister und half mit ihrem Lohn und oft genug auch mit Resten vom Tisch der Borghoffs, ihre Familie zu ernähren. Sicher war das, was abfiel, in den letzten Monaten weniger geworden, aber Lina hatte streng darauf geachtet, dass sie zumindest immer den vollen Lohn zahlen konnte.
So herrschte trotz der schlechten Zeiten eine heitere Stimmung in der Näherei, es wurde gescherzt und gelacht. Und solange die Arbeit darüber nicht liegenblieb, hatte die Chefin auch nichts dagegen.
Lina begutachtete den Zuschnitt, den Anna für ein leichtes Sommerkleid gemacht hatte. Er war tadellos. «Grete, du solltest bis heute Abend den Rock zusammengenäht haben. Um das Oberteil werde ich mich selbst kümmern.» Sie hatte einige raffinierte Details vorgesehen, und Anna, die Einzige, der sie es zugetraut hätte, das Stück zu nähen, war noch mit anderen komplizierten Aufgaben beschäftigt.
Sie schaute sich die Ergebnisse von Susannas Änderungen bei verschiedenen Kleidern an und nickte zufrieden. Nur ein Stück fand nicht ihre Zustimmung. Sie hielt es Susanna hin. «Die Naht musst du noch einmal auftrennen und neu nähen, sie beult sich hier.»
Susanna wurde augenblicklich hochrot. «Entschuldigen Sie.»
«Mach es noch einmal, dann ist es ja in Ordnung.» Lina lächelte. Sie genoss den Respekt, den die Mädchen vor ihr hatten, aber sie legte Wert darauf, dass sich jeder wohl fühlte in ihrem Haus.
Sie verließ die Werkstatt durch den hinteren Ausgang und ging hinüber in das kleine Büro, das sie für sich hergerichtet hatte.
Der junge Mann sprang auf, als sie den Raum betrat. «Frau Borghoff?», fragte er.
«Ja, die bin ich.»
«Ferdinand Weigel. Ich werde bei Herrn von Sannberg die Stelle eines Sekretärs antreten. Und da das Stadthaus des Barons hier in Ruhrort sehr klein ist, schlug er vor, bei Ihnen ein Zimmer zu mieten.»
Lina deutete auf den Stuhl, auf dem er bereits während der Wartezeit Platz genommen hatte, und setzte sich selbst hinter den kleinen schnörkellosen Schreibtisch. Weigel war ein hübscher Kerl, trug die blonden Haare vielleicht ein wenig zu lang und war nach der neuesten Herrenmode gekleidet. Womöglich sein einziger Anzug, dachte sie, denn er trug noch leichte Spuren von Reiseschmutz. An der Wand lehnte eine mittelgroße Reisetasche.
«Wo kommen Sie her?», fragte sie.
«Ursprünglich aus einem kleinen Ort in Thüringen. Später bin ich nach Berlin gegangen. Aber den Baron habe ich in Italien kennengelernt. Ich war dort mit meinem Dienstherrn auf Reisen. Ich wollte jedoch gern wieder nach Deutschland zurück, und deshalb habe ich dem Baron geschrieben.» Er drückte sich gewählt aus.
«Und er hat Sie bereits eingestellt?»
Weigel nickte. «Er will wieder vermehrt selbst seinen Geschäften nachgehen und braucht dabei Hilfe. Einen Teil meiner Zeit werde ich auf dem Gut in Moers verbringen, den größeren jedoch hier in Ruhrort. Über die Miete sind Sie sich ja schon einig geworden, wie er mir sagte.»
«Ja, das sind wir», lächelte Lina. Cornelius von Sannberg wusste, dass ihr das Geld sehr helfen würde, bis die Krise endgültig überstanden war. «Luxus können Sie in diesem Haus allerdings nicht erwarten. Das Zimmer ist einfach eingerichtet.»
«Solange ich es warm und behaglich habe, stört mich das nicht.»
«Dann kommen Sie mal mit.» Lina stand auf und führte ihn direkt zurück in den Flur des Hauses. Die Dienstboten wohnten alle in Clara Dahlmanns ehemaligem Haus, die Zimmer, die sie vermieten wollte, lagen bei ihr daheim unterm Dach. Sie hatte sie schon vor einigen Jahren als Gästezimmer hergerichtet, aber da ihre Verwandten ja alle in Ruhrort wohnten, wurden sie nur sehr selten gebraucht.
Geduldig hielt Weigel Abstand, bis Lina vor ihm die Treppe ins Dachgeschoss erklommen hatte. Es gab drei kleine Zimmer dort oben, in das größte, das sich über die ganze Hausfront zog, hatte der Vorbesitzer bereits eine Gaube mit zwei kleinen Fenstern einbauen lassen, sodass man von dort oben auf die Harmoniestraße hinuntersehen konnte.
Der Raum war lang und schmal mit einer tiefen Dachschräge an der einen Seite. Lina hatte ihn mit den Möbeln aus ihrem alten Zimmer im Hause Kaufmeister eingerichtet und auch etwas von der Einrichtung des Vorbesitzers übernommen. Das Bett stand unter der Schräge in der hinteren Ecke und wurde gemeinsam mit dem Waschtisch und dem unvermeidbaren Tönnchen für die Notdurft durch einen Vorhang vom übrigen Zimmer abgetrennt.
Ein gemütlicher Ohrensessel mit einer gepolsterten Fußbank stand direkt am Fenster, es gab auch einen Tisch mit zwei Stühlen, einen kleinen Ofen und einen großen Schrank.
«Sehr gemütlich», sagte Weigel. «Und vollkommen ausreichend für mich.»
«Es gefällt Ihnen also?»
Weigel trat an das Fenster und sah hinunter auf das Treiben in der Straße. «Ja, sehr.»
«Möchten Sie hier essen, oder werden Sie beim Baron etwas bekommen?»
Weigel überlegte kurz. «Wäre es möglich, das Essen gesondert abzurechnen? Ich werde mich ja auch öfter auf dem Gut aufhalten.»
«Sicher. Wir werden es aufschreiben. Möchte der Baron die Miete monatlich oder jährlich zahlen?»
«Oh, er sagte, er würde ein halbes Jahr im Voraus bezahlen.» Er griff in seine Hosentasche und zog einen kleinen Beutel heraus. «Das sind 24Thaler.»
Lina nahm den Beutel und schüttete den Inhalt, zwölf Doppelthaler, in ihre Hand. «Vielen Dank», sagte sie und ließ das Geld in ihrer Schürzentasche verschwinden. «Dann hätten wir die Formalitäten ja erledigt.» Sie hielt Weigel die Hand hin. «Herzlich willkommen im Hause Borghoff, Herr Weigel.»
Er schüttelte sie. «Danke.»
«Wann bringen Sie Ihre Sachen her?», fragte Lina.
Weigel errötete. «Die Tasche unten in Ihrem Büro ist alles. Ich habe außerdem einen Koffer, aber der ist noch unterwegs aus Italien.»
«Dann können Sie ja gleich einziehen, Herr Weigel.»
Commissar Robert Borghoff betrat seine Dienststelle im Rathaus an der Dammstraße und bemerkte gleich die junge Frau, die vor Ebels kleinem Schreibtisch saß. Und wie üblich machte Ebel sich wichtig, die Frau in den bunten Röcken saß eingeschüchtert auf dem kleinen unbequemen Hocker. Doch bevor er etwas sagen konnte, steckte der Bürgermeister seinen Kopf zur Tür herein. «Haben Sie einen Moment Zeit, Herr Commissar?»
Robert nickte und folgte ihm in die oberen Diensträume.
«Du bist spät, Robert», sagte Weinhagen.
Robert war sicher, dass er längst erfahren hatte, wo sein Polizeichef heute Morgen gewesen war. «Lina wollte unbedingt zu Kätts Beerdigung. Und du weißt, wie das ist, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat.»
«Du hättest es ihr verbieten können, Robert.» Weinhagen grinste ein wenig.
«Ihr lag etwas daran, warum hätte ich mich mit ihr über so etwas Unwichtiges streiten sollen?» Robert sah Weinhagen direkt ins Gesicht. «Wolltest du mit mir nur darüber reden, warum ich zu spät bin heute Morgen, William?»
Weinhagen lachte laut heraus. «Lass dich doch nicht so necken, Robert. Wenn Lina meine Frau wäre, würde ich es mir auch zweimal überlegen, ob ich einen Streit riskiere. Nein, ich möchte etwas anderes.» Er strahlte geradezu. «Es geht wieder aufwärts, Robert!» William Weinhagen war ein unerschütterlicher Optimist. Der besonnene Commissar sah ihn leicht zweifelnd an.
«Nicht nur dass wir begonnen haben, die neuen Hafenbecken südlich des Hafens auszuheben. Ich habe gestern Abend mit Direktor Hüffer gesprochen. Der Phoenix wird in den nächsten Monaten bis zu hundert neue Arbeiter einstellen. Und er hat versprochen, dass er bevorzugt jene einstellt, die nach der Entlassung mit ihren Familien hiergeblieben sind. Um die Gemeinde zu entlasten.»
«Es gibt aber weit mehr Arme in Laar und Meiderich als hier bei uns. Die wollen auch zu ihrem Recht kommen.»
Weinhagen nickte. «Und die Löhne sind durch die Not der Menschen noch mehr gedrückt worden, das ist kein Geheimnis. Aber ich kann dafür sorgen, dass Ruhrort zumindest einen großen Anteil der Stellen bekommt, und selbst wenn wir manche Familien weiter unterstützen müssen, bleibt mehr in der Stadtkasse.» Er deutete Robert an, sich zu setzen, und nahm selbst hinter seinem Schreibtisch Platz.
«Was ich mit dir besprechen wollte, Robert, ist Folgendes: Sobald bekannt wird, dass der Phoenix und auch die anderen Werke wieder einstellen, wird hier eine Menge Volk durchkommen. Wir müssen die Kontrollen und Registrierungen so organisieren, dass uns keiner entgeht, der sich ohne Wohnung und Arbeit hier niederlassen will.»
Robert seufzte. Mit dem neuen Polizeidiener hatte er endlich einen Personalstand erreicht, mit dem er der Menge der Ein- und Durchreisenden gewachsen war. Aber die Ankündigung des Bürgermeisters ließ erahnen, dass er wieder nicht genug Leute haben würde.
«Meinst du, es lässt sich überall so organisieren wie an der Duisburger Fähre?»
«Das würde bedeuten, dass je ein Mann an der Roskath’schen Fähre, der Aakerfähre, dem Hebeturm, am Bahnhof und an der Chaussee Posten bezieht.» Robert schüttelte den Kopf. «Dazu sind wir immer noch zu wenige. Schließlich müssen die Leute ja auch registriert werden, jemand muss die Schreibarbeiten erledigen.»
«Nun, wenn wir Geld sparen, weil wir weniger Bedürftige unterstützen müssen, dann könnte ich euch vielleicht noch einen Schreiber zur Verfügung stellen.»
«William, Ruhrort ist eine Stadt ohne Mauern, abgesehen von den Anlegestellen am Fluss gibt es keine festen Kontrollpunkte. Selbst wenn wir jeden Einfallsweg kontrollieren, es schleichen sich immer Leute an uns vorbei. Und wenn sie erst einmal drin sind – du weißt doch, die Altstadt ist wie ein Loch: Wen sie einmal verschluckt hat, den spuckt sie nicht mehr aus. Ich glaube, dass wir zurzeit schon einige hundert Bürger mehr in Ruhrort haben, als unsere Listen ausweisen.» Er dachte kurz nach. «Wir verstärken die Kontrollen an der Duisburger Fähre und konzentrieren uns auf die Chaussee und die Phoenixstraße. Von dort sind die meisten zu erwarten, die im Werk arbeiten wollen. Und dann gehen wir häufiger Streife in der Altstadt und kontrollieren die Kneipen und Unterkünfte regelmäßig.»
Weinhagen wirkte unzufrieden. «Das heißt aber, dass uns viele durch die Lappen gehen werden.»
«Weniger, als du denkst, William», sagte Robert bestimmt. «Und letztlich ist das Gesindel, das sich in der Altstadt verbirgt, doch eher meine Sache. Steuern zahlen die ohnehin nicht.»
Der Bürgermeister schien immer noch nicht glücklich zu sein, aber die nüchterne Einschätzung des Commissars war richtig. Solange sie in Ruhrort und dem durch das Phönix-Werk und andere Betriebe stark gewachsenen Meiderich mit nur vier Polizeioffizieren und sechs Polizeidienern arbeiten mussten, war es unmöglich, den Altstadtsumpf trockenzulegen und zu verhindern, dass neuer Abschaum einsickerte.
«Hast du noch etwas für mich?», fragte Weinhagen.
Robert nickte. «Die Staatsanwaltschaft wird Anklage erheben gegen den Schlosser Johann Weiler wegen Betrugs. Er wurde von mehreren Kunden angezeigt, weil er Geld genommen, aber die Arbeiten nicht ausgeführt hat. Die Stadt hatte ihm letztes Jahr eine Hilfe gezahlt, als seine Werkstatt ohne sein Verschulden ausgebrannt war. Wenn er jetzt vor Gericht steht und verurteilt wird, wirst du das Geld wohl abschreiben müssen.»
Weinhagen seufzte. «Ich setze es auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung. Die werden nicht sehr erfreut sein.»
Zita Fredowsky hatte zwei unbequeme Stunden vor Ebels Schreibtisch verbracht. Der Inspektor war zwischenzeitlich von einem Polizeidiener zu einer Marktstreitigkeit gerufen worden und mit zwei festgenommenen Bauern zurückgekehrt. Daraufhin hatte er Zita in das Gewahrsam im Keller des Rathauses gesteckt, wo in einer Ecke ein stockbesoffener Schiffer seinen Rausch ausschlief. In der anderen Ecke hockte eine nicht mehr ganz junge Hure, die einen Freier bestohlen hatte. Sie musterte Zita von oben bis unten und fragte dann: «Neu hier?»
Zita nickte nur.
«Ist hart zurzeit im Gewerbe, was?»
«Ich bin keine Hure», antwortete Zita knapp.
Die Frau lachte trocken auf. «Das kannst du denen da oben weismachen, Kindchen, aber nicht der schwarzen Eva.»
Eva war mager, und ihre Haut erinnerte an gegerbtes Leder, die glatten schwarzen Haare waren grau durchzogen. «Die werfen dich raus hier, wenn du keine Arbeit und keinen Schlafplatz nachweisen kannst. Und von ehrlicher Arbeit kann hier längst keine mehr leben, es sei denn, du kommst bei einer Patronin unter. Es gibt hier zu viele von uns.» Sie lehnte sich an die Wand. «Früher konntest du dich hier Tag und Nacht wund arbeiten. Hunderte Schiffer kamen durch, und die Arbeiter vom Phoenix und den Gießereien haben ihren Wochenlohn mit uns durchgebracht, vor allem die vielen armen Kerle, die weit weg von ihren Familien waren. Aber dann hat der Phoenix mehr als die Hälfte der Leute entlassen, weniger Stahl bedeutet weniger Schiffe im Hafen und weniger Arbeit in den Gießereien. Und weniger Freier für uns.»
«Ich bin keine Hure», wiederholte Zita noch einmal. «Nicht mehr», fügte sie dann leise hinzu.
Eva grinste breit. «Ach so eine bist du. Und ausgerechnet in diesen Zeiten willst du ehrbar werden?»
«Ich will es versuchen. Und ich habe es schon eine Weile geschafft.»
Zumindest, solange ich noch Tomasz’ Geld hatte, fügte sie in Gedanken hinzu.
«Weißt du, ich habe schon viele wie dich kennengelernt. Versuch es ruhig. Aber wenn du in Schwierigkeiten kommst, dann geh zur dicken Martha oder zur roten Katharina in der Altstadt. Du bist noch jung und sehr hübsch. Vielleicht nimmt eine von denen dich auf. Auf eigene Rechnung wird es hier schwer.»
«Danke, aber ich glaube, ich versuche es lieber auf die andere Art.»
Zita wusste nicht, wie viele Stunden sie schon im Gewahrsam verbracht hatte. Die schwarze Eva hatte ihr viel von sich erzählt und natürlich von Ruhrort. Sie war eine von denen, die ihr Wissen bereitwillig teilten, und Zita war ihr dankbar dafür, auch wenn sie hoffte, dass es nicht so weit kommen würde, dass sie sich wieder verkaufen musste.
Inzwischen war der Schiffer aufgewacht und hatte begonnen, die beiden Frauen zu belästigen, bis ein Polizeidiener ihn gegen Zahlung einer Geldbuße freiließ. Schließlich wurde auch Eva weggebracht, ins kleine Gefängnis an der Kasteelstraße. Auf sie wartete der Duisburger Staatsanwalt.
Ebel hatte Feierabend gemacht und war auf dem Weg zu Lohbeck. Wie alle Polizeioffiziere hatte er dort freies Essen und Trinken. Zwar gefiel das Commissar Borghoff nicht, weil die freigebigen Kneipenwirte immer äußerst milde behandelt wurden, wenn sie sich etwas zuschulden kommen ließen, doch da das höchst selten der Fall war, tolerierte er es. Seit seiner Heirat aß er zu Hause, holte sich nur manchmal in einem großen Deckelkrug ein Feierabendbier bei Lohbeck.
Robert saß noch an seinem Schreibtisch, als Polizeidiener Schröder mit einem angetrunkenen Mann hereinkam. Sein rechtes Auge war zugeschwollen, die Lippe blutete. An Schröders Uniform war ein Knopf abgerissen, aber sonst schien er unversehrt. «Er hat in der ‹Laterne› in der Altstadt eine Schlägerei angefangen», erklärte Schröder. «Den anderen konnte ich leider nicht mitbringen, der wird gerade vom alten Bleiweiß zusammengeflickt. Sieht übel aus, aber Bleiweiß hat zum Glück schon genug gesoffen, um ihn ordentlich zu nähen.»
«Bringen Sie ihn in den Keller, er soll erst mal seinen Rausch ausschlafen», sagte Robert. Seit den Entlassungen im Werk hatten sie fast jeden zweiten Tag eine Kneipenschlägerei. Aber wer konnte es den armen Schweinen verdenken, dass sie ihre letzten Groschen versoffen?
Als Schröder nach einer Weile wiederkam, fragte er: «Herr Commissar, was ist mit der jungen Frau da unten? Ebel hat sie heute von der Fähre mitgebracht. Er wollte etwas überprüfen, und dann hat er sie wohl vergessen. Wir können sie doch nicht mit dem Kerl zusammen einsperren…»
«Bringen Sie sie zu mir, Schröder, und dann gehen Sie nach Hause. Sie hatten einen langen Tag.» Er vermutete, dass Schröder in der «Laterne» eigentlich hatte zu Abend essen wollen, als die Schlägerei losging.
Kurze Zeit später stand Zita vor seinem Schreibtisch. Roberts Taschenuhr zeigte sieben Uhr, die Glocke von St.Maximilian hatte vor einer halben Stunde zum abendlichen Angelus-Gebet geläutet.
«Was wollte der Inspektor denn überprüfen?», fragte Robert Zita.
«Ich… ich suche hier jemanden. Einen Mann, einen Arzt. Er war ein Freund meines verstorbenen Ehemannes, und es hieß, er sei hier in Ruhrort. Deshalb bin ich hergekommen.» Und weil Borghoff darauf nichts erwiderte, fügte sie hinzu: «Ihr Inspektor hielt mich für eine Hure. Aber das bin ich nicht.»
Ein Lächeln huschte über Borghoffs Gesicht, das durch eine tiefe Narbe und das zerstörte rechte Auge recht finster wirkte. «Und wie lange sind Sie denn schon ehrbar, junge Dame?»
«Wie lange?» Sie versuchte empört auszusehen, aber dann gab sie auf. «Seit mein Mann und ich Wien verlassen haben. Er… er ist dann gestorben, aber ich habe versucht, mich mit ehrlicher Arbeit durchzuschlagen.» So ganz stimmte das nicht, weil Tomasz Fredowskys Geld nur bis Düsseldorf gereicht hatte, aber das wollte sie Borghoff nicht auf die Nase binden.
«Wie heißt denn der Freund Ihres Mannes?», fragte er unvermittelt.
«Hermann Demuth.»
«Und er ist Arzt?»
Sie nickte.
«Wir haben hier in Ruhrort zwei Ärzte, Dr.Feldkamp und Dr.Havemann.»
Zitas Mut sank. Doch dann kramte sie in ihrem Bündel. «Das ist ein Brief von meinem Mann. Er hat ihn mir kurz vor seinem Tod geschrieben.»
Sie reichte ihn dem Commissar.
«Liebste Zita», las er. «Wenn Du aufmachst diesen Brief, dann ich bin tot und kann Dir nicht mehr geben Schutz. Ich hab gehört, dass Freund Hermann jetzt sein soll oben in Norden in kleiner Stadt Ruhrort. Er wird sich kümmern um Dich, er hat Schuld bei mir. Geh zu ihm und fordere Schuld ein. Dein Dich immer liebender Tomasz»
Es waren hastig hingekritzelte Zeilen.
«Mein Mann war Pole», sagte Zita entschuldigend.
«Ich habe alles verstanden. Sie brauchen also Schutz?»
Zita schüttelte heftig den Kopf. «Das sagt man doch so, wenn sich jemand kümmern soll. Ich hoffe, ich kann eine Weile bei Hermann bleiben, bis ich Arbeit gefunden habe.»
Commissar Borghoff runzelte nicht einmal die Stirn. «Wissen Sie, wie lange er schon hier sein soll?»
«Er ist vor drei Jahren weg aus Wien.»
Borghoff stand auf. «Heute Abend werde ich unsere Registerlisten nicht mehr durchgehen können, Frau Fredowsky.»
«Muss ich dann hierbleiben?»
«Bei dem tollwütigen Kerl da unten?» Er schüttelte den Kopf. «Es gibt hier Unterkünfte. Können Sie zahlen?»
«Nein. Mein letztes Geld habe ich an der Fähre gelassen.»
«Dann versuchen wir es im Armenhaus. Für eine Nacht wird das sicher gehen.»
Zita hatte schon in Armenhäusern übernachtet, und ihr graute davor.
Im Armenhaus gab es keinen Platz mehr, spätestens seit Ankunft der Familie des Geigers war die enge Notunterkunft völlig überfüllt. Zita fürchtete, dass der Commissar sie nun doch noch der Stadt verweisen würde, aber nach kurzem Überlegen sagte der nur: «Kommen Sie mit. Sie können die Nacht bei mir zu Hause verbringen.»
«Danke», sagte Zita leise.
«Nur eine Nacht. Wenn wir Ihren Freund morgen nicht finden, werden Sie weiterziehen müssen.»
«Ja, sicher.»
Sie fragte sich, welcher Art die Wohnung des Commissars wohl sein mochte. So finster er aussah, er hatte sich als freundlicher und mitfühlender Mann gezeigt. Lebte er allein und verbrachte seine Abende einsam?
Nein, einsam war er wohl nicht. Fast alle Menschen, denen sie auf dem Weg zu seinem Haus begegneten, grüßten ihn respektvoll, sogar ein paar feine Herren in teuren warmen Mänteln und Zylindern. Schließlich kamen sie zu einem Laden, der über zwei Hausfassaden reichte. «Carolina Borghoff» stand auf einem Schild. «Stoffe und Tuche» über der einen Seite, «Damenkleider» über der anderen.
Als sie ins Haus traten, hörten sie laute Gespräche und Lachen. Borghoff nahm ihr Tuch und Bündel ab und legte beides in den Flur. Dann hängte er die Uniformjacke auf, stellte den Helm auf eine Kommode und schob Zita in eine große Küche. Rund um den größten Küchentisch, den Zita je gesehen hatte, hockten viele Frauen und drei junge Männer und an einem kleinen Tischchen in der Ecke drei Kinder – eine große, fröhliche Gesellschaft, die verstummte, als sie den Raum betraten.
Eine zierliche Frau erhob sich. «Wen hast du uns denn da mitgebracht, Robert?» Zita hatte sich eigentlich vorstellen wollen, doch als sie das Gesicht der Frau sah, schwieg sie erschrocken. Das kann nicht sein!, dachte sie.
«Einen Notfall, fürchte ich. Lina, das ist Frau Fredowsky. Ebel hat sie leider den ganzen Tag im Rathaus festgehalten, sodass die Arme sich keine Unterkunft suchen konnte. Ich dachte, sie kann in einer der freien Dachkammern schlafen, nur für heute Nacht.»
Lina kam zu ihnen und begrüßte ihren Gast; Zita sah, dass sie stark hinkte. Der Schreck fiel von ihr ab. Eine Verwechslung, Gott sei Dank eine Verwechslung! Obwohl sie sich nicht vorstellen konnte, dass es dieses schöne Gesicht zweimal geben sollte. Artig knickste sie vor der Dame des Hauses.
«Sie müssen müde sein, meine Liebe. Und hungrig!»
Zita nickte.
Wie auf ein geheimes Kommando holte jemand einen Hocker hervor und schob ihn zwischen die ohnehin schon eng stehenden Stühle. Das Hausmädchen deckte einen weiteren Teller und Besteck, ein Becher für den Tee wurde hingestellt, und schon saß Zita mitten unter den Angehörigen des Haushaltes Borghoff, zusammen mit den Näherinnen, deren langer Arbeitstag jetzt vorbei war. Es gab köstliche Bratkartoffeln, in denen sich sogar etwas Speck und aufgeschlagene Eier befanden, und für jeden eine eingelegte saure Gurke. Zita hatte das Gefühl, schon lange nicht mehr etwas so Schmackhaftes gegessen zu haben.
Die Namen der vielen Personen konnte sie sich auf die Schnelle nicht merken, aber sie bekam rasch mit, dass drei der jungen Frauen Näherinnen waren, die vierte, etwas ältere ebenfalls in der Näherei arbeitete. Das etwas mürrische ältere Hausmädchen wohnte auch hier, ebenso wie der junge Hausknecht und seine Frau, die ebenfalls Hausmädchen und Köchin war, und zu denen die drei Kinder an dem kleinen Tisch und das kleine Mädchen, das die junge Frau auf dem Schoß sitzen hatte, gehörten. Dann gab es noch den Ladengehilfen und einen weiteren Hausknecht und natürlich den Commissar und seine Frau.
Ihr selbst wurden nur wenige Fragen gestellt. Als die Näherinnen, der Ladengehilfe und der zweite Hausknecht nach Hause gegangen waren und sich die junge Familie in ihre Räume zurückgezogen hatte, ging Antonie, die Mürrische, nach oben, um das Bett für Zita herzurichten.
«Ich hoffe, der Trubel war Ihnen nicht zu viel», sagte Lina Borghoff.
«Nein. Es war schön. Ich habe schon lange nicht mehr mit solch fröhlichen Menschen zusammengesessen. Essen hier immer alle gemeinsam?»
«Ja. Mittags gibt es oft zu viel zu tun, um alle an einen Tisch zu bekommen, aber abends lassen wir den Tag gewöhnlich gemeinsam ausklingen.» Linas Blick fiel auf Zitas bunten Rock.
Verschämt sah sie zu Boden. «Ich musste nehmen, was ich bekommen konnte», sagte Zita leise.
«Nun, er ist… bunt.» Lina lachte und nahm eine Stufe des Rocks in die Hand. «Aber sehr gut genäht. Die Stoffreste sind offenbar sehr geschickt verarbeitet. Sie verstehen etwas vom Handwerk.»
«Danke.» Zita errötete. «Ich mache das sehr gern. Früher habe ich auch richtige Kleider angefertigt. Nicht aus Stoffresten, meine ich.»
Sie nahm sich ein Herz und sprach aus, woran sie den ganzen Abend gedacht hatte, nachdem ihr klargeworden war, dass sie sich in einer Kleidermacherei befand. «Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, Frau Borghoff, gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, für Sie zu arbeiten? Vielleicht nur für ein paar Wochen… oder Tage?»
Lina schüttelte bedauernd den Kopf. «Anfang letzten Jahres habe ich noch sechs Näherinnen beschäftigt. Ich musste zwei von ihnen schweren Herzens entlassen, weil ich nicht mehr so viele Aufträge bekam. Glauben Sie mir, ich würde sehr gern eine so gute Näherin wie Sie einstellen, aber im Moment verdiene ich selbst kaum genug, um die verbliebenen vier zu bezahlen.» Sie tätschelte Zita bedauernd die Hand. «Aber die Zeiten werden bestimmt bald besser. Sollten Sie noch in Ruhrort sein, wenn ich wieder jemand einstellen kann, werde ich sicher an Sie denken.»
«Wenn Ihr Mann den Freund nicht findet, wegen dem ich hergekommen bin, muss ich verschwinden. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll.»
«Nun schlafen Sie sich erst einmal richtig aus. Und morgen bekommen Sie noch ein gutes Frühstück. Vielleicht ist dieser Freund ja wirklich hier, und Sie können erst einmal bleiben», sagte Robert Borghoff, der still am Tisch gesessen hatte und jetzt aufstand. «Kommen Sie, ich bringe Sie hinauf, Antonie müsste oben fertig sein.»
Antonie kam ihnen auf der Treppe zum Dachgeschoss entgegen. «Alles erledigt, Herr Commissar», sagte sie. Und dann nickte sie Zita freundlich zu. «Es ist leider recht kalt da oben, deshalb habe ich noch eine warme Decke geholt. Schlafen Sie gut, junge Dame.»
«Danke, vielen Dank.»
Der Commissar brachte sie bis vor die Tür der kargen Dachkammer, eigentlich mehr ein Verschlag, der nach oben zu den Dachbalken offen war. Doch eine Kerze verbreitete warmes Licht, und auf einem Stuhl stand eine Schüssel und ein Krug, aus dem warmes Wasser dampfte, daneben ein einfaches Stück Seife. Das Bett hatte zwar nur eine Strohschütte, doch ein weiches Kissen und weiße Laken mit zwei dicken Decken versprachen eine gute Nachtruhe. Darauf lag sogar ein grobes Leinennachthemd.
Zita verabschiedete sich vom Commissar und ließ ihr Bündel auf den Boden fallen. Schnell zog sie sich bis auf die Unterwäsche aus, wusch sich mit dem warmen Wasser und schlüpfte dann unter die Decken. Seit Bonn, wo sie für ein paar Tage in einer Gaststube arbeiten und schlafen konnte, hatte sie nicht mehr so gut gelegen. Lina Borghoffs freundliches Gesicht kam ihr wieder in den Sinn. Und wie unmöglich es sein konnte, dass diese Züge auch noch einer anderen Person gehören könnten. Einer widerlichen, intriganten und bösartigen Person, der sie nie wieder begegnen wollte.
2. Kapitel
Als Zita am anderen Morgen aufwachte, stellte sie erschreckt fest, dass es schon heller Tag war. Schnell zog sie sich an und lief die Treppe hinunter. Im ersten Stock war ein heftiger Streit im Gange, ein oder zwei Kinder weinten. Das waren wohl die beiden jüngeren Hausangestellten. «Was hast du mit dem Geld aus dem Milchtopf gemacht?», schrie die junge Frau. «Das war meines so gut wie deines. Ich hatte es gespart, die Kinder brauchen neue Schuhe nächsten Winter.»
«Ich schufte hier den ganzen Tag. Willst du mir verbieten, ins Wirtshaus zu gehen?», brüllte der Mann zurück. «Bild dir nicht ein, du könntest so mit mir umspringen, nur weil Herr Borghoff seiner Frau alles durchgehen lässt. Was ich mit meinem Geld tue, ist ganz allein meine Angelegenheit!»
Die arme Kleine, dachte Zita. Die Männer waren doch alle gleich. Selbst ihr Tomasz hatte ein Vermögen durchgebracht mit Saufen und Spielen. Trotzdem hatte sie ihn geliebt.
Sie fand die Küche wieder. Das Haus summte bereits vor Geschäftigkeit. Antonie werkelte genauso mürrisch wie gestern in der Küche herum. «Da ist Hafergrütze», sagte sie und deutete auf den Herd. «Nicht zu tief im Topf kratzen, sie ist etwas angebrannt. Frau Borghoff hat gesagt, Sie sollen sich Honig dazu nehmen. Und es ist auch noch etwas Kaffee da.»
Im Gegensatz zur Grütze schmeckte der Kaffee gut, selbst nach Wiener Maßstäben. Während Zita schweigend die Hafergrütze aß, kam plötzlich Lina Borghoff herein. «Ausgeschlafen?», fragte sie fröhlich.
Zita wurde rot. «Entschuldigen Sie…»
«Nein, nicht doch», sagte Lina. «Sie haben sicher lange nicht mehr ausschlafen können. Sie sind doch unser Gast. Schauen Sie mal.» Sie zog ein Stück grauen, sehr dicken Wollstoff hervor. «Besonders schön ist er nicht, aber sehr warm. Und da der Frühling in diesem Jahr einfach nicht kommen will, dachte ich, Sie könnten ihn gebrauchen. Sie können ihn nachher in der Werkstatt säumen, das gibt ein schönes warmes Umschlagtuch.» Und dann legte sie eine kleine Winterbluse aus festem, warmem Wollstoff dazu – Konfektionsware, die sie im Stoffladen verkaufte. «Damit nicht immer gleich alle denken, Sie wären… na, Sie wissen schon.» Die Bluse war hochgeschlossen. «Hier ist ein kleiner Riss, den Sie sicher leicht flicken können.»
Zita traten die Tränen in die Augen. Es war lange her, dass jemand so gut zu ihr war. «Vielen Dank, Frau Borghoff, vielen Dank!»
«Gern geschehen. Wenn Sie mit allem fertig sind, können Sie aufs Rathaus zu meinem Mann gehen. Vielleicht hat er dann Ihren Freund schon gefunden.»
Mit Bedauern hatte Zita das gastliche Haus der Borghoffs verlassen. Den Rest des Morgens hatte sie noch in der Nähwerkstatt mit den anderen Frauen verbracht, sorgfältig das schwere Wolltuch gesäumt und die Bluse geflickt. Jetzt trug sie sie über der alten weißen Bluse und hatte den neuen Schal umgelegt. Es war immer noch sehr kalt draußen, aber zum ersten Mal, seit sie ihre Reise angetreten hatte, fror sie nicht mehr – zumindest auf dem kurzen Weg von der Harmoniestraße zum Rathaus.
Als sie den Dienstraum betrat, stieß sie auf Inspektor Ebel.
«Ah, ich habe mich schon gefragt, wo du geblieben bist…»
«Frau Fredowsky hat in meinem Haus übernachtet, Ebel – zwangsläufig, weil Sie die Frau so lange festgehalten haben, dass kein Nachtquartier mehr zu finden war.» Der Commissar war hinter seinem Schreibtisch hervorgekommen und bedeutete Zita, sich auf einen der Stühle davor zu setzen.
«Sie war doch gut aufgehoben im Gewahrsam», protestierte Ebel leise. Seit man ihn zum Inspektor befördert hatte, war er Kritik noch weniger zugänglich als zuvor. Aber inzwischen konnte er Borghoff gegenüber nicht mehr die Karte des Ruhrort-Erfahrenen ausspielen. Nach fast sieben Jahren kannte der Polizeichef nicht nur jeden Winkel der Stadt, sondern auch die ehrbaren Bürger und das Altstadtgesindel mindestens ebenso gut wie sein am Ort geborener Inspektor. Bis heute konnte Ebel sich nicht erklären, warum der Bürgermeister und die Honoratioren so große Stücke auf einen Mann hielten, der in seinen Augen viel zu lasch mit Lumpenpack, Schiffern und Arbeitern umging. So wie jetzt mit dieser Zigeunerdirne. Ein Polizeidiener hatte heute Morgen sogar mehrere Stunden lang die Registrierungslisten durchsehen müssen nach einem Mann, den diese Frau wahrscheinlich erfunden hatte.
Robert Borghoff kümmerte sich nicht weiter um den verstimmten Ebel, setzte sich wieder hinter den Schreibtisch und zog ein Blatt hervor. «Hermann Demuth, Hüttenarbeiter», las er vor.
«Hüttenarbeiter?», fragte Zita erstaunt. Sie erinnerte sich an Hermanns gepflegte Hände, mit denen er in Wien seine Patienten versorgt hatte. Aus Erzählungen wusste sie, wie hart die Arbeit in den Hütten war.
«Nun, so steht es hier. Die Adresse ist Milchstraße 3, allerdings ist der Eintrag schon zwei Jahre alt, vielleicht wohnt er schon nicht mehr dort. Aber vielleicht haben Sie auch Glück.»
Ein wenig Glück habe ich nach den letzten Monaten wirklich verdient, dachte Zita und bedankte sich herzlich für alles, was der Commissar für sie getan hatte. Dann bat sie ihn darum, ihr den Weg zu erklären, doch stattdessen wurde dem Polizeidiener, der ohnehin Streifendienst in der Altstadt hatte, aufgetragen, sie hinzubringen.
Als sie aus der Neustadt mit ihren geraden Straßen und gepflegten kleinen Häusern in die Altstadt kamen, war sie Borghoff sehr dankbar, dass er ihr diese Begleitung mitgegeben hatte. Nie und nimmer hätte sie sich in diesem Labyrinth von Gassen und Gässchen zurechtgefunden, durch die kein größerer Karren geschweige denn eine Kutsche passte.
Uralte Fachwerkhäuser wuchsen über manchen Gassen so zusammen, dass kaum noch ein Lichtstrahl hineinfiel. Und überall wimmelte es von Menschen. Schiffer- und Arbeiterfrauen machten Besorgungen, die kleineren Kinder auf dem Arm. Zwischendrin sah man auch das eine oder andere Hausmädchen wohlhabender Herrschaften. Bereits um diese Uhrzeit herrschte reger Betrieb in den zahllosen kleinen Kneipen und Gasthäusern. Auf dem einzigen größeren Platz standen junge Männer in Gruppen herum und schwatzten, meist Schiffer, die ein paar Tage Zeit hatten, bis sie ihre nächste Fracht oder einen Platz im Schleppverband bekamen, und es sich jetzt gutgehen ließen.
Und Huren gab es hier – viele Huren. Sie erkannten einander, Zita und die Huren. Viele abschätzende Blicke streiften die hübsche Fremde – war sie eine Konkurrenz? Wilderte sie in fremdem Revier? Und warum war sie mit einem Polizisten unterwegs?
Schließlich bogen sie in die Milchstraße ein und fanden das Haus Nummer 3.Der Polizeidiener wünschte ihr Glück und verabschiedete sich dann. Zita blickte an der grauen Fassade hinauf. Die meisten Fenster waren mit dunklen Lumpen verhängt. Vorsichtig klopfte sie an die Tür.
Als sich drinnen nichts tat, klopfte sie erneut, diesmal fester. Nach dem dritten Mal öffnete eine alte Frau und starrte sie entgeistert an. «Ja?», fragte sie so laut, dass Zita sofort begriff, dass sie schwerhörig war.
«Wohnt Hermann Demuth hier?», fragte sie.
«Häh?»
«Demuth. Hermann Demuth.» Zita schrie fast.
«Ah, Herr Demuth!», rief die Alte. «Ja, der wohnt hier. Oben unterm Dach.»
«Ist er zu Hause?»
Die Alte nickte. «Ja, aber er schläft. Hat Nachtschicht.»
«Bitte, ich muss ihn sprechen. Ich bin eine alte Freundin von ihm.»
Die Alte zögerte einen Moment, aber dann sagte sie: «Komm rein, Kind. Ich werde ihn wecken.»
Zita folgte ihr und stand direkt in einer verdreckten Küche, die noch eine Feuerstelle statt eines Herdes hatte. In einem Topf über dem Feuer brodelte etwas, das zwar nach Eintopf aussah, aber widerlich roch.
«Da geht es rauf», sagte die Alte und schlurfte voran. Sie trug ein graues verschlissenes Winterkleid und darüber eine Strickjacke. Trotzdem schien sie zu frieren, was kein Wunder war, denn außerhalb der Küche war es im Haus eisig kalt.
Über dem zweiten Stock ging es hinauf in die Mansarde, alles war klein und eng. Oben unter dem Dach gab es vier Türen, an die erste links klopfte die Alte. «Herr Demuth! Wachen Sie auf! Hier ist Besuch für Sie.»
Es dauerte eine Weile, aber dann öffnete sich die Tür, und ein verschlafenes Gesicht mit verstrubbelten Haaren sah heraus. Die Alte blieb neugierig bei ihnen stehen.
«Hermann?», fragte Zita. Sie hätte ihn fast nicht wiedererkannt, so dünn und abgearbeitet sah er aus. Kaum zu glauben, dass er in Wien der große Weiberheld gewesen war. Den «schönen Hermann» hatten sie ihn oft genannt. Ein fast zu hübsches Gesicht für einen Mann, charmante Umgangsformen, eine betörende Stimme und die Anmut eines Tänzers – jede Frau, die Zita kannte, hatte sich in ihn verguckt. Davon war wenig übrig geblieben.
Er sah sie an, als hätte er ein Gespenst vor sich.
«Ich bin es, Zita. Tomasz’ Frau.»
«Ja, sicher, Zita. Wie hast du mich gefunden?» Er schien immer noch verwirrt.
Sie zog den Brief ihres Mannes aus der Tasche. Hermann rieb sich die verschlafenen Augen, bevor er las. «Ist er tot?», fragte er, als er ihr den Brief zurückgab.
Sie nickte.
«Was willst du von mir?»
«Du hast den Brief doch gelesen.»
«Ja, schon. Aber ich kann dich nicht beschützen. Ich könnte nicht einmal mich selber beschützen. Ist der Greifer hier?»
Sie schüttelte den Kopf. «Wir haben Wien vor gut einem halben Jahr verlassen, aber der Greifer hat uns ein paar Leute hinterhergeschickt. In der Nähe von Straßburg haben sie uns erwischt und Tomasz – du kannst es dir vorstellen. Aber ich konnte fliehen. Und seitdem habe ich keinen von der Bande mehr gesehen.»
«Das hat nichts zu sagen.» Er zog die Decke, die er übergeworfen hatte, enger um sich. «Wenn du sie auf meine Spur gebracht hast, werden wir beide sterben. Geh, sieh zu, dass du dich selbst in Sicherheit bringst.»
«Ich…»
«Ich muss noch ein paar Stunden schlafen, sonst stehe ich die Schicht nicht durch. Wir reden heute Abend.»
«Dann kann ich hierbleiben?» Zitas Herz klopfte. Wenn er sie nicht aufnahm, musste sie Ruhrort spätestens morgen verlassen.
Die taube Alte hatte kaum etwas mitbekommen von ihrem Gespräch. «Kann sie bei Ihnen unten bleiben bis heute Abend?», schrie Hermann.
Sie nickte. «Ich habe gern etwas Gesellschaft. Aber fürs Essen muss sie zahlen.»
Hermann verschwand kurz im Zimmer und kam zurück mit fünf Pfennigen, die er der Alten in die Hand drückte.
«Für heute reicht das», sagte sie. «Kommen Sie, Kind», wandte sie sich an Zita. «In der Küche ist es warm.»
Am Nachmittag hatte sich bei Lina Borghoff Kundschaft im Modesalon angekündigt. Trotz der knappen Kasse hatte Antonie eine große Kanne Kaffee gekocht, und Finchen hatte einen Kuchen gebacken. Beatrice, die ältere Tochter des Barons von Sannberg, Linas gutem Freund, hatte vor einem halben Jahr Eberhard Messmer, den Stiefsohn von Linas Schwester Guste, geheiratet. Die junge Frau hatte sich in Eberhard verliebt und bereitwillig ihrem kapriziösen Leben in Berlin entsagt. Und sie schien sich sehr wohl zu fühlen in der kleinen, feinen Gesellschaft der Ruhrorter Reichen, die nach außen hin protestantisch karg und bescheiden lebte, nach innen aber gern zeigte, was sie hatte.
Auf den heutigen Besuch war Lina sehr gespannt. Zum einen wusste sie von ihrer Schwester Guste, dass Beatrice guter Hoffnung war und deshalb neue Kleider brauchte, zum anderen wurde sie von der neuen Ehefrau des Barons begleitet. Cornelius von Sannberg hatte in den letzten Jahren ausgedehnte Reisen unternommen und war nur selten auf seinem Gut in der Grafschaft Moers oder in seinem kleinen Ruhrorter Stadthaus gewesen. Lina ahnte dunkel, dass dies mit ihrer und Roberts Heirat zusammenhing. Der Baron hatte eine unverhohlene Schwäche für sie gezeigt, aber dann war ihr Robert gekommen, und sie hatte sich für den kleinen Polizisten und gegen den reichen Baron entschieden. Cornelius mochte sie – und auch Robert – zu gern, als dass er ihnen die Freundschaft aufgekündigt hätte, aber das fremde Glück ständig vor Augen zu haben war ihm wohl zu viel gewesen. Doch Lina war sich sicher, früher oder später hätte es den weltgewandten Cornelius von Sannberg auch ohne diesen Vorfall in die Fremde getrieben.