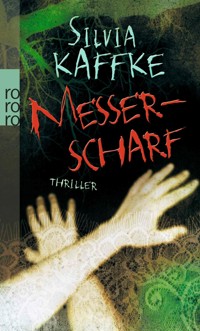
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Down and out – bisher undenkbar für Barbara Pross, Serienmordspezialistin beim BKA. Zurzeit ist sie auf eigenen Wunsch beurlaubt. In ihrer Depression unfähig, Freunde und Familie um Hilfe zu bitten, lebt sie auf der Straße. Doch ausgerechnet hier geht ein Frauenmörder um. Seine Opfer: obdachlose Frauen und Prostituierte. Bald findet sich Barbara unfreiwillig in einem Undercover-Job wieder … «Silvia Kaffke hat mit ihrem Erstling einen ganz großen Wurf gelandet.» (Rheinische Post) «Eine dicht erzählte, intelligente Geschichte mit psychologischer Tiefenschärfe.» (WAZ)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Ähnliche
Silvia Kaffke
Messerscharf
Thriller
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
«Du kommst ganz schön spät! Die Dispo hat schon dreimal angerufen, wo du bleibst.» Paul Gantner, der Vorarbeiter in der Müllsortieranlage, musste gegen den Lärm des kleinen Bulldozers anschreien, der den Müll in den Graben vor dem Band schaufelte. Der Fahrer warf den Hebel um, um auch seine Mulde zu entleeren, und sprang dann aus dem Wagen.
«Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Ärger das war bei Walkenhein», meinte er. Die Firma Walkenhein war seit fünf Monaten geschlossen, seitdem hatten die Mulden auf dem Gelände gestanden. «Der neue Besitzer des Geländes hat mich eine halbe Stunde warten lassen. Dann musste ich eine Ladung zur Müllverbrennung bringen, weil die Abdeckung des Containers defekt war und irgendwer Haus- und Sperrmüll hineingekippt hatte. Um diese Zeit ist da Hochbetrieb. Und dann wieder raus zu Walkenhein und die zweite Mulde holen …»
«Ja, ist ja schon gut», sagte Paul. «Melde dich in der Dispo, die haben wohl noch einen Extraauftrag für dich.»
Der Fahrer kletterte in den LKW, hievte die Mulde wieder auf den Wagen und fuhr in Richtung Verwaltungsgebäude. Paul dachte an seine Zigaretten. Aber hier in der Anlage war Rauchen strengstens verboten.
Der Bulldozer schob die Ladung aus der Mulde in den Graben. Langsam bewegten sich große Pappstücke, Styropor, Folien und Umreifungsbänder nach oben in Richtung Folienabscheider. An dieser Seite der Anlage wurden nur Gewerbeabfälle sortiert, es fehlte der süßliche Geruch, der nebenan in der Halle mit den Grüner-Punkt-Abfällen über allem schwebte.
In der großen Trommel des Folienabscheiders rumpelte es heftig. Paul seufzte. Obwohl nur bestimmte Stoffe in den Containern landen sollten, waren sie nur zu oft falsch befüllt. Wahrscheinlich war es eine zerbrochene Europalette, die diesen Lärm verursachte – aber nein, das Geräusch klang irgendwie dumpfer –, oder auch in diesen Container hatte man Sperrmüll geworfen. Das Rumpeln hörte auf, das schwere Teil war wohl durchgelaufen.
Paul wollte gerade hinauf in den Kontrollraum laufen, um die Anlage für die Mittagspause abzuschalten, als von oben aus der Sortierkabine plötzlich Schreie gellten. Das Band blieb stehen, jemand hatte den Not-Aus-Schalter gedrückt. Oben schrie immer noch eine Frau. ‹Ein Unfall›, schoss es Paul durch den Kopf. Seit er Vorarbeiter war, war in der Anlage noch nichts passiert, aber er kannte die Geschichten der Kollegen, die länger dabei waren. Einen Toten hatte es schon gegeben. Er stürmte die enge Metalltreppe zur Kabine hinauf und stieß oben vor der Tür beinah mit dem Betriebsleiter zusammen, der aus dem Kontrollraum gerannt kam.
Inzwischen war es still in der Kabine. Ein Blick sagte Paul, dass alle Leute an ihrem Platz waren, es war also niemandem etwas passiert. Aber alle starrten auf das Sortierband.
Was da lag, war einmal ein menschlicher Körper gewesen. Paul unterdrückte ein Würgen. Offensichtlich hatte die Leiche nicht erst seit gestern in den Abfällen gelegen, und die Trommel des Folienabscheiders hatte ein Übriges dazu getan, dass dieses Etwas grotesk verkrümmt auf dem Band lag, mit dem Kopf voran, die Füße hingen noch hinter den Plastikstreifen des Vorhangs.
«Alle raus hier», sagte der Betriebsleiter mit geradezu unheimlicher Ruhe. «Herr Gantner, gehen Sie und rufen Sie die Polizei.»
Die Sortierer drängelten sich hinaus, Paul ging zum Kontrollraum. ‹Verdammt›, schoss es ihm durch den Kopf, ‹jetzt wird die Anlage erst einmal stillstehen.› Und dann wunderte er sich, dass er an so etwas auch nur denken konnte.
Eins
Barbara Pross wachte an diesem Tag erst gegen Mittag auf. Seit ein paar Wochen hatte sie diesen Rhythmus – sie ging gegen Morgen zu Bett und schlief bis ein oder zwei Uhr. Seit der Wecker morgens nicht mehr klingelte, hatte sie sich vollständig zum Nachtmenschen entwickelt.
Sie war um halb vier nach Hause gekommen in der letzten Nacht. Obwohl sie lange genug geschlafen hatte, fühlte sie sich nicht erfrischt. Sie ging ins Bad und stellte sich unter die Dusche. Nackt und nur notdürftig abgetrocknet, kletterte sie in ihrem Schlafzimmer über Berge von Schuhen und getragenen Kleidern auf der Suche nach etwas, das sie anziehen konnte.
Sie fand einen sauberen Slip und ein Paar Socken, die an der Ferse durchlöchert waren. Dunkel erinnerte sie sich daran, dass sie die Socken hatte wegwerfen wollen, aber irgendwie waren sie in ihrer Waschmaschine gelandet, und als sie gewaschen waren, hatte sie sie wieder in die Schublade gelegt. Jetzt waren sie ihr einziges sauberes Paar. Mit einer Hose war es da schon schwieriger. Sie wühlte in dem Kleiderberg auf dem Sessel und zog dann eine Jeans heraus, die sie erst ein- oder zweimal getragen hatte. Ihre Pullis, das wusste sie, waren entweder voller Flecken oder sonst wie schmuddelig. In einer Kommodenschublade entdeckte sie ein verblichenes Sweatshirt, das schon bessere Tage gesehen hatte. Sie fuhr sich durch die feuchten Haare – eigentlich hätte sie schon seit zwei Monaten einen Haarschnitt nötig gehabt. Der herausgewachsene Kurzhaarschnitt sah aus, als hätte sich ein Amateur daran versucht.
Barbara sah kurz in den Spiegel. «Na wunderbar», murmelte sie. Ihr Blick fiel auf ein Sechshundert-Mark-Kostüm, das sie zumindest auf einen Bügel, wenn auch nicht in den Kleiderschrank gehängt hatte. Sie besaß drei davon und einen Hosenanzug. Bei der Arbeit hatte sie selten etwas anderes getragen. Lange hatte es nicht gedauert, um aus der schicken Karrierepolizistin eine unscheinbare Frau zu machen, die auf Äußerlichkeiten nur wenig Wert legte. Genau genommen hatte es nur ganze zwei Monate gebraucht – seit ihrer Beurlaubung auf eigenen Wunsch.
Ihr Magen knurrte. Sie ging in die Küche, aber sie wusste, dass der Blick in den Kühlschrank sinnlos war – sie hatte seit letzter Woche nicht eingekauft. Der Brotrest war schimmelig, und was in ihrem Kühlschrank lag, war ungenießbar. Überall stand gebrauchtes Geschirr, die Spülmaschine war auch voll. Sie musste sich etwas zu essen kaufen.
Im Flur blinkte ihr Anrufbeantworter. Es war schon länger her, dass sie ihn abgehört hatte. Es hatte sie einfach nicht interessiert. Heute war die alte Gewohnheit stärker. Sie drückte die Wiedergabetaste.
Die ersten beiden Nachrichten waren knapp: Jemand legte auf, einmal mit einem hörbaren Seufzer. Dann ihre Mutter: «Barbara, du hast dich so lange nicht mehr gemeldet. Ich weiß, du hast viel zu tun, aber bitte melde dich.» – «Barbara, hier ist Philipp. Wir vermissen dich – ohne dich kommt die Arbeit nur halb so schnell voran. Ich würde dich gerne sehen, ruf mich an.» – «Guten Tag, Frau Pross, Dr. Kernmayr hier. Sie haben schon drei Therapiesitzungen platzen lassen. Ich denke nicht, dass wir die Behandlung jetzt abbrechen sollten. Melden Sie sich in der Praxis, damit wir einen neuen Termin machen können.» – «Barbara, Kind, melde dich doch. Oder soll ich zu dir nach Frankfurt kommen?» – «Hier ist Becker. Ich arbeite für meine Vortragsreihe an der Polizei-FH gerade den Kindermörderfall nach und entdecke, dass eine der Analysen, die Sie ganz zu Anfang verfasst haben, im endgültigen Bericht nicht mehr auftaucht. Ich denke aber, dass das ganz wichtig für meinen Vortrag wäre. Wenn Sie mir also sagen könnten, ob und wo Sie sie abgespeichert haben, ich drucke sie mir dann schon aus …» – «Praxis Dr. Kernmayr, Müller …» Barbara drückte fast automatisch die Löschen-Taste. Für ihren Chef Becker war der Fall Schmidtmann also nur noch ein Lehrstück für die Polizeistudenten. Sie spürte, wie ihr Herz zu rasen begann. In einem plötzlichen Impuls riss sie das Kabel des Anrufbeantworters aus der Wand, griff nach ihrer Jacke und der Geldbörse und rannte aus dem Haus, als müsste sie den nächsten Bus bekommen.
Eine Stunde später fand sich Barbara am Bahnhof wieder. Irgendwie zog es sie immer wieder hierher, in der letzten Zeit war sie fast täglich hier gewesen. Sie hockte sich je nach Wetter vorm oder im Bahnhof auf eine Bank und beobachtete die Leute. Die Reisenden, die schnell mit ihrem Gepäck zu einem Gleis hasteten, oder die Pendler, die am frühen Abend heimwärts strömten, interessierten sie nicht so sehr. Sie schaute den Nutten, Strichern und Dealern zu, den kleinen Junkies und Taschendieben, die sich hier herumtrieben. Manchmal lachte sie in sich hinein, wenn irgendwo ein Geschäft abgewickelt wurde, das kein Reisender je als solches hätte erkennen können. Aber ihrem geübten Auge entging kaum etwas.
Anfangs hatte sie misstrauische Blicke geerntet, und die Bahnhofspenner, denen ihr Interesse weniger galt, hatten ihre Bank gemieden. Inzwischen hatte man sich wohl an sie gewöhnt und sie als harmlos eingestuft. Aber sie spürte trotzdem die starke Distanz dieser Leute. ‹Vielleicht bin ich doch noch nicht so heruntergekommen›, dachte sie manchmal.
Jetzt saß sie wieder auf einer Bank vor dem Bahnhof. Sie aß ein teures, pappiges Brötchen und holte aus einer Plastiktüte eine Bierdose. Ein blasser kleiner Stricher mit einem hübschen Mädchengesicht, der, wie sie mitbekommen hatte, auf den Spitznamen «Lolo» hörte, steuerte auf einen gepflegt aussehenden Mittvierziger zu. Lolo wirkte fahrig, wahrscheinlich brauchte er einen Schuss. Der Mann sah sich kurz um, dann nickte er und sagte etwas zu dem Jungen. Er ging über den Bahnhofsvorplatz zum Taxistand und fuhr los. Lolo schlenderte zurück in den Bahnhof. Barbara wusste, das Taxi würde am anderen Ausgang in einer Nebenstraße warten.
Sie kannte den Ablauf. Bevor sie ihre Ausbildung zum höheren Dienst absolviert hatte und zum BKA gewechselt war, hatte sie im Morddezernat gearbeitet. Sie hatte mehr als einmal Jungen wie Lolo – wie alt war er wohl? Sechzehn? Siebzehn? Oder doch erst fünfzehn? – tot gesehen: gestorben an einer Überdosis, ermordet, langsam krepiert an Aids.
Es begann zu regnen. Widerwillig stand Barbara auf und ging in das Bahnhofsgebäude. Am Zeitungsladen schrien die Schlagzeilen der Boulevardblätter auf sie ein. «Frauenleiche auf dem Sortierband – Ein neues Opfer des unheimlichen Frauenmörders von Düsseldorf?» Sie ging daran vorbei und bemühte sich, nicht hinzusehen, aber ganz gelang ihr das nicht.
«Frauenmörder von Düsseldorf»: Noch vor wenigen Wochen hätte sie genau gewusst, was für ein Fall das war. Sie hätte alle Einzelheiten über die Opfer und das spezielle Vorgehen des Mörders gekannt – die Grundlage für ein psychologisches Täterprofil. Sie hätte sie mit ihrer Datei – einer ganz persönlichen Kartei von unaufgeklärten Sexualmorden und verwandten Straftaten – verglichen, um herauszufinden, ob der Täter früher schon einmal zugeschlagen hatte. Man hätte sie offiziell damit beauftragt, oder irgendein ratloser Kollege im zuständigen LKA oder bei einer Polizeidienststelle hätte sich vertraulich an sie gewandt. Sie stand in dem Ruf, die Beste zu sein. Sie war die unumstrittene Polizeiexpertin für die Aufklärung der abstoßendsten und perversesten Fälle und bildete Polizisten auf diesem Gebiet weiter. Sie hatte fast jeden Serienmörder, der in den vergangenen Jahren in Deutschland gefasst wurde, persönlich kennengelernt.
Aber das war jetzt vorbei. Nach dem Fall Schmidtmann hatte sie einen Zusammenbruch, den sie nur mühsam vor ihren Kollegen und Vorgesetzten vertuschen konnte. Als es ihr etwas besser ging, hatte sie sich beurlauben lassen, für ein ganzes Jahr. Im Nachhinein stellte sich das als keine gute Idee heraus. Statt Abstand und Erholung zu finden, versank sie aufgrund der plötzlichen Untätigkeit nach und nach in einer Depression. Im Moment glaubte sie nicht daran, jemals wieder ihre alte Arbeit im BKA aufnehmen zu können, die doch über Jahre ihr fast ausschließlicher Lebensinhalt gewesen war. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie überhaupt jemals wieder etwas tun würde. Sie konnte nur irgendwo herumsitzen und stumm beobachten, zu wirklich sinnvollen Handlungen war sie kaum fähig, und sie wollte es auch nicht sein. Der Fall Schmidtmann war ein Fall zu viel gewesen für sie.
Barbara stand zitternd vor dem Zeitungsständer. «Ist Ihnen nicht gut?», fragte eine ältere Dame besorgt. Sie hatte sich eine Frauenzeitschrift gekauft und trug einen kleinen Koffer bei sich. «Nein, nein, alles in Ordnung», sagte Barbara. Die Dame zuckte die Schultern und ging.
‹Ich muss weg hier›, dachte Barbara plötzlich. ‹Weg aus Frankfurt, raus aus allem.› Sie tastete nach ihrer Geldbörse in der Gesäßtasche. Dann ging sie langsam zum Fahrkartenschalter und reihte sich in die Schlange ein.
«Eine Fahrkarte bitte», sagte sie, als sie an der Reihe war.
«Und wohin möchten Sie?», fragte der Schalterbeamte unfreundlich.
Einen Moment lang sah Barbara ihn verwirrt an.
Er seufzte ungeduldig. «Ihr Fahrtziel bitte.»
«Düsseldorf», sagte Barbara. «Düsseldorf.»
«Einfache Fahrt? Zweiter Klasse? Mit dem IC oder …»
«Ja.»
Er runzelte die Stirn. «Ja, mit dem IC?»
Sie nickte.
Er stellte die Karte aus und gab sie ihr. «Der Zug fährt in zwanzig Minuten vom Gleis zehn ab.»
«Danke.» Barbara hielt ihre Karte in der Hand, als wüsste sie nicht, was das war. – Was zur Hölle wollte sie in Düsseldorf? Sie würde nicht dorthin fahren. Einen Augenblick stand sie unschlüssig im Verkaufsraum, dann ging sie zurück in die Halle. Der Beamte sah ihr kopfschüttelnd nach.
Barbara lehnte sich draußen an die Wand des Verkaufsraumes. Im Bahnhofseingang entdeckte sie den kleinen Lolo, der sich nervös umblickte. ‹Ist ziemlich schnell gegangen mit dem Freier›, dachte sie. Jetzt wartete er auf seinen Dealer. Von Minute zu Minute wurde er nervöser.
Auf der großen Anzeigetafel rückte der IC nach Düsseldorf immer weiter nach oben. Schließlich stand er an der Spitze. Wenn sie noch mitfahren wollte, musste sie sich sehr beeilen. Und dann, von der einen Sekunde zur anderen, begann sie zu rennen. Etwa auf der Hälfte der Strecke hörte sie die Durchsage: «Am Gleis zehn bitte einsteigen und die Türen schließen …» Sie legte noch etwas Tempo zu. Der Zugbegleiter wollte gerade die Tür zuschlagen, ließ sie aber noch einsteigen. Es war ein Zug mit Großraumwagen. Barbara warf sich keuchend auf einen Sitz. Düsseldorf. Sie fuhr nach Düsseldorf.
Etwa gegen sieben Uhr abends fuhr der Zug in den Düsseldorfer Hauptbahnhof ein. Barbara stieg aus und stand unschlüssig auf dem Bahnsteig herum. Ihr Magen knurrte schon wieder, also ging sie hinunter in die Halle und zum Ausgang Friedrich-Ebert-Straße. Ihr kam es vor, als lungerten hier dieselben Leute herum wie in Frankfurt. Fast erwartete sie, Lolo an einer Ecke nach einem Freier Ausschau halten zu sehen.
Ein wenig die Straße hinunter fand sie eine Pizzeria und kaufte sich eine Spinatpizza und eine Literflasche billigen Rotwein. Sie hatte sich die Pizza einpacken lassen und suchte eine Weile nach einem geeigneten Platz, um sie in Ruhe zu essen. Gar nicht weit vom Bahnhof entfernt fand sie eine kleine Grünanlage mit einer Bank. Hier setzte sie sich hin und aß. Dann öffnete sie den Schraubverschluss der Flasche und trank einen Schluck. Der Wein war süß, aber zum Glück nicht ganz so widerlich, wie sie befürchtet hatte. In letzter Zeit war sie da nicht mehr so anspruchsvoll.
Sie trank langsam, aber nach der halben Flasche spürte sie doch die Wirkung. Es dämmerte und wurde kühl. Sie würde sich irgendeinen Platz zum Schlafen suchen müssen. In Frankfurt hätte sie um diese Zeit begonnen, durch die Straßen zu streifen, bis sie zum Umfallen müde war und nur noch in ihr Bett sank. Nur nicht ins Grübeln kommen, wenn es dunkel wurde. Nicht an Schmidtmann denken, den netten älteren Herrn, der ganz sanft und vorsichtig drei kleine Jungen erwürgt hatte, nachdem er sie missbraucht hatte. Der sie mit Blumen geschmückt und dann abgelegt hatte. Im Verhör um jeden Einzelnen hemmungslos geweint hatte.
Schmidtmann war längst aktenkundig gewesen, Barbara wusste, sie hätten auf ihn kommen müssen in ihren Ermittlungen. Wenn schon nicht die Kollegen in der norddeutschen Kleinstadt, dann zumindest doch sie, Barbara, die die Daten und Fakten immer so geschickt zu deuten wusste. Immer wieder hatte sie sich ablenken lassen, bis ihr plötzlich klar wurde, Schmidtmann musste der Mörder sein. Und als sie ihn festnahmen, lag gerade der dritte Junge tot in der Gartenlaube. Die Polizei hätte es verhindern können. Barbara hätte es verhindern können, wenn sie nur ein wenig schneller gewesen wäre.
«Isst du das noch?», fragte eine müde Frauenstimme. Barbara sah hoch. Vor ihr stand eine Frau in zerlumpter Kleidung mit einer kleinen alten Reisetasche, deren Henkel gerissen waren. Sie hatte einen Ledergürtel herumgeschlungen und trug sie damit.
«Was?», fragte Barbara verwirrt.
«Die Pizza.» Die Frau deutete auf den offenen Karton, in dem das letzte Viertel der Spinatpizza lag.
«Nein, bedien dich», sagte Barbara.
Die andere setzte sich und verschlang gierig die kalte Pizza. Die Frau roch ein wenig nach Schweiß, aber Barbara hatte bei den Bahnhofspennern schon Schlimmeres erlebt. Obwohl ihre Kleidung in einem sehr schlechten Zustand war, war sie einigermaßen sauber. Barbara hatte den Eindruck, auch die Frau hatte vor gar nicht allzu langer Zeit eine Dusche gesehen.
Als sie den letzten Bissen heruntergeschluckt hatte, bot Barbara ihr aus einem plötzlichen Impuls heraus die Rotweinflasche an. Die Frau schüttelte den Kopf und begann, in ihrer Tasche zu kramen. Schließlich zog sie eine Flasche Rum heraus. Erstaunt bemerkte Barbara, dass es eine sehr teure Marke war. «So ’n bisschen Rotwein wirkt bei mir nicht mehr.»
Eine Weile saßen sie schweigend beieinander und tranken, Barbara ihren Rotwein, die andere den Rum.
«Haste ’nen Platz zum Schlafen?», fragte die Frau plötzlich.
Barbara schüttelte den Kopf.
«Ich denke, Frauen sollten in diesen Zeiten zusammenhalten», meinte die Frau. «Hier geht ein Mörder um – und auf solche wie dich hat er es gerade abgesehen.»
«Solche wie mich?», fragte Barbara.
«Frauen, die auf der Straße leben. Gut aussehende Frauen.» Sie grinste, dabei entblößte sie eine Zahnlücke, der linke Eckzahn fehlte. «Obwohl – die Gabi war nich gerade ’ne Schönheit.»
«Ist diese Gabi ermordet worden?»
Die Frau nickte. «Sie war die Zweite, die sie gefunden haben. War aber mindestens schon drei Monate verschwunden. Ich hab sie gekannt. Sie ging auf’n Strich. Ist mit irgendeinem Freier mitgegangen, den sie in einer Kneipe aufgelesen hat. War bei der da bestimmt nicht anders.» Sie hatte einen Express aus dem Papierkorb neben der Bank gefischt und hielt ihn Barbara unter die Nase. «Wieder Frauenmord in Düsseldorf – Killer schlug zum dritten Mal zu», lautete die Schlagzeile. Barbara schob die Zeitung angeekelt weg. «Auf dem Band einer Müllsortieranlage wurde gestern Mittag ein grausiger Fund gemacht …», las die Frau vor, dann las sie leise weiter. «Hier steht, das Opfer hat schon mindestens fünf Monate in dem Müllcontainer gelegen.»
‹Dann ist sie vor dieser Gabi getötet worden›, dachte Barbara. Je nachdem, wann das erste Opfer umgebracht worden war, konnte man feststellen, ob die Abstände kürzer wurden … Die automatische Polizistin in ihr ließ nicht so leicht locker. Barbara schüttelte energisch den Kopf. Sie wollte nichts damit zu tun haben.
Die Frau, ein wenig enttäuscht über Barbaras scheinbares Desinteresse, stand auf und nahm ihre Tasche. «Du kannst mitkommen zu meinem Schlafplatz. Ist nicht gerade gemütlich, aber trocken und warm.»
Barbara stand auf und folgte ihr.
Es wurde ein mehr als einstündiger Fußmarsch durch Düsseldorf. Barbara, die inzwischen die Wirkung des Alkohols deutlich spürte, bekam von dem Weg kaum etwas mit. Schließlich kamen sie zu einem heruntergekommenen, offensichtlich leer stehenden Bürogebäude aus den Sechzigern, das umrahmt war von mehreren neuen Prachtbauten mit viel Glas. Die Frau sah sich um, führte sie zu einer Stelle, an der der Maschendrahtzaun um das Gelände durchtrennt war, und schlich dann um das Haus.
«Du darfst keinem verraten, wo der Platz ist», sagte sie. «Sonst hab ich nachher eine Menge Untermieter.» Sie stieg eine Kellertreppe hinunter und warf sich unten gegen die Tür, die sich quietschend öffnete. «Strom gibt’s keinen, also bleib dicht hinter mir.» Sie bogen um eine Ecke und gingen dann in einen Raum. Der Mond schien durch das Kellerfenster.
Die Frau hantierte mit etwas, und wenig später hatten sie Licht: eine Baustellenlampe, die sie offensichtlich irgendwo gestohlen hatte. «Die Decke da kannst du haben.» Sie wies auf eine ziemlich schmutzige Baumwolldecke. Überall auf dem Boden waren Pappkartons ausgelegt. An der Wand stand ein kleines Regal mit ein paar Konserven. Sie war offensichtlich ganz stolz auf ihr kleines Reich. «Ich heiße Doris», sagte sie.
«Barbara.»
«Du lebst nicht auf der Straße, oder? Siehst jedenfalls nicht danach aus», meinte Doris und setzte sich auf den Boden.
Barbara setzte sich auch. «Wie meinst du das?»
«Deine Kleidung. Und wenn du Geld für Pizza und Wein hast …»
Doris fuhr sich durch die Haare und schien sie genau zu taxieren. «Ich lebe manchmal wochenlang von Abfällen.»
Barbara sagte nichts dazu, eine Weile schwiegen beide.
«Wie bist du auf der Straße gelandet?» Barbara fürchtete fast, sie wäre zu weit gegangen, normalerweise sprachen die Penner nicht darüber, aber Doris lachte nur hart.
«Erwarte keine große, tragische Geschichte. Mein Mann hat das Weite gesucht, und weil ich anfing zu saufen, verlor ich den Job, den ich mir gesucht hatte. Ich habe meine Kinder vernachlässigt – sie kamen dann ins Heim. Und da machte es keinen Sinn mehr, die Fassade aufrechtzuerhalten … Du siehst, es braucht kein großes Schicksal, um ganz unten zu landen. Das kann sehr schnell gehen. Was meinst du, wie alt ich bin?»
«Keine Ahnung.»
«Sag schon.»
Barbara zierte sich. Doris war nicht hässlich, sah aber verbraucht und müde aus. Der Alkohol grub langsam deutliche Spuren in ihr Gesicht. Sie konnte jedes Alter zwischen dreißig und fünfzig haben. «Anfang vierzig vielleicht.»
«Ich bin zweiunddreißig – wahrscheinlich jünger als du, oder?»
«Ja – ich bin sechsunddreißig. Tut mir leid.»
«Ach was», sagte Doris. «Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie eine alte Frau. Der Alkohol ist nicht gerade ein Jungbrunnen – aber wenn du zu bist, merkst du nichts davon.» Sie hielt Barbara die Rumflasche hin. «Der wärmt besser als dein süßes Gesöff.»
Barbara nahm einen Schluck. Es war ein wirklich guter Rum. «Hast du versucht, wieder ein normales Leben zu führen?»
«Wozu? Ich werde nicht mit dem Saufen aufhören. Ich werde saufen, bis ich tot bin. Dieses beschissene Leben kann ich nur ertragen, wenn ich blau bin. Ich würde aber gern die Kinder mal sehen … Doch es ist besser, wenn sie denken, ich sei tot.» Doris sagte das ganz nüchtern, ohne jede Emotion. Sie sah Barbara an: «Und was ist mit dir?»
«Ich … ich habe etwas Schlimmes erlebt, das ich nicht vergessen kann. Ich kann nicht arbeiten, nicht mit Leuten zusammen sein. Ich kann nicht mehr so leben wie bisher, und ich weiß nicht, wie ich leben soll.»
Doris nickte. Dann meinte sie: «Halte dich von Drogen und Schnaps fern. Wenn du erst mal drauf bist, hast du keine Chance mehr. Ich weiß, wovon ich rede.»
Sie legte sich hin und breitete ihre Decke über sich, die Reisetasche war ihr Kopfkissen. Dann löschte sie die Lampe. Barbara stauchte einen Teil der großen Baumwolldecke zu einem Kopfkissen zusammen und wickelte sich in den Rest ein, der Boden schien unter ihr nachzugeben – sie hatte viel zu viel getrunken. Aber das war gut. Sie musste nicht mehr an Schmidtmann denken. Und auch nicht an Ina.
Als Barbara am nächsten Morgen aufwachte, brummte ihr Schädel. Die Sonne erleuchtete ein kleines Rechteck am Boden. Doris war weg – ihre Decke hatte sie sorgfältig zusammengefaltet. Barbara stand auf und faltete ihre Decke ebenso ordentlich, als wolle sie sich damit bei Doris für ihre Gastfreundschaft bedanken. Sie war froh, in der Nacht ein Dach über dem Kopf gehabt zu haben, aber jetzt, nüchtern und verkatert, kam sie sich unendlich schmutzig vor. Ihre Kleidung roch nach Schweiß und der muffigen Decke.
Sie musste sich irgendeine öffentliche Toilette suchen, um sich zumindest notdürftig zu waschen. Essen konnte sie nichts, ihr Magen drehte sich schon beim Gedanken daran. Sie dachte an das Gespräch mit Doris – nein, so wollte sie auf keinen Fall enden. Sie würde zurückfahren nach Frankfurt, ihren Psychiater anrufen … Automatisch fuhr ihre Hand zur Gesäßtasche, und dann zuckte sie zusammen. Die Tasche hing an einer Seite ausgerissen herunter. Ihr Geld war weg.
Sie musste es verloren haben, in der Grünanlage vielleicht, wo sie Doris getroffen hatte. Oder hatte vielleicht Doris …? Sie erinnerte sich dunkel an Doris’ Gesicht, wenn von Geld die Rede war. Rasch zog sie die Hose aus und besah den Schaden an der Tasche: Sie war fein säuberlich aufgetrennt worden. Doris hatte sie bestohlen. ‹Kein Wunder, dass sie sich solchen Rum leisten konnte›, dachte Barbara. Sie griff in die vordere Tasche und zog einen Zehnmarkschein und ein bisschen Kleingeld heraus – sie hatte das Geld in der Pizzeria einfach in ihre Tasche gestopft. Damit könnte sie wenigstens über den Tag kommen.
Barbara stolperte aus dem Keller ans Tageslicht. Die Sonne blendete sie, sie kniff die Augen zusammen. ‹Erst einmal waschen›, dachte sie. ‹Und dann zurück in diese Grünanlage, um vielleicht Doris zu erwischen und nach der Geldbörse zu fragen.›
Es dauerte länger als am Abend zuvor, den Weg zurück zum Bahnhof zu laufen. Barbara war ein paarmal um die falsche Ecke gebogen, aber schließlich sah sie ein Straßenschild.
Die Bahnhofstoilette war relativ sauber und ganz leer. Sie wusch sich Hände und Gesicht, spülte sich den Mund aus und fuhr sich mit den feuchten Händen durch die Haare, die zu allen Seiten abstanden. Der Blick in den Spiegel verhieß nichts Gutes: Die Augenringe waren noch ein bisschen tiefer geworden, ihr Gesicht noch ein bisschen blasser. Gierig trank sie von dem Leitungswasser, bevor sie ging. Die Toilettenfrau sah sie böse an, weil sie ihr kein Geld gab.
Inzwischen war sie doch hungrig geworden, aber im Bahnhof war es ihr zu teuer. Also lief sie los in Richtung Innenstadt. An einem Kiosk kaufte sie eine Flasche Mineralwasser und zwei Brötchen.
Den Rest des Tages verbrachte sie am Bahnhof, immer in der Hoffnung, Doris zu erwischen. Einen Augenblick lang dachte sie daran, Philipp in Wiesbaden oder ihre Mutter anzurufen und um Hilfe zu bitten, aber dann verwarf sie den Gedanken wieder bei der Vorstellung, wie entsetzt beide reagieren würden. Sie tat nichts, ließ einfach alles laufen.
Es wurde Abend, und ein kühler Wind kam auf. Barbara ging ins Bahnhofsgebäude, doch kaum dass es ganz dunkel war, patrouillierten verstärkt Bahnpolizisten. Es war klar, dass sie hier nicht bleiben konnte, zumal der Bahnhof irgendwann geschlossen wurde. Auch die U-Bahn war keine Alternative.
Doris’ Schlafplatz: Barbara beschloss, es dort zu versuchen. Wahrscheinlich könnte sie dann auch Doris zur Rede stellen und ihr Geld zurückbekommen. Sie lief los zu der Grünanlage und versuchte, den Weg zu finden, doch es gelang ihr nicht. Mehr als zwei Stunden irrte sie durch die Stadt – sie konnte sich einfach nicht mehr an den Straßennamen erinnern und verfluchte sich, weil sie zumindest am Morgen nicht besser aufgepasst hatte. Aber da hatte sie ja noch geglaubt, nach Frankfurt zurückzufahren.
Schließlich gab sie es auf und machte sich auf den Weg zurück zum Bahnhof. Als sie dort ankam, war es bereits gegen elf. Sie wollte nicht in das Bahnhofsgebäude, sondern setzte sich auf den Rand eines Blumenkübels. Die Bänke um sie herum waren besetzt. Es war inzwischen sehr kühl geworden, der Wind wehte stärker. Wenig später begann es heftig zu regnen. Noch bevor Barbara sich unterstellen konnte, waren Jacke und Hose völlig durchnässt.
Barbara dachte an das bisschen Kleingeld, das ihr geblieben war – wenig mehr als sieben Mark. Es musste hier Kneipen geben, die nicht schon um eins schlossen. Sie machte sich auf den Weg die Friedrich-Ebert-Straße entlang und bog dann in die Charlottenstraße ein. Ein paar Mädchen, manche minderjährig, standen herum – Straßenstrich. Die Mädchen wirkten nervös. ‹Wahrscheinlich sind hier oft Streifen unterwegs›, dachte Barbara. Sie lief an ein oder zwei Bars vorbei, schließlich fand sie in einer Nebenstraße eine Kneipe, die gerade noch als bürgerlich durchgehen konnte.
Direkt neben der Tür saßen zwei gepflegt aussehende Frauen, irgendwo zwischen vierzig und fünfzig. Sie hatten große Gläser Altbier vor sich stehen.
An einem größeren Tisch hockten vier Männer, etwa Mitte zwanzig, bei einem leisen Gespräch. Die Polizistin in Barbaras Hinterkopf vermutete, dass sie irgendein Ding ausbrüteten. Am Nebentisch unterhielten sich zwei junge Frauen mit Sonnenbankbräune und der typischen Lockentuff-Pferdeschwanz-Frisur. Einer der Männer drehte sich zu ihnen um und fragte etwas. Offenbar gehörten die sechs zusammen.
Weiter hinten saß ein dunkel gekleideter Mann bei einem Glas Rotwein – vielleicht war es der schwarze Rollkragenpullover, denn Barbara fühlte sich sofort an Fotos von Existenzialisten erinnert. Auf dem Tisch lag zwar eine Zeitung, aber die schien ihn nicht sonderlich zu interessieren. Er beobachtete von diesem günstigen Standort aus ungeniert die anderen Gäste, sehr entspannt, aber völlig bewegungslos, abgesehen vom gelegentlichen Griff zum Weinglas.
Die restlichen Gäste, drei jüngere Männer in billigen Jogginganzügen aus Fliegerseide und zwei ältere, die mit dem Wirt knobelten, standen an der Theke.
Einen Moment sahen alle Barbara an, aus deren Haaren es tropfte, dann gingen sie wieder zur Tagesordnung über. Barbara ging zur Theke, und der Wirt unterbrach sein Knobelspiel.
«Na, Mädschen, wat willste denn?», fragte er freundlich.
Barbara dachte an ihr bisschen Geld und fragte: «Haben Sie einen Tee?»
«Sischer dat. Mit enem Schuss oder …»
«Nein danke, ohne bitte.»
«Du solltest aber de nasse Jacke ausziehn, du holst dir ja dä Tod. Warte, isch hol dir en frisches Handtuch für die Haare ze druge.» Der Wirt verschwand in den Raum hinter der Theke und kam mit einem sauberen Handtuch zurück. Barbara, die inzwischen gehorsam die Jacke ausgezogen und auf einen Stuhl neben der Heizung gehängt hatte, lächelte ihn dankbar an und ging zur Toilette. Die nasse Hose klebte an ihren Beinen, in ihren Schuhen schien das Wasser zu stehen, und auch ihr Sweatshirt war ein wenig klamm. Doch sie fühlte sich schon besser, als ihre Haare fast trocken gerubbelt waren. Sie frisierte sie mit den Fingern.
Als sie zurückkam, stand der Tee auf der Theke. Zwei der Fliegerseidetypen hatten sich inzwischen verabschiedet, der dritte stand immer noch am Tresen.
«So ein Scheißwetter», sagte er zu Barbara, die ihren Tee in kleinen Schlucken trank in der Hoffnung, er würde sie aufwärmen. «Gerade scheint noch die Sonne, dann gießt es wie aus Eimern. Als hätten wir April und nicht Oktober.»
Der Mann war sicher nicht mehr ganz nüchtern, aber die meisten Sätze kamen noch klar heraus. Er war sehr groß, mindestens eins neunzig, trug einen kleinen Ohrstecker und hatte einige Pfunde zu viel, das meiste davon um die Hüften, die von der Jogginghose umspannt wurden. «Sie sind ganz schön nass geworden», stellte er fest.
Barbara nickte nur und trank weiter ihren Tee.
Das etwas schwammige, aber freundliche Gesicht des Mannes verzog sich zu einem Lächeln. «Der Tee tut sicher gut, nicht wahr?»
«Ja», sagte Barbara. Das Teeglas war leer, und ihr war immer noch nicht wärmer.
«Ich heiße übrigens Walter», sagte er und versuchte, Barbara in die Augen zu sehen. Sie war sicher, er hielt diesen Blick für leidenschaftlich.
Langsam setzte sie das Teeglas auf die Theke. «Kann ich noch einen haben, bitte?», fragte sie den Wirt.
«Willste nisch lieber doch ene Schuss drinn?», fragte er zurück. «Nur von heißem Wasser wird dir auch nisch wieder warm.»
«Wie teuer ist das denn?»
«Fünf Mark.»
Barbara schüttelte den Kopf. «Nur Tee bitte.»
Walter sah wieder eine Chance zu einem Gespräch: «Ich lade Sie gerne ein …»
«Das ist sehr nett gemeint, aber ich möchte das nicht», sagte Barbara mit einem kühlen Unterton. Sie bemühte sich, an Walter vorbeizusehen, und ihr Blick fiel auf den Gast an dem hinteren Tisch. Er saß immer noch zurückgelehnt da und beobachtete konzentriert die ganze Szene. Barbara fühlte sich unbehaglich unter diesen aufmerksamen, forschenden Augen.
«Machst du uns noch eins?» Das kam von den Frauen an dem kleinen Tisch neben der Tür. Und es klang eindeutig eine Oktave zu tief.
«Sischer, Gerda», sagte der Wirt. «Sofort.»
«Scheißschwuchteln», zischte Walter neben Barbara.
Der Wirt beachtete ihn gar nicht, zapfte die beiden Alt und brachte sie an den Tisch.
Barbara drehte ihren Kopf zur Seite, damit Walter nicht bemerkte, dass sie grinsen musste. ‹Ich lasse langsam nach›, dachte sie, ‹die beiden sind viel zu elegant für eine Kneipe wie diese.›
«Aber Sie frieren doch immer noch», nahm Walter den Gesprächsfaden wieder auf. «Ich bezahl Ihnen einen Tee mit Schuss. Achim, mach einen Schuss rein», sagte er zu dem Wirt und versuchte, sehr bestimmt zu klingen. Der Wirt sah Barbara an, und die schüttelte den Kopf.
«Du siehs ja, se will nisch.»
Walter griff nach Barbaras Arm. «Warum wollen Sie mich denn nicht bezahlen lassen? Ich tue Ihnen doch nichts.»
«Lassen Sie mich sofort los», sagte Barbara ruhig. «Ich mache keine Bekanntschaften an der Theke.»
Walter lachte höhnisch auf, ließ sie aber los. «Was glaubst du eigentlich, wer du bist? So eine hergelaufene Pennerin kommt hier rein und spielt die große Dame …»
«Walter! Das reicht!» Der Wirt sprach plötzlich hochdeutsch. «Die Dame ist ein Gast wie jeder andere hier, und wenn sie nicht eingeladen werden möchte, dann hast du dich daran zu halten.»
«Dame – dass ich nicht lache. So eine kleine Straßennutte …»
Der Wirt kam hinter der Theke vor. «Walter, du solltest für heute Abend Schluss machen und nach Hause gehen.»
«Na, hör mal, ich bin hier schließlich Stammgast», protestierte Walter.
«Wenn du dich so benimmst, nicht mehr lange. Jank no Hus, Jung, und schlaf dinne Rausch us.» Mit diesen versöhnlichen Worten schob der Wirt Walter durch die Tür nach draußen.
«Tut mir leid», sagte er zu Barbara, als er wieder zurückkam. «Dat is ene liebe Jung, aber bei Frauen …»
«Dä Walter hat immer ene sexuelle Notstand», warf einer der beiden Knobler ein.
Barbaras Magen knurrte vernehmlich. «Haben Sie auch was zu essen?», fragte sie.
«Frikadellen und kalte Koteletts. Und Gulaschsuppe und Baguettes. Hier is die Karte.» Der Wirt hielt ihr eine Pappseite unter die Nase.
Barbara sah sich die Preise an. Sie fror noch immer. «Wissen Sie was – geben Sie mir doch lieber einen Schnaps in meinen Tee.»
Der Alkohol wärmte sie endlich ein wenig. Sie kletterte auf einen der Barhocker. Die nächste Stunde hielt sie sich an ihrem Teeglas fest und beobachtete verstohlen die Leute.
Gegen Mitternacht kamen drei Frauen herein – zwei trugen Minis, unter denen Strapse hervorlugten, die andere goldene Leggings. Die tief ausgeschnittenen Oberteile verhüllten fast gar nichts, und die kurzen Jäckchen aus Kunstpelz und Leder wärmten sicher nicht besonders. Die drei sahen recht verfroren aus, aber nass geworden waren sie nicht, sie hatten alle Regenschirme bei sich. Sie stellten sich an die Theke.
«Drei Cola – du weißt schon, Achim», sagte die eine. Sie war groß und blond und war die Einzige, die man als hübsch bezeichnen konnte. Die beiden anderen waren kleiner, eine mit schwarz-, die andere mit rotgefärbtem Haar, und hatten eher Durchschnittsgesichter, soweit Barbara das bei dem dicken Make-up, das alle trugen, beurteilen konnte.
Achim goss drei Cola ein und kippte dann Whisky hinterher. «Na, wie war dat Geschäft heute Abend, Mädschen?», fragte er, als er ihnen die Gläser hinstellte.
«Ganz flau», meinte die kleine Rothaarige. Sie deutete auf die Blonde. «Lena hatte bis halb elf einen Freier, wir beide gar keinen. Und als der Regen dann anfing, war es ganz aus. Wir haben Carlo angerufen, er sagte, er holt uns hier ab.»
«Dann lasst eusch besser nisch erwischen», meinte der Wirt mit einem Blick auf die Gläser.
«Keine Angst», Lena griff nach ihrem Glas. «Du kannst die neue Cola schon fertigmachen.»
Die drei nippten an ihren Gläsern. Ihr Gespräch drehte sich um Kinder – Lena hatte zwei, die Rothaarige eines. «Es wird besser, wenn deine Kleine in den Kindergarten kommt, Anja», meinte Lena. «Du musst dann zwar morgens früh raus, aber danach kannst du dich wieder hinlegen und nochmal richtig schlafen. Und wenn sie erst in der Schule sind …»
Die Schwarzhaarige schien irgendwie unbeteiligt und sah sich gelangweilt um. Sie musterte Barbara, prüfte, ob sie zur Konkurrenz gehörte, und entdeckte dann den Mann am hinteren Tisch. «Bin gleich wieder da», sagte sie und stakste auf ihren Zwölf-Zentimeter-Stilettos nach hinten.
Barbara konnte nicht hören, über was sie sprachen, aber der Mann lächelte kurz und schüttelte dann den Kopf. Die Schwarzhaarige zuckte die Schultern und kam zurück zur Theke.
Der Wirt legte ihr die Hand auf den Arm. «Isch hab dat nisch jern, Andrea.»
«Was?»
«In meinem Lokal werden keine Freier aufjerissen, dat weiß du.»
Barbara sah, dass es ihm damit sehr ernst war.
Andrea lächelte: «Aber das ist doch nur ein alter Bekannter, dem ich guten Abend sagen wollte.»
«Na jut – aber merk et dir trotzdem», meinte Achim und wandte sich wieder seinem Knobelspiel zu.
Die drei Nutten hatten die erste Cola getrunken und saßen nun vor dem zweiten Glas – ohne Schuss. Lena hatte Pfefferminz verteilt. Wenig später sah Barbara durch die bunten Fenster eine große Limousine, die vor der Kneipe hielt. Ein gutaussehender Mann in einem teuren Anzug kam herein.
«’n Abend, Carlo», sagte Achim. «Willste wat trinken?»
«’n Abend.» Carlo hatte nichts von den landläufigen Zuhälterattributen an sich: kein Goldkettchen, keine dicken Ringe. Sein Hemd war geschlossen, und er trug eine edle Seidenkrawatte. «Danke, für mich nichts. Los, Mädels, beeilt euch. Ich habe noch zu tun. Schreib’s auf den Deckel, Achim, ich bezahl ihn nächste Woche.»
«Is jut.»
Als Carlo und die drei verschwunden waren – Achim war gerade dabei, die Gläser zu spülen –, meinte einer der beiden Knobler: «Dat Karlschen hat sisch fein erausgemach. Wer hätt dat jedacht, wenn dä früher mit sinnem Vatter hier wor un sin Appelsap jenippt hät.»
Der andere kippte seinen Korn: «Isch han jehört, dä bringt sinne Pferdschen demnäx in dä jroße Puff vom ahlen Köster unter. Do kanner vill mehr Jeld machen – un den Mädels ginget auch besser, wenn se nisch mehr up der Stroß stehen müssten.»
«Dat sinn doch alles unjelegte Eier.» Achim trocknete sich die Hände ab. «Dat Jeld, um sisch beim Köster einzekaufen, müssen de Mädschen ers mal ranschaffen.» Er schüttelte den Knobelbecher und knallte ihn dann auf die Theke. «Na bitte, isch krisch eusch noch.»
Die vier jungen Männer und die beiden Frauen verabschiedeten sich. Sie hatten keineswegs ein Verbrechen geplant, sondern eine Junggesellenparty für einen ihrer Freunde, wie Barbara feststellte. Der Mann im schwarzen Pullover sah nun häufig zu ihr herüber.
Ihr Magen knurrte wieder. Jetzt wurde ihr langsam richtig schlecht vor Hunger. Sie ging zur Toilette und trank so viel Wasser, wie sie konnte, aber es half nicht viel. Auf dem Weg von der Toilette zurück zur Theke wurde ihr einen Moment lang schwarz vor Augen. Und wieder bemerkte sie, dass der Mann am hinteren Tisch sie beobachtete. Sie hatte Angst umzukippen, ging aber tapfer zurück zu ihrem Platz.
Der dunkel gekleidete Mann kam mit seinem Glas zur Theke. «Ich hätte gerne noch einen», sagte er. Seine Stimme war leise, aber Barbara glaubte nicht, dass sie jemals überhört werden könnte.
«Ich hätt en Ihnen doch jebracht», sagte der Wirt, nahm das Glas, legte es ins Spülbecken und nahm ein neues aus dem Regal. In der Flasche war nur noch ein Rest. Er ging nach hinten, um eine volle zu holen.
«Ich weiß, dass Sie Hunger haben», sagte der Mann plötzlich zu Barbara. Seine Stimme klang angenehm und ruhig. «Ich würde Sie gern einladen. Mehr nicht. Werden Sie mir auch eine Abfuhr erteilen?» In seinen Mundwinkeln erschien die Spur eines Lächelns.
Barbara zögerte kurz. Was wollte dieser Mann von ihr? Sein Blick zeigte jedoch nichts als ein distanziertes Interesse – keine Spur von einer beabsichtigten Anmache. Langsam schüttelte sie den Kopf. «Ich glaube, für eine Abfuhr bin ich zu hungrig.»
Der Wirt kam zurück. «Bringen Sie der Dame, was sie möchte, und schreiben Sie es auf meinen Deckel», sagte der Mann zu ihm, nahm das gefüllte Glas und ging zurück an seinen Tisch.
«Wat willste denn haben, Mädschen?», fragte der Wirt mit leicht gehobener Augenbraue.
«Eine Gulaschsuppe und ein Schinkenbaguette – wenn die Küche noch aufhat.»
Der Wirt lachte. «De Küsch, dat bin isch. Un wenn de Hunger hass, dann mach isch dir wat.»
Er verschwand in der Küche, und Barbara saß unschlüssig auf dem Barhocker. Dann stand sie auf und ging zu dem hinteren Tisch.
«Darf ich?», fragte sie.
«Sicher.»
Barbara entdeckte gerade noch den schwarzen Borsalino, der auf dem Stuhl lag. Sie nahm ihn vorsichtig und legte ihn auf den anderen Stuhl. Der Hut musste ein Vermögen gekostet haben.
Bis der Wirt mit dem Essen kam, sprachen sie kein Wort. Barbara machte sich über die dampfende Suppe her.
«Danke», sagte sie.
«Wie lange haben Sie nichts mehr gegessen?» Er stellte die Frage sachlich, ohne eine Spur von Mitleid.
«Seit heute Morgen.»
Geduldig wartete er, bis Barbara alles aufgegessen hatte. «Möchten Sie auch noch etwas trinken?»
«Ja.» Sie sah auf sein Glas. «Ist der gut?»
«Trinkbar.» Er winkte dem Wirt und orderte ein Glas Rotwein.
Wieder schwiegen sie. An der Theke verabschiedeten sich die beiden Knobler, und der Wirt begann, das Lokal aufzuräumen. Bald würde er schließen wollen. Der Mann registrierte jede ihrer Regungen. Sie spürte genau, dass er wusste, sie hatte Angst, in kurzer Zeit draußen auf der Straße zu stehen.
«Leben Sie auf der Straße?» Wieder dieser sachliche Ton – nicht einmal Verhöre waren so emotionslos.
Sie sah ihn an: Seine Augen waren hellbraun, fast bernsteinfarben, sie wirkten sanft und warm und bildeten einen starken Kontrast zu dem hageren, scharf geschnittenen Gesicht mit dem kühlen Ausdruck. Die Haare trug er ganz kurz, sie waren dicht und fast schwarz. «Im Moment ja.»
«Sie können bei mir übernachten. Ich habe ein Gästebett.» Er bemerkte ihr Erstaunen, und auf einmal kam dieses winzige, spöttische Lächeln wieder, das sie dazu gebracht hatte, seine Einladung anzunehmen. «Ich pflege nicht über Frauen herzufallen – jedenfalls nicht, wenn sie es nicht wollen.»
«Ich will es nicht», sagte Barbara.
«Was wollen Sie nicht?», fragte er sanft. «Einen Platz zum Schlafen oder …»
Barbaras Herz begann zu klopfen. Doris war ihr wieder eingefallen. Die ermordete Gabi, die mit einem Freier aus einer Kneipe verschwunden war. ‹Auf solche wie dich hat er es abgesehen›, hörte sie Doris sagen. Aber der Wirt war fertig mit Aufräumen, und in ein paar Minuten würde er sie auffordern zu gehen. Dieser merkwürdige dunkle Mann könnte der Mörder sein – und niemand wusste besser als Barbara: Jeder könnte ein Serienmörder sein, gutaussehende Charmeure wie der Heidemörder, freundliche ältere Herren wie Schmidtmann …
‹Na, wennschon›, sagte eine Stimme in ihrem Innern. «Was wäre so schlimm daran, wenn du umgebracht würdest? Wäre es nicht die einzige Pointe, die dein Leben hergeben würde?» Sie sah den Mann an, der gelassen auf ihre Antwort wartete. Und sie spürte, dass er ihren Sinneswandel registriert hatte wie alles andere zuvor. Nichts schien ihm zu entgehen. «Ich nehme Ihr Angebot an – für heute Nacht», sagte sie leise und hoffte, sie habe jetzt nicht den Fehler ihres Lebens gemacht.
«Gut, dann sollten wir jetzt gehen.» Er stand auf, und sie gingen zur Theke. Wie selbstverständlich zahlte er auch ihren Tee.
Zum Glück hatte es aufgehört zu regnen, aber Barbaras nasse Jacke war vor der Heizung nicht trocken geworden. «Ich laufe sonst nach Hause, aber bis Pempelfort ist es recht weit, und Ihre Sachen sind immer noch nass. Am Bahnhof bekommen wir ein Taxi», sagte der Mann.
Schweigend gingen sie nebeneinanderher. Er bewegte sich ruhig und langsam, mit der gleichen Gelassenheit, mit der er in der Kneipe gesessen hatte. Barbara hatte plötzlich das Gefühl, etwas sagen zu müssen. «Ich heiße Barbara.»
Er sah sie mit gerunzelter Stirn an. «Tun Sie mir einen Gefallen, kommen Sie auf die rechte Seite. Ich bin auf dem linken Ohr praktisch taub. Mittelohrentzündung als Kind.»
Barbara wechselte zu seiner rechten Seite. «Kann man da nichts machen?», fragte sie eine Spur zu laut.
«Nein», sagte er und lächelte. «Aber auf dem rechten Ohr höre ich ausgezeichnet. Ich heiße Thomas Hielmann. Und wie war Ihr Name? Barbara?»
Sie nickte.
«Der Name passt», meinte er.
Barbara sah ihn fragend an.
«Barbara – aus dem Griechischen: ‹die Fremde›. Ich bin Altphilologe – unter anderem. Wie nennt man Sie? Bärbel? Babs?»
«Barbara. Ich habe keinen Kosenamen.»
Im Taxi fiel kein Wort, aber er schien sie immer noch zu beobachten. Sie wunderte sich, dass ihr das gar nicht mehr unangenehm war. Wenn er nach vorn blickte, betrachtete sie verstohlen sein Profil: hohe Wangenknochen, eine gutgeformte Nase, ein Kinn, das auf einen starken Willen schließen ließ. Für einen Augenblick durchzuckte sie der Gedanke, dass sie völlig wahnsinnig sein musste, mit einem wildfremden Mann unterwegs in seine Wohnung zu sein. Aber genauso beschäftigte sie, was ihn dazu brachte, sie einfach einzuladen. Eigentlich konnte er doch nur eine Sache im Sinn haben … Doch diesen Gedanken verwarf sie sofort wieder. Hielmann war nicht auf Sex aus, dazu war er viel zu distanziert. Aber was wollte er dann?
Nicht lange, und sie standen vor dem Haus, in dem Hielmann wohnte. Es war ein wunderschönes altes Stadthaus mit einer tadellos renovierten Fassade und stilechten neuen Fenstern. Er wohnte im ersten Stock. Sie betraten den Flur, er war lang und breit, in einem dunklen Blau gestrichen. An einer Wand hingen zwei alte Porträts, darunter stand eine antike Truhe, auf der ein paar antiquarische Bücher lagen und ein offensichtlich echter Totenschädel ohne Unterkiefer. Das Arrangement war perfekt. Barbara blieb davor stehen und konnte den Blick nicht von dem Schädel lösen.
«Das ist ein Frauenschädel. Hat mich einiges gekostet, er stammt aus einer alten Gruft, die Reihengräbern weichen musste», sagte Hielmann. «Ein Memento mori, wann immer ich aus dem Haus gehe.»
Barbara schluckte. Er musste einen seltsamen Humor haben … oder meinte er es ernst?
Hielmann öffnete eine Tür zu einem kleinen Raum. Hier gab es keine kunstvollen Arrangements – ein Trainingsrad stand da und ein Bügelbrett, ein Korb voll Wäsche. Hielmann zog ein zusammengeklapptes Reisebett aus einer Nische hervor und klappte es auseinander. «Das Bettzeug ist da drin», sagte er und deutete auf die Nische. «Alles frisch bezogen. Aber vielleicht sollten Sie erst einmal aus den nassen Sachen steigen und eine heiße Dusche nehmen. Das Bad ist gleich nebenan. Sie können sich ein Handtuch aus dem Regal nehmen und den hellen Bademantel anziehen.»





























