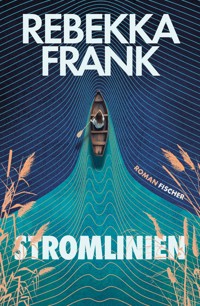14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wilde Schönheit der Nordseeküste, ein geheimnisvolles Schiffswrack und zwei Frauen, verbunden durch das Meer St. Peter, 1955: Tillas Welt ist das Meer. Sie will nicht heiraten, sondern tauchen. Nicht eingeengt werden, sondern die Freiheit der Wellen spüren. Dabei entdeckt sie in der Tiefe der Nordsee ein altes Schiffswrack, von dem sich die Fischer seit Generationen Legenden erzählen. In Tilla wächst der unbändige Wunsch, seine Geheimnisse zu lüften. Auf einer Nordseeinsel, 1633: Die junge Nes sucht mit ihrer Mutter in einem Beginenkonvent Zuflucht vor ihrer Vergangenheit. Doch bald wenden sich die Inselbewohner gegen die Frauen und gefährliche Anschuldigungen machen die Runde. Zeitgleich taucht am Horizont ein geheimnisvolles Schiff auf, das Rettung oder Verderben bedeuten könnte ... »Wie der Sog des Meeres zieht einen dieses Buch in seinen Bann – bis man staunend vor dem Ende steht wie vor einem gehobenen Schatz.« Miriam Georg, Bestsellerautorin von »Elbleuchten« und »Das Tor zur Welt«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 802
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rebekka Frank
Das Echo der Gezeiten
Roman
Über dieses Buch
St. Peter, 1955: Tilla will nicht heiraten, sondern tauchen. Nicht eingeengt werden, sondern die Freiheit der Wellen spüren. Dabei entdeckt sie in der Tiefe der Nordsee ein altes Schiffswrack, von dem sich die Fischer seit Generationen Legenden erzählen. In Tilla wächst der unbändige Wunsch, seine Geheimnisse zu lüften.
Auf einer Nordseeinsel, 1633: Die junge Nes sucht mit ihrer Mutter in einem Beginenkonvent Zuflucht vor ihrer Vergangenheit. Doch bald wenden sich die Inselbewohner gegen die Frauen und gefährliche Anschuldigungen machen die Runde. Zeitgleich taucht am Horizont ein geheimnisvolles Schiff auf, das Rettung oder Verderben bedeuten könnte ...
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Für Rebekka Frank steckt das Meer voller Geschichten. Wenn sie nicht gerade selbst in seinen Tiefen taucht, schreibt sie darüber. Sie hat Theaterwissenschaft und Germanistik studiert und lebt mit ihrem Mann und ihrem Hund auf dem Land in Nordhessen. Auf Instagram und TikTok ist sie unter @rebekka.mit.k zu finden.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Für all die Frauen, an die sich niemand erinnert
Prolog
Hoch oben auf dem Deich stand eine junge Mutter und drückte ihr Bündel fest an die Brust. An ihrem erdfarbenen Rock riss der Wind, ihr Blick war starr auf das Segelschiff weiter unten gerichtet. Noch war das Meer hinter dem kleinen Hafen dunkel, beinahe schwarz. Doch das Morgengrauen kündigte sich bereits in den Wolken an, die leuchtend über den Himmel jagten.
Bisher hatte sie niemand bemerkt. Leute schleppten Kisten über den Steg. Ein Ruderboot legte ab und steuerte auf den gewaltigen Zweimaster vor der Küste zu. Sie könnte sich umdrehen und wieder gehen. Doch sie würde nicht noch einmal davonlaufen. Nein, an diesem Morgen würde sie auf dieses Schiff steigen – für ihr Kind. Es war die einzige Lösung.
Aufmerksam betrachtete sie die hohen Masten und all die Leinen, die wie Spinnweben zwischen ihnen hingen. Bisweilen bildeten sie so enge Netze, dass mutige Seeleute an ihnen hinaufklettern konnten. Hoch oben waren die Segel eng verschnürt. Schon bald würden sie heruntergezogen, damit sie dieses monströse Schiff mit Hilfe des Windes in Bewegung setzten und über das Meer trieben. Ein wahnwitziges Unterfangen.
Die junge Mutter betete nicht – dem Heiligen Geist vertraute sie schon lang nicht mehr. Flüsternd sprach sie stattdessen zur Königin des Wassers. Verzeih mir, Nimueh. Und lass mich nicht aus den Augen. Sie betrachtete die Wellen, sah, wie sie sich in der Ferne aufbäumten und wieder zurückzogen, wie sie das Schiff lockten und versuchten, es zu verführen. Leise schäumend brachen sie sich schließlich an seinem Bug und leckten am Holz der Galionsfigur. Vom Deich aus konnte die junge Frau ihr geschnitztes Gesicht zwar nicht erkennen, doch sie wusste genau, dass die aus Seekiefer gefertigte Gorgone den Mund weit aufgerissen hatte und dass ihre Haare sich windende Schlangen waren.
Sie dachte an die Geister, die unsichtbar in den Wellen wohnten. Sie meinten es gut mit ihr, versuchte sie, sich selbst zu beruhigen. Das hatten sie immer getan.
Mit der freien Hand berührte sie ihre rosafarbene Muschelkette, einmal, zweimal, dreimal, bevor sie mit ihrem Bündel den Deich hinunterstieg.
1. Kapitel
September 1960
Tilla Puls grub die Zehen in den heißen Sand und sah hinaus aufs Meer. Endlich war der Moment gekommen, auf den sie jahrelang hingearbeitet hatte. Ruhig und dunkelblau lag der Ozean vor ihr, und sein sanftes Plätschern wiegte sie in Sicherheit. Sie durfte seiner Stimme nicht immer trauen, das wusste sie – das hatte sie auf die harte Tour lernen müssen. Und noch konnte sie umdrehen und wieder gehen. Doch wenn sie ehrlich war, war das für sie keine Option, noch nie eine gewesen. Heute würde sie sich dem Meer anvertrauen, komme, was wolle. Sie würde ihm seine uralten Geheimnisse entlocken.
In der einen Hand hielt sie ihre Taucherbrille. In der anderen das Atemgerät. Der Wind riss an ihren Haaren. Wenn das Mädchen, das Tilla noch vor fünf Jahren gewesen war, sie jetzt so sehen könnte – was würde es denken? Wäre es stolz? Hätte es Angst?
Angst wahrscheinlich nicht, überlegte sie. Die Angst war erst in letzter Zeit zu ihr gekommen. Vielleicht gehörte sie zum Erwachsensein dazu. Vielleicht sickerte sie zusammen mit dem an der Universität vermittelten Wissen in sie hinein. Und vielleicht könnte Tilla sie wieder loswerden – zumindest für einen Moment –, wenn sie endlich aufbrach, endlich unterging, endlich schwebte. So wie früher, als sie noch nicht wusste, welchen Preis ein Abenteuer hatte. Und welche Macht das Meer.
September 1955
Tilla Puls verlagerte ihr Gewicht auf ein Bein und legte den Kopf schräg, so wie es Lotte Hass auf den Fotos in der Brigitte getan hatte. Seitdem Tilla den Artikel über die Taucherin gelesen hatte, war sie ihr größtes Idol. Zwar sagten viele, Tilla sähe aus wie Audrey Hepburn in Ein Herz und eine Krone, aber Tilla fand, dass sie sich irrten. Die Leute schauten einzig auf ihre dunklen Haare mit dem kurzen Pony. Sobald Tilla sie blond färben durfte, würde man ihre Ähnlichkeit mit Lotte nicht mehr übersehen können.
Tilla atmete den Duft des Meeres ein, während das Keuchen ihrer Freundinnen in ihrem Rücken lauter wurde.
»Mensch, Tilla!«, rief Hilde.
»Du bist viel zu schnell.« Auch Hannelore ächzte, und doch schwang in ihrer hohen Stimme ein klein wenig Bewunderung mit.
Tilla musste an die Worte ihrer Großmutter denken: »Das sind keine Freundinnen«, hatte sie gesagt, »das sind Bewunderer.«
»Quatsch, Oma. Und außerdem heißt das Fans.«
»Bitte, was?«
»Heutzutage nennt man das Fans.«
Ihre Großmutter hatte gegrinst. »So, so, die junge Dame hat also Fääänz.«
Tilla hatte seufzend den Kopf geschüttelt, doch sie wusste – von dieser Überzeugung konnte sie die alte Frieda Puls sowieso nicht wieder abbringen.
Hilde und Hannelore schlossen jetzt zu ihr auf. Beide trugen das gleiche Kleid wie Tilla. In der Taille war es mit einem Gürtel geschnürt, und sein Rocksaum flatterte in der Brise. In einer dramatischen Geste lehnte Hilde ihre erhitzte Stirn an Hannelores Schulter.
»Nun stellt euch mal nicht so an!« Der Satz rutschte Tilla einfach so raus, als würde ihre Mutter aus ihr sprechen. Augenblicklich schämte sie sich dafür und schob freundlicher hinterher: »Schaut doch, wie schön es hier heute ist!« Sie deutete in die Ferne, auf den Priel, der bis zum Deich brodelte, und die hölzerne Seebrücke, die über die Marschlandschaft weit hinaus zur gewaltigen Sandbank führte. Moderne Lampen bogen sich darüber, und vereinzelte Badegäste spazierten den Weg hinauf und hinunter. Am tiefblauen Himmel hing keine einzige Wolke. Man hätte meinen können, es wäre Sommer. Doch wer genau hinsah, bemerkte die Anzeichen des frühen Herbstes. Die hohe See in der Ferne war dunkel. Und dann war da noch die Brise. Sie zerrte und riss an ihnen, als wollte sie sie zurückhalten.
»Gehen wir weiter zur Brücke«, sagte Hannelore. Tilla antwortete mit einem Nicken und lief voran. Sie schlüpfte unter dem Geländer hindurch, betrat die hölzernen Planken und stemmte sich gegen den Wind.
»Hier ist kaum eine Menschenseele, Tilla!«, sagte Hilde, sobald sie aufgeschlossen hatte. »Hast du nicht behauptet, hier wäre mittlerweile alles voll von Typen?« Tilla spürte ein warmes Kribbeln im Bauch. Typ – ihre Lehrer missbilligten dieses neumodische Wort. In der Schule traute sich keine von ihnen, es zu benutzen. Doch hier draußen konnten sie es laut aussprechen.
»Am Strand sind bestimmt welche. Wir müssen nur noch ein Stückchen weitergehen.« Doch Tilla guckte ihre Freundinnen nicht an. Schon möglich, dass sie ein wenig übertrieben hatte und in Wahrheit eigentlich nur aus einem Grund herkommen wollte – sie war einfach gern am Meer. Typen hin oder her.
Um das Thema zu wechseln, hob sie im Gehen ihren Rock und betrachtete ihre neuen Strümpfe. »Sie machen tatsächlich ein schönes Bein.« Sie beugte sich kurz nach hinten, um die dunkle Naht auf der Mitte ihrer Waden zu begutachten.
Auch Hannelore schaute auf Tillas Waden. »Du hast ohnehin schöne Beine. Da brauchen die Strümpfe nicht viel zu machen.« Sie seufzte. »Meine Mutter sagt, ich muss dringend mehr essen, wenn ich mal einen Mann abbekommen möchte.«
Tilla winkte ab. »Darüber würde ich mir an deiner Stelle überhaupt keine Gedanken machen.«
»Nicht?« Hilde zog die Augenbrauen hoch. »In der Zeitung schreiben sie immer wieder vom Frauenüberschuss. Vier von meinen Tanten sind alte Jungfern! Vier!«
Tilla zuckte mit den Schultern. »Wieso soll denn auch jede Frau einen Mann haben? Im Grunde gibt es doch wirklich Wichtigeres im Leben.«
Vollkommen entgeistert drehten Hilde und Hannelore die Köpfe. »Was zum Beispiel?«
Tilla wich ihren Blicken aus und schaute wieder in Richtung Horizont. Zum Beispiel das Meer, hätte sie gern gesagt. Sie musste an die Nordsee-Legende denken, die ihre Oma Frieda ihr von klein auf immer wieder erzählt hatte. Daran, welche Geschichten der Ozean verbarg. Und an all die Schätze, die ihre Oma bereits gefunden hatte. Montags, wenn das Pfahlbaurestaurant der Familie Puls geschlossen war, spazierte sie gern über den Strand und hielt Ausschau nach Treibgut. Schon als Kind hatte Tilla es geliebt, sie bei der Schatzsuche zu begleiten. Manchmal fanden sie uralte Tonscherben, Glasflaschen, hin und wieder sogar einen Silberring oder eine Brosche. Ihre Oma konnte zu jedem noch so kleinen Gegenstand die spannendste Geschichte erzählen. Und zurück im Restaurant arrangierte sie ihre Fundstücke auf den Fensterbänken und auf dem Tresen so liebevoll, als wäre das Gebäude auf den hohen Pfählen ein zauberhaftes Museum und keine Gaststätte.
Wenn Tilla sich ihre Zukunft ausmalte, dann hatte sie immer mit Omas Schätzen aus dem Meer zu tun. Mit den Rätseln, die sich unter der Wasseroberfläche verbargen. Und mit dem aufregenden Prickeln, das ihr die alten Geheimnisse über die Haut jagten. Doch bei der Vorstellung, ihren Freundinnen von diesen diffusen Träumen zu erzählen, wurde sie rot. Denn ihre Mutter hatte ihr nicht nur einmal erklärt, dass Schatzsuche kein Beruf wäre, sondern eine Spinnerei. Sie wäre fast erwachsen und solle mit den Kindereien aufhören. Um abzulenken, antwortete Tilla, weiterhin den Blick auf den Horizont geheftet: »Erinnert ihr euch an Egon Rank?«
»Du meinst euren Stammgast aus Hessen?«
»Er ist Fotograf. Und er findet, ich hätte das Zeug zum Fotomodell.«
»Das hat er gesagt?« Hilde sah sie mit großen Augen an.
Tilla zuckte mit den Schultern. So recht wollte sie an seine Worte auch nicht glauben. »Wenn alle Stricke reißen, heirate ich einfach einen Amerikaner. In der Zeitung sucht immer einer nach einer deutschen Frau.«
Jetzt grinste Hilde. »Ja, weil sie denken, deutsche Frauen seien gute Hausfrauen. Tilla, du kannst ja vieles, aber das bist du nun wirklich nicht.«
»Aber vielleicht kann ich es werden!« Tilla griff in ihre Tasche und kramte eine kleine Flasche hervor. Frauengold stand in großen Lettern darauf.
»Hilft es?«, fragte Hannelore.
»Meine Mutter schwört jedenfalls darauf.« Tilla trank als Erste einen Schluck. Es schmeckte scharf und süß zugleich, es schüttelte sie. Und noch während sie das Frauengold an Hannelore weitergab, stieg bereits ein angenehmes Gefühl in ihr auf, weich und warm. Sie breitete die Arme aus, schwang die Hüften und spürte dem sanften Schwindel dieses Wundermittels nach. Genau so musste sich eine Dame fühlen.
Allmählich näherten sie sich der Sandbank, die genauso hellgelb war wie Tillas Rock. Dahinter glitzerte das Meer. An jedem Tag, zu jeder Stunde konnte die Nordsee eine andere sein. Mal schaumig, aufgebauscht und nah. Dann wieder ganz leise, flüsternd und weit in der Ferne. An warmen Sonnentagen funkelten die Wellen, als hätten sie sich fein gemacht. An regnerischen Tagen – und davon gab es zu dieser Jahreszeit viele – schienen sie matt und düster. Heute war es, als könnte sich das Meer nicht recht entscheiden.
»Wisst ihr, was mein Plan ist?«, fragte Hilde. »Ich werde Sekretärin und angele mir den Chef. In der Gabriele gibt’s eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und dann …«
»O nein …«, unterbrach Tilla sie. Denn höchstens hundert Schritte entfernt sah sie zwei wohlbekannte Gestalten über die Sandbank laufen.
»Sind das nicht …?« Hannelore war ihrem Blick anscheinend gefolgt.
»… mein Bruder und meine Oma.« Tilla schloss die Augen. »So ein Mist.« Die zwei wollten bestimmt aufs Meer rausfahren. Dabei war Frieda zu alt, um das Fischerboot allein zu lenken, und Nepomuk zu jung, um gewissenhaft zu helfen. Am liebsten wäre Tilla bei ihren Freundinnen geblieben. Doch das war jetzt nicht mehr möglich. Es war ihre Aufgabe, auf Nepomuk und Großmutter aufzupassen. Was, wenn ihnen etwas zustieß? Der Gedanke, ihre zwei liebsten Menschen auf dieser Welt könnten in Gefahr geraten, war ihr unerträglich. Tilla streifte sich die Schuhe ab. Den linken hielt sie Hannelore, den rechten Hilde hin.
»Aber Tilla! Du kannst doch nicht …«, sagte Hannelore.
Doch Tilla rannte schon los. Unter ihren Füßen knirschte der Sand.
»Deine Nylonstrümpfe!«, rief ihr Hilde hinterher.
»Wo wollt ihr hin?«, fragte Tilla atemlos.
»Was glaubst du?« Großmutter setzte ein schiefes Grinsen auf und deutete mit dem Kinn auf Nepomuk.
»Heute ist so gutes Wetter, vielleicht können wir es von oben sehen!«, sagte der mit seiner kleinen Piepsstimme.
Sofort stahl sich ein Lächeln auf Tillas Gesicht. Das passierte immer, wenn sie ihren kleinen Bruder anschaute. Er war erst acht Jahre alt, feingliedrig, dennoch überraschend pausbäckig und alles in allem süßer als jeder Hundewelpe. Wieso konnte allein der Anblick eines niedlichen Wesens einen so sanft stimmen, überlegte Tilla. Sie versuchte, dagegen anzuatmen. Nepomuk würde ihr auf der Nase herumtanzen, wenn er es bemerkte.
»Das haben wir schon oft genug probiert, Nepomuk.«
»Aber Oma hat gesagt, heute ist das Wetter besonders gut.«
Tilla verdrehte die Augen, so dass Wasser, Boot und Himmel in einem kurzen Augenblick eins waren. Eine blaugraue Unendlichkeit, die es nur am Meer geben konnte. »Aber ihr sollt doch nicht mehr zu zweit rausfahren!«
»Du kannst gern mitkommen.« Frieda wendete sich dem Boot zu, das hinter ihnen auf den Wellen schaukelte. Tilla liebte den hölzernen Kahn. Vor Jahrzehnten hatte ihr Großvater die Planken weiß-blau angemalt. Zwar war die Farbe schon an vielen Stellen abgeblättert, und das Holz hatte sich verzogen, doch genau das ließ dieses Boot mit dem windschiefen Steuerhäuschen so malerisch aussehen. Bei Ebbe lag es mitten im Watt. Doch bei einsetzender Flut konnte man leicht einsteigen – nur bis zu den Waden wurde man nass – und bald darauf losfahren.
»Was ist nun, Tilla Puls? Entweder du gehst zurück zu deinen Fääänz, und wir fahren allein. Oder du kommst mit«, sagte Frieda, während sie erstaunlich behände eine schmale Leiter hinaufkletterte. Nepomuk folgte ihr und warf Tilla oben angekommen ein glückliches Zahnlückenlächeln zu.
Die Sonne stand jetzt hoch am Himmel und knallte Tilla auf die Stirn. Schon nach wenigen Minuten im Wind war ihre Frisur hinüber. Sie sah auf ihre Füße und stellte fest, dass ihre neuen Nylonstrümpfe nicht nur dreckig und nass waren, sondern auch zerrissen. Und wenn schon, dachte Tilla. An Land musste sie sich vielleicht verhalten wie eine Dame, aber hier, auf den Wellen, war das nicht nötig. Und als sie das plötzlich begriff, löste sich etwas in ihr wie ein festverschnürtes Tau. Sie sog die Brise tief ein, genoss die kalten Wasserspritzer auf der Haut und die Vorstellung von der Tiefe des Meeres unter ihr.
Als sie so weit entfernt vom Strand waren, dass sie ihn mit bloßem Auge nicht mehr sehen konnten, schaltete Oma den Motor ab. »Wir sind da.«
Tilla sprang auf, um den Anker ins Wasser zu lassen. Nepomuk beugte sich tief über die Reling und starrte ins Meer. Ganz langsam lief er auf dem Boot einmal im Kreis.
»Ich hab’s dir doch gesagt«, sagte Tilla, konnte sich aber nicht davon abhalten, ebenfalls auf die Wasseroberfläche zu schauen. Sie war rau und spiegelte tiefblau den Himmel. Hin und wieder huschte ein kleiner Schwarm Fische darunter hinweg.
»Man sieht gar nichts, Oma!«, sagte Nepomuk.
»Es ist wohl doch zu tief.« Frieda verzog entschuldigend das Gesicht. Dann streckte sie einen Arm aus. »In dieser Richtung liegt Pellworm. Und dort Nordstrand.«
Langsam ließ sie sich auf die Bank am Rand des Boots nieder.
»Früher bist du immer allein hier rausgefahren, oder?« Nepomuk zeigte aufs Wasser.
»Nicht immer.« Oma sah mit ihren hellen Augen an ihm vorbei. »Manchmal war mein Vater bei mir. Oder meine Schwester. Aber das ist alles so lange her …«
Tilla musterte ihre Großmutter. Diesen sehnsüchtigen Tonfall schlug Frieda nur selten an. Die kleine Frau wirkte stets zäh und wetterfest, obwohl sie schon über siebzig war. Ihr Dutt saß fest an ihrem Hinterkopf, nur wenige weiße Strähnen hatten sich daraus gelöst und wirbelten um ihr vergnügtes Gesicht. Sie hatte Abertausende von kleinen Falten. Tilla stellte sich vor, dass jeder ihrer Lachanfälle eine von diesen Falten hinterlassen hatte. Und Lachanfälle hatte Oma täglich. Sie liebte Witze, klopfte sich gern auf die schlanken Oberschenkel und scherzte den lieben langen Tag mit jedem, auf den sie traf. Doch in diesem Moment war sie eigentümlich ernst.
»Das war, bevor ich euren Großvater geheiratet habe … Danach bin ich nur noch selten zum Fischen rausgefahren.«
Tilla spürte ein Ziehen in der Brust. Was für eine Frau wäre ihre Großmutter wohl ohne die Ehe gewesen? Wasser spritzte über die Reling und Tilla ins Gesicht. Es war eiskalt. Natürlich, es war September. Oben in der Luft gab der Sommer eine letzte Zugabe, doch unten im Meer machte sich schon grollend und drohend der Winter breit.
Nepomuk wirbelte herum. »Ich will schwimmen! Können wir reinspringen, Oma? Nur kurz?«
»Auf gar keinen Fall«, sagte Tilla mit aller Autorität, die sie aufbringen konnte, bevor Frieda eine ihrer unvernünftigen Oma-Antworten geben konnte. Im Grunde war es Tilla ein Rätsel, wie ihr Vater Hansjörg seine Kindheit überlebt hatte. Frieda sagte nicht nur zu allem ja, sie hatte auch vor nichts Angst und machte sich fast nie Sorgen.
Mit verschmitztem Lächeln wendete sich Nepomuk jetzt an sie. »Oma, darf ich?«
»Deine Schwester hat recht, hier ist es zu gefährlich.«
Überrascht drehte sich Tilla zu ihr um. Sie hatte eine Hand auf das Eisengeländer der Reling gelegt, den Blick an ihren Enkelkindern vorbei aufs Meer gerichtet.
»Ich dachte, es ist nur eine Legende.« Tilla spürte, wie ihr Herz schneller schlug.
Oma wiegte den Kopf. »Unterschätze niemals eine Legende, Tilla Puls.« Ein eigentümliches Lächeln umspielte ihre Lippen. »Legenden haben Macht. Genau wie die Nordsee. Beide sind unberechenbar.«
»Erzählst du sie uns noch einmal?« Tilla spürte das vertraute Kribbeln unter ihrer Haut. Ihre Mutter war weit entfernt, sie konnte sie nicht ermahnen, die Kindereien sein zu lassen. Also würde Tilla ihr noch einmal genussvoll lauschen.
Großmutter lächelte erst sie, dann ihren Bruder an. »Genau hier, tief unter uns, liegt es. Ein fast vergessenes, uraltes Wrack.«
Nepomuk beugte sich über das Wasser und starrte konzentriert in das unergründliche Dunkelblau.
»Woher weißt du eigentlich, dass es hier liegt?«, fragte Tilla.
»Einmal Fischerin, immer Fischerin. Wir kennen sämtliche Schiffwracks an der nordfriesischen Küste. Wo die Krabbennetze zerfetzt heraufkommen, liegen Schiffe. Dieses hier soll aus einer anderen Zeit stammen. Schon meine Großeltern und deren Großeltern wussten, dass es hier lag. Man sagt, es wäre schon hier gewesen, als es das Watt noch gar nicht gegeben hat und die alte Insel noch nicht versunken gewesen ist. Vor Hunderten von Jahren, als die Menschen eine andere Sprache sprachen, eine Sprache, die auch die Wellen verstanden, da haben Männer eine heilige Kirchenglocke gestohlen. Doch das Meer hat es gesehen. Es sieht alles, und es verzeiht nichts. In einem düsteren Oktober schickte es eine Flutwelle, so gewaltig, dass sie die alte Insel entzweiriss. Die Diebe flohen mitsamt der Glocke auf ein Schiff, um sich in einer anderen, neuen Welt vor ihrem Schicksal zu verstecken. Doch sobald sie auf hoher See waren, hat das Meer das Schiff mitsamt seinen Männern verschlungen. Nie wieder hat man von ihnen gehört. Nur die Glocke, die kann man bis heute hören. Jedes Jahr im Oktober läutet sie in der Tiefe. Und manchmal, wenn der Wind richtig steht, tragen die Wellen ihren Klang bis nach St. Peter …«
Tilla und Nepomuk sahen einander an, lächelten und lauschten, wie sie es bei diesen Worten immer getan hatten, hörten auf das rastlose Flüstern, das ewige Murmeln und Rauschen der Wellen. Als Tilla ein kleines Kind gewesen war, hatte ihr diese Geschichte, die ihre Großmutter in schauerlichem Ton vortrug, noch Angst gemacht. Doch je älter Tilla wurde, desto aufregender fand sie sie. Wie es dort unten wohl aussah, auf dem Meeresgrund? Was wohl mit einem Schiff geschah, das sich nicht auf den Wellen, sondern darunter befand?
Wie gut das trübe Wasser der Nordsee seine Geheimnisse doch verbarg. Schon oft hatte Tilla ihren Vater danach gefragt. Er war Taucher, ganz ähnlich wie Lotte Hass. Nur dass er das Tauchen für den Krieg gelernt hatte, nicht für Spielfilme.
»Warst du schon einmal in der Nordsee?«, hatte sie ihn gefragt. Er hatte kurz mit dem Kopf geschüttelt. Sie sollte nicht weiterfragen, das hatte sie gespürt.
»Darf ich auch tauchen lernen?« Sie konnte es einfach nicht lassen. Doch er hatte nur die Hand gehoben und sie stehen lassen.
Wie gern würde sie mit ihrem Vater zu diesem Wrack hinuntertauchen. Mit Sicherheit könnte sie dort Schätze finden, die noch viel mehr Geschichten erzählten als Omas Treibgut. Wie gern würde sie herausfinden, welche Wahrheiten sich hinter der alten Legende verbargen.
Eines Tages …, dachte Tilla bei sich und genoss diesen verheißungsvollen Gedanken. Eines Tages würde sie dem Meer seine Geheimnisse entlocken.
2. Kapitel
Oktober 1633
Nes Dorn rannte, und bei jedem Schritt roch sie Rauch und Feuer. Der Gestank ihrer Entscheidung hatte sich in ihren Haaren verfangen.
»Komm schon, Nes!«, rief Belanca.
Nes hätte die Schnellere sein müssen. Sie war die Jüngere, die Tochter. Doch Belanca war nun mal keine klassische Mutter. Nes hatte vor Jahren aufgehört, damit zu hadern. Jetzt hastete sie hinter ihr her. Hinter diesem Körper, der größer und massiver war als ihr eigener. Belancas erdfarbener Rock flatterte. Sie hielt die Fackel, die sie bei Einbruch der Dunkelheit brauchen würden, Nes trug den Beutel. Darin war alles, was ihnen noch von ihrem alten Leben blieb. Viel war es nicht, und das war gut so.
Im Rücken hörte sie Keuchen und vergnügtes Grunzen. Es klang, als würden sie von einer Horde Wildschweine verfolgt werden. Und Nes wünschte sich, es wäre wirklich so.
»Wo wollt ihr denn hin?«, rief einer der Männer höhnisch. »Glaubt ihr, woanders ist es besser als bei uns?«
Natürlich wollte Nes glauben, dass es anderswo besser sein würde. Diese Hoffnung trieb die beiden Frauen an, seitdem sie ihr Heimatdorf verlassen hatten. Sie hatte sie gelockt, verleitet.
»Am besten trennen wir uns!« Belanca sagte diese Worte nicht in der Sprache ihres Volkes, sondern in ihrer eigenen, in der, die nur Nes und sie verstanden. Das zornige Gesicht ihres Vaters blitzte vor Nes’ innerem Auge auf. Er hatte es gehasst, wenn Belanca in dieser Geheimsprache redete. Nicht selten hatte er sie dafür grün und blau geprügelt. Doch nun konnte er es nicht mehr hören. Er war fort, und die Sprache, die Belanca eigens für ihre Tochter erfunden hatte, würde ihm nie mehr zu Ohren kommen.
»Du links, ich rechts. Nicht weit von hier steht eine schiefe Espe. Dort treffen wir uns.«
»Ist gut!« Nes’ Lunge brannte, doch ihre Beine waren stark. Sie würden so lange laufen wie nötig.
Nes schlug einen Haken nach links. Hier war das Gras höher, die Erde weicher. Sie sank mit jedem Schritt ein wenig ein, doch das taten ihre Verfolger ebenfalls. Und während die für ihr Vergnügen rannten, lief Nes um ihr Leben.
»Jetzt bleib schon stehen!«
Kurz warf sie einen Blick zurück. Zwei der drei Kerle folgten anscheinend Belanca, denn hinter Nes war jetzt nur noch einer her. Er war jung, bestimmt ein oder zwei Jahre jünger als sie. Und mindestens zehn Jahre jünger als der Mann, den sie geheiratet hatte. Damals, als sie noch ein Zuhause gehabt hatte.
Gier und Vergnügen verzerrten sein helles Gesicht.
»Lass mich in Ruhe!«
Der junge Kerl lachte. »Wann kommt schon mal eine so schöne Frau auf unseren Hof? Und dann ganz allein. Da brauchst du dich nicht zu wundern.«
Nes versuchte, noch schneller zu rennen. Die Wut trieb sie voran.
Belanca und sie hatten nur nach Brot und Käse fragen wollen, sie hatten Geld und einen gewaltigen Hunger. Doch ihnen war nichts als Feindlichkeit entgegengeschlagen. Denn Frauen durften nicht reisen, schon gar nicht ohne männliche Begleitung. Sobald eine Frau niemandem gehörte, gehörte sie allen. Nes und Belanca wussten das, doch der Bauernhof hatte freundlich gewirkt. Ein offenes Scheunentor, der Geruch von Heu, fröhliches Gelächter. Sie hätten dem Schein nicht trauen, besser im Verborgenen bleiben und stehlen sollen, was sie brauchten.
»Lass mich dich wenigstens anschauen. Wie alt bist du? Zwanzig? Ich hab noch nie eine Hure aus der Nähe gesehen!«, rief der junge Kerl hinter ihr her.
Nes hätte darüber hinweggehen und weiterlaufen sollen, bestimmt hätte er bald aufgegeben, doch das konnte sie nicht.
»Ich bin keine Hure!«
Für einen kurzen Moment war Nes abgelenkt und stolperte über einen Stein, der sich zwischen den Gräsern verbarg. Sie strauchelte, ruderte mit den Armen – und spürte seine Hände auf ihrem Körper. Er riss sie zurück, der stechende Geruch von Schweiß stieg ihr in die Nase. Ohne zu zögern, rammte Nes das kleine, scharfe Messer, das sie im Ärmel versteckt bei sich trug, in seinen Oberschenkel. Er schrie auf, ließ von ihr ab und hielt sich das Bein. Fassungslos starrte er auf die Wunde. Für einen Moment blieb Nes stehen und beobachtete das Blut, das durch den Stoff seiner Hose quoll. Er hatte es nicht anders verdient, sagte sie sich. Und doch tat es ihr leid. Denn sie hatte sich geschworen, niemandem mehr Schaden zuzufügen. Nie wieder. Wind kam auf, zog an ihren Haaren, und wieder konnte sie den Gestank, der sich darin verfangen hatte, riechen.
Als ob …
»Du bist wirklich keine Hure.« Der junge Mann presste die Worte zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Du bist eine Hexe.«
Nes schluckte, wich seinem Blick aus und rieb das blutverschmierte Messer an ihrem Rock sauber. Langsam schob sie es zurück in ihren Ärmel. »Behandle die Wunde mit Spitzwegerich.« Ihre Stimme war dunkel und sanft, klang, als wäre nichts passiert. Als wäre alles noch so wie früher.
Der Fremde fluchte. »Hexe!«
Nes drehte sich wortlos um und lief weiter, auf der Suche nach einer schiefen Espe.
Sie erkannte sie schon von weitem. Es war ein hoher, schmaler Baum, an dessen bereits kahlen Ästen nur noch einzelne gelbe Blätter hingen. An seinem schlanken Stamm lehnte ihre Mutter. Obwohl Belanca Dorn zwanzig Jahre älter war als ihre Tochter, wirkten sie fast wie Schwestern. Beide hatten sie feine, klare Gesichtszüge und auffallend hellgrüne Augen. Und beide hatten sie langes lockiges Haar, das sich einzig in seiner Farbe unterschied. Belancas war dunkelblond, beinahe brünett, und von silbrigen Strähnen durchzogen. Nes’ Haar hingegen war von hellem Blond, das im Licht rot schimmerte.
»Immerhin haben wir das«, sagte ihre Mutter, sobald Nes nah genug war. Sie hatte ein Stück Brot aus der Tasche geholt und es entzweigebrochen. Nun hielt sie Nes eine Hälfte hin. Nur kurz konnte Nes den dunkelrot verkrusteten Schorf auf Belancas Handflächen sehen.
»Wie hast du das gemacht?«
Sie griff nach dem Brot und biss sofort hinein. Es war alt und zäh. Nes kaute schnell, schlang es hinunter, um gleich das nächste Stück mit den Zähnen abzureißen.
Belanca antwortete nicht. Ihr Blick wanderte langsam zu dem Fleck auf Nes’ Rock.
»Blut?«
»Nicht meins.«
Belanca nickte. Und dann setzten sie wortlos ihren Weg fort.
Sie schwiegen für Stunden, doch sie hielten sich an den Händen, wann immer sie nebeneinander laufen konnten, oder am Rock oder an der Schulter, sobald der Weg schmaler wurde und sie hintereinander gehen mussten. Belanca schritt voran und beleuchtete den Weg mit ihrer Fackel. Nes folgte ihr und schaute dabei hinauf zum Himmel. Der Mond leuchtete hell, doch die Sterne, an denen sich Belanca und Nes orientierten, waren kaum noch zu sehen. Ganz allmählich setzte die Morgendämmerung ein. Nes’ Beine waren immer schwerer geworden, sie schwankte, so müde war sie. Sie fror. Belanca hingegen ließ sich keinerlei Erschöpfung anmerken. Dabei musste auch sie todmüde sein. Die letzte Rast hatten die beiden Frauen vor einem Tag und einer Nacht gemacht. Seither waren sie unterwegs.
»Wir sollten ein wenig schlafen«, sagte Nes in das Schweigen hinein. »Zumindest ein paar Stunden.«
Belanca ging nicht darauf ein, lief einfach weiter. »Riechst du das?«
»Was riechen?«
»Kannst du es hören?«
Nes lauschte. Ihr war aufgefallen, dass der Boden unter ihren Füßen immer flacher geworden war. Seit sie den Bauernhof hinter sich gelassen hatten, waren sie an keinem Haus mehr vorbeigekommen. Sie waren über weite Wiesen, vorbei an Feldern und kleinen Kiefernwäldern gelaufen. Nes hörte vor allem den Wind, der an ihren Kleidern riss und in ihren Ohren rauschte. Sie konnte nichts riechen, aber sie verstand … Noch einmal drückte sie die Hand ihrer Mutter.
»Sind wir etwa schon da?«
Die beiden Frauen machten keine Pause, bis sie an den Fuß eines breiten Hügels gelangten. Nes warf Belanca einen fragenden Blick zu. Wie sollte sie ihren schmerzenden Körper dort hinaufzwingen? Doch Belanca beachtete sie nicht. Stattdessen begann sie mit dem Aufstieg.
Nes seufzte und schleppte sich hinter ihr her. Es brauchte ein paar Schritte, bis sie das Klappern, Piepsen und Kreischen bemerkte.
»Was sind das für Vögel?«, rief sie gegen den Wind an.
»Austernfischer. Bekassinen. Und Möwen.«
Und dann waren sie auch schon oben, umgeben von tausend flatternden, kreischenden Vögeln im peitschenden Wind. Nes keuchte vor Überraschung auf, versuchte, mit den Füßen Halt zu finden, und breitete die Arme aus. Der Wind zerrte an ihr, ließ ihre Haare wild wirbeln.
Da war es. Das Meer. Belanca hatte ihr so viele Geschichten darüber erzählt. Sie kannte zahlreiche Seeungeheuer, Wassergeister und ertrunkene Herrscher. Sie hatte sich das Meer düster, gefährlich und riesig vorgestellt. Doch was sie jetzt sah, übertraf jede Phantasie. Denn vor ihr lag die Unendlichkeit.
Zwischen Treibholz und Ufergras fanden sie ein altes Ruderboot.
»Wusste ich doch, dass es noch hier sein würde«, sagte Belanca. »Gut, dass die Fischer ihre Angewohnheiten nie ändern.«
Gemeinsam zogen sie es zum Wasser hinunter. Sie streiften ihre Schuhe ab, warfen sie ins Boot und schoben es in die Wellen. Kälte biss Nes in die Zehen.
Belanca lachte, als sie Nes’ Gesicht sah.
»Na, spring schon rein!«
Schnell kletterte Nes ins schaukelnde Boot, hielt sich an der Seitenwand fest und setzte sich auf die Sitzbank. Angespannt betrachtete sie den Boden des Boots, doch es schien kein Wasser einzudringen. Offenbar war es tatsächlich noch dicht. Ruhig schob Belanca es weiter aufs Meer hinaus, und schon bald stand sie bis zur Hüfte im Wasser.
»Komm endlich rein, Belanca!«
Zwar roch die Luft noch nach Herbst, doch im Meer wirbelte der Winter schon dunkel umher.
Endlich kletterte auch ihre Mutter ins Boot. Sie zitterte nicht einmal, als sie nach den Riemen griff. Ihr Rock drückte schwer und nass auf ihre Beine.
Nes ließ den Blick schweifen. Die Wellen wogten und schäumten unter ihnen, trugen sie viel zu schnell und weit vom weißen Strand fort. Bald war er nur noch ein Strich am Horizont.
Wie tief das Meer unter ihnen wohl war?
»Hab keine Angst.« Belanca schaute Nes ernst an.
»Woher weißt du, wohin du rudern musst?«, fragte Nes besorgt.
Belanca zuckte mit den Schultern. »Einmal Fischerin, immer Fischerin.«
Nes nickte. Und allmählich wurde sie ruhiger. Sie atmete langsamer und tiefer, schmeckte das Salz auf ihrer Zunge, hörte die fremden Meeresvögel schreien, fühlte den Wind in ihren Haaren. Es hatte immer geheißen, das Meer brächte den Tod und man täte gut daran, ihm fernzubleiben. Doch jetzt, wo sie ihm so nahe war, konnte sie sich seiner Faszination nicht erwehren.
Der Wind wehte Nes die Haare ins Gesicht. Rauch. Feuer. Noch immer. Wie sie diesen Geruch hasste.
Sie schwieg lange, dann endlich fragte Nes: »Glaubst du, sie sind tot?«
Belanca seufzte. Doch sie antwortete nicht.
Nes beugte sich über die Bootswand und hielt die Fingerspitzen vorsichtig ins Wasser. »Denkst du, ich kann meine Haare im Meer waschen?«
Belanca blickte auf die Wellen, dann sah sie Nes an und nickte.
Nes kniete sich an die Bootswand, beugte sich darüber und tauchte ihren Schopf ins Meer. Sie spürte die Kälte an ihrer Kopfhaut und die Kraft, mit der das Wasser an ihren Haaren zog. Sie wusste, dass es Fische, Muscheln und Würmer im Meer gab. Ja, und vielleicht auch diese anderen Lebewesen, an die ihre Mutter glaubte, von denen man aber im Beisein eines Mannes nicht sprechen durfte. Ob sie wohl alle gemeinsam lebten, dort unten in der Dunkelheit?
Den Kopf vorgebeugt, richtete Nes sich wieder auf und presste mit den Händen das Wasser aus ihren nassen Strähnen. Ihre Haare nahmen gern auf, gaben nur ungern wieder her. Auch wenn der Gestank nicht gänzlich herausgewaschen war, würden sie nun nicht mehr nur nach Vergangenheit, sondern auch nach Zukunft riechen – nach Meer, Salz, Algen und nach Unendlichkeit. Mit langsamen Bewegungen steckte Nes sie zu einem Knoten zusammen.
»Dort ist es«, sagte Belanca und zeigte in die Ferne. »Wir sind fast da.«
3. Kapitel
Winter 1955/1956
Eine der größten Veränderungen in Tillas Leben begann mit Toast Hawaii. Sie war gerade sechzehn Jahre alt geworden, trug ihren Pony immer noch kurz, Hepburn-kurz, und ihre Röcke immer noch lang. Toast Hawaii war Nepomuks Lieblingsessen, und auch ihre Mutter mochte es. Das lag allerdings nicht daran, dass ihre Mutter Dosenananas mit Schinken derart vergötterte wie Nepomuk, sondern eher daran, dass Tilla bei diesem Gericht nichts anbrennen oder Soße bis an die Decke spritzen lassen konnte. Tilla fand eigentlich, sie kochte recht gut, doch jeder Handgriff, den sie anders als ihre Mutter ausführte, beeinträchtigte die Stimmung beim anschließenden Essen enorm. Bei Toast Hawaii passierte das nicht.
Zu fünft saßen sie nun bei normal beeinträchtigter Stimmung am Tisch, kauten und schwiegen auf die friedliche Art. Einzig Großmutter sagte hin und wieder etwas. Etwa »Knuspriger Schinken« oder »Eine wirklich saftige Ananas, Tilla« und »Dieses moderne Essen macht schon Durst, nicht wahr?«.
Sie erntete strenge Blicke von ihrer Schwiegertochter Meta, die der Meinung war, bei den Mahlzeiten werde weder geredet noch getrunken, sondern einzig gegessen. Für alles andere wäre immer noch Zeit. Dabei war eigentlich nie für irgendetwas Zeit: Nepomuk musste ins Bett, die Frauen aufräumen und abspülen und Vater Pfeife rauchend aus dem Fenster sehen. Vater tat selten etwas anderes. Egal, ob im kleinen Wohnhaus in St. Peter oder im Pfahlbaurestaurant von Tillas Familie auf der Sandbank – meistens blickte er schweigend in die Ferne. Dabei stand er stets so ungünstig, dass er Tilla beim Bedienen, Mutter beim Wischen oder Oma beim Kochen im Weg war.
Hansjörg sei nicht immer so gewesen, betonte Frieda häufig. Der Krieg hätte ihn verändert. Manchmal fragte Tilla ihn, wonach er da draußen eigentlich Ausschau hielt, bisher hatte sie aber noch nie eine Antwort erhalten.
Doch heute war es anders. Nach dem Essen blieb Vater sitzen, holte seine Pfeife hervor, und als er anfing, sie zu stopfen, sagte er: »Ich möchte eine wichtige Ankündigung machen.« Und dann sah er Tilla an. So richtig. Er schaute nicht durch sie hindurch oder knapp an ihr vorbei – er fixierte sie. Ihr wurde schlagartig kalt. Hatte sie einen so großen Fehler begangen, dass sich diesmal nicht ihre Mutter, sondern ihr Vater um die Strafe kümmern würde?
Der Blick ihres Vaters wanderte zu Nepomuk hinüber, der blass und starr wurde. »Eine Ankündigung, euch beide betreffend. Aber zuerst, was wisst ihr über Elba?«
Tilla war verwirrt, antwortete aber dennoch wie aus der Pistole geschossen: »1814 wurde Napoleon auf die italienische Insel verbannt.«
»Was noch?«
»Sie liegt im Mittelmeer und ihre Hauptstadt …« Sie unterbrach sich, als ihr Vater die Stirn krauszog.
»Du weinst doch nicht etwa, Nepomuk?«, fragte er.
Tilla drehte den Kopf. Die Augen ihres Bruders waren nass und angstgeweitet.
»Willst du uns wegschicken?«
Bei den Worten lachte ihre Großmutter laut auf. »Ich wusste ja gar nicht, dass du ein kleiner, französischer Diktator bist, Nepomuk!« Sie wuschelte ihm durchs Haar, und er wurde rot.
»Natürlich werde ich euch nicht wegschicken.« Ihr Vater antwortete in einem so ernsten Ton, dass Oma das Lachen wieder verging. »Wir werden gemeinsam nach Elba gehen. Wir drei.«
»Machen wir dort … Urlaub?«, fragte Tilla. Sie wagte gar nicht zu hoffen. Wie alle ihre Freundinnen träumte sie davon, einmal nach Italien zu reisen. Doch bisher war es undenkbar gewesen, dass die Familie Puls in die Sommerfrische fuhr, schließlich beherbergte sie in den warmen Monaten nicht nur Feriengäste in ihrem Haus, sie hatte auch alle Hände voll mit dem Restaurant zu tun.
»Nein.« Vater ließ ein Streichholz aufflammen, hielt es an den Tabak und zog an der Pfeife. »Das wird kein Urlaub. Im Gegenteil. Die Firma Barrakuda aus Hamburg wird die erste deutsche Tauchschule auf Elba eröffnen. Der Inhaber ist ein guter Freund von mir … Von früher. Ich soll die ersten Tauchkurse in diesem Sommer geben. Er hat mir dafür ein ausgezeichnetes Gehalt angeboten. So lange wird Onkel Jakob eurer Mutter hier zur Hand gehen. Und ihr kommt mit mir. Ich möchte, dass ihr tauchen lernt.«
Tilla hielt sich mit beiden Händen an der Tischplatte fest, um nicht vor Begeisterung aufzuspringen. Sie konnte nicht fassen, was sie da gerade gehört hatte. Sollte ihr Traum tatsächlich wahr werden?
Als Tilla und Nepomuk noch ganz klein gewesen waren, hatte Vater ihnen manchmal von riesigen Rochen, gewaltigen Dorschen und bunten Korallen erzählt. Restaurant-Chef war Hansjörg nämlich erst, seitdem sich Frieda dafür zu alt gefühlt hatte. Bis dahin war er Sportschwimmer und Kampftaucher gewesen. Und in seinem Herzen würde er das wohl auch bleiben. Wann immer er vom Tauchen sprach, wurde seine Stimme freundlich und sein Blick klar. Er beschrieb seinen Kindern, wie schwerelos man sich unter Wasser fühlte und wie leicht jede Bewegung war. »Beim Tauchen vergisst man alles andere. Dort unten gibt es keine Sorgen, keinen Alltag, nichts, was einen beschwert.«
Seitdem Tilla zum ersten Mal diesen Glanz in den Augen ihres Vaters gesehen hatte, wollte sie selbst auch tauchen können. Wegen ihres Vaters verehrte sie die Taucherin Lotte Hass, sammelte sämtliche Artikel über sie, schnitt alle ihre Bilder aus und hängte sie sich über ihr Bett. Seinetwegen träumte sie nicht vom Heiraten, wie es Hilde und Hannelore taten, sondern allein vom Tauchen.
Irgendwann wollte sie mit einem Atemgerät auf dem Rücken dort draußen in der Ferne stehen, wo die Wellen auf die Sandbank zurollten. Neben ihrem Vater. Vielleicht würden sie dann gemeinsam hinabsteigen, in diese Tiefe, in der Hansjörg Puls noch der Alte war.
Vor seinem nur halb verspeisten Toast Hawaii saugte Hansjörg an seiner Pfeife und ließ große Rauchwolken aufsteigen. »Der Inhaber möchte, dass auch Kinder unterrichtet werden. Er will beweisen, dass jeder, egal wie alt, das Tauchen lernen kann. Nepomuk, du wirst in wenigen Wochen neun, und eine verantwortungsvolle Aufgabe wie das Tauchen wird dich sicherlich schnell zu einem selbstbewussten Mann machen. Und Tilla, ich weiß, wie gern du schon immer tauchen lernen wolltest. Ich habe dich lange vertröstet, aber ich habe es nicht vergessen.«
Tilla spürte, dass ihre Augen feucht wurden. Mit aller Kraft versuchte sie, sich zusammenzureißen. Nur nicht heulen, sagte sie sich streng. Auf keinen Fall hier vor ihren Eltern. Niemals durften sie ihre Tränen sehen.
»Das ist der schönste Tag meines Lebens«, sagte sie.
»Wart’s erst mal ab.« Ihre Oma lachte und zwinkerte ihr zu. »Da kommen noch ein paar.«
Am nächsten Morgen pochte es laut an Tillas Zimmertür. Erschrocken fuhr sie hoch. Draußen war es noch dunkel.
»Aufstehen, fertigmachen. Wer tauchen will, muss seinen Körper stärken«, sagte Vater durch die Tür. Er hatte sie noch nie geweckt. Tilla atmete flach, während sie seinen Anweisungen folgte.
Wenige Minuten später standen sie, Vater und Nepomuk in der eisigen Februarkälte vor dem Haus. Es war das erste Mal, dass Tilla mit ihm und Nepomuk allein etwas unternahm. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen, ihm zu folgen. Dann trabte er los, in Richtung Seebrücke.
Tilla und Nepomuk liefen hinter ihm her. Für Tilla konnte es gar nicht schnell genug gehen, ihre Aufregung ließ sie regelrecht fliegen. Ihr Bruder hingegen geriet schon nach wenigen Metern ins Keuchen.
»Geht’s?«, fragte sie ihn leise.
Nepomuk antwortete nicht, er japste nur.
»Macht euch bereit!«, rief ihr Vater, sobald sie die Brücke erreicht hatten. Im Laufen drehte er sich zu ihnen um. »Wer zuerst am Strand ist!«
»Aber …« Tilla versuchte, das Gesicht ihres Vaters in der Dämmerung zu erkennen. »Das ist ungerecht! Nepomuk hat doch viel kürzere Beine als ich!«
»Ungerecht?« Vaters Stimme klang hart. »Ihr wisst nichts über Ungerechtigkeit. Eins, zwei, drei.«
Beide Geschwister spurteten los. Tilla war selbstverständlich schneller, augenblicklich ließ sie ihren Bruder hinter sich. Ihre Füße schlugen dumpf auf den Holzplanken der Brücke auf. Ein Kilometer war lang, vor allem, wenn man rannte. Doch sie konzentrierte sich einzig auf das weitentfernte Glitzern des Meeres. Sie lief unter den gebogenen Lampen, an den Sitzbänken und Telefonzellen vorbei und näherte sich der Sandbank. Als sie endlich ankam, stach es heftig in ihrer Lunge. Sie rang nach Atem, beugte sich vor, stützte die Hände auf ihre Knie.
»Gerade stehen bleiben«, sagte ihr Vater.
Erst Minuten später kam Nepomuk bei ihnen an. Er taumelte und keuchte.
»Merke dir diesen Tag«, sagte ihr Vater zu ihm. »Nie wieder wirst du so langsam sein wie heute, hörst du? Miss dich nicht mit deiner älteren Schwester. Sondern immer mit dir selbst.«
Nepomuk nickte und wollte sich in den eiskalten Sand fallen lassen.
»Nein! Bleib stehen, das ist besser für deinen Kreislauf. Und guck deiner Schwester zu.«
Sobald Tilla sich etwas erholt hatte, legte ihr Vater mit der ersten Übungseinheit los. Er ließ sie über den Sand sprinten, Hampelmänner und Liegestütze machen. Dann musste sie zwischen zwei Pfahlbauten hin und her laufen, während ihr Vater schrie: »Knie hoch, Fersen ans Gesäß!«
Tilla rannte, sprang, prustete und schwitzte. Allmählich tauchte ein rotgoldener Schein am Horizont auf. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne ergossen sich über das Meer, und Tilla war sich sicher, dass sie diesen Anblick niemals vergessen würde. Ihr Vater war hier, bei ihr und sah endlich, wie sehr sie sich bemühte. Gleichzeitig spürte sie jede Faser ihres Körpers, die Luft in ihrer Lunge, die Kraft in ihren Beinen. Und sie hörte das lockende Flüstern der Wellen. Bald, dachte Tilla und blickte über das Meer, bald bin ich bereit.
4. Kapitel
Oktober 1633
Nes hatte sich diese Insel namens Strand anders vorgestellt. In Belancas Geschichten war sie öde und einsam gewesen. Ein ausgedörrtes Land, das vielmehr dem Meer gehörte als den Menschen. So klein, dass es zwischen den Wellen kaum zu sehen war, und doch groß genug, dass eine Bewohnerin den lieben langen Tag keiner zweiten Menschenseele begegnete. Es war ein Ort der Widersprüche.
»Die Insel ist stumm. Sie ist geschwätzig. Sie vergisst. Sie vergisst niemals. Die Insel ist eine Falle. Die Insel ist unsere Rettung«, hatte Belanca gesagt.
Im Grunde hätte Nes klar sein müssen, dass es einen solchen Ort nicht gab.
»Ist das Strand?«, fragte sie, ohne ihre Mutter anzusehen.
Belanca antwortete nicht. Schweigend näherten sie sich der weichen Küstenlinie. Glänzendes Watt erhob sich aus der See, dahinter lag gelber Sand, aus dem in der Ferne kräftige Holzstämme ragten. Sie stützten einen hohen, stellenweise grün bewachsenen Erdwall. Einen Wall gegen das Unheil der See. Und dahinter ragten Kirchturmspitzen in den Himmel.
Unbeirrt ruderte Belanca weiter. Sie hielt nicht direkt auf den Strand zu, sondern steuerte das Boot entlang der Küstenlinie. Bald sahen sie die ersten Menschen. Männer und Frauen, die mit Schaufeln Sand auf Karren häuften. Andere, die diese Karren den Wall hinaufschoben und sie dort leerten.
»Sie vergrößern den Deich.«
Fragend sah Nes ihre Mutter an.
»So nennt man den Hügel, den diese Insel vor dem Meer schützt. Jeder Tag ist ein Kampf.«
»Es sieht nicht aus, als würden sie kämpfen.«
Kinderlachen wehte zu ihnen herüber. Hoch oben auf dem Deich waren kleine Gestalten zu sehen, die offenbar Fangen spielten. Nes musste bei ihrem Anblick lächeln. Vielleicht würde sie hier finden, was sie seit Jahren suchte: Schutz und Geborgenheit.
»Gleich dahinter liegt das Dorf Trindermarsch«, sagte Belanca. »Und etwas weiter im Inneren Evensbüll.«
An Land wurde ein Mann auf das Ruderboot mit den beiden Frauen aufmerksam. Er richtete sich auf, schirmte seine Augen mit der Hand ab und folgte dem Boot mit seinem Blick. »Das ist doch nicht etwa …?«
Nes sah ihre Mutter an. Die senkte den Blick und ruderte entschlossen weiter.
»He, Göntje!«, rief der Mann jetzt einer Frau zu, die nicht weit von ihm schaufelte. »Guck dir das an und sag mir, dass ich nicht verrückt geworden bin.«
Auch die Frau richtete sich auf und schirmte die Augen ab. »Unsinn, das kann nicht sein.« Doch auch sie wendete den Blick nicht vom Boot ab.
Mit kräftigen Zügen ruderte Belanca weiter, bis die Leute nur noch Punkte in der Ferne waren.
Bald sahen sie keine Menschenseele mehr. Schilf wehte im Wind, dahinter tauchte ein hölzerner Steg auf, der bis ins Wasser reichte.
»Hier ist es«, sagte Belanca.
Mit geübten Griffen vertäute Belanca das Boot am Steg. Dann fasste sie Nes’ Hand. Nes konnte Belancas frische Narben spüren, sofort verdrängte sie die aufkommenden Erinnerungen. Hier, auf Belancas Insel, die auch die ihre werden sollte, hatten sie nichts zu suchen. Hand in Hand liefen sie über die verwitterten Bretter, bis sie Sand unter ihren Füßen spürten.
»Darf ich fragen, wer ihr seid?«
Mit einem erstickten Keuchen wirbelte Nes herum. Die fremde Gestalt stand so plötzlich hinter ihnen, dass Nes’ ganzer Körper vor Schreck bebte. Wo war sie hergekommen? Panisch sah sich Nes um. Lauerten ihnen noch mehr Leute auf?
»Mein Name ist Belanca Dorn, das ist meine Tochter Nes. Wir suchen den Schutz und die Gemeinschaft der Beginen.«
Wie konnte Belanca so ruhig bleiben? Sie lächelte sogar freundlich, während Nes darüber nachdachte, ob sie ihr Messer zücken sollte.
»Wir bieten allen Frauen Schutz und Gemeinschaft, die sie brauchen.« Auf dem Gesicht der Fremden erschien ein untergründiges Lächeln, während sie Nes forschend in die Augen sah. Nes begann sich zu entspannen. Vor dieser hochgewachsenen Frau brauchte sie keine Angst zu haben, das konnte sie spüren. Bei ihr waren sie in Sicherheit.
Langsam zog die Fremde die Kapuze von ihrem Kopf, so dass ein tiefer, dunkelblonder Haaransatz zum Vorschein kam. Sie war jung, ihre Gesichtszüge markant und klar. »Belanca und Nes Dorn also«, sagte sie, und zum ersten Mal mochte Nes den Klang ihres eigenen Namens. Sie konnte den Blick nicht von diesem fremden Gesicht lösen. Etwas darin schien hell zu leuchten. »Woher kommt ihr?«
Nes wusste nicht, wie sie ihr das erklären könnte, doch Belanca antwortete bereits: »Aus dem Landesinneren, zwei Tagesreisen entfernt. Eine Krankheit hat unsere Familie ausgelöscht.«
»Eine Krankheit?«
Belanca hob die Hände. »Keine Angst, das ist schon Wochen her. Wir beide sind verschont geblieben.«
»Welche Krankheit war es?«
Nes presste die Zunge fest an den Gaumen und bemühte sich, den Blick nicht zu senken.
»Das wissen wir nicht, wir haben sie nie zuvor gesehen …«
Die Fremde legte den Kopf schief. »Und warum kommt ihr ausgerechnet zu uns?«
Belanca lächelte. »Ich bin auf Strand aufgewachsen … Darf ich fragen, wie du heißt?«
»Entschuldigt meine Unhöflichkeit. Ich bin Perke Peters. Wenn ihr mögt, führe ich euch zu unserem Konvent.«
Zuerst bemerkte Nes die Turmspitze, auf der statt eines Kreuzes eine Kugel saß, dann, hinter hohem Gebüsch, das seltsame Gebäude selbst. Es stand auf einem grünen Hügel, der sich hinter dem tiefgelben Strand erhob, und wirkte, als wäre ein ganzes Dorf zu einem Haus zusammengewachsen, so verwinkelt war es. Das Reetdach hatte unterschiedliche Höhen, mal war es spitz, mal geschwungen. Manche der steinernen Wände waren so schmal, dass nur ein winziges Fenster hineinpasste, andere so breit und ausladend, dass große Türen und Balkone zu sehen waren. Es gab die unterschiedlichsten Anbauten und Ställe. Nes schaut in einen großen, offenen Hof. Alles strahlte eine solche Wärme und Behaglichkeit aus, dass Nes nicht anders konnte, als Hoffnung zu schöpfen. Nie zuvor hatte sie ein so schönes Gebäude gesehen. An einer über den Hof gespannten Schnur hingen Kleider zum Trocknen. Grob gezimmerte Schemel standen herum, und der Duft von gebratenem Fisch erfüllte die Luft. Nes hörte das Geklapper von Geschirr und spürte, wie sich ihr Magen vor Hunger zusammenzog.
»Belanca.«
Eine fremde Stimme ließ sie herumfahren. Sie war leise, aber bestimmt. Von der anderen Seite des Hofs kam eine weißhaarige Frau auf sie zu. Im Gegensatz zu Perke lächelte sie kein bisschen.
»Du scheinst dich verdoppelt zu haben, meine Liebe …« Die Frau blieb direkt vor ihnen stehen und sah zwischen Nes und Belanca hin und her. »Ich sehe deine erwachsene Erscheinung vor mir – und die junge, die damals von hier aufgebrochen ist.«
»Ich bin ihre Tochter.« Es war das erste Mal, dass Nes an diesem Ort das Wort ergriff, und ihre Stimme klang mutiger, als sie sich fühlte. »Nes Dorn.« Doch die Frau beachtete sie nicht.
Belanca räusperte sich. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich in meinem Leben noch einmal sehen würde.« Kurz zögerte sie, dann fügte sie hinzu: »Guten Abend, Mutter.«
Auf Nes’ Teller lag ein Schollenfilet. Es duftete so herrlich und war so saftig, dass sie alles um sich herum für einen Moment vergaß – die Stube mit den Mustern auf den Holzbalken und den Blumenmalereien an den Wänden, die Perke Peters Pesel nannte, und auch die vier fremden Frauen – die einzigen Bewohnerinnen des gewaltigen Gebäudes –, die sich mit ihnen an den Tisch gesetzt hatten und sie nun unumwunden anstarrten. Sogar diese weißhaarige Fee, die Nes’ Großmutter war, hatte sie für einen kurzen Augenblick vergessen. Nes kaute und schluckte. Es war köstlich, und dennoch fiel es ihr zunehmend schwer, die Mahlzeit zu genießen, denn sie wusste nicht so recht, was sie von alldem halten sollte. Mit ihrer anderen Großmutter hatte sie fürchterliche Erfahrungen gemacht. Und diese hier schien ihr keinen Deut besser zu sein. Während Nes ihre Scholle aß, musterte sie die Alte möglichst unauffällig. Sie war eine schöne Frau. Und doch blieb ihre Miene streng und unbewegt. Zwei tiefe Falten an ihren Mundwinkeln deuteten darauf hin, dass sie die Lippen gern zu einem missbilligenden Strich verzog. Den Oberkörper hielt sie gerade, als wäre er aus Holz. Nur ihre Augen huschten beobachtend von einer der Frauen zur anderen.
»Sagt, was hat euch hierher verschlagen?«, fragte die jüngste Bewohnerin, die sich kurz zuvor als Walburga Beheim vorgestellt hatte, in die Stille hinein. Ihre Stimme war ein Piepsen, und ihre zarten Gesichtszüge mit den großen Augen verliehen ihr etwas Kindliches. Nes konnte nicht anders, als ihr offenes Lächeln umgehend zu erwidern – es tat gut, in ein so freundliches Gesicht zu blicken. »Wisst ihr, ich bin nicht von hier«, sagte Walburga. »Deshalb ist es für mich so aufregend, andere Frauen vom Festland zu treffen!«
»Sie sind nicht vom Festland«, sagte Perke trocken, mit vollem Mund und ohne den Blick von ihrem Fisch zu heben.
»Oh, sie scheinen es zumindest mehr zu sein als alle anderen hier auf Strand!« Walburga lachte und warf der vierten Frau in der Runde, Gyde Carstens, einen auffordernden Blick zu. Die nickte und lächelte pflichtschuldig. Gyde schien das Gegenteil der zarten Walburga zu sein, ihre Haare waren matt, ihre Augenwinkel schlaff und müde, die Schneidezähne standen vor und drückten von innen gegen ihre kräftigen Lippen.
»Ich stamme ursprünglich aus einem Kloster drei Tagesreisen von hier entfernt. Ich war Nonne«, sagte Walburga. Sie strich sich die honigblonden Haare zurück, und Nes erschrak – ihr fehlte ein Ohr. Stattdessen sah sie an seiner Stelle nichts als tiefrote, zerfurchte Haut. Erst auf den zweiten Blick bemerkte sie, dass auch an ihrer rechten Hand Glieder fehlten, statt des Zeige- und Mittelfingers waren da nur noch zwei Stümpfe. »Doch Jesus befahl mir, diesen Ort hinter mir zu lassen. Er sagte zu mir: ›Geliebte, gehe gen Norden, so wirst du finden dein Seelenheil.‹ Er führte mich bis zum Meer und auf diese Insel. Und hier bin ich.« Vergnügt zog sie die Schultern hoch. »Es war Gottes Plan, dass wir uns heute hier begegnen, denkt ihr nicht auch?«
»Belanca ist keine Katholikin«, sagte die Frau, die von nun an Nes’ Großmutter sein sollte, mit eisiger Stimme. »Sie glaubt nicht an Gott.«
Bei diesen Worten blieb den drei anderen Frauen der Mund offenstehen. Belanca erwiderte ruhig: »Natürlich glaube ich an Gott, Mutter.«
»Du hast kein Recht mehr, mich so zu nennen, Belanca. Mein Name ist Kreske Ketels. Belassen wir es dabei.«
Unter anderen Umständen hätte Nes sich am Klang des Namens erfreut. Wie einen alten Zauberspruch hätte sie ihn ein paar Mal vor sich hin geflüstert, doch die Stimmung war dermaßen angespannt, dass sie jetzt besser den Mund hielt.
»Gut, Kreske … Ich bin auf dem Festland zum Protestantismus konvertiert, so wie es außerhalb von Strand Usus ist. Mein Gottesglaube ist unverändert.«
Die alte Frau lachte ohne jede Belustigung auf. »Natürlich ist er das …«
Dann aß sie schweigend weiter.
Während sich Gyde mit belegter Stimme erkundigte, ob jemand noch etwas Gemüse haben wollte, beugte Nes sich zu ihrer Mutter und flüsterte in ihrer Geheimsprache: »Warum ist Großmutter so unfreundlich?«
Belanca sah Nes erschrocken an, doch bevor sie etwas erwidern konnte, kam Kreske ihr zuvor: »Deine Mutter und ich sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen.«
Als sie diese Worte aus Kreskes Mund hörte, fiel Nes die Gabel aus der Hand. Entgeistert starrte sie ihre neue Großmutter an. »Du sprichst unsere Sprache?«
Für einen Moment war es vollkommen still im Pesel. Dann lachte Walburga glockenhell. Amüsiert fielen Perke und Gyde in das Gelächter ein.
»Eure Sprache?«, fragte Kreske mit hochgezogenen Augenbrauen. »Friesisch gehört uns allen, oder etwa nicht?«
»Friesisch?«, wiederholte Nes fragend.
»Walburga zuliebe verzichten wir meistens darauf. Sie versteht das Friesische zwar, doch fällt es ihr noch ein wenig schwer.«
Belanca sah ihre Tochter entschuldigend an.
»Friesisch ist die Sprache des Nordens«, sagte Kreske. »Deine Mutter hat sie mitgenommen, als sie die Insel verlassen hat.« Es klang, als wollte sie gestohlen sagen.
Die Enttäuschung durchfuhr Nes wie eine eiskalte Nordseewelle. Sie dachte daran, wie ihre Mutter sich einst Vater in den Weg gestellt hatte. Wie sie Nes abgeschirmt, einen Schlag, der für ihre Tochter bestimmt gewesen war, eingesteckt und »Lauf in den Wald!« gerufen hatte, »Ich lenke ihn ab«. Und im Gegensatz zu Nes hatte er kein Wort verstanden. Sie allein war in den Wald gerannt, und niemand war ihr gefolgt.
Sie dachte an ihre jüngere Schwester, die keine Geduld für diese Geheimsprache gehabt hatte. Sie hatte über Nes gelacht. »Wenn du mit diesen Kindereien nicht aufhörst, wirst du niemals heiraten«, hatte sie ihr prophezeit. Und dann hatte sie sich an ihren frischangetrauten Gemahl geschmiegt und glücklich die Augen geschlossen. Sie war zwei Jahre jünger als Nes und erst vierzehn gewesen, als sie geheiratet hatte. Sofort stieg der altbekannte Schmerz in Nes auf, und sie verscheuchte die Erinnerungen.
Als Nes ihr Dorf, ihr altes Leben und alle, die sie einst liebte, zurückgelassen hatte, da hatte sie diese Sprache mit sich genommen – ihren Schatz, der nicht verging, der ihr gehörte, für immer.
Und nun erfuhr sie, dass ihre Mutter ihr nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ihre geheime Sprache war nicht geheim. Sie gehörte unzähligen Menschen. Menschen, die sie besser sprachen als Nes. In diesem Moment begriff sie, dass sie nichts besaß. Und dass das Vertrauen zu ihrer Mutter, auf das sie bisher all ihre Entscheidungen begründet hatte, trügerisch war.
»Ich erkläre es dir später«, flüsterte Belanca ihr zu, und jeder am Tisch konnte sie verstehen.
Nes zwang sich zu einem Nicken, zu einem Lächeln. Niemals würde sie ihrer Mutter vor diesen fremden Frauen Vorwürfe machen. Schon gar nicht vor Kreske Ketels, die nur darauf zu lauern schien, dass hier ein Streit losbrach. Nes wollte ihre neue Großmutter dafür hassen, doch sie konnte es nicht. So hart ihr Blick auch war – ihre zittrige Hand, mit der sie ihre Gabel eine Spur zu langsam zum Mund führte, ihr schnelles Blinzeln und die roten Flecken an ihrem Hals verrieten sie. Sie war lang nicht so kaltherzig, wie sie wirken wollte, vielmehr schien es in ihr zu toben. Nes erkannte sich selbst in Kreske wieder. Vielleicht hatten sich an ihrem Hals ebenfalls rote Flecken gebildet, in jedem Fall bebte auch ihre Hand. Sie waren einander ähnlich, das ahnte Nes. Ihren Körper konnten sie zähmen, jedoch nicht ihr Herz.
»Ich bin erstaunt, dass es diesen Konvent bis heute gibt«, sagte Belanca in sanftem Ton. »Im ganzen Land verschwinden die Beginen. Aber ihr seid noch hier.«
»Zumindest vier von uns.« Perke grinste. »Wir halten die Stellung.« Sie reckte eine Faust in die Luft. Walburga kicherte vergnügt, und Gyde beeilte sich, ebenfalls zu lächeln.
»Natürlich haben sie versucht, uns zu vertreiben.« Mit kalter Stimme erstickte Kreske die aufkommende Fröhlichkeit. »Sie haben uns verboten, unsere Kerzen, unser Garn und unsere Wappen zu verkaufen. Aus Angst, wir würden den Handwerkern der Insel Konkurrenz machen. Neuaufnahmen sind uns untersagt. Nur dank unseres Gönners dürfen wir lebenslang im Konvent wohnen bleiben und die Kinder von Strand unterrichten.«
»Ihr dürft niemanden aufnehmen?«, fragte Nes nach.
Mit kühlem Ausdruck sah ihre Großmutter sie an. »Ihr habt doch nicht gedacht, ihr könntet in die alte Heimat zurückkehren, und alles würde wieder so, wie es nie war?«
»Mutter …«, setzte Belanca an.
»Mein Name ist Kreske!«
Einen Moment lang herrschte Stille.
Dann legte Kreske ihre Hände flach auf den Tisch. »Es ist Zeit für das Gebet. Belanca, Nes, bitte entschuldigt uns.« Sie stand auf, und zögerlich folgten die anderen Frauen ihrem Beispiel.
»Aber, der Tisch …«, sagte Walburga. »Wir müssen doch erst mal …«
»Wir werden abräumen.« Belanca nickte ihr zu. »Macht euch keine Sorgen. Wir sind sehr dankbar für eure Gastfreundschaft.«
»Sollten unsere Gäste nicht mit uns beten?«, fragte Gyde. Immer wieder fuhr sie mit den Handflächen über ihren grauen Rock.
Doch Kreske hatte sich bereits abgewendet und war im Begriff, den Raum zu verlassen. Schnell eilten Walburga, Gyde und Perke ihr nach.
Sobald sie weg waren, spürte Nes, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten.
»Ich werde dir alles erklären. Bitte urteile erst dann über mich, wenn du meine Geschichte gehört hast«, Belanca sah sie flehend an. »Versprichst du mir das, mein Herz?«
Nes schluchzte auf und nickte. »Ich verspreche es.«
5. Kapitel
Mai 1956
Noch nie zuvor hatte Tilla Puls das Eintreffen der Badegäste verpasst. Doch diesmal würde sie nicht beobachten, wie sich die gewaltige Sandbank füllte, wie die Cafés und Strandkörbe erobert wurden und all die Sandburgen entstanden. Denn während in diesem Frühling die Fremden in den Norden kamen, reiste Tilla gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem Bruder in den Süden.
Die Fahrt war lang. Zunächst sah Vater schweigend aus dem Fenster, und die Geschwister malten sich die italienische Insel flüsternd als Paradies aus, das von Wind und Wetter verschont blieb. Irgendwo in Tillas Bauchgegend bildete sich dabei ein kleiner Knoten. In St. Peter kannte sie jeden, dort hatte sie ihre Freundinnen, ihre Familie. Wie würde dieser Sommer werden – ohne all das?
»Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor?«, fragte ihr Vater plötzlich. Erstaunt sah Tilla ihn an, sein Blick war ernst und aufmerksam.
Nepomuk antwortete schnell und aufgeregt: »Ich werde Seemann. Vielleicht fange ich mal einen Wal, dann baue ich für unser Fischrestaurant ein so riesiges Walknochentor wie das auf Nordstrand!«
Vater sah ihn aufmerksam an. »Du weißt, dass es schon lange keine deutschen Walfänger mehr gibt?«
»Natürlich weiß ich das.« Nepomuks Gesicht bekam einen Rotstich. »Aber es gibt eine griechische Reederei, die Nordfriesen einstellt. Ulfs großer Bruder arbeitet dort.«
»Ulf?«, fragte Vater.
Tilla verzog unwillkürlich das Gesicht, als hätte sie sich geschnitten. Vater wusste nicht, wer Ulf war.
»Er ist mein bester Freund!« Nepomuk strahlte und beugte sich ein wenig vor. »Wir machen alles zusammen, reden jeden Tag, wir sitzen in der Schule nebeneinander und …«