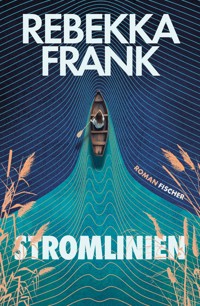
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie schwer wiegt ein Geheimnis? Ein großer, sensibel erzählter Familienroman über Lebensentscheidungen, die uns auseinandertreiben können – oder für immer miteinander verbinden. Enna und Jale sind in den Elbmarschen zu Hause. Sie leben im Rhythmus von Ebbe und Flut, beobachten Kormorane und Austernfischer – und zählen die Tage, bis ihre Mutter Alea aus der Haft entlassen wird. Doch als es endlich so weit ist, verschwindet nicht nur Alea spurlos, sondern auch Jale. Entschlossen durchkämmt Enna auf der Suche nach ihnen das Alte Land, ohne zu ahnen, dass dieser Weg sie für immer verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rebekka Frank
Stromlinien
Roman
Über dieses Buch
Enna und Jale sind in den Elbmarschen zu Hause. Sie streifen immer zu zweit umher, während sie Ebbe und Flut, Kormorane und Austernfischer beobachten, den Feuerkröten lauschen und die Tage zählen, bis ihre Mutter Alea aus der Haft entlassen wird. Doch als es endlich so weit ist, verschwindet nicht nur Alea spurlos, sondern auch Jale. Nur Stunden später kentert ein Boot, und ein Mann verunglückt. Das Dorf hat schnell zwei Verdächtige: Alea Eggers und ihre verschwundene Tochter. Enna jedoch ist von der Unschuld ihrer Mutter überzeugt. Und davon, dass ihre Schwester sie niemals verlassen würde. Unbeirrt durchkämmt die junge Frau das Alte Land und stößt bei der Suche nach ihrer Mutter und Schwester auf ein überflutetes Dorf, ein altes Familiengeheimnis und eine unerwartete Liebe.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Rebekka Frank wurde 1988 in Kassel geboren. Nach dem Studium der Theaterwissenschaften und Germanistik arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie findet ihre Inspiration in der Natur, in genauer Recherche und in den Verbindungen zwischen Menschen, wo man auf den ersten Blick keine vermuten würde. Im Zentrum ihrer Geschichten steht oft ein Geheimnis, an dessen Auflösung ihre Protagonistinnen wachsen. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Hund auf dem Land in Nordhessen. Auf Instagram und TikTok ist sie unter @rebekka.mit.k zu finden.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort
[Eine Gestalt kippt und fällt ...]
Kapitel 1 15. August 2023
[Die Steine, tief in den Hosentaschen, ...]
Kapitel 2 16. August 2023
Kapitel 3 11. Dezember 1983
Kapitel 4 16. August 2023
Kapitel 5 10. Januar 2023
Kapitel 6 16. August 2023
Kapitel 7 1. August 1923
Kapitel 8 16.–17. August 2023
[Der Körper ist gerade erst ...]
Kapitel 9 2. Oktober 1984
Kapitel 10 17. August 2023
Kapitel 11 September 1923
Kapitel 12 17. August 2023
Kapitel 13 Januar 2023
Kapitel 14 17. August 2023
[Mit dem Gesicht nach oben ...]
Kapitel 15 17. August 2023
Kapitel 16 2. Oktober 1984
Kapitel 17 17.–18. August 2023
Kapitel 18 September 1923
Kapitel 19 18. August 2023
Kapitel 20 Januar 2023
Kapitel 21 19. August 2023
[Über dem Körper wird es taghell ...]
Kapitel 22 19. August 2023
Kapitel 23 Februar 1924
Kapitel 24 19. August 2023
Kapitel 25 2. Oktober 1984
Kapitel 26 19. August 2023
Kapitel 27 2. Oktober 1984
6. Dezember 1978
Kapitel 28 6. Dezember 1978
Kapitel 29 19. August 2023
Kapitel 30 11. Dezember 1978
Kapitel 31 2. Oktober 1984
Kapitel 32 19. August 2023
Kapitel 33 12. Dezember 1978
Kapitel 34 12. Dezember 1978
2. Oktober 1984
Kapitel 35 19. August 2023
Kapitel 36 2. Oktober 1978
Kapitel 37 19. August 2023
[Die Ebbe zerrt am Körper ...]
Kapitel 38 19. August 2023
Kapitel 39 10. Mai 2023
Kapitel 40 19. August 2023
Kapitel 41 Winter 1984/85
Kapitel 42 19. August 2023
Kapitel 43 April 1985
Kapitel 44 19. August 2023
Kapitel 45 Juni 2023
Kapitel 46 19. August 2023
Kapitel 47 Mai 1985
Kapitel 48 19.–21. August 2023
Kapitel 49 Juli 2023
Kapitel 50 21. August 2023
Kapitel 51 1985–2006
Kapitel 52 21. August 2023
Kapitel 53 5. August 2023
Kapitel 54 März – September 2006
Kapitel 55 21. August 2023
Kapitel 56 15. August 2023
Kapitel 57 21. August 2023
Kapitel 58 August 2011
Kapitel 59 21. August 2023
Kapitel 60 21. August 2023
Kapitel 61 21. August 2023
Kapitel 62 21. August 2023
Kapitel 63 13. September 2023
Kapitel 64 15. August 2023
Kapitel 65 September – Oktober 2023
Kapitel 66 16. Oktober 2023
Kapitel 67 29. Oktober 2023
Nachwort
Für alle, die wissen, wie schwer ein Geheimnis wiegt.
Eine Gestalt kippt und fällt. Ihre Augen sind geschlossen. Sie sehen die dünnen Schleierwolken am Himmel nicht. Nicht den weißen Bauch der Seeschwalbe, die hoch oben, fast lautlos, mit ihren grauen Flügeln schlägt. Nicht das undurchdringliche Schilf am Ufer der Elbe, in dem auf und ab schaukelnd die Tauchenten schlafen. Nicht all die Häuser weit dahinter, deren Bewohner noch immer plaudernd in ihren Gärten sitzen – als wäre dies ein ganz normaler Tag. Ein allerletzter Atemzug – süß und salzig zugleich. Von den Marschwiesen rufen ein paar Feuerkröten herüber, eine mystisch dunkle Melodie, dann trifft der Rücken auf die gekräuselte Wasseroberfläche. Schwer und kraftlos. Der Körper kämpft nicht mehr. Er rührt sich nicht, wird nur von den Wellen bewegt. Der Fluss ist kalt, aber nach einem heißen Tag wie diesem hat sich sein Wasser an der Oberfläche erwärmt. Als Kind hat es dieser Mensch, dessen Körper nun untertaucht, geliebt, Wärme und Kälte gleichzeitig auf der Haut zu fühlen. Hat die Arme ausgebreitet, die Finger gespreizt und den unterschiedlichen Temperaturen nachgespürt. Seine Hände sind warm gewesen, die Füße nadelstichkalt. Er hat gequietscht vor Vergnügen, mit den Beinen gestrampelt und sich die geheimnisvolle Tiefe ausgemalt. All die bunten Fischschwärme, die leuchtenden Muscheln und Würmer, die versunkenen, vergessenen Schätze. Die kalte Dunkelheit.
Doch das Kind von damals ist erwachsen geworden, hat sich schon lange nichts dergleichen mehr vorgestellt. Denkt nicht an den blaugrünen Fluss, der breit und scheinbar ruhig daliegt, nicht an seine unzähligen Bewohner. Nicht an all das, was verloren ist, was zurückbleibt – für immer.
Taumelnd sinkt der Körper hinab, wird von den Gezeiten erfasst und hineingerissen in den erlösenden Strom der Elbe.
Kapitel 115. August 2023
Quellwolken hingen über der Elbe und färbten das Wasser aschfahl, beinahe schwarz. Aus der Ferne rollte Donner heran, gegen den die Graugänse am Ufer anschrien. Ohne die Flut wäre die Luft drückend gewesen. Doch die sich kräuselnden Wellen spülten einen Hauch von Nordseeweite bis hin zur Elbinsel Hanskalbsand.
Wir saßen im furchendurchzogenen Watt, vergruben die Füße und die Hände darin und schauten auf den Fluss hinaus. Nicht weit von uns wartete die Sturmhöhe, unser blaugrünes Holzboot mit dem kleinen alten Motor am Heck, den zwei schmalen Sitzbrettern in der Mitte und der abblätternden Farbe an den Seitenwänden. Damit man es vom Festland aus nicht sah, hatten wir es tief ins Ufergras gelenkt, dorthin, wo die Bäume ihre dunkelgrünen Blätter über die wogenden Schilfrispen senkten.
Hanskalbsand mit seinen Büschen, Auwäldern und dem kleinen Binnensee stand unter Naturschutz, und das war gut so. Niemand sollte auf der Insel seinen Müll hinterlassen, das Schilf zertreten oder laut lachend die Dunkelwasserläufer verscheuchen. Niemand durfte hier sein – nur für uns galt das nicht. Schließlich waren wir selbst so etwas wie Dunkelwasserläufer. Wie Graugänse. Wir hinterließen keine Spuren, und wir machten kein Geräusch, wenn wir das nicht wollten. Meine grün-schwarz gefärbten Haare verschmolzen mit dem Ufergras, und die braun gebrannte Haut meiner Zwillingsschwester schien eins zu sein mit dem feuchten Flusssand.
Wir waren die Elbmädchen, wir waren siebzehn Jahre alt, und morgen war es endlich so weit.
»Jetzt sind es noch genau sechzehn Stunden«, sagte Jale, und in meinem Magen schlug die Vorfreude kleine Wellen.
»Noch sechzehn Stunden.« Ich reckte mich und schaute über das Wasser, hinüber nach Hahnöfersand. Auf die grünen weiten Wiesen, die aneinandergereihten Bäume, die Felder, die sich seit Jahren kaum verändert hatten.
Schon als Kinder hatten wir hier gesessen, zu dieser anderen Insel hinübergesehen und viel höhere Zahlen genannt. »Es sind noch achthundertsechsundzwanzig Tage, sechs Stunden und dreiundzwanzig Minuten«, sagten wir zum Beispiel und lauschten dem Rauschen der Wellen, die unsere Zahlen bei Flut nach Hamburg und bei Ebbe hinaus aufs Meer trugen. Hauptsache fort, dachten wir, Hauptsache weit weg, damit sie endlich schrumpfen und vom Wind verwirbelt werden würden.
Seit zwölf Jahren kamen wir nach Hanskalbsand, um die Tage zu zählen. Beim ersten Mal waren wir gerade fünf Jahre alt geworden, und Oma Ehmi hatte uns mit dem Boot hergefahren. Ein denkwürdiger Tag. Großmutter hatte uns nur selten zu Ausflügen mitgenommen. Seitdem ich denken konnte, sprach sie wenig mit uns – oder mit irgendjemandem sonst. Wenn Oma nicht gerade an der Universität war, versank sie in ihrem Ohrensessel neben dem überquellenden Bücherregal, um Zeitungen, Magazine oder staubige Bücher zu lesen. Nicht selten schlief sie darüber ein, und die Lesebrille rutschte ihr von der Nase.
Wenn es draußen warm genug war, saß sie rauchend im Garten. Er war schmal und wild. Die Hecken links und rechts ragten so hoch auf, dass seit Jahren kein Nachbar mehr darüberschauen konnte. Der alte Birnbaum hatte ausgetrieben, der Rasen war zu Gestrüpp geworden, meterhohe Sonnenblumen standen inmitten von Brennnesseln, dahinter wucherte der Giersch, und einzig der grellgelbe Löwenzahn konnte sich gegen ihn behaupten. Der Garten grenzte direkt an den Deich. Nur ein hölzerner Zaun und ein morsches Tor trennten uns von den Spaziergängern, die manchmal über die Deichkrone schlenderten und auf unser ungepflegtes Grundstück glotzten. Die Rosen, die einst sorgsam um den Torbogen gebunden worden waren, hatten sich losgemacht, waren hoch hinausgewachsen und streckten sich leuchtend dem Himmel entgegen. Dahinter türmte sich der Deich auf. Nur aus der Dachkammer konnte man über seine Krone und auf die Lühe schauen, die dahinter verlief – ein schmaler Zufluss der Elbe.
Oma Ehmi saß stets am Fuß des Deichs inmitten ihres Unkrauts in ihrem Klappstuhl und starrte auf diese grüne Wand. Sie drehte sich eine Zigarette nach der anderen und schwieg. Manchmal glaubten wir, sie sei vielleicht doch schwerhörig, so wenig reagierte sie auf uns. Auf ihre Art und Weise kümmerte sich Ehmi zwar schon um uns: Sie füllte den Kühlschrank, heizte das Haus, und wenn wir keine Lust hatten, in die Schule zu gehen, schrieb sie uns eine Entschuldigung. Sie war nie grob zu uns. Sie schrie uns nicht an, sie schimpfte uns nicht aus, sie wies uns nicht zurecht. Doch sie lächelte und lachte auch nicht. Überhaupt hörte sie uns kaum zu. Manchmal war es, als wäre sie gar nicht da, als käme abends nur eine leere Hülle aus dem Vorlesungssaal zurück, und wir würden ganz allein in dem altersschiefen Fachwerkhaus mit dem sonnengebleichten Reetdach wohnen. Zu zweit spielten wir in unseren Kinderzimmern, auf dem knarrenden Dachboden oder in der alten Gartenhütte. Bald machten wir Ausflüge und erkundeten die Ufer der Lühe, an denen sich Apfelbäume über den Fluss beugten und all die morschen Stege von längst vergangenen Zeiten erzählten, in denen man die Obsternte noch mit Ewern vom Alten Land zum Hamburger Markt gebracht hatte. Wir beobachteten, wie in den dichten Büschen, Gräsern und Kirschbäumen die Blüten explodierten. Wie sie sich Wochen später lösten und vom Wind herumgewirbelt wurden, bis sie hinabsanken und auf den Wellen tanzten. Bei Flut stieg die Lühe an, bei Ebbe sank sie ab. Wenn kaum noch Wasser im Flussbett war, kletterten wir hinunter, tauchten unsere Füße in den weichen, nassen Schlick und atmeten den Geruch von Erde, Sand und Algen ein. Sobald das Wasser sprudelnd zurückkehrte, beobachteten wir die kleinen Fische, die zwischen unseren Füßen glitzerten.
Hin und wieder gingen wir auch zu den Spielplätzen an der Elbe, die wir langweilig fanden. Wir rutschten und schaukelten nicht, sondern sahen hinaus auf diesen unfassbar breiten Fluss. Größer konnte nicht einmal das Meer sein, dachten wir. Anfangs betrachteten wir all die Inseln, Buchten und Sandbänke nur aus der Ferne. Doch dann drangen wir langsam immer tiefer in die Marsch vor. Dorthin, wo die Wasserläufer durch die Pfützen sprangen und die kleinen schwarzen Feuerkröten mit ihren roten Tupfern so unheimlich klangen wie kaputte Xylophone.
Wenn wir nach Hause zurückkehrten, saß Oma noch immer im Garten, obwohl es längst kalt geworden war. In der Dämmerung sahen wir das Glühen ihrer Zigarette und das glänzende Weiß ihrer Augen. Wir wussten nicht, warum Ehmi inmitten ihrer Wildnis ausharrte oder wohin sie starrte.
Nur einmal, an jenem denkwürdigen Tag, an dem wir fünf Jahre alt wurden, öffnete Ehmi das klapprige Tor, winkte uns hinter sich her und stieg mit uns über den Deich. Auf der anderen Seite führten verwitterte Steintreppen bis zum Wasser hinunter, und dahinter lag ein alter schmaler Holzsteg, an dem ein Boot festgemacht war.
»Das ist die Sturmhöhe. Wenn ihr alt genug seid, um damit zu fahren, gehört sie euch. Heute machen wir eine Bootsfahrt.« So viele Sätze am Stück hatte sie lang nicht mehr gesprochen. Und dann schaukelten wir zum ersten Mal mit Ehmi auf den Wellen der Lühe. So schön wie an diesem Tag hatte der Fluss nie zuvor ausgesehen, fanden wir. Bäume ragten schief und leuchtend aus dem Wasser, streckten ihre Äste hoch über unsere Köpfe und bildeten ein tiefgrünes Blätterdach. Lichtpunkte tanzten auf den Wellen. Leise summten die Mücken im Gestrüpp am Ufer. Bald öffnete sich die Landschaft vor uns, wir sahen Radfahrer auf der Deichkrone vorbeiziehen und Vögel auf weiten Feldern landen.
Doch all das war nichts im Vergleich zu dem Anblick, der sich uns hinter dem Sperrwerk bot – die Elbe. Wir hatten sie schon häufig gesehen, vom Wasser aus kam sie uns allerdings noch gewaltiger vor. Sie war so blaugrün wie unser Holzboot und so undurchschaubar wie ein Gewitterhimmel. Ein Katamaran zog vorbei, und in der Ferne blitzte ein Containerschiff. Es dauerte nicht lang, bis die Flut uns nach Hanskalbsand mit seinen flachen Stränden gebracht hatte.
»Seht ihr das?«, fragte Ehmi, sobald wir das Boot auf die Insel gezogen hatten. Wir versuchten zu erkennen, worauf der krumme Zeigefinger unserer Oma deutete.
»Dort ist ebenfalls eine Insel. Sie heißt Hahnöfersand.«
»Das ist ja spannend, Oma«, sagte Jale mit einem dankbaren Lächeln. Ich glaube, für meine Schwester war es einer der schönsten Tage, die sie je erlebt hatte. Schließlich redete Oma mit uns. Sie sagte ganze Sätze, ohne dass wir darum betteln mussten.
»Oma?«, fragte ich leise. Im Gegensatz zu Jale traute ich Omas Stimmung nicht. »Warum erzählst du das?«
Meine Haare waren noch genauso dunkelblond wie die meiner Schwester, doch schon damals war ich aufmüpfiger als sie. Ich war zwei Minuten älter, zwei Minuten mutiger, zwei Minuten misstrauischer. Während der Altersunterschied bei anderen Geschwistern mit den Jahren immer unwichtiger wurde, schien es bei Jale und mir umgekehrt zu sein. Je häufiger wir von den Nachbarskindern gehänselt oder von deren Eltern verjagt wurden und je tiefer wir in die Elbmarsch vordrangen, desto forscher wurde ich, während Jale immer zurückhaltender zu werden schien. Schon früh waren wir wie Ebbe und Flut. Jale wusste immer, wann wir uns zurückziehen, wann wir leise, still und ruhig sein sollten. Ich hingegen konnte gut vorpreschen, genau den richtigen Moment abpassen, um einen Frosch zu fangen, einen Fintenschwarm zu beobachten oder mit Anlauf ins Flussbett der Lühe zu springen, sobald sie ihren Tiefstand erreicht hatte.
»Warum hast du uns hergebracht, Oma?«, fragte ich und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Weil ihr alt genug seid, um es zu erfahren.«
Sie schwieg, brauchte einen Moment, bis sie es schließlich aussprach. Und als die Worte einmal in der Welt waren, fühlte es sich an, als hätte Ehmi Waschbären ausgesetzt. Nie würde sie die wieder einfangen können. Sie flitzten davon, vermehrten sich in Windeseile und waren mit einem Mal überall. Ihre Worte veränderten alles – diese Insel, die Elbe, Ebbe und Flut – für immer. Von diesem Tag an sollten wir nie wieder dieselben sein.
»Noch fünfzehn Stunden und dreiundvierzig Minuten«, flüsterte Jale am fünfzehnten August. Nur etwa hundert Meter von uns entfernt ließen sich ein paar Austernfischer nieder. Nach und nach kamen mehr Vögel dazu, bis wir sie nicht mehr zählen konnten. Anfangs suchten sie im Watt mit ihren langen orangefarbenen Schnäbeln nach Würmern, doch schon bald stieg das Wasser zu hoch. Sie hüpften an Land, um auf die Ebbe zu warten. Von nun an standen die schwarz-weiß gefiederten Tiere einfach so da – einige am Strand, andere zwischen den Büschen und Gräsern, die gleich hinter dem Sand wuchsen – und harrten aus.
Uns kroch das Wasser mittlerweile bis zu den Händen und Füßen. Langsam wurden unsere Hintern nass, doch das war okay. Es war ohnehin so heiß, dass wir unsere weiten Shirts und kurzen Hosen in der Sturmhöhe gelassen hatten. In unseren Bikinis saßen wir auf Hanskalbsand, weit weg von den Bewohnern unseres Dorfes. Es war zwar nicht so, dass wir auf die Blicke achteten, die sie uns immer wieder zuwarfen, doch ohne fühlten wir uns wohler. Ihr Mustern, Starren und Stirnrunzeln, das ertappte Kopfabwenden, das demonstrative Wegschauen und Nichtgrüßen hatten sich uns tief eingebrannt. Wir hatten schon immer gewusst, dass wir anders waren. Als wir noch klein gewesen waren, hatten die Leute uns traurig angeschaut und lange und leise geseufzt, als wollten sie in Wahrheit so etwas sagen wie: Da kann man nichts machen. Tragisch, tragisch.
Als wir größer geworden waren, hatten sich auch die Blicke verändert. Das Mitleid war verschwunden, stattdessen sahen sie uns nun vorwurfsvoll an, manchmal auch voll Abscheu oder Verlangen. Jale hatte langes gewelltes Haar, ihre Augen wirkten treuherzig, und ihre Lippen waren voll. Dazu hatte sie diesen athletischen Körper, der sich beinahe schwerelos durch die Marschwiesen bewegte – mit einer ähnlichen Eleganz wie der eines Seeadlers. Die Jungs auf unserer Schule hätten es nie zugegeben, doch ich war mir sicher, dass sie alle auf Jale standen. Sie musterten sie heimlich, wenn sie glaubten, dass es niemand bemerkte. Meist musste ich darüber nur schmunzeln. Doch was ich hasste, war die Art, wie die erwachsenen Männer Jale ansahen. Auf der Straße, im Supermarkt, aus dem Auto. Sie starrten mit einer grinsenden, unverhohlenen, anzüglichen Selbstsicherheit, die ich ihnen am liebsten aus den Gesichtern geprügelt hätte.
Jale zuckte nur mit den Schultern, wenn ich mich darüber aufregte – als wäre es egal, was die anderen in ihr sahen. Ich hingegen wollte in keiner einzigen Phantasie auftauchen. Niemand sollte meinen Anblick genießen. Kurz nach unserem dreizehnten Geburtstag färbte ich mir zum ersten Mal die Haare. Erst tiefschwarz, dann rosa, später blau. Ich freute mich, wenn jemand darüber erschrak. Bei Grün-Schwarz blieb ich schließlich. Ich mochte, dass es die Farbe von Weidengebüsch und Schilfröhricht war. Schließlich war ich nirgends so glücklich wie an den einsamen Ufern unserer Flüsse. In dieser Zeit entschieden Jale und ich, dass wir unser eigenes Geld brauchten. Oma Ehmi gab uns zwar Taschengeld, doch es reichte nicht. Haarfärbemittel waren nicht billig, und auch der Tätowierer in Hamburg wollte mir nichts schenken. Also nahmen wir unseren ersten Schülerjob an und arbeiteten als Erntehelferinnen bei einem Obstbauernpaar aus der Großstadt. Jeden Cent sparte ich für Piercings und Tattoos. Oma Ehmi unterschrieb alle Einverständniserklärungen, ohne auch nur eine Frage zu stellen, und so ließ ich mir erst einen Ring durch die Lippe und dann meine Lieblingstiere unter die Haut stechen. Auf der Innenseite meines linken Handgelenks saß bald eine kleine schwarze Feuerkröte. Um meinen rechten Fußknöchel herum schwamm ein Schwarm Finten, und über mein Dekolleté, direkt unter dem Hals, flog eine Seeschwalbe.
Ich war nicht so klassisch schön wie meine Schwester. Doch Jale behauptete, meine Stupsnase sei niedlich. Um dem entgegenzuwirken, umrahmte ich meine Augen mit schwarzem Kajal.
Am fünfzehnten August 2023 hatte ich darauf verzichtet. Hier draußen war es egal, ob ich niedlich wirkte. Bis auf die Austernfischer waren wir allein, niemand konnte uns sehen, und so war es uns am liebsten.
»Noch fünfzehn Stunden und achtundzwanzig Minuten«, sagte ich. Ich sah Jale an und bemerkte, wie häufig sie blinzelte.
»Was glaubst du, wie sehr wird sich unser Leben verändern?«, fragte Jale.
Ich grinste. Seit Jahren spielten wir dieses Spiel, und keine von uns war es je müde geworden.
»Vollkommen«, antwortete ich, wie ich es immer tat. Und dann spann ich drauflos: »Irgendwann werden wir ein Hausboot haben. Und aus den Fenstern können wir auf die Elbe schauen.«
Jale lächelte. »Es wird eine Veranda haben, so richtig amerikanisch.«
»Und darauf sitze ich abends breitbeinig mit meinem Gewehr und schnauze jeden an, der dem Boot zu nahe kommt.«
Jale kicherte. »Du hast ein Gewehr?«
»Dann schon.«
»Fängst du an zu rauchen?«
»Pfeife«, sagte ich. »Und ich lerne, wie man Rauchkringel macht.«
Jale schaute in Richtung Nordsee. »Wir werden Tante Greetjes alte Gitarre mitnehmen und abends Lieder aus den Achtzigern spielen.«
»Willst du das wirklich?«, fragte ich. »Ich warne dich, ich werde singen!«
In gespielter Überraschung sah Jale mich an. »Äh, ehrlich gesagt …«
Ich unterbrach sie mit schiefen Tönen: »Hmhmhm … to my boat on the river!«
Jale lachte und legte schnell den Zeigefinger an ihre Lippen. Denk an die Austernfischer, hieß das, und tatsächlich stoben zwei von ihnen auf. Mit einem Mal geriet der ganze Schwarm in Bewegung. Aufgeregt rannten die Vögel den Strand hinunter, das Schwarz und Weiß ihres Gefieders hob und senkte sich, wilde Muster entstanden. Sie nahmen Anlauf, und dann erhoben sie sich flügelschlagend in die Luft, schlossen zu ihren Artgenossen auf. Nur langsam kehrte wieder Ruhe ein auf Hanskalbsand. Die Austernfischer hielten ihre leuchtenden Schnäbel in die Luft, während das Wasser zwischen ihren Beinen und den Schilfrohren immer höherstieg.
»Entschuldigung.«
»Okay, keine Gitarre.«
»Noch fünfzehn Stunden und neunzehn Minuten.«
Wir schlossen die Augen. Lauschten dem weit entfernten Grummeln des Himmels und dem Rascheln der Blätter in den Bäumen. Das sonnengewärmte Wasser schwappte uns über die Haut. Wir liebten es, wenn die Flut auf Hanskalbsand zuhielt und uns allmählich einhüllte. Sie brachte das Schilf zum Tanzen und verschluckte den Strand. Sie war so stark, dass sie die Strömung der Elbe aufhob. Alles floss, schwamm und schwappte an uns vorbei, unaufhaltsam hinein ins Land, weg vom Meer. Doch schon bald, ganz plötzlich, würden die Wellen ihre Richtung wieder ändern. Saugend und gurgelnd würden sie den Rückzug antreten und den Strand wieder verlassen. Ebbe und Elbströmung würden sich vereinen zu einem mächtigen Sog gen Nordsee. Wenn es so weit wäre, müssten wir nur noch in die Sturmhöhe zu springen. Den Motor bräuchten wir nicht. Die Elbe würde uns zurück zur Lühe tragen, zum Tor, das in Ehmis verwilderten Garten führte. Wir würden unser Boot an Land ziehen, ins Haus laufen, uns umarmen und dann in unsere Zimmer gehen. Dort würde jede für sich darauf warten, dass die Nacht käme und wieder ginge, bis es endlich so weit war.
Doch noch saßen wir in der Flut auf Hanskalbsand. Unsere Hände tasteten nacheinander und hielten sich fest.
»Noch fünfzehn Stunden und fünfzehn Minuten.«
»Noch fünfzehn Stunden und drei Minuten.«
»Noch fünfzehn Stunden.«
Die Steine, tief in den Hosentaschen, wären nicht nötig gewesen. Denn die Flut hat bereits eingesetzt. Mit eins Komma zwei Metern pro Sekunde rauscht das Wasser das Flussbett entlang und reißt den Körper mit, hin zur Fahrrinne, zu all den Strudeln, die sich tief unter der Oberfläche verbergen. Die Elbe scheint unzählige Hände zu haben, die nun nach den Füßen greifen, nach den Waden, die den Körper hinabzerren in die dunkle Tiefe.
Ein pechschwarzer Schlund klafft unter dem Körper. Je tiefer er sinkt, umso schwerer wiegen die Wassermassen, die ihn nach unten drücken. Der Körper wird es nicht mehr spüren. Denn nun öffnet sich sein Mund. Nun atmet seine Lunge Wasser. Und der Schmerz explodiert in ihm, zerfetzt diesen Geist und mit ihm all die Erinnerungen, all die Fehler, all die Hoffnungen auf Vergebung, die darin konserviert sind. Alles zerreißt, löst sich auf. Und dann ist da endlich Stille. Und die tiefe Dunkelheit. Weit unten. In der Fahrrinne der Elbe.
Kapitel 216. August 2023
Ich zog die alten Rollläden hoch. Sie quietschten und rumpelten, während mich die Morgensonne blendete. Mit Schwung öffnete ich das Fenster.
»Noch zwei Stunden und sieben Minuten«, rief ich über den Deich, der vor unserem Garten aufragte. Ich wirbelte herum, lief in den Flur und riss die Zimmertür meiner Schwester auf.
»Noch zwei Stunden und sechs Minuten!«
Ich hastete zum Fenster, um Licht hereinzulassen.
»Wie hast du geschlafen?«
Ich drehte mich um und hielt inne. Jales Decke war zurückgeschlagen, das Bett leer.
»Jale?«
Ich lief über den Flur zum Badezimmer, klopfte zweimal laut an und riss die Tür auf. Doch auch hier war niemand.
»Jale!«
Ich polterte die Treppe runter und stürmte in die Küche. Blass und starr saß Ehmi am Tisch.
»Morgen, Oma. Wo ist Jale?«
Ehmi antwortete nicht, doch damit hatte ich ohnehin nicht gerechnet. Ich lief an ihr vorbei, schaute in die kleine Kammer, dann ins Wohnzimmer mit all den alten Büchern. Ich öffnete die Terrassentür und rannte durch den Garten. Niemand saß im Gras oder auf dem Klappstuhl. Vielleicht war Jale zum Bäcker gelaufen, um Brötchen zu holen. Bestimmt würde sie gleich zurückkommen. Ich drückte das Tor auf, stieg auf den Deich und schaute auf den Steg hinunter. Unberührt lag das blaugrüne Boot da. Ich saugte an meinem Lippenpiercing.
Wir hatten den Morgen minutiös geplant. Hatten alles gemeinsam vorbereiten und dann so früh mit Oma Ehmi aufbrechen wollen, dass wir die letzten Minuten in Ruhe würden runterzählen können.
Wieso war Jale jetzt, am wichtigsten Tag unseres Lebens, nicht da?
»Jale ist schon gestern Nacht gegangen«, sagte Ehmi hinter mir. Ich fuhr herum. Oma stand unten im Gartentor und sah an mir vorbei.
»Was meinst du damit?«
»Ich habe gehört, dass sie nachts raus ist. Ich dachte, sie braucht frische Luft vor lauter Aufregung.«
Ich hatte keine Zeit, mich über Ehmis ausführliche Antwort zu wundern. »Wann war das?«
»Gegen elf.«
»Und seitdem ist sie weg?«
»Das weiß ich nicht, irgendwann bin ich wohl eingeschlafen.«
Ich versuchte mehrmals, Jale auf dem Handy anzurufen, doch sie ging nicht ran. Mit hämmerndem Herzen lief ich die Straße runter bis zum Bäcker und wieder rauf. Hier war alles gepflegt – an den Fachwerkhäusern erstrahlten die Holzbalken in weißer Farbe, die Giebel leuchteten sattgrün, und die Reetdächer waren wie neu. Nur unser Haus passte nicht in diese Gegend. Die Fensterläden hatten schon vor vielen Jahren ihre Farbe verloren. Zerfurcht und schief hingen sie an der Fassade, von der der Putz abgebröckelt war und die den Blick auf rote Ziegelsteine freigab.
»Oma, wir nehmen jetzt das Auto«, entschied ich, sobald ich wieder in der Küche stand.
Wir stiegen in Ehmis alten roten Ford Fiesta, und ich hoffte inständig, dass die mürrische Karre uns nicht im Stich lassen würde. Zum Glück sprang sie an. Langsam fuhren wir durch Grünendeich in Richtung Elbe. Doch nirgends konnten wir Jale sehen – auch nicht, als wir am Fähranleger angekommen waren. Ich guckte auf mein Handy. »Noch eine Stunde und neunzehn Minuten.«
Was hatte das zu bedeuten? Jale war es doch genauso wichtig wie mir, heute um 9.15 Uhr in Hinterbrack zu sein. Nichts war ihr wichtiger als das – seit zwölf Jahren. Niemals würde sie einfach so ohne jede Nachricht verschwinden. Und doch war sie weg. Die Panik, die in mir aufzusteigen drohte, durfte ich um keinen Preis zulassen. Stattdessen suchten Ehmi und ich weiter. Zweimal fuhren wir den Elbdeich entlang, dann bat ich Oma Ehmi, mich nach Hause zu bringen – zu meinem Fahrrad.
»Ich komme mit dir nach Hinterbrack«, sagte Oma Ehmi mit zusammengezogenen Brauen.
»Nein, Oma, das geht nicht. Wenn Jale hier wieder auftaucht, müsst ihr schnell mit dem Auto nachkommen, okay?«
Einen Moment lang sah sie mir in die Augen. Ich war mir sicher, dass sie heute dabei sein wollte. Und dass sie gleichzeitig Angst davor hatte. Vielleicht war das der Grund dafür, dass sie sich schließlich überreden ließ.
»Du bleibst hier, ich fahre jetzt los. Wenn sie dort ist, rufe ich dich an.«
Ich holte mein Fahrrad aus dem Garten, schob es hinauf auf den Deich und radelte in Richtung Elbe. Immer wieder sah ich mich um. Beinahe erwartete ich, Jale in einem Boot auf der Lühe zu entdecken. Am Sperrwerk hielt ich mich links, überquerte den viel höheren Elbdeich und radelte, so schnell ich konnte, am breiten Wasser, am Schilf, an all den Weiden vorbei. Bald schob sich eine riesige Obstplantage zwischen mich und das Wasser, und ich roch den schweren Duft von Most und gemähtem Gras. Dann war ich da. Der kleine Parkplatz direkt an der Borsteler Binnenelbe war leer. Die Sonne brannte grell auf den gewaltigen Zaun hinab, der das Festland von Hahnöfersand trennte. Der einzige Zugang zu dieser Elbinsel, die nun vor mir lag, war verschlossen – die Schranke war unten. Nirgends sah ich Jale.
Um kurz vor neun Uhr klingelte mein Handy. Hastig zog ich es aus der Tasche – doch es war Ehmi, die anrief. »Sie ist noch immer nicht hier.«
Ich schloss die Augen, versuchte, ruhig zu atmen. »Kannst du weiterwarten?«
»Ja«, sagte Ehmi nur und legte auf.
Ratlos drehte ich mich um die eigene Achse. Hinter mir grasten Schafe. Ein Jogger überquerte den Deich. Ansonsten war es leer. Und still. Ich stieg hoch auf die Deichkrone. Von oben konnte ich unter mir auf der einen Seite die Elbe sehen und auf der anderen Hahnöfersand. Den Zaun. Das Haus des Pförtners. Die Schranke.
»Noch zehn Minuten«, flüsterte ich. Ob Jale, wo sie auch immer war, gerade das Gleiche sagte?
In der Ferne, auf der Zubringerstraße, die auf die Insel Hahnöfersand führte, sah ich ein Auto. Doch Jale war nicht bei mir. Und ein wenig fühlte sich das an, als würde ich nur mit einem Auge auf die Insel hinunterschauen. Auf das Glitzern der Wellen dahinter und auf die weißen Spuren der Boote. Auf das Baggerschiff, das sich an der Fahrrinne gen Hamburg abarbeitete, und auf das weiße Sportboot, das über das Wasser raste.
»Noch fünf Minuten.«
Das Auto hielt vor der Schranke, ein junger Mann stieg aus und betrat das Häuschen. Wäre Jale hier, würde sie laut überlegen, wer wohl noch in diesem Auto saß. Fragen, ob es nun so weit war. Endlich. Sie würde von einem Fuß auf den anderen treten, und ihre Wangen wären rot. Sie wäre nervös genug für uns beide zusammen, so dass ich ganz ruhig bleiben könnte. Doch ohne sie raste mein Puls.
»Noch drei Minuten.«
Der Mann kam aus dem Häuschen heraus, stieg wieder ins Auto ein, ließ den Motor an. War es so weit? Jetzt? Ich knabberte an meinem Piercing. Wollte Jales Hand nehmen. Griff ins Leere.
»Noch eine Minute.«
Die Schranke öffnete sich. Im Schritttempo fuhr das Auto in die Freiheit.
»Noch null Minuten.«
»Was sagst du?«
Ich drehte den Kopf. Neben mir stand ein kleines mir fremdes Mädchen, das zu mir hochsah.
»Ich rede nur mit mir selbst.« Entschuldigend verzog ich den Mund und ließ das Kind stehen, um den Deich hinunterzusteigen.
»Es ist so weit«, flüsterte ich Jale zu, die gar nicht neben mir herlief.
Doch noch bevor ich unten ankam, war das Auto weggefahren. Einfach so.
Ich sah auf mein Handy. Sie war da – die Stunde null. Doch außer mir war niemand gekommen.
Was würde Jale jetzt tun? Oder besser: Was würde ich tun, wenn Jale an meiner Seite wäre? Ich gab mir einen Ruck und trabte zum Pförtnerhäuschen, öffnete die Tür und sah dem Mann mit den grauen Haaren und der dunklen Haut direkt ins Gesicht.
»Entschuldigen Sie. Ich warte auf … jemanden.« Seit zwölf Jahren, fügte ich in Gedanken hinzu. Seit beschissenen zwölf Jahren. »Können Sie mir sagen, wann …?«
»Heute kommt niemand mehr«, sagte der Mann bedauernd.
Ich brauchte einen Moment, um seine Worte zu begreifen. »Aber … es hieß, heute Morgen …«
Mitleidig sah der Mann mich an. »Tut mir leid, Mädchen. Heute kommt niemand mehr raus.«
Mir wurde schwindelig. Ich taumelte zwei Schritte rückwärts, fing mich wieder, wirbelte herum und verließ das Häuschen ohne einen Gruß. Ich brauchte frische Luft, rannte zurück auf den Deich, so schnell, dass ich keuchend oben ankam. Hatten wir uns geirrt?
Ich musste mit Jale sprechen, sofort, ich sehnte mich nach den Ideen und Gedanken meiner Schwester, nach ihren Händen in meinen.
Und dann hörte ich einen Schrei. Ich blickte in die Richtung, aus der er gekommen war, und sah das Mädchen, das mich vorhin angesprochen hatte. Es stand nicht weit von mir entfernt und zeigte hinaus auf die Elbe, während seine Eltern die Schafe mit ihren schwarzen Köpfen und ihren lustigen Blicken fotografierten.
»Guckt mal da!«, rief es. »Das Schiff! Es geht unter!«
Mein Blick folgte seinem. Ich brauchte einen Moment, bis ich es entdeckte. Auf der Elbe zwischen Neßsand und Hinterbrack ragte der Bug eines weißen Sportboots aufrecht aus dem Wasser. Sein Heck war bereits unter der Wasseroberfläche verschwunden. Ein Rettungsboot näherte sich, Wasser spritzte hinter ihm in hohem Bogen auf. Und doch schien es mir unendlich langsam zu sein.
Ich konnte mich nicht rühren. Stand nur da und sah zu, wie das weiße Boot verschwand. Und in diesem Moment wusste ich, dass mit ihm nicht nur mein altes Leben, sondern auch mein neues unterging: All unsere Pläne und Träume einer verheißungsvollen, glanzvollen Zeit, die auf die Stunde null folgen sollte, versanken unaufhaltsam in den Tiefen der Elbe.
Kapitel 311. Dezember 1983
Alea Eggers schreckte aus dem Schlaf auf. Kerzengerade saß sie da und starrte in die Dunkelheit. Sie war sich sicher, das Telefon klingeln gehört zu haben. Ring, ring – schrill und durchdringend. Doch jetzt war es vollkommen ruhig im Haus. Tief atmete sie ein und aus, fuhr sich über das Gesicht. Sie hatte bestimmt mal wieder geträumt.
Schlafen konnte sie in dieser Nacht nicht mehr, und auch als es hell wurde, ging ihr das Klingeln des Telefons nicht aus dem Kopf.
Am frühen Nachmittag setzte sie sich auf die Schräge des Deichs hinter ihrem Garten, schob sich den Kopfhörer auf die Ohren, nahm ihren blauen Walkman in die Hand und drückte auf Play. Mit sehnsuchtsvollen Klängen bat Culture Club um Zeit, und der elektronische Sound ihrer Musik hüllte Alea ein, übertönte endlich dieses gottverdammte Telefonklingeln in ihrem Inneren.
Sie sah auf die Sturmhöhe, die im Ufergras der Lühe schaukelte, und fror. Die Kälte drang durch ihre schwarze Jeans und die weite Trainingsjacke. Alea zitterte, sie konnte ihren Atem sehen, und doch würde sie nicht reingehen.
In ihrem Ohr sang Boy George: Gib mir Zeit, um zu begreifen, was ich getan habe. Und wie jedes Jahr um diese Zeit fragte sich Alea, wie es sein musste zu ertrinken. Irgendwo hatte sie einmal gehört, es sei unvorstellbar schmerzhaft. Wann begann ein Mensch wohl, Atem zu holen, wo keiner war? Wie fühlte es sich an, Wasser statt Luft in der Lunge zu haben? Alea stellte sich vor, sie würde bei diesen Temperaturen in die Lühe steigen. Immer tiefer. Bis zum Bauchnabel. Bis zu den Schultern. Bis zur Stirn. Wie wäre das wohl?
Ich habe in deinen Augen getanzt, sang Boy George. Und dann spürte Alea, dass sie nicht mehr alleine war. Dass jemand hinter ihr stand, der in die gleiche Richtung sah wie sie. Und wenn sie ehrlich zu sich selbst war, hatte sie sich schon auf diesen Jemand gefreut.
Der Rhythmus wechselte. Alea richtete sich auf, drehte sich um. Ein wenig fröhlicher fragte Boy George: Willst du mir wirklich weh tun? Und sie betrachtete Henri, der über ihr auf der Deichkrone aufragte.
Er war ein Jahr älter als sie, jetzt also neunzehn. Seit zwölf Monaten hatte sie ihn nicht mehr gesehen, und in dieser Zeit musste irgendetwas mit ihm passiert sein. Dieser schräge Pony, den sie in der Schule nur Elbtunnel nannten. Der Trenchcoat. Die weiße Karottenjeans und die perfekt polierten Collegeschuhe. Sie verzog den Mund und streifte sich den Kopfhörer von den Ohren. Nur noch ganz leise hörte sie Boy George. Willst du mir wirklich weh tun?
»Bist du jetzt ein Popper?«, fragte sie mit spöttischer Stimme.
Henri ruckte mit dem Kopf, um sich den Elbtunnel aus der Stirn zu schwingen, und lächelte galant. »Und du? Siehst beinahe aus wie ein Punk.«
Alea zog die Brauen hoch. Zum Punk fehlte ihr so ziemlich alles: hochtoupierte Haare. Zerrissene Klamotten. Nagellack. Schwarze Schminke um die Augen. Nichts davon würde ihre Mutter ihr erlauben. Die Tochter von Professorin Eggers hatte sich angemessen zu kleiden, auch wenn sie bereits volljährig war.
»Schön wär’s.«
Doch ein wenig freute es sie, dass er zumindest die Wahl ihrer schwarzen Klamotten und den dunklen Lidstrich richtig zugeordnet hatte.
»Sind unsere Mütter schon beim Likör?«
»Ehmi hat gerade die Flasche rausgeholt.«
Alea hob beide Brauen. »Dann sollten wir verschwinden, solange wir noch können.« Mit dem Kopf zeigte sie auf die Sturmhöhe. Es war Tradition, dass Alea und Henri am elften Dezember gemeinsam auf die Elbe rausfuhren, Musik hörten und versuchten, den Grund für ihr jährliches Wiedersehen zu vergessen. Doch in diesem Augenblick rauschte eine Böe durch den verwilderten Garten, riss Henri den schrägen Pony und Alea die Dauerwelle aus dem Gesicht. Nur eine Sekunde später begann es zu regnen. Eiskalte Tropfen prasselten auf die Lühe, die kahlen Äste der Obstbäume und das matschige Gras zu ihren Füßen.
»Verdammt!«, rief Henri und hob beide Arme über seine aufwendig gestaltete Frisur. Alea musste grinsen. Sie schloss die Augen, und für einen Moment hielt sie das Gesicht in den kalten Regen.
»Alea! Komm mit!«
Sie spürte seine Hand an ihrem Unterarm, und dann rannten sie gemeinsam über den Deich und durch den verwilderten Garten zum schiefen Haus, in dem Alea aufgewachsen war. Vollkommen durchnässt stürmten sie in die Diele.
»Henri, Alea?«, rief Ehmi aus der Küche.
»Wir trocknen uns erst mal ab!« Alea zog Henri die Treppe hinauf in ihr Zimmer.
Es war lange her, dass er bei ihr oben gewesen war. Und als Alea die Tür hinter sich schloss, musste sie daran denken, wie sie Henri vor fünf Jahren kennengelernt hatte.
Sie waren Kinder, Alea dreizehn und Henri vierzehn Jahre alt, und beide noch viel zu jung gewesen, um auf einer Trauerfeier den Tod ihrer Väter zu beweinen. Doch da hatten sie gestanden. Ein Grab hatte es nicht gegeben. Und auch keine Antworten. Nur diesen Gedenkstein, auf dem Henri und Alea ihre eigenen Nachnamen wiedergefunden hatten.
Henris Mutter war so ziemlich das Gegenteil von Aleas Mutter. Sie weinte ohne Scham, ihre Stöckelschuhe klackerten bei jedem Schritt durch die Kirche, und immer wieder drückte sie ihren Sohn an sich, der es mit widerwilligem Gesichtsausdruck über sich ergehen ließ. Ehmi hätte niemals hohe Schuhe getragen. Oder geschluchzt. Oder Alea in aller Öffentlichkeit an sich gedrückt. Sie hielt ihr nur die Hand, und dieser feste Griff war das Einzige, was Alea davor bewahrte, in einen unsichtbaren Abgrund zu fallen.
»Ich kann nicht aufhören, mir vorzustellen, wie sie gestorben sind«, sagte Henris Mutter hinterher bei Streuselkuchen und Filterkaffee.
Forschend sah Henri über den Tisch in Aleas Gesicht.
»Mama, nicht jetzt.« In seiner Stimme lag eine Autorität, die Alea überraschte. Seine Mutter gehorchte sofort.
In einem Gasthaus war eine lange Tafel gedeckt worden. Alea und ihre Mutter saßen Henri und seiner Mutter gegenüber. Alea war sich sicher, dass Ehmi nicht die geringste Lust verspürte, mit der sorgfältig geschminkten, honigblonden Frau zu sprechen, doch es gebot ihr wohl der Anstand.
»Und Sie kommen aus Hamburg?«, fragte Ehmi ein wenig steif.
»Aus Altona«, sagte die Frau. »Aber bitte – bei allem, was wir gerade gemeinsam durchmachen –, sagen Sie ruhig du. Ich bin Renate.« Sie lächelte hinter ihrem Tränenschleier.
Verstohlen sah Alea ihre Mutter von der Seite an. Ehmi konnte es nicht leiden, schon beim ersten Treffen das Du angeboten zu bekommen. In der Regel testete sie eine Bekanntschaft monatelang, bevor sie einen solchen Schritt auch nur in Erwägung zog. Und nicht selten lehnte sie ein Du ohne Zögern ab. Doch anscheinend war dies keine Entscheidung, die bei einem Leichenschmaus zu Ehren der gleichzeitig verstorbenen Ehemänner getroffen werden durfte.
»Ehmi Eggers.«
»Ehmi! So ein schöner Name!« Renate tupfte sich die Tränen von den Wangen. »Schön, euch kennenzulernen. Und du bist …?«
»Alea.« Ihre Stimme war belegt, sie sah hinab auf ihre Hände.
»Wie ungewöhnlich!« Sie schob sich das Taschentuch unter den Ärmel. »Das ist mein Sohn Henri. Ihr könntet im gleichen Alter sein, oder?«
Alea hob den Blick und betrachtete ihr Gegenüber. Er war gut aussehend, schon damals, seine Miene wirkte gefasst. Dass er wie Alea seinen Vater verloren hatte, sah man ihm nicht an.
An diesem Nachmittag sprachen Henri und Alea kein Wort miteinander. Alea befand sich, seit sie vom Tod ihres Vaters erfahren hatte, in Schockstarre, und Henri war zu sehr darauf bedacht, seine Mutter in Schach zu halten. Sobald sie wieder auf die verstorbenen Männer zu sprechen kam, stieß er sie in die Seite. Und wenn sie Ehmi zu persönliche Fragen stellte, wies er sie zurecht.
Sobald sie sich verabschiedet hatten, hatte Ehmi aufgeatmet. Doch ein Jahr später, am ersten Todestag ihrer Männer, stand Renate mit Henri und einer großen Tupperdose vor der Tür.
»Guten Tag«, sagte Ehmi steif.
»Moin!« In Renates Augen schimmerten wieder die Tränen. »Bitte entschuldige den Überfall, Ehmi. Susanne hat mir verraten, wo du wohnst. Du weißt schon, die Frau von Jürgen. Ich habe für alle Hinterbliebenen Streuselkuchen gebacken.« Während sie die Tupperdose in die Höhe hob, zitterte ihr Kinn. »Hallo, Alea!«
Alea stand neben ihrer Mutter und spürte, wie Ehmi einen Schritt zurücktrat. Sicher hätte sie ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen, wenn ihre Tochter nicht ihre Hand genommen und sie festgehalten hätte.
»Guten Tag«, sagte Alea und nickte Renate und Henri höflich zu.
Überrascht sah Ehmi sie an. Seit dem Tod ihres Vaters sprach Alea selten mit Fremden. Am liebsten vergrub sie sich in ihrem Zimmer oder in ihrem Boot. Dass sie Renate und Henri nun grüßte, schien Ehmi Hoffnung zu machen. Vielleicht dachte sie, Henri wäre Alea sympathisch. Vielleicht hoffte sie, er könnte ihr helfen.
In Wahrheit hatte Aleas Gruß weniger mit Henri zu tun als mit ihrer Mutter. Ehmi war in den letzten Monaten noch wortkarger und abweisender geworden. Früher hatte sie sich hin und wieder mit Kollegen von der Universität getroffen, mittlerweile pflegte sie aber keine Kontakte mehr – bis auf den zu ihrer Schwester und den zu ihrer Tochter. Vielleicht war es gut, wenn Renate mit ihrem Streuselkuchen in Ehmis Leben platzte. Sie würde ein bisschen Farbe in dieses schiefe Haus an der Lühe bringen. Und ein paar Tränen. Und Alea wusste nicht, was von beidem wichtiger war.
»Kommt doch rein«, sagte Ehmi widerstrebend und hielt dem ungebetenen Besuch die Tür auf.
Es war schon lange niemand mehr hier gewesen abgesehen von Ehmis Zwillingsschwester Greetje. Unschlüssig, wie sie sich verhalten sollte, stand Alea neben Ehmis Ohrensessel. Während die beiden Mütter in der Küche Kaffee kochten und Sahne schlugen, sprachen Henri und Alea zum ersten Mal miteinander.
»Ich hätte nicht gedacht, dass sie uns reinlässt.« Henri sah sich mit müdem Blick in dem mit Büchern vollgestopften Raum um.
»Hältst du meine Mutter für einen Unmenschen?« Aleas Stimme klang scharf.
Henri zuckte mit den Schultern. »Ich hätte uns doch selbst nicht reingelassen.«
Alea legte den Kopf schief, sagte aber nichts.
»Nervt deine Mutter dich nicht? Also, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich meine nervt.« Henri ließ sich in Ehmis Ohrensessel fallen und verschränkte die Hände hinter dem Kopf.
Alea dachte einen Moment darüber nach. Ehmi war nicht einfach. Aber tatsächlich nervte sie nie. Wie sollte jemand nerven, der so still und zurückgezogen lebte? Beinahe wünschte Alea sich, sie hätte eine genauso anstrengende Mutter wie Henri, eine, die Gefühle zeigte, Alea fest an sich drückte und über die sie sich aufregen konnte. Doch sie hatte Ehmi, und beide hatten sie in diesem einsamen Haus vergessen, wie man laut wurde.
»Lebst du gern hier?« Henri sah durch die gläserne Terrassentür in den verwilderten Garten, hinter dem wie eine grüne Wand der Deich aufragte.
»Du stellst komische Fragen.«
»Und du antwortest nicht.«
Alea zuckte mit den Schultern und folgte seinem Blick.
»Es wirkt langweilig hier draußen. Hier ist bestimmt nichts los, oder?«
Alea sog ihre Unterlippe ein. Aus irgendeinem Grund wollte sie nicht, dass dieser schnöselige Hamburger mit seinen polierten Schuhen auf ihr Leben in Grünendeich herabblickte.
»Ich habe ein Boot.«
Henri drehte den Kopf zurück in ihre Richtung. »Echt?«
»Von hier aus kann man bis zur Elbe fahren.«
In diesem Moment kamen ihre Mütter aus der Küche. Der Anblick der hochgewachsenen, steifen Ehmi, die eine Servierplatte voller Streuselkuchen und eine Kanne Kaffee trug, war überfordernd. Alea brauchte einen Moment, um ihn zu verarbeiten.
»Na, Kinder, habt ihr schön geplaudert?«, rief Renate, während sie eine Schüssel Sahne auf den Tisch stellte. Ihr Blick war wässrig, doch ihr Lächeln warm.
Als plaudern würde Alea es zwar nicht unbedingt bezeichnen, trotzdem nickte sie.
»Alea und ich würden gern mit dem Boot rausfahren.« Henri sprang auf. »Frau Eggers, würden Sie das erlauben?«
Ehmi wechselte einen überraschten Blick mit ihrer Tochter.
»Aber, Henri«, sagte Renate. Ihr Lächeln verrutschte. »Wir wollen doch jetzt Kuchen essen …«
Henri unterbrach sie: »Es wäre gut, wenn ihr ein bisschen unter euch wärt, Mama. Immer sagst du, nichts geht über Gespräche unter Frauen, stimmt’s?«
»Das stimmt.« Renate lächelte Ehmi an. Und bevor Alea überlegen konnte, wie sie ihre Mutter retten könnte, zog Henri sie schon hinter sich her.
Von diesem Tag an standen Renate und Henri an jedem elften Dezember vor Ehmis und Aleas Tür. Jahr für Jahr überlegte Ehmi, ob sie nicht über den elften Dezember das Land verlassen sollte. Und dann blieb sie doch und aß mit Renate mal Marmorkuchen, mal Zupfkuchen, mal Bienenstich. Sie würde es nicht zugeben, aber vielleicht half es ihr ja, am Todestag ihres Mannes Renate beim Plaudern und Weinen zuzuhören. Vielleicht war alles besser als die Stille, die sonst in diesem Haus am elften Dezember herrschen würde.
Henri und Alea entkamen dem Kaffeetrinken fast jedes Mal und flohen auf die Lühe. Während Alea die Sturmhöhe bis zur Elbe lenkte, redete Henri. Und darüber war sie froh – seine Stimme konnte das Klingeln in ihren Ohren wunderbar übertönen. In den ersten Jahren sprach er am liebsten über Musik, über Styx und Pink Floyd. Er hatte einen Walkman, bevor Alea einen hatte. Bei ihrer zweiten Bootsfahrt setzte er ihr den Kopfhörer auf, und während die Lühe in die Elbe überging, sangen Styx von einem Boot auf einem Fluss und von der Sehnsucht, weit hinauszufahren.
Und Alea konnte nichts sagen, konnte kaum atmen. Sie hatte nicht gewusst, wie überwältigend es war, so weit draußen, fern von jedem Radiogerät und jeder Stereoanlage, Musik zu hören. Die Melodien schienen direkt in ihrem Kopf zu entstehen. Es gab nichts mehr zwischen ihr und dem Song, sie war eingehüllt, sie wurde getragen, sie verschmolz.
Bis Henri ihr den Kopfhörer wieder abnahm.
»Affengeil, oder?«
Sie nickte sprachlos und ließ sich erklären, wie der Walkman funktionierte. Henri öffnete die Klappe, holte die Kassette heraus und hielt sie ihr wie ein wertvolles Schmuckstück auf der geöffneten Handfläche hin.
Später begann er, über Zigaretten und Whisky zu reden, dabei war er gerade mal sechzehn. Manchmal erzählte er auch von seinen Plänen, Medizin oder Wirtschaft zu studieren. Niemals kam er auf ihre Väter zu sprechen.
Umso mehr erschrak Alea, als Henri nun in ihrem Zimmer sagte: »Gut, dass mein Vater das nicht mitbekommt.«
Alea reichte ihm ein Handtuch, mit dem er sich den abgesoffenen Elbtunnel trocken rubbelte.
»Warum ist das gut?«
»Er hätte es nie erlaubt, dass ich allein das Zimmer eines hübschen Mädchens betrete.« Er grinste Alea an, und mit seinen zerzausten, nassen Haaren sah er noch besser aus als sonst. Die weiße Hose klebte an seinen Beinen, nur das Hemd war unter dem Trenchcoat trocken geblieben.
Kurz überlegte Alea, ihn zu fragen, was denn seine Mutter dazu sagen würde. Doch im Grunde kannte sie die Antwort ohnehin. Henri hatte Renate im Griff. Wenn einer von den beiden ein Verbot aussprach, dann er.
»Ich hoffe, das kommt jetzt nicht komisch rüber. Aber – kann ich die Hose ausziehen?«
»Äh … klar.« Alea sah aus dem Fenster, um zu verbergen, dass sie rot wurde. Und sobald sie sich wieder zu ihm umdrehte, saß Henri in Unterhose und mit nassen Haaren auf ihrem Bett. Sie hatte das Gefühl, diesen Jungen gut zu kennen. Schließlich war es schon fünf Jahre her, dass sie sich zum ersten Mal gesehen hatten. Andererseits war es erst ihr sechstes Zusammentreffen. Wie gut lernte man jemanden kennen – an sechs Nachmittagen?
»Schade, ich wäre gern wieder mit dir Boot gefahren«, sagte Henri.
Langsam schälte sie sich aus ihrer durchweichten Trainingsjacke.
»Ich hab uns sogar eine neue Kassette aufgenommen.«
»Was ist drauf?«
»Ein bisschen Michael Jackson, ein bisschen Geier Sturzflug.«
»Du bist wirklich ein Popper geworden. Wie konnte das nur passieren?«
»Ich genieße das Leben, Alea! Das solltest du auch mal versuchen!«
Nachdenklich sah sie ihn an, wie er da saß, fast lag, aufgestützt auf die Ellbogen, grinsend unter den feuchten Haarsträhnen. Ein Teil von ihr wollte ihm erklären, dass sie niemals Popper werden könnte. Diese Welt war viel zu falsch, als dass man unpolitisch in ihr leben durfte. Solange es große Konzerne gab, die ihre Mitarbeiter, ohne zu zögern, in den Tod schickten, die ihren Familien ihre Väter entrissen und dennoch weiter gewaltige Profite anhäuften, musste man politisch sein. Eigentlich war keine Zeit, das Leben zu genießen. Sie mussten die Welt verändern. Sie mussten endlich etwas tun. Alea wusste zwar noch nicht, wie – die RAF ging viel zu weit, auch die Aktionen der Revolutionären Zellen waren Alea zu krass. Doch irgendetwas wollte Alea unternehmen. Eines Tages würde sie es zumindest versuchen.
Der andere Teil von ihr wollte Henri zustimmen. Sie genoss das Leben selten. Nur manchmal, mit ihrem Kopfhörer auf den Ohren, kam sie ganz nah an dieses Gefühl heran. Und das war gut. Verdammt gut sogar. Die Welt konnte sie heute sowieso nicht mehr ändern. Was brachte es also, diesen Tag einfach so verstreichen zu lassen? Sie war achtzehn Jahre alt. Und irgendetwas sagte ihr, dass ihr nicht viel Zeit bleiben würde, die sie genießen könnte.
»Was denkst du, Alea Eggers?«, fragte Henri mit rauer, leiser Stimme und seinem schiefen Grinsen.
»Ach«, sagte Alea. »Weißt du, was? Scheiß drauf.«
Dann ging sie zu Henri rüber, beugte sich zu ihm herunter und küsste ihn.
Vorher hatte sie noch nie einen Jungen geküsst. Mit den Typen in der Schule konnte sie nichts anfangen, die waren im Kopf noch Kinder. Und andere Jungs kannte sie nicht. Keinen bis auf Henri. Doch als ihre Lippen sich berührten und ihr sein blumiges Parfüm in die Nase stieg, wurde ihr bewusst, dass sie auch ihn kaum kannte. Sie hatte keine Ahnung, wie sich seine Zunge anfühlen, wie er auf ihre Entscheidung reagieren, was er dazu sagen würde, dass sie diese Welt gern anders verlassen würde, als sie sie vorgefunden hatte, wusste nicht, warum er seine Mutter herumkommandierte und so selten über seinen Vater sprach. Und vielleicht war das okay. Vielleicht musste sie noch gar nicht alles über ihn wissen, um ihn küssen zu wollen.
Leider war es unbequem, so gebeugt dazustehen, also hielt sie inne. Sie wäre ihm gern noch näher gekommen, gleichzeitig waren ihr seine Beine ein bisschen zu nackt, um sich neben ihn zu setzen.
»Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet.« Henri biss sich auf die Unterlippe. »Interessante Wendung, Alea Eggers.« Er grinste, dann packte er sie an den Hüften und zog sie zu sich aufs Bett. »Aber ich kann durchaus improvisieren.«
Sie begannen zu knutschen und hörten lange nicht mehr damit auf. Bald vergaß Alea sogar, dass er ihr gerade noch etwas zu nackt gewesen war, und verknotete ihre Beine mit seinen.
Kapitel 416. August 2023
Mit dem Sportboot auf der Elbe war ein Mann untergegangen – er war ertrunken. Die Nachricht verbreitete sich so schnell im Alten Land, dass es am Mittag, nur wenige Stunden nach dem Vorfall, schon jeder wusste. Wir alle fragten uns, wer es sein könnte, doch niemand hatte auch nur die leiseste Ahnung. Trotzdem verschlug es mir den Atem, als ich die Meldung auf dem Handy las, und das flaue Gefühl in meinem Magen wuchs zur Übelkeit heran. Schließlich hatte ich gerade eben dabei zugesehen, wie das Boot versunken war. Mit fahrigen Fingern teilte ich den Link mit Jale. Guck mal, der Artikel, schrieb ich. Das Boot habe ich heute Morgen selbst gesehen. Und dann fügte ich hinzu: Wo verdammt nochmal bist du???
Mittlerweile stand ich auf dem Schulhof und wusste nicht, was ich hier wollte. Hatte ich wirklich geglaubt, Jale könnte in der Schule auftauchen? Sie würde einfach so in Mathe neben mir sitzen und auf ihrem Bleistift kauen? Ein irrationaler Teil von mir hoffte, sie käme zu Deutsch. Es war immerhin der erste Schultag nach den Sommerferien. Vielleicht war alles nur ein Irrtum. Ich wünschte mir, Jale würde leise und erschrocken lachen. »Du hast geglaubt, es wäre heute? Aber, Enna, ich würde doch an unserem großen Tag nicht einfach so verschwinden! Es ist erst morgen so weit. Morgen, weißt du nicht mehr?«
Alles würde sich aufklären. Mit Jale zusammen würde ich weiterzählen.
»Minus drei Stunden«, flüsterte ich stattdessen allein vor mich hin.
Ein paar Schritte entfernt sah ich Ayla Demir. Wie immer erinnerte mich ihr Anblick an einen Geist. Sie sah aus, als wäre sie vor vielen Jahrzehnten der Einladung zu einer eleganten Dinnerparty in einem Schloss gefolgt und nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Ihr Haar war blond gefärbt und mit Schmetterlingsspangen geschmückt, ihr Mund blutrot geschminkt und ihr Kleid lang. Und um ihren Hals schloss sich ein enger Spitzenkragen wie weiße dünne Finger. Eigentlich war sie die Letzte, mit der ich jetzt sprechen wollte.
»He, Ayla.« Ein Lächeln konnte ich mir nicht abringen.
»Mmh?« Sie schob das Kinn vor.
»Hast du Jale gesehen?«
Ganz leicht zog sie die Brauen zusammen. »War sie nicht bei dir?«
Ich konnte schon ihre Art zu sprechen, diese überdeutlich artikulierten Konsonanten, nicht ausstehen. »Nein. Würde ich dich sonst fragen?«
Sie legte den Kopf schief. »Bleib mal ruhig, girl.«
Und wie ich ihre geliebten Anglizismen hasste. Mit dieser Meinung war ich in der Schule allerdings allein – jedenfalls solange Jale nicht hier war.
»Du hast keine Ahnung, was bei mir los ist. Vielleicht solltest du dir das mal bewusstmachen, bevor du deine schlauen Ratschläge raushaust«, fuhr ich sie an. Ich konnte mich in diesem Moment selbst nicht leiden. Doch es überraschte mich nicht im Geringsten, dass es Ayla war, an der ich meine Laune ausließ.
»Gut, Enna. Was ist los?« Sogar das t in Aylas ist knallte.
»Jale ist nicht da. Weißt du, wo sie ist?«
»Woher soll ich das wissen?«
Was hatte ich auch erwartet?
»Enna! Da bist du ja!«
Ich unterdrückte ein Seufzen und drehte mich um. Vor mir stand Luca Lemke – breites Kreuz, übertriebener Bizeps, Tattoos bis zu den Unterarmen. »Ich habe zwanzig Minuten auf dich gewartet. Wir hätten vorhin Redaktionssitzung gehabt.« Luca sah man selten verärgert. Doch ich hatte es anscheinend geschafft.
»Sorry«, murmelte ich. »Hast du meine Schwester gesehen?«
»Ne. Aber dich sehe ich gerade. Hast du deinen Artikel über die Elbvertiefung fertig? Nächste Woche ist Redaktionsschluss.«
Ich verzog das Gesicht. In den vergangenen Tagen hatte ich keine Sekunde an die Schülerzeitung gedacht. Von Anfang an war ich dagegen gewesen, unsere erste Ausgabe schon so kurz nach den Sommerferien erscheinen zu lassen, aber Luca, neben mir der einzige Redakteur, hatte so lange genervt, bis ich eingeknickt war. Immer wieder hatte ich es bereut, überhaupt der AG beigetreten zu sein. Eigentlich hielt ich mich nicht unbedingt länger als nötig in der Schule auf – zu laut, zu viele Menschen und zu viele unausgesprochene Erwartungen und Regeln. Und die Schülerzeitung machte zudem sehr viel mehr Arbeit, als ich gedacht hatte. Vor allem, da es nur zwei Leute gab, die sie gründen wollten – Luca und mich. Doch einmal dabei, brachte ich es nicht übers Herz, einen Rückzieher zu machen und Luca mit allem allein zu lassen. Außerdem wollte ich auf keinen Fall, dass die Leute aus meiner Klasse am Ende recht behielten. Denn als sie erfahren hatten, dass ich mit Luca eine Schülerzeitung gründen wollte, hatten sie es überhaupt nicht glauben können.
»Enna Eggers macht irgendetwas ohne ihre Schwester? No way. Die ist doch krankhaft auf Jale fixiert«, hatte einer gesagt.
Und eine andere: »Enna Eggers schreibt Artikel? Verarsch mich nicht. Dafür müsste sie still in einem geschlossenen Raum sitzen. Sie müsste mit Menschen reden, statt sie nur anzumotzen. Das hat sie noch nie gekonnt.«
Ich hatte es ihnen allen zeigen wollen. Dabei steckte, wenn ich ganz ehrlich war, in all diesen Behauptungen ein Funken Wahrheit, so weh es auch tat, mir das einzugestehen.
»Sorry, ich werd’s nicht schaffen«, sagte ich nun. »Tut mir leid.«
Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Ayla den Moment nutzte, um abzuhauen. Luca ließ die Arme hängen und schaute mich mit großen Augen an. »Dann können wir im August nicht mehr in Druck gehen.«
»Sorry«, sagte ich noch mal.
Lucas Brauen zogen sich zusammen. »Du lässt mich im Stich?«
Von hinten trat Paul, ein großer, dünner Typ, an Luca heran und schlug ihm auf die Schulter. »Was hast du erwartet?« Er grinste. »Bei der Mutter! War doch klar, dass du dich auf die nicht verlassen kannst!«
Ich wollte mich umdrehen und gehen. Heute hatte ich wirklich nicht die Kraft, mich auch noch über Paul zu ärgern. Doch Luca reagierte schneller als ich.
»Red nicht so eine Scheiße, Paul. Das hier hat weder etwas mit Ennas Mutter noch mit dir zu tun. Verpiss dich einfach.«
Paul jaulte lachend auf. »Du verteidigst die?«
Luca verdrehte die Augen und verschränkte die muskulösen Arme vor der Brust. »Ich verteidige jede Frau gegen deinen misogynen Bullshit, wenn es sein muss.«
Paul grinste, wandte sich ab und rief ihm im Gehen zu: »Stimmt. Damit du es hinterher auf TikTok posten kannst!«
Luca antwortete nicht mehr und drehte sich wieder zu mir um. Sein Ärger auf mich schien verflogen zu sein. Wahrscheinlich war er von seiner heroischen Tat so begeistert, dass alles andere dahinter verblasste. Ich verdrehte unwillkürlich die Augen.
»Was ist los, Enna?«, fragte er und musterte mein Gesicht. »Du bist schon seit Tagen so komisch. Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Ne, Luca. Paul hat recht. Dreh einfach ein neues pseudoaktivistisches Gym-Video und lass mich in Ruhe.«
Ich nahm meine Kopfhörer aus meiner Bauchtasche, steckte sie mir in die Ohren und ließ ihn stehen. Es war schon das zweite Mal an diesem Morgen, dass ich mich verabscheute. Ohne Jale an meiner Seite war ich wirklich die schlimmste Version meiner selbst. Beinahe erinnerte ich mich an meine eigene Oma. Wäre meine Schwester hier, könnte ich vielleicht ein bisschen nachsichtig sein, könnte Lucas Verhalten nett finden und mich bei ihm bedanken. Doch jetzt, wo Jale weg war, tat sich in mir ein Loch auf, in das alles hineingesogen wurde: mein Verständnis, meine Höflichkeit, die Fähigkeit, angemessen mit anderen Leuten umzugehen. Jale konnte all das in jeder Situation. Ich konnte es nur, wenn Jale bei mir war. Während ich über den Hof lief, gab mir Billie Eilish recht: Ich bin der bad guy. Es läutete zur nächsten Stunde, und beinahe hätte ich mich von der Masse ins Gebäude mitziehen lassen, mich wie all die anderen in meinen Klassenraum begeben, als wäre es ein ganz normaler Tag. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und ließ meinen Blick über all die Köpfe und Gesichter gleiten. Keines davon bedeutete mir etwas. Denn meine Schwester war nicht hier. Also lief ich dann doch gegen den Strom hinüber zu den Fahrrädern, schloss meins auf und fuhr in Richtung der kilometerlangen Obstplantagen davon.
Sobald das Rufen und Lachen auf dem Schulhof der Stille zwischen den Apfelbäumen gewichen waren, atmete ich ein wenig auf und drehte Billie Eilish leiser. Der Menschenmenge zu entkommen tat gut. Doch Jale hatte ich nicht gefunden – sie war nicht zur Schule gekommen. Dabei war ihr die Schule heilig. Ich hatte schon häufig vorgeschlagen, zu schwänzen, einfach in die Elbmarsch rauszufahren und die Wolken zu beobachten, anstatt uns der Lautstärke und den Streitereien in der Schule auszusetzen. Doch Jale war der Unterricht immer wichtig gewesen.
»Wir dürfen nicht so enden wie Mama«, sagte sie manchmal, und ich wusste, dass sie sich für diese Worte schämte. Wir hatten eine stille Übereinkunft getroffen. Über unsere Mutter würden wir nicht schlecht sprechen. Wenn alle anderen es taten, mussten wir erst recht zu ihr halten. Wir und Oma Ehmi waren die Einzigen, die sie verteidigten. Die Einzigen, die trotz allem an sie glaubten. Nur hin und wieder, in Sätzen wie diesen, wurden wir schwach. Wir vermissten Mama, wir wollten bei ihr sein. Doch so sein wie sie, das wollten wir nicht.
So gern ich auch vom Schwänzen träumte und davon, dass wir endlich mal auf alles scheißen würden, so sehr achtete ich dennoch darauf, gute Noten zu schreiben. Allerdings tat ich es aus einem anderen Grund als Jale. Meine Schwester wollte irgendwann einmal etwas aus ihrem Leben machen. Ich hingegen wollte die Leute in unserer Klasse einfach Lügen strafen – und zwar jetzt. Jetzt wollte ich ihnen zeigen, dass sie sich in uns irrten. Mamas Geschichte sagte nichts über uns aus. Wir waren klüger, als sie alle zugeben wollten.
Wenn Jale und ich zusammen waren, funktionierte das, gemeinsam waren wir Gegenwart und Zukunft. Doch in diesem Moment, in dem ich allein entlang der Apfelbaumreihen fuhr, wurde mir klar, wie hilflos ich ohne meine Schwester war.
»Mama ist nicht geendet«, hatte ich Jale jedes Mal geantwortet. Dabei wusste ich natürlich, dass sie recht hatte. Ein Teil von Mama war geendet. Für immer.





























