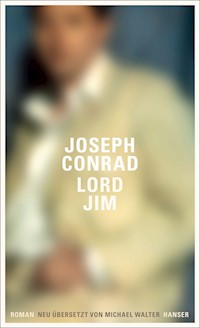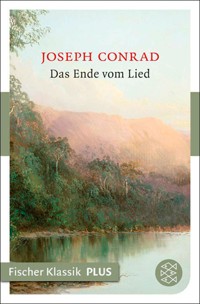
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Alles ist anders gelaufen als erwartet. Kapitän Whalley, früher wohlhabend, erfolgreich, berühmt, ist im Alter dem finanziellen Ruin nahe. Auch von Stolz und Ehre musste er sich verabschieden. Mit unbeirrbarer Entschlossenheit, zu allem bereit, verfolgt er nur noch ein einziges Ziel: seiner Tochter in Australien Geld schicken und sie noch einmal wieder sehen zu können. Doch die Chancen stehen schlecht: Er befindet sich auf einem maroden Schiff, umgeben von skrupellosen, gewinnsüchtigen Männern. Und schlimmer noch: Da gibt es etwas, das sie auf keinen Fall wissen dürfen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Ähnliche
Joseph Conrad
Das Ende vom Lied
Erzählung
Erzählung
Aus dem Englischen von Manfred Allié
FISCHER E-Books
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Inhalt
I.
Noch lange nachdem der Dampfer Sofala Kurs auf Land genommen hatte, blieb die flache, sumpfige Küste nichts als ein verschwommener schwarzer Fleck hinter dem glitzernden Band des Wassers. Die Sonnenstrahlen prallten mit solcher Heftigkeit auf die ruhige See, dass es war, als wollten sie auf der diamantenen Oberfläche zu blitzendem Staub zerplatzen, zu einem gleißenden Lichtschleier, der das Auge blendete und mit seinem unsteten Leuchten den Verstand müde machte.
Kapitän Whalley sah nicht hin. Als sein Serang sich dem geräumigen Korbsessel, den er mühelos ausfüllte, näherte und ihn mit leiser Stimme wissen ließ, dass der Kurs geändert werden müsse, hatte er sich auf der Stelle erhoben und war, den Blick nach vorn gerichtet, stehen geblieben, bis der Bug seines Schiffes einen Viertelkreis beschrieben hatte. Er hatte kein einziges Wort gesprochen, nicht einmal Anweisung gegeben, auf Kurs zu gehen. Es war der Serang, der Bootsmann, ein älterer, lebhafter kleiner Malaie mit tiefdunkler Haut, der dem Rudergänger den Befehl zumurmelte. Danach ließ Kapitän Whalley sich wieder in den Sessel auf der Kommandobrücke sinken und blickte starr auf die Deckplanken zu seinen Füßen.
Er konnte nicht darauf hoffen, dass er auf dieser Route noch etwas Neues zu Gesicht bekam. Er befuhr die Küstenregion schon seit drei Jahren. Vom Low Cape bis nach Malantan waren es fünfzig Meilen, sechs Stunden Fahrt für den alten Dampfer, wenn er mit der Flut fuhr, sieben gegen die Strömung. Dann steuerte man geradewegs auf das Land zu, und nach und nach erschienen drei Palmen am Horizont, hoch und schlank, die zerzausten Kronen verschwörerisch zusammengesteckt, als übten sie insgeheim Kritik an den dunklen Mangroven. Die Sofala hielt auf den düsteren Küstenstreifen zu, wo in einem bestimmten Augenblick, wenn das Schiff nahe genug herangekommen war, mehrere Einschnitte erkennbar wurden– das sumpfige Mündungsgebiet eines Flusses. Von dort stampfte die Sofala flussaufwärts durch eine dunkle Brühe, drei Teile Wasser und ein Teil schwarze Erde, gesäumt von flachen Ufern, drei Teile schwarze Erde und ein Teil brackiges Wasser, wie sie es seit sieben oder mehr Jahren Monat für Monat getan hatte, lange bevor er überhaupt gewusst hatte, dass es sie gab, lange bevor er je auf die Idee gekommen war, er könne einmal etwas mit ihr und ihren immergleichen Fahrten zu tun haben. Der alte Dampfer hätte den Weg besser kennen müssen als seine Besatzung, von der nicht alle so lange dabei waren; besser als der treue Serang, den der Kapitän von seinem letzten Schiff mitgebracht hatte, damit er für ihn die Wache übernahm; besser als er selbst, der erst seit drei Jahren das Kommando an Bord führte. Man konnte sich allzeit darauf verlassen, dass die Sofala den Kurs hielt. Ihr Kompass versagte nie. Sie war leicht zu steuern, als hätte das hohe Alter ihr Wissen, Weisheit und Beständigkeit verliehen. Sie landete stets exakt an der berechneten Stelle, und das fast immer pünktlich. Wann immer er ohne aufzublicken auf der Brücke saß oder sich schlaflos in seinem Bett wälzte, konnte er auf den Punkt genau sagen, wo er war– einfach indem er die Tage und Stunden zählte. Er selbst kannte den Weg ebenso genau, die monotonen Hökerfahrten durch die Meerenge und wieder zurück; er kannte den Weg und die Orte und die Menschen. Erste Station Malakka, bei Tagesanbruch hinein und in der Abenddämmerung wieder hinaus, um dann, eine steife, phosphoreszierende Kielwelle im Schlepptau, diese vielbefahrene Verkehrsader des Fernen Ostens zu kreuzen. Dunkelheit und schimmernde Reflexe auf dem Wasser, leuchtend helle Sterne an einem schwarzen Himmel, vielleicht die Lichter eines heimwärts fahrenden Dampfers, der unbeirrt seinem Kurs in der Mitte der Straße folgte, vielleicht auch der flüchtige Schatten eines Eingeborenenschiffs mit Mattensegeln, das lautlos vorüberglitt– und bei Tageslicht flaches Land in Sichtweite auf der anderen Seite. Um die Mittagszeit die drei Palmen des nächsten Hafens am Oberlauf eines trägen Flusses. Der einzige Weiße dort war ein junger ehemaliger Seemann, mit dem er sich im Lauf seiner vielen Reisen angefreundet hatte. Sechzig Meilen weiter der nächste Hafen, eine tiefeingeschnittene Bucht mit einigen wenigen Hütten am Strand. Und so ging es weiter, einlaufen und auslaufen, hie und da in einem Küstenort Ladung aufnehmen und zum Schluss hundert Meilen ununterbrochen durch das Labyrinth eines Archipels aus winzigen Inseln bis zu einer großen Ansiedlung der Einheimischen am Ende der Route. Dort legte das alte Schiff eine dreitägige Ruhepause ein, bevor es die Rückreise antrat und er dieselben Ufer aus der umgekehrten Richtung sah, dieselben Stimmen an denselben Orten hörte und über die große Straße des Ostens wieder den Heimathafen erreichte, wo die Sofala fast genau gegenüber dem massigen Steinbau der Hafenmeisterei festmachte, bis es Zeit war, die vertraute Runde von 1600 Meilen und dreißig Tagen erneut zu befahren. Kein allzu abwechslungsreiches Leben für Kapitän Whalley, Henry Whalley, auch bekannt als Harry Whalley, der Draufgänger von der Condor, einem seinerzeit berühmten Klipper. Nein. Kein sonderlich abwechslungsreiches Leben für einen Mann, der für berühmte Kompanien gefahren war und berühmte Schiffe gesteuert hatte (mehr als eines davon sein Eigentum); der berühmte Reisen unternommen und neue Routen und Handelswege erkundet hatte; der die unbekannten Gewässer der Südsee befahren und über Inseln die Sonne hatte aufgehen sehen, die auf keiner Karte verzeichnet waren. Fünfzig Jahre auf See, und vierzig davon in Ostindien (»eine verdammt lange Lehrzeit«, sagte er gern mit einem Lächeln), hatten ihm bei einer ganzen Generation von Reedern und Kaufleuten einen guten Ruf eingetragen, in sämtlichen Häfen von Bombay bis dahin, wo an der Küste der beiden Amerika der Osten auf den Westen trifft. Sein Ruhm hatte zwar kleine, aber doch deutliche Spuren auf den Seekarten hinterlassen. Gab es nicht irgendwo zwischen Australien und China eine Whalley-Insel und ein Condor-Riff? Auf dieser gefährlichen Korallenbank hatte der gefeierte Klipper einst drei Tage lang festgesessen; Kapitän und Mannschaft hatten buchstäblich mit der einen Hand die Ladung über Bord geworfen, während sie mit der anderen eine Flottille von eingeborenen Kriegskanus abwehrten. Zu jener Zeit gab es auf den offiziellen Karten weder die Insel noch das Riff. Mit der Wahl der beiden Namen zollten die Offiziere des königlichen Dampfschiffs Füsilier, die später den Auftrag erhielten, die Route zu kartieren, der Leistung des Mannes und der Tüchtigkeit seines Schiffs ihren Tribut. Überdies beginnt, wie jeder Interessierte selbst nachlesen kann, das Allgemeine Handbuch, Bd.II, S.410, seine Beschreibung der »Malotuor-Whalley-Passage« mit den Worten: »Diese im Jahre 1850 von Kapitän Whalley auf dem Schiff Condor entdeckte Passage« und endet damit, dass es die Route allen Seglern, die von Dezember bis April die chinesischen Häfen in Richtung Süden verlassen, wärmstens ans Herz legt.
Das war der größte Erfolg seines Lebens. Diesen Ruhm konnte niemand mehr schmälern. Der Durchstich an der Landenge von Suez hatte, einem Dammbruch gleich, eine Flut von neuen Schiffen, neuen Menschen, neuen Handelsmethoden in den Fernen Osten gespült. Dieses Ereignis hatte das Antlitz der östlichen Meere ebenso verändert wie die gesamte Lebensweise, und so hatten seine früheren Erfahrungen für die jüngere Generation von Seeleuten nun keinerlei Bedeutung mehr.
In jenen längst vergangenen Tagen hatte er für viele Tausend Pfund aus dem Vermögen seiner Auftraggeber und auch aus seiner eigenen Tasche die Verantwortung getragen; er hatte, wie das Gesetz es von einem Schiffskapitän erwartet, die widerstreitenden Interessen von Reedern, Kaufleuten und Versicherungen sorgfältig miteinander vermittelt. Nie hatte er ein Schiff verloren oder sich auf unseriöse Geschäfte eingelassen; und er hatte standgehalten, länger sogar als die Welt, in der er sich einen Namen gemacht hatte. Er hatte seine Frau bestattet (im Golf von Petschili), hatte seine Tochter mit dem Mann verheiratet, auf den zu seinem Kummer ihre Wahl gefallen war, und hatte beim Zusammenbruch der berüchtigten Travancore-Deccan-Bank, der ganz Ostindien wie ein Erdbeben erschütterte, ein mehr als ansehnliches Vermögen verloren. Und er war siebenundsechzig Jahre alt.
II.
Sein Alter trug er leicht, und seines verlorenen Vermögens schämte er sich nicht. Er war nicht der Einzige gewesen, der auf diese Bank gesetzt hatte. Männer, deren Urteil in Finanzdingen so untrüglich war wie das seine in Seemannsdingen, hatten seine Umsicht bei den Investitionen gelobt und bei dem großen Bankrott selbst viel Geld verloren. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und ihm war, dass er alles eingebüßt hatte. Und nicht einmal das stimmte ganz. Von seinem verlorenen Reichtum war ihm eine schmucke kleine Bark geblieben, die Fair Maid, die er ursprünglich erworben hatte, um mit ihr seine Mußestunden als Seemann im Ruhestand zu verbringen– »mein Spielzeug«, wie er selbst sagte.
Im Jahr vor der Heirat seiner Tochter hatte er seinerzeit in aller Form erklärt, er ziehe sich von der Seefahrt zurück. Doch als das junge Paar zu seinem zukünftigen Zuhause in Melbourne aufgebrochen war, merkte er schnell, dass er an Land nicht glücklich sein konnte. Er war zu sehr Handelskapitän, als dass eine Jacht zum Zeitvertreib ihn zufriedenstellte. Er wollte weiter tätig sein, und mit dem Erwerb der Fair Maid sorgte er dafür, dass er sein altes Leben weiterleben konnte. Er stellte sie seinen Bekannten in all den Häfen als »mein letztes Kommando« vor. Wenn er einmal zu alt sei, um ein Schiff zu führen, werde er sie auflegen lassen und an Land gehen, um dort zu sterben; in seinem Testament werde er bestimmen, dass die Bark am Tage seiner Beisetzung aufs offene Meer geschleppt und dort mit allen Würden versenkt werden solle. Seine Tochter werde ihm die Genugtuung nicht verwehren, dass kein Fremder nach ihm sein letztes Schiff steuern solle. Bei dem Vermögen, das er ihr vermachen werde, sei der Gegenwert einer 500-Tonnen-Bark kaum der Rede wert. All dies sagte er mit einem schelmischen Augenzwinkern: Der rüstige alte Mann war viel zu munter für solch sentimentales Bedauern; aber ein wenig wehmütig war er doch, denn er liebte das Leben und hatte seine echte Freude an all den Dingen und Unternehmungen, an seinem Ansehen und Ruf und seinem Wohlstand, an der Liebe zu seiner Tochter und seinem Stolz auf das Schiff– seinem Spielzeug für die Muße des Alters.
Er ließ die Kajüte nach seinen genügsamen Vorstellungen von Bequemlichkeit auf See einrichten. Ein großes Bücherregal (denn er las viel) nahm die eine Seite seines Salons ein; das Porträt seiner verstorbenen Frau, ein stumpfes, düsteres Ölgemälde, auf dem man das Profil und eine einzelne lange schwarze Haarlocke einer jungen Frau erkennen konnte, hing seiner Bettstatt gegenüber. Drei Chronometer wiegten ihn in den Schlaf und tickten beim Aufwachen munter um die Wette. Tag für Tag stand er um fünf Uhr auf. Durch die weite Öffnung des kupfernen Ventilators hörte dann der Offizier der Morgenwache, der mit einer frühmorgendlichen Tasse Kaffee auf dem Achterdeck am Ruder stand, das Spritzen, Prusten und Planschen, das sein Kapitän bei der Morgentoilette machte. Auf diese Geräusche folgte in der Regel das tiefe Gemurmel des Vaterunsers, das er mit lauter, ernster Stimme sprach. Fünf Minuten später tauchten Kopf und Schultern von Kapitän Whalley im Treppenabgang auf. Jedes Mal hielt er einen Augenblick lang inne, ließ den Blick über den Horizont bis hinauf zur Takelage schweifen und atmete mit tiefen Zügen die kühle frische Luft ein. Erst dann trat er hinaus auf das Achterdeck und quittierte die zum Gruß an den Mützenschirm gelegte Hand mit einem gemessenen, wohlwollenden »Einen guten Morgen wünsche ich«. Bis acht Uhr schritt er gewissenhaft auf Deck auf und ab. Hin und wieder, ein-, zweimal im Jahr, musste er sich eines steifen Hüftgelenks wegen auf einen dicken, knorrigen Stock stützen– ein Anflug von Rheumatismus, nahm er an. Ansonsten kannte er keine körperlichen Beschwerden. Wenn die Glocke zum Frühstück rief, begab er sich unter Deck, fütterte seine Kanarienvögel, zog die Chronometer auf und nahm seinen Platz am Kopfende des Tisches ein. Von dort blickte er direkt auf die großformatigen, schwarz gerahmten Fotografien von seiner Tochter, ihrem Ehemann und zwei speckbeinigen Babys– seinen Enkelkindern–, die in die aus Ahornholz gefertigten Schotten der Kajüte eingelassen waren. Nach dem Frühstück polierte er das Glas über diesen Porträts eigenhändig mit einem Tuch und staubte das Ölbild von seiner Frau mit einem Staubwedel ab, der neben dem schweren Goldrahmen an einem kleinen Messinghaken baumelte. Anschließend setzte er sich hinter verschlossener Kajütentür auf die Couch zu Füßen des Porträts, um ein Kapitel in einer dicken Taschenbibel zu lesen– ihrer Bibel. Doch an manchen Tagen saß er nur eine halbe Stunde lang da, den Finger zwischen die Seiten geklemmt, das Buch ungeöffnet auf den Knien. Vielleicht war ihm plötzlich eingefallen, wie gern sie auf See gewesen war.
Sie war eine echte Gefährtin gewesen, und eine gute Ehefrau dazu. Für ihn stand fest, dass es nie ein helleres, fröhlicheres Heim gegeben hatte noch je geben würde, weder zu Wasser noch zu Land, als ihr Zuhause unter dem Achterdeck der Condor, die große Kapitänskajüte ganz in Weiß und Gold, wie für ein immerwährendes Fest mit nie verwelkenden Girlanden geschmückt. Jedes Paneel hatte sie liebevoll mit Blumen ihrer Heimat bemalt. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis sie mit dem Salon fertig war. Für ihn blieben ihre Malereien immer ein Wunderwerk, der Gipfel des Geschmacks und der Kunstfertigkeit; und der alte Swinburne, sein Maat, stand, wann immer er zu einer Mahlzeit herunterkam, in Bewunderung erstarrt vor dem Fortschritt ihres Werks. Man könne die Rosen beinahe riechen, erklärte er und sog das schwache Terpentinaroma ein, das in jener Zeit den Salon durchwehte und ihn (wie er im Nachhinein gestand) beim Essen etwas weniger herzhaft zugreifen ließ als sonst. Doch nichts gab es, was seine Freude an ihrem Gesang hätte trüben können. »Mrs Whalley ist wahrhaftig eine Nachtigall, Sir«, erklärte er mit Kennermiene, wenn er ihr, über die Luke gebeugt, bis zum Ende ihrer Darbietung andächtig gelauscht hatte. Bei schönem Wetter konnten die beiden Männer während der zweiten Abendwache ihre von Klavier untermalten Triller und Rouladen aus der Kajüte hören. Gleich am Tag ihrer Verlobung hatte er nach London geschrieben und das Instrument bestellt; aber als es nach seiner langen Reise um das Kap endlich eintraf, waren sie bereits über ein Jahr lang verheiratet. Die große Kiste war Teil der ersten Stückgutladung gewesen, die direkt nach Hongkong verschifft wurde– ein Ereignis, das den Menschen, die heute an den geschäftigen Kais entlanggingen, so fern und unwirklich vorkommen musste wie die graueste Vorzeit. Aber Kapitän Whalley konnte in einer einsamen halben Stunde sein gesamtes Leben Revue passieren lassen, die romantischen, beschaulichen Zeiten wie die Zeiten des Kummers. Er hatte ihr selbst die Augen schließen müssen. Sie wurde auf See bestattet, tief im Herzen selbst ein Geschöpf der See. Ohne ein Zittern in der Stimme hatte er die Worte der Trauerandacht aus ihrem eigenen Gebetbuch vorgelesen. Als er den Blick hob, sah er den alten Swinburne, der ihn, die Mütze an die Brust gepresst, anstarrte, das knorrige, wettergegerbte, unerforschliche Gesicht von Wasser überströmt wie ein zerklüfteter roter Granitfelsen in einem Regenschauer. Der alte Seebär hatte gut weinen. Er aber musste weiterlesen bis zum Ende; doch was in den nächsten Tagen nach dem klatschenden Aufprall geschah, daran erinnerte er sich nicht mehr. Ein älterer Matrose aus der Mannschaft, der gut mit Nadel und Faden umgehen konnte, schneiderte aus einem ihrer schwarzen Röcke ein Trauerkleid für das Kind.
All das würde er gewiss nie vergessen; aber man kann das Leben nicht aufstauen wie einen trägen Strom. Es wird den Damm durchbrechen und über das Leid eines Menschen hinweggehen, es wird seinen Kummer aufnehmen wie das Meer einen Toten, ganz gleich, wie viel Liebe mit auf den Grund gesunken ist. Und die Welt ist nicht schlecht. Die Menschen waren sehr gut zu ihm gewesen, vor allem Mrs Gardner, die Ehefrau des Seniorpartners von Gardner, Patteson Co., den Eignern der Condor. Sie hatte angeboten, sich um die Kleine zu kümmern, und hatte sie später zum Abschluss ihrer Erziehung zusammen mit ihren eigenen Töchtern mit nach England genommen (in damaliger Zeit eine sehr beschwerliche Reise, selbst auf dem Landweg). Er sollte sie erst zehn Jahre später Wiedersehen.
Als kleines Kind hatte sie sich nie vor Unwettern gefürchtet; sie hatte gebettelt, dass er sie unter seinen Ölmantel packte und mit an Deck nahm, damit sie zusehen konnte, wie die gewaltigen Wassermassen auf die Condor einstürzten. Das Tosen und Krachen der Wellen erfüllte ihre kleine Seele, wie es schien, mit atemlosem Entzücken. »An ihr ist ein Junge verlorengegangen«, sagte er oft im Scherz. Er hatte sie auf den Namen Ivy getauft, des Klangs und einer dunklen Faszination wegen, die er beim Gedanken an diese Pflanze empfand. Wie Efeu hielt sie sein Herz eng umschlungen, und er wünschte sich, dass sie sich fest an ihren Vater schmiegte wie an einen Stamm, der ihr Halt bot; und solange sie klein war, dachte er nicht daran, dass sie, wie es in der Natur des Lebens liegt, irgendwann ihre Ranken lieber um einen anderen schlingen würde. Aber er liebte das Leben so sehr, dass ihm auch dies, als es schließlich kam, in gewissem Sinne Freude machte, über das Gefühl des großen Verlustes in seinem Inneren hinaus.
Nachdem er die Fair Maid als Beschäftigung für seine einsamen Tage erworben hatte, nahm er sogleich eine nicht allzu einträgliche Fracht nach Australien an, einfach weil sie ihm die Gelegenheit bot, seine Tochter in ihrem neuen Zuhause zu besuchen. Aber er war nicht recht zufrieden dort– nicht weil ihre Ranken nun einen anderen umschlangen, sondern weil der Stamm, den sie dafür erkoren hatte, sich bei genauerem Hinsehen als »ein ziemlich armseliges Stöckchen« entpuppte– und nicht einmal gesund war. Die steife Höflichkeit seines Schwiegersohns missfiel ihm fast noch mehr als die Art, wie er Ivys Mitgift verschleuderte. Aber er behielt seine Bedenken für sich. Erst am Tag der Abreise, als er sie in der offenen Haustür bei den Händen hielt und ihr tief in die Augen blickte, hatte er gesagt: »Du weißt, meine Liebe, alles, was ich besitze, gehört dir und den Kindern. Bitte schreibe mir ganz offen.« Sie hatte ihm mit einem kaum merklichen Nicken geantwortet. Nicht nur Augen und Wesensart waren die ihrer Mutter– wie diese verstand auch die Tochter ihn ohne viele Worte.
Es dauerte nicht lange, bis sie schrieb, und bei manchen dieser Briefe hob Kapitän Whalley die weißen Augenbrauen. Doch alles in allem schien es ihm der schönste Lohn für sein Leben, dass er aushelfen konnte, wann immer sie in Not war. Im Grunde fühlte er sich wohler, als er es seit dem Tod seiner Frau je getan hatte. Und es war typisch, dass die Regelmäßigkeit, mit der sein Schwiegersohn Schiffbruch erlitt, aus der Ferne eine Art Zuneigung für den Mann in ihm weckte. Der Bursche geriet so oft in Seenot, dass man es unmöglich alles seinem Leichtsinn anlasten konnte. Nein, nein! Er wusste genau, was das war. An dem Mann klebte das Pech. Ihm selbst war im Leben viel Glück widerfahren, aber er hatte zu viele gute Männer gesehen– Seeleute und andere–, die von der schieren Last des Pechs in die Tiefe gezogen wurden, als dass er die bösen Vorzeichen jetzt nicht erkannt hätte. Und deshalb war er sogar da noch mit Gedanken beschäftigt gewesen, wie er jeden Penny, den er hinterlassen würde, sicher anlegen könne, als nach einem leisen Rumoren (das erste Donnergrollen erreichte ihn in Schanghai) der Schock des großen Bankenkrachs kam; und nachdem er die Phasen der Erstarrung, der Ungläubigkeit und der Entrüstung durchlaufen musste, hatte er sich damit abfinden müssen, dass er nun nichts Nennenswertes mehr hinterlassen konnte.
Als habe er nur auf diese Katastrophe gewartet, gab der unglückliche Mann im fernen Melbourne sein wenig einträgliches Spiel nun vollends auf und setzte sich zur Ruhe– und das in einem Rollstuhl. »Er wird nie wieder laufen können«, schrieb seine Ehefrau. Und zum ersten Mal in seinem Leben fehlten Kapitän Whalley die Worte.
Fortan musste die Fair Maid ernsthaft arbeiten. Jetzt ging es nicht mehr darum, die Erinnerung an den Draufgänger Harry Whalley auf den ostindischen Meeren lebendig zu halten oder einem alten Mann ein wenig Taschengeld und hin und wieder einen neuen Anzug zu verschaffen, vielleicht am Jahresende die Rechnung für ein paar Hundert erstklassige Zigarren zu begleichen. Er musste sich ordentlich ins Zeug legen und sich um sein Schiff kümmern, und vielleicht blieb gerade noch genug übrig, um die üppige goldene Schnörkelzier an Heck und Vordersteven instand zu halten.
Diese Notlage öffnete ihm die Augen dafür, wie sehr sich die Welt um ihn herum verändert hatte. Aus seiner Vergangenheit blieben nur ein paar vertraute Namen, hie und da, aber die Dinge und die Menschen, die er gekannt hatte, waren fort. Der Name Gardner, Patteson Co. prangte noch immer in mehr als einer östlichen Hafenstadt auf den Wänden von Lagerhäusern am Kai und auf Messingschildern und Fensterscheiben in den Geschäftsvierteln, aber es gab in der Firma keinen Gardner und auch keinen Patteson mehr. Kein Sessel und kein herzlicher Willkommensgruß wartete mehr im Privatkontor auf Kapitän Whalley, und niemand hatte mehr einen kleinen Auftrag für einen alten Freund, um der alten Zeiten willen. Jetzt saßen die Ehemänner der Gardner-Töchter an den Schreibtischen in dem Raum, wo er noch lange nach seinem Ausscheiden aus den Diensten der Firma jederzeit willkommen gewesen war, solange der Senior dort das Sagen hatte. Ihre Schiffe hatten jetzt gelbe Schornsteine mit schwarzem Topp und feste Fahrpläne wie eine elende Straßenbahn. Ob es Dezember war oder Juni, spielte keine Rolle, die Winde waren für sie alle gleich; ihre Kapitäne (allesamt hervorragende junge Männer, daran zweifelte er nicht) wussten sicher, wo die Whalley-Insel lag, denn die Regierung hatte vor einigen Jahren ein weißes Signalfeuer an der Nordspitze installieren lassen (mit einem roten Gefahrensektor über dem Condor-Riff), aber die meisten von ihnen wären bass erstaunt gewesen, wenn sie erfahren hätten, dass dieser Whalley immer noch unter den Lebenden weilte– ein alter Mann, der ruhelos über die Meere zog und hie und da einen Auftrag für seine kleine Bark zu ergattern suchte.
Und es war überall das gleiche Spiel. Verschwunden die Männer, die bei der Nennung seines Namens anerkennend genickt hätten und denen es eine Ehre gewesen wäre, etwas für den Draufgänger Harry Whalley zu tun. Verschwunden die guten Gelegenheiten, die er beim Schopf hätte packen können. Verschwunden auch die Klipper mit ihren weißen Segeln, die Bewohner der stürmischen, unsicheren Winde, die große Vermögen aus der Gischt des Meeres geschöpft hatten. In einer Welt, die Gewinne auf das kleinste mögliche Minimum drückte, in einer Welt, die ihre freie Tonnage zweimal täglich berechnen konnte und in der man sich magere Aufträge drei Monate im Voraus telegraphisch sicherte, hatte ein Einzelner, der auf gut Glück mit einer kleinen Bark unterwegs war, keine Chance– ja kaum mehr überhaupt einen Platz auf der Welt.
Es wurde von Jahr zu Jahr schwieriger. Er litt sehr darunter, dass er seiner Tochter nur so geringe Beträge schicken konnte. Mittlerweile hatte er die guten Zigarren aufgegeben und beschränkte sich sogar bei den billigen Stumpen auf sechs Stück pro Tag. Er erzählte ihr nie von seinen Schwierigkeiten, und sie sagte nicht viel über ihren Kampf ums Leben. Sie vertrauten einander so sehr, dass sie ohne große Erklärungen auskamen, und verstanden sich so gut, dass sie auf Bezeigungen der Dankbarkeit oder Zeichen des Bedauerns verzichten konnten. Er wäre entsetzt gewesen, wenn sie auf die Idee gekommen wäre, ihm ausdrücklich zu danken, aber er fand es ganz und gar selbstverständlich, wenn sie ihm sagte, sie brauche zweihundert Pfund.
Auf der Suche nach Fracht lief er mit der mit Ballast beladenen Fair Maid in den Heimathafen der Sofala ein, und dort erreichte ihn der Brief seiner Tochter. Sie wolle kein Blatt vor den Mund nehmen, schrieb sie darin. Es gebe nur einen einzigen Ausweg: sie müsse eine Pension eröffnen, wofür die Aussichten, soweit sie beurteilen könne, günstig stünden. So günstig immerhin, dass sie es wage, ihm offen zu sagen, dass sie mit zweihundert Pfund einen Anfang machen könne. Er hatte den Umschlag hastig aufgerissen, auf Deck, wo ihn ein Laufbursche des Schiffsausrüsters überbracht hatte; schon als sie den Anker zu Wasser ließen, war er mit seiner Post erschienen. Zum zweiten Mal im Leben war er mit Stummheit geschlagen und stand stocksteif am Abgang zur Kajüte, und das Blatt zitterte zwischen seinen Fingern. Eine Pension eröffnen! Zweihundert Pfund für einen Anfang! Der einzige Ausweg! Und er wusste nicht einmal, woher er zweihundert Pence nehmen sollte.
Die ganze Nacht ging Kapitän Whalley auf dem Achterdeck seines vor Anker liegenden Schiffs auf und ab, als nähere er sich bei schwerem Nebel der Küste und sei sich seiner Position nicht mehr gewiss, nach einer Reihe von grauen Tagen ohne einen einzigen Blick auf Sonne, Mond und Sterne. Die Richtfeuer der Seeleute und der unbewegte Lichtersaum am Ufer funkelten in der Nacht, und rings um die Fair Maid warfen die Ankerlichter der Schiffe tanzende Strahlen über das Wasser der Reede. Kapitän Whalley sah nicht einmal einen Schimmer, bis der Morgen kam und er merkte, dass seine Kleider klamm waren vom schweren Tau.
Sein Schiff erwachte. Er blieb abrupt stehen, fuhr sich über den nassen Bart und stieg dann rückwärts mit müden Füßen die Achterdecktreppe hinab. Der Erste Offizier, der schläfrig unten gestanden hatte, hielt mitten in einem großen Gähnen inne und stand mit offenem Munde da.
»Einen guten Morgen wünsche ich«, sagte Kapitän Whalley grimmig und duckte sich in die Tür zur Kajüte. Dort hielt er inne, und ohne sich umzudrehen, sagte er: »Übrigens, da müsste eine leere Holzkiste im Lazarett sein. Sie haben sie doch nicht zu Brennholz zerhackt, oder?«
Der Offizier schloss den Mund, und dann fragte er wie benommen: »Eine leere Kiste, Sir?«
»Eine große flache Packkiste für das Gemälde in meiner Kammer. Lassen Sie sie an Deck bringen und sagen Sie dem Zimmermann, er soll sehen, ob sie in gutem Zustand ist. Vielleicht brauche ich sie bald.«
Der Erste Offizier rührte sich erst, als er hörte, wie der Kapitän in der Kajüte die Salontür hinter sich zuwarf. Dann winkte er den Zweiten Offizier mit dem Zeigefinger zu sich hin und ließ ihn wissen, dass da etwas »im Anzug war«.
Als die Glocke erklang, kam Kapitän Whalleys gebieterische Stimme von drinnen: »Setzen Sie sich und warten Sie nicht auf mich.« Und die verblüfften Offiziere nahmen ihre Plätze ein, tauschten Blicke und flüsterten über den Tisch hinweg miteinander. Was! Kein Frühstück! Und das, nachdem er offenbar die ganze Nacht an Deck gewesen war! Keine Frage, da braute sich etwas zusammen. Im Oberlicht über ihren ernst über die Teller gebeugten Köpfen schaukelten und rasselten die drei Drahtkäfige mit den Kanarienvögeln, die rastlos und hungrig darin hüpften; und sie konnten die Laute »des Alten« aus dem Salon hören. Sorgfältig zog Kapitän Whalley die Chronometer auf, staubte das Porträt seiner verstorbenen Frau ab, holte ein frisches Hemd aus der Schublade, machte sich auf seine gründliche, gemächliche Weise fertig für den Landgang. An diesem Morgen hätte er keinen einzigen Bissen heruntergebracht. Er hatte sich entschlossen, die Fair Maid zu verkaufen.
III.
Just zu dieser Zeit kauften die Japaner an europäischen Schiffen auf, was sie nur bekommen konnten, und er hatte keine Mühe, einen Käufer zu finden, einen Spekulanten, der den Preis drückte, aber bar zahlte im Vertrauen darauf, dass er mit Gewinn weiterverkaufen konnte. So kam es, dass Kapitän Whalley an einem gewissen Nachmittag die Stufen eines der größten Postämter Ostindiens hinabschritt, einen bläulichen Zettel in der Hand. Es war die Quittung für einen eingeschriebenen Brief mit einem Wechsel über zweihundert Pfund, gerichtet an eine Adresse in Melbourne. Kapitän Whalley steckte den Zettel in seine Westentasche, nahm den Stock, den er unter dem Arm gehabt hatte, und spazierte die Straße hinunter davon.
Es war eine erst vor kurzem angelegte, unordentliche Geschäftsstraße; die Bürgersteige waren noch ungepflastert, und ein feiner Staub lag über allem. Am einen Ende mündete sie in die verkommene Hafenstraße mit chinesischen Läden, am anderen führte sie unbebaut noch meilenweit weiter, durch üppiges Grün wie ein Dschungel, bis sie an den Toren der neuen Vereinigten Dockgesellschaft endete. Nüchterne Fassaden neuer Regierungsgebäude wechselten ab mit den Bretterzäunen leerer Grundstücke, und der Blick in den Himmel gab der ohnehin offenen Landschaft mehr Weite denn je. Es war eine öde Gegend, und die Einheimischen mieden sie nach Geschäftsschluss, als erwarteten sie, dass ein Tiger aus der Gegend der neuen Wasserwerke oben auf dem Berg heruntergetrottet kam und die Straße nutzte, um sich einen chinesischen Kaufmann zum Abendessen zu holen. Doch Kapitän Whalley ließ sich von der Einsamkeit dieser grandios geplanten Straße nicht einschüchtern. Dazu hatte er zu viel Persönlichkeit. Er war einfach nur ein Mann, der allein und energisch dort entlangging, mit einem langen weißen Bart wie ein Pilger und mit einem Stock, den er wie eine Waffe führte. Auf der einen Seite hatte der neue Justizpalast einen niedrigen, schmucklosen Vorbau, gedrungene Säulen hinter ein paar alten Bäumen, die an der Auffahrt stehen geblieben waren. Auf der anderen reichten die Seitenflügel des neuen Schatzamts der Kolonialverwaltung bis an die Straße heran. Doch Kapitän Whalley, der jetzt kein Schiff und kein Zuhause mehr hatte, erinnerte sich im Vorübergehen daran, dass, als er zum ersten Mal aus England herübergekommen war, an diesem Ort noch ein Fischerdorf gestanden hatte, ein paar wenige Hütten aus geflochtenen Matten, errichtet auf Pfählen zwischen dem schlammigen Brackwasser und einem sumpfigen Pfad, der in den Tiefen des Dschungels verschwunden war, ohne Hafenanlagen und ohne Wasserwerke weit und breit.
Kein Schiff– kein Zuhause. Und seine arme Ivy, so weit fort, hatte ebenfalls kein Zuhause. Ein Gästehaus, das war keine Heimat, auch wenn es einem vielleicht den Lebensunterhalt sicherte. Die Vorstellung, dass sie eine Pension betreiben sollte, kränkte ihn zutiefst. So wie das Leben ihn nun einmal gemacht hatte, empfand er eine wahrhaft aristokratische Abscheu vor der entwürdigenden Art mancher Beschäftigungen. Er hatte es immer vorgezogen, Handelsschiffe zu führen (eine aufrechte Arbeit), statt selbst zu handeln, was ja letzten Endes darauf hinauslief, dass man einen anderen zu seinem eigenen Profit übervorteilte– bestenfalls ein unwürdiger Wettstreit der geistigen Fähigkeiten. Sein Vater war Colonel Whalley (a.D.) von der Ostindienkompanie gewesen, mit sehr bescheidenem Einkommen, doch ausgezeichneten Kontakten. Er konnte sich noch aus Kindertagen erinnern, wie oft Kellner, Krämer, niedere Menschen aller Art den alten Krieger mit »Mylord« anredeten, und tatsächlich hatte er auch die Erscheinung und das Auftreten eines Lords gehabt.
Kapitän Whalley selbst (er wäre zur Navy gekommen, wäre der Vater nicht vor seinem vierzehnten Geburtstag gestorben) hatte etwas Stattliches in seiner Art, das gut zu einem alten und ruhmreichen Admiral gepasst hätte, doch er war verloren wie ein Strohhalm im Strudel eines Baches, als er nun nach der breiten und menschenleeren Hauptstraße in das braune und gelbe Gewimmel einer Seitenstraße einbog, die ihm schmal wie eine Gasse vorkam und in der das Leben rings um ihn nur so toste. Die Häuser waren blau getüncht, und die Läden der Chinesen starrten ihn an, gefährliche Höhlen, in deren Tiefe ein Untier hausen mochte. Alle nur erdenklichen Waren quollen aus dem Dunkel der langen Arkadenflucht hervor, und die prachtvolle Glut der untergehenden Sonne ließ die Mitte der Straße vom einen Ende bis zum anderen aufleuchten wie vom Widerschein eines Feuers. Das warme Licht fiel auf die bunten Kleider und die braunen Gesichter der barfüßigen Menge, auf die bleichen Rücken der halbnackten, um Platz rangelnden Kulis, auf die Uniform eines hochgewachsenen Sikhs mit gegabeltem Bart und beachtlichem Schnurrbart, der am Tor der Polizeistation Wache hielt. Sämtliche Köpfe überragend, bahnte sich in einer rot angestrahlten Staubwolke die dicht bepackte Straßenbahn durch den Menschenstrom ihren Weg unter beständigem Tuten ihres Signalhorns, wie ein Dampfer sich einen Weg durch den Nebel ertastet.
Auf der anderen Seite kam Kapitän Whalley wie ein Taucher wieder hervor, und in dem menschenleeren Schatten zwischen den Wänden zweier geschlossener Lagerhäuser nahm er den Hut ab, um sich die Stirn zu kühlen. Das Gewerbe einer Pensionswirtin hatte nicht gerade den besten Ruf. Diese Frauen galten als raffgierig, rücksichtslos, verlogen; und auch wenn es nicht seine Art war, seine Mitmenschen vorab zu verurteilen– Gott behüte!–, waren es doch Vorurteile, denen keine Whalley sich aussetzen sollte. Aber er hatte sie nicht getadelt. Er war sich sicher, dass sie die Dinge genauso sah wie er; sie tat ihm leid; er wusste, dass er sich auf ihr Urteil verlassen konnte; für ihn war es eine Gnade des Schicksals, dass er ihr noch dies eine Mal helfen konnte– aber der Aristokrat in seinem Herzen hätte sich eher damit abgefunden, wenn sie Näherin geworden wäre. Vage erinnerte er sich, dass er vor Jahren einmal etwas Rührendes gelesen hatte. »Das Lied vom Hemd« hatte es geheißen. Das mochte gut und schön sein, Lieder über die Armut von Frauen. Aber die Enkelin von Colonel Whalley– Wirtin einer Pension! Unmöglich! Er setzte seinen Hut wieder auf, wühlte in beiden Taschen, hielt inne, ließ ein Steichholz aufflammen, hielt es ans Ende eines billigen Stumpens und blies einer Welt, die solche Überraschungen bereithielt, eine Rauchwolke der Verbitterung ins Gesicht.
Eines stand für ihn fest– dass sie das kluge Kind einer klugen Mutter war. Jetzt wo er die Qual, dass er sich von seinem Schiff trennen musste, überwunden hatte, sah er deutlich, dass es ein unvermeidlicher Schritt gewesen war. Vielleicht war er sich