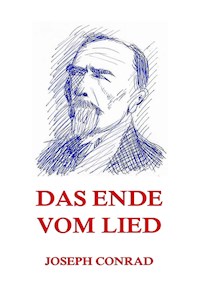
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem unnachahmlichen Stil erzählt Conrad die Geschichte des alten Kapitän Whalley, der noch einmal ein Kommando annimmt um seine verarmte Tochter unterstützen zu können. Als aber der Maschinist und Eigner des Schiffes erkennt, dass Whalley fast blind ist, möchte er diesen Umstand zu einem Versicherungsbetrug nutzen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Ende vom Lied
Joseph Conrad
Inhalt:
Joseph Conrad – Biografie und Bibliografie
Das Ende vom Lied
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Das Ende vom Lied, J. Conrad
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849607784
www.jazzybee-verlag.de
Joseph Conrad – Biografie und Bibliografie
Britischer Schriftsteller, geboren am 3. Dezember 1857 in Berditschew (Polen), verstorben am 3. August 1924 in Bishopsbourne, England. Sohn des polnischen Adligen und Schriftstellers Apollo Korzeniowski. Dieser wurde 1861 wegen nationalistischer Tätigkeiten nach Wologda in Nordrußland verbannt. Seine Familie folgte ihm dorthin. Nach dem Tod der Mutter wurde der Vater begnadigt und zog mit seinem Sohn nach Krakau, wo C. das Gymnasium besuchte. Mit 16 Jahren, nach dem Tod des Vaters 1869, zieht es C. zur See und er heuert in Marseille als Seemann an. Nach einigen Besuchen auf der Insel zieht er nach England und erhält 1886 die britische Staatsbürgerschaft. Ab 1890 beginnt C. zu schreiben, sein Durchbruch als einer der wichtigsten Autoren des frühen 20. Jahrhunderts erfolgt aber erst 1914. Er stirbt 1924 an Herzversagen.
Wichtige Werke:
Almayer's Folly: A story of an Eastern River (1895)An Outcast of the Islands (1895)The Nigger of the "Narcissus" (1897)Lord Jim (1900)Heart of darkness (1902)Nostromo: A Tale of the Seaboard (1904)The Secret Agent (1907)Under Western Eyes (1911)Chance (1914)Victory (1915)The Shadow-Line (1917)The Arrow of Gold (1919)The Rescue (1920)The Rover (1923)Suspense (1925)Das Ende vom Lied
I
Noch lange, nachdem der Dampfer Sofala Kurs auf das Land zu genommen hatte, war die morastige Küste als ein dunkler Rauchstreifen hinter dem Band aus Schaum erschienen. Es war, als ob Sonnenstrahlen mit größter Gewalt auf die ruhige See fielen, als ob sie auf der Oberfläche in glitzernden Dunst zerstäubten, in ein fast greifbares Licht, das das Auge blendete und das Hirn mit seinem grellen Flackern ermüdete.
Kapitän Whalley sah nicht auf die See. Als sein Serang sich dem geräumigen Rohrstuhl, den der Kapitän wuchtig ausfüllte, genähert und mit leiser Stimme gemeldet hatte, daß der Kurs umgesteuert werden müsse, da war Kapitän Whalley sofort aufgestanden und, das Gesicht geradeaus gerichtet, stehengeblieben, während das Vorderende seines Schiffes einen Viertelkreisbogen beschrieb. Er hatte kein einziges Wort ausgesprochen, hatte nicht einmal den Befehl gegeben, das Ruder zu stützen. Es war der Serang, ein ältlicher, flinker, kleiner Malaie mit sehr dunkler Haut, der murmelnd dem Steuermann den Befehl gab. Und dann setzte sich Kapitän Whalley langsam wieder in den Armstuhl auf der Brücke und sah starr auf das Deck zu seinen Füßen.
Er konnte nicht hoffen, in diesen Gewässern etwas Neues zu sehen. Er hatte während der letzten drei Jahre immer die gleichen Küsten befahren; von Low Cape nach Malantan waren es fünfzig Meilen, sechs Stunden Fahrt für das alte Schiff mit der Flut, oder sieben dagegen. Dann steuerte man das Land an, und allmählich erschienen dann drei Palmen am Himmel, hoch und schmächtig, die flatterigen Köpfe zusammengesteckt, wie zu einem heimlichen Klatsch über die dunklen Mangroven. Die Sofala hielt auf den dunklen Küstenstreifen zu, der in einem gegebenen Augenblick, wenn das Schiff nahe genug heran war, verschiedene leuchtende Einbuchtungen aufwies – die Mündung eines hochgehenden Flusses. Dann arbeitete sich die Sofala stromaufwärts durch eine braune Flüssigkeit, drei Teile Wasser und ein Teil schwarze Erde, zwischen niedrigen Ufern hin, drei Teile schwarze Erde und ein Teil Brackwasser, wie sie es einmal in jedem Monat, durch sieben Jahre hindurch oder noch länger getan hatte, lange bevor Kapitän Whalley von ihrem Dasein gewußt, lange bevor er daran gedacht hatte, er könnte jemals etwas mit ihr und ihren unabänderlichen Reisen zu tun haben. Das alte Schiff hätte den Weg besser kennen müssen als die Besatzung, die nicht so lange Zeit ohne Veränderung dabeigeblieben war; besser auch als der treue Serang, den Whalley von seinem letzten Schiff mitgebracht hatte, um die Kapitänswache zu halten; besser als Whalley selbst, der ja erst seit drei Jahren befehligte. Man konnte sich immer auf die Sofala verlassen, daß sie ihre Fahrten machen würde. Ihre Kompasse wurden kaum gebraucht. Es machte durchaus keine Mühe, sie herumzuführen; es schien, als hätte ihr ihr hohes Alter Erkenntnis, Weisheit und Ruhe beschert. Sie kam auf einen Grad der Peilung genau in Sicht des Landes, und fast auf die Minute pünktlich nach dem Fahrplan. Kapitän Whalley konnte in jedem Augenblick, während er, ohne aufzusehen, auf der Brücke saß oder schlaflos in seinem Bett lag, sagen, wo er sich befand, und den genauen Standort angeben, indem er einfach die Tage und Stunden nachzählte. Auch er kannte sie gut, diese ewig gleichbleibende Hausierertour, die Meerengen hinauf und herunter. Er kannte die Reihenfolge, die Aussichten und das Land. Als erstes Malakka, bei Tageslicht hinein, in der Dämmerung heraus, um dann, ein steifes, phosphoreszierendes Kielwasser hinter sich, diese Hauptstraße des Fernen Ostens zu überqueren. Dunkelheit und ein Leuchten da und dort über den Wassern, helle Sterne an einem schwarzen Himmel, vielleicht noch die Lichter eines heimwärtsfahrenden Dampfers, der gerade in der Mitte seinen festen Kurs steuerte, oder auch der undeutliche Schatten eines Eingeborenenfahrzeuges, das unter Mattensegeln vorbeiflitzte – und bei Tageslicht das niedrige Land auf der andern Seite in Sicht. Um Mittag die drei Palmen des nächsten Anlegeplatzes, am Oberlauf eines trägen Flusses. Der einzige Weiße, der dort hauste, war ein junger Seemann im Ruhestand, mit dem sich Whalley im Laufe vieler Reisen angefreundet hatte. Sechzig Meilen weiter war wieder ein Anlegeplatz, eine tiefe Bai, an deren Ufer nur ein paar Häuser standen. Und so weiter, hinein und heraus, wobei man der Küste entlang etwas Ladung einnahm; das Ende bildete eine ununterbrochene Fahrt von etwa hundert Meilen durch ein Gewimmel kleiner Inselchen, bis zu einer großen Eingeborenenstadt am Ende des Kurses. Dort gab es dann drei Tage Rast für das alte Schiff, vor dem Aufbruch in entgegengesetzter Richtung, wobei man dann dieselben Ufer in umgekehrter Reihenfolge sah, dieselben Stimmen an denselben Orten hörte; bis zum Heimathafen der Sofala, an der großen Hauptstraße zum Osten, wo Kapitän Whalley dann fast gegenüber den großen Steinhäusern des Hafenamtes ein Zimmer nahm, bis es wieder Zeit wurde, die alte Rundfahrt über sechzehnhundert Meilen in dreißig Tagen anzutreten. Kein sehr aufregendes Leben das für Kapitän Whalley, Henry Whalley, auch Teufelsharry genannt – den Whalley vom Kondor, der seinerzeit ein berühmter Schnellsegler gewesen war. Nein, kein sehr aufregendes Leben für einen Mann, der berühmten Firmen gedient, berühmte Schiffe (von denen mehr als eines sein Eigentum gewesen war) gesegelt, der berühmte Überfahrten gemacht hatte; der Pionier neuer Routen und neuer Handelszweige gewesen war, unerforschte Gebiete der Südsee durchkreuzt und die Sonne über Eilanden aufgehen gesehen hatte, die auf keiner Karte standen. Fünfzig Jahre zur See und vierzig Jahre im Osten ('eine recht gründliche Lehrzeit', pflegte er lächelnd zu bemerken) hatten ihn einer Generation von Reedern und Händlern in Ehren bekannt gemacht, von allen Häfen von Bombay ab bis dorthin, wo an der Küste der beiden Amerika der Osten in den Westen verläuft. Sein Ruhm blieb auf den Admiralitätskarten aufgezeichnet, nicht sehr hervorstechend, aber doch deutlich genug. Gab es nicht irgendwo zwischen Australien und China ein Whalley Island und ein Kondorriff? Auf jener gefährlichen Korallenformation war der berühmte Schnellsegler drei Tage lang gestrandet festgesessen; der Kapitän und die Mannschaft hatten sozusagen mit einer Hand die Ladung über Bord geworfen und mit der anderen eine Flottille von Kriegskanus der Eingeborenen abgewehrt. Damals führten weder das Eiland noch die Klippe ein amtlich anerkanntes Dasein. Später erkannten die Offiziere I. M. Dampfschiffs Füsilier, ausgeschickt, um die Route aufzunehmen, die Tat des Mannes und die Festigkeit des Schiffes an, indem sie die beiden Namen beibehielten. Überdies beginnt ja, wie jedermann, dem daran liegt, sehen kann, das 'Allgemeine Handbuch', Vol. II, Pag. 410, die Beschreibung der 'Malotu oder Whalley Passage' mit den Worten: "Diese vorteilhafte Route, die zuerst von Kapitän Whalley in dem Schiff Kondor im Jahre 1850 entdeckt wurde ..." und endet mit einer warmen Empfehlung dieser Route für Segelschiffe, die aus chinesischen Häfen in den Monaten Dezember bis April nach Süden auslaufen.
Das war der ersichtliche Gewinn gewesen, den er vom Leben gehabt hatte. Nichts konnte ihm diese Art Ruhm nehmen. Der Durchstich der Landenge von Suez hatte, wie der Durchbruch eines Damms, eine Überschwemmung des Ostens durch neue Schiffe, neue Menschen, neue Handelsmethoden zur Folge gehabt. Das Gesicht der östlichen Meere, wie auch der Kern ihres Lebens waren dadurch geändert worden, so daß Kapitän Whalleys frühere Erfahrungen der neuen Generation von Seeleuten nichts mehr bedeuteten.
In jenen verklungenen Tagen hatte er viele tausend Pfund von seiner Reeder und seinem eigenen Geld in Händen gehabt. Er hatte getreulich, wie es das Gesetz von einem Kapitän erwartet, die einander widerstreitenden Interessen der Reeder, Befrachter und Versicherung vertreten. Er hatte nie ein Schiff verloren oder sich zu einer zweideutigen Handlung hergegeben; und er hatte gut ausgehalten und schließlich sogar die Vorbedingungen überdauert, die die Entstehung seines guten Namens ermöglicht hatten. Er hatte sein Weib begraben (im Golf von Petschili), hatte seine Tochter an den Mann ihrer unglücklichen Wahl verheiratet und ein sehr stattliches Vermögen beim Bankrott des bekannten Travancore-Dekhan-Bankvereins verloren, dessen Sturz den Osten wie ein Erdbeben erschüttert hatte. Und er war fünfundsechzig Jahre alt.
II
Sein Alter drückte ihn nicht schwer; und seines Ruins schämte er sich nicht. Er war nicht der einzige gewesen, der an die unbedingte Sicherheit des Bankvereins geglaubt hatte. Leute, deren Urteil in Geldangelegenheiten so zuverlässig schien, wie das seine in allem, was die See betraf, hatten gemeint, er habe sein Geld gut angelegt, und hatten selbst bei dem großen Zusammenbruch viel Geld verloren. Der einzige Unterschied zwischen ihm und ihnen war, daß er alles verloren hatte. Und doch nicht alles. Von seinem verlorenen Vermögen war ihm eine sehr hübsche kleine Bark Fair Maid übriggeblieben, die er gekauft hatte zum Zeitvertreib für die Jahre, in denen er sich vom Dienst zurückgezogen haben würde – als Spielzeug, wie er es selbst nannte.
Daß er der See müde sei, hatte er ausdrücklich in dem Jahre vor der Verheiratung seiner Tochter erklärt. Als aber das junge Paar weggezogen war, um sich in Melbourne niederzulassen, hatte er entdeckt, daß er an Land doch nicht glücklich werden könne. Er war zu sehr Kapitän der Handelsmarine, als daß ihn bloßer Jachtsport hätte befriedigen können. Er wünschte wenigstens den Anschein von Geschäften beizubehalten; und die Erwerbung der Fair Maid gewährleistete ihm die Möglichkeit, sein Leben fortführen zu können. Seinen Bekannten in verschiedenen Häfen stellte er sie als 'mein letztes Kommando' vor. Wenn er einmal zu alt geworden war, daß man ihm weiterhin hätte ein Schiff anvertrauen dürfen, dann wollte er sie abtakeln und an Land gehen, um sich begraben zu lassen, in seinem Testament aber die unbedingte Verfügung hinterlassen, daß am Begräbnistage die Bark hinausgeschleppt und in tiefem Wasser sauber versenkt werden sollte. Seine Tochter würde ihm sicher nicht die Erfüllung seines Wunsches verwehren, daß kein Fremder nach ihm sein letztes Kommando in die Hände bekommen würde. Bei dem Vermögen, das er ihr hinterlassen konnte, spielte der Wert einer Fünfhundert-Tonnen-Bark keine Rolle. All dies pflegte er mit einem lustigen Augenzwinkern zu erzählen; der rüstige alte Mann hatte zu viel Lebenskraft, um ein schmerzliches Bedauern aufbringen zu können; ein wenig Wehmut klang vielleicht doch mit, denn er fühlte sich im Leben zu Hause und fand ehrliche Freude an seinen Gefühlen und Genüssen; an seinem eigenen ehrenwerten Ruf und seinem Reichtum, an der Liebe für seine Tochter und der Zufriedenheit mit dem Schiff – dem Spielzeug seiner einsamen Mußezeit.
Die Kajüte hatte er sich mit all der Bequemlichkeit einrichten lassen, die sein eigener einfacher Geschmack, ihm zur See zu erlauben schien. Ein großer Bücherkasten (er war leidenschaftlicher Leser) nahm eine Seite der Staatskabine ein. Das stark nachgedunkelte Ölbildnis seiner verstorbenen Frau, auf dem das Profil und eine lange Ringellocke eines jungen Weibes zu erkennen waren, hing seiner Bettstelle gegenüber. Drei Chronometer tickten ihn in den Schlaf und begrüßten ihn beim Erwachen mit dem dünnen Stimmendurcheinander ihrer Gangwerke. Er stand jeden Tag um fünf Uhr auf. Der Offizier von der Morgenwache, der achtern beim Rad seinen Frühkaffee trank, konnte durch die weite Mündung der Kupferventilatoren all das Plätschern, Schnauben und Sprudeln von seines Kapitäns Morgentoilette hören. Diese Geräusche waren unweigerlich von einem gleichtönigen, tiefen Murmeln gefolgt: der Kapitän sprach mit ernster Stimme das Vaterunser. Fünf Minuten später tauchten sein Kopf und seine Schultern aus der Kajütenluke auf. Unbeweglich hielt er eine Zeitlang auf der Treppe an und sah ringsum nach dem Horizont, nach oben, nach der Segelstellung, und zog dabei in tiefen Zügen die frische Luft ein. Dann erst pflegte er auf die Hütte hinaufzugehen und, während der Offizier grüßend die Hand an den Mützenrand legte, mit einem majestätischen und wohlwollenden "Guten Morgen" zu antworten. Bis acht Uhr schritt er gewissenhaft das Deck ab. Manchmal, doch nicht öfter als zweimal im Jahre, mußte er dabei einen starken, keulenartigen Stock gebrauchen, wegen einer kleinen Steifheit in der Hüfte, eines Anflugs von Rheumatismus, wie er annahm. Im übrigen wußte er nichts von den Übeln des Fleisches. Beim Klang der Frühstücksglocke ging er hinunter, um seine Kanarienvögel zu füttern, die Chronometer aufzuziehen und den Platz am Kopfende des Tisches einzunehmen. Von dort aus hatte er die großen Lichtbilder seiner Tochter, ihres Gatten und zweier dickbeiniger Babys – seiner Enkelkinder – vor Augen, die in schwarzen Rahmen in das Ahornholz der Wandverkleidung eingelassen waren. Nach dem Frühstück pflegte er das Glas über diesen Bildern selbst mit einem Tuch abzuwischen und das Ölbild seiner Frau mit einem Federwisch abzustauben, der an einem kleinen Messinghaken neben dem schweren Goldrahmen hing. Dann schloß er die Tür seiner Staatskabine hinter sich und setzte sich auf das Ruhelager unter dem Bild, um ein Kapitel aus einer dicken Taschenbibel, ihrer Bibel, zu lesen. An manchen Tagen aber saß er nur eine halbe Stunde da und hielt die Finger zwischen den Blättern und das geschlossene Buch auf dem Knie. Vielleicht hatte er sich plötzlich daran erinnert, wie sehr sie das Segeln geliebt hatte.
Sie war ein guter Schiffskamerad und eine echte Frau gewesen. Für ihn war es ein Glaubenssatz, daß es niemals ein helleres, traulicheres Heim zur See oder zu Lande gegeben hatte oder geben konnte, als sein Heim unter dem Hüttendeck des Kondor, mit der großen Hauptkajüte, die ganz in Weiß und Gold gehalten und wie für ein immerwährendes Fest von einer unverwelklichen Blumenkette umzogen war. Sie selbst hatte die Mitte jedes Feldes in der Vertäfelung mit einem Strauß heimatlicher Blumen geschmückt. Es hatte sie zwölf Monate gekostet, um mit dieser liebevollen Arbeit um die ganze Kajüte herumzukommen. Ihm war es als ein Wunderwerk der Malerei erschienen, unübertrefflich vollendet in der geschmackvollen Ausführung; und der alte Swimburne gar, sein Erster Offizier, blieb, sooft er zu den Mahlzeiten herunter kam, wie angenagelt stehen und bewunderte das Fortschreiten des Werkes. "Man könnte diese Rosen beinahe riechen", erklärte er und schnüffelte den leisen Terpentingeruch ein, der damals den Salon durchzog und (wie der Alte nachher gestand) ihm mitunter ein wenig die Freude am Essen genommen hatte. Nichts derartiges aber stand dem Genüsse im Wege, den er an ihrem Singen fand. "Frau Whalley ist eine wirklich vollkommene Nachtigall, Herr", pflegte er sachverständig zu bemerken, nachdem er über das Oberlicht gebeugt ein Stück bis zu Ende angehört hatte. Bei gutem Wetter konnten die beiden Männer während der zweiten Wache ihre Triller und Läufe hören, die mit Klavierbegleitung aus der Kajüte drangen. Am Tage ihrer Verlobung hatte er nach London um das Instrument geschrieben; sie waren aber mehr als ein Jahr verheiratet, als es sie endlich erreichte. Die große Kiste bildete einen Teil der ersten Ladung, die ohne Umladen um das Kap herumgekommen war und im Hafen von Hongkong gelöscht wurde – ein Ereignis, das den Männern, die jetzt über die geschäftigen Quais schreiten, schattenfern schien wie vorgeschichtliche Zeitalter. Kapitän Whalley aber konnte während der Stunde der Einsamkeit sein ganzes Leben wieder durchleben, mit seiner Romantik, seinen stillen Freuden und seinen Schmerzen. Er selbst hatte seiner Frau die Augen schließen müssen. Sie ging unter der Flagge über Bord, wie eine rechte Seemannsfrau, sie selbst im Herzen ein Seemann. Er hatte über ihr das Totengebet gelesen, aus ihrem eigenen Gebetbuch, und die Stimme war ihm nicht gebrochen. Wenn er die Augen hob, hatte er den alten Swimburne sehen können, der ihn ansah und die Mütze an die Brust gedrückt hielt und dessen runzeliges, wetterverbranntes Gesicht von Wasserperlen triefte wie ein rohbehauener roter Granitblock in einem Regenschauer. Für den alten Seebären war es ganz recht zu weinen. Er selbst aber mußte bis zu Ende lesen; allerdings erinnerte er sich nicht mehr, was einige Tage nach dem Aufklatschen geschehen war. Ein älterer Matrose aus der Mannschaft, der nähen konnte, hatte für das Kind aus einem der schwarzen Kleider der Mutter ein Trauerkleidchen zurechtgemacht.
Kapitän Whalley glaubte, nicht vergessen zu können. Aber das Leben läßt sich nicht aufstauen, wie ein träger Strom. Es bricht durch und überflutet eines Mannes Kummer, es schließt sich über einem Schmerz, wie die See über einem toten Leib, ganz gleich, wieviel Liebe mit auf den Grund gegangen ist. Und die Welt ist nicht schlecht. Die Leute waren gütig gegen Kapitän Whalley gewesen; besonders Frau Gardner, die Frau des Seniorchefs von Gardner, Patteson & Co., den Reedern des Kondor. Sie hatte sich freiwillig erboten, für die Kleine zu sorgen, und sie, als es soweit war, mit ihren eigenen Mädchen nach England genommen (und das war damals eine Reise, wenn auch mit der Überlandpost), um ihre Erziehung zu vollenden. Zehn Jahre waren vergangen, bevor er sie wiedergesehen hatte.
Als kleines Kind hatte sie sich nie vor schlechtem Wetter gefürchtet. Sie bettelte oft, daß er sie in der Brustfalte seines Ölzeugs an Deck nehmen sollte, um den großen Brechern zuzusehen, die über den Kondor wegschlugen. Das Rauschen und Krachen der Wogen schien ihre kleine Seele mit atemlosem Entzücken zu erfüllen. 'An der ist ein guter Junge verloren', pflegte er spaßhaft von ihr zu sagen. Er hatte sie Ivy genannt, dem Klang des Wortes zuliebe und vielleicht auch durch eine undeutliche Gedankenverbindung bestimmt. Sie hatte sich eng um sein Herz gerankt und sollte sich, nach seinem Willen, fest an ihren Vater halten können, wie an einen Turm der Stärke; dabei hatte er, solange sie klein war, vergessen, daß sie sich der Natur der Dinge entsprechend wahrscheinlich an irgendeinen anderen halten würde. Doch liebte er das Leben zur Genüge, daß ihm sogar diese Tatsache eine gewisse Befriedigung neben dem mehr heimlichen Gefühl des Verlustes geben konnte. Nachdem er die Fair Maid gekauft hatte, um einen Zeitvertreib zu haben, hatte er schnell eine ziemlich unvorteilhafte Fracht nach Australien aus dem einfachen Grunde angenommen, um seine Tochter in ihrem eigenen Heim besuchen zu können; daß er dort sehen mußte, wie sie nun an irgend jemand hing, verstimmte ihn nicht so sehr wie die andere Erkenntnis, daß der Halt, den sie sich erwählt hatte, sich bei näherer Prüfung als ein recht armseliger Stecken erwies – sogar in bezug auf die Gesundheit. Dem Alten widerstrebte die unterstrichene Höflichkeit des Schwiegersohnes vielleicht noch mehr als dessen Art, die Geldsumme zu verwalten, die Ivy bei der Hochzeit mitbekommen hatte. Doch sagte er nichts von seinen Befürchtungen. Nur am Tage seiner Abreise, während die Hallentür schon offenstand, hielt er Ivys beide Hände, sah ihr fest in die Augen und sagte: "Du weißt, meine Liebe, alles, was ich habe, ist für dich und die Kleinen. Denke daran, mir immer offen zu schreiben." Sie hatte ihm mit einer fast unmerklichen Kopfbewegung geantwortet. Sie ähnelte ihrer Mutter in der Farbe der Augen, im Charakter – und auch darin, daß sie ihn ohne viel Worte verstand. Sie hatte allerdings bald zu schreiben – und über manche dieser Briefe mußte Kapitän Whalley seine weißen Brauen hochziehen. Im übrigen war er der Ansicht, daß er den wahren Lohn für seine Lebensmühen nur erntete, wenn er imstande war, alles zu tun, was man von ihm verlangte. Seit dem Tode seiner Frau hatte er sich keine großen Vergnügungen gegönnt. Bezeichnenderweise weckten die unweigerlichen Mißerfolge seines Schwiegersohns aus der Entfernung in ihm sogar eine gewisse Güte gegen den Mann. Der Bursche saß alle Augenblicke so jämmerlich an einer Leeküste fest, daß es augenscheinlich unbillig gewesen wäre, der leichtfertigen Navigation die ganze Schuld zu geben. Nein, nein! Kapitän Whalley wußte wohl, was das hieß. Das Glück fehlte. Er selbst hatte immer sehr viel Glück gehabt, hatte aber auch in seinem Leben zu viele gute Männer – Seeleute und andere – einfach an dem Mangel an Glück untergehen sehen, um die schlimmen Anzeichen nicht zu erkennen. Aus allen diesen Gründen erwog er gerade den besten Weg, um jeden Pfennig, den er zu hinterlassen hatte, recht fest anzulegen, als nach wenigen vorhergehenden Gerüchten {die ihn zufällig zuerst in Shanghai erreichten) plötzlich der große Krach erfolgte. Und nachdem er die Phasen der sprachlosen Verblüffung, der Ungläubigkeit und Entrüstung durchlaufen, hatte er sich mit der Tatsache abzufinden gehabt, daß ihm nichts Nennenswertes übriggeblieben war, das er hätte hinterlassen können.
Daraufhin, als hätte er nur auf diesen Schicksalsschlag gewartet, gab der Unglücksmensch dort in Melbourne seinen unvorteilhaften Beruf auf und setzte sich zur Ruhe – noch dazu in einem Rollstuhl. 'Er wird nie wieder gehen können', schrieb die Frau. Zum ersten Male in seinem Leben fühlte sich Kapitän Whalley etwas niedergeschlagen.
Für die Fair Maid wurde es nun mit der Arbeit bittrer Ernst. Es ging nicht länger darum, das Andenken für Teufelsharry Whalley in den östlichen Meeren wachzuhalten oder einem alten Mann das Taschengeld und die Schneiderrechnung zu bezahlen und vielleicht darüber hinaus noch ein paar feine Zigarren bei Jahresschluß. Er mußte sich richtig ins Zeug legen und das Schiff scharf hernehmen, wobei für die Vergoldung der Lebkuchenschnörkel an Steven und Heck wenig übrigblieb.
Diese Notwendigkeit öffnete ihm die Augen für die grundlegenden Veränderungen in der Welt. Aus seiner Vergangenheit waren da und dort die Familiennamen geblieben, die Dinge und die Männer aber, wie er sie gekannt hatte, waren dahingegangen. Der Name von Gardner, Patteson & Co. fand sich noch an den Mauern von Lagerhäusern an den Quais, auf Messingplatten und Fensterscheiben im Geschäftsviertel von mehr als einem Hafen des Ostens; aber es gab keinen Gardner oder Patteson mehr in der Firma. Es gab auch für Kapitän Whalley keinen Lehnstuhl und keinen Willkomm mehr im Privatbureau, kein kleines Geschäftchen dazu, das man einem alten Freund zum Dank für frühere Dienste gelegentlich zuschob. Die Gatten der Gardner-Mädels saßen hinter den Schreibtischen in dem Zimmer, wo er sich zu Lebzeiten des alten Mannes, lange nachdem er den Dienst verlassen, noch ein Eintrittsrecht gewahrt hatte. Ihre Schiffe hatten gelbe Schornsteine mit schwarzem Rand und einen genau festgelegten Fahrplan, wie eine elende Straßenbahn. Die Winde im Dezember und im Juni machten ihnen nichts aus. Den Kapitänen (ausgezeichneten jungen Leuten, daran zweifelte er nicht) war natürlich Whalley Island vertraut, denn kürzlich hatte die Regierung an der Nordspitze ein weißes festes Feuer eingerichtet (mit einem roten, Gefahr kündenden Seitenlicht nach dem Kondorriff zu). Doch die meisten unter ihnen wären wohl aufs höchste überrascht gewesen, zu hören, daß es noch einen Whalley von Fleisch und Blut gab – einen alten Mann, der die Welt durchzog und sich mühte, da und dort eine Ladung für seine kleine Bark aufzutreiben.
Und überall war es das gleiche. Dahin die Männer, die bei der Nennung seines Namens anerkennend genickt und es als Ehrenpflicht betrachtet hätten, etwas für Teufelsharry Whalley zu tun. Dahin die Möglichkeiten, die er verstanden hätte auszunützen. Und verschwunden, zugleich mit ihnen, auch die weißbeschwingte Schar der Schnellsegler, die im ungewissen Wehen der Winde dahinlebten und aus der schäumenden See viel Geld herausschlugen. In einer Welt, die den Gewinn auf die Mindestgrenze heruntergedrückt hatte, die ihre freie Tonnage täglich zweimal überzählen konnte und in der magere Frachten drei Monate im voraus durch Kabel vergeben wurden – in einer solchen Welt gab es keine Aussichten mehr für ein Menschenwesen, das auf gut Glück mit einer kleinen Bark herumzog; keine Aussichten, kaum noch Platz zum Leben.
Er fand es von Jahr zu Jahr schwieriger. Er litt schwer darunter, daß er seiner Tochter nur kleine Zuschüsse senden konnte. Inzwischen hatte er gute Zigarren ganz aufgegeben und sich sogar bei den billigeren auf sechs Stück am Tage beschränken gelernt. Er schrieb ihr nie ein Wort von seinen Schwierigkeiten, und auch sie ließ sich über die ihren niemals aus. Ihr gegenseitiges Vertrauen zueinander verlangte keine Aufklärungen, und ihr unbedingtes Verstehen hielt an, auch ohne Versicherungen von Dankbarkeit oder Bedauern. Es hätte ihn verletzt, wenn sie es sich hätte einfallen lassen, ihm wortreich zu danken, doch fand er es ganz natürlich, daß sie ihm gestand, sie brauche zweihundert Pfund.
Er hatte mit der Fair Maid unter Ballast den Heimathafen der Sofala angelaufen, um nach einer Fracht Ausschau zu halten, und ihr Brief hatte ihn dort erreicht. Sein Inhalt besagte, daß es keinen Sinn habe, die Tatsache zu beschönigen. Ihr bliebe kein andrer Ausweg, als ein Kosthaus zu eröffnen, wofür ihrer Meinung nach die Aussichten günstig waren. Gut genug jedenfalls, um ihr den Freimut zu der Mitteilung zu geben, daß sie mit zweihundert Pfund anfangen könnte. Er hatte hastig den Umschlag aufgerissen, auf Deck, wo er ihm durch den Laufboten des Schiffsmaklers, der ihm sofort nach dem Ankern die Post gebracht hatte, übergeben worden war. Zum zweiten Mal in seinem Leben fühlte er sich niedergeschlagen und blieb stocksteif in der Kajütentür stehen, das Papier in den zitternden Fingern. Ein Kosthaus eröffnen! Zweihundert Pfund für den Anfang! Der einzige Ausweg! Und er wußte nicht, wo er zweihundert Pence hernehmen sollte!
Die ganze Nacht lang schritt Kapitän Whalley die Hütte seines verankerten Schiffes ab, als handelte es sich darum, bei schlechtem Wetter unter Land zu kommen, ohne genaue Kenntnis des Standpunktes, nach einer Fahrt durch viele graue Tage, ohne Sonne, Mond und Sterne. Die schwarze Nacht glitzerte von Richtfeuern für Seeleute und den ruhigen, geraden Streifen der Lichter an Land. Rings um die Fair Maid warfen tanzende Schiffslichter zitterigen Widerschein über das Wasser der Reede. Kapitän Whalley sah nirgends einen Lichtschimmer, bis der Tag anbrach und er merkte, daß seine Kleider von schwerem Tau durchnäßt waren.
Sein Schiff war schon wach. Er blieb kurz stehen, drückte seinen nassen Bart aus und stieg rücklings, mit müden Füßen, die Hüttenleiter hinab. Bei seinem Anblick blieb dem Ersten Offizier, der sich schläfrig auf dem Hauptdeck herumdrückte, mitten in dem Morgengähnen der Mund offen stehen.
"Guten Morgen", sagte Kapitän Whalley feierlich und ging in die Kajüte. Doch er blieb in der Tür stehen und fügte, ohne zurückzusehen, hinzu: "Nebenbei ... irgendwo im Lazarett muß noch eine leere Holzkiste aufgehoben sein. Sie ist nicht zerschlagen worden, oder?"
Der Offizier schloß den Mund und fragte dann wie betäubt: "Was für eine leere Kiste, Herr?"
"Eine große, flache Kiste, für das Ölbild in meinem Zimmer. Lassen Sie sie an Deck schaffen und vom Zimmermann nachsehen. Ich werde sie vielleicht bald brauchen."
Der Offizier rührte kein Glied, bis er die Tür zu des Kapitäns Staatskajüte hatte zuschlagen hören. Dann winkte er den Zweiten achtern zu sich und teilte ihm mit, 'es sei etwas im Winde'. Als die Glocke zum Frühstück läutete, dröhnte Kapitän Whalleys Stimme durch die geschlossene Tür: "Setzen Sie sich hin und warten Sie nicht auf mich." Und seine Offiziere setzten sich bedrückt zu Tisch und tauschten Blicke und geflüsterte Worte. Was? Kein Frühstück? Und noch dazu, nachdem er sich offenbar die ganze Macht auf Deck herumgetrieben hatte! Ja, da war freilich etwas im Winde. Über ihren Köpfen, die ernst über die Teller gebeugt waren, schaukelten im Oberlicht drei Drahtkäfige von dem rastlosen Umherhüpfen der hungrigen Kanarienvögel. Aus der Staatskajüte konnten sie die gemessenen Bewegungen ihres Alten hören. Kapitän Whalley zog bedächtig die Chronometer auf, staubte das Ölbild seiner verstorbenen Frau ab, nahm ein sauberes, weißes Hemd aus der Schublade und machte sich in seiner peinlich genauen, besonnenen Art fertig, an Land zu gehen. Er hätte an jenem Morgen keinen Bissen hinunterbringen können. Er hatte sich entschlossen, die Fair Maid zu verkaufen.
III
Gerade damals suchten die Japaner weit und breit nach Schiffen von europäischer Bauart, und Kapitän Whalley hatte keine Schwierigkeiten, einen Käufer zu finden, einen Spekulanten, der hart feilschte, aber die Fair Maid, im Hinblick auf einen gewinnreichen Weiterverkauf, bar bezahlte. So kam es, daß Kapitän Whalley an einem gewissen Nachmittag die Freitreppe eines der bedeutendsten Postämter des Ostens mit einem Streifen bläulichen Papiers in der Hand hinunterging. Es war der Aufgabeschein eines eingeschriebenen Briefes, den er mit einem Scheck über zweihundert Pfund nach Melbourne geschickt hatte. Kapitän Whalley schob den Papierstreifen in seine Westentasche, zog seinen Stock unter dem Arm hervor und ging die Straße hinunter.
Es war eine kürzlich eröffnete und noch unfertige Hauptstraße, mit einer Andeutung von Bürgersteigen zu beiden Seiten und über und über von einer weichen Staubschicht bedeckt. Ihr eines Ende mündete





























