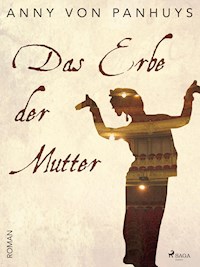
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Erbe der Mutter ist Erika Marholms schöne Gesangsstimme; doch es ist auch ein belastendes Erbe: Leopold Marholm, gefeierter Komponist, kommt auch nach siebzehn Jahren nicht über den Tod seiner geliebten Felizitas hinweg, die eine begnadete Sängerin war, und wann immer seine Tochter Erika zu singen anfängt, erfüllt ihn das mit tiefem Schmerz über die Verlorene sowie mit abwehrender Antipathie gegen diese volltönende Altstimme, so dass er Erika ein für alle Mal das Singen verboten hat. Doch Erika macht nichts lieber als singen und möchte um alles in der Welt eine große, ruhmreiche Sängerin werden. Gut, dass da der alte, gütige Gesangslehrer Josef Rößle ist sowie Frau Agnete von Erikas Mädchenpensionat, die sich für das talentierte Mädchen einsetzen und schließlich erreichen, dass Erika bei der gefeierten Donna Manuela vorsingen kann. "Wenn Donna Manuela deine Stimme anerkennt, weiß ich bestimmt, steht dir die ganze Welt einmal offen." Doch hat Erika wirklich das Zeug zur großen Sängerin? Und ist das denn tatsächlich der ihr vorbestimmte Lebensweg? Gibt es nicht noch andere Dinge im Leben als die Kunst – die Liebe zum Beispiel? Plötzlich begreift Erika, dass sie sich zwischen dem Gesang und ihrem stürmischen Verehrer, dem geliebten jungen Arzt Kurt Faber, entscheiden muss. Am Ende steht eine Hochzeit und die Einsicht: "Ruhm ist wundervoll, Nachruhm herrlich, aber die warme beglückende Gegenliebe eines heißgeliebten Menschen gibt wohl das vollkommenste Glück." Aber es ist der alte Vater, Leopold Marholm, der hier noch einmal das Liebesglück gefunden hat ... Ein anrührender Unterhaltungsroman über die Kunst, den Ruhm, die Liebe!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anny von Panhuys
Das Erbe der Mutter
Roman
Saga
Das Erbe der Mutter
© 1924 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570180
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Leopold Marholm liess die Hand mit dem Federhalter lässig sinken, und sein scharfer Charakterkopf bog sich ein wenig zur Seite, sein Gesichtsausdruck verriet Aufhorchen und unterdrückten Aerger. Seine Augen versuchten, durch das Frühlingsgrün des vor seinem Fenster stehenden Baumes auf den Titisee hinauszuspähen, aber durch die grünumsponnenen Aeste glitzerten nur Teile des Sees im Glanz der Abendsonne wie rötlich durchstrahltes Silber, das Boot, das sein Blick suchte, fand er nicht.
Vom See her klang eine klare Altstimme — ein altes Volkslied war es, das vom See her in das heimelige, dunkelgetäfelte Zimmer schwebte und in dem Manne zwiespältige Gefühle auslöste. Vor allem Sehnsucht nach seiner toten Frau, seiner blendend schönen, genialen, von ihm über alles geliebten Frau, deren Stimme dieselbe Klangfarbe gehabt wie die ihres Kindes, dessen Geburt ihr selbst die herrliche Gottesgnadenstimme nahm, für immer nahm. Vor Gram darüber war sie langsam dahingesiecht, nachdem sie Lebensmut und Willen in jahrelangen Kuren erschöpft hatte. Kein Halsspezialist der ganzen Welt war mächtig genug gewesen, ihr diese wundervollste Stimme, die je einem Geschöpf auf seiner Erdenpilgerfahrt mitgegeben worden, zurückzuerobern.
Siebzehn Jahre waren vergangen seitdem, aber die Wunde, die ihm Felizitas’ Tod geschlagen, wollte sich nicht schliessen. Am meisten erregte es ihn aber, die Tochter singen zu hören. Mochte sie singen, wenn er nicht daheim war oder er sich in einer Entfernung befand, die den Tönen weit vor seinem Ohre ein Ziel setzte.
Jetzt schwieg der Gesang, um nach minutenlanger Pause von neuem zu beginnen. Wieder war es die Melodie eines jener traurigen und ein wenig einförmigen Volkslieder, die, wenn auch schon uralt, doch lange, lange jung bleiben und deren Ursprung sich irgendwo im Dunkel verliert, es war eines jener Lieder, die nur von einer weichen, dunkelgefärbten Frauenstimme gesungen werden sollten.
Ueber Leopold Marholms Stirn wetterleuchtete es. Fast heftig riss er seine grosse, breitschulterige Gestalt von dem Schreibtischstuhl empor und schloss mit hörbarem Zuschlagen die Fensterflügel. Dabei redete er vor sich hin, zornig und schnell:
„Dummer Singsang — tut meinem Ohr weh, weil ein Klang, ein süsser Klang darin ist, ein ähnlicher, nicht derselbe.“ Er legte seine beiden Hände an die Schläfen, lachte bitter. „Als ob es den Klang noch einmal auf Erden gäbe, als ob es dieses Gotteswunder noch einmal gäbe!“ Er stöhnte laut auf. „Sind denn Jahre nur Sekunden gewesen, dass ich immer und immer die Schmerzen und alle Not des Nichtvergessenkönnens fühle wie am Tage, als sie starb. Wäre es nicht gut und schön, wenn sich die Zeit meiner erbarmte und mein Leid milderte? Wunden vernarben, Trauer schlummert mählich ein, nur meine Wunde brennt wie einst, und meine Trauer wacht stets und ständig.“
Er trat vor einen grossen, schwarzen, von silbernen Sternen durchstickten Vorhang. Und an einer dicken, niederhängenden Seidenschnur ziehend, flog der beinahe eine halbe Zimmerwand verhüllende Vorhang zurück, und ein in natürlicher Grösse gemaltes Bild in schwerem, durchbrochenem Silberrahmen zeigte sich. Das Bild seiner toten Frau. Lebenswarm war es auf die Leinwand gebannt, so lebenswahr, dass man hätte meinen können, die reizende schlanke Frau atme und presse sich nur zum Scherz in den Prunkrahmen.
Die braunen Augen lachten dem Beschauer entgegen, die roten Lippen waren leicht geöffnet, liessen perlweisse Zähne hervorblinken. Gold flimmerte um die schmale, weisse Stirn, goldgesponnenes, krauses Haar von wilder, verblüffender Fülle und die schmalen, dunklen Brauen berührten sich über der Wurzel der schmalen Nase, gaben dem süssen Antlitz einen Anflug von Nachdenklichkeit, Versonnenheit.
„Felizitas!“ Gleich einem leisen Schrei löste sich der Name seines ihm zu früh entrissenen Weibes von des Mannes Lippen, aus Herzenstiefen emporgerissen von ungestümer, niemals ruhender Sehnsucht.
Die Hände des Mannes fanden sich wie betend zusammen, reckten sich dem Bilde entgegen.
„Felizitas, das Leben ist so endlos lang und grau ohne dich, unerträglich lang und grau! Wäre es nicht schwerste Sünde, ich liefe freiwillig daraus fort und dir nach in die Ewigkeit.“
Das letzte erstickte in einem schluchzenden Laut, und es war, als winde sich die hohe, mächtige Gestalt unter einem scharfen, alle Nerven erregenden Schmerz.
Langsam zog Leopold Marholm den dunklen Vorhang wieder zu, kühle, silberne Sterne auf weichem Samthimmel verhüllten die lachenden Augen, das entzückende Gesicht wieder, dessen Anblick der Mann niemandem gönnte. Das Bild war dicht vor seiner Hochzeit gemalt worden in den Tagen seines seligsten Glückes, als noch kein Ahnen in ihm war, wie kurz dieses Glück sein würde.
Er nahm wieder am Schreibtisch Platz, aber alle Arbeitslust, die ihm zuweilen zufriedene Stunden zu geben vermochte, war erloschen. Vor sich hinbrütend, vergangenen Zeiten nachträumend, sass er untätig.
Die Sonne schwand völlig, liess ein paar rosig durchflammte Wolken zurück. Längst war der Gesang draussen verstummt und das Silberflimmern über dem See erloschen. Leopold Marholm schreckte leicht empor von einem Pochen an der Tür.
Er rief ein kurzes Herein! und, die Schreibtischlampe anknipsend, blickte er unfreundlich das junge, noch kindlich wirkende Geschöpf an, das sein Denken aus tiefer Verträumtheit zu wecken gewagt. „Was willst du, Erika?“ fragte er.
Das schlanke, feingliedrige Mädchen, über dessen ganzer Erscheinung ein Hauch von Unfreiheit und Scheu lag, erwiderte leise:
„Bitte, komm Abendbrot essen, Vater, ich habe im Garten, in der Pfeifenblattlaube gedeckt, es ist so wundervoll heute im Freien.“
Leopold Marholm stand auf, trat dicht vor die noch immer an der Tür Stehende.
„Habe ich dir nicht verboten, so laut zu singen, wenn ich daheim bin, so entsetzlich laut, dass du mich bei der Arbeit dadurch störst?“
Lichte Braunaugen verdunkelten sich, ein nervöses, weinerliches Zucken bewegte die jungen Lippen, ehe sie Worte der Entschuldigung fanden.
„Verzeih, Vater, aber ich vergass dein Verbot, ich glaubte, du würdest mein Singen nicht hören, oder —“ sie stockte flüchtig — „nein, ich will nicht lügen, ich dachte überhaupt nicht daran, ob du mich hören könntest oder nicht, ich sass im Kahn und fuhr in die untergehende Sonne wie in einen flammenden, lockenden Himmel hinein, und da wusste ich eigentlich gar nichts mehr. Nichts mehr von Dürfen und Nichtdürfen. Ich fühlte nur, wie überwältigend schön die herrliche Gotteswelt ist, und mein Herz war so übervoll, dass ich nicht schweigsam weiterrudern konnte.“ Gross und ernst schauten die Mädchenaugen in das finstere Gesicht des Vaters. „Ich musste singen! Ich glaube, das Herz wäre mir zersprungen, wenn ich nicht hätte singen dürfen.“
Leopold Marholm verspürte eine weiche Regung; doch rasch und flüchtig war sie, erlosch bei dem Gedanken, dass die Geburt Erikas die tiefe Glockenstimme ihrer schönen Mutter zerstörte und diese vor Gram darüber starb. Hart ward sein Denken, hart Ton und Wort.
„Du bist nun siebzehn Jahre und solltest demnach vernünftig reden, statt dir in dergleichen Sentimentalitäten und Phrasen zu gefallen. Ich habe dich gebeten, das Singen zu unterlassen, und danach hast du dich zu richten!“
Erika riss all ihren Mut zusammen.
„Kann ich dafür, dass ich singen muss, Vater? — Ich meine manchmal, so wie mir müsse den Vögeln zumute sein, so heiligfroh, so überquellend —.“ Sie brach ab, murmelte leise: „Ich will versuchen, nicht mehr zu singen, wenn du zu Hause bist, mehr kann ich nicht versprechen.“
Leopold Marholm fand den Satz trotzig und aufsässig.
Er war erregt, überreizt.
„So, du willst es also gnädigst versuchen, ob du meinem Wunsche Folge leisten kannst!“ Hohn war in seiner Stimme. „Nein, meine liebe Erika, so weit sind wir denn doch noch nicht. Und wenn es jetzt im allgemeinen auch Mode geworden zu sein scheint, dass die Eltern sich nach dem Willen der Kinder richten, so habe ich in der Beziehung noch die dir vielleicht altmodisch dünkende Ansicht, es müsse umgekehrt sein, und deshalb verbitte ich dir so dumme Redensarten wie: Ich will versuchen!“
In Erikas Augen wollten Tränen steigen; aber sie drängte sie tapfer zurück. Nur nicht weinen vor dem Vater, nur nicht völlig zum hilflosen Kinde werden vor ihm!
Sie empfand sein Verbot als eine Ungerechtigkeit, die sie empörte. Ihre Lippen lagen fest aufeinandergepresst. Das gab ihrem blassen Gesicht einen starren, älteren Ausdruck, den das allzu schroff zurückgebürstete Haar noch unterstrich.
Leopold Marholm zog die Brauen zusammen. Er fand Erika hässlich, trotzdem sie Aehnlichkeit mit ihrer schönen toten Mutter besass. Eine Aehnlichkeit, die allerdings nur in der Farbe der Augen, dem Schnitt von Nase und Mund bestand; denn hölzern und hart war bei der Tochter, was bei der Mutter reizvolles Leben gewesen.
Wo war das süsse Lächeln, mit dem Felizitas alle Welt in ihren Bann gezwungen, wo ihr seelenvoller Blick und ihre graziösen, ungezwungenen Bewegungen, mit denen sie auf den Brettern und überall, wohin sie kam, bezauberte? Ja, Erika war ihrer Mutter ähnlich und auch wiederum nicht. Wie eine schlechte, groteske Nachbildung der Wunderschönen war sie. Felizitas war das Kunstwerk eines genialen Bildhauers und Erika die Pfuscharbeit eines Dilettanten; der Vergleich passte ungefähr, wollte ihm bedünken.
„Geh’ jetzt, ich komme gleich zum Nachtessen,“ sagte er kühl, aber wieder beherrscht.
Erika verliess das Zimmer. Er sah noch ein Zucken ihrer schmalen Schultern. —
Weinte das Mädchen etwa gar? Unsinn, so war Erika nicht! Die zog es vor, die Lippen zusammenzupressen und den Kopf in den Nacken zu werfen!
Nichts Weiches, Frauliches hatte sie in ihrem Wesen, und das war es wohl auch besonders, was ihn am meisten gegen sie aufbrachte, wenn sein Herz sich für sein einziges Kind erwärmen wollte. Dass er, er selbst die Schuld daran trug, dass Erika starrsinnig war, wie er es nannte, auf den Gedanken verfiel er nicht ein einziges Mal.
Das Nachtmahl verfiel ziemlich still. Leopold Marholm hatte nach der Erregung, in die ihn Erikas ‚Unbotmässigkeit‘ versetzt, keine Lust zur Unterhaltung, und wovon sollte er sich auch mit dem Mädel unterhalten? Vor vier Wochen war sie aus der Pension in Konstanz gekommen, wo sie seit langen Jahren geweilt, und er dachte, dass es eigentlich bequemer und hübscher hier gewesen, ehe die Tochter zurückgekehrt. Aber er konnte sie doch nicht noch länger fort lassen, da sie so dringend heimbegehrt hatte.
Er ass mechanisch, spann seinen Gedankenfaden.
Auch Erika ass mehr mechanisch als bewusst, wenngleich es ihr sehr gut schmeckte. Ihre Jugend verspürte stets gesunden Appetit. So leckere Dinge wie daheim waren in Frau Mutebachs Institut nur an hohen Feiertagen auf den Tisch gekommen, und so recht von Herzen hatte sie sich eigentlich niemals daran satt essen können.
Erika zermalmte mit ihren blanken, scharfen Zähnen das goldbraun gebratene Schnitzel, empfand angenehm den Geschmack desselben und war doch, trotz des momentanen körperlichen Wohlbehagens, sehr, sehr traurig. Wie so ganz anders hatte sie sich ihr Zusammenleben mit dem Vater ausgemalt! Seine kleine Hausfrau, seine Freundin und Gefährtin wünschte sie zu sein, die schöne Mutter musste sie ihm nach Möglichkeit zu ersetzen versuchen. Aber schon nach Tagen machte er ihr klar, er möge dieses ewige Herumscharwenzeln um seine Person nicht. Er bedürfe grösster Ruhe und Sammlung bei seiner Arbeit, und seine neue, beinahe vollendete Oper nehme ihn völlig in Anspruch, dulde keine Ablenkung. Deshalb sei es klüger von ihr, die Zügel des Haushaltes ruhig weiter in den Händen der bewährten Wirtschafterin zu lassen, anstatt mit ihr herumzustreiten und ihm undefinierbare Speisen aufzutischen. Auch beklage sich Fräulein Stosch bereits und würde ihm kündigen, wenn sie sich weiter in deren wirtschaftliche Angelegenheiten hineinmische. In den vier Wochen, seit sie die Konstanzer Pension mit dem väterlichen Heim am Titisee vertauscht, hatte Erika einen idealen und mit Kindesliebe aufgebauten guten Vorsatz nach dem anderen zunichte gehen lassen müssen. Und bald, nur zu bald hatte sie erkannt, sie könne dem Vater gar nichts sein, sie störe ihn nur, wäre ihm im Wege, und den grössten Gefallen täte sie ihm, wenn sie sich nach Möglichkeit im Hintergrund hielte.
Gegen ihren Willen entfloh ihr ein leiser Seufzer.
Leopold Marholm blickte auf, sein Blick, der plötzlich nachdenklich ward, haftete auf ihren Zügen.
„Du langweilst dich hier, nicht wahr, Erika?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, nickte er. „Natürlich. Ich habe wenig Zeit für dich, und schliesslich: Jugend gehört zur Jugend! Vielleicht sehnst du dich, trotzdem du dort fort wolltest, wieder zu deinen Pensionsgefährtinnen zurück. Besuche Sie, wenn du Lust hast. Auch findest du im Sommer hier Anschluss, wenn du magst, jetzt ist’s Frühling, es sind noch wenig Fremde hier. Fahre nach Neustadt, ich glaube, es ist jetzt ein Zirkus da, und im übrigen wirst du doch irgendein Steckenpferd haben. Handarbeite, batike, male oder sticke — musst doch zu irgend etwas besondere Lust haben.“
Erika ward rot, ihre Augen flimmerten.
„Singen möchte ich, singen muss ich, Vater!“
Wie ein Sehnsuchtsschrei löste es sich von ihren Lippen.
Er stand schroff auf, der Stuhl, auf dem er gesessen, stürzte um.
„Willst du mich mit Absicht quälen und zornig machen?“ schrie er die jäh Erblasste an. „Wieder und wieder habe ich dir gesagt, ich mag dein Singen nicht und will es nicht! Muss ich dir erst klar machen, dass mir deine Stimme zuwider ist?“ Er redete sich in immer grössere Erregung hinein. „Noch ein einziges Lied von deiner Stimme, und du kehrst wieder in die Pension zurück!“
Schon hatte er die Laube verlassen, und die rosa verschleierte Tischlampe beleuchtete ein verstörtes Mädchenantlitz.
Krampfig atmete das junge Geschöpf, als fehle ihm die Luft nach langem, erschöpfendem Lauf. Zwei glasklare Tränen zogen langsam, wie in feierlicher Prozession über die zarten Wangen, und Bitternis, unsagbare Bitternis riss die Mundwinkel herab.
Erika war zumute, als hätte eine allgewaltige Hand Sonne, Mond und Sterne zugleich vom Himmelszelt gerissen und damit alle Wärme, allen Glanz, alles Leuchten bei Tag und Nacht aus der Welt verbannt und zugleich alle Sehnsüchte nach hohen, idealen und hehren Zielen.
Immer noch hatte sie gehofft, ein wenig Verständnis beim Vater zu finden. War er doch der Mensch, der ihr am nächsten stand, am nächsten stehen sollte! Heilig hatten die Worte Vater und Mutter über ihrem jungen Leben gestanden, und wenn sie sich auch der Mutter kaum noch zu erinnern vermochte, so wusste sie doch, welch eine Grösse sie im Reiche der Kunst gewesen, welch eine Sängerin von Gottes Gnaden!
Und der Vater war ein berühmter Komponist, in dessen Opern die schöne Mutter, die so jung hatte Triumphe gefeiert, die schöne Mutter, die so jung hatte sterben müssen, sang.
Dass sie daran gewissermassen die Schuld trug, das allerdings wusste sie nicht. Niemand hatte ihr bisher davon gesprochen, davon ahnte sie nichts. Bis zu ihrem zehnten Jahre hatte sie eine Erzieherin gehabt, dann brachte sie der Vater nach Konstanz.
Das Dienstmädchen kam, um abzuräumen. Es war ein rosiges, dralles Schwarzwaldmädel aus dem Prechtal, trug stolz ihr verziertes Samtmieder zum wogenden Faltenrock und des Sonntags beim Ausgang den weissen, wippenden Strohhut, den ein starrer Blumenkranz umwand, und von dem lange, schwarze Samtbänder niederhingen. Mit ein wenig neugierigem Blick musterte sie die stumm und in sich versunken Dasitzende, und als sich Erikas aufschauende Augen mit denen des Mädchens trafen, leuchtete es ihr wie Mitleid entgegen.
Erika fröstelte, und ihre Stimmung meisternd, stand sie auf, ging dem Mädchen zur Hand, redete ein paar freundlich gleichgültige Worte. Sie atmete auf, nachdem das Mädchen gegangen war. Fremde sollten und brauchten nichts von ihrem Kummer zu wissen.
Sie wanderte ein Stück am See entlang, der an den Garten stiess. Am Ufer stand eine Bank und dort liess sich Erika Marholm nieder. Unzählige Gedanken und Zukunftspläne schossen ihr durch den Kopf; doch war keiner dabei, den es sich verlohnte festzuhalten; denn sie waren alle zu romantisch, waren unausführbar für sie, die sie doch völlig vom Vater abhing. Wie schön und glücklich hätte sich ihr Leben hier in diesem paradiesischen Heim gestalten können, wenn der Vater nur ein wenig Verständnis für sie zeigen würde!
Diese Eisesatmosphäre um sie herum war unerträglich. Immer trug der Vater eine leichte Gereiztheit gegen sie zur Schau, die beim kleinsten Grund zum Zorn ward, sie einschüchterte und wortkarg machte.
Sie stützte den rechten Ellenbogen aufs Knie, legte das Kinn in die offene Handschale, und ihre Augen glitten über den grauen See, dessen Wasser mit leichtem, eintönigen Gemurmel an das Ufer schlug. War der See in dieser Dämmerabendbeleuchtung nicht ein Sinnbild ihres Lebens? Grau und trübe, eingeengt in die Ufer!
Zum Weinen traurig war das.
Was hatte sie dem Vater getan, dass er sie so fremd, so kühl behandelte? Sie war sich keiner Schuld bewusst. Er mochte sie nicht singen hören.
„Muss ich dir erst klarmachen, dass mir deine Stimme zuwider ist?“ hatte er sie heute angeschrien.
Unfassbar war das, ebenso wie sein Verbot. In der Pension war alles mäuschenstill gewesen, wenn sie sang, und der alte Gesanglehrer Josef Rössle, der bei Frau Mutebach in Konstanz unterrichtete, hatte mehr als einmal zu ihr gesagt: „Der liebe Herrgott hat edles Glockenmetall mit in deine Stimme gegossen, und du bist ein auserwähltes Menschenkind!“
Stolz, o so stolz war sie auf diesen Ausspruch des alten Herrn gewesen, und nun hatte sie noch nicht einmal gewagt, dem Vater diesen Ausspruch zu wiederholen. Nach dem heutigen Tage würde sie es auch niemals wagen.
Wie überflüssig sie war! Im Haushalt sollte sie nicht helfen, es störte die Wirtschafterin in ihren Gewohnheiten, der Vater brauchte sie ebenfalls nicht, auch ihm bedeutete ihre Gegenwart nur eine Störung. Wozu war sie nun eigentlich da?
Batiken sollte sie, handarbeiten, nach Neustadt in den Zeltzirkus laufen, im Sommer Anschluss an Kurgäste suchen, um die Zeit hinzubringen, also hatte ihr der Vater geraten! Nutzlos sollte sie ihre Zeit vergeuden mit Dingen, die sie langweilten, nur das sollte und durfte sie nicht tun, was ihr Freude bereitete. Nur singen durfte sie nicht! Seit heute gab sie die Hoffnung auf, den Vater darin umzustimmen, und nie würde sie es wagen, ihn zu bitten, ihr guten Gesangsunterricht geben zu lassen, wie es ihr der alte Josef Rössle in Konstanz angeraten.
Vom Wasser wehte es kühl, und es war nun beinahe dunkel. Irgendwo drüben vom anderen Ufer grüsste ein Licht, wie ein Sternlein sah es aus, wie ein Hoffnungsstern in trübem, düsteren Grau.
Müde erhob sich Erika. Sie fror, alle Glieder waren ihr steif geworden.
Langsam, gleichsam widerwillig, schritt sie dem Hause zu.
Auf der Diele trat ihr die Wirtschafterin entgegen. Sie führte schon seit Jahren den Haushalt Marholms und fühlte sich darin fast als Herrin. Sie hatte ein breites Gesicht von alltäglichem Ausdruck, und ihr fahlbraunes Haar war schlecht und ungeschickt gewellt. Sie hiess Frieda Stosch, aber Erika nannte sie bei sich immer Fräulein Frosch, denn an das Tier erinnerten sie die etwas vorstehenden grüngrauen Augen der Wirtschafterin. Fräulein Stosch hatte einen verkniffenen Ausdruck im Gesicht.
„Hören Sie, Erika,“ empfing Sie die Eintretende, „ich möchte sie, da Sie sonst niemand darauf aufmerksam macht, vor allem bitten, sich nicht bei völliger Dunkelheit allein im Freien aufzuhalten, und ausserdem bitten, Ihren Herrn Vater nicht zu erregen. Er kam ganz zornig vom Abendessen aus der Laube und sitzt nun verstimmt in seinem Zimmer, ohne die Tasten anzurühren. Nach dem Nachtessen pflegte er doch stets zu spielen. Er äusserte einmal zu mir, dann fielen ihm merkwürdigerweise oft seine besten Melodien ein. Sie dürfen Ihren Herrn Vater in keiner Weise erregen und stets bedenken, alle Künstler, und noch dazu ein so bedeutender Künstler wie er, hängen von Stimmungen ab! Sie dürfen überhaupt nicht vergessen —“
Erika hatte in der offenen Küchentür das lauschende Mädchen erspäht.
„Hat mein Vater Sie beauftragt, mir das alles zu erzählen?“ unterbrach sie Fräulein Stosch nun mit leiser, aber vor Erregung bebender Stimme.
Die Haushälterin blickte verdutzt und gab dann empört Antwort.
„Nein, aber da ich mich verpflichtet fühlte —“
Auch diesen Satz konnte sie nicht vollenden.
Erika empfand ein Gefühl von eisigkaltem Hochmut, ihr Widerwillen gegen die sich allmächtig gebärdende Stosch schien noch zu wachsen.
„Ich glaube kaum, dass mein Vater Anerkennung dafür hat, dass Sie sich verpflichtet fühlen, mich hier auf dem Flur abzukanzeln. Wenn Sie wirklich meinen, dass die Erziehung der Haustochter mit zu Ihren Obliegenheiten gehört, ebenso wie Backen und Einmachen, dann gestatten Sie vielleicht, dass ich darüber anderer Meinung bin. Im übrigen möchte ich jetzt auf mein Zimmer gehen.“
Sie machte einen Schritt vorwärts auf die Treppe zu.
Jetzt ähnelte die Haushälterin wirklich einem Frosch. Ihre Augen schienen auf Stielen zu sitzen, so weit schoben sie sich vor. „Erika!“ Fast gellend vor Empörung rief sie den Namen.
Die Jüngere behielt die überlegene Ruhe des Gesichts bei, nur die Stimme vermochte sie nicht zur Ruhe zu zwingen.
„Fräulein Stosch, ich bitte Sie, da es jetzt gerade passt, mich fernerhin nicht beim Vornamen zu nennen, ich bin kein Kind mehr und wünsche von Ihnen so angeredet zu werden wie von jedem fremden Menschen, nämlich: Fräulein Marholm.“
Zu einem Steinbild erstarrt, stand die Haushälterin, während Erika mit gleichmütigem Gesichtsausdruck die Treppe hinaufstieg.
In ihrem Zimmer angekommen, veränderte sich dieser Ausdruck aber vollständig und, in haltloses Weinen ausbrechend, sank sie auf einen Stuhl in dem matt erhellten Raum, dem eine vor dem Hause angebrachte Laterne von draussen ein wenig Licht spendete. Sie schluchzte und weinte und konnte sich nicht beruhigen. Das also war ihr Los! Dem Vater war sie im Wege, die Haushälterin mäkelte an ihr herum, erteilte ihr Rügen, während das Dienstmädchen mit mitleidigem Lächeln zuhörte. Erst kurze Wochen war sie wieder daheim und schon so müde, so müde, als lägen liebeleere, inhaltslose Jahre zwischen der Pensionszeit und dem Heute. Sollte das Tag für Tag so weitergehen? War es da nicht besser, sie kehrte wieder in die Pension zurück, wie es ihr der Vater heute angedroht? Alle waren dort lieb und freundlich zu ihr gewesen. Aber sie konnte doch nicht ewig in der Pension bleiben! Sie seufzte!
Ach, was war das Leben doch so kompliziert, und wenn man noch so viel nachdachte und sich alles noch so gründlich zurechtlegte, es kam doch anders.
„Erstens kommt es anders.
Zweitens, als man denkt!“
pflegte der alte Gesanglehrer Josef Rössle immer zu sagen. An ihn musste Erika jetzt denken. Und heisse Sehnsucht nach dem weisshaarigen kleinen Männchen mit dem kohlpechrabenschwarzen Schnurrbart wallte in ihr auf. Wie war er stets so ganz besonders gut zu ihr gewesen, hatte ihr zuweilen von ihrer Mutter erzählt, die er einmal im Frankfurter Opernhaus gehört hatte, wo sie in der Oper Carmen gastierte! Das war ein Erlebnis für ihn gewesen, und er meinte einmal: „Du hast dasselbe Stimmaterial wie deine Mutter, Mädelchen, aber ob’s allemal ein Segen ist, wenn man solche Schätze in der Kehle besitzt? Dein Vater wird’s sicher besser wissen als ich, was für sein Kind frommt, ob’s eine Künstlerin werden soll —. Mag wohl ein anstrengender Dornenweg sein bis zum Gipfel, jeder hat nicht die rechte Kraft zum Klimmen, und ich denke mir, bei einem mit Genie ausgestatteten Menschenkind haben zwei Paten an der Wiege gestanden, ein Engel und ein Teufel, die reissen das geniale Menschlein ständig hin und her, bis einer von beiden siegt und die Führung übernimmt.“ Er hatte dazu gelächelt und weiter philosophiert: „So einer wie Josef Rössle hat ja niemals mit Engeln und Dämonen zu tun gehabt; aber es sieht anders aus in solchen begnadeten Menschen, die Welt und das Leben spiegeln sich anders in ihren Hirnen, und ihr Empfinden wird wahrscheinlich von dem meinen so verschieden sein wie das eines rassigen Rennpferdes von dem einer braven Hausziege.“
Ueber den Vergleich hatte er dann selbst lachen müssen, und Erika musste jetzt noch, als sie daran dachte, lächeln.
Der gute, alte Mann mit seiner leisen, sanften Stimme stand deutlich vor ihrem geistigen Auge, sie glaubte, ihn reden zu hören.
Ach, wenn sie sich hätte mit ihm aussprechen dürfen! Sie hatte das bestimmte Empfinden, er würde ihr mit ein paar naiv klugen Worten den Ausweg aus ihrer Bekümmernis weisen.
Sie schloss das Fenster, liess die kleinen elektrischen Birnen, die an der Zimmerdecke in Form eines Sternes angebracht waren, aufleuchten. Sanfte Helle füllte das hübsch eingerichtete Gemach. Nachdem sich Erika die verweinten Augen gekühlt, nahm sie an ihrem schmalen Schreibtisch Platz, sie verspürte Lust, an Josef Rössle zu schreiben. Ihr Leid wollte sie ihm nicht klagen; aber es machte ihm vielleicht Freude, wenn er einen Brief von ihr erhielt. Sie legte einen Bogen vor sich hin und begann. Und dann war sie plötzlich mit all ihrem Denken wieder in dem hübschen weissen Hause an der Rheinbrücke in Konstanz bei ihren Schulkameradinnen und Lehrerinnen und plauderte lustig mit dem alten Josef Rössle, der so still und bescheiden durch sein einsames Junggesellenleben ging, über den Bitternis und Unmut keine Macht zu besitzen schienen; denn niemals hatte ihn Erika Marholm verstimmt gesehen. Sein Lächeln, das sich unter dem jugendlich gefärbten Bärtchen hervorstahl, verlor er niemals, es war immer da.
Fräulein Stosch hatte ebensogut wie Erika bemerkt, dass die dralle Prechtalerin von der Küchentür aus neugierig lauschte, als sie, wie sie es bei sich nannte, dem jungen Mädchen ins Gewissen zu reden versuchte. Es war ihr nicht einmal so unangenehm gewesen, Publikum bei der Szene zu wissen. Wie hätte sie aber auch nur einen solchen Ausgang voraussehen können? Statt geduldig ihre guten Lehren anzuhören und dankbar für die Hinweise Besserung zu geloben, erlaubte sich dieser halbflügge Backfisch, der sonst tat, als könnte er nicht bis fünf zählen, ihr in einem Ton zu antworten, in einem Ton — —! Minutenlang noch hatte Fräulein Stosch dagestanden und, nach Atem ringend, nicht zu begreifen vermocht, dass diese magere, unscheinbare Halberwachsene ihr förmlich die Leviten gelesen hatte. Ihr, und noch dazu in Gegenwart des dumm-schlauen Bauernmädels, das sich über diese Niederlage ihrer Vorgesetzten wahrscheinlich sehr freute und den Vorfall sicher weiterklatschte ...
Nachdem sich die Haushälterin aus ihrer Erstarrung gelöst hatte, sah sie, dass sich die Prechtalerin in die Küche zurückgezogen und taktvoll die Tür hinter sich geschlossen hatte. Ein Glück für sie, sonst wäre ihr bestimmt ein Donnerwetter an den Kopf geflogen! — Fräulein Stosch bebte an allen Gliedern ob dem Schimpf, den ihr Erika angetan, und war keineswegs gewillt, den Schimpf auf sich sitzen zu lassen. Seit die damals zehnjährige Erika in die Pension gekommen, hatte sie die Zügel des Haushalts in Händen, und der berühmte Mann war stets mit ihr zufrieden gewesen, so zufrieden, dass sie sich zuweilen in blendende Zukunftsträume verlor. Nie hatte er ihr ein rauhes oder auch nur unzufriedenes Wort gesagt, und niemand verstand es wohl, so für ihn zu kochen, so für seine Ruhe zu sorgen wie sie. Schliesslich war das doch auch ein Verdienst, und Herr Marholm würde wohl kaum mit der Behandlung einverstanden sein, die seine Tochter sich gegen sie herausnahm. Jedenfalls noch einmal sollte sie es nicht wagen, lieber verliess sie die Villa Marholm!
Aber das würde nicht geschehen, dessen war sie sicher, der berühmte und nervöse Leopold Marholm brauchte einen zuverlässigen Menschen wie sie. Aber es schadete nichts, wenn sie die Gelegenheit benützte, ihre Unentbehrlichkeit zu erproben, um dem Mann einmal vor Augen zu führen, welche Perle er in ihr besass.
Ihr Entschluss war gefasst.
Sie eilte zunächst in ihr Zimmer, das eine behagliche Einrichtung zeigte, und puderte ihr bereits gelbliches Gesicht, auf dem hektische Flecke der Erregung brannten. Sie zupfte auch ein wenig an ihrem Haar und erweiterte den Ausschnitt ihres Kleides um einen Knopf, steckte die Silbertalerbrosche tiefer und ging. Ging schnurstracks auf das Arbeitszimmer des Komponisten zu.
Erst lauschte sie. Kein Ton! Vielleicht las er, denn nachdem er vorhin so erregt vom Abendessen aus der Laube gekommen, würde er wohl kaum Arbeitslust haben. Sie klopfte leise an.
„Herein!“ klang es missmutig.
Fräulein Stosch trat bescheiden ein, brachte mit niedergeschlagenen Augen ihre Klage gegen Erika vor.
„Ich habe es doch nur gut gemeint, nur gut,“ beteuerte sie am Schlusse weinerlich, „aber Erika hat mich gar nicht recht sprechen lassen und mich in einer Weise angefahren, die ich nicht gewohnt bin, und deshalb, Herr Marholm, so schwer es mir wird,“ jetzt weinte sie ganz laut und stiess dabei langsam und abgerissen hervor: „Deshalb bitte ich Sie um meine Entlassung.“
Frieda Stosch erschrak selbst, nachdem sie dieses Aeusserste, ihre Macht zu erproben, gewagt hatte. Beim Himmel! Es wäre ja furchtbar gewesen, wenn sie ihren Einfluss überschätzt hätte. Gar nicht auszudenken wäre das, denn einen ähnlichen bequemen Unterschlupf, wie ihn ihr die hausfrauenlose Villa Marholm bot, würde sie kaum wiederfinden. Dazu die Aussicht, hier eines Tages vielleicht noch eine andere Stellung, die Stellung der Herrin, einzunehmen!
Es wäre doch möglich, alles war in der Beziehung möglich! War es nicht schon oft dagewesen, dass gerade grosse Männer ihre Wirtschafterinnen geheiratet hatten in älteren Jahren? Und die Erstbeste war sie ja schliesslich auch nicht! Sie stammte aus einem Pastorenhaus, war die jüngste von zwölf Geschwistern, die bis auf zwei schon unter der Erde ruhten. Sie war vierundvierzig, das passte dem Alter nach ausgezeichnet, fand sie, und auch sonst würden sie beide kein schlechtes Paar abgeben. Kleider tun in der Beziehung Wunder. Elegante Röcke, Blusen, Mäntel und Hüte flogen an Frieda Stoschs geistigem Auge vorüber, während sie fiebernd wartete, wie der berühmte Mann ihre Kündigung aufnehmen würde. Sie hatte gleichsam alles auf ein Kartenblatt gesetzt.
Leopold Marholm sass in einem Klubsessel, sass noch in derselben Haltung, wie ihn die Haushälterin bei ihrem Eintritt angetroffen, und auch seine Züge hatten sich kaum verändert. Möglich, dass sie noch ein wenig finsterer waren als vorher. Es dauerte lange, bis er sprach, und Fräulein Stosch wagte kaum zu atmen. Endlich kam Bewegung in seine Glieder. Fast krampfig umspannten seine Finger die Armlehnen des Stuhls, und knurrend warf er der Wartenden entgegen:





























