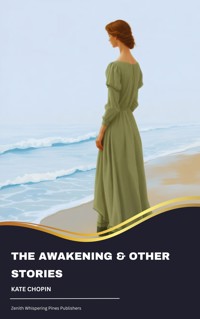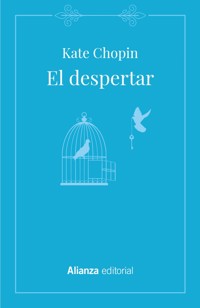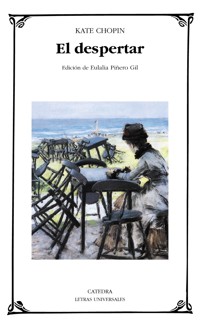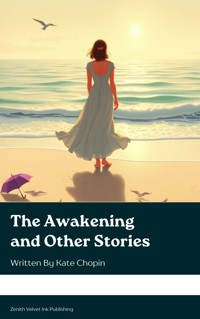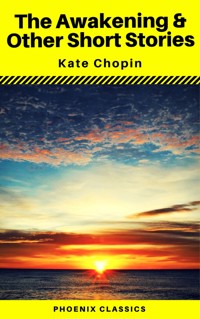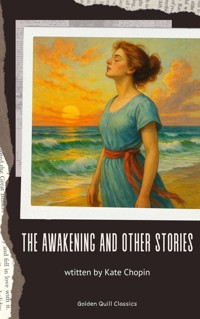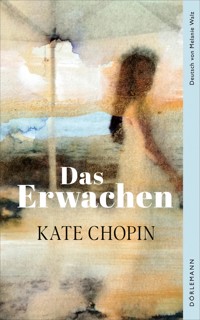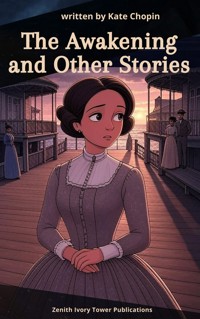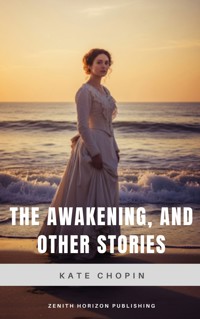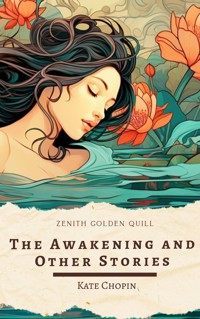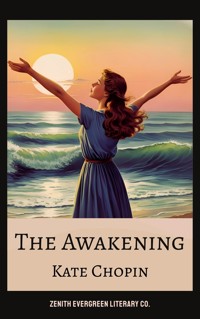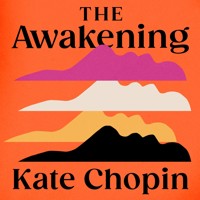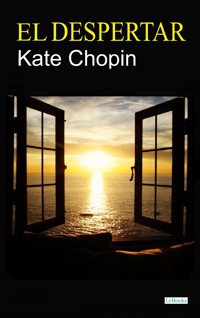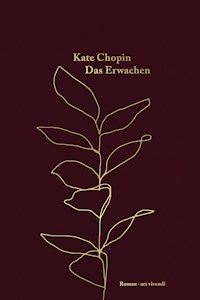
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Edna Pontellier scheint alles zu haben, was sich eine Frau ihres Standes und ihrer Zeit nur wünschen kann: einen erfolgreichen Gatten, zwei kleine Söhne, ein großes Haus im wohlhabenden French Quarter. Und dennoch spürt sie seit ihrer Kindheit, dass da mehr sein muss als die bloße Anpassung an gesellschaftliche Gepflogenheiten. Als sie sich während der Sommerferien auf Grand Isle in den jungen Robert verliebt, gelingt es ihr nach der Rückkehr in die Stadt endgültig nicht mehr, in die Rolle der braven Ehefrau und guten Mutter zurückzufinden. Edna beschließt, aus dem goldenen Käfig auszubrechen. Sie beginnt zu malen und lässt sich auf ein außereheliches Verhältnis ein. Doch die neu entfachten Leidenschaften stellen nur einen Schritt auf dem Weg zur Selbstfindung dar. Kann es für Edna überhaupt die freie Wahl und ein alternatives Leben geben? - Wiederentdeckter Klassiker in vollständig überarbeiteter Übersetzung - Fesselnder Roman über den Bewusstwerdungsprozess einer Frau vor der aufregenden Kulisse New Orleans' und der Küste Louisianas - Mit Nachwort und Anmerkungen der Übersetzerin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kate Chopin
Das Erwachen
Roman
Ins Deutsche übertragen und mit einem Nachwort
versehen von Ingrid Rein
ars vivendi
Die Originalausgabe erschien 1899unter dem Titel
The Awakening.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen überarbeiteten Neuausgabe 2019
© 2019, 1996 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten.
www.arsvivendi.com
Cover: ars vivendi unter Verwendung einer Illustration von Tanya Scott
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0101-5
Inhalt
Das Erwachen
Anmerkungen
Nachwort
Die Autorin
Das Erwachen
I
Ein grün-gelber Papagei in einem Käfig draußen vor der Tür wiederholte ein ums andere Mal:
»Allez vous-en! Allez vous-en! Sapristi!l So ist’s gut!«
Er konnte auch ein wenig Spanisch sowie eine Sprache, die keiner verstand außer vielleicht der Spottdrossel auf der anderen Seite der Türe, die ihre Flötentöne mit aufreizender Beharrlichkeit in die Brise hinauszwitscherte.
Mr Pontellier, außerstande, auch nur einigermaßen in Ruhe seine Zeitung zu lesen, erhob sich mit verdrießlicher Miene und einem Ausruf des Unwillens. Er ging die Galerie hinunter und über die schmalen Stege, die die einzelnen Ferienhäuser auf dem Anwesen der Lebruns miteinander verbanden. Er hatte vor der Tür des Haupthauses gesessen. Der Papagei und die Spottdrossel waren das Eigentum von Madame Lebrun, und es war ihr gutes Recht, so viel Lärm zu machen, wie sie wollten. Mr Pontellier seinerseits stand es frei, sich ihrer Gesellschaft zu entziehen, wenn er sie nicht mehr als unterhaltsam empfand.
Vor seinem eigenen Ferienhäuschen machte er halt; es war das vierte vom Hauptgebäude aus und das vorletzte in der Reihe. Er setzte sich in den Korbschaukelstuhl vor der Tür und widmete sich erneut der Aufgabe des Zeitunglesens. Es war Sonntag, die Zeitung schon einen Tag alt. Die Sonntagszeitungen waren noch nicht auf Grand Isle2 eingetroffen. Die Marktberichte kannte er bereits; nun überflog er unkonzentriert die Leitartikel und Meldungen, zu deren Lektüre er vor seiner Abreise aus New Orleans keine Zeit mehr gefunden hatte.
Mr Pontellier trug eine Brille. Er war ein Mann von vierzig Jahren, mittlerer Größe und recht schlankem Wuchs; er ging etwas gebeugt. Sein Haar war braun und glatt und auf einer Seite gescheitelt, sein Bart ordentlich und kurz gestutzt.
Zuweilen sah er von der Zeitung auf und blickte um sich. Im Haus drüben – das Hauptgebäude wurde »das Haus« genannt, um es von den Ferienhäusern zu unterscheiden – war der Lärm größer denn je. Die beiden Vögel schwatzten und zwitscherten noch immer. Zwei junge Mädchen, die Farival-Zwillinge, spielten ein Duett aus Zampa3 auf dem Klavier. Madame Lebrun eilte geschäftig ein und aus, wobei sie jedes Mal, wenn sie das Haus betrat, mit lauter Stimme einem Gärtnerjungen Befehle gab, und jedes Mal, wenn sie herauskam, mit gleich lauter Stimme einer Dienstmagd im Speisesaal Anordnungen erteilte. Sie war eine lebhafte, hübsche Frau, die immer weiße Kleider mit halblangen Ärmeln trug. Ihre gestärkten Röcke raschelten bei jeder Bewegung. Weiter unten ging eine Dame in Schwarz vor einem der Ferienhäuschen gesetzten Schrittes auf und ab und betete dabei den Rosenkranz. Eine ganze Reihe von Pensionsgästen war in Beaudelets Boot nach Chênière Caminada4 gefahren, um dort der Messe beizuwohnen. Ein paar junge Leute spielten unter den Wassereichen Krocket. Auch Mr Pontelliers Kinder befanden sich darunter – zwei kräftige Kerlchen von vier und fünf Jahren. Das Kindermädchen, eine Quarteronne5, folgte ihnen mit geistesabwesender, nachdenklicher Miene.
Mr Pontellier zündete sich schließlich eine Zigarre an und begann zu rauchen, die Zeitung ließ er träge aus der Hand gleiten. Er heftete den Blick auf einen weißen Sonnenschirm, der im Schneckentempo vom Strand heraufkam. Er konnte ihn deutlich zwischen den hageren Stämmen der Wassereichen und jenseits des Streifens gelb blühender Kamille sehen. Der Golf schien weit weg und im fernen Dunst mit dem Blau des Horizonts zu verschmelzen. Der Sonnenschirm kam langsam näher. Unter dem rosa gefütterten, schützenden Dach gingen seine Frau, Mrs Pontellier, und der junge Robert Lebrun. Als die beiden das Ferienhäuschen erreichten, ließen sie sich – offenbar ein wenig erschöpft – auf der oberen Verandastufe nieder; sie saßen einander gegenüber, jeder an einen Stützpfosten gelehnt.
»Welch eine Torheit! Um diese Zeit und bei solch einer Hitze zu baden!«, rief Mr Pontellier. Er selbst war gleich bei Tagesanbruch zum Baden gegangen. Deshalb kam ihm der Vormittag auch so lang vor.
»Du bist ja bis zur Unkenntlichkeit verbrannt«, fügte er hinzu und sah seine Frau dabei an, wie man ein wertvolles Stück persönlichen Eigentums ansieht, das Schaden genommen hat. Sie hielt ihre Hände in die Höhe, kräftige, schön geformte Hände, und betrachtete sie kritisch, wobei sie ihre Batistärmel über die Handgelenke hochzog. Dabei erinnerte sie sich an ihre Ringe, die sie ihrem Gatten gegeben hatte, bevor sie zum Strand hinuntergegangen war. Schweigend streckte sie ihm eine Hand entgegen; er verstand sofort, nahm die Ringe aus seiner Westentasche und ließ sie in ihre offene Handfläche fallen. Sie steckte sie an die Finger, dann umschlang sie die Knie, sah zu Robert hinüber und begann zu lachen. Die Ringe funkelten an ihren Fingern. Robert stimmte in ihr Lachen ein.
»Was ist los?«, fragte Pontellier; bedächtig und amüsiert blickte er von einem zum anderen. Es handelte sich um etwas völlig Albernes – irgendein Erlebnis draußen im Wasser, von dem nun beide gleichzeitig berichteten. Es klang nicht halb so lustig, wenn man es erzählte. Sie merkten das, und Mr Pontellier merkte es auch. Er gähnte und streckte sich. Dann stand er auf und erklärte, er habe nicht übel Lust, in Kleins Hotel hinüberzugehen, um eine Partie Billard zu spielen.
»Kommen Sie doch mit, Lebrun«, schlug er Robert vor. Doch Robert gab ganz unumwunden zu, dass er lieber bleiben wolle, wo er sei, um sich mit Mrs Pontellier zu unterhalten.
»Schick ihn fort, wenn er dich langweilt, Edna«, wies ihr Gatte sie an, bevor er aufbrach.
»Hier, nimm den Schirm«, sagte sie und hielt ihm den Sonnenschirm hin. Er nahm ihn, spannte ihn auf, während er die Stufen hinunterging, und entfernte sich.
»Kommst du zum Abendessen?«, rief seine Frau ihm nach. Pontellier blieb einen Augenblick stehen und zuckte mit den Schultern. Er griff in seine Westentasche, dort befand sich eine Zehndollarnote. Er wusste es selbst noch nicht; vielleicht würde er zum Abendessen zurückkommen, vielleicht auch nicht. Das hing ganz von der Gesellschaft ab, die er im Kleins drüben vorfinden würde, und von der Größe »der Partie«. Er sagte das nicht, aber sie verstand auch so, lachte und nickte ihm zum Abschied zu.
Beide Kinder wollten ihrem Vater folgen, als sie ihn weggehen sahen. Er küsste sie und versprach, ihnen Süßigkeiten und Erdnüsse mitzubringen.
II
Mrs Pontelliers Augen waren lebhaft, strahlend und von fast der gleichen gelblich braunen Farbe wie ihr Haar. Sie hatte die Angewohnheit, den Blick schnell auf einen Gegenstand zu richten und ihn dann darauf ruhen zu lassen, als sei sie ganz in seine Betrachtung oder tief in Gedanken versunken.
Ihre Augenbrauen waren einen Ton dunkler als ihr Haar. Sie waren dicht und beinahe waagrecht, was die Tiefe ihrer Augen noch betonte. Edna Pontellier war eher hübsch denn schön. Ihr Gesicht bezauberte durch eine gewisse Offenheit in seinem Ausdruck und durch ein widersprüchliches, hintergründiges Mienenspiel. Ihre Umgangsformen nahmen alle für sie ein.
Robert drehte sich eine Zigarette. Er rauche Zigaretten, weil er sich Zigarren nicht leisten könne, behauptete er. Er hatte indes eine Zigarre in der Tasche; sie war ein Geschenk von Mr Pontellier, das er sich bis nach dem Abendessen aufsparen wollte.
Dies schien ihm völlig in Ordnung und natürlich. In der Gesichtsfarbe unterschied Robert sich nicht wesentlich von seiner Gefährtin. Dass sein Gesicht glatt rasiert war, ließ die Ähnlichkeit nur noch deutlicher hervortreten. Nicht der geringste Schatten von Kummer oder Sorge lag auf seinen offenen Zügen. Seine Augen sammelten und reflektierten das Licht und die einschläfernde Schwüle des Sommertages.
Mrs Pontellier griff nach einem Palmwedelfächer auf dem Boden der Veranda und fächelte sich Luft zu, während Robert zwischen den Lippen Rauchwölkchen aufsteigen ließ. Sie plauderten unablässig: über die Dinge um sie herum, ihr amüsantes Abenteuer vorhin im Wasser, das seinen unterhaltsamen Charakter wiedergewonnen hatte, über den Wind, die Bäume, die Leute, die nach Chênière gefahren waren, über die Kinder, die unter den Eichen Krocket spielten, und die Farival-Zwillinge, die nun die Ouvertüre zu Der Dichter und der Bauer 6 zum Besten gaben.
Robert sprach ziemlich viel über sich selbst. Er war sehr jung und wusste es nicht besser. Mrs Pontellier sprach aus dem gleichen Grund ein wenig über sich. Beide interessierte, was der andere sagte. Robert erzählte von seiner Absicht, im Herbst nach Mexiko zu gehen, wo das Glück auf ihn warte. Er hatte eigentlich immer vor, nach Mexiko zu gehen, aber irgendwie kam er nie hin. Unterdessen harrte er auf seinem bescheidenen Posten in einem Handelshaus in New Orleans aus, wo er sich dank einer gleichermaßen profunden Vertrautheit mit dem Englischen, Französischen und Spanischen einer nicht geringen Wertschätzung als Kommis und Korrespondent erfreute.
Er verbrachte gerade – wie jedes Jahr – seinen Sommerurlaub bei seiner Mutter auf Grand Isle. Früher, zu Zeiten, an die Robert sich nicht erinnern konnte, war das Haus ein sommerlicher Luxus gewesen, den die Lebruns sich gegönnt hatten. Jetzt, flankiert von dem Dutzend oder mehr Ferienhäuschen, die stets mit exklusiven Gästen aus dem Quartier Français7 bevölkert waren, gestattete der Besitz des Hauses es Madame Lebrun, das sorgenfreie und behagliche Leben weiterzuführen, das ihr angestammtes Recht zu sein schien.
Mrs Pontellier erzählte von der Plantage ihres Vaters in Mississippi und dem Zuhause ihrer Kindheit, die sie in der vom Rispengras geprägten Landschaft des alten Kentucky verbracht hatte. Sie war eine Amerikanerin mit einem kleinen Schuss französischen Blutes, von dem indes aufgrund fortwährender Verwässerung nicht mehr viel vorhanden schien. Sie las einen Brief ihrer Schwester vor, die im Osten lebte und sich dort verlobt hatte. Robert zeigte Interesse, wollte wissen, was für eine Art Mädchen die Schwestern waren, was für ein Mensch der Vater und wie lange die Mutter schon tot war.
Als Mrs Pontellier den Brief zusammenfaltete, war es Zeit, sich fürs Abendessen umzukleiden.
»Léonce kommt offenbar nicht zurück«, sagte sie mit einem Blick in die Richtung, in die ihr Gatte verschwunden war. Robert vermutete das ebenfalls, denn drüben im Kleins hielt sich eine ganze Reihe von Klubmitgliedern aus New Orleans auf.
Als Mrs Pontellier den jungen Mann verließ, um sich auf ihr Zimmer zu begeben, schlenderte er die Stufen hinunter und zu den Krocketspielern hinüber, wo er sich in der halben Stunde vor dem Essen mit den kleinen Pontelliers, die sehr von ihm angetan waren, die Zeit vertrieb.
III
Es war elf Uhr nachts, als Mr Pontellier an diesem Tag aus Kleins Hotel zurückkehrte. Er war bei bester Laune, geradezu in gehobener Stimmung, und sehr gesprächig. Sein Eintreten weckte seine Frau, die bereits zu Bett gegangen war und fest geschlafen hatte. Er sprach mit ihr, während er sich auszog, erzählte ihr Anekdoten, Neuigkeiten und Klatschgeschichten, die er tagsüber aufgelesen hatte. Aus seinen Hosentaschen nahm er eine Handvoll zerknüllter Geldscheine und eine größere Menge Silbermünzen, die er, zusammen mit Schlüsseln, Messer, Taschentuch und was sich sonst noch in seinen Taschen befand, auf der Kommode aufhäufte. Edna Pontellier war völlig schlaftrunken und antwortete ihm nur mit einsilbigen Bemerkungen.
Er betrachtete es als sehr entmutigend, dass seine Gattin, die doch der einzige Sinn und Zweck seines Daseins war, so wenig Interesse an Dingen bekundete, die ihn betrafen, und seine Konversation derart geringschätzte.
Mr Pontellier hatte die Süßigkeiten und Erdnüsse für die Jungen vergessen. Dennoch liebte er seine Söhne sehr, und er ging ins Nebenzimmer, wo sie schliefen, um nach ihnen zu sehen und sich zu vergewissern, dass sie behaglich ruhten. Das Ergebnis seiner Nachforschung war alles andere als zufriedenstellend. Er drehte und wendete die Kleinen im Bett hin und her. Einer der Jungen begann zu strampeln und von einem Korb voller Krabben zu reden.
Mr Pontellier kehrte mit der Nachricht zu seiner Gattin zurück, Raoul habe hohes Fieber und bedürfe ihrer Fürsorge. Dann zündete er sich eine Zigarre an und setzte sich an die offene Tür, um dort zu rauchen.
Mrs Pontellier war sich recht sicher, dass Raoul kein Fieber hatte. Er sei vollkommen gesund zu Bett gegangen, erklärte sie, und den ganzen Tag über habe ihm nichts gefehlt. Mr Pontellier war zu vertraut mit Fiebersymptomen, um sich zu irren. Er versicherte ihr, das Kind werde in ebenjenem Moment im Nebenzimmer vom Fieber verzehrt.
Er hielt seiner Gattin ihre Unaufmerksamkeit, ihre ständige Vernachlässigung der Kinder vor. Wenn es nicht die Aufgabe einer Mutter sei, sich um die Kinder zu kümmern, wessen Aufgabe sei es um alles in der Welt denn dann? Er selbst habe alle Hände voll zu tun mit seinem Börsenmaklergeschäft, könne nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, nämlich unterwegs, um den Unterhalt für seine Familie zu verdienen, und zu Hause, um dafür zu sorgen, dass Frau und Kinder keinen Schaden nähmen. Er sprach in monotonem, eindringlichem Ton.
Mrs Pontellier sprang aus dem Bett und ging ins Nebenzimmer. Wenig später kam sie zurück, setzte sich auf die Bettkante und legte den Kopf auf das Kissen. Sie sagte nichts und weigerte sich, auf die Fragen ihres Gatten zu antworten. Sobald er seine Zigarre zu Ende geraucht hatte, ging er zu Bett, und binnen einer halben Minute war er fest eingeschlafen.
Mrs Pontellier war nun hellwach. Sie weinte ein wenig und trocknete ihre Augen am Ärmel ihres Peignoir8. Dann blies sie die Kerze aus, die ihr Mann hatte brennen lassen, schlüpfte mit den bloßen Füßen in ein Paar Satinpantoffeln, die am Fußende des Bettes standen, und ging auf die Veranda hinaus, wo sie sich in den Korbstuhl setzte und sanft vor und zurück zu schaukeln begann.
Es war inzwischen nach Mitternacht. Die Ferienhäuschen waren alle dunkel. Ein einsamer schwacher Lichtschein fiel aus der Eingangshalle des Hauses. Kein Laut war zu hören außer den Schreien einer alten Eule in der Krone einer Wassereiche und der ewigen Stimme des Meeres, die zu dieser lieblichen Stunde nur gedämpft erklang. Wie ein trauriges Wiegenlied brach sie sich in der Nacht.
Die Tränen stiegen nun so geschwind in Mrs Pontelliers Augen, dass der feuchte Ärmel ihres Peignoir nicht länger ausreichte, um sie zu trocknen. Sie hielt die Rückenlehne des Stuhles mit einer Hand umklammert; an dem erhobenen Arm war ihr der weite Ärmel fast bis zur Schulter zurückgeglitten. Sie wandte den Kopf zur Seite, verbarg ihr heißes, nasses Gesicht in der Armbeuge und weinte in dieser Haltung weiter, ohne sich die Mühe zu machen, Gesicht, Augen oder Arme zu trocknen. Sie hätte nicht sagen können, warum sie weinte. Vorkommnisse wie das eben waren nichts Ungewöhnliches in ihrem Eheleben. Sie schienen bisher aber nie sehr ins Gewicht gefallen zu sein angesichts der übergroßen Liebenswürdigkeit ihres Gatten und einer gleichbleibenden Zuneigung, wie sie im Laufe der Zeit stillschweigend und selbstverständlich geworden war.
Eine unbeschreibliche Bedrücktheit, die von einem unbekannten Bereich ihres Bewusstseins auszugehen schien, erfüllte ihr ganzes Wesen mit einer unbestimmten Angst. Wie ein Schatten, ein feiner Nebel, zog sie über den Sommertag ihrer Seele hinweg. Es war eine seltsame, ihr nicht vertraute Empfindung, eine Laune. Edna saß nicht da und machte ihrem Gatten im Stillen Vorwürfe, sie haderte nicht mit dem Schicksal, das ihre Schritte auf den von ihr eingeschlagenen Pfad gelenkt hatte. Sie weinte sich einfach einmal richtig aus. Die Moskitos taten sich an ihr gütlich, stachen sie in die festen, runden Arme und sogen Blut aus ihren nackten Fußrücken.
Den kleinen stechenden, surrenden Quälgeistern gelang es, eine Stimmung zu verscheuchen, die Edna sonst vielleicht den Rest der Nacht in der Dunkelheit draußen hätte verharren lassen.
Am nächsten Morgen war Mr Pontellier schon frühzeitig auf, um die Kutsche zu nehmen, die ihn zum Dampfschiff an der Anlegestelle bringen sollte. Er kehrte zu seinen Geschäften in die Stadt zurück, auf der Insel würde man ihn vor dem nächsten Samstag nicht wiedersehen. Er hatte seine Fassung zurückgewonnen, die er in der Nacht zuvor etwas verloren hatte. Er war erpicht darauf wegzukommen, denn ihn erwartete eine lebhafte Woche in der Carondelet Street9.
Mr Pontellier gab seiner Frau die Hälfte des Geldes, das er am Abend zuvor aus Kleins Hotel mitgebracht hatte. Sie mochte Geld, wie die meisten Frauen, und nahm es mit nicht geringer Befriedigung entgegen.
»Damit lässt sich ein hübsches Hochzeitsgeschenk für Janet kaufen!«, rief sie, zählte die Banknoten und strich dabei jede einzelne glatt.
»Deine Schwester wird uns mehr wert sein als das, mein Liebes«, erklärte er lachend, bevor er sie zum Abschied küsste.
Die Jungen tollten umher, klammerten sich an seine Beine und bettelten, er möge ihnen bei seinem nächsten Besuch doch recht viel mitbringen. Mr Pontellier war sehr beliebt, und stets fanden sich Damen, Herren und Kinder, ja selbst Kindermädchen ein, um ihn zu verabschieden. Seine Frau winkte lächelnd, die Jungen riefen ihm laut hinterher, als er in dem alten Einspänner auf der sandigen Straße entschwand.
Einige Tage später traf aus New Orleans ein Päckchen für Mrs Pontellier ein. Es war von ihrem Gatten und mit Friandises10, ausgesuchten Köstlichkeiten und Leckereien, gefüllt – mit den feinsten Früchten, Pâtes11, ein, zwei erlesenen Flaschen, köstlichen Sirupen und Pralinen im Überfluss.
Mrs Pontellier war mit dem Inhalt solcher Päckchen immer sehr großzügig; sie erhielt häufig welche, wenn sie von zu Hause fort war. Pâtes und Obst wurden in den Speisesaal gebracht, die Pralinen herumgereicht. Und die Damen, die mit kennerhaften, kritischen Fingern und ein wenig gierig ihre Wahl trafen, erklärten ausnahmslos, Mr Pontellier sei der beste Ehemann der Welt. Mrs Pontellier sah sich gezwungen zuzugeben, sie kenne keinen besseren.
IV
Es hätte Mr Pontellier Mühe bereitet, zu seiner eigenen oder irgendjemandes anderen Zufriedenheit zu erklären, inwiefern seine Frau ihre Pflicht den Kindern gegenüber vernachlässigte. Es war etwas, das er eher fühlte denn tatsächlich beobachtete, und er äußerte das Gefühl nie ohne nachträgliches Bedauern und reichliche Wiedergutmachung.
Wenn einer der kleinen Pontelliers beim Spielen hinfiel, stürzte er sich nur selten weinend in die Arme seiner Mutter, um sich von ihr trösten zu lassen; meist stand er wieder auf, wischte sich das Wasser aus den Augen und den Sand aus dem Mund und spielte weiter. So klein die beiden Knirpse auch noch waren, zogen sie doch an einem Strang und behaupteten ihren Platz in kindlichen Gefechten mit vereinten Fäusten und erhobenen Stimmen, setzten sie sich für gewöhnlich gegen die anderen Muttersöhnchen durch. Das Kindermädchen wurde von ihnen als gewaltige Behinderung empfunden, gut lediglich zum Zuknöpfen von Hemdchen und Höschen und zum Bürsten und Scheiteln des Haars, da es nun einmal anscheinend ein Gesetz der Gesellschaft war, dass das Haar gescheitelt und gebürstet zu sein hatte.
Kurz, Mrs Pontellier war keine mütterliche Frau. Die mütterlichen Frauen schienen in jenem Sommer auf Grand Isle in der Überzahl. Sie waren leicht zu erkennen: Mit ausgebreiteten, schützenden Flügeln flatterten sie aufgeregt umher, wenn ihrer kostbaren Brut irgendeine tatsächliche oder eingebildete Gefahr drohte. Es waren Frauen, die ihre Kinder vergötterten, ihre Ehemänner anbeteten und es als heiliges Privileg ansahen, sich selbst als Individuen auszulöschen und sich als gute Engel Flügel wachsen zu lassen.
Viele von ihnen beherrschten diese Rolle ganz ausgezeichnet; eine indes war die Verkörperung von weiblicher Tugend und Anmut schlechthin. Sollte ihr Gatte sie nicht lieben und verehren, wäre er ein Rohling, der es verdiente, langsam zu Tode gefoltert zu werden. Ihr Name war Adèle Ratignolle. Es gibt keine Worte, um sie zu beschreiben, außer den alten, die so oft schon dazu dienten, die romantische Heldin vergangener Tage und die Frau unserer Träume zu charakterisieren. An ihren Reizen war nichts Hintergründiges oder Verborgenes; ihre strahlende Schönheit war für jedermann auf den ersten Blick sichtbar: das Goldfadenhaar, das weder Kamm noch Klemme bändigen konnten; die blauen Augen, die allein mit Saphiren vergleichbar waren; die Lippen, die sich schürzten und so rot waren, dass man bei ihrem Anblick nur an Kirschen oder eine andere köstliche hochrote Frucht denken konnte. Zwar wurde sie allmählich ein wenig rundlich, doch dies schien der Anmut ihrer Schritte, Posen und Gesten keinerlei Abbruch zu tun. Man hätte sich ihren weißen Hals kein bisschen weniger voll gewünscht und auch ihre Arme nicht schlanker. Nie hatte es elegantere Hände gegeben als die ihren, und es war eine Freude zuzusehen, wenn sie die Nadel einfädelte oder den goldenen Fingerhut auf ihren langen, spitzen Mittelfinger steckte, um die kleinen Schlafanzüge zu nähen oder ein Leibchen oder Lätzchen anzufertigen.
Madame Ratignolle mochte Mrs Pontellier gern, und oft ging sie mit ihrer Näharbeit zu ihr hinüber, um die Nachmittage in ihrer Gesellschaft zu verbringen. Auch an dem Nachmittag, an dem das Paket aus New Orleans eintraf, war sie dort. Sie hatte den Schaukelstuhl in Beschlag genommen und war emsig dabei, einen winzigen Schlafsack zu nähen.
Sie hatte das Schnittmuster mitgebracht, damit Mrs Pontellier es sich ausschneiden konnte, handelte es sich doch um eine wunderbare Konstruktion, die darauf angelegt war, den Körper des Kindes so vollständig einzuhüllen, dass nur noch zwei Äuglein aus dem Kleidungsstück hervorlugten wie die eines Eskimos. Es war zum Tragen im Winter gedacht, wenn heimtückische Zugluft den Kamin herabfährt und hinterhältige Ströme eisiger Kälte ihren Weg durch Schlüssellöcher finden.
Mrs Pontellier war eigentlich ganz beruhigt, was die augenblicklichen materiellen Bedürfnisse ihrer Kinder anlangte, und konnte keinen Sinn darin sehen, vorauszuplanen und winterliche Nachtkleidung zum Gegenstand ihrer sommerlichen Betrachtungen zu machen. Doch sie wollte nicht unfreundlich und uninteressiert erscheinen; deshalb hatte sie Zeitungen geholt, sie auf dem Boden der Galerie ausgebreitet und unter Madame Ratignolles Anleitung ein Schnittmuster für das luftundurchlässige Kleidungsstück angefertigt.
Robert war ebenfalls zugegen, er hatte sich an dieselbe Stelle gesetzt wie am Sonntag zuvor. Auch Mrs Pontellier hatte wieder ihren Platz auf der oberen Stufe eingenommen und lehnte sich matt gegen den Pfosten. Neben ihr stand eine Bonbonniere, die sie von Zeit zu Zeit Madame Ratignolle hinhielt.
Jener Dame schien die Wahl schwerzufallen, doch schließlich entschied sie sich für eine Nougatstange, allerdings nicht, ohne sich zu fragen, ob diese ihr vielleicht zu schwer im Magen liegen, ihr möglicherweise schaden könne. Madame Ratignolle war seit sieben Jahren verheiratet. Ungefähr jedes zweite Jahr bekam sie ein Kind. Damals hatte sie drei Kinder und stellte sich gerade auf ein viertes ein. Sie sprach ständig über ihren »Zustand«. Ihr »Zustand« war keineswegs offenkundig, und kein Mensch hätte ihn bemerkt, hätte sie ihn nicht so beharrlich zum Gesprächsthema gemacht.
Robert beruhigte sie; er behauptete, er habe eine Dame gekannt, die nur von Nougat gelebt habe, und dies während der gesamten … Als er die Röte in Mrs Pontelliers Gesicht aufsteigen sah, hielt er inne und wechselte das Thema.
Obwohl Mrs Pontellier mit einem Kreolen verheiratet war, fühlte sie sich in der Gesellschaft von Kreolen nicht ganz zu Hause; niemals zuvor hatte sie so eng mit ihnen zusammengelebt.12 In jenem Sommer waren ausschließlich Kreolen bei Madame Lebrun. Alle kannten einander und fühlten sich wie eine große Familie, deren Mitglieder aufs Freundschaftlichste miteinander verbunden waren. Eine Eigenschaft, die sie auszeichnete und die Mrs Pontellier zutiefst beeindruckte, war, dass ihnen jegliche Prüderie fremd war. Die freie Ausdrucksweise war ihr zunächst unverständlich, obwohl es ihr keine Schwierigkeiten bereitete, sie mit der erhabenen Keuschheit in Einklang zu bringen, die der Kreolin angeboren und ihr unverkennbares Merkmal zu sein scheint.
Niemals würde Edna Pontellier die Bestürzung vergessen, mit der sie zugehört hatte, wie Madame Ratignolle dem alten Monsieur Farival die qualvolle Geschichte eines ihrer Accouchements13 erzählte, ohne auch nur ein intimes Detail auszulassen. Sie gewöhnte sich langsam an solch bestürzende Erfahrungen, konnte aber nicht verhindern, dass ihr auch weiterhin die Röte in die Wangen stieg. Mehr als einmal hatte ihr Kommen die amüsante Geschichte unterbrochen, mit der Robert gerade eine Gruppe verheirateter Frauen unterhielt.
Ein Buch machte in der Pension die Runde. Als die Reihe, es zu lesen, an ihr war, tat sie dies mit größtem Befremden. Obwohl dies keiner von den anderen getan hatte, sah sie sich veranlasst, das Buch heimlich und in aller Abgeschiedenheit zu lesen, es beim Klang näherkommender Schritte zu verbergen. Es wurde bei Tisch offen kritisiert und freimütig diskutiert. Mrs Pontellier hörte auf, befremdet zu sein, und kam zu dem Schluss, dass es wohl immer Wunder geben würde.
V
Sie bildeten eine einträchtige Gruppe, wie sie an jenem Sommernachmittag so beisammensaßen – Madame Ratignolle mit ihrer Näharbeit beschäftigt, die sie häufig unterbrach, um, unterstrichen von ausdrucksvollen Gesten ihrer vollkommenen Hände, eine Geschichte oder Begebenheit zu erzählen, während Robert und Mrs Pontellier untätig dabeisaßen und gelegentlich Worte, Blicke oder ein Lächeln wechselten, die auf ein gewisses fortgeschrittenes Stadium von Vertrautheit und Kameraderie hindeuteten.
Er hatte den ganzen vergangenen Monat über in ihrem Schatten gelebt. Niemand dachte sich etwas dabei. Viele hatten vorausgesagt, dass Robert sich in diesem Jahr Mrs Pontellier widmen würde. Seit seinem fünfzehnten Lebensjahr, und das lag elf Jahre zurück, betätigte Robert sich jeden Sommer auf Grand Isle als ergebener Begleiter einer schönen Frau oder eines hübschen Fräuleins. Manchmal fiel seine Wahl auf ein junges Mädchen, dann wieder auf eine Witwe, aber genauso oft auch auf eine interessante verheiratete Frau.
Zwei aufeinanderfolgende Sommer lang lebte er im Sonnenschein von Mademoiselle Duvignés Gegenwart. Doch vor dem nächsten Sommer starb sie. Robert gab sich untröstlich und warf sich Madame Ratignolle zu Füßen, dankbar für jedes noch so kleine Zeichen der Anteilnahme oder des Trostes, das sie ihm zu gewähren geruhte.
Mrs Pontellier machte es Freude, dazusitzen und ihre Gefährtin so anzuschauen, wie sie eine makellose Madonna betrachtet hätte.
»Könnte sich jemand vorstellen, welche Grausamkeit sich hinter diesem schönen Äußeren verbirgt?«, murmelte Robert. »Sie wusste vom ersten Augenblick an, dass ich sie anbetete, und sie ließ es zu, dass ich sie anbetete. Es hieß: ›Robert, kommen Sie, gehen Sie, stehen Sie auf, setzen Sie sich, tun Sie dies, tun Sie jenes, schauen Sie nach, ob das Baby schläft, meinen Fingerhut, bitte, den ich weiß Gott wo liegenlassen habe. Kommen Sie und lesen Sie mir Daudet14 vor, während ich nähe.‹«
»Par exemple!15 Ich musste Sie nie bitten. Sie sind mir ständig um die Beine gestrichen wie eine lästige Katze!«
»Sie meinen, wie ein ergebener Hund. Und sobald Ratignolle auf der Bühne erschien, erging es mir tatsächlich wie einem Hund. ›Passez! Adieu! Allez vous-en!‹«16
»Vielleicht fürchtete ich, Alphonse könnte eifersüchtig werden«, warf sie mit übertriebener Naivität ein. Da mussten alle lachen. Die rechte Hand eifersüchtig auf die linke! Das Herz eifersüchtig auf die Seele! Und zudem ist der kreolische Ehemann ohnehin nie eifersüchtig, denn diese das Innere zerfressende Leidenschaft ist bei ihm durch Nichtgebrauch verkümmert.
Unterdessen erzählte Robert, an Mrs Pontellier gewandt, weiter von seiner einstigen hoffnungslosen Leidenschaft für Madame Ratignolle: von schlaflosen Nächten, von der verzehrenden Glut, die sogar die See jeden Tag aufs Neue zum Zischen brachte, wenn er darin eintauchte. Die Dame mit der Nadel begleitete seinen Bericht mit knappen, verächtlichen Bemerkungen: »Blagueur – farceur – gros bête, va!«17
Er schlug diesen halb ernsten, halb scherzhaften Ton nie an, wenn er mit Mrs Pontellier allein war. Sie wusste nie genau, was sie davon halten sollte; auch in jenem Augenblick war es ihr unmöglich zu erraten, wie viel an der Geschichte Spaß und was ernst gemeint war. Es hieß, er habe Madame Ratignolle oft Liebeserklärungen gemacht, ohne indes je auf den Gedanken gekommen zu sein, er könnte ernst genommen werden. Mrs Pontellier war froh, dass er ihr gegenüber nicht in eine ähnliche Rolle geschlüpft war. Es wäre inakzeptabel und ärgerlich gewesen.
Mrs Pontellier hatte ihre Malutensilien mitgebracht, mit denen sie sich zuweilen aus reiner Liebhaberei und völlig unprofessionell beschäftigte. Sie mochte dieses Dilettieren. Sie empfand dabei eine Befriedigung, wie sie ihr keine andere Beschäftigung zu geben vermochte.
Sie hatte sich schon lange einmal an Madame Ratignolle versuchen wollen. Nie war ihr diese Dame als Objekt verlockender erschienen denn in diesem Augenblick, da sie wie eine sinnliche Madonna dasaß und das warme Licht des zu Ende gehenden Tages ihre wunderbare Ausstrahlung noch betonte.
Robert wechselte auf die andere Seite hinüber und setzte sich auf die Stufe unterhalb von Mrs Pontellier, damit er ihr beim Arbeiten zusehen konnte. Sie führte die Pinsel mit einer Leichtigkeit und Ungezwungenheit, die nicht aus lang vertrautem Umgang mit ihnen herrührten, sondern einer natürlichen Begabung entsprangen. Robert verfolgte ihre Arbeit mit großer Aufmerksamkeit; immer wieder äußerte er seine Bewunderung in anerkennenden Ausrufen, die er auf Französisch an Madame Ratignolle richtete. »Mais ce n’est pas mal! Elle s’y connaît, elle a de la force, oui.«18
In selbstvergessene Betrachtung versunken, lehnte er einmal seinen Kopf sacht gegen Mrs Pontelliers Arm. Genauso sanft stieß sie ihn zurück. Noch einmal machte er sich des gleichen Vergehens schuldig. Auch wenn sie es nur für eine Gedankenlosigkeit seinerseits halten konnte, war dies dennoch kein Grund, es zuzulassen. Sie machte ihm keine Vorhaltungen, sondern stieß ihn nur erneut sacht, aber entschieden zurück. Er hielt es nicht für nötig, sich zu entschuldigen.
Das fertige Bild wies keinerlei Ähnlichkeit mit Madame Ratignolle auf. Mrs Pontellier war tief enttäuscht, als sie feststellte, dass es ihrer Freundin nicht glich. Aber es war eine recht ansprechende Arbeit und in vielerlei Hinsicht zufriedenstellend.
Mrs Pontellier war offensichtlich anderer Meinung. Nachdem sie die Skizze kritisch begutachtet hatte, zog sie einen breiten Farbstrich darüber und zerknüllte das Papier mit beiden Händen.
Die Jungen kamen die Stufen heraufgestolpert, das farbige Kindermädchen folgte in dem respektvollen Abstand, den einzuhalten sie von ihm verlangten. Mrs Pontellier trug ihnen auf, ihre Farben und Malsachen ins Haus zu bringen. Sie wollte noch ein wenig mit ihnen plaudern und scherzen, doch die beiden blieben völlig ernst. Sie waren nur gekommen, um den Inhalt der Bonbonniere zu prüfen. Ohne Murren gaben sie sich mit dem zufrieden, was ihre Mutter ihnen in die rundlichen Händchen legte, die sie ihr in der eitlen Hoffnung, sie könnten gefüllt werden, wie eine Schöpfkelle entgegenstreckten; dann machten sie sich gleich wieder davon. Die Sonne stand tief im Westen, und die Brise, die sanft vom Süden heraufwehte, war einschläfernd schwül und schwer vom verführerischen Duft des Meeres. Kinder, gerade erst in frische Rüschenröckchen und -hemden gesteckt, versammelten sich zum Spielen unter den Eichen. Ihre Stimmen waren schrill und durchdringend.
Madame Ratignolle faltete ihre Näharbeit zusammen, legte Fingerhut, Schere und Faden ordentlich in die Stoffrolle und verschloss diese sorgfältig mit einer Nadel. Sie klagte über plötzliche Mattigkeit. Mrs Pontellier holte eilends Kölnischwasser und einen Fächer. Sie betupfte Madame Ratignolles Gesicht mit Kölnisch, während Robert den Fächer mit unnötiger Heftigkeit hin und her bewegte.
Der Anfall ging rasch vorüber, und Mrs Pontellier fragte sich, ob nicht ein wenig Einbildung im Spiel gewesen sein mochte, denn die rosige Farbe war zu keinem Zeitpunkt aus dem Gesicht ihrer Freundin gewichen.
Sie stand da und sah der schönen Frau nach, die mit einer Anmut, wie sie Königinnen zuweilen nachgesagt wird, und majestätischer Würde die lange Reihe der Galerien hinunterschritt. Ihre Kinder kamen ihr entgegengelaufen. Zwei von ihnen klammerten sich an ihre weißen Röcke, das dritte nahm sie dem Kindermädchen ab und trug es unter tausend Liebkosungen in ihren eigenen zärtlichen, schützenden Armen weiter. Und dies, obwohl der Arzt, wie jedermann wusste, ihr verboten hatte, auch nur eine Nadel aufzuheben!
»Gehen Sie baden?«, fragte Robert Mrs Pontellier. Es war weniger eine Frage als eine Erinnerung.
»Ach nein«, antwortete sie in unentschlossenem Ton. »Ich bin müde; ich glaube, ich gehe nicht.« Ihr Blick wanderte von seinem Gesicht hinunter zum Golf, dessen sonores Murmeln wie eine liebevolle, aber eindringliche Aufforderung an ihr Ohr drang.
»Ach, kommen Sie doch!«, drängte er sie. »Sie dürfen Ihr Bad nicht versäumen. Kommen Sie. Das Wasser muss herrlich sein; es wird Ihnen nicht schaden. So kommen Sie doch.«
Er griff nach ihrem großen, groben Strohhut, der an einem Haken vor der Tür hing, und setzte ihn ihr auf. Dann gingen sie die Stufen hinunter und spazierten zusammen in Richtung Strand. Die Sonne stand tief im Westen, die Brise war sanft und warm.
VI
Edna Pontellier hätte nicht sagen können, warum sie es zunächst ablehnte, mit Robert zum Strand zu gehen, obwohl sie den Wunsch dazu verspürte, um dann doch im nächsten Augenblick dem anderen der beiden widersprüchlichen Impulse in ihr zu gehorchen.
Ein schwaches Licht begann in ihr aufzuflackern – das Licht, das den Weg zwar erkennen lässt, sein Beschreiten aber gleichzeitig verbietet.
In dieser frühen Phase trug dieses Licht nur dazu bei, sie zu verwirren. Es verführte sie zum Träumen, ließ sie in Nachdenklichkeit versinken, stürzte sie in die schattenhafte Angst, von der sie in der Nacht übermannt worden war, als sie ihren Tränen freien Lauf gelassen hatte.
Kurz, Mrs Pontellier begann sich ihrer Stellung als menschliches Wesen im Universum bewusst zu werden, ihre Beziehungen als Individuum zur Welt in ihr und um sie herum zu erkennen. Dies mag als gewaltige Last an Erkenntnis erscheinen, die sich da auf die Seele einer jungen Frau von achtundzwanzig Jahren herabsenkte – vielleicht mehr an Erkenntnis, als der Heilige Geist normalerweise einer Frau zu gewähren geruht.
Doch der Anfang aller Dinge, und insbesondere einer Welt, ist notwendigerweise diffus, verworren, chaotisch und außerordentlich beunruhigend. Wie wenige von uns kommen jemals über einen solchen Anfang hinaus! Wie viele Seelen gehen in seinen Wirren zugrunde!
Die Stimme der See ist verführerisch; ohne Unterlass, flüsternd, tosend oder murmelnd, lädt sie die Seele ein, für kurze Zeit in Abgründen der Einsamkeit zu wandeln, sich in Irrgärten nachdenklicher Betrachtung zu verlieren.
Die Stimme der See spricht zur Seele. Die Berührung der See ist sinnlich, wenn sie den Körper in sanfter, inniger Umarmung umschließt.
VII
Mrs Pontellier war keine Frau, die zu Vertraulichkeiten neigte; diese Eigenschaft war bisher ihrer Natur zuwidergelaufen. Bereits als Kind hatte sie ihr eigenes kleines Leben ganz in ihrem Inneren geführt. Sehr früh schon hatte sie instinktiv begriffen, dass es zwei Leben gibt – jenes äußere, das sich anpasst, und das innere, das alles hinterfragt.