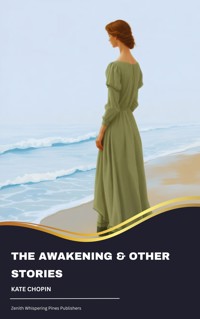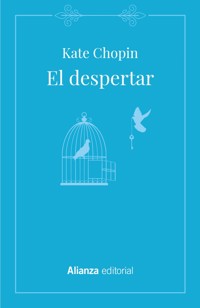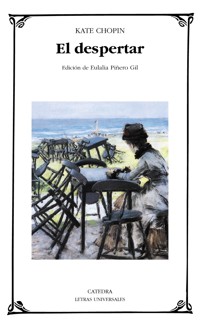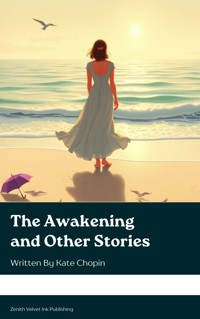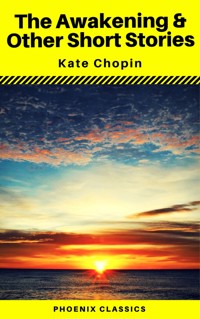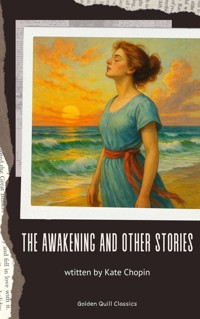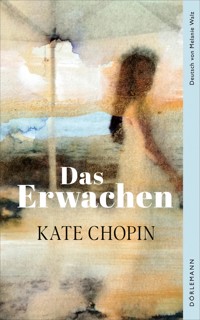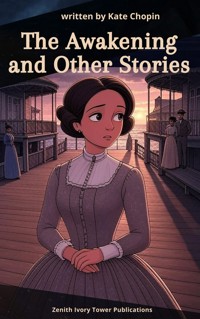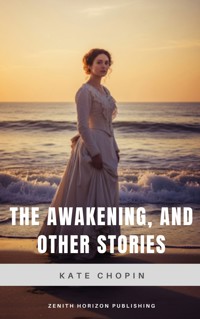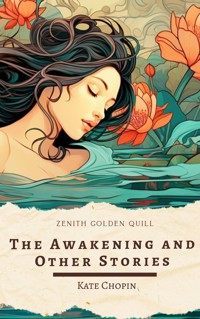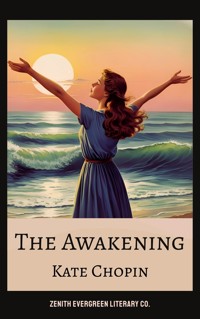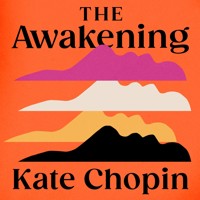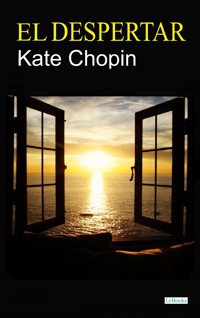Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition fünf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: edition fünf
- Sprache: Deutsch
Sommerfrische am Meer, Ende des 19. Jahrhunderts: Mit 28 Jahren ist Edna Pontellier längst Ehefrau und Mutter. Ihre Ehe scheint harmonisch, das Leben geordnet. Doch dann leistet ihr der aufmerksame Robert Gesellschaft, und Edna verliebt sich. Als die beiden ihre Gefühle füreinander entdecken, flieht der junge Mann erschrocken auf eine Geschäftsreise. Edna wartet vergeblich auf Post. Alleingelassen kehrt sie in die Stadt zurück und lässt alle gesellschaftlichen Konventionen hinter sich — mit fatalen Folgen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 2 der
Kate Chopin
Das Erwachen
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Becker, Petra Bräutigam, Josefine Carls, Miriam Hansen, Iris Klose, Sibylle Koch-Grünberg, Rita Maier, Heide Schlüpmann, Petra Stein
Mit einem Nachwort von Barbara Vinken
Genehmigte Lizenzausgabe August 2010
© 2010 editionfünfVerlag Silke Weniger, Gräfelfingherausgegeben von Karen Nölle und Christine Gräbe
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 1899 unter dem Titel The Awakening bei H. S. Stone & Co., Chicago und New York, die deutsche Ausgabe 1978 im Verlag Roter Stern, Frankfurt am Main.© der deutschen Übersetzung Stroemfeld Verlag 1978
Neu bearbeitet von Karen Nölle und Christine Gräbe
Gestaltung und Satz Kathleen Bernsdorf, Hamburg
ISBN 978-3-942374-00-2eISBN: 978-3-942374-76-7
www.editionfuenf.de
1—In einem Käfig vor der Tür krächzte unablässig ein grüngelber Papagei:
»Allez vous-en! Allez vous-en! Sapristi! That’s all right!«
Er konnte auch ein wenig Spanisch und noch eine Sprache, die keiner verstand – außer vielleicht der Spottdrossel im Käfig gegenüber, die ihre Melodie mit nervtötender Ausdauer in den Wind hinaus zwitscherte.
Mr Pontellier, der sich nicht in der Lage sah, seine Zeitung in Ruhe zu lesen, erhob sich mit empörter Miene und einem Ausruf der Entrüstung. Er verließ die Veranda und schritt über die schmalen Stege, die den Verbindungsweg zwischen den Cottages der Familie Lebrun bildeten. Gesessen hatte er vor dem Eingang des Haupthauses. Der Papagei und die Spottdrossel gehörten Madame Lebrun, und sie durften so viel lärmen, wie sie wollten. Mr Pontellier seinerseits hatte alles Recht, sich ihrer Gesellschaft zu entziehen, wenn sie nicht länger seiner Unterhaltung dienten.
Vor der Tür zu seinem eigenen Cottage, dem vierten und vorletzten hinter dem Haupthaus, blieb er stehen. Dort setzte er sich in einen Korbschaukelstuhl und nahm sich erneut seine Zeitung vor. Es war Sonntag, die Zeitung war einen Tag alt. Die Sonntagsausgaben waren noch nicht auf Grand Isle eingetroffen. Da er die Börsenberichte bereits kannte, überflog er nun die Kommentare und Meldungen, die er am Vortag vor seiner Abfahrt aus New Orleans noch nicht hatte lesen können.
Mr Pontellier trug eine Brille. Er war ein mittelgroßer, schmächtiger Mann von vierzig Jahren und leicht gebeugter Haltung. Sein glattes braunes Haar war seitlich gescheitelt, der tadellose Bart säuberlich gestutzt.
Von Zeit zu Zeit löste er den Blick von der Zeitung und sah sich um. Im Haupthaus drüben herrschte noch mehr Lärm als gewöhnlich. Es bildete den Mittelpunkt der Anlage und wurde, um es von den Cottages rings um zu unterscheiden, allgemein »das Haus« genannt. Die Vögel schwatzten und zwitscherten immer noch. Zwei junge Mädchen, die Zwillinge der Farivals, spielten auf dem Klavier ein Duett aus »Zampa«. Und Madame Lebrun, die sich unentwegt drinnen und draußen zu schaffen machte, erteilte regelmäßig schrille Befehle: dem Burschen im Garten, wenn sie gerade im Haus war, und dem Tischdiener im Speisesaal, wenn sie draußen war. Sie war eine lebhafte, hübsche Frau, die stets weiße Kleider mit großen Puffärmeln trug. Ihre gestärkten Röcke raschelten bei jeder Bewegung. Etwas näher, vor einem der Cottages, schritt ernst eine Dame in Schwarz auf und ab, die einen Rosenkranz murmelte. Einige Feriengäste waren in Beaudelets Boot nach Chênière Caminada zur Messe übergesetzt. Unter den Moor-eichen spielten ein paar Kinder Krocket. So auch Mr Pontelliers Söhne, zwei stämmige kleine Knaben von vier und fünf. Ihr Kindermädchen, eine quadroon, beaufsichtigte sie mit abwesender, gedankenverlorener Miene.
Schließlich zündete sich Mr Pontellier eine Zigarre an und ließ die Zeitung vom Schoß gleiten. Er heftete seinen Blick auf einen weißen Sonnenschirm, der sich im Schneckentempo vom Strand heranbewegte. Zwischen den kahlen Stämmen der Mooreichen und über den Streifen gelber Kamille hinweg war er gut zu erkennen. Das Meer dahinter schien weit entfernt und verschwamm mit dem diesigen Blau des Horizonts. Der Sonnenschirm kam stetig, aber langsam näher. Unter seinem rosa gesäumten, schützenden Dach gingen seine Frau, Mrs Pontellier, und der junge Robert Lebrun. Als sie das Cottage erreichten, setzten sie sich, offenkundig erschöpft, auf die oberste Stufe der Veranda und lehnten sich einander zugewandt rechts und links an die Pfosten.
»Was für ein Unfug! Um diese Tageszeit und bei dieser Hitze zu baden!«, rief Mr Pontellier. Er selbst war bei Tagesanbruch im Meer gewesen. Deshalb erschien ihm der Vormittag so lang.
»Dein Sonnenbrand spottet jeder Beschreibung«, fügte er hinzu und bedachte seine Frau mit einem abschätzigen Blick wie ein wertvolles Stück persönlichen Eigentums, das Schaden genommen hat. Sie schob ihre Musselinärmel zurück, hob ihre schönen, starken Hände und betrachtete sie prüfend. Dabei entsann sie sich der Ringe, die sie ihrem Mann vor dem Aufbruch zum Strand gegeben hatte. Stumm streckte sie ihm die Hand entgegen, und er verstand die Geste, nahm die Ringe aus der Westentasche und ließ sie in ihre geöffnete Hand fallen. Sie steckte sie sich an, umschlang ihre Knie und fing, mit einem Blick zu Robert hinüber, an zu lachen. Die Ringe blitzten an ihren Fingern. Robert antwortete mit einem Lächeln.
»Was ist?«, fragte Pontellier und betrachtete die beiden träge und amüsiert. Es ging um irgendeine Nichtigkeit, irgendein kleines Abenteuer draußen im Wasser, und beide versuchten gleichzeitig, es wiederzugeben. Es schien im Nachhinein nicht mehr halb so amüsant. Das merkten beide, und Mr Pontellier auch. Er gähnte und streckte sich. Dann stand er auf und verkündete, er habe nicht übel Lust auf eine Runde Billard, drüben in Kleins Hotel.
»Kommen Sie doch mit, Lebrun«, schlug er vor. Doch Robert gestand frei heraus, noch zu bleiben zu wollen, um sich mit Mrs Pontellier zu unterhalten.
»Nun denn, schick ihn fort, wenn er dich langweilt, Edna«, befahl ihr Gatte und wandte sich zum Gehen.
»Hier, nimm den Sonnenschirm«, rief sie und hielt ihm den Schirm hin. Er nahm ihn, spannte ihn auf, während er die Treppe hinunterging, und machte sich auf den Weg.
»Kommst du zum Mittagessen?«, rief seine Frau ihm hinterher. Mr Pontellier hielt einen Moment inne und zuckte die Achseln. Er griff in seine Westentasche und fand eine Zehn-Dollar-Note. Er wusste es nicht: Vielleicht würde er zum Mittagessen wiederkommen, vielleicht auch nicht. Das hing von der Gesellschaft ab, die er bei Kleins antraf, und von dem Spiel, das dort lief. Er sprach das nicht aus, aber sie verstand es, lachte und nickte ihm zum Abschied zu.
Beide Kinder wollten ihren Vater begleiten, als sie ihn aufbrechen sahen. Er gab ihnen einen Kuss und versprach ihnen, Bonbons und Erdnüsse mitzubringen.
2—Mrs Pontelliers Augen waren flink und klar und von einem ähnlichen Goldbraun wie ihre Haare. Sie hatte die Gewohnheit, ihren Blick schnell auf etwas zu richten und dort ruhen zu lassen, als habe sie sich in ein inneres Labyrinth von Betrachtungen und Gedanken verloren.
Ihre Brauen waren einen Ton dunkler als ihr Haar. Dicht und beinahe waagerecht betonten sie die Tiefe ihrer Augen. Sie war eher anziehend als schön. Ihr Gesicht bestach durch seine Offenheit und das feine, widersprüchliche Mienenspiel. Und sie hatte eine liebenswürdige Art.
Robert drehte sich eine Zigarette. Er rauche Zigaretten, weil er sich keine Zigarren leisten könne, sagte er. Zwar hatte er in der Tasche eine Zigarre, die ihm Mr Pontellier geschenkt hatte, doch die wollte er sich für nach dem Essen aufbewahren.
Das erschien ihm nur angemessen und natürlich. Sein Teint war dem seiner Begleiterin nicht unähnlich. Das glattrasierte Gesicht betonte die Ähnlichkeit noch. Auf seiner offenen Miene lag nicht der Schatten einer Sorge. Seine Augen sammelten und reflektierten das Licht und die Wärme des Sommertages.
Mrs Pontellier angelte sich einen Palmwedel vom Boden der Veranda und begann sich Luft zuzufächeln, während Robert kleine Rauchwölkchen ausstieß. Sie plauderten in einem fort: über in ihre Umgebung, über das amüsante Erlebnis draußen im Wasser – es hatte seinen ursprünglichen Reiz wiedergewonnen –, über den Wind, die Bäume, die Leute, die zur Chênière gefahren waren; über die Kinder, die unter den Eichen Krocket spielten, und die Zwillinge der Farivals, die jetzt die Ouvertüre zu »Dichter und Bauer« zum Besten gaben. Robert sprach recht viel von sich. Er war sehr jung und wusste es nicht besser. Aus dem gleichen Grund erzählte Mrs Pontellier recht wenig von sich. Beide waren interessiert an dem, was der andere sagte. Robert sprach von seiner Absicht, im Herbst nach Mexiko zu gehen, weil er dort sein Glück versuchen wolle. Er hatte schon länger vor, nach Mexiko zu gehen, aber irgendwie kam es nie dazu. Derweil hielt er an seiner bescheidenen Stellung in einem Handelshaus in New Orleans fest, wo ihm die Tatsache, dass er die englische, französische und spanische Sprache gleichermaßen gut beherrschte, zu nicht geringem Ansehen als Kontorist und Korrespondent verhalf.
Wie jedes Jahr verlebte er seine Sommerferien bei seiner Mutter auf Grand Isle. Früher, Robert konnte sich an diese Zeit nicht erinnern, war »das Haus« die Sommerresidenz der Lebruns gewesen. Jetzt war es von einem Dutzend oder mehr kleiner Cottages flankiert, die ständig mit exklusiven Gästen aus dem »Quartier Français« besetzt waren und es Madame Lebrun ermöglichten, auch weiterhin das angenehme, sorgenfreie Leben zu führen, zu dem sie offenbar geboren war.
Mrs Pontellier erzählte von der Plantage ihres Vaters in Mississippi und von ihrer Kindheit im Bluegrass-Gebiet des alten Kentucky. Sie war Amerikanerin mit einem Schuss französischen Bluts, das sich nach Generationen verwässert zu haben schien. Sie las einen Brief ihrer Schwester vor, die im Osten lebte und sich soeben verlobt hatte. Robert fragte interessiert, was für Charaktere die beiden Schwestern seien, was für ein Mensch ihr Vater, und wie lange ihre Mutter schon tot sei.
Als Mrs Pontellier den Brief wieder zusammenfaltete, war es Zeit, sich zum Essen umzuziehen.
»Wie ich sehe, kommt Léonce nicht zurück«, sagte sie mit einem Blick in die Richtung, in die ihr Gatte entschwunden war. Robert pflichtete ihr bei, da sich drüben bei Kleins eine ganze Reihe Clubfreunde aus New Orleans zusammengefunden hatten.
Als Mrs Pontellier ihn verließ, um in ihr Zimmer zu gehen, stieg der junge Mann die Treppe hinunter und schlenderte zu den Krocketspielern, wo er sich die halbe Stunde vor dem Essen mit den beiden Jungen der Pontelliers vertrieb, die ihn sehr gern hatten.
3—Es war elf Uhr nachts, als Mr Pontellier aus Kleins Hotel zurückkehrte. Er war glänzender Laune, in Hochstimmung und zum Reden aufgelegt. Als er hereinkam, weckte er seine Frau, die schon ins Bett gegangen war und fest schlief. Während er sich auszog, erzählte er ihr Anekdoten, kleine Neuigkeiten und Klatsch, den er im Laufe des Tages mitbekommen hatte. Seinen Hosentaschen entnahm er eine Handvoll zerknüllter Banknoten und viele Silbermünzen, die er auf die Kommode häufte, zusammen mit Schlüsseln, Messer, Taschentuch und allem anderen, was sich gerade in seinen Taschen befand. Seine schlaftrunkene Frau antwortete ihm nur in unzusammenhängenden Halbsätzen.
Er fand es sehr enttäuschend, dass sie, die doch sein Ein und Alles war, so wenig Interesse für seine Angelegenheiten aufbrachte und das Gespräch mit ihm so wenig schätzte.
Die Bonbons und Erdnüsse für die Kinder hatte Mr Pontellier vergessen. Gleichwohl liebte er sie sehr und ging ins Nebenzimmer, wo sie schliefen, um nach ihnen zu schauen und sich zu vergewissern, dass sie friedlich ruhten. Das Ergebnis seiner Untersuchung war alles andere als zufriedenstellend. Er schob und drehte die Kleinen in ihren Betten herum. Einer seiner Söhne begann zu strampeln und von einem Korb voller Krebse zu reden.
Mr Pontellier kehrte mit der Mitteilung zu seiner Frau zurück, Raoul habe hohes Fieber und man müsse nach ihm sehen. Dann zündete er sich eine Zigarre an und setzte sich zum Rauchen an die offene Tür.
Mrs Pontellier war nahezu sicher, dass Raoul kein Fieber hatte. Er sei beim Zubettgehen absolut wohlauf gewesen, sagte sie, und auch tagsüber habe ihm nicht das Geringste gefehlt. Mr Pontellier hingegen war zu gut mit Fiebersymptomen vertraut, um sich zu irren. Er versicherte ihr, das Kind ringe in diesem Moment im Nebenzimmer mit dem Tod. Seiner Frau warf er Unaufmerksamkeit und ständige Vernachlässigung der Kinder vor. Wenn es nicht die Aufgabe der Mutter sei, die Kinder zu versorgen, wessen um Himmels willen denn sonst? Er selbst habe mit seinem Börsenmaklergeschäft alle Hände voll zu tun. Er könne nicht an zwei Orten zugleich sein: unterwegs, um den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen, und zu Hause, um aufzupassen, dass sie keinen Schaden nahmen. Seine Stimme war monoton und eindringlich.
Mrs Pontellier sprang aus dem Bett und ging ins Nebenzimmer. Bald darauf kehrte sie zurück, setzte sich auf die Bettkante und legte ihren Kopf auf das Kissen. Sie sagte nichts und verweigerte die Antwort auf die Fragen ihres Mannes. Als seine Zigarre aufgeraucht war, legte er sich ins Bett und war nach einer halben Minute fest eingeschlafen.
Doch Mrs Pontellier war mittlerweile hellwach. Sie weinte ein wenig und trocknete ihre Tränen am Ärmel ihres Morgenmantels. Dann blies sie die Kerze aus, die ihr Mann hatte brennen lassen, schlüpfte in ein Paar Seidenpantoffeln am Fußende des Bettes und ging auf die Veranda hinaus, wo sie sich in den Korbstuhl setzte und sachte hin und her zu schaukeln begann.
Es war nach Mitternacht. Alle Cottages lagen im Dunkel. Nur im Flur des Haupthauses brannte ein schwaches Licht. Weit und breit war kein Laut zu hören, nur der Schrei einer alten Eule im Wipfel einer Mooreiche und die ewige Stimme des Meeres, die zu dieser stillen Stunde nur sanft erhoben war. Wie ein trauriges Schlaflied drang sie durch die Nacht.
Die Tränen stiegen so schnell in Mrs Pontelliers Augen, dass der feuchte Ärmel des Morgenmantels zum Trocknen nicht mehr ausreichte. Sie legte den Arm auf die Rückenlehne des Schaukelstuhls; ihr weiter Ärmel glitt fast bis zur Schulter zurück. Nun drückte sie ihr feuchtes, heißes Gesicht in die Armbeuge und ließ den Tränen freien Lauf, ohne sie noch zu trocknen. Sie hätte nicht sagen können, weshalb sie weinte. Begebenheiten wie die vorangegangene waren in ihrem Eheleben nichts Ungewöhnliches, doch bislang waren sie gegen die große Güte und die gleichbleibende Zuneigung ihres Mannes, die er ihr stillschweigend und selbstverständlich entgegenbrachte, noch nie ins Gewicht gefallen.
Ein unbeschreiblicher Kummer, der in einem verborgenen Bereich ihres Bewusstseins zu entstehen schien, erfüllte sie mit namenloser Angst. Es war, als legte sich ein Schatten, ein Nebel, auf den Sommertag ihrer Seele. Ein seltsames, unbekanntes Gefühl, eine Anwandlung. Sie saß nicht da und schimpfte innerlich auf ihren Mann oder beklagte das Schicksal, das ihre Schritte auf den Weg gelenkt hatte, den sie gegangen war. Sie weinte sich nur einmal richtig aus. Die Moskitos machten sich über sie her, stachen sie in die festen, runden Arme und in die bloßen Füße.
Die kleinen stechenden, summenden Quälgeister brachten es fertig, die Stimmung zu vertreiben, die sie sonst womöglich eine halbe Nacht lang dort in der Dunkelheit gehalten hätte.
Am nächsten Morgen stand Mr Pontellier rechtzeitig auf, um die Kutsche zu erreichen, die ihn zum Dampfer am Landeplatz befördern sollte. Er wollte zu seinen Geschäften in die Stadt zurückkehren, auf der Insel würde man ihn vor dem kommenden Samstag nicht wiedersehen. Seine Gemütsruhe, die in der vergangenen Nacht etwas angeschlagen schien, war wiederhergestellt. Er freute sich auf eine lebhafte Woche in der Carondolet Street und hatte es eilig, wegzukommen.
Mr Pontellier gab seiner Frau die Hälfte des Geldes, das er am Abend zuvor in Kleins Hotel gewonnen hatte. Wie die meisten Frauen schätzte sie Geld und nahm es nicht ohne Genugtuung entgegen.
»Das wird ein hübsches Hochzeitsgeschenk für Janet geben!«, rief sie aus, während sie die Banknoten glatt strich und zählte.
»Oh, deine Schwester wird von uns etwas Besseres bekommen, mein Liebes«, lachte er und schickte sich an, sie zum Abschied zu küssen.
Die Kinder tollten herum, hängten sich an seine Beine, bettelten, er möge ihnen allerlei mitbringen, wenn er wiederkomme. Mr Pontellier war sehr beliebt, und Damen, Herren, Kinder und sogar deren Kinderfrauen ließen es sich nie nehmen, ihn zu verabschieden. Seine Frau winkte ihm lächelnd nach, die Söhne johlten, als er in der alten Kutsche die sandige Straße hinunter verschwand.
Ein paar Tage darauf traf ein Paket aus New Orleans für Mrs Pontellier ein. Es war von ihrem Gatten und enthielt allerlei friandises, herrliche Delikatessen: feinste Früchte, pâtés, ein paar erlesene Flaschen, köstlichen Sirup und Bonbons im Überfluss.
Mrs Pontellier verfuhr mit dem Inhalt eines solchen Pakets stets sehr großzügig, denn sie erhielt dergleichen regelmäßig, wenn sie verreist war. Die pâtés und Früchte wurden in den Speisesaal gebracht, die Bonbons rundherum angeboten. Und die Damen, die mit spitzen Fingern sorgfältig, und ein wenig gierig, ihre Auswahl trafen, erklärten einhellig, Mr Pontellier sei der beste Ehemann der Welt. Mrs Pontellier musste zugeben, dass sie keinen besseren kenne.
4—Mr Pontellier hätte sich selbst oder anderen nur schwer zu erklären vermocht, worin seine Frau ihren Pflichten den Kindern gegenüber nicht genügte. Es war eher ein Gefühl, als dass er es hätte festmachen machen können, und er äußerte es nie ohne spätere Reue und Versöhnungsgesten.
Wenn einer der kleinen Pontelliers beim Spielen hinfiel, warf er sich in der Regel nicht weinend in die Arme seiner Mutter, um sich trösten zu lassen. Eher raffte er sich wieder auf, wischte sich die Tränen aus den Augen und den Sand aus dem Mund und spielte weiter. So klein sie waren, bissen sie die Zähne zusammen und behaupteten sich in kindlichen Raufereien mit geballten Fäusten und so lautstark, dass sie gewöhnlich die anderen Muttersöhnchen übertönten. Die Kinderfrau wurde als lästiger Anhang empfunden, zu nichts anderem gut, als Knöpfe an Leibchen und Hosen zu schließen und Haare zu bürsten und zu scheiteln, da es nun einmal ein unumstößliches Gesetz der Gesellschaft zu sein schien, dass Haare gescheitelt und gebürstet waren.
Kurzum, Mrs Pontellier gehörte nicht zu den mütterlichen Frauen, die diesen Sommer auf Grand Isle in der Überzahl zu sein schienen. Sie waren leicht zu erkennen, wie sie mit ausgebreiteten, schützenden Flügeln umherflatterten, wenn eine Gefahr, ob real oder eingebildet, ihre teure Brut bedrohte. Diese Frauen vergötterten ihre Kinder, lagen ihren Ehemännern zu Füßen und empfanden es als heilige Ehre, sich als Individuen auszulöschen und Engelsflügel wachsen zu lassen.
Vielen von ihnen stand diese Rolle gut; eine war die Verkörperung weiblicher Anmut und weiblichen Charmes schlechthin. Ein Ehemann, der sie nicht verehrte, wäre ein Rohling und verdiente den Tod durch langsame Folter. Ihr Name war Adèle Ratignolle. Es gibt keine Worte, sie zu beschreiben, außer den alten, die schon so oft dazu gedient haben, die romantische Heldin vergangener Zeiten oder die Angebetete unserer Träume darzustellen. Ihr Liebreiz hatte nichts Raffiniertes oder Verborgenes. Ihre strahlende Schönheit lag offen zu Tage; das goldgesponnene Haar, das nicht durch Kamm noch Klammer zu bändigen war; die blauen Augen, die allein Saphiren vergleichbar waren; volle Lippen, die so rot waren, dass man sich bei ihrem Anblick an Kirschen oder eine andere köstliche karmesinrote Frucht erinnert fühlte. Dass sie ein wenig rundlich wurde, schien der Anmut ihrer Gesten, Posen, Schritte nicht das Geringste anzuhaben. Man hätte sich ihren weißen Hals nicht einen Deut weniger voll und ihre schönen Arme nicht schlanker gewünscht. Niemals hatte es feinere Hände gegeben als ihre, und es war eine Freude zu sehen, wie sie ihre Nadel einfädelte oder den goldenen Fingerhut auf ihrem Mittelfinger zurechtrückte, wenn sie einen Schlafanzug oder ein Leibchen oder Lätzchen nähte.
Madame Ratignolle hatte Mrs Pontellier sehr gerne und setzte sich oft nachmittags mit ihrer Näharbeit zu ihr. Auch an dem Nachmittag, als das Paket aus New Orleans ankam, saßen sie zusammen. Sie hatte den Schaukelstuhl in Beschlag genommen und nähte eifrig an einem winzigen Schlafanzug. Das Schnittmuster hatte sie Mrs Pontellier zum Ausschneiden mitgebracht – ein äußerst praktisches Kleidungsstück, in dem ein Kind so rundherum verpackt wurde, dass nur die kleinen Augen herausschauten wie bei einem Eskimo. Es war für den Winter gedacht, wenn tückische Zugluft aus den Kaminen strömte und der tödliche Hauch eisiger Kälte durch die Schlüssellöcher drang.
Mrs Pontellier sah eigentlich keinen Anlass, sich über die materiellen Bedürfnisse ihrer Kinder Gedanken zu machen, und wusste nicht recht, warum sie Nachtkleider für den Winter zum Gegenstand ihrer sommerlichen Überlegungen machen sollte. Aber weil sie nicht unfreundlich und desinteressiert erscheinen wollte, hatte sie Zeitungen hervorgeholt, sie auf dem Boden der Veranda ausgebreitet und unter Madame Ratignolles Anleitung ein Muster für das schützende Kleidungsstück ausgeschnitten.
Robert war bei ihnen, auf seinem Platz vom vergangenen Sonntag. Auch Mrs Pontellier saß wieder auf der obersten Stufe, matt gegen einen Pfosten gelehnt. Neben ihr stand die Bonbonschachtel, die sie von Zeit zu Zeit Madame Ratignolle hinhielt.
Dieser fiel es offenbar schwer, eine Auswahl zu treffen, doch schließlich entschied sie sich für eine Nougatstange, wobei sie allerdings Zweifel äußerte, ob sie nicht zu schwer und süß sei, ihr möglicherweise nicht bekomme. Madame Ratignolle war sieben Jahre verheiratet. Ungefähr alle zwei Jahre bekam sie ein Kind. Derzeit hatte sie drei und begann an ein viertes zu denken. Sie sprach ständig von ihrem »Zustand«. Ihr »Zustand« war keineswegs offensichtlich, niemand hätte etwas davon geahnt, hätte sie ihn nicht mit Beharrlichkeit zum Gesprächsthema gemacht.
Robert setzte an, ihr zu versichern, dass er eine Dame kannte, die sich ausschließlich von Nougat ernährt habe, als sie –, aber als er die Röte in Mrs Pontelliers Gesicht aufsteigen sah, brach er ab und wechselte das Thema.
Mrs Pontellier fühlte sich, obwohl mit einem Kreolen verheiratet, in kreolischer Gesellschaft nicht eigentlich zu Hause, und noch nie hatte sie auf so vertrautem Fuße mit den Leuten gelebt. In diesem Sommer waren ausschließlich Kreolen bei den Lebruns. Sie kannten einander und waren wie eine große Familie, in der die freundschaftlichsten Verhältnisse herrschen. Die Eigenschaft, die Mrs Pontellier am stärksten beeindruckte, war das Fehlen jeglicher Prüderie. Anfangs hatte sie sich mit der freien Ausdrucksweise schwer getan, obwohl es ihr andererseits keine Probleme bereitete, sie mit der erhabenen Keuschheit in Einklang zu bringen, die der kreolischen Frau angeboren und ihr untrügliches Kennzeichen zu sein schien.
Niemals würde Edna Pontellier vergessen, wie schockiert sie war, als sie mitangehört hatte, wie Madame Ratignolle dem alten Monsieur Farival die entsetzliche Geschichte einer ihrer Niederkünfte anvertraute, ohne auch nur ein vertrauliches Detail auszulassen. Sie gewöhnte sich langsam an ähnliche Schocks, konnte aber nicht verhindern, dass ihr jedes Mal die Röte in die Wangen stieg. Mehr als einmal hatte ihr Hinzukommen eine der komischen Geschichten unterbrochen, mit der Robert einen amüsierten Kreis verheirateter Frauen unterhielt. Ein Buch hatte in der Ferienkolonie die Runde gemacht.
Als es in ihre Hände kam, las sie es mit tiefem Erstaunen. Sie fühlte sich versucht, das Buch heimlich und für sich allein zu lesen – es beim Geräusch nahender Schritte zu verstecken, obwohl das sonst niemand getan hatte. Es wurde offen kritisiert und bei Tisch frei diskutiert. Mrs Pontellier hörte auf zu staunen und sagte sich, dass der Wunder kein Ende sei.
5—Sie bildeten eine harmonische Gruppe, wie sie an jenem Sommertag beisammensaßen – Madame Ratignolle nähend, aber dabei oft innehaltend, um mit ausdrucksvollen Gesten ihrer wohlgeformten Hände eine Geschichte oder Begebenheit zu verdeutlichen; Robert und Mrs Pontellier, untätig, gelegentlich ein Wort wechselnd und sich Blicke oder Lächeln zuwerfend, die ein schon fortgeschrittenes Stadium der Intimität und camaraderie anzeigten.
Robert war während des vergangenen Monats ihr ständiger Begleiter gewesen. Niemand dachte sich etwas dabei. Viele hatten schon vor seiner Ankunft vermutet, dass er sich Mrs Pontelliers annehmen würde. Seit seinem fünfzehnten Lebensjahr, das elf Jahre zurücklag, hatte sich Robert jeden Sommer auf Grand Isle zum treuen Gefährten einer schönen Dame oder jungen Frau gemacht. Manchmal war es ein junges Mädchen, dann wieder eine Witwe, sehr oft aber eine interessante verheiratete Frau.
Zwei aufeinanderfolgende Sommer hatte er in der Sonne Mademoiselle Duvignés gelebt. Doch dann war sie zwischen zwei Sommern gestorben; Robert gab sich untröstlich, warf sich unterwürfig Madame Ratignolle zu Füßen und war dankbar für jeden Brosamen Sympathie und Trost, den sie ihm zu gewähren geruhte.
Mrs Pontellier saß gerne da und schaute ihre schöne Freundin an, gerade so, wie sie eine makellose Madonna betrachtet hätte.
»Könnte sich irgendjemand vorstellen, welche Grausamkeit sich hinter diesem schönen Äußeren verbirgt?«, murmelte Robert. »Sie wusste, dass ich sie verehrte, und ließ zu, dass ich sie verehrte. Immer hieß es: ›Robert, kommen Sie, gehen Sie, stehen Sie auf, setzen Sie sich, tun Sie dies, tun Sie das, sehen Sie nach, ob das Baby schläft, meinen Fingerhut bitte, den ich Gott weiß wo liegen gelassen habe. Kommen Sie und lesen Sie mir aus Daudet vor, während ich nähe.‹«
»Par exemple! Ich musste niemals fragen. Sie strichen immer um mich herum wie eine lästige Katze.«
»Sie meinen, wie ein ergebener Hund. Und immer, wenn Ratignolle die Szene betrat, wurde ich wirklich zum Hund. Passez! Adieu! Allez vous-en!«
»Vielleicht fürchtete ich, Alphonse eifersüchtig zu machen«, warf sie mit übertriebener Naivität ein. Alle lachten. Die rechte Hand eifersüchtig auf die linke! Das Herz eifersüchtig auf die Seele! Doch der kreolische Ehemann kennt keine Eifersucht; bei ihm ist diese zehrende Leidenschaft durch Nichtbeanspruchung verkümmert.
An Mrs Pontellier gewandt erzählte Robert weiter von seiner einst hoffnungslosen Leidenschaft für Madame Ratignolle, von schlaflosen Nächten, von Flammen so heiß, dass das Meer zischte, wenn er sein tägliches Bad nahm. Die Dame mit der Nadel kommentierte das spöttisch:
»Blagueur – farceur – gros bête, va!«
Wenn er mit Mrs Pontellier allein war, sprach er nie in diesem halb ernsten, halb scherzenden Ton. Sie wusste nie genau, wie er zu verstehen war; auch jetzt vermochte sie unmöglich einzuschätzen, wie viel Scherz und wie viel Ernst war. Es war deutlich, dass er Madame Ratignolle häufig seine Liebe beteuert hatte, ohne im Geringsten zu erwarten, dass er ernst genommen würde. Mrs Pontellier war froh, dass er ihr gegenüber nicht eine ähnliche Rolle angenommen hatte. Es wäre ihr unangenehm und lästig gewesen.
Mrs Pontellier hatte ihre Malutensilien mitgebracht, denn sie spielte – ohne jeden künstlerischen Anspruch – gern mit Farben und Pinsel. Es machte ihr Freude und erfüllte sie mit einer Befriedigung, die ihr sonst keine Beschäftigung gab.
Lange schon hatte sie sich an Madame Ratignolle versuchen wollen. Nie war ihr diese Dame als Modell verführerischer erschienen als in diesem Augenblick, wo sie dasaß wie eine sinnliche Madonna im Abendlicht, das ihre blühende Farbe noch unterstrich. Robert wechselte den Platz und setzte sich eine Stufe tiefer als Mrs Pontellier, um ihr bei der Arbeit zuzusehen. Sie führte die Pinsel mit einer Leichtigkeit und Freiheit, die nicht von langer und enger Vertrautheit herrührten, sondern von einer natürlichen Begabung. Robert folgte ihrer Arbeit mit großer Aufmerksamkeit und verlieh seiner Bewunderung zuweilen Ausdruck, indem er sich mit kurzen Bemerkungen auf Französisch an Madame Ratignolle wandte.
»Mais ce n’est pas mal! Elle s’y connait, elle a de la force, oui.«
In seiner selbstvergessenen Aufmerksamkeit lehnte er einmal ganz leicht den Kopf gegen Mrs Pontelliers Arm. Ebenso sanft wies sie ihn zurück. Noch einmal wiederholte er sein Vorgehen. Sie konnte dies nur für eine Gedankenlosigkeit seinerseits halten; aber das war kein Grund für sie, es hinzunehmen. Sie sagte nichts, sondern schob ihn nur erneut ruhig, aber bestimmt fort. Er bat nicht um Verzeihung.
Das fertige Bild hatte keine Ähnlichkeit mit Madame Ratignolle. Sie war sehr enttäuscht, dass es ihr nicht glich. Aber es war eine hübsche Arbeit und in vielerlei Hinsicht befriedigend.
Mrs Pontellier dachte offensichtlich anders. Nachdem sie das Bild kritisch gemustert hatte, zog sie einen breiten Pinselstrich quer darüber und zerknüllte das Blatt mit beiden Händen.
Die Kleinen tollten die Treppe hinauf, von der quadroon in gebührlichem Abstand gefolgt. Mrs Pontellier hieß ihre Söhne die Farben und anderen Utensilien ins Haus tragen. Gern hätte sie ein wenig mit ihnen geschwatzt und gescherzt. Aber die Kinder hatten etwas Ernstes im Sinn. Sie waren bloß gekommen, um den Inhalt der Bonbonschachtel zu inspizieren. Ohne Murren nahmen sie entgegen, was ihnen in die rundlichen Hände gegeben wurde, die sie, in der vergeblichen Hoffnung, sie würden gefüllt, weit geöffnet hinhielten; dann liefen sie wieder davon.
Die Sonne stand tief im Westen, die südliche Brise trug sanft und lau den verführerischen Duft des Meeres herbei. Unter den Eichen sammelten sich die frisch umgezogenen Kinder zum Spielen. Ihre Stimmen waren hoch und durchdringend.
Madame Ratignolle legte ihr Nähzeug zusammen und wickelte es mit Fingerhut, Schere und Faden ordentlich zu einer Rolle, die sie sorgsam mit einer Nadel verschloss. Sie klagte über plötzliche Schwäche. Mrs Pontellier eilte nach Kölnisch Wasser und einem Fächer. Sie befeuchtete Madame Ratignolle das Gesicht mit Kölnisch Wasser, während Robert ihr mit unnötiger Heftigkeit zufächelte.
Der Anfall ging schnell vorüber, und Mrs Pontellier konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ein wenig Einbildung mit im Spiel gewesen war, denn die rosige Farbe war keinen Moment aus dem Gesicht ihrer Freundin gewichen.
Sie sah der schönen Frau nach, wie sie mit einer Anmut und Majestät, die man gemeinhin Königinnen nachsagt, über die langen Stege schritt. Ihre Kinder liefen ihr entgegen. Zwei hängten sich an ihre weißen Röcke, das dritte nahm sie der Kinderfrau ab und barg es mit unzähligen Liebkosungen in ihren zärtlichen Armen. Obwohl, wie jedermann wusste, der Arzt ihr verboten hatte, auch nur eine Stecknadel zu heben!
»Gehen Sie baden?«, fragte Robert Mrs Pontellier. Es war weniger eine Frage als eine Erinnerung.
»Ach nein«, antwortete sie mit unentschlossener Stimme.
»Ich bin müde, ich glaube nicht.« Ihr Blick wanderte von seinem Gesicht hinüber zum Golf, dessen leises, tiefes Rauschen sie wie ein liebevolles, aber unnachgiebiges Flehen erreichte.
»Ach, kommen Sie!«, beharrte er. »Sie dürfen Ihr Bad nicht versäumen. Kommen Sie. Das Wasser muss herrlich sein, es wird Ihnen nicht schaden. Kommen Sie doch.«
Er griff nach ihrem großen, einfachen Strohhut, der an einem Haken vor der Tür hing, und setzte ihn ihr auf den Kopf. Sie gingen die Treppe hinunter und schlugen den Weg zum Strand ein. Die Sonne stand tief im Westen, und der Wind war sanft und warm.
6—Edna Pontellier hätte nicht sagen können, warum sie trotz des Wunsches, mit Robert zum Strand zu gehen, erst einmal abgelehnt hatte, um dann im nächsten Augenblick doch dem anderen der beiden widersprüchlichen Impulse in ihr nachzugeben.
In ihr begann ein Licht zu glimmen – ein Licht, das einen Weg wies und ihn gleichzeitig verbot.
In dieser frühen Phase verwirrte es sie nur. Es verführte sie zum Träumen und Grübeln und weckte die unbestimmte Angst, die in jener Nacht über sie gekommen war, als sie sich den Tränen überlassen hatte.