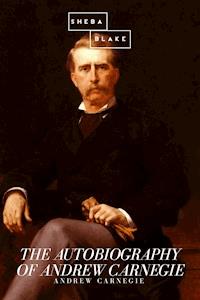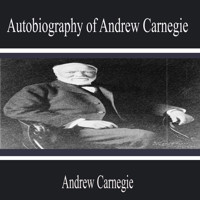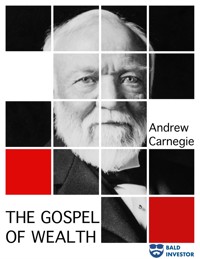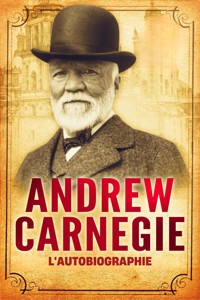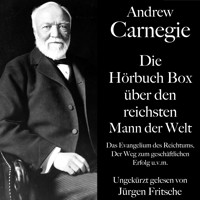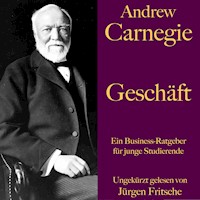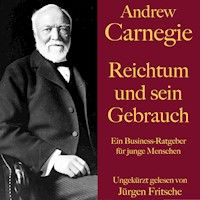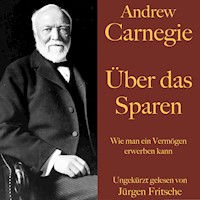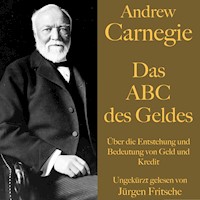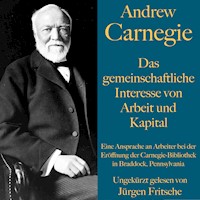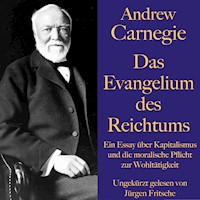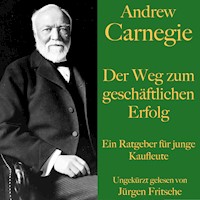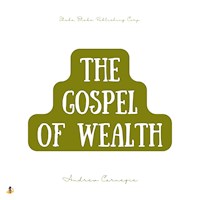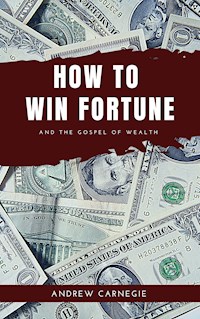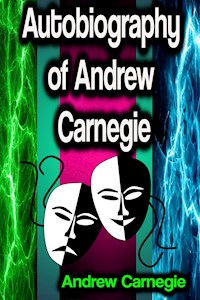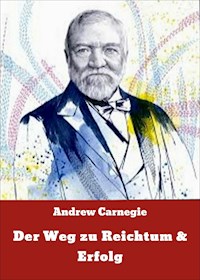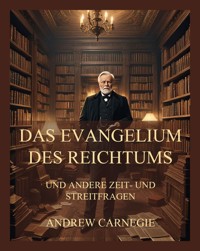
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Das Evangelium des Reichtums" ist ein von Andrew Carnegie im Juni 1889 verfasster Artikel, der die Verantwortung zur Philanthropie durch die neue Oberschicht der amerikanischen Selfmade-Reichen beschreibt. Der Artikel wurde in der North American Review, einer Meinungszeitschrift für das amerikanische Establishment, veröffentlicht. Carnegie schlägt vor, dass der beste Weg, mit dem neuen Phänomen des ungleich verteilten Reichtums umzugehen, darin bestünde, dass die Wohlhabenden ihre überschüssigen Mittel auf verantwortungsbewusste und umsichtige Weise einsetzen (ähnlich dem Konzept des "noblesse oblige"). Dieser Ansatz wurde dem traditionellen Vermächtnis (Patrimonium) gegenübergestellt, bei dem Vermögen vererbt wird, sowie anderen Formen des Vermächtnisses, z. B. wenn der Staat das Vermögen für öffentliche Zwecke nutzen darf. Neben diesem weltberühmten Essay finden sich in diesem Band noch weitere Schriften des größten Stahlmagnaten seiner Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Evangelium des Reichtums
Und andere Zeit- und Streitfragen
ANDREW CARNEGIE
Das Evangelium des Reichtums, A. Carnegie
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681195
Dieses Werk folgt der Ausgabe von 1905, im Original zu finden unter https://play.google.com/store/books/details?id=7qkvAAAAMAAJ&rdid=book-7qkvAAAAMAAJ&rdot=1, und wurde in Teilen der neuen Rechtschreibung angepasst.
Übersetzer; Paul Leonhard Heubner
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort.1
Einleitung. Wie ich meine Lehre bestand.3
Das Evangelium des Reichtums.12
I. Das Problem der Verwaltung des Reichtums.12
II. Das beste Feld für Menschenliebe.24
Die Vorteile der Armut.39
Landläufige Illusionen über Trusts.61
Eines Arbeitgebers Ansicht über die Arbeiterfrage.73
Die Ergebnisse des Arbeitskampfes.83
Ferne Besitzungen. Am Scheideweg.95
Amerikanertum gegen Imperialismus.105
I.105
II.118
Die Demokratie in England.129
Selbstregierung in Amerika.135
Hasst Amerika England?. 152
Der Reichsbund.162
Britischer Pessimismus.184
Vorwort.
Der amerikanische Stahlkönig und der Wohltäter Carnegie sind in Deutschland jedermann bekannt. Ebenso dürfte der Schriftsteller Carnegie weitere Kreise unseres Volkes interessieren, gleichviel wie sich einer zu den Anschauungen und Handlungen dieses Mannes im Einzelnen stellen mag. Eine unter dem Namen "The Empire of Business" erschienene Sammlung seiner Feder entstammender Schriften, die vorzugsweise Aufsätze über geschäftliche und wirtschaftliche Gegenstände umfasst, hat denn auch bereits auf dem deutschen Büchermarkt eine günstige Aufnahme erfahren. Es darf daher erwartet werden, dass die vorliegende neue Sammlung, betitelt "The Gospel of Wealth and other timely Essays", die durchweg andere Aufsätze als die erste, namentlich solche über Fragen sozialer und politischer Natur bringt und von einer Selbstbiographie des Verfassers begleitet ist, dem deutschen Leser gleichfalls willkommen sein wird, zumal darin vielfach Verhältnisse und Möglichkeiten berührt werden, die augenblicklich zu den brennendsten Tagesfragen gehören. Auf die in den einzelnen Aufsätzen enthaltenen Ansichten, Behauptungen und Vorschläge kritisch einzugehen, würde bei der Art und Mannigfaltigkeit des Stoffes den Rahmen eines bloßen Vorwortes und damit die Aufgabe des Übersetzers überschreiten. Es muss und kann vielmehr dem Leser überlassen bleiben, allein zu beurteilen, in welchen Punkten Carnegie recht zu geben ist und in welchen nicht, ob ihn nicht z. B. sein soziales Empfinden oder sein starker Patriotismus manche Dinge in zu einseitigem Lichte sehen und gewisse Tatsachen – beispielsweise die ethnographisch bedeutungsvolle Beimischung deutscher, romanischer und slavischer Elemente in dem amerikanischen Zweig der "englischsprechenden Rasse" – vergessen lässt. Unterbleiben musste ebenso eine Prüfung oder Ergänzung der in einigen der Betrachtungen benutzten, meist sehr abgerundeten statistischen Daten, da eine solche zu weit geführt haben und auch nur zum Teil möglich gewesen sein würde. Indessen sind in einzelnen Fällen, wo Ungenauigkeiten ohne weiteres zutage treten, berichtigende Fußnoten angebracht worden, so z. B. beim letzten Aufsatz, wo die staatliche Steuerbelastung des Engländers mit der des Deutschen verglichen, die doppelte Belastung des Deutschen durch Reich und Einzelstaat dabei aber nicht mit in Rechnung gestellt wird.
Die Übersetzung des Buches, über die ich nunmehr ein paar Worte sagen möchte, bot, wie jede Übersetzung, Schwierigkeiten. Was sich am schlechtesten aus einer Sprache in die andere übersetzen lässt, ist, mit Nietzsche zu reden, das Tempo ihres Stils, die in jedem guten Satze steckende Kunst – Kunst, die erraten sein will, sofern der Satz verstanden sein will – dass man über die rhythmisch entscheidenden Silben nicht im Zweifel sein darf, dass man die Brechung der allzu strengen Symmetrie als gewollt und als Reiz fühlt, dass man jedem staccato, jedem rubato ein feines, geduldiges Ohr hinhält, dass man den Sinn in der Folge der Vokale und Diphthonge rät, und wie zart und reich sie in ihrem Hintereinander sich färben und umfärben können, dass man weiß, was eine Silbe, was ein Wort wiegt, inwiefern ein Satz schlägt, springt, stürzt, läuft, ausläuft: Pflichten und Forderungen, die vom Leser, umso mehr vom Übersetzer anerkannt sein wollen, Kunst und Absicht in der Sprache, auf die solchergestalt hinzuhorchen ist. Inwieweit es mir gelungen ist, solche ästhetischen Schwierigkeiten, die durch die individuelle Schreib- und Ausdrucksweise Carnegies und die grammatisch-logische Verschiedenheit des englischen Satzbaues vom deutschen vielfach noch erhöht wurden, zu erkennen und zu überwinden, mag derjenige, der an der Hand des Originals vergleichende Stichproben vornehmen will, mit Nachsicht entscheiden. Im Allgemeinen habe ich mich bestrebt, das Buch nach Inhalt wie Form so treu wie möglich wiederzugeben und nur da zu einer freieren Übertragung, unwesentlichen Verschiebungen, Kürzungen, Flickwörtern usw. Zuflucht genommen, wo mir eine dem Sprachgefühl und Original zugleich genügende Verdeutschung anders nicht glücken wollte. Der Versuchung, alles Nichtdeutsche, auch internationale Lehnwörter, geographische Bezeichnungen und dergl. der Übersetzung anheimfallen zu lassen, habe ich zu widerstehen gesucht. Zulässig und angezeigt erschien es mir indessen, statt gut entbehrlicher Fremdwörter, wie "Import", "Export", "Produktion" usw. die dafür zu Gebote stehenden deutschen Ausdrücke zu benutzen und dem Deutschen geläufige Ländernamen und Sachfirmen, wie "Virginia", "Pennsylvanische Eisenbahn", "Woodruffsche Schlafwagen-Gesellschaft" usw. deutsch aufzuführen; dagegen sind bei Zeitungsnamen wie "North American Review" zur Unterscheidung von etwa in deutscher Sprache erscheinenden Zeitungen gleichen Titels die englischen Bezeichnungen beibehalten worden. Was endlich die vom Verfasser meist ohne nähere Angaben angezogenen Dichterworte angeht, so ist deren Wortlaut zum Teil deutschen Ausgaben entnommen und nur soweit, als solche nicht vorhanden oder die angeführten Stellen nicht aufzufinden waren, Werk des Übersetzers.
Oban, den 15. September 1904.
Dr. P. L. Heubner.
Einleitung. Wie ich meine Lehre bestand.
Es bereitet mir großes Vergnügen, zu erzählen, wie ich als Kaufmann meine Lehre bestand. Zuvor scheint mir aber eine andere Frage Beantwortung zu erheischen: Warum wurde ich Kaufmann? Ich bin sicher, dass ich nie eine kaufmännische Laufbahn gewählt haben würde, wenn ich hätte wählen können.
Als ältester Sohn von Eltern, die selbst arm waren, musste ich leider bereits in sehr jungen Jahren beginnen, irgendeine nützliche Arbeit in der Welt zu verrichten, um rechtschaffen meinen Unterhalt zu gewinnen, und so lernte ich denn schon in sehr früher Kindheit, pflichtgemäß meinen Eltern beizustehen, um gleich ihnen so bald als möglich ein brotverdienendes Mitglied der Familie zu werden. Was ich an Arbeit bekommen konnte, nicht was ich wünschte, war maßgebend.
Als ich geboren wurde, war mein Vater ein behäbiger Webermeister in Dunfermline in Schottland. Er besaß nicht weniger als vier Damaststühle und beschäftigte Lehrjungen. Es war dies vor den Tagen des Dampfbetriebs für Leinenweberei. Ein paar große Kaufleute nahmen Bestellungen auf und beschäftigten Webermeister wie meinen Vater, die das Zeug webten, während die Kaufleute das Material dazu lieferten.
Als sich das Fabriksystem entwickelte, ging die Handweberei natürlich zurück und mein Vater war einer derjenigen, die unter dem Wechsel zu leiden hatten. Die erste ernste Lehre meines Lebens ward mir eines Tages zuteil, als er seine letzte Arbeit dem Kaufmann abgeliefert hatte und in unser kleines Heim tief betrübt zurückkehrte, weil keine Arbeit mehr für ihn zu haben war. Ich war damals erst etwa 10 Jahre alt, aber diese Lehre prägte sich tief in mein Herz ein und ich beschloss, dass das Gespenst der Armut eines Tages, wenn es in meiner Macht stünde, aus unserem Haus vertrieben werden sollte.
Im Familienrat kam nun die Frage auf, die alten Stühle zu verkaufen und nach den Vereinigten Staaten auszuwandern und ich hörte, wie hierüber tagtäglich beratschlagt wurde. Schließlich beschloss man, den entscheidenden Schritt zu tun und Verwandten nachzufolgen, die sich bereits in Pittsburgh befanden. Ich erinnere mich sehr wohl, dass weder mein Vater noch meine Mutter die Veränderung anders als wie ein großes Opfer von ihrer Seite ansahen, aber glaubten, "es würde so für die beiden Jungen besser sein."
Wenn man in späterer Zeit, wie ich es jetzt tue, zurückblickt und sich darüber wundert, wie Eltern zum Besten ihrer Kinder auf ihre eigenen Wünsche vollständig verzichten, muss man ihr Andenken mit Gefühlen verehren, die der Anbetung nahe kommen.
Nach unserer Ankunft in Allegheny City (wir waren unser vier: Vater, Mutter, mein jüngerer Bruder und ich) trat mein Vater in eine Baumwollfabrik ein. Ich folgte bald und half als "Spuljunge" und begann auf diese Weise, mich auf meine spätere Lehrzeit als Kaufmann vorzubereiten. Ich bekam die Woche einen Dollar und 20 Cents und war damals etwa 12 Jahre alt.
Ich kann nicht sagen, wie stolz ich war, als ich meinen ersten eigenen Wochenverdienst erhielt. Einen Dollar und 20 Cents, die ich selbst erworben und die man mir gegeben hatte, weil ich der Welt von Nutzen gewesen war! Von meinen Eltern nicht mehr vollständig abhängig, sondern endlich fähig, ihnen zu helfen und beitragendes Mitglied der Familiengemeinschaft! Ich denke, das macht mehr als alles andere aus einem Knaben einen Mann und auch einen wahren Mann, wenn man überhaupt einen Keim echter Männlichkeit in sich hat. Fühlen, dass man nützlich ist, heißt Alles.
Ich habe mit großen Summen zu tun gehabt. Viele Millionen Dollar sind seitdem durch meine Hände gegangen. Die echte Genugtuung, die ich über jenen einen Dollar und 20 Cents empfand, wiegt aber mehr als jede spätere Freude am Gelderwerben. Sie waren der unmittelbare Lohn rechtschaffener Handarbeit; sie stellten eine Woche harter Arbeit dar, so harter Arbeit, dass das Wort Sklaverei kein allzu starker Ausdruck dafür wäre, wenn nicht ihr Zweck und Ziel sie mit Weihe umgäben.
Jeden Morgen außer dem heiligen Sonntagmorgen aufstehen und frühstücken und auf die Straße hinaustreten und seinen Weg in die Fabrik gehen und mit der Arbeit beginnen, während es draußen noch finster ist und erst erlöst sein, nachdem es am Abend wieder dunkel geworden ist, mit nur 40 Minuten Mittagspause, ist für einen Burschen von 12 Jahren ein schreckliches Los.
Ich war aber jung und hatte meine Träume und etwas in ihnen sagte mir immer, dass es nicht auf die Dauer so bleiben würde, könnte und sollte – dass ich eines Tages zu einer besseren Stellung kommen würde. Außerdem fühlte ich mich nicht mehr als ein bloßer Knabe, sondern völlig als kleiner Mann und dies machte mich glücklich.
Ein Wechsel trat bald ein, denn ein freundlicher alter Schotte, der mehrere unserer Verwandten kannte und Spulen verfertigte, nahm mich in seine Fabrik, bevor ich 13 wurde. Eine Zeitlang war es hier indessen noch schlimmer als in der Baumwollfabrik, da ich im Keller einen Kessel zu heizen und die kleine Dampfmaschine, die den Betrieb bewegte, in Gang zu halten hatte. Das Heizen des Kessels war mir ganz recht, denn glücklicherweise wurden nicht Kohlen, sondern Holzabfälle gefeuert und ich befasste mich immer gern mit Holz. Die Verantwortung, das Wasser und die Maschine beim rechten zu halten und die Gefahr, dass ein Fehler von mir die ganze Fabrik in die Luft fliegen lassen könnte, bedeuteten aber eine zu große Anspannung für mich und oft erwachte ich, wie ich die ganze Nacht hindurch im Bette saß und den Dampfdruckmesser ablas. Nie aber sagte ich daheim, dass ich einen harten Kampf zu bestehen hatte. Nein, nein! Alles musste ihnen freundlich erscheinen.
Es war dies ein Ehrenpunkt, denn jedes Mitglied der Familie arbeitete hart, mein kleinerer Bruder natürlich ausgenommen, der noch ein Kind war, und wir erzählten uns einander nur die angenehmen Dinge. Übrigens pflegt ein Mann nicht zu weinen und die Flinte ins Korn zu werfen – eher würde er sterben.
Einen Dienstboten gab es in unserer Familie nicht, und ein paar Dollar wöchentlich wurden noch von meiner Mutter verdient, indem sie nach der Verrichtung ihres Tagewerkes Schuhe band! Auch der Vater hatte in der Fabrik hart zu arbeiten. Konnte ich mich da beklagen?
Mein gütiger Arbeitgeber, John Hay – Friede seiner Asche! – befreite mich bald von der unverhältnismäßigen Anstrengung, denn er brauchte jemand, der ihm die Rechnungen ausschreiben und die Bücher führen sollte und da er fand, dass ich eine deutliche Schulbubenhandschrift hatte und rechnen konnte, machte er mich zu seinem einzigen Kommis. Noch aber hatte ich oben in der Fabrik hart zu arbeiten, denn die Schreiberei nahm nur wenig Zeit in Anspruch.
Es ist bekannt, wie über die Armut als ein großes Übel gejammert wird und man scheint anzunehmen, dass die Menschen glücklicher und nützlicher sein und mehr vom Leben haben würden, wenn sie nur eine Menge Geld hätten und reich wären.
In der Regel findet sich in der bescheidenen Hütte des Armen eine höhere Befriedigung, ein edleres Leben und eine größere Lebensfreude als in dem Palast des Reichen. Ich bedaure immer die Söhne und Töchter der reichen Leute, denen Diener aufwarten und die später Erzieherinnen haben, tröste mich aber dabei mit dem Gedanken, dass sie nicht wissen, was sie entbehren.
Sie haben auch zärtliche Väter und Mütter und meinen, dass sie diesen Segen im vollsten Maße genießen, und doch können sie das nicht, denn der Sohn des Armen, der in seinem Vater seinen beständigen Gefährten, Lehrer und Berater und in seiner Mutter – welch heiliger Name! – seine Ernährerin, Erzieherin, Beschützerin, seine Heilige, alles in einer Person besitzt, genießt ein reicheres, köstlicheres Glück im Leben als der nicht so begünstigte Sohn eines Reichen kennen kann, und im Vergleich damit zählen alle anderen Glücksumstände nur wenig.
Weil ich weiß, wie süß und glücklich und rein, wie frei von verwirrenden Sorgen, von sozialem Neid und Eifersucht das Heim rechtschaffener Armut ist, wie liebevoll und einig seine Besitzer in ihrem gemeinsamen Interesse der Unterhaltung der Familie sein können, habe ich mit dem Jungen des Reichen Mitgefühl, während ich die Jungen des Armen beglückwünsche, und aus diesen Gründen sind aus den Reihen der Armen immer so viel starke, hervorragende, selbstbewusste Männer hervorgegangen und müssen immer solche aus ihnen hervorgehen.
Wenn man die Liste der Unsterblichen liest, die "nicht geboren wurden, um zu sterben," wird man finden, dass die meisten von ihnen geboren wurden, das kostbare Erbe der Armut anzutreten.
Es erscheint heutzutage allgemein als wünschenswert, dass die Armut abgeschafft werden möchte. Wir sollten streben, den Luxus abzuschaffen, die ehrliche, fleißige, sich selbst verleugnende Armut abschaffen hieße aber den Boden zerstören, auf dem die Menschheit die Tugenden hervorbringt, die unserer Rasse die Erreichung einer noch höheren Stufe der Zivilisation ermöglichen, als sie schon besitzt.
Ich komme jetzt zu der dritten Stufe meiner Lehre, denn wie man sieht, hatte ich bereits zwei erklommen, die Baumwollfabrik und dann eine Spulenfabrik, und mit der dritten – aller guten Dinge sind drei, bekanntlich – kam die Erlösung. Ich erhielt eine Anstellung als Telegraphenbote im Pittsburgher Telegraphenbüro, als ich 14 Jahre alt war. Hier trat ich in eine neue Welt ein.
Inmitten von Büchern, Zeitungen, Griffeln, Federn und Tinte und Schreibunterlagen, eines sauberen Büros, reiner Fenster und der literarischen Atmosphäre war ich der glücklichste Junge, den es auf der ganzen Welt gab.
Meine einzige Sorge war, dass ich eines Tages entlassen werden könnte, weil ich die Stadt nicht kannte, denn für einen Telegraphenboten ist es nötig, alle Firmen und Adressen der Leute zu kennen, die Telegramme zu erhalten pflegen. Ich war aber in Pittsburgh fremd. Ich beschloss indessen, der Reihe nach jedes Geschäftshaus in den Hauptstraßen hersagen zu lernen und konnte bald mit geschlossenen Augen auf der einen Seite der Wood Street anfangen und alle Firmen nacheinander bis ans Ende und dann auf der anderen Seite herunter alle bis ans andere Ende aufzählen. Binnen kurzer Zeit war ich imstande, dasselbe mit den Geschäftsstraßen überhaupt zu tun. Mein Gewissen war dann über diesen Punkt beruhigt.
Natürlich will jeder ehrgeizige Telegraphenbote ein Telegraphist werden, und ehe die Telegraphisten frühmorgens kamen, schlüpften die Jungen hinauf zu den Instrumenten und übten. Ich tat dies auch und konnte mich bald mit den Jungen in den anderen Bürox die Linie entlang, die ebenfalls übten, unterhalten.
Eines Morgens hörte ich Philadelphia Pittsburgh anrufen und das Zeichen "Todesnachricht" geben. Man erwartete damals gerade mit großer Aufmerksamkeit Todesnachrichten und ich dachte, ich sollte versuchen, die angemeldete anzunehmen. Ich antwortete und tat es und ging fort und lieferte sie ab, ehe der Telegraphist kam. Von da an pflegten mich die Telegraphisten zuweilen zu bitten, für sie zu arbeiten.
Da ich ein empfängliches Ohr für den Schall hatte, lernte ich bald Telegramme nach dem Gehör aufzunehmen, was damals sehr ungewöhnlich war – ich glaube nur zwei Personen in den Vereinigten Staaten konnten es damals. Heute nimmt jeder Telegraphist nach dem Gehör auf, so leicht ist es, zu folgen und zu tun, was jeder andere Junge kann – wenn er nur muss. Dies machte mich bekannt und schließlich wurde ich Telegraphist und empfing die für mich ungeheure Besoldung von 25 Dollar den Monat – 300 Dollar im Jahr!
Dies war ein Vermögen – genau die Summe, die ich mir als Fabrikarbeiter als das Einkommen gedacht hatte, das ich besitzen wollte, weil die Familie von 300 Dollar jährlich leben und dabei fast oder ganz unabhängig sein konnte. Da war sie nun endlich! Bald sollte ich aber noch im Besitz einer besonderen Vergütung für besondere Arbeiten sein.
Die sechs Zeitungen Pittsburghs bekamen gemeinsame Telegrammnachrichten. Sechs Abschriften jeder Depesche wurden von einem Herrn angefertigt, der hierfür 6 Dollar die Woche bekam und er bot mir einen Golddollar wöchentlich, wenn ich es tun wollte, worüber ich außerordentlich froh war, da ich immer gern mit Nachrichten zu tun haben und für Zeitungen schreiben wollte.
Die Berichterstatter holten jeden Abend in einem Zimmer die Nachrichten ab, die ich fertig gemacht hatte, und dies brachte mich in sehr angenehme Berührung mit diesen gewandten Leuten und überdies erhielt ich einen Golddollar die Woche Taschengeld, denn dieser wurde von mir nicht als Familieneinkommen betrachtet.
Ich denke, dies Letztere, etwas über seine Aufgabe hinaus zu tun, kann mit vollem Recht als "Geschäft" angesehen werden; das andere Einkommen war eben, wie man sieht, der Lohn für die regelmäßige Arbeit, hier aber war ein kleines Geschäftsunternehmen auf eigene Rechnung, und ich war in der Tat auf meinen Golddollar für jede Woche sehr stolz.
Bald darauf wurde die Pennsylvanische Eisenbahn bis Pittsburgh vollendet und jenes Genie, Thomas A. Scott, war ihr Inspektor. Er kam oft nach dem Telegraphenbüro, um sich mit seinem Vorgesetzten, dem Generalinspektor in Altoona, zu unterhalten und ich wurde ihm auf diese Weise bekannt.
Als dieses große Eisenbahnsystem eine eigene Telegraphenlinie errichtete, forderte er mich auf, sein Kommis und Telegraphist zu werden; ich verließ daher das Telegraphenbüro – wo ein junger Mann tatsächlich in großer Gefahr ist, dauernd begraben zu werden – und trat in Beziehung zu den Eisenbahnen.
Die neue Stellung war von einer Gehaltsaufbesserung begleitet, die für mich ganz außerordentlich groß war. Mein Gehalt sprang von 25 auf 35 Dollar im Monat. Mr. Scott erhielt damals 125 Dollar den Monat und ich pflegte mich darüber zu wundern, was auf der Welt er mit so viel Geld tun könnte.
Ich blieb 13 Jahre lang im Dienst der Pennsylvanischen Eisenbahngesellschaft und war zuletzt Inspektor der Pittsburgher Bahnabteilung, als Nachfolger Mr. Scotts, der inzwischen in die Stellung eines Vizepräsidenten der Gesellschaft aufgerückt war.
Eines Tages fragte mich Mr. Scott, der ein äußerst gütiger Mann war und mich sehr gern mochte, ob ich 500 Dollar für eine Kapitalanlage hätte oder aufbringen könnte.
Jetzt kam der Geschäftsinstinkt ins Spiel. Da mir die Tür zu einer geschäftlichen Anlage mit meinem Chef offenstand, hätte es meinem Gefühle nach geheißen, der Vorsehung halsstarrig ins Gesicht schlagen, wenn ich nicht freudig darauf zugesprungen wäre, und so antwortete ich denn rasch:
"Jawohl, ich glaube, ich kann es."
"Gut," sagte er, "beschaffen Sie sie; es ist eben jemand gestorben, der zehn Anteile der Adams Express Company besitzt, die Sie kaufen sollen. Es wird Ihnen jeder Anteil 50 Dollar kosten und ich kann Ihnen mit einem kleinen Fehlbetrag aushelfen, wenn Sie nicht alles aufbringen können."
Es war eine eigentümliche Sache. Das verfügbare Vermögen der ganzen Familie betrug nicht 500 Dollar. Es gab aber ein Mitglied der Familie, dessen Tüchtigkeit, Mut und Hilfe uns nie fehlten, und ich fühlte mich sicher, dass das Geld auf die eine oder andere Weise durch meine Mutter beschafft werden könnte.
Hätte allerdings Mr. Scott unsere Lage gekannt, würde er es selbst vorgeschossen haben; seine Armut offenbaren und sich auf andere verlassen, wäre aber das letzte auf der Welt, was der stolze Schotte tun würde. Die Familie hatte es zu jener Zeit zuwege gebracht, ein kleines Haus zu kaufen und zu bezahlen, um an Miete zu sparen. Soviel ich mich erinnere, war es 800 Dollar wert.
Die Angelegenheit wurde an jenem Abend dem Rate der drei vorgelegt und das Orakel sprach: "Es muss geschehen. Nehmen wir eine Hypothek auf das Haus. Ich werde morgen früh den Dampfer nach Ohio nehmen und den Onkel besuchen und ihn bitten, die Sache in Ordnung zu bringen. Ich bin sicher er kann es." Dies geschah. Natürlich war ihr Besuch erfolgreich – wo hätte sie je Misserfolg gehabt?
Das Geld wurde beschafft und ausgezahlt; zehn Anteile der Adams Express Company waren mein; niemand wusste aber, dass unser kleines Haus verpfändet worden war, "um unserm Jungen unter die Arme zu greifen."
Die Adams-Express-Aktien zahlten damals monatlich Dividenden von 1% und die erste Anweisung über 5 Dollar kam an. Ich habe sie noch jetzt vor Augen und erinnere mich genau der Unterschrift "J. C. Babcock, Kassierer," der eine starke "John Hancock"-Hand schrieb.
An dem nächsten Tage, der ein Sonntag war, machten wir Jungen – ich und meine stets treuen Gefährten – unsern üblichen Sonntagnachmittag-Ausflug aufs Land und als wir uns im Walde niedergesetzt hatten, zeigte ich ihnen diese Anweisung mit den Worten: "Eureka! Es ist erreicht!"
Es war das uns allen etwas Neues, denn keiner von uns hatte je etwas erhalten außer für Arbeit. Ein Ertrag aus Kapital war etwas Fremdes und Neues.
Wie Geld Geld erzeugen könnte, wie ohne jede besondere Bemühung meinerseits dieser geheimnisvolle goldene Besucher vorsprechen sollte, führte auf Seiten der jungen Burschen zu viel Grübelei und zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich als "Kapitalist" begrüßt.
Man sieht, ich fing an, meine Lehre als Geschäftsmann in befriedigender Weise zu bestehen.
Ein sehr wichtiges Ereignis meines Lebens trat ein, als eines Tages im Zuge ein netter, fremd ausschauender Herr an mich herantrat und mir sagte, er habe vom Schaffner erfahren, dass ich Beziehungen zur Pennsylvanischen Bahn hätte und möchte mir gern etwas zeigen. Er zog aus einer kleinen grünen Tasche das Modell des ersten Schlafwagens hervor. Es war Mr. Woodruff, der Erfinder.
Die Sache leuchtete mir sofort ein. Ich bat ihn, die folgende Woche nach Altoona zu kommen, was er tat. Mr. Scott nahm den Gedanken mit seiner gewöhnlichen Schnelligkeit auf. Es wurde mit Mr. Woodruff ein Vertrag abgeschlossen, nach dem er versuchsweise zwei Wagen auf der Pennsylvanischen Eisenbahn einstellen sollte. Bevor er Altoona verließ, kam er zu mir, um mir eine Beteiligung an dem Unternehmen anzubieten, worauf ich sofort einging. Wie ich aber meine Zahlungen leisten sollte, beunruhigte mich ziemlich, denn die Wagen waren nach der Lieferung in monatlichen Raten zu bezahlen und meine erste monatliche Zahlung sollte 227½ Dollar betragen.
Ich hatte das Geld nicht und sah kein Mittel, es zu bekommen. Schließlich entschloss ich mich, den Bankier des Ortes zu besuchen und ihn um ein Darlehn zu bitten, wobei ich mich verpflichtete, es in monatlichen Raten von 15 Dollar zurückzuzahlen. Er gewährte es mir sofort. Ich werde nie vergessen, wie er mir die Hand auf die Schulter legte und sagte, "O, ja, Andy, Sie haben ganz Recht!"
Ich stellte bei dieser Gelegenheit meinen ersten Wechsel aus. Welch großer Tag, und jetzt wird sicher niemand bestreiten, dass ich im Begriff war, ein "Kaufmann" zu werden. Ich hatte meinen ersten Wechsel gezeichnet, und, das Wichtigste – denn jedermann kann einen Wechsel zeichnen – ich hatte einen Bankier gefunden, der gewillt war, ihn als "gut" zu nehmen.
Meine späteren Zahlungen wurden aus den Einkünften von den Schlafwagen geleistet und ich machte in der Tat meinen ersten beträchtlichen Gewinn durch diese Kapitalanlage in der Woodruff-Schlafwagen-Gesellschaft, die dann von Mr. Pullmann mit übernommen wurde, einem bedeutenden Manne, dessen Name heute in der ganzen Welt bekannt ist.
Bald darauf wurde ich zum Inspektor der Pittsburgher Abteilung ernannt, und nun kehrte ich in meine alte liebe Heimat, das rauchige Pittsburgh zurück. Man gebrauchte damals auf den Eisenbahnen ausschließlich Holzbrücken, und die Pennsylvanische Eisenbahn machte Versuche mit einer Brücke, die aus Gusseisen gebaut war. Ich sah, dass Holzbrücken in der Zukunft nicht mehr genügen würden, und bildete in Pittsburgh eine Gesellschaft für den Bau von eisernen Brücken.
Ich nahm dabei wiederum Zuflucht zur Bank, da mein Kapitalanteil 1250 Dollar betrug und ich das Geld nicht hatte; aber die Bank lieh es mir und wir begründeten die Keystone-Brückenwerke, die sich als sehr erfolgreich erwiesen. Diese Gesellschaft baute die ersten großen Brücken über den Ohio von 300 Fuß Spannung und hat seitdem viele der wichtigsten Bauten ausgeführt
Dies war mein Anfang als Fabrikant, und aus diesem Anfange sind alle unsere anderen Werke hervorgewachsen, indem die Gewinne des einen die anderen begründet haben. Meine "Lehre" als Kaufmann erreichte bald ihr Ende, denn ich gab meine Stellung als Beamter der Pennsylvanischen Eisenbahngesellschaft auf, um mich ausschließlich dem Geschäft zuzuwenden.
Ich war nun nicht mehr ein bloßer Angestellter, der für andere gegen Besoldung arbeitete, sondern ein vollauf flügger Geschäftsmann, der auf seine eigene Rechnung arbeitete.
Ich war nie ganz damit einverstanden, für andere Leute zu arbeiten. Ein Eisenbahnbeamter hat im besten Falle den Genuss eines bestimmten Gehaltes zu erwarten und er muss sehr vielen Leuten gefallen; selbst, wenn er es bis zum Präsidenten bringt, hat er zuweilen einen Ausschuss von Direktoren, die nicht wissen können, was am besten zu tun ist, und selbst wenn diese Körperschaft befriedigt ist, hat er einen Ausschuss von Anteileignern, die ihn kritisieren, und da die Anlagen ihm nicht gehören, kann er sie nicht verwalten, wie er möchte.
Mein Lieblingsgedanke war immer, mein eigner Herr zu sein, etwas zu erzeugen und vielen Leuten Beschäftigung zu gewähren. Es ist nur die Erzeugung eines Dinges denkbar, wenn man ein Pittsburgher ist, denn Pittsburgh nahm bereits damals die erste Stellung als "Eisenstadt" ein, als führende Eisen und Stahl erzeugende Stadt Amerikas.
So fingen meine unentbehrlichen und tüchtigen Teilhaber, die, wie ich mit Freuden bekenne, meine Jugendgefährten gewesen waren – einige derselben Jungen, die im Gehölz zusammen die 5 Dollaranweisung bewundert hatten – das Geschäft mit mir an und noch fahren wir fort, es zu erweitern, um den beständig wachsenden und beständig wechselnden Bedürfnissen unseres außerordentlich fortschreitenden Landes ein Jahr nach dem anderen zu begegnen.
Immer hoffen wir, dass wir uns nicht noch weiter auszudehnen brauchen, stets aber finden wir wieder, dass ein Aufschub weiterer Ausdehnung einen Rückschritt bedeuten würde, und noch heute lösen sich die aufeinanderfolgenden Verbesserungen und Erfindungen so schnell ab, dass für uns noch eben so viel zu tun bleibt wie je.
Wenn die Stahlfabrik aufhört zu wachsen, fängt sie an zurückzugehen, so müssen wir denn fortfahren, uns auszudehnen. Das Ergebnis dieser ganzen Entwicklung ist, dass 3 Pfund fertigen Stahls heute in Pittsburgh für 2 Cents zu kaufen sind, was billiger ist als irgendwo anders auf der Erde und dass unser Vaterland der größte Eisenerzeuger der Welt geworden ist.
Und hiermit endet die Geschichte meiner Lehre und meines Aufrückens als Geschäftsmann.
Das Evangelium des Reichtums.
I. Das Problem der Verwaltung des Reichtums.
Das Problem unserer Zeit liegt in der rechten Verwaltung des Reichtums, in der harmonischen Vereinigung des Reichen und des Armen durch die Bande der Brüderlichkeit. Die Bedingungen des menschlichen Lebens haben innerhalb der letzten paar Jahrhunderte nicht nur eine Veränderung, sondern eine Umwälzung erfahren. In früheren Zeiten unterschieden sich Wohnung, Kleidung, Nahrung und Umgebung des Herrn wenig von der seiner Dienstmannen. Die Indianer sind heute, wo damals der Kulturmensch war. Als ich die Sioux besuchte, führte man mich zum Wigwam des Häuptlings. Es war den übrigen in der äußeren Erscheinung gleich und hob sich auch im Innern von denen seiner ärmsten Streiter kaum ab. Der Gegensatz zwischen dem Palaste des Millionärs und der Hütte des Arbeiters in unserer Zeit lässt die Veränderung ermessen, die mit der Zivilisation gekommen ist. Diese Veränderung ist jedoch nicht zu beklagen, sondern als höchst nützlich zu begrüßen. Es ist gut, ja wesentlich für den Fortschritt des Menschengeschlechts und besser, dass die Häuser einzelner für alles Höchste und Beste in der Literatur und Kunst und alle Verfeinerungen der Kultur Heimstätten bieten, als wenn es solche überhaupt nicht gäbe. Viel besser diese große Ungleichheit als allgemeiner Unflat. Ohne Reichtum auch keine Mäzene. Die "guten alten Zeiten" waren keine guten alten Zeiten. Weder Herr noch Diener waren so wohl gestellt wie heute. Ein Rückfall in die alten Zustände wäre unheilvoll für beide, nicht am mindesten für den, der dient, und würde die Zivilisation mit wegfegen. Aber gleichviel, sei der Wandel zum Guten oder Schlechten, er ist da, ist durch unsere Macht nicht abzuändern, und wir müssen ihn darum annehmen und das Beste daraus zu machen suchen. Das Unvermeidliche zu tadeln, wäre Zeitverschwendung.
Wie die Umwandlung gekommen ist, ist leicht ersichtlich. Ein Beispiel wird genügen, jede der einzelnen Wandlungen zu erklären. In der Erzeugung der Güte haben wir die ganze Entwicklung. Sie passt auf alle Beziehungen menschlicher Betriebsamkeit, wie sie die Erfindungen unseres wissenschaftlichen Zeitalters mit sich gebracht und ausgedehnt haben. Früher wurden die Gegenstände im häuslichen Familienkreis oder in kleinen Werkstätten hergestellt, die einen Teil der Haushaltung bildeten. Der Meister und seine Lehrlinge arbeiteten Seite an Seite, wobei die letzteren bei dem Meister wohnten und daher unter denselben Bedingungen lebten. Wenn diese Lehrlinge zum Meister aufstiegen, trat in ihrer Lebensweise wenig oder kein Wechsel ein, und ihrerseits erzogen sie nun nachfolgende Lehrlinge in dem gleichen, gewohnheitsmäßigen Lauf. Es herrschte im wesentlichen gesellschaftliche Gleichheit und selbst politische Gleichheit, denn die in gewerblichen Berufen stehenden hatten damals überhaupt wenig oder gar nichts im Staate zu bedeuten.
Die notwendige Folge einer solchen Herstellungsweise waren grobe Erzeugnisse bei hohen Preisen. Heute erhält die Welt Waren ausgezeichneter Beschaffenheit zu Preisen, die selbst das letzte uns vorangegangene Geschlecht für unmöglich gehalten hätte. Auf dem Gebiet des Handels haben ähnliche Ursachen ähnliche Wirkungen herbeigeführt, und die Menschheit hat den Gewinn davon. Der Arme genießt, was ehedem der Reiche nicht bestreiten konnte. Was Gegenstände des Luxus waren, sind Lebensbedürfnisse geworden. Der Arbeiter hat gegenwärtig mehr Annehmlichkeiten als vor einigen Menschenaltern der Pächter. Der Pächter erfreut sich eines größeren Wohllebens als ehedem der Grundeigentümer, er ist besser gekleidet und wohnt besser. Der Grundeigentümer besitzt kostbarere Bücher und Bilder und eine kunstvollere Einrichtung als sie früher dem König erreichbar waren.
Der Preis, den wir für diese heilsame Veränderung zahlen, ist ohne Zweifel hoch. Wir versammeln in der Fabrik, im Bergwerk Tausende von Handarbeitern, die der Arbeitgeber nur wenig oder nicht kennen kann und denen er kaum mehr ist als ein Held der Sage. Jeder Verkehr zwischen ihnen ist zu Ende. Strenge Kasten haben sich gebildet, und wie gewöhnlich gebiert die gegenseitige Unkenntnis gegenseitiges Misstrauen. Jede Kaste ist ohne Mitgefühl für die andere und bereit, alles zu glauben, was jene herabsetzt. Die Gesetze des Wettbewerbs zwingen den Arbeitgeber Tausender zu den genauesten Ersparnissen, wobei die für die Arbeit gezahlten Sätze eine hervorragende Rolle spielen, und oft kommt es zur Reibung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Reich und Arm. Die menschliche Gesellschaft verliert die Homogenität.
Der Preis, den die Gesellschaft dem Gesetz des Wettbewerbs entrichtet, ist wie der Preis, den sie für billige Behaglichkeit und Üppigkeit zahlt, hoch, aber dafür sind die Vorteile dieses Gesetzes noch grösser als seine Kosten – denn diesem Gesetz verdanken wir unsere wundervolle materielle Entwickelung, die die verbesserten Lebensbedingungen im Gefolge führt. Aber, mag das Gesetz eine Wohltat sein oder nicht, es gilt von ihm dasselbe wie von der Veränderung der menschlichen Lebensbedingungen, auf die wir hingewiesen haben: Es ist da, wir können uns ihm nicht entziehen, nichts anderes an seine Stelle setzen, und während es für den Einzelnen manchmal eine Härte sein mag, ist es für die Menschheit das Beste, weil es in jedem Lebenskreis die Erhaltung der Tauglichsten gewährleistet. Wir nehmen daher die große Ungleichheit der Umwelt, die Vereinigung des Geschäfts in Gewerbe und Handel in den Händen weniger und das Gesetz des Wettbewerbs zwischen diesen als etwas für den künftigen Fortschritt der Menschheit nicht nur nützliches, sondern wesentliches an und erblicken darin Bedingungen, denen wir uns anzupassen haben. Hieraus folgt, dass für besondere Fähigkeiten des Kaufmanns und Industriellen, der Geschäfte in großem Maßstab zu führen hat, ein weiter Spielraum vorhanden sein muss. Dass solches Organisations- und Verwaltungstalent unter den Menschen selten ist, erhellt aus der Tatsache, dass es seinem Besitzer, gleichviel wo und unter welchen Gesetzen und Bedingungen, stets einen außerordentlich hohen Lohn sichert. Die in Geschäften erfahrenen betrachten in erster Linie stets die Persönlichkeit, die mit ihren Diensten als Gesellschafter gewonnen werden kann, so dass die Frage des Kapitals daneben kaum mehr von Belang bleibt, denn: befähigte Männer schaffen bald Kapital; in den Händen solcher ohne die erforderliche, besondere Gabe verfliegt das Kapital dagegen bald. Solche Männer werden an Firmen und Gesellschaften, die mit Millionen arbeiten, beteiligt, und nimmt man auch nur an, das angelegte Kapital verzinse sich einfach, so ist es doch unausbleiblich, dass ihr Einkommen ihren Aufwand übersteigt, sie infolgedessen Reichtum anhäufen. Auch gibt es nicht irgend eine mittlere Stufe, auf der solche Leute stehen können, weil eine große gewerbliche oder Handelsunternehmung, die nicht wenigstens die Zinsen ihres Kapitals verdient, bald eingeht. Sie muss entweder vorwärts gehen oder zurückbleiben, Stillstand ist unmöglich. Es ist eine wesentliche Bedingung für ihr erfolgreiches Wirken, dass sie so weit gewinnbringend sein, ja sogar, dass sie über die Verzinsung des Kapitals hinaus Gewinn abwerfen muss. Es ist mithin ein ebenso sicheres Gesetz wie irgendeins der oben erwähnten, dass Männer im Besitze dieses besonderen Geschäftstalentes notwendigerweise bald mehr Einkommen beziehen, als eigentlich auf sie entfallen dürfte, und dieses Gesetz ist ebenso nützlich für die Menschheit wie die anderen.
Einwendungen gegen die Grundlage, auf denen die Gesellschaft beruht, sind nicht am Platze, weil die Lebensbedingungen der Menschheit mit dieser Grundlage besser sind, als mit irgendwelchen anderen, die man zu schaffen versucht hat. Der Wirkung neuer vorgeschlagener Ersatzmittel können wir nicht sicher sein. Der Sozialist oder Anarchist, der die gegenwärtigen Verhältnisse umzustürzen sucht, ist als jemand anzusehen, der die Grundlage der Kultur selbst angreift, denn die Kultur ging von dem Tage aus, an dem der fähige, fleißige Arbeiter zu seinem untauglichen und trägen Genossen sagte: "Wenn du nicht säest, sollst du nicht ernten," und auf diese Weise endete der anfängliche Kommunismus durch die Trennung der Drohnen von den Bienen. Wer darüber nachdenkt, wird sich bald vor die Schlussfolgerung gestellt sehen, dass die Kultur selbst von der Anerkennung des Eigentums abhängt – das Recht des Arbeiters auf seine hundert Dollar in der Sparkasse in gleicher Weise wie das gesetzliche Recht des Millionärs auf seine Millionen. Es muss jedermann gestattet sein "unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum zu sitzen, ohne jemand fürchten zu brauchen," wenn die menschliche Gesellschaft fortschreiten oder auch nur den erreichten Stand behaupten soll. Für diejenigen, die diesen starken Individualismus durch den Kommunismus ersetzen wollen, lautet die Antwort: Die Menschheit hat das versucht. Alle Fortschritte aus jenen barbarischen Zeiten bis zur Gegenwart haben sich aus dessen Verdrängung ergeben. Nicht Böses, sondern Gutes ist der Menschheit aus der Anhäufung des Reichtums durch diejenigen erwachsen, die die Fähigkeit und Tatkraft besessen haben, ihn hervorzubringen. Aber selbst wenn wir auch nur einen Augenblick zugeben, dass es für die Menschheit besser sein könnte, ihre jetzige Grundlage, den Individualismus zu verwerfen, – dass es ferner ein edleres Ideal für den Menschen sei, nicht für sich selbst allein, sondern innerhalb und zum Nutzen einer Brüderschaft von Genossen zu arbeiten, mit ihnen alles gemeinschaftlich zu teilen und so Swedenborgs Idee vom Himmel zu verwirklichen, wo die Glückseligkeit der Engel, wie dieser sagt, nicht von der Arbeit für sich, sondern für einander herstammt – selbst all dies zugegeben, so bleibt doch immer die Antwort: Dies ist nicht Evolution, sondern Revolution. Es wäre eine Änderung der menschlichen Natur selbst erforderlich – eine Äonenarbeit, selbst wenn die Änderung gut wäre, was man nicht wissen kann.
In unseren Tagen oder unserem Zeitalter ist sie nicht durchführbar. Selbst wenn sie theoretisch wünschenswert ist, gehört sie einer anderen, erst später folgenden soziologischen Ablagerung an. Unsere Pflicht verweist uns auf das, was jetzt und mit den nächsten innerhalb unserer Zeit und Generation möglichen Schritten zu erzielen ist. Es ist sträflich, unsere Kräfte in dem Bemühen zu verschwenden, den ganzen Baum der Menschheit aus den Wurzeln zu reißen, wenn alles, was wir mit Nutzen erreichen können, darin besteht, ihn ein wenig nach der Richtung zu biegen, die der Erzeugung guter Früchte unter den vorhandenen Umständen am günstigsten ist. Ebenso gut wie die Ausrottung des Individualismus, des Privateigentums, der Gesetze der Kapitalanhäufung und des freien Wettbewerbs könnten wir die Ausrottung der höchsten auf der Erde vorkommenden Menschengattung betreiben, weil sie unser Ideal zu erreichen verfehlte; denn diese Einrichtungen und Gesetze sind der höchste Erfolg menschlicher Erfahrung, der Boden, auf dem die Gesellschaft bisher die besten Früchte hervorgebracht hat. So ungleich oder ungerecht, wie sie vielleicht zuweilen wirken, und so unvollkommen, wie sie dem Idealisten erscheinen mögen, sind sie nichtsdestoweniger, gleich der höchsten Menschengattung, das beste und wertvollste von allem, was die Menschheit bis jetzt zur Entfaltung gebracht hat.
Wir gehen also von einem Stand der Dinge aus, der den besten Interessen der Menschheit förderlich ist, der Reichtum aber unvermeidlich nur Wenigen beschert. Insoweit kann man denn die Lage, wenn man die Verhältnisse nimmt, wie sie sind, übersehen und als gut bezeichnen. Es erhebt sich nun die Frage – und wenn das Vorhergehende richtig ist, ist es die einzige Frage, mit der wir uns zu befassen haben: Welches ist die richtige Art und Weise, den Reichtum zu verwalten, den die Gesetze, auf welchen die Kultur begründet ist, den Wenigen in die Hände gelegt haben? Und für diese große Frage glaube ich, die richtige, wahre Lösung angeben zu können. Ich schicke voraus, dass im Folgenden nur von großen Vermögen die Rede ist, nicht von bescheidenen, in vielen Jahren mühevoll ersparten Summen, deren Erträge zur behaglichen Unterhaltung und zur Erziehung von Familien gebraucht werden. Denn das ist nicht Reichtum, sondern nur hinlängliches Auskommen, und ein solches zu erwerben, sollte im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft das Ziel aller sein.
Es gibt nur drei Formen, über überschüssigen Reichtum zu verfügen. Er kann den Familien der Verstorbenen hinterlassen werden, oder er kann für öffentliche Zwecke vermacht werden, oder endlich, er kann von seinen Besitzern während ihrer Lebzeiten verwaltet werden. In der ersten und zweiten Form ist der meiste Reichtum der Welt, der den Wenigen zugekommen ist, seither verwendet worden. Betrachten wir nacheinander jede dieser Formen. Die erste ist die unverständigste. In monarchischen Ländern werden der Landbesitz und der größte Teil des Vermögens dem ersten Sohne hinterlassen, damit die Eitelkeit des Vaters durch den Gedanken befriedigt wird, dass sein Name und Titel unvermindert auf nachfolgende Generationen übergehen werden. Der heutige Zustand dieser Klasse in Europa lehrt, dass solche Hoffnungen oder solcher Ehrgeiz trügen. Die Nachfolger sind oft durch ihre Torheiten oder durch das Fallen des Bodenwertes verarmt. Selbst in Großbritannien hat man das strenge Gesetz unveräußerlichen Erblehens nicht für geeignet befunden, eine erbende Klasse dadurch weiter zu erhalten. Sein Grund und Boden befindet sich in raschem Übergang in die Hände Fremder. Unter republikanischen Einrichtungen ist die Verteilung des Eigentums an die Kinder ja viel gerechter, aber die Frage, die sich in allen Ländern dem Denkenden aufdrängt, ist die: Warum sollen die Menschen ihren Kindern große Vermögen hinterlassen? Wenn es aus Liebe geschieht, ist es dann nicht eine falsch geleitete Liebe? Die Wahrnehmung lehrt, dass es für die Kinder, allgemein gesprochen, nicht gut ist, wenn man sie mit einer solchen Bürde belastet. Ebenso wenig gut ist es für den Staat. Mehr vorzusehen als bescheidene Einkommensquellen für die Frau und die Töchter und sehr bescheidene Beträge, wenn überhaupt welche, für die Söhne, möge man wohl Bedenken tragen, denn es steht außer Frage, dass große hinterlassene Summen oft mehr zum Schaden als zum Nutzen der Empfänger wirken. Weise Leute werden bald den Schluss ziehen, dass solche Vermächtnisse im Hinblick auf das wahre Interesse ihrer Familienglieder wie des Staates einen unrichtigen Gebrauch ihrer Mittel darstellen.
Es ist dies nicht so zu verstehen, dass diejenigen, die es unterlassen haben, ihre Söhne zum Erwerb ihres Lebensunterhaltes zu erziehen, sie aufs geradewohl der Armut preisgeben sollen. Wenn es jemand passend gefunden hat, seine Söhne in der Absicht großzuziehen, dass sie ein träges Leben führen sollen, oder ihnen, was sehr lobenswert wäre, das Gefühl eingeflößt hat, dass sie ohne Rücksicht auf den Geldpunkt für öffentliche Zwecke wirken können, so ist es dann natürlich seine Vaterpflicht, zuzusehen, dass in maßvoller Weise für sie gesorgt ist. Es gibt Beispiele von Millionärssöhnen, die, reich aber durch den Reichtum unverdorben, dem Volke noch große Dienste leisten. Sie sind das wahre Salz der Erde und ebenso wertvoll wie sie leider selten sind. Man muss indessen nicht die Ausnahme, sondern die Regel ins Auge fassen, und ein denkender Mensch, der die gewöhnliche Folge der Übertragung ungeheurer Summen auf Erben betrachtet, muss sich einfach sagen: "Ich möchte meinem Sohne lieber einen Fluch als den allmächtigen Dollar hinterlassen," und sich selbst eingestehen, dass nicht das Wohl der Kinder, sondern Familienstolz diese Vermächtnisse eingibt.
Was die zweite Form anlangt: den Reichtum beim Tode zu öffentlicher Benutzung zu hinterlassen, so darf man sagen, dass dies ein bloßes Mittel der Verfügung über Reichtum ist, wenn sich jemand begnügt zu warten, bis er tot ist, um in der Welt noch zu etwas gut zu sein. Die Kenntnis der Wirkungen solcher Legate ist nicht dazu angetan, die glänzendsten Hoffnungen zu erwecken, dass durch sie nach dem Tode viel Gutes gestiftet wird. Der Fälle sind nicht wenig, wo der wirkliche, vom Erblasser verfolgte Zweck nicht erreicht wird, auch kommt es nicht selten vor, dass seine wirklichen Wünsche völlig durchkreuzt werden. In vielen Fällen werden die Vermächtnisse so benutzt, dass sie nur zu Denkmälern seiner Torheit werden. Es ist deshalb gut, daran zu erinnern, dass es kein geringeres Geschick erfordert, um Reichtum in einer der Gesamtheit wahrhaft nützlichen Weise zu verwenden, als Reichtum zu erwerben. Außerdem kann man wohl sagen, dass niemand für das zu loben ist, was er schließlich tun muss, auch schuldet ihm das Gemeinwesen, dem er nur beim Tode Reichtum hinterlässt, keinen Dank. Von Leuten, die auf diese Weise unermessliche Summen hinterlassen, darf man ohne weiteres annehmen, dass sie überhaupt nichts hinterlassen haben würden, wenn sie es hätten mitnehmen können. Ihr Gedächtnis kann nicht in dankbarer Erinnerung bewahrt werden, denn aus ihren Gaben spricht kein Wohlwollen. Man braucht sich nicht zu wundern, dass solchen Vermächtnissen so allgemein der Segen zu fehlen scheint.
Die zunehmende Neigung, großen, beim Tode hinterlassenen Besitz immer höher zu besteuern, ist ein tröstliches Anzeichen dafür, dass sich in der öffentlichen Meinung ein heilsamer Wechsel vollzieht. Der Staat Pennsylvanien nimmt jetzt – mit einigen Ausnahmen – ein Zehntel des von seinen Bürgern hinterlassenen Eigentums. Das dem britischen Parlament kürzlich vorgelegte Budget enthielt den Vorschlag, die Erbschaftssteuern zu erhöhen, und zwar soll die neue Steuer bezeichnenderweise eine abgestufte sein. Von allen Formen der Besteuerung scheint dies die weiseste. Denjenigen, die ihr ganzes Leben lang fortgesetzt große Summen aufhäufen, deren richtige Verwendung zu öffentlichen Zwecken der Gesamtheit, aus der sie hauptsächlich flossen, Nutzen bringen würde, sollte zum Bewusstsein gebracht werden, dass die den Staat bildende Gesamtheit nicht in dieser Weise ihres eigenen Anteils beraubt werden darf. Durch die hohe Besteuerung des Besitzes beim Todesfall bekundet der Staat seine Verurteilung des unwürdigen Lebens selbstsüchtiger Millionäre.
Es wäre wünschenswert, dass die Staaten in dieser Richtung viel weiter gingen. Allerdings ist es schwer, denjenigen Teil des Vermögens eines reichen Mannes zu bestimmen, der bei dessen Tode durch die Vermittlung des Staates dem Gemeinwohl zukommen soll, und auf jeden Fall müssten solche Steuern derart abgestuft werden, dass bescheidene Summen für Dienende befreit bleiben und mit den anschwellenden Beträgen dann eine recht rasche Steigerung eintritt, bis von des Millionärs Schätzen, wie denen Shylocks, wenigstens die andere Hälfte in den geheimen Schrein des Staates fließt. Diese Politik würde dazu beitragen, den Reichen zu bestimmen, der Verwaltung des Reichtums zu Lebzeiten obzuliegen, ein Ziel, welches die Gesellschaft, als das bei weitem Ersprießlichste für das Volk, stets im Auge behalten sollte. Es braucht auch nicht befürchtet zu werden, dass diese Politik den Unternehmungsgeist in seinen Wurzeln untergraben und die Menschen weniger bestrebt zum Geldanhäufen machen würde, denn der Klasse, deren Ehrgeiz es ist, große Vermögen zu hinterlassen, um nach dem Tode besprochen zu werden, wird es nur noch mehr Beachtung und eine etwas edlere Genugtuung verschaffen, ungeheure Summen aus ihrem Vermögen dem Staate gezahlt zu haben.
Es verbleibt also nur ein Modus, große Vermögen zu benutzen, aber in ihm besitzen wir das wahre Heilmittel gegen die zeitweilig ungleiche Verteilung des Reichtums, die Aussöhnung der Reichen und Armen – ein Reich der Harmonie, ein neues Ideal, das freilich von dem der Kommunisten abweicht, indem es nur die Weiterentwicklung bestehender Verhältnisse, nicht den gänzlichen Umsturz unserer Kultur verlangt. Es stützt sich auf den gegenwärtigen höchsten Individualismus und die Menschheit ist vorbereitet, es schrittweise praktisch anzuwenden, so oft es Anklang findet. Unter seinen Schwingen werden wir einen idealen Staat haben, in dem der überschüssige Reichtum der Wenigen für das gemeinschaftliche Wohl verwaltet und daher im besten Sinne das Eigentum der vielen anderen wird, und dieser Reichtum, der durch die Hände der Wenigen geht, kann eine viel wirksamere Kraft zur Hebung der Menschheit werden, als wenn er in kleinen Summen an das Volk verteilt würde. Selbst die Ärmsten werden sich davon überzeugen lassen und zugeben, dass große Summen, die von einigen ihrer Mitbürger angesammelt und für öffentliche Zwecke ausgegeben worden sind, um der großen Menge zum Vorteil zu gereichen, wertvoller für sie sind, als wenn sie unter ihnen nur in geringfügigen Beträgen im Laufe vieler Jahre verstreut worden wären.
Betrachtet man die Wohltaten, die sich zum Beispiel aus dem Cooper-Institut auf den besten Teil der mittellosen Bevölkerung New Yorks ergießen und vergleicht man sie mit den Vorteilen, die der großen Masse aus einer gleichen, von Mr. Cooper zu seinen Lebzeiten in der Form von Löhnen verteilten Summe entstanden wären – und dies würde, da für getane Arbeit und nicht aus Mildtätigkeit geschehen, die höchste Form der Verteilung gewesen sein – so kann man sich von den Möglichkeiten zur Hebung der Menschheit, die das jetzige Gesetz der Anhäufung von Reichtum birgt, einen Begriff machen. Viel von dieser Summe wäre bei einer Verteilung in kleinen Mengen unter das Volk zu übermäßiger Befriedigung der Esslust verschwendet worden, und man darf bezweifeln, ob selbst der am besten, nämlich zur Erhöhung der häuslichen Behaglichkeit angewandte Teil für die Menschheit als solche Erfolge gezeitigt hätte, die denen, welche dem Cooper-Institut entspringen und von Generation zu Generation noch entspringen sollen, überhaupt vergleichbar sind. Die Verfechter eines gewaltsamen Wechsels von Grund auf mögen diesen Gedanken wohl erwägen.
Man könnte sogar so weit gehen, ein anderes Beispiel zu nehmen, dasjenige Mr. Tildens Vermächtnisses von fünf Millionen Dollar für eine freie Bibliothek in der Stadt New York; aber mit Bezug darauf muss man sich unwillkürlich sagen: Wie viel besser wäre es gewesen, hätte Mr. Tilden die letzten Jahre seines eigenen Lebens der richtigen Verwaltung dieser unermesslichen Summe gewidmet, da dann weder Rechtsstreitigkeiten noch sonstige Verzögerungsgründe die Verwirklichung seiner Ziele hätten stören können. Nehmen wir indessen an, dass Mr. Tildens Millionen schließlich noch dazu dienen werden, unserer Stadt eine prächtige öffentliche Bibliothek zu geben, wo die in Büchern enthaltenen Schätze der Welt jedermann unentgeltlich und kostenlos immerdar offenstehen sollen. Erwägt man das Wohl jenes Teiles der Bevölkerung, der sich in und um Manhattan Island befindet, so entsteht die Frage: Wäre sein dauernder Vorteil besser gefördert worden, wenn man diese Millionen in kleinen Summen durch die Hände der großen Masse hätte laufen lassen? Selbst der eifrigste Verteidiger des Kommunismus muss dies bezweifeln. Die meisten derjenigen, die nachdenken, werden nicht den geringsten Zweifel hegen.