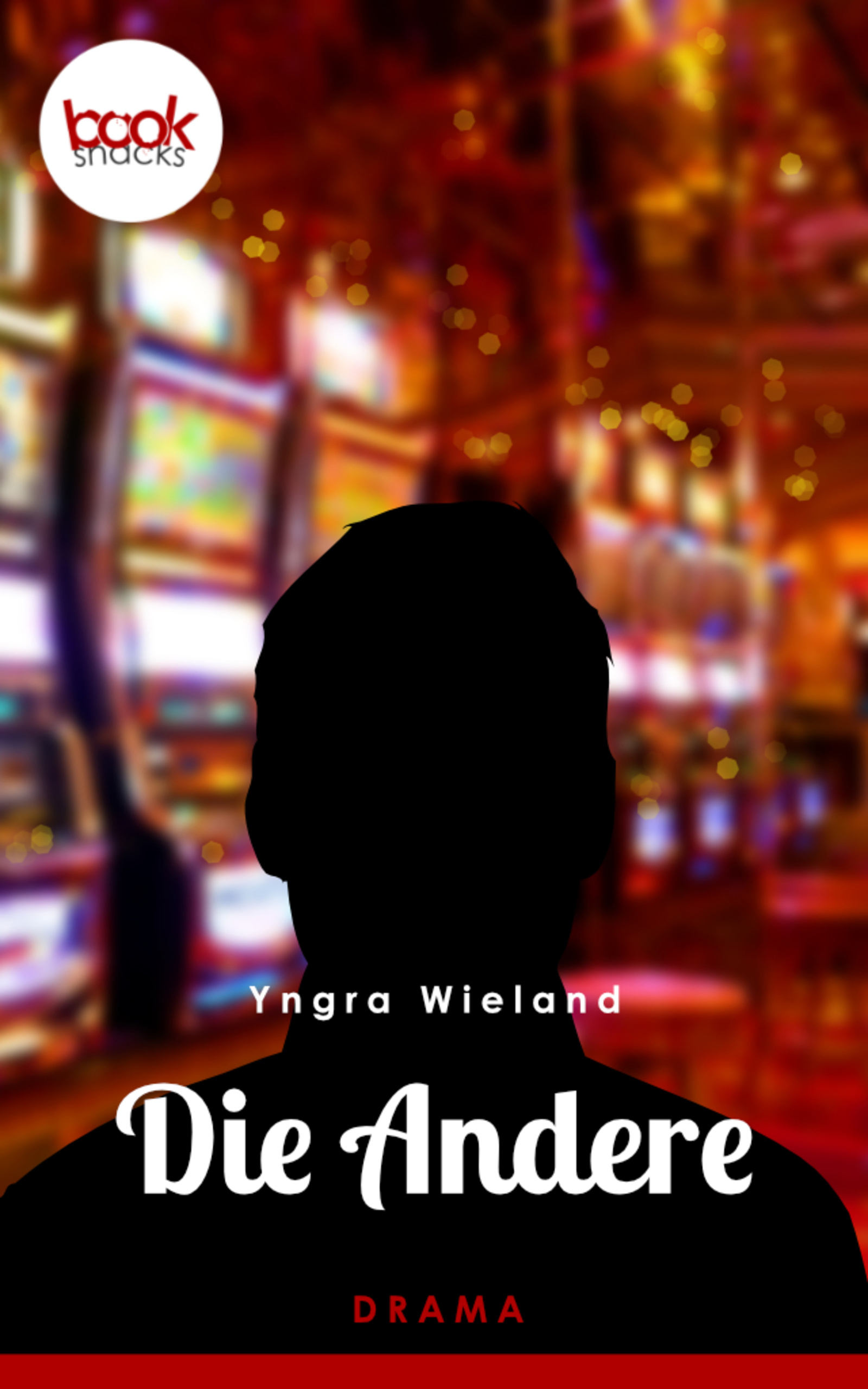4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Burgenwelt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Schicksale - ein gefährliches Geheimnis. München im Jahre 1471 – Ein Unfall in der rauen Isar führt Fronica, Tochter des Floßmeisters Resch, den Steinmetzgesellen Gabriel und den Flößerlehrling Lambert zueinander. Fortan sind ihre Schicksale miteinander verwoben. Während Lambert das lebensgefährliche Dasein als Flößer satt hat und mit dem Aufbau eines Handelsbetriebes der bitteren Armut zu entkommen versucht, will Gabriel sich mit einer unvergleichlichen Steinfigur für die gerade im Bau befindliche Kirche zu Unserer Lieben Frau einen Namen machen. Beide Männer haben einen beschwerlichen Weg vor sich, und zu allem Überfluss macht die heimliche Liebe zu Fronica sie auch noch zu Konkurrenten. Die Flößertochter indes hat ihre eigenen Herausforderungen zu meistern. Sie besitzt die Gabe Träume zu deuten und kann die Zukunft voraussehen. Eine heikle Fähigkeit, die sich keine geringere als Sidonie, Mätresse des Herzogs Albrecht IV von Bayern, zunutze machen will. Dabei kommt die Flößertochter einem lebensgefährlichen Geheimnis auf die Spur, das tiefer reicht als die reißenden Wasser der Isar … Yngra Wieland – Autorin der Erfolgsbücher „Der Tanz der Schäfflerin“ und „Das Schicksal der Schäfflerin“ verwebt in ihrem neuen Roman geschickt die Schicksale ihrer Protagonisten zu einem spannenden Abenteuer vor einer bildgewaltigen historischen Kulisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Geheimnis der Flößerin
Historischer Roman
von Yngra Wieland
Vollständige E-Book-Ausgabe der Druckausgabe
ISBN 978-3-943531-77-0
ISBN 978-3-943531-76-7 (Print Ausgabe)
© Burgenwelt Verlag | Jana Hoffhenke
Hastedter Osterdeich 241 | 28207 Bremen
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Juliane Stadler
Umschlaggestaltung | Illustration: Detlef Klewer
Satz | Gestaltung: Jana Hoffhenke
Ebook-Realisierung: Eridanus IT-Dienstleistungen
Für Gaby Kilian,
in herzlicher Freundschaft.
Vorwort
Helga Lauterbauch, Vorsitzende Flößer-Kulturverein München-Thalkirchen e.V.
Der historische Kontext dieses spannenden Romans ist im 15. Jahrhundert angesiedelt, als jährlich an die 3.000 Flöße an der Unteren Lände in München anlegten. Sie befand sich vor den Toren der Stadt bei der Salzbrücke an der Isar. Zwölf Münchner Floßmeister betrieben das Gewerbe. Die Stadt zählte damals an die 13.000 Einwohner.
Das unter Herzog Albrecht IV. aufblühende spätgotische München benötigte große Mengen an Baumaterial. Die mit Rohstoff reich gesegneten Isarwinkler kamen dadurch mächtig ins Geschäft. Erstmals wurde das Floßholz knapp und der Herzog musste ein Landgebot zur Schonung der Junghölzer erlassen.
In dieser außen- und innenpolitisch schwierigen Zeit regierte der junge Albrecht IV. seit 1476 als Alleinherrscher auf dem bayerischen Thron. Als erster Wittelsbacher humanistisch ausgebildet, gestaltete er das Staatswesen entsprechend und förderte die Künste in großzügiger Weise.
Die Herzogburg, der Alte Hof zu München, ist glanzvoller Mittelpunkt seiner prächtigen Feste. Unterschiedlichste Menschen treffen hier aufeinander, meist in der Hoffnung, möglichst lange von der Gunst Albrechts IV. profitieren zu können.
Einen weiteren wichtigen Schauplatz im Roman stellt die Frauenkirche dar, die seit der Grundsteinlegung im Jahre 1468 schnell zu einer mächtigen Hallenkirche heranwächst. Mittelalterliche Moralvorstellungen der Kleriker und die frommen Absichten der Bruderschaften, die an den Seitenaltären ihre Andachten halten, stehen sich gegenüber. Sie wetteifern untereinander auf der Suche nach einem geheimnisvollen Dokument.
Die Bauleitung der Kirche zu unserer Lieben Frau aber liegt in Händen des Stadtbaumeisters Jörg von Halspach. Nebenher muss er noch den Bau des Alten Rathauses beaufsichtigen. An Arbeitsplätzen mangelt es nicht. Viele Handwerker finden Arbeit und Brot in diesem Umfeld. Von morgens bis abends dauert ein Arbeitstag, unterbrochen von zwei Pausen für ein Süpplein zur Stärkung. Trotz der kräftezehrenden Arbeit verspürt ein Steinmetzgeselle die Energie, seine künstlerische Ideal-Vorstellung einer Marienfigur umzusetzen. Was hat er damit vor?
Die Handwerker der Frauenkirche und die Flößer kennen sich. Allein für das Gebälk des gewaltigen Dachstuhls werden 147 Flöße gebraucht. Immer wieder kommt es dabei beim Floßtransport zu Unglücksfällen im Wasser. Trotzdem vertrauen Menschen den mutigen Floßmeistern ihr Leben an, wenn es auf schnellem Wege nach München oder weiter isarabwärts gehen soll.
Für den Roman »Das Geheimnis der Flößerin« taucht Yngra Wieland fantasievoll ins 15. Jahrhundert ein. Fesselnd beschreibt sie diese Zeit mit vielen historischen Details. In spannenden Schritten deckt die Autorin das Geheimnis um die Flößerin auf.
Helga Lauterbach, München, Juli 2017
Kapitel 1 - Rautgundis’ Geschichte
Gegeben zu Frauenwörth, X Martius MCDLV anno domini. Ehrwürdiger Bischof Tulbeck, erlauchte Eminenz, ich, Rautgundis zu Engelshofen, wende mich in allerhöchster Not und tiefster Reue an Euch. Ich habe eine schwere Sünde begangen, trotzdem erhoffe ich Eure Vergebung und flehe Euch um Hilfe an. Ich habe mich zu einer unseligen Leidenschaft mit dem Domprobst Hartwig von Redern hinreißen lassen. Aus dieser Verbindung ist ein Kind hervorgegangen, daraufhin sagte sich Hartwig von Redern von mir los. Als meine Tochter das Licht der Welt erblickte, war sie unstrittig als sein Kind zu erkennen. Seit ihm dies zu Ohren gekommen ist, hat er bereits zwei Anschläge auf mein Leben und das meines Kindes unternehmen lassen. Gnädige Eminenz, ich bitte Euch inständig, bringt Hartwig von Redern zur Besinnung, haltet Eure schützende Hand über das unschuldige Leben meines Kindes. Falls mir etwas zustoßen sollte, ist für meine Tochter gesorgt. Mein Sohn aus der Ehe mit Graf Martin zu Engelshofen, meinem verstorbenen Gatten, befindet sich in Vorbereitung seiner geistlichen Laufbahn im Kloster zu Freysing. Für ihn wird gesorgt sein. Eminenz, erbarmt Euch Eurer unwürdigen Dienerin.
In Demut und voll Scham werfe ich mich vor Euch in den Staub und hoffe inständig auf Eure Hilfe.
Eure untertänigste Dienerin Gräfin Rautgundis zu Engelshofen.«
Zögerlich setzte Rautgundis ihre Unterschrift unter das Schreiben. Ihre Hand begann zu zittern, der Federkiel entglitt ihren eiskalten Fingern. Tinte kleckste auf das Schreibpult, rann über das blankgescheuerte Holz. Im Kerzenschein glich das Rinnsal einer dünnen Blutspur. Mit fahrigen Bewegungen streute sie Sand auf die nassen Schriftzüge, erhitzte Wachs und versiegelte das Schreiben. War sie verfolgt worden? Ob sie einem Boten vertrauen konnte? Würde dieser ihr Schreiben an Bischof Johannes Tulbeck überbringen, oder würde auch er sich kaufen lassen und das Dokument unverzüglich ihrem Peiniger übergeben? Sie begann in der engen Klosterzelle auf und ab zu gehen. Der Säugling greinte leise. Sie beugte sich über das Bettchen, musterte kummervoll das Gesicht des Kindes.
»Schschsch«, machte sie geistesabwesend und nahm ihren ruhelosen Gang wieder auf. Tränen der Verzweiflung rannen über ihre Wangen. Wie konnte der Mann, der einst behauptete in Liebe zu ihr entbrannt zu sein, derart grausam handeln? Rautgundis war hingerissen gewesen von den Aufmerksamkeiten, die er ihr zu Teil hatte werden lassen, und von seiner stolzen Erscheinung. Sein Äußeres und seine Haltung ließen auf den ersten Blick den hohen katholischen Würdenträger erkennen und er hatte eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf sie ausgeübt. Es war nicht ungewöhnlich, dass Kirchenmänner Mätressen hatten, und es geschah ebenso oft, dass aus diesen Liebschaften Kinder hervorgingen. Niemals würde sie sein Mienenspiel vergessen, als sie ihm bebend vor Aufregung mitgeteilt hatte, dass sie sein Kind unter dem Herzen trug. Für den Bruchteil eines Augenblicks hatte sich sein Gesicht in unbändigem Zorn verzerrt, bevor sich eine glatte Maske darüber legte und er ihr die unglaublichen Worte ins Gesicht schleuderte.
»Ich habe mir nicht umsonst meine Stelle als protegierter Kleriker erkämpft. Ich wünsche Euch und Eurer zukünftigen Familie viel Glück. Dem Vater meine Empfehlung. Geht jetzt, ich habe zu tun.«
Wie betäubt hatte sie sein Gemach verlassen, war einer Schlafwandlerin gleich in eine Mietsänfte gestiegen und hatte sich nach Hause bringen lassen. Das herrschaftliche Haus, das ihr Vater vor Kurzem als Stadtsitz für die Familie erworben hatte, war nicht weit entfernt, aber ihre Füße hätten sie nicht bis dorthin getragen. Im Halbdunkel der Sänfte dröhnte Hartwigs Stimme unablässig in ihrem Kopf. Ihre heimlichen Träume waren mit wenigen Worten zerschmettert worden, sie stand vor dem Nichts.
Die Kirchenglocken riefen die Nonnen zur Vesper und holten sie in die Wirklichkeit der kalten Zelle zurück. Vor dem schmucklosen, hölzernen Kreuz hielt sie an und kniete nieder. Stumm betete sie um eine Eingebung, und Gott gewährte ihr die Gnade. Nach dem Gebet war Rautgundis ruhig. Sie wusste, was sie zu tun hatte.
Beim ersten Tageslicht brach Rautgundis auf. Wehmütig blickte sie zurück auf das Klostergebäude, dessen Umrisse mit jedem Ruderschlag unkenntlicher wurden. Sie war dankbar für die Sicherheit, die ihr dieser Ort gewährt hatte, für die Ruhe, die sie gefunden hatte, wenigstens für einige Tage. Der Fährmann, der die wenigen Besucher des Benediktinerinnenklosters auf der Insel im Chiemsee übersetzte, ruderte stumm durch die Nebelschwaden, die über dem Wasser waberten. Das gleichmäßige Geräusch der eintauchenden Ruder, die Schreie der Möwen, das Klatschen der Flügel eines Wasservogels drangen gedämpft an Rautgundis’ Ohren. Ihre Lider waren schwer von den Anstrengungen in der Nacht. Sie blickte auf Frederica hinab, sah ihr in die Augen, die Hartwig von Rederns glichen, als wären es die seinen. Sie hatte sich versündigt und die Strafe erhalten, trotzdem glomm in ihr ein letzter verzweifelter Funke Hoffnung auf Rettung für sich und das Kind. Sie hatte ihr Möglichstes getan, jetzt musste sie ihr beider Los der höchsten Macht anvertrauen. Ihre Hände schmerzten bei jeder Bewegung. Die Handinnenflächen waren mit Blasen bedeckt, an manchen Stellen war das rohe Fleisch zu sehen. Sie biss die Zähne zusammen. Eine der Nonnen hatte die Wunden mit Heilsalbe und Verbänden versorgt, um die Schmerzen zu lindern.
An der Anlegestelle in Stadt zog der Fährmann das Boot an Land und half ihr ans Ufer. Sie bezahlte ihn großzügig und schickte einen am Ufer herumstreunenden Jungen nach ihrem Wagen. Der Fuhrmann und Barbera, ihre Kammerfrau und Vertraute, waren in einem Wirtshaus im Dorf untergebracht. Der Nebel löste sich in zarte Schleier auf, die ersten Sonnenstrahlen warfen blassgelbes Licht auf die Uferböschung. Bangen Herzens ging Rautgundis auf und ab, blind für die Schönheit des im Morgenlicht glitzernden Sees. Abseits der Klostermauern fühlte sie sich schutzlos und ausgeliefert. Sie atmete auf, als endlich der Wagen mit dem Wappen derer zu Engelshofen vor ihr hielt. Barbera sprang heraus und beeilte sich, ihr das Kind abzunehmen. Sie warf Rautgundis besorgte Blicke zu.
»Herrin, Ihr seid entsetzlich blass! Seid Ihr unwohl?«
Rautgundis blickte unruhig umher. Sie wusste nicht, ob das Gefühl, sie würden beobachtet, richtig oder ihrer Müdigkeit zuzuschreiben war.
»Ich habe schlecht geschlafen. Lasst uns aufbrechen, ich will bei Zeiten in München ankommen.«
Als sie den Wagen bestiegen, erspähte Barbera Rautgundis’ verbundene Hände und stöhnte mitleidig auf.
»Herrin, was ist Euch zugestoßen?«
Rautgundis schüttelte matt den Kopf.
»Eine Unachtsamkeit, nichts weiter.«
Kaum setzte der Wagen sich in Bewegung, fiel Rautgundis in einen unruhigen Schlaf. Jedes Mal, wenn das Gefährt durch ein Schlagloch rumpelte oder anhalten musste, um Gegenverkehr vorbei zu lassen, schreckte sie hoch. Ihr schmerzender Körper erinnerte sie an die schrecklichen Stunden der Geburt. Sie war ohnmächtig geworden, als die heimlich in der Nacht herbeigerufene Hebamme mit groben Händen das Kind aus ihr herausgezogen hatte. Die schleichende Angst, die Besitz von ihr ergriffen hatte, als sie Frederica das erste Mal ins Gesicht sah. Einer der Bediensteten musste geredet haben, wie sonst hätte Hartwig davon erfahren? Hatte er die Hebamme bestochen, jemand ihrer Dienerschaft gekauft? Die Bilder des Überfalls stiegen in ihr auf, die Rettung durch einen beherzten Passanten im letzten Augenblick. Zuerst hatte sie geglaubt, es handele sich um Strauchdiebe, die es auf Geld und Geschmeide abgesehen hatten. Als sie den Kerl mit dem verschlagenen, pockennarbigen Gesicht aber einige Tage später erneut in der Nähe ihres Hauses herumlungern sah, hatte sie gewusst, dass es kein gewöhnlicher Überfall gewesen war. Schlagartig hatte sie sich daran erinnert, dem Mann schon einmal begegnet zu sein. Er stand im Dienste Hartwigs. Vor Angst bebend, hatte sie sich im Haus verschanzt, traute sich nicht, ihrem Vater eine Botschaft zu schicken, ihn um Hilfe zu bitten, er war ahnungslos über ihren Sündenfall. Nach ein paar Tagen hielt sie es nicht mehr aus. Sie ließ Barbera das Notwendigste für sich und das Kind zusammenpacken und floh beim Morgengrauen zu den Benediktinerinnen nach Frauenwörth, an den Ort, an dem die geliebte Mutter ihre letzten Jahre verbracht hatte. Die Abgeschiedenheit der Insel hatte Rautgundis Klarheit geschenkt. Sie wusste jetzt, an wen sie sich wenden konnte – Fürstbischof Johannes Tulbeck, einst Beichtvater ihrer Mutter. Sie hatte von dem Sohn eines Münchner Goldschmieds stets als weisem und gerechtem Diener Gottes gesprochen, schon, als er noch Pfarrer an der Marienkirche gewesen war. Johannes Tulbeck würde ihr helfen, sie war sich sicher. Er galt als frommer Mann. Den Plan, einen Boten mit der Übergabe des Schreibens zu beauftragen, hatte sie fallen gelassen. Sie würde selbst zum Bischofsitz gehen und dafür sorgen, dass Tulbeck das Schreiben bekam. Alles andere war zu riskant. Sie trug den Brief bei sich, niemand außer dem Fürstbischof durfte ihn zu sehen bekommen. Kurz vor Torschluss erreichten sie München. In der Herberge am Thaltor fanden sie Unterkunft. Sie konnte die Schönheit des Raumes mit seinen getäfelten Wänden und Decken, schachbrettgemusterten Mosaikböden, Butzenscheibenfenstern und selbst das Himmelbett mit seinen weichen Federbetten nicht genießen, die Unruhe war zu groß. Am nächsten Tag würden sie weiterfahren nach Freysing.
Rautgundis schlief traumlos in dieser Nacht. Als sie erwachte, fühlte sie das dringende Bedürfnis, um Beistand zu beten. Sie wies Barbera an, zu packen und den Wirt zu bezahlen, nahm Frederica und ging die wenigen Schritte von der Herberge zur Marienkirche. Als sie auf die Kirche zusteuerte, meinte sie, aus dem Augenwinkel einen Schatten wahrzunehmen, der hastig in einem Bogengang verschwand. Ihr Herz begann, hart zu klopfen. War es möglich, dass die Widersacher ihr bereits die ganze Zeit auf den Fersen waren, oder sah sie Gespenster? Sie ging schneller. Eine Gestalt löste sich aus dem Dunkel eines Torbogens, bewegte sich auf sie zu. Rautgundis’ Kehle schnürte sich zusammen. Sie beschleunigte ihren Schritt. Gehetzt sah sie über ihre Schulter. Erkannte den Pockennarbigen. Sie wollte schreien, um Hilfe bitten, aber die Leute schoben sich achtlos an ihr vorbei. Nur noch wenige Schritte, dann würde sie den Schutz der Kirche erreichen. Sie huschte durch das Portal, tauchte ihre Finger in das Weihwassergefäß, beugte das Knie und bekreuzigte sich. Ihr Atem flog. Man durfte das Schreiben nicht bei ihr finden, auf keinen Fall. Ihr Blick glitt durch das Halbdunkel der Kirche. Rautgundis hörte, wie das Portal geöffnet wurde und den dumpfen Laut, mit dem es sich wieder schloss. Mit zitternden Händen nestelte sie den Brief hervor, faltete ihn kleiner und schob ihn in einen Mauerspalt am Sockel des Nothelferaltars. Ganz in ihrer Nähe befand sich der Seiteneingang. Rautgundis nahm all ihren Mut zusammen und lief hin, Frederica an sich gepresst. Gnädige Mutter, lass das Tor nicht verschlossen sein. Sie drückte die Klinke herunter, floh ins Freie. Ein leichter Regen hatte eingesetzt. In nackter Angst eilte sie die Straße entlang, nur fort von ihren skrupellosen Verfolgern. Unter ihrem Umhang bewegte sich das Kind, wimmerte kläglich. Sie hatte sich verlaufen, wo war der Marktplatz, wo das Gasthaus, in dem Barbera wartete? Keuchend rannte sie die breite Straße entlang. Da vorn war das Stadttor. Sie drängte sich rücksichtslos zwischen den Leuten hindurch, wollte Abstand zwischen sich und ihre Verfolger bringen. Rautgundis konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, es gab nur noch blanke Angst. Hatte sie die Schurken abgeschüttelt? Sie fand sich draußen vor den Stadtmauern wieder. Der Regen rauschte gleichmäßig herab. An einem Stapel aus rohen Baumstämmen musste sie sich ausruhen, ihre Seite schmerzte, ihr Atem holperte. Nasse Strähnen lösten sich aus ihrer Frisur und klebten an ihrer Wange. »Da drüben ist die Schlampe!«
Sie ahnte die Bewegung mehr, als dass sie sie sah, sprang auf und floh. Sie strauchelte, fing sich wieder. Vor ihr war der Fluss, hinter sich hörte sie raue Männerstimmen. Sie kamen näher, immer näher.
»Gnädiger Gott, vergib mir!«
Rautgundis lief geradewegs auf den Fluss zu, verlor einen Schuh. Sie spürte die Kälte kaum, watete weiter. Das Wasser zog an ihren Röcken. Sie ließ sich fallen, das Kind fest umklammert.
Kapitel 2 - Die Floßlände
München, im März 1471
Halt fest! In Gottes Namen, lass die Oblast nicht aus!«
Der Floßmeister brüllte gegen den Donner, verbissen gegen das vordere Ruder gestemmt. Gischt sprühte um seinen Kopf und vermischte sich in der Luft mit dem herabprasselnden Regen. Der Himmel war ebenso dunkel wie die Fluten, auf denen sie um ihr Leben und um ihre Ladung kämpften. Lambert drückte sich mit letzter Kraft gegen die Wand aus Fässern, die bedrohlich ins Wanken geraten war. Seine Arme zitterten vor Kälte und Schmerz. Seit Tagesanbruch waren sie unterwegs, hatten gehofft, noch vor Ausbruch des seit dem Mittag am Himmel dräuenden Wetters die Lände in München zu erreichen, aber die Natur war unbarmherzig.
»Heiliger Nikolaus steh uns bei!«, ächzte Lambert.
Mit einer Hand klammerte er sich an den Stützbalken der Abdeckung, die die kostbare Fracht zusammenhielt. Die Knöchel seiner Hand traten bläulich weiß hervor. Fässer mit schneeweißem Kalk aus dem Oberen Isartal hatten sie geladen. Baumeister Joerg von Halspach stellte höchste Ansprüche an das Material, das er an den beiden größten Baustellen in München verwenden ließ. Lambert hatte gehört, wie der berühmte Baumeister den Handel mit Floßmeister Resch abgeschlossen hatte. Halspach hatte derart schwärmerisch von dem Kalk gesprochen, als würde er die Haut einer schönen Frau beschreiben. Lambert drückte die Stirn gegen das raue Holz, seine Nackenmuskeln waren zum Zerreißen gespannt. Er hörte Alois, den Steurer, schreien, aber das Heulen des Windes und der Donner, der den Himmel zerriss, übertönte alles Menschliche. Durchhalten, Lambert, du musst durchhalten, beschwor er sich selbst und suchte verzweifelt nach einem Gedanken, der ihm die nötige Kraft dazu verleihen würde. Fronica. Fronicas Lächeln, das manchmal wie ein Sonnenstrahl zwischen den dunklen Wolken des Alltags hervorbrach und sein ganzes Sein innerhalb eines Augenblickes erhellte.
»Für dich, Fronica, und unsere Zukunft«, knirschte er und stemmte sich mit aller Macht gegen die Fässer. Das Floß tat einen gewaltigen Ruck durch die Wasserstrudel und schoss um die Biegung, haarscharf an einem hervorstehenden Felseneck vorbei. Sie glitten unter dem peitschenden Regen dahin, am Horizont zackten Blitze über das Schwarzblau des Himmels. Lambert schloss kurz die Augen und atmete auf. Sie hatten es wieder einmal geschafft. Durch die Regenschleier sah er von Zeit zu Zeit schemenhaft Marterln vorbeigleiten, Erinnerungen an das Schicksal der weniger Glücklichen, die ihren letzten Atem in den Armen der Wassernymphen ausgehaucht hatten. Lambert schauderte. Von Frühjahr bis Winter, so die Witterung es zuließ, riskierten sie Tag für Tag ihr Leben auf den Wassern der Isar. Bald war das Jahr als Floßknecht vorbei und er kam seinem Ziel ein Stück näher. Lambert hatte Glück, sein Floßmeister ließ ihn über den Winter in der Dachkammer des Flößerhauses wohnen und er konnte sein Auskommen in der kalten Zeit mit Holzhacken und Schreinerarbeiten verdienen. Sein Münzvorrat, den er in einem Kästchen unter einem Dielenbrett aufbewahrte, vermehrte sich stetig. Lambert liebte nichts mehr, als nach der Heimkehr abends in seiner Kammer am Boden zu hocken, die Münzen durch die Finger gleiten zu lassen und von seiner Zukunft zu träumen. Ein reicher Mann würde er sein, mit einem Haus aus Stein und einem Pferd. Dienerschaft würde er haben und eine schöne Frau, die ihm Söhne schenken würde. An dieser Stelle seines Tagtraumes überkam ihn oft die brennende Sehnsucht nach Fronica, der Tochter seines Meisters. Ihre elfenhafte Gestalt, das feingeschnittene Gesicht, Haar wie aus Mondlicht gesponnen. Meist übersah sie ihn, aber wenn sie ihn manchmal mit einem Ausdruck anblickte, als wäre sie nicht von dieser Welt, wollte ihm der Atem vergehen. Trotz ihres Makels erschien sie ihm als das begehrenswerteste Wesen auf Erden, als die einzige Frau, die ihn aus seiner harten, feindseligen Welt befreien konnte. Vor ihnen lag die Münchner Lände. Der Ländhüter und seine Knechte standen am Ufer bereit. Lambert warf einem das Seil zu. Er warf ungeschickt, der Mann erwischte es und zog unvermittelt. Das Floß stieß an die Uferbefestigung und Lambert, noch immer mit den Gedanken bei Fronicas Lippen, verlor das Gleichgewicht. Rücklings stürzte er ins Wasser, versuchte Halt an dem Seil zu finden, riss es dem Ländknecht dabei aus der Hand. Hart schlug Lambert mit dem Kopf an eine Ländsäule.
»Ihr beide geht zur Lände und schaut, ob das Floß vom Resch angekommen ist. Überwacht das Abladen! Ich traue dem Flößerpack nicht über den Weg.«
Gabriel, der gerade die Schablone an den Stein anlegte, sah unwillig auf.
»Meister, ich bin noch nicht fertig mit …«
»Geh zur Lände, sage ich. Den Stein kannst du später fertighauen.«
Gabriel tauschte einen missmutigen Blick mit Albin, der am Platz neben ihm arbeitete. Es goss und er verspürte wenig Lust, sich aus dem Schutz der Bauhütte in die feuchte Kälte hinauszubewegen. Trotz der warnenden Geste des Werkmeisters verzog Albin das Gesicht zu einer Grimasse, legte Hammer und Meißel beiseite und ging hinaus. Gabriel folgte ihm. Die Stimmung Meister Sebolds war in den letzten Tage granitgrau wie die Wolken am Himmel, besser man folgte seinen Anweisungen widerspruchslos und ging ihm aus dem Weg. In der Regel war Gabriel zufrieden mit seiner Arbeitsstelle. Ab Petri Stuhlfeier begann die Arbeit in der Bauhütte um fünf Uhr morgens und endete mit dem Sechsuhrläuten am Abend. Eine halbe Stunde Pause für die Suppe, eine Stunde für die Mahlzeit am Mittag. Dafür erhielt er sechsundzwanzig Pfennige am Tag, er kam gut damit aus. In letzter Zeit aber war eine Sehnsucht in ihm erwacht, die er nicht bezwingen konnte. Gabriel beeilte sich, Albin einzuholen, im Gehen schlug er seine Kapuze über den Kopf und übersah dabei die Lade eines Mörtelmischers, die dieser hinter sich her schleifte. Er stolperte darüber und fiel der Länge nach auf den aufgeweichten Boden. Albin lachte laut heraus, als er Gabriel im Dreck liegen sah. Als er dessen Gesichtsausdruck bemerkte, kam er versöhnlich auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen.
»Los steh auf, dein Mittagsschläfchen kannst du anderswo halten!«
Gabriel wischte sich verärgert die Hände an seiner Hose ab und schickte dem Mörtelmischer einen Fluch hinterher. Albin sah ihn kopfschüttelnd an.
»Welche Laus ist dir bloß über die Leber gelaufen? Seit Tagen grantelst du vor dich hin, nichts ist mit dir anzufangen!«
Gabriel sah ihn stirnrunzelnd an und überlegte einen Moment lang, ob er Albin den Grund für seine schlechte Laune verraten wollte.
»Ich bin es leid, immer nur die eintönigen Steine für den Fries zu hauen. Wasserspeier will ich meißeln, Kapitelle, Schlusssteine, die Verzierungen an den Portalen! Vor allem die Figuren für das Hauptportal! Meister Joerg will die alten Figuren nehmen, habe ich ihn sagen gehört, aber ich will eine neue Mutter Gottes schaffen, wie es ihresgleichen nicht gibt!«
In seiner Vorstellung sah er die perfekte Marienstatue vor sich, ein Lächeln huschte über sein Gesicht, verschwand aber sofort wieder.
»Diese stumpfsinnige Steinklopferei treibt mich in den Wahnsinn«, knurrte er schließlich, »wenn ich nur wüsste, wie ich den Baumeister von meiner Figur überzeugen könnte.«
Albin bedachte ihn mit einem Blick, den Gabriel nicht deuten konnte, erwiderte aber nichts. Gabriel winkte gereizt ab.
»Ach, lass gut sein. Komm wir gehen! Trockener wird es nicht.«
Die beiden Steinmetzgesellen bahnten sich ihren Weg durch das geschäftige Treiben der Baustelle, die auf engstem Raum der inneren Stadt zwischen den Häusern lag. Die neue Kirche wurde um die alte, viel zu klein gewordene herumgebaut. Zwei Jahre, bevor Gabriel mit seiner Steinmetzbruderschaft aus Regensburg hierhergekommen war, hatte man die Fundamente im Osten und Norden ausgehoben. Joerg von Halspach war vom Rat als Stadtmaurer eingestellt worden und ließ zunächst den alten Kirchturm abtragen. Danach begann man im Osten mit dem Mauerwerk und arbeitete sich über den Norden nach Süden voran. Sobald die Kirche fertiggestellt wäre, würde sie die letzte Ruhestätte des verstorbenen deutschen Kaisers, Ludwig den Bayern, aufnehmen. Gabriels Blick blieb an den Männern im großen Laufrad hängen und seine Unzufriedenheit wurde etwas milder. Das waren wirklich arme Teufel! Den ganzen Tag rackerten sie in dem hölzernen Rad, um Holzbalken, Steine und Mörtel zu den Arbeitern hoch oben auf den Gerüsten hinaufzubefördern. Wenn sie vor Erschöpfung oder aus Unachtsamkeit ausrutschten und im Gestänge hängenblieben, kostete es sie ihre Knochen oder schlimmstenfalls das Leben. Mehr als einmal hatte er einen Sterbenden seinen letzten Hauch unter dem Rad verröcheln sehen, mit zerquetschtem Brustkorb, die Gedärme aus dem Leib geplatzt. Sie gingen in Richtung Thal und Gabriel war gerade dabei, den Ausflug als eine angenehme Abwechslung zu empfinden, als ein Schwein auf ihn zulief und grunzend an seinen Schuhen schnüffelte. Verärgert gab er dem Tier einen Tritt in das speckige Hinterteil, das Schwein rannte quiekend davon.
»Dieser Mistviecher werden immer dreister! Irgendwann gibt es mehr Schweine als Menschen in der Stadt!«
Gabriel sah finster auf ein Rudel Schweine, das im Unrat neben einer Wirtsstube wühlte und wich einem Kothaufen aus, den eines der Tiere hinterlassen hatte.
»Ist es dir nicht fad, tagaus tagein die gleichen langweiligen Muster zu meißeln?«, forschte er.
Albin sah selbstvergessen einer Magd nach, die ihm mit einem koketten Hüftschwung ausgewichen war.
»Ach was soll’s, für einen Fries werde ich ebenso bezahlt wie für einen Schlussstein und den Ruhm heimst am Ende ohnehin der Baumeister ein«, wiegelte Albin ab und steuerte auf einen Bäckerstand zu.
»Warte, ich will mir krumme Krapfen kaufen.«
Als Gabriel der warmwürzige Duft des Schmalzgebackenen in die Nase kroch, knurrte unwillkürlich sein Magen. Er griff nach seinem Beutel und lugte hinein.
»Auch für mich drei, guter Mann!«
»Da sind das feinste Mehl, die frischesten Eier, köstlicher Käse und edelste Gewürze drin!«, pries der Standbesitzer seine Ware vollmundig an und reichte Gabriel die Krapfen.
Herzhaft biss der in die hufeisenförmige Köstlichkeit.
»Au! Verdammt, ist das heiß!«
Er spuckte wütend den glutheißen Batzen aus. Das Brennen auf seiner Zunge trieb ihm Tränen in die Augen. Er riss den Mund auf und fächelte Luft hinein. Heute ging ihm wahrlich alles daneben!
Sie passierten den Zimmerplatz, dort wurden die angelieferten Stämme behauen, die dem Bau von Gerüsten und dem Dachstuhl der Kirche dienen würden. Als sie die Floßlände erreichten, fiel der Regen nur noch spärlich. An der Stelle, an der die schweren Flöße ankamen, zogen Männer mit langen Haken Triftholz an Land, Befehle und raue Flüche schollen durch die Luft. Fuhrwerke standen bereit, um die Güter in die Stadt zu bringen. Der Ländaufseher trieb seine Gehilfen an, die beim Abladen der Flöße zur Hand gingen, kassierte die Hänggebühr, achtete darauf, dass an der Weinlände niemand unerlaubt aus den Weinfässern trank.
»Tölzer Prügel!«, schrie ein Floßmann, unverkennbar ein derber Tölzer, von einem anländenden Floß und warf Kleinholz in die Isar, worauf einige herumlungernde Gestalten ins Wasser rannten und sich darum balgten. Mehrere Flöße schaukelten an den Uferwänden, die Fracht wurde über Bretterstiegen abgeladen. Albin stieß Gabriel mit dem Ellenbogen an.
»Da, wir haben Glück, das Reschfloß kommt gerade an.«
Gabriel schaute in die Richtung, in die Albin zeigte. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Lambert ins Wasser stürzte und nicht wieder auftauchte, das Floß vom Fluss weggezogen wurde. Unaufhaltsam näherte es sich einem Brückenpfeiler. Die beiden Männer auf dem Floß stemmten sich mit Stangen dagegen, vergeblich. Gabriel handelte, ohne es zu wollen. Er ließ seinen letzten Krapfen fallen, sprang mit ein paar mächtigen Sätzen in den Fluss. Das eiskalte Wasser raubte ihm beinahe die Sinne, er sah wie durch einen Nebel. Gabriel schnappte nach Luft, griff in die grauen Wasserstrudel und bekam den Jungen am Arm zu fassen. Gabriel versuchte verzweifelt, ihn nach oben zu ziehen, aber das Tau hatte sich um den Flößer gewickelt. Das schwere Floß trieb unaufhaltsam in die Flussmitte. Vergeblich zog und zerrte er an dem Körper, der bleischwer tiefer sank. Schließlich sah Gabriel nur einen Ausweg. Er holte Luft, tauchte ins eisige Wasser und befreite den immer noch Bewusstlosen von dem Seil. Keuchend kam er an die Oberfläche, wickelte sich das Tau um den Arm, im anderen Arm den Jungen, stemmte sich verbissen gegen den Sog, spürte endlich wieder Boden unter den Füßen. Inzwischen war es den Flößern gelungen, mit Stangen und Haken Halt zu finden. Sie leisteten nach besten Kräften Beistand, um das Floß ans Ufer zu staken und es zu verankern. Andere Männer waren aufmerksam geworden, kamen ihm entgegen und halfen, den Floßknecht an Land zu bringen. Gabriel ließ sich zu Boden fallen, er rang nach Luft, fassungslos über sich selbst. Als er wieder bei Atem war und die Augen öffnete, stand Albin kopfschüttelnd vor ihm.
»Was hast du dir dabei gedacht? Bist du deines Lebens derart überdrüssig?«
»Hätte ich den armen Teufel ersaufen lassen sollen? Wo warst du eigentlich?«, hustete Gabriel und spie aus.
Albins Miene verfinsterte sich, Röte breitete sich auf seinem Gesicht aus.
»Ich kann nicht schwimmen«, gestand er schließlich kleinlaut.
Gabriel rappelte sich auf und schaute sich nach dem Verunglückten um.
»Lebt der Floßmann?«
Ein graubärtiger Riese in den hohen Stiefeln eines Flößers kreuzte neben ihm auf. Gabriel sah in das wetterzerklüftete Gesicht des Floßmeisters Resch.
»Ich stehe in deiner Schuld«, der Flößermeister kratzte sich verlegen am Kopf, »die Isar ist manchmal eine recht ungestüme Braut! Einen Augenblick Unachtsamkeit meines Knechts hätte ich beinahe teuer bezahlen müssen. Wenigstens ein Pfund Pfennige und die Stadthaft hast du mir erspart, zwei Pfund Schillinge für das Floß und obendrein das Leben meines Floßknechts gerettet! Wie kann ich’s dir vergelten?«
Gabriel versuchte, seine nasse Kleidung auszuwringen, so gut es ging. Der Stoff klebte wie eine eisige Haut an seinem Körper.
»Ein heißer Würzwein und eine Schale Suppe wären nicht schlecht, wenn du so fragst. Ansonsten war es um der Liebe Christi Willen«, versetzte er und versuchte, nicht zu zittern.
»Werkmeister Sebold hat uns hergeschickt, um nach deinem Floß Ausschau zu halten.«
Den schmählichen Ausspruch des Steinmetzmeisters über die Vertrauenswürdigkeit der Flößer behielt er wohlweislich für sich.
»Sobald die Ladung verschafft ist, lade ich dich auf eine anständige Mahlzeit dort drüben ein.«
Resch wies auf das Wirtshaus unweit der Lände. Das Zunftschild, das im Wind vor dem Gasthaus baumelte, zeigte den Heiligen Nikolaus, den Schutzpatron der Flößer. Gabriel dankte dem Mann mit einem Nicken. Die Kälte, die sich seiner bemächtigt hatte, war inzwischen schier unerträglich. Schlotternd ging er zu dem Verunglückten hinüber, der wieder zu sich gekommen war. An der Schläfe des Burschen begann sich eine gewaltige Beule zu wölben. Er sah zu Gabriel hoch. Der Blick aus dunklen Augen wirkte müde und hart zugleich.
»Ich verdanke dir mein Leben. Ohne dich wäre ich jetzt bei den Wassernixen. Ich habe ihre langen Haare schon an meinem Hals gespürt. Sie winkten, haben ihre weißen Arme nach mir ausgestreckt.«
Er schauderte, kam mühsam auf die Beine.
»Ich heiße Lambert. Du hast etwas gut bei mir.«
Mit einem schiefen Grinsen setzte er hinzu:
»Die Floßmeister wollen lieber Knechte, die nicht schwimmen können, die kämpfen mehr um das Floß. Hat nicht geklappt bei mir.«
Gabriel war überrascht von der Gefasstheit des Flößerknechts, der um Haaresbreite dem Tod entgangen war. Lambert strahlte eine Ernsthaftigkeit aus, die nicht zu seiner Jugend passte. Er schlug in die ihm entgegengestreckte Hand ein.
»Ich bin Gabriel Neuhauser, Steinmetzgeselle.«
Kapitel 3 - Die Seherin
Fronica sah der Frau des Müllers nach, die gemächlich davon stapfte. Sie war zufrieden gewesen mit dem, was Fronica für sie im Wasser gesehen hatte. Die Mutter würde das Mehl gut gebrauchen können, selbst wenn sie es nicht mochte, dass Fronica für die Leute das Schicksal weissagte. Sie beugte sich erneut über die Schale, rührte das Wasser mit dem Haselzweig. Ihr Blick suchte die Mitte, dort, wo der kleine Strudel kreiselte. Wie jedes Mal, wenn sie das Wasser schaute, wurde ihr schwindelig, ein Gefühl, als würde sie unter die Wasseroberfläche gezogen. Sie rang nach Luft. Einen Augenblick lang schwankte ihr Oberkörper, fing sich wieder. Sie wurde still, neigte sich tiefer über die Schale, ließ ihren Blick ins Wasser hineinziehen. Langsam formte sich ein Gesicht, die Augen in blankem Entsetzen aufgerissen, als würden sie den Tod erblicken. Sie fuhr zurück, das Haselstäbchen fiel zu Boden. Im Nu war sie auf den Füßen, die Schale kippte um, das Wasser versickerte im Boden. Fronica rannte auf das Haus zu, warf sich in die Arme der Mutter, so wie sie es als Kind getan hatte.
»Der Vater, bestimmt ist ihm etwas zugestoßen. Ich habe es im Wasser gesehen!«
Fronica spürte die Hand der Mutter auf ihrem Scheitel.
»Fronica, dein Vater ist der beste Flößer auf der Isar. Lass halt die dumme Wasserleserei sein! Dabei kann nichts Gutes herauskommen!«
»Sein Gesicht, die Augen, als wäre er …«, sie weinte still. Zum Kummer ihres Vaters fürchtete Fronica nichts mehr als die wilden Wasser der Isar. Sie vermied es, wann immer es möglich war, dem Fluss nahe zu kommen. Allein das Rauschen des Wassers konnte sie in Angst und Schrecken versetzen. Sie richtete sich auf und schob die Augenklappe zurecht.
In solchen Momenten hasste sie ihre Gabe. Für die Menschen, die ihren Rat suchten, konnte sie die Bilder klar deuten, fragte sie jedoch für sich selbst, blieben die Botschaften meist rätselhaft, warfen mehr Fragen und Ängste auf, als sie Antwort und Zuversicht gaben. Die letzten Tage hatte sie eine seltsame Unruhe erfasst, als würde bald etwas Bedeutsames geschehen, das ihr Leben von Grund auf änderte. Jedes Mal, wenn sie versuchte, das Gefühl zu ergründen, entzog es sich ihr, als würde es sich im Nebel auflösen. Die Mutter reichte ihr ein Schaff.
»Es ist Zeit, die Ziegen zu melken.«
Als Fronica zum Ziegenstall hinüberging, nahm sie sich wieder einmal vor, dem Wasser keine Fragen mehr zu stellen, die sie selbst betrafen. Der scharfe Tiergeruch klärte ihre Sinne. Fronica kraulte die Schwarz-Weiße hinter den Hörnern und legte ihr einen Strick um die Vorderfüße, die Ziege ließ es willig geschehen. Das gleichmäßige Zischen der Milch beruhigte Fronica zusehends. Sie gähnte herzhaft. Die letzten Nächte hatte sie schlecht geschlafen, dunkle Träume waren durch ihren Schlaf gewandert und hatten ein Gefühl unbestimmter Bedrohung zurückgelassen. Ins Melken versunken schaute sie über den Rücken der Ziege zum Waldrand. Nebelschwaden zogen in der Dämmerung auf, legten einen sanften Schleier auf Büsche und Bäume. Hinter ihr raschelte es, aber als sie herumfuhr, bewegten sich nur die Weiden träge im Wind. Jemand beobachtet mich, dachte sie. Seit Tagen hatte sie das Gefühl, von Blicken verfolgt zu werden, aber wenn sie sich umsah, war niemand da. Sie löste den Strick und gab der Schwarz-Weißen einen freundlichen Klaps. Das Tier sprang meckernd davon und Fronica nahm sich gerade die nächste Ziege vor, als sie Männerstimmen hörte. Hastig stellte sie den Eimer zur Seite und rannte den Weg hinauf.
»Vater, endlich! Ich habe mir solche Sorgen gemacht!«
»Ich war es nicht, den die Isar heute beinahe verschlungen hätte! Um ihn hättest du dich sorgen können.«
Ihr Vater wies mit dem Daumen hinter sich auf Lambert, der sich vergeblich bemühte, unbeteiligt zu erscheinen. Fronica sah die Blässe seiner Haut unter schwarzem, strubbeligem Haar, die Starre in seinen Augen. Trotzdem, sie hatte keinen weiteren Blick für den Flößerknecht. Für sie zählte einzig und allein, dass ihr Vater heil und gesund nach Hause gekommen war. Sie schmiegte sich an seine Brust, genoss seine Wärme und Stärke, alle Gefahr war gebannt. Drüben im Wald schrie ein Kauz.
Der Wind pfiff ihm eisig um die Ohren. Gabriel schauderte und zog seinen Umhang enger. Zwei Tage hatte er fiebernd in seiner Kammer gelegen, an diesem Morgen hatte er sich gezwungen, aufzustehen und zur Baustelle zu gehen. Er wich einem hoch mit Ziegeln beladenen Ochsenkarren aus und machte sich im Inneren der Kirche auf die Suche nach dem Meister, um dessen Anweisungen entgegenzunehmen. In stiller Andacht ging er an den Altären an der Nordseite vorbei, die noch aus der alten Kirche stammten und nun weiter ausgebaut wurden. Ein Duftgemisch aus feuchtem Mörtel, Steinstaub und einer Ahnung von Weihrauch lag in der Luft. Er legte den Kopf in den Nacken und schaute nach oben, wo eine grob gezimmerte Bretterdecke die Heiligtümer so lange vor Wind und Wetter abschirmte, bis die Decke eingewölbt sein würde. Gestützt auf kraftvolle Achteckpfeiler würden sich zart ockerfarbene Sterngewölbe wie ein Schutzmantel über die Betenden spannen, so hatte es der Baumeister mit weitausholenden Gesten beschrieben. Hoch über ihm würden irgendwann die Schlusssteine und die Kreuzstücke, die er und die anderen Steinmetze schufen, das Dachgewölbe zieren. Wenn man die Kirche durch das Westportal betrat, stünde man vor elf Paaren glänzendweiß gekalkter Backsteinpfeiler, die im Mittelschiff auf Figurenkonsolen ruhten. Die Steinmetze hatten begonnen, Abbilder der Handwerker, die an der Kirche arbeiteten, an den Konsolen zu verewigen. Es wirkte, als würden die Handwerker die Pfeiler tragen.
Gabriel fiel es schwer, sich das vollendete Bauwerk vorzustellen. Er kannte keine Kirche, die in diesem Stil erbaut war. Dieser Bau sollte die Kirchen anderer Fürsten übertreffen, die Landshuter, die Ingolstädter, die Regensburger, das war das Ziel Herzog Sigismunds und damit das von Meister Joerg und jedem, der an dieser Baustelle arbeitete. Die Zunft der Goldschmiede hatte sich bereits das Recht gesichert, den Altar mit Zierrat und Ornat auszustatten. Wenn Gabriel nur endlich am Brautportal arbeiten könnte! Es kribbelte ihn in den Fingern, wenn er nur daran dachte. Er würde alles dafür geben, diese Arbeit tun zu dürfen. Gabriel bemühte sich, die aufkommende Ungeduld zu unterdrücken. Man hatte die Arbeit an der Nordseite der Kirche aufgenommen. Einige Steinsetzer arbeiteten bereits an der südlichen Außenfassade, geduldig setzten sie Ziegel für Ziegel aufeinander, immer wieder wurde die Richtschnur angesetzt und überprüft, ob die Wand gerade hochgezogen wurde. Gabriel nickte ihnen zu und ging weiter. Er hörte die Stimmen, bevor er jemanden sah und blieb, einer plötzlichen Regung folgend, hinter einer halbfertigen Säule stehen.
»Gute Arbeit, Albin, wirklich gute Arbeit!«
Gabriel wunderte sich. Steinmetzmeister Sebold war im Allgemeinen mit Lob sparsamer, als es Äpfel im Frühling gab. Etwas in Gabriel zwang ihn, hinter der Säule zu verharren und zu lauschen. Ein unbehaglicher Druck machte sich in seiner Magengegend breit.
»Schaut Meister, so stelle ich mir die Figur der Mutter Gottes vor. Ich habe einen Entwurf gezeichnet.«
Gabriel überlief es heiß und kalt zugleich. Er glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Litt er an Fieberphantasien? Was in aller Heiligen Namen machte Albin da?
Mit aller Macht unterdrückte er den aufsteigenden Hustenreiz und lugte hinter der Säule hervor. Auf einem Steinblock hatte Albin eine Skizze ausgebreitet.
»Hmm.«
Der Meister schob das Kinn vor und rieb sich den Bart, während er den Entwurf betrachtete. Er deutete auf die Zeichnung.
»Den Blickwinkel müsste man ändern. Sie soll auf das Kind schauen, aber gleichzeitig den Betrachter anblicken.«
Albin nickte eifrig und kratzte sich am Ohr.
»Das ist eine großartige Idee. So mache ich es!«
In Gabriel stieg unbändiger Zorn auf. Plötzlich wusste er Albins merkwürdigen Blick während ihres Gesprächs auf dem Weg zur Lände zu deuten. Dieser gemeine Verräter! Gabriel hatte ihm seine geheimsten Wünsche anvertraut, und kaum lag er krank in seiner Kammer, ging Albin hinter seinem Rücken zum Meister, schmeichelte sich ein und stahl ihm seinen Traum!
»Aber zuerst machst du mir noch einige vollendete Schlusssteine, hörst du!«
Blick und Tonfall des Steinmetzmeisters wurden streng.
»Beweise mir, dass du es kannst, dann gehe ich zu Meister Joerg und sage ihm, dass du die Figur machen willst.«
Er zögerte, wiegte den Kopf, als sei ihm noch etwas eingefallen.
»Vorausgesetzt, er will sie nicht selbst hauen …«
Gabriel erinnerte sich, dass der Baumeister, von dem man munkelte, er stehe mit dem Teufel im Bunde, dafür bekannt war, dass er gerne selbst Meißel und Klöpfel zur Hand nahm und bei fast jedem seiner Bauwerke einige Figuren selbst schuf. Gabriel beobachtete aus seinem Versteck, wie Meister Sebold Albin gutmütig auf die Schulter schlug und davon ging. Gabriel glaubte ohnmächtig zu werden, derart heftig tobten die Gefühle in ihm. Am liebsten wäre er hinter seiner Säule hervorgestürmt und hätte Albin die Fäuste ins Gesicht gedroschen. Er presste seine Hände vor den Mund, damit sein Keuchen ihn nicht verriet.
Was war das? Gabriel bekam seinen Atem unter Kontrolle, lauschte nach dem Geräusch. Kratzen, Metall auf Stein. Was machte Albin? Gabriel schob sich hinter der Säule hervor. Der Steinmetzgeselle kauerte am Boden und machte sich mit dem Messer an einem der unteren Steine eines Seitenaltars zu schaffen, tastete, drückte und klopfte dagegen. Die Kapelle des Heiligen Blasius und der unschuldigen Kindlein, stellte Gabriel voll Grimm fest. Wie passend! Er beobachtete, wie Albin auf die andere Seite des Steines kroch und in der Mauerritze stocherte. Offensichtlich suchte er etwas. Ein schleifendes Geräusch kündigte einen Mörtelmischer an. Gabriel zog sich in eine Seitennische zurück.
Am nächsten Morgen war Gabriel lange vor Albin in der Bauhütte. Voll Unmut hieb er auf seinen Stein ein, als Albin die Werkstatt betrat.
»Gabriel, bist du wieder gesund?«
Arglos kam Albin herbei.
»Warum willst du das wissen?«
Gabriel hielt sich nicht mit Feinschliff auf. Er blickte hoch, musterte Albin mit finsterer Miene.
»Hast die Zeit gut genutzt, in der ich krank war, nicht wahr?«, versetzte er.
Albin blickte verständnislos drein.
»Um dich beim Meister lieb Kind zu machen, meine ich.«
Gabriel meißelte erneut auf den Stein ein, Splitter, Steinstaub und Zorn umgaben ihn. Seine hölzerne Schablone verrutschte, er knurrte einen Fluch. Er konnte Albin nicht ansehen, ohne ihn schlagen zu wollen.
»Du willst hoch hinaus, koste es, was es wolle, habe ich Recht?«, stichelte er weiter.
Albin hatte genug. Er verschränkte die Arme und baute sich breitbeinig vor Gabriel auf.
»Was soll das? Hat dir das Fieber dein Hirn weggebrannt?«
Gabriel ließ den Meißel fallen und sprang auf.
»Du hast es nötig, mich zu beleidigen! Du Verräter, ich schlag dir den Schädel ein!«, brüllte er, außer sich vor Zorn. Er konnte sich nicht länger zurückhalten, mit beiden Fäusten stieß er Albin vor die Brust, der taumelte, fiel ins Freie. Gleich war Gabriel hinter ihm her, warf sich auf ihn, schlug wutblind auf den Steinmetz ein, dass ihm die Knöchel knackten. Albin wehrte sich, drängte ihn zurück, hieb ihm hart in die Seite. Bei dem Versuch auszuweichen, stieß Gabriel sich schmerzhaft den Kopf an einem Totenbernhard, einem missglückten Werkstück, das nicht ordentlich vergraben worden war. Er schrie auf. Verbissen rollten sie am Boden zwischen Steinblöcken, Sand und Werkzeug, knurrten und heulten wie kämpfende Wölfe, bis Albin die Oberhand bekam und es ihm gelang, Gabriels Arme auf den Boden zu drücken. Von dem Gebrüll angelockt, ließen die Windeknechte und Steintreiber ihre Werkzeuge im Stich, kamen herbeigelaufen und bildeten einen Kreis um die Kämpfenden. Einige Mönche eilten ebenfalls herbei, manche bekreuzigten sich.
»Seid ihr komplett narrisch? Aufhören sag ich, hört sofort auf!«
Gabriel dachte nicht daran aufzuhören. Durch einen roten Nebel sah er die Vision von Albin, selbstgefällig neben der Statue der Maria stehend, das Lob und die Anerkennung dafür einheimsend, spürte keinen Schmerz, nur Betrug und Verrat, lodernden Hass, der seine Brust sprengen wollte.
»Ich bring dich um, bei der Heiligen Mutter Gottes«, knirschte er, bäumte sich auf und warf Albin mit einem gewaltigen Ruck herum. Er ballte die Rechte, holte aus zu einem mächtigen Schlag – dann waren sie hinter ihm, er wurde hochgerissen, ein eiskalter Guss machte seine Sinne mit einem Mal klar. Er keuchte, schüttelte sich und taumelte zurück. Albin saß vor ihm am Boden, schmutzig, hielt sich den Arm. Aus seiner Nase rann Blut, der Kittel war über der Brust aufgerissen.
»Geht wieder an die Arbeit!«
Meister Sebold, der den Wasserkübel über den Kampfhähnen ausgegossen hatte, löste mit einer herrischen Geste die Meute von gaffenden Handwerkern auf.
»Ihr beide verlasst den Bauplatz. Auf der Stelle! Umsichtiges Verhalten ist hier lebenswichtig! Ich melde euch dem Baumeister. Er wird entscheiden, ob ihr weiter hier arbeiten könnt. Geht mir aus den Augen!«
Gabriel wandte sich wortlos ab, hörte, wie Albin aufbegehrte, wollte nur noch weg.
»Das ist ungerecht, Meister! Er hat mich angegriffen!«
Ziellos lief Gabriel durch die Gassen, bis er außerhalb der Stadtmauer vor dem Thaltor stand. Er ging an der Lände vorbei, die Fäuste noch immer geballt, sein Schädel brummte. Einmal war ihm, als rufe jemand seinen Namen, aber er wollte niemandem sehen und mit keinem reden. Er lief und lief, die Kälte kümmerte ihn nicht mehr. Vor seinen Augen fügten sich Bilder zusammen wie die leuchtend farbigen Glasfenster der Kirche. Seine Marienfigur, Albin mit dem Meister in der Kirche, der Flößerjunge im Wasser. Wo soll ich hin, wenn ich nicht mehr an der Frauenkirche bauen darf, dachte er, und sein Herz wurde hart wie eine geballte Faust. Seit Jahren hatte er seine ganze Kraft darauf ausgerichtet, ein guter Steinmetz zu werden, so wie es sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater vor ihm gewesen waren. Aber er, Gabriel, er wollte mehr! Er wollte Kunstwerke schaffen, ein Steinbildhauer wollte er sein, so herausragend, dass die Leute über ihn sprachen und ihn zu den herrlichsten Bauwerken riefen, damit er dort seine Kunst ausübte und die Kirchen, Paläste, Kathedralen damit einzigartig machte. Eines Tages würde er nach Frankreich reisen, um die Kathedrale von Chartres zu sehen. Seit er einige Mönche, die von einer Pilgerfahrt dorthin zurückgekehrt waren, darüber hatte sprechen hören, ließ ihm die Vorstellung, dieses Bauwerk zu sehen, keine Ruhe. Er stolperte und geriet ins Straucheln, bemerkte, wie schwach er auf den Beinen war. Gabriel lehnte sich gegen die raue Borke einer Ulme, ließ sich herunterrutschen, bis er auf seinen Fersen hockte. Elend fühlte er sich, der kalte Schweiß stand ihm auf der Stirn. Rasselnder Husten schüttelte ihn, der Schmerz zerriss seine Brust, er spie aus.
Inzwischen war ein schneidender Wind aufgekommen. Er blickte sich um, nach einer Hütte, nach Schutz, nach Wasser und Nahrung. Der Wald schaute ihm dunkel entgegen, dann, mit einem Mal rauschten die Zweige laut, als wollten sie die Angst übertönen, die in ihm emporkroch. Zwischen den Bäumen zeigten sich geisterhafte Fratzen und starrten ihn an, wurden größer, verschwammen vor seinen Augen. Er versuchte, die Klauen abzuwehren, die nach ihm griffen, langte ins Leere. Sie nahmen ihn mit.
Jemand rüttelte an seiner Schulter. Er drehte sich weg, wollte zurück dorthin, wo er eine Mutter Gottes geschaffen hatte, die derart lebensecht war, dass man vor ihr niederknien und den Saum ihres Gewandes küssen wollte. Er stand neben ihr, blickte in die bewundernden Gesichter der Menschen, von Halspach war unter ihnen, Meister Sebold, sogar sein Großvater zollte ihm, Gabriel, Respekt. Er fuhr hoch und blickte in ein uraltes, zerklüftetes Gesicht. Er war sich nicht sicher, ob er einen Mann oder eine Frau vor sich hatte.
»Keine Angst«, murmelte das Wesen in eigenartigem Singsang,»keine Angst, er ist dem Tod noch einmal ausgekommen, seine Zeit ist noch nicht da.«
Er versuchte zu sprechen, es gelang ihm nicht, seine Zunge lag wie ein trockener Klumpen in seiner Mundhöhle. Ein Becher näherte sich, zähe Flüssigkeit tropfte auf seine aufgesprungenen Lippen. Er schluckte widerwillig, stöhnte. Bitter schmeckte es in seinem Mund. Bevor er dankbar ins Dunkel zurücksank, meinte er, einen Engel hinter dem faltigen Wesen zu sehen.
Als er das nächste Mal zu sich kam, fühlte er sich kräftig und hungrig genug, um einen Ochsen zu verspeisen. Er öffnete langsam die Augen. Der Schein des Feuers im Herd war die einzige Lichtquelle in der Hütte. Er war allein. Gabriel stellte fest, dass er auf ein Lager aus mehreren Strohsäcken gebettet war, darüber ein geflicktes, aber reines Tuch. Beschämt bemerkte er, dass er unter der Decke nackt war. Er setzte sich auf. Am Fußende lag seine Kleidung, sauber und trocken. Hastig kleidete er sich an, war gerade dabei, in seine Stiefel zu schlüpfen, als sich die Tür knarzend öffnete. Gabriel hob den Kopf und erstarrte. Seine Mutter Gottes stand vor ihm! Das feingeschnittene Gesicht, der weiche Bogen der Braue, es war das Gesicht der Marienfigur in seinen Träumen! Nur die Binde, die das rechte Auge verbarg, verlieh ihr etwas Fremdartiges und der trotzige Schwung der Lippen war etwas zu kühn für eine Marienfigur.
»Es geht dir besser.«
Ihre rauchdunkle Stimme berührte sein Innerstes und ließ einen Schauer auf seiner Haut zurück.
»Hast du mich … meine Kleider …?«
Ein schneller Blick streifte ihn. Wortlos stellte sie einen Korb auf den Tisch, packte Brot, zwei Eier und einen weichen, weißen Käse aus, legte ihren Umhang auf der Bank ab. Aus einem Eimer goss sie Wasser in den Kessel über dem Feuer und gab verschiedene Kräuter hinein. Ihre Bewegungen waren weich und fließend, wie ein schmaler Bach, gesäumt mit Wildblumen, mit blanken Kieseln darin, vom ewigen Fließen rund geschliffen, dachte Gabriel, der nicht aufhören konnte, sie anzusehen.
Jetzt warf sie einen Blick in den Kessel, nickte zufrieden und schöpfte einen Becher voll.
»Trink das.«
Gabriel erinnerte sich an den gallig bitteren Geschmack und verzog das Gesicht.
»Trink.«
Widerstrebend nahm er ihr den Becher ab.
»Wie lange bin ich schon hier?«
Unter ihrem fordernden Blick setzte er den Becher an die Lippen, ließ die Flüssigkeit in seinen Mund laufen, stöhnte.
»Drei Tage hast du hier gelegen. In einem gottserbärmlichen Zustand warst du. Ohne die Heilkünste der alten Anna hättest du es nicht geschafft.«
Sie schnitt einige Scheiben Brot, schob sie ihm hin. Gabriel war entsetzt. Drei Tage! Er erinnerte sich an die Schlägerei mit Albin und sein Kopf wurde heiß. Er musste zurück, sich bei Albin entschuldigen und den Meister bitten, ihn wieder auf der Baustelle arbeiten zu lassen. Sein Magen knurrte. Zuerst musste er essen, dann würde er sich aufmachen und tun, was zu tun war. Er musste seine Marienfigur erschaffen, jetzt, wo er sie deutlicher denn je vor Augen hatte! Gierig biss er in das Brot, kaute, stopfte etwas von dem Käse hinterher. Als sein Hunger gestillt war, fiel ihm ein, dass er dem Mädchen nicht einmal seinen Namen genannt hatte.
»Ich heiße Gabriel. Ich bin Steinmetzgeselle.«
»Was hattest du bei diesem Wetter im Wald zu schaffen?«
Gabriel wusste nicht, was er antworten sollte. Er setzte mehrmals zu einer Erklärung an, schaute auf seine Hände, als sähe er sie das erste Mal. Er entschied sich für die Wahrheit.
»Ich hatte Streit mit einem anderen Gesellen. Wir prügelten uns und wurden von der Baustelle verwiesen. Ich bin einfach weggelaufen, ohne Ziel.«
Er stand auf, wischte sich die Hände an der Hose ab.
»Deshalb muss ich schleunigst zurück. Ich muss das in Ordnung bringen.«
Was sie jetzt wohl von ihm dachte? Sobald er die Sache mit Albin ins Reine gebracht hatte, würde er sie zeichnen, damit seinem Gedächtnis nicht die winzigste Einzelheit dieses Gesichtes verloren ging.
»Wo ist Anna? Ich will ihr danken und meine Schuld begleichen.«
Er tastete nach seinem Beutel, zog ein paar Kreutzer heraus.
»Anna ist bei der Gerberin. Das Kind kommt.«
Er stand unsicher da, drehte die Münzen in den Fingern. Unvermittelt streckte er den Arm aus, nahm ihre Hand und legte die Münzen hinein. Ihre zierliche Hand verschwand in seiner Pranke.
»Was ist …«, er zögerte, aber schließlich siegte die Neugier, »… mit deinem Auge?«
Ein schnelles, kaum wahrnehmbares Kopfschütteln war die Antwort. Gabriel hielt noch immer ihre Hand in seiner.
»Danke.«
Er stieß die Tür auf und trat hinaus in den kalten Nebel. Es musste die letzten Tage ununterbrochen geschneit haben, eine dichte Schneedecke hatte den Wald in glitzernde Stille gehüllt, obwohl der Frühling vor der Tür stand. Sie lehnte in der Türöffnung, zeigte auf eine schwach sichtbare Fußspur, die sich zwischen Büschen verlor.
»Folge meinen Spuren, sie führen zum Fluss.«
Er nickte und stapfte durch den Schnee davon. Nach ein paar Schritten fiel ihm etwas ein. Er drehte um, wollte fragen.
»Fronica. Mein Name ist Fronica.«
Ihre Stimme klang ihm den ganzen Weg über im Ohr. Der zurückgekehrte Winter hatte die Äste von Bäumen und Büschen am Flussufer mit filigranen Eiskristallen überzogen und Skulpturen daraus gezaubert. Aus den grauen Wolken begannen beständig große weiche Flocken zu sinken. Obwohl er ganz und gar keinen Grund zum Frohlocken hatte, fühlte er sich seltsam leicht. Er schritt kräftig aus, wollte schnell die Stadt erreichen, um diese dumme Geschichte aus der Welt zu schaffen. Welcher Teufel hatte ihn nur geritten?
Fronica sah ihm nach, bis seine Gestalt sich zwischen den Bäumen verlor. Am liebsten wäre sie ihm nachgelaufen. Der merkwürdige Blick, mit dem er sie angesehen hatte. Fast ehrfürchtig. Oder grauste es ihm vor ihr? Sie berührte ihre Augenklappe. Wie sie es hasste, sie tragen zu müssen! Seine Augen waren schön, graublau und tief. In ihr keimte das Verlangen auf, sich an seine Brust zu lehnen, sich ihm anzuvertrauen. Er war groß, seine Schultern breit, seine kräftigen Arme luden dazu ein, sich halten zu lassen. Ein ganz normales Leben führen, ohne Visionen, ohne Geheimnisse. Ihre Finger spielten mit dem Ring, den sie an einer Kette um den Hals trug. Zu ihren Füßen hatte der hereingewehte Schnee eine Pfütze gebildet. Missmutig stampfte sie mit dem Fuß hinein. Was nutzte es schon? Das Leben, das sie sich wünschte, war nicht für sie bestimmt, so war es nun einmal. In gedrückter Stimmung räumte sie Annas Hütte auf. Sie verriegelte die Tür und folgte der Spur in den Wald. Fronica machte große Schritte, setzte ihre Füße in die Fußstapfen des Steinmetzes.
Daheim fand sie ihre Mutter in großer Aufregung. Ein in die Farben des Herzogs gekleideter Bote saß am Tisch und schlürfte Suppe. Die Mutter nahm Fronica beiseite.
»Eine hohe Dame aus der Hofburg schickt nach dir, Gräfin Sidonie von Riedenburg. Sie hat von deinen Fähigkeiten gehört und will, dass du für sie das Wasser schaust.«
Fronica sah überrascht auf.
»Du musst mitgehen. Aber sage ihr nichts. Erzähle ihr nur Belanglosigkeiten oder, noch besser sage ihr, dass du nichts sehen kannst.«
Das Gesicht ihrer Mutter verzog sich angstvoll.
»Es ist nicht gut, sich mit den Hoheiten einzulassen, glaube mir, Kind!«, warnte sie Fronica.
Fronica wandte sich ab, holte ihren Beutel und trat auf den Lakaien zu.
»Wir können gehen.«
Auf der Schwelle drehte sie sich zur Mutter um, die mit vor der Brust gefalteten Händen dastand, Sorgenfalten ins Gesicht gegraben.
»Sorge dich nicht, Mutter. Ich bin bald zurück.«
Fronica versuchte, Festigkeit in ihre Stimme zu legen. Während sie die Kapuze tief in die Stirn zog, fing sie den argwöhnischen Blick des Bediensteten auf und Fronica bemühte sich, möglichst finster dreinzuschauen. Schweigend folgte sie dem Mann den Treidelpfad entlang. Oben auf der Salzbrücke standen mehrere Fuhrwerke an, um dem Zolleintreiber den geforderten Preis zu bezahlen. Fronica sah sich scheu um. Der Trubel, der trotz der Kälte auf der Brücke herrschte, stand ganz im Gegensatz zu dem einsamen Leben, das sie im Flößerhaus führte. Sie sah mit Salzscheiben beladene Ochsenkarren, die unter dem Gewicht knarzend über die Holzbrücke rumpelten, einen Jungen, der eine Schar Gänse durch den Schneematsch trieb, Bäuerinnen mit Kiepen voll Eiern und getrockneten Kräutern, einen zweirädrigen Wagen, der mit Schaffellen beladen war. Sie konnte den Blick nicht von den Weichheit und Wärme versprechenden Fellen abwenden und prallte auf den Boten, der unvermittelt stehengeblieben war. Vor dem Thaltor hatte sich eine lange Schlange gebildet.
»Pass auf, wo du hintrittst, Weib!«, raunzte der Mann. Er musterte sie mit wachsamem Blick, als fürchtete er, sie würde ihn ob seiner Grobheit im nächsten Augenblick mit einem Bannspruch belegen. Fronica kämpfte die Aufregung nieder, die mit jedem Schritt, den sie auf die Hofburg zugingen, größer wurde. Wie hatte die hohe Dame von ihr erfahren? Was erwartete sie von ihr? Fronica war selten in der Stadt unterwegs. Ihr fiel auf, wie sauber die Straßen waren. Laut Verordnung musste Unrat in der inneren Stadt innerhalb eines Tages weggeschafft werden. Alle übelriechenden oder lärmenden Gewerbe wie Gerber und Schäffler befanden sich in der äußeren Stadt, im Schatten der Stadtmauern. Vor der Hofburg kreuzten grimmig aussehende Wachen ihre Hellebarden vor dem Tor. Als sie des Lakaien ansichtig wurden, traten sie zur Seite und ließen sie passieren. Fronicas Herz klopfte in der Kehle. Staunend sah sie sich um. Die Burg war in einem Viereck angelegt. Die eine Seite war von einer Kirche begrenzt, davor wölbte sich ein Bogengang. Der Innenhof war voller Menschen, edlen Pferden und Wagen. Ein riesiger blauer Vogel mit einem Krönchen auf dem Kopf schleppte ein unsagbar schönes Federkleid hinter sich durch den Schnee. Er hob den Kopf und stieß einen klagenden Schrei aus. Fronica schreckte zusammen und erinnerte sich daran, wo sie sich befand. Vor ihr lag ein Brunnen, um den sich Edelknaben und Mädchen ihres Alters scharten, dahinter wuchsen Linden. Ein Höfling zog einen Zweig herunter und ließ den Schnee auf ein Mädchen in einem scharlachroten Umhang rieseln, sie kreischte auf und schlug spielerisch nach ihm. Mägde huschten geschäftig umher, Diener trugen Behälter mit dampfenden Speisen vorüber. Eine Hofdame stolzierte an ihr vorbei und Fronica sah bewundernd auf den pelzverbrämten Mantel und die kunstvoll geflochtene Frisur. Sie hätte gerne alles genauer betrachtet, aber der Lakai zog sie ungeduldig zu einer Seitenpforte. Sie folgte ihm über Treppen und Gänge, bis sie vor einer prachtvoll verzierten Tür Halt machten.
»Warte hier, bis die Gräfin dich holen lässt.«
Sie nickte hastig und senkte den Kopf. Der Lakai warf ihr einen letzten, mürrischen Blick zu und stampfte grußlos davon. Einige Zofen rauschten kichernd an ihr vorbei. Eine von ihnen, eine hübsche Brünette, warf ihr einen hochmütigen Blick zu und zog mit übertriebener Geste ihr Gewand an sich, damit es Fronicas Umhang nicht berührte. Fronicas Wangen begannen zu brennen. Die Tür öffnete sich, eine Frau winkte sie mit einer knappen Handbewegung herein.
»Komm.«
Fronica fühlte sich beklommen. Sie war noch nie einer hohen Dame von Angesicht zu Angesicht begegnet, hatte keine Ahnung, wie sie sich verhalten sollte. Als sie Sidonie von Riedenburg gegenübertrat, wusste sie, dass sie diesen Anblick in ihrem Leben nicht mehr vergessen würde. Die Gräfin erschien Fronica so überirdisch schön, dass sie vor Staunen vergaß zu atmen. Die junge Gräfin zu Riedenburg war noch nicht frisiert, ihre honigfarbenen Locken fielen weich bis zu ihrer Taille. Die Haare über der Stirn waren nicht ausgezupft, wie Fronica es ab und zu bei vornehmen Damen gesehen hatte. Ihre Haut schimmerte wie milchfarbene Seide, ihre Augen waren blauer als der Himmel über der Isar an einem Maitag. Das Gewand der Gräfin, die kaum älter als Fronica sein konnte, strahlte schneeweiß, die weiten Ärmel waren mit glänzend blauem Stoff unterfüttert, dasselbe Blau schmiegte sich um ihre Schultern und betonte ihre Augenfarbe. Den Rock, unter dem mit glitzerndem Stoff bezogene Schuhe hervorblitzten, zierten goldene Sterne, in deren Mitte winzige Steine funkelten, um die Taille trug Sidonie einen Gürtel aus goldener Spitze. Das Mieder ließ einen großzügigen Blick auf den Brustansatz der Gräfin zu. Fronica ertappte sich dabei, dass sie Sidonie mit offenem Mund anstarrte und senkte rasch den Blick. Sidonie schickte die Frauen, die im Hintergrund mit Kleidungsstücken hantierten, mit einer knappen Handbewegung aus dem Zimmer.
»Du bist jünger, als ich angenommen habe!«
Sidonie von Riedenburg ging um Fronica herum und musterte sie eingehend, als begutachte sie ein Pferd, das sie zu kaufen gedachte.
»Was ist mit deinem Auge geschehen?«
Die Stimme war kräftig und klar und ihr Klang ließ keinen Zweifel daran, dass die Herzogin gewohnt war, zu bekommen, was sie wollte.
Fronica errötete erneut.
»Eine Entstellung, Ihro Gnaden, ich …«, sie geriet ins Stocken, rang nach Worten, »ich habe sie schon seit meiner Geburt.«
Die Gräfin stand dicht vor ihr. Sie war ein deutliches Stück größer als Fronica. Der Duft von Lilien und etwas unsagbar Köstlichem, etwas, das Fronica noch nie gerochen hatte, hüllte sie ein. Sie legte zwei Finger unter Fronicas Kinn und hob es leicht an.
»Schade um so ein hübsches Gesicht.«
Sie beendete die Musterung und ließ sich anmutig auf einen Stuhl neben dem Kamin sinken. Sidonie griff in eine silberne Schale, in der sich rotbackige Äpfel türmten und wählte eine Frucht. Sie biss hinein und blickte nachdenklich in die Flammen, als hätte sie Fronicas Anwesenheit von einem Augenblick zum anderen vergessen. Fronica ließ ihren Blick umherschweifen. Die weinroten Samtvorhänge erzeugten eine heimelige Stimmung. Nahe beim Fenster hing ein Käfig mit einem kleinen, grünen Vogel, wie sie noch nie einen zu Gesicht bekommen hatte. Sie drehte sich unauffällig ein wenig, damit sie die andere Seite des Raumes sehen konnte, als sie entsetzt feststellte, dass Schneereste von ihren Schuhen abgeschmolzen waren und eine Pfütze auf den honigfarbenen Holzdielen bildeten. Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen.
»Steh nicht herum wie auf dem Jahrmarkt, komm her und setz dich zu mir!«
Die Gräfin wies auf den Stuhl ihr gegenüber. Fronica nahm ihren Umhang ab und legte ihn sorgfältig über die Stuhllehne. Sidonie betrachtete sie belustigt.
»Wenn du mir Gutes weissagst, kannst du dir bald ein schöneres Gewand leisten und musst nicht mehr in Lumpen daherkommen.«
»Das sind keine Lumpen«, fuhr Fronica auf, »meine Mutter hat mir den Umhang gewebt!«
Erschrocken sah sie der Gräfin ins Gesicht. So durfte sie nicht mit einer Dame von Stand reden! Sicher würde die Gräfin sie gleich hinauswerfen lassen. Sidonie tat nichts dergleichen. Sie hob lediglich eine Braue und nagte gelassen weiter an ihrem Apfel.
»Also, beginne. Was wird mir die Zukunft bringen?«
Fronica ließ sich auf der Stuhlkante nieder.
»Ich brauche eine Schale Wasser, Hoheit.«
»Mein Wohl oder Wehe liegt in einer Schüssel mit Wasser?« Die Gräfin lachte belustigt auf.