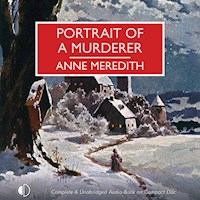7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Krimi
- Serie: British Library Crime Classics
- Sprache: Deutsch
»Mitreißend und beeindruckend« Dorothy L. Sayers England 1931, ein verschneites Landhaus am Weihnachtsabend, eine zerstrittene Familie, ein Mord. Wer tötete Adrian Gray? Ein psychologischer Kriminalroman in der Tradition von Agatha Christie. Im Original 1933 erschienen und nun erstmals auf Deutsch. Jedes Jahr im Dezember lädt das ebenso greise wie geizige Familienoberhaupt Adrian Gray die gesamte Verwandtschaft samt Anhang in sein abgelegenes Landhaus King's Polar ein. Und alle kommen, weil sie auf sein Geld aus sind, obwohl fast jeder einen Grund hat, ihn zu hassen. An Heiligabend versammelt sich die Familie wie gewohnt, nur dass am nächsten Morgen Gray ermordet aufgefunden wird. Hat sich eines seiner sechs Kinder seinen Weihnachtswunsch selbst erfüllt? Dieser nostalgische und ungewöhnliche Kriminalroman erzählt die Geschichte einer dunklen Weihnachtsnacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anne Meredith
Das Geheimnis der Grays
Eine weihnachtliche Kriminalgeschichte
Deutsch von Barbara Heller
Mit einem Nachwortvon Martin Edwards
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die englische Originalausgabe erschien 1933 unter dem Titel »Portrait of a Murderer. A Christmas Crime Story« by Victor Gollanz, London.
© Republished 2017 by The British Library, 96 Euston Road, London NW1 2DB
© Copyright Lucy Malleson, 1934
Nachwort Copyright © 2017 Martin Edwards
Für die deutsche Ausgabe
© 2018, 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGERUNDRASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Illustration von Dieter Braun Illustration, Hamburg
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98362-3
E-Book: ISBN 978-3-608-11502-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Erster Teil
HEILIGABEND
Zweiter Teil
HILDEBRAND GRAYS TAGEBUCH
Dritter Teil
DER ERSTE WEIHNACHTSTAG
Vierter Teil
NACH DEM VERBRECHEN
Fünfter Teil
DAS URTEIL ÜBER EUCH ALLE
Sechster Teil
ZEUGE DER VERTEIDIGUNG
Siebter Teil
DIE LÖSUNG
Epilog
Martin Edwards
Nachwort
Erster Teil
HEILIGABEND
1. ADRIAN
Adrian Gray wurde im Mai 1862 geboren und starb Weihnachten 1931 eines gewaltsamen Todes durch die Hand eines seiner eigenen Kinder. Das Verbrechen geschah aus dem Augenblick heraus, ohne Vorsatz, und der Mörder, noch nicht beunruhigt, geschweige denn verängstigt, stand nur stumm da, starrte ungläubig die Waffe auf dem Tisch an und sah dann zu dem Toten hin, der im Halbdunkel am Fuß der schweren Vorhänge lag.
2. DIE GRAYS
Zum Zeitpunkt seines Todes stand Gray in seinem siebzigsten Jahr und hatte sechs lebende Kinder. Ein siebtes war gestorben, vor so langer Zeit, dass die Jüngeren sich kaum noch daran erinnerten. Nur wenn Bitterkeit und Vergeblichkeit des Vaterseins den alternden Mann niederdrückten und er noch stärkeren Überdruss empfand als sonst, fragte er sich, ob der kleine Philip nicht vielleicht zu einem Trost, zu einem Gefährten für ihn herangewachsen wäre. Solche Stimmungen waren jedoch selten; meist dachte er so wenig wie seine Kinder an den Sohn, der vor dreißig Jahren gestorben war.
Zu Weihnachten pflegte er alle seine Verwandten in sein einsames Haus in King’s Poplars einzuladen. Mit der Frau eines seiner beiden Söhne und den Ehemännern zweier Töchter waren es neun an der Zahl, mit ihm selbst und Mrs. Alastair Gray, seiner neunzigjährigen Mutter, insgesamt elf Personen. Hinzu kam eine Reihe von Dienstboten, männlichen wie weiblichen.
Wie die Ermittlungen ergaben, stand sich Gray mit keinem seiner Kinder gut, vielmehr hatten einige allen Grund zu wünschen, er wäre ihnen nicht länger im Wege. Sein ältester Sohn Richard war zweiundvierzig, ein ehrgeiziger Mann, verbissen und wild entschlossen, sein Ziel, nämlich Rang und Namen, zu erreichen. Er war kinderlos – ein Umstand, der ihn peinigte und beschämte –, auf der politischen Bühne kein Unbekannter und einige Jahre zuvor in den Adelsstand erhoben worden. Seit etlichen Jahren war er mit Laura Arkwright verheiratet, einer angesehenen Dame der Gesellschaft.
Grays älteste Tochter Amy, das einzige seiner Kinder, das ledig geblieben war, führte ihm den Haushalt, eine kluge, streitbare Vierzigjährige, klein, mit scharfen Gesichtszügen, rötlichem Haar, dünnen Lippen und schmalen Händen.
Seine zweite Tochter Olivia war mit Eustace Moore verheiratet, einem intelligenten, aber skrupellosen Finanzier, dem Gray den Großteil seines Vermögens anvertraut hatte.
Der tote Philip war als Nächster gekommen und nach ihm Isobel. Sie hatte eine glänzende Partie gemacht, doch die Ehe hatte sich als katastrophal erwiesen. Gray war hocherfreut gewesen, als Devereux um die Hand seiner Tochter anhielt. Der Bewerber war reich, gutaussehend und allseits begehrt. Er stand – nicht ganz zu Unrecht – in dem Ruf, witzig und charmant zu sein, aber er hätte besser eine Frau aus seinen eigenen Kreisen geheiratet, nicht die junge, freiheitsliebende, glühend idealistische Isobel. Nach zwei Jahren hatte sie eingesehen, welche Dummheit sie begangen hatte, doch als sie sich deren Folgen zu entziehen suchte, musste sie feststellen, dass ihr die Hände gebunden waren. Ihr Mann erklärte ihr, dass der Versuch, sich von ihm scheiden zu lassen, ihr nichts als Schimpf und Schande einbringen würde, und sie sah ein, dass er recht hatte. Ein so beliebter Mann konnte an jedem Finger zehn Frauen haben, die bereit waren, ihn zu verteidigen. Isobel hielt es für unwahrscheinlich, dass er sich nicht nach allen Seiten abgesichert hatte, und so harrte sie noch ein weiteres Jahr aus. Dann brachte sie eine Tochter zur Welt, die jedoch nur sieben Monate alt wurde. Sie führte den Tod des Kindes auf eine bestimmte grausame Handlung des Vaters zurück und quälte sich wochenlang mit der Frage, wie sie die Tragödie hätte verhindern können. Schließlich schrieb sie an Gray, schilderte ihm, so gut sie konnte, ihr unerträgliches Leben in London und bat ihn, sie wieder bei sich aufzunehmen. Sowohl er als auch Amy beschworen sie in ihren Antwortbriefen, doch zu bedenken, in was für eine Lage sie sich damit brächte, wie die Leute sich den Mund über sie zerreißen würden und wie demütigend dies alles für sie wäre. Sie äußerten ihr Mitgefühl zum Tod des Kindes, ließen jedoch durchblicken, dass sie ihre Bitte einer aufgewühlten Gemütsverfassung nach dem Verlust zuschrieben, und sprachen hoffnungsvoll von einem »nächsten Mal«. Isobel reagierte nicht darauf, und in King’s Poplars hörte man nichts mehr von ihr, bis eines Tages Devereux selbst erschien und vorschlug, Isobel solle nach Hause zurückkehren, sie sei krank, halsstarrig, sie verweigere ihm fortgesetzt seine Rechte und er befürchte eine Verzweiflungstat ihrerseits, einen Selbstmord etwa.
»Und du meinst, für uns sei es angenehmer als für dich, den Skandal im Haus zu haben?«, lautete Grays beißender Kommentar.
Und Amy sagte: »Das Leben ist so schon schwer genug, auch ohne dass man noch ein Maul mehr zu stopfen hat.«
Devereux stellte klar, dass er seiner Frau eine ansehnliche Apanage zahlen würde, sofern sie in King’s Poplars blieb, worauf Vater und Schwester augenblicklich einlenkten. Eine Woche später war Isobel wieder da. Die älteren Dienstboten – eine Haushälterin, die die Familie seit vielen Jahren kannte und die ein Jahr später starb, sowie der altgediente Moulton – machten keinen Hehl aus ihrer Erschütterung über Isobels Aussehen. Sie war immer die Selbständige, die Mutige gewesen. Sie hatte sich im benachbarten Marktstädtchen eine Arbeit gesucht, sie war gern allein gewesen, hatte viel gelesen und ihre Ausflüge nach London genossen, und sie war eine häufige Besucherin in Buchhandlungen und Kunstgalerien gewesen. Isobel Devereux aber kam bleich und teilnahmslos zurück, ihrem Vater gegenüber verhielt sie sich unterwürfig, und ihrer Schwester Amy händigte sie widerspruchslos fast alles Geld aus, das ihr Mann ihr zahlte. Als Persönlichkeit wurde sie kaum wahrgenommen, doch sie erledigte zuverlässig jene gelegentlich anfallenden undankbaren häuslichen Pflichten, vor denen andere sich zu drücken pflegten.
Als Nächster kam Hildebrand, benannt nach dem berühmten Kardinal, ein schwieriger, auffallender, gutaussehender Mann. Er war düster und verschlossen, konnte jedoch unvermittelt aus sich herausgehen und blühte dann schön und unerwartet auf wie eine Blume oder ein Wunder; in der Familie aber blieb er schweigsam und übellaunig. Eigenwillig, starrköpfig und jähzornig, wie er war, hatte er seinem Vater von klein auf Sorgen bereitet, und schon früh hatte er jeden freundschaftlichen Verkehr mit seinen Verwandten abgebrochen, die seine Ideale und Pläne ablehnten und höchst ungnädig auf seine ständigen Bitten um finanzielle Unterstützung reagierten (verständlicherweise unter den gegebenen Umständen). Ihren Bekannten gegenüber erwähnten sie ihn selten, und so fristete er mit der Frau, die er geheiratet hatte, und einem Stall voller freudloser, unansehnlicher Kinder ein kümmerliches Dasein in einem kleinen Haus nahe dem Friedhof von Fulham.
Grays letztes Kind, Ruth, war seit acht Jahren mit Miles Amery verheiratet, einem einst vielversprechenden jungen Anwalt, dessen Karriere bedauerlicherweise nicht hielt, was sie versprochen hatte. Richard wie auch Eustace erzürnten und empörten sich über diesen eigenwilligen Verwandten, dem jeglicher Ehrgeiz zu fehlen schien und der auch gar nicht gewillt war, der Familie, in die er eingeheiratet hatte, Ehre zu machen. Sichtlich zufrieden ging er seinen unbedeutenden Angelegenheiten nach, ohne jemals höher hinaus zu wollen. Für ihn schienen ein bescheidenes Einkommen und ein kleinbürgerliches Haus in einem gediegenen Viertel das höchste der Gefühle zu sein. Fragte man ihn, wie es ihm gehe, bekam man zur Antwort, er erfreue sich bester Gesundheit und habe jede Menge Spaß.
»Spaß!«, rief Eustace mit Grabesstimme, in einem Ton, in dem Charles Dickens’ Chadband »Schnaps!« hätte rufen können, genauso sündhaft fand er das.
»Spaß!«, echote Richard, schockiert über ein in seinen Augen sträfliches Vertun von Chancen. »Was für Spaß?«
Eine gute Frage. Ruth hätte es ihnen sagen können. Es waren das Haus in St. John’s Wood, die beiden kleinen Töchter Moira und Pat und ihr ganzes glückliches und erfülltes gemeinsames Leben.
3. RICHARD
I
Am Morgen des vierundzwanzigsten Dezembers 1931, der so tragisch enden sollte, fuhren Richard Gray und seine Frau Laura erster Klasse nach King’s Poplars. Nach langem Schweigen ließ Richard die Times sinken, hob sein hochmütiges, melancholisches Gesicht und sagte in einem Ton so kalt und glatt wie ein Messingtürgriff: »Laura, vergiss um Gottes willen nicht, wie dein Vater über die Zölle denkt. Es ist von größter Wichtigkeit, dass er sich nicht aufregt, bevor ich Gelegenheit habe, die Lage mit ihm zu erörtern. Du weißt ja, wie er sich bei diesen politischen Meinungsverschiedenheiten ereifert.«
Richard sprach stets so, als hätte er einen Reporter in der Westentasche.
Laura, eine hochgewachsene, hübsche und sehr gut gekleidete Frau, sagte leichthin: »Du kannst dich auf meine Diskretion verlassen. Ich weiß selbst, wie wichtig es ist, dass er sich nicht aufregt. Schließlich liegt mir genauso viel an einem Titel wie dir daran, mir einen zu kaufen.«
Richard runzelte die Stirn und wandte sich wieder seiner Zeitung zu. Er fand die Äußerung seiner Frau geschmacklos. Laura war eine seiner weniger profitablen Investitionen. Als junger Mann, noch vor Abschluss seines Studiums, hatte er beschlossen, sein Leben zu einem Erfolg zu machen. Er hatte hart gearbeitet und sich einen großen Bekanntenkreis zugelegt, er war gereist und hatte sehr viel gelesen, hatte sich beigebracht, Golf zu mögen, und nasse Nachmittage lang einem Ball nachgeschaut, der unentwegt über glitschigen Rasen geschlagen wurde; in gewissen Kreisen hatte er sogar Geld bei Pferdewetten verloren. Mit dem Ergebnis, dass er sich innerhalb von zehn Jahren einen Ruf erworben hatte. Er hatte eine politische Karriere in Angriff genommen und wurde schon bald mit Ehrungen überhäuft. Stolzgeschwellt und voller Ehrgeiz erweiterte er seinen Bekanntenkreis, und mit dreißig lernte er Laura Arkwright kennen. Sie war drei Jahre jünger als er, hübsch, eine gute Partie, sie hatte eine einflussreiche Verwandtschaft, war gebildet, weltläufig und eine bekannte Amateurpianistin. Mit einem Wort: Sie war in jeder Hinsicht die passende Ehefrau für einen aufstrebenden Parlamentarier.
Richard, hochzufrieden mit seinem Weitblick, erwartete sich von diesem neuen Fühler, den er ausgestreckt hatte, eine Bereicherung seines Lebens. Doch er wurde in fast jeder Hinsicht bitter enttäuscht. Das Vermögen seiner Frau schmolz durch unkluge Spekulation weitgehend dahin. Schon recht bald nach der Heirat gab sie ihr Klavierspiel auf, aus dem erstaunlichen Grund, dass sie etwas gegen kommerzielle Kunst habe. Darüber sann Richard einige Zeit nach – er war schon genau wie sein Vater –, dann trieben ihn Kränkung und Neugier dazu, sie zu fragen, was sie damit meine. Sie meine, antwortete Laura obenhin, dass sie seinen Freunden nicht mehr vorspielen wolle und dass ihr schon immer die schönen Hunde leidgetan hätten, die bei Wettbewerben zur Schau gestellt würden – auch dies eine kryptische, absurde Äußerung, die Richard nicht verstand. Doch er hatte genug davon, um Erklärungen zu bitten, und griff zu anderen Mitteln, um sein Missfallen kundzutun.
Seine größte Enttäuschung aber war, dass keine Kinder kamen. Er hatte Söhne gewollt, später vielleicht eine Tochter oder zwei, denn Töchter, obwohl an sich nichts Besonderes, konnten ihrem Vater durch Heirat vorteilhafte Verbindungen verschaffen. Doch Richard und Laura hatten nie die Ängste und Hoffnungen junger Paare erlebt. Richard gab natürlich seiner Frau die Schuld; manchmal, in vertrauter männlicher Runde, wenn er sich hinreichend verletzt fühlte, bekannte er, dass sie frigide sei. Es überraschte ihn immer wieder, wie viele wichtige Leute Wert darauf legten, mit ihr in Kontakt zu bleiben, auch noch, nachdem sie ihr Vermögen verloren hatte; er vermutete jedoch, sie seien sich darüber im Klaren, dass Laura mit einem Mann verheiratet war, der ihnen eines Tages sehr nützlich werden konnte.
Laura meinte verächtlich, es sei kein Wunder, dass sie keine Kinder hätten, ein Mann wie Richard könne das auch nicht erwarten; so geizig, wie er sei, würde er ihnen schon ihr bloßes Leben missgönnen.
Nach drei Jahren hasste sie ihn. Nachdem er eingesehen hatte, dass sie höchstwahrscheinlich nie Kinder bekommen würden, hatte er zunächst demonstrativ den Beleidigten gespielt. Später jedoch nahm sein Groll subtilere Formen an. Er fuhr fort, seine Frau mit Schmuck, schönen Kleidern und Pelzen zu überhäufen, und Laura sagte bitter: »Er versieht mich mit seinem Markenzeichen, damit ich ihm nicht abhandenkommen kann.« Andere Frauen meinten neidvoll: »Herrlich muss das sein, einen Mann wie Richard Gray zu haben! Seine Frau rührt keinen Finger für ihn, und trotzdem ist er der großzügigste Ehemann der Welt. Ein Glück haben manche Frauen!« Das hatte Richard schlauerweise auch beabsichtigt, wie Laura wusste – es war eine neue Methode, sie zu demütigen. Zu allem Übel hatten auch ihre Verwandten seine Erwartungen nicht erfüllt und sich eher als peinlich denn als nützlich entpuppt. Sie hatten sich einem fortschrittlichen Radikalismus verschrieben, der Richard abstieß und entsetzte; er vertrat den Standpunkt, dass eine Klasse, die seit Jahrhunderten Macht und Land in Händen hielt, eben damit ihre Regierungsfähigkeit bewies.
Laura gab sich nach außen hin heiter und lebhaft, war in Wirklichkeit aber todunglücklich. Das lag zum Teil an der demütigenden Erkenntnis, dass sie nicht einmal mit ihrem Küchenmädchen mithalten konnte, das vor kurzem mit erstaunlicher Gelassenheit und ohne Trauschein Zwillinge zur Welt gebracht hatte. Noch mehr aber war ihr Unglück dem tristen, sinnlosen Leben geschuldet, das sie mit ihrem Mann führte. Von Natur aus eher leichtsinnig und impulsiv, hatte sie sich einen kühlen, geschliffenen Habitus zugelegt, der einer gleichgültigen Welt mit offenem Zynismus begegnete. Im Grunde ihres Herzens verabscheute sie die zahllosen politischen Ränkespiele, die ihr Mann ins Werk setzte und deren Lohn sie verachtete. Zudem war sie unsterblich in einen Mann verliebt, der sich wie Richard hauptsächlich für seine beruflichen Erfolge interessierte und sie seinerseits demütigte, indem er sie höchst feige immer wieder beschwor, vorsichtig zu sein, damit nur ja nicht die wahre Natur ihrer Beziehung ans Licht kam. Manchmal hatte sie mit dem Gedanken gespielt, Richard um die Scheidung zu bitten, aber im Grunde kannte sie beide Männer zu gut, um darauf hoffen zu können, dass sie ihr zuliebe auch nur ein Jota von ihren Zielen abrücken würden.
Sie wusste um Richards missliche Lage. Seit einiger Zeit strebte er mit verzehrender Leidenschaft nach der Peerswürde, was sie zutiefst anwiderte. Das Ausmaß an Emotionen, das er an das Erreichen dieses lächerlichen Ziels verschwendete, stieß sie mehr ab als die damit verbundenen Kosten. Er hatte diesen Schritt ursprünglich gar nicht in Betracht gezogen, aber dann hatte er jemanden aus seinem Club, der nicht ganz so versnobt war wie er, zu einem Nachbarn sagen hören: »Was in aller Welt nützt ein Titel einem Burschen wie Gray? Er hat ja niemanden, dem er ihn vererben könnte«, und seitdem hatte er sich vollends darauf versteift. Ein Titel würde ihm auf jeden Fall Ansehen und Beachtung verschaffen, wenn schon nicht bei der Nachwelt, so doch zumindest bei den Zeitgenossen. Inzwischen war das zur fixen Idee geworden und verleitete ihn sogar zu unverantwortlichem Handeln. Nicht nur die Peerswürde begehrte er, sondern auch ein bestimmtes Amt, für das, so glaubte er, die Peerswürde Voraussetzung war. Es gab noch einen Mitbewerber, einen Mann, der in vieler Hinsicht besser dastand als er, und dem verbissenen Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihm widmete sich Richard ohne Rücksicht auf Verluste. Das war mit Ausgaben verbunden, die seine Möglichkeiten weit überstiegen, und er war bereits Verpflichtungen eingegangen, denen er nicht nachzukommen vermochte. Der Mann, den er von sich überzeugen musste, ein gewisser F., war ein strenger Nonkonformist, der es mit Sicherheit missbilligen würde, wenn sein Kandidat sich kopfüber in Schulden stürzte. Kamen ihm Richards finanzielle Nöte zu Ohren, war womöglich alle Hoffnung auf Titel und politischen Aufstieg dahin.
Das Geld, so glaubte er, war gut angelegt. Einen Teil hatte er für wohltätige Zwecke ausgegeben: Er hatte ein Bett für ein etwas obskures Krankenhaus in F.s Wahlkreis gestiftet, eine hübsche Summe hatte er in einen Arbeitslosenfonds eingezahlt, der gerade ins Leben gerufen wurde, und er hatte mehreren Stiftungen für Bedürftige Spenden zukommen lassen. So weit, so gut, selbst aus F.s Sicht. Weitaus höher waren jedoch die Summen, die er für Bewirtung, teure Weine und exotische Früchte aufwandte, hinreißende Kleider und glitzernde Juwelen für Laura, ein Automobil, das in mehreren Klatschblättern abgebildet wurde, und teure Plätze bei gesellschaftlichen Ereignissen – alles, um den Eindruck zu erwecken, es fehle etwas, wenn Richard Gray nicht dabei war. Und als wäre es nicht schon lästig genug, von kurzsichtigen Gläubigern bedrängt zu werden, die in Verkennung der Lage nicht sahen, welcher Lohn ihrer Geduld winkte, war da auch noch die Affäre mit Greta Hazell.
Miss Hazell war eine auffallende junge Schönheit südländischen Typs, heißblütig, hinreißend und, ja, sehr kostspielig. Wie kostspielig, das dämmerte Richard gerade erst. Er hatte sich, was seine Frau anging, für großzügig, wenn nicht gar waghalsig verschwenderisch gehalten, doch Greta zeigte ihm, dass eine Geliebte sich auch ohne solche Zurschaustellung als genauso teuer erweisen konnte. Hier lag, auch wenn er es niemals zugegeben hätte, die Wurzel seiner Geldverlegenheit, die ihn Tag und Nacht verdross. Alles andere hätte er hingenommen, aber dies machte die Last unerträglich. Die fragliche Dame, die eine Nase für Geschäfte und auch Erfahrung damit hatte, erpresste ihn um eine aberwitzige Summe. Als er protestierte, sagte sie: »Es wäre dir gar nicht recht, mein lieber Richard, wenn unsere Beziehung publik würde. Wohingegen mir das überhaupt nichts ausmachen würde. Im Gegenteil, da du ja neuerdings sehr im Rampenlicht stehst, wäre es sogar gut für mich. Die Frau, die Richard Gray verführt hat.« Und sie lachte.
Er sah sie stumm an. Selbst jetzt, bei aller Wut und Ernüchterung, konnte er nicht umhin, ihren Liebreiz wahrzunehmen. Gewiss, er hatte sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt kennengelernt. Er hatte an einer Herrengesellschaft teilgenommen, deren Ehrengast ein berühmter Romancier gewesen war, der sich sehr freimütig äußerte und dessen Bücher selbst Richard gelesen hatte. Die Stunden vergingen, der Einfluss dieses Herrn und des ausgezeichneten Weins löste mehreren Gästen die Zunge, und Richard gelangte zu der schockierenden Erkenntnis, dass für Geld ein Vergnügen zu haben war, das er noch nicht kannte. Die maßvollen Freuden, die er mit seiner Braut genossen hatte, waren nichts im Vergleich zu dem, was einige der Anwesenden hinter vorgehaltener Hand schilderten. Offenbar gab es da einen geheimen Quell der Lust, aus dem andere Männer tranken, er aber nicht.
Seine eheliche Treue war eine Frage der Zweckmäßigkeit und der freien Entscheidung gewesen. Er fühlte sich keiner Moral verpflichtet, war aber nie in Versuchung geraten, Laura zu betrügen, und außerdem zu sehr damit beschäftigt gewesen, anderweitig Trophäen zu sammeln. Doch das Gespräch hatte seine Eigenliebe angefacht. Diese Männer waren weniger wohlhabend und weniger intelligent, sie verfügten über weniger gute Beziehungen und waren in jeder Hinsicht weniger brillant als er – und doch erschienen sie ihm jetzt reicher. Seine Sicht der Dinge war einseitig gewesen; er hatte nur die Arbeit im Kopf gehabt und nie an privaten Ausgleich gedacht. Ungewöhnlich aufgewühlt machte er sich auf den Nachhauseweg, darauf gefasst, dass seine Frau nicht auf ihn eingehen würde. Die Umstände erwiesen sich als günstig. Sie hatte am Nachmittag ein höchst unbefriedigendes Gespräch mit ihrem Liebhaber geführt und daher gründlich die Nase voll von den Männern, ihren Ausflüchten und Beteuerungen. Daher wandte sie sich ab, als Richard zu ihr trat, ihren Arm fasste und ihn besitzergreifend streichelte. Er war ob dieser Demonstration ehelicher Kälte jedoch eher erfreut. Drei Tage später traf er sich mit Greta Hazell, zwei Wochen darauf hatte er in der Shaftesbury Avenue eine hübsche kleine Wohnung für sie gemietet – erst später stellte er fest, dass die Miete dreihundertzwanzig Pfund im Jahr betrug –, und er kaufte ihr, wonach immer ihr gerade der Sinn stand. Nach einigen Monaten merkte er, dass er keineswegs der einzige Besucher in der Wohnung war. Der Untreue bezichtigt, lachte Greta dreist. Ob er geglaubt habe, ihr Leben sei allein seinem Vergnügen vorbehalten, fragte sie. Richard war wie vor den Kopf geschlagen. Etwas, das er gekauft hatte, entzog sich ihm. Das war unerträglich. Augenblicklich beschloss er, die Beziehung zu beenden und diese verachtenswerte Person nie wiederzusehen. Da nannte sie ihre Bedingungen. Sie waren niederschmetternd. Anfangs nahm er sie nicht ernst; bestimmt machte sie sich – in geschmacklosester Weise – über ihn lustig. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuße. Er konnte nichts tun. Sie hatte ihn in der Hand, und in seiner derzeitigen Lage wäre es gefährlich gewesen, sie sich zur Feindin zu machen. Woher wusste sie so genau Bescheid? Dass unter ihren Besuchern ein politischer Gegner von ihm sein konnte, kam ihm nicht in den Sinn.
So also war die Lage an Heiligabend. Er hatte ihre Forderungen noch nicht erfüllt, sah sich gar nicht dazu imstande, war sich aber darüber im Klaren, dass er die Zahlung nicht länger hinausschieben konnte. Wohl oder übel musste er seine Gefühle hintanstellen und seinen Vater irgendwie dazu bringen, ihm zu helfen. Als Erstes musste er Greta ausbezahlen – die in dem Ruf stand, einen abgelegten Liebhaber oder einen, der sie seinerseits ablegte, nie wieder heimzusuchen –, dann musste er genug Geld beschaffen, um sich die penetranteren Gläubiger so lange vom Leib zu halten, bis er sein Ziel erreicht hatte. Das war eine schwierige Aufgabe. Adrian Gray hatte seinem Sohn, als er in den Adelsstand erhoben wurde, nur widerwillig gratuliert. Richard fand, er hatte alles andere als angemessen reagiert, als er mit gespielter Herzlichkeit sagte: »Ganz wie es dir beliebt, Richard, versteht sich. Zu meiner Zeit hat es genügt, Gentleman zu sein. Wir haben auf diese schicken Titel und die Buchstaben hinter unserem Namen keinen Wert gelegt.« Eine Generation zuvor sei der Gentleman noch etwas Vornehmeres gewesen, fügte er hinzu. Nichtsdestotrotz bereitete es ihm eine gewisse Genugtuung, »Mein Sohn, Lord Soundso« zu sagen, auch wenn er möglicherweise der Meinung war, dieses Prestige sei seinen Preis nicht wert. Seine eigenen Geschäfte gingen schlechter, als ihm klar war. Richard wusste das, und er hielt es für unwahrscheinlich, dass Eustace ihn über den wahren Stand der Dinge aufgeklärt hatte. Umso erpichter war er darauf, seinem Schwager zuvorzukommen und als Erster mit seinem Vater zu sprechen. Hatte Eustace erst einmal Farbe bekannt, bestand für beide keine Aussicht mehr, dass Adrian ihnen half. Und was Brand anging – den konnte man schlicht vergessen. Er war ein unbedeutender Mensch von keinerlei Einfluss, einer, wie ihn selbst ein Peer in seiner Verwandtschaft haben kann – was bei einem bloßen Ritter freilich alles andere als empfehlenswert ist. Eustaces Spekulationen waren Dauerthema von Klatsch und Tratsch in Richards Kreisen; man war der Meinung, der Mann werde in Kürze am Ende sein und könne von Glück sagen, wenn er nicht ins Gefängnis komme. Wettliebhaber hätten allerdings im Falle eines Zweikampfs zwischen ihm und Richard hoch auf Eustace gesetzt, etwa fünfzig zu eins. Richard spürte, dass seine einzige Chance, mochte sie auch noch so gering sein, darin bestand, als Erster zur Stelle zu sein.
Amtsgeschäfte hatten ihn jedoch bis zum Abend des Dreiundzwanzigsten in der Stadt festgehalten, und dann war es zu spät gewesen, um noch die umständliche und beschwerliche Fahrt nach King’s Poplars anzutreten. Er hatte sich entschlossen, den Zug zu nehmen, der ihn nichts kostete. Als Bittsteller in seiner vielgerühmten chromblitzenden Karosse vorzufahren hätte Gray verprellt und Eustace Gelegenheit gegeben, mit spöttischem Finger auf ihn zu zeigen.
»Warum stößt er den Wagen nicht ab, wenn er so klamm ist?«, hätte er gefragt. Und zweifellos hätte Gray sich auch ohne diesen Souffleur dieselbe Frage gestellt.
Überdies war das Auto eines jener Luxusgüter, die er noch nicht bezahlt hatte, sodass es ihm sicherer erschien, es in der Garage zu lassen. Im Bahnhof London Bridge hielt er nervös Ausschau nach Eustace, obgleich sein Schwager höchstwahrscheinlich mit dem Auto fahren würde. Eustace war weder auf dem Bahnsteig noch im Zug zu sehen, und Richard musste sich bis King’s Poplars in Geduld üben. Kurz bevor der Zug dort einfuhr, richtete er unvermittelt das Wort an Laura.
»Mein Vater hat offenbar einen sehr beunruhigenden Brief von Brand erhalten«, sagte er kühl. »Er bittet wieder einmal um Geld.«
Laura zog ihre reizvollen Brauen hoch. »Da sitzen wir ja zur Abwechslung mal im selben Boot.«
Richard war wütend. Es war widerwärtig. Ihn mit einem ärmlichen kleinen Angestellten zu vergleichen, der eine Frau mit einer grauenvollen Vergangenheit am Hals hatte, in einem heruntergekommenen Viertel von London lebte und in seiner freien Zeit mit einem Malkasten herumstümperte – so etwas tat allenfalls ein Lakai. Einen feinen Verwandten würde Brand künftig für seine Lordschaft abgeben.
Endlich angekommen, erfuhr er, dass im Moment kein Fahrzeug zur Verfügung stand, und bekundete seinen Ärger auf eine Weise, die Laura abstieß. Sein würdeloser Zorn auf den Stationsvorsteher verursachte ihr leichte Übelkeit, und sie dachte: »Warum in aller Welt habe ich das getan? Was habe ich geglaubt, was einmal aus ihm wird? Niemand hat Druck auf mich ausgeübt. Ich war unabhängig, ich hatte Geld und eine Familie, die ich liebe. Was habe ich nur in ihm gesehen? Und wer von uns beiden hat sich so sehr verändert?«
In den Augen des Stationsvorstehers wirkte Lady Gray stets damenhaft, ruhig und stolz, das schöne rote Haar, das sie nie schneiden ließ, unter dem modischen Hut gerade noch sichtbar. Endlich fand sich ein Taxi, und sie fuhren zum Herrenhaus, Richard in fiebriger Unruhe, Laura angewidert und gelangweilt. Der erste, dem sie über den Weg liefen, war Eustace, der mit kalter, mürrischer Miene durch den Park streifte.
»Hast du meinen Vater gesehen?«, fragte Richard höflich. Eustace bejahte und meinte, der alte Mann mache keinen sehr gesunden Eindruck. Er habe von einem schwachen Herzen gesprochen; ob Richard etwas darüber wisse? Richard verneinte entschieden, stürmte unter Missachtung deutlicher Zeichen, die Eustace und Amy ihm gaben – für Amy hatte er in der Eile kaum einen Gruß übrig –, in die Bibliothek und sprudelte seinen Bericht über seine Lage hervor.
Adrian reagierte alles andere als teilnahmsvoll. »Du kannst dir deinen Titel an den Hut stecken«, schnaubte er. »Ich bin ruiniert, sagt Eustace. Ruiniert. Daran ist allein dieser Mensch schuld, dieser Gauner, dieser schmierige Kerl, der nicht mal ein Gentleman ist. Was Olivia an dem gefunden hat, ist mir ein Rätsel. So eine gestandene Frau, und lässt sich mit dieser Ratte ein.«
Richard, bestrebt, das Beste aus der beklagenswerten Angelegenheit zu machen, antwortete rasch: »Ich fand Eustace noch nie sehr vertrauenswürdig. Er wirft anderer Leute Geld aus dem Fenster.«
Gray funkelte ihn zornig an. »Wenn du dir da so sicher warst, warum hast du mich dann nicht gewarnt? Du wusstest doch, dass der Großteil meines Kapitals in seinen Geschäften steckt.«
Richard glich einem Mann, der sich verzweifelt müht, ein durchgehendes Pferd zu zügeln. Er war weiß im Gesicht, vor Zorn und von der Anstrengung, ihn zu unterdrücken; seine Stimme klang unnatürlich hoch, und er sprach hastig, als könne er seiner Wut und Enttäuschung gar nicht schnell genug Luft machen. »Wie sollten wir dich denn warnen? Du hast ja auf niemanden gehört. Du warst doch überzeugt, dass du in Gelddingen mutiger bist als jeder andere. Ständig hast du uns was von hohen Dividenden und gewagten Investitionen erzählt. Solide Unternehmen haben nicht mal fünf Prozent gezahlt, da hättest du dir doch denken können, dass du bei sage und schreibe vierzehn Prozent ein Risiko eingehst oder dich außerhalb der Legalität bewegst. Wir haben dir Vorhaltungen gemacht, Miles genauso wie ich. Und hast du auf uns gehört? Nein. Ich war für dich ein halbseidener Politiker, der sich nur die Taschen füllen will, und Miles ein Anwalt, der hofft, von beiden Seiten zu profitieren.«
»Miles …«, begann Gray unsicher, doch sein Sohn schnitt ihm das Wort ab.
»Miles ist Anwalt, so wie Eustace Finanzier ist; keiner von beiden macht einen Finger krumm, sofern er nicht dafür bezahlt wird. Warum auch? Du hättest nur ein paar Erkundigungen einziehen müssen, dann hättest du gewusst, was los ist. Du kannst jeden in der City fragen, was für einen Ruf Eustace genießt. Die Antwort bekommst du mit einem einzigen Wort. Du hast gewusst, dass er immer Geld in der Tasche hatte, obwohl er keinen Beruf ausübt wie wir anderen. Hast du dich je gefragt, wo das Geld herkam? Aus anderer Leute Taschen kam es, und die wollten es genauso wenig verlieren wie du. Jetzt will er wahrscheinlich noch mehr …«
»Kriegt er aber nicht, keinen Penny. Ich hab’s nicht. Und für dich hab ich auch nichts. Du kaufst die Peerswürde ja nicht, um mir eine Freude zu machen. Sie ist ein teurer Luxus, zumal du keinen Sohn hast, dem du sie vererben könntest.«
»Noch nicht«, sagte Richard mit belegter Stimme.
»Noch nicht?« Sein Vater starrte ihn an. »Du meinst, Laura ist nach all den Jahren …?« Angesichts der möglichen Schmach seines Sohnes schlug er augenblicklich einen verbindlichen Ton an. »Mein lieber Junge, gibt dir das nicht zu denken?«
»Ich rede doch nicht von so etwas!«, rief Richard wütend. »Laura wird keine Kinder bekommen, so wenig, wie sie mich jemals betrügen wird. Eine Frau wie sie mag zwar nicht gerade ideal sein für einen normalen Mann, aber sie kennt ihre Pflichten, und eine davon besteht darin, mir keine Hörner aufzusetzen.« Sein Zorn machte ihn grob und bitter.
»Wovon redest du dann? Laura ist doch kerngesund, oder nicht?«
»Doch, schon, soviel ich weiß, abgesehen von ihrem bedauerlichen Unvermögen, mir Kinder zu schenken.«
»Du baust doch Luftschlösser, wenn du unter diesen Umständen noch mit einem Erben rechnest. Und du wirst doch wohl nicht Brands Sohn zuliebe uns beide, dich selbst und mich ruinieren wollen?«
Richard gab ihm eine unflätige Antwort. Nachdem er gegangen war, tat sein zutiefst aufgewühlter Vater etwas Seltsames. Er schickte nach Miles Amery, seinem zweiten Schwiegersohn, und sagte: »Siehst du Richard eigentlich öfter, wenn ihr beide in der Stadt seid? Er scheint mir in einer ganz merkwürdigen Verfassung zu sein.«
»Er will hoch hinaus«, antwortete Amery, ein großer schlanker, leicht gebeugter Mann in einem salz- und pfefferfarbenen Anzug und mit freundlichen grauen Augen hinter dem randlosen Kneifer. »Das strapaziert die Nerven.«
»So wie er sich eben hier verhalten hat, würde ich sagen, er steht kurz vor einem Zusammenbruch. Hast du irgendeinen Einfluss auf ihn?«
Miles schüttelte den Kopf. »Wir kennen uns kaum. Wir haben nichts gemeinsam, verstehst du, und ich bezweifle, dass wir uns auch nur in einem einzigen Punkt einig wären.«
»Normalerweise ist er ja eher schweigsam, aber heute redet er wie ein Wasserfall und mit einer Heftigkeit, dass ich das Gefühl habe, es geht ihm nicht gut. Laura habe ich noch nicht gesehen. Wie wirkt sie auf dich?«
»Bei Laura käme man nie auf die Idee, dass irgendetwas sie beunruhigt oder bekümmert. Man müsste schon sehr vertraut mit ihr sein, viel vertrauter, als es Ruth oder mir beschieden ist, um zu wissen, was sie fühlt oder denkt. Vom Äußeren her war sie immer die hinreißendste Frau, die ich je gesehen habe!«
»Hoffentlich ist alles in Ordnung«, sagte Gray nervös. »Nach meinem Eindruck war er in einer Stimmung, in der ihm alles zuzutrauen ist. Außerdem – ganz unter uns (du bekommst ja viel Vertrauliches zu hören, Miles, und ich sage das vollkommen unvoreingenommen) –, außerdem glaube ich, dass er eine regelrechte Abneigung gegen Laura entwickelt hat. Er hat sogar die Möglichkeit einer späteren zweiten Heirat angedeutet. Und dabei denkt er mit Sicherheit nicht an Scheidung.«
Miles schien besorgt. »Glaubst du im Ernst, es könnte für Laura gefährlich werden, bei ihm zu bleiben? Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf.«
»Ich werfe ihm gar nichts vor. Ihr Anwälte wollt immer ein Ende mit Schrecken. Davon lebt ihr.«
»Wir sind auch nur Menschen und müssen wie alle anderen sehen, wo wir bleiben«, erklärte Miles ruhig.
»Ich sage ja nur, dass Richard mir unausgeglichen vorkommt. Denk nur an die enormen Kosten und den Aufwand, den er betreibt, um diesen Titel zu bekommen. Würde er so etwas tun, nur damit Brands Sohn den Titel später erbt? Richard ist doch sonst so verschlossen. So wie heute habe ich ihn noch nie erlebt; in seiner momentanen Stimmung ist er womöglich zu jeder Ungeheuerlichkeit fähig.«
»Könntest du ihn überreden, zum Arzt zu gehen?«, fragte Miles.
»Er würde nicht auf mich hören, egal, was ich sage. Aber vielleicht auf dich …«
Miles sah bedenklich drein und sagte, er werde es versuchen, verspreche sich aber nicht viel davon.
II
Unterdessen berichtete Richard einer desinteressierten Laura wutschnaubend vom Ausgang des Gesprächs. Als er geendet hatte, fragte sie nachdenklich und unablässig den prächtigen Marquisering an ihrem Finger drehend: »Meinst du, das war sein letztes Wort?«
»Ich denke, er hat bewusst oder unbewusst die Wahrheit gesagt, als er erklärt hat, er besitzt keinen Penny mehr. Er ist am Ende, wenn man dem Klatsch in der City glauben darf. Eustace ebenso und wir auch. Es ist das Ende jahrelanger Mühen und Bestrebungen. Ich habe alles meiner Karriere untergeordnet, und das habe ich nun davon. Ich verliere alles, meine Gesundheit, meine Position, mein Geld, meine Sicherheit, meine Freiheit – alles weg, in einer einzigen Stunde.«
»Es ist schon zum Lachen, dass wir das nicht früher gemerkt haben«, lautete Lauras überraschende Antwort.
»Nicht gemerkt …?«
»Ich meine, dass all unsere Mühe, es zu Wohlstand zu bringen, schlicht umsonst gewesen sein kann. Wäre es um etwas anderes gegangen, etwas Stabileres, Lohnenderes, dann hätten wir zwar genauso scheitern können, aber wir müssten uns nicht eingestehen, dass wir alles verloren haben. Wir hätten immer noch die Freude an unserer Arbeit und das Vergnügen, Gleichgesinnte kennenzulernen. Aber so haben wir gar nichts mehr. Nur Zeit. Davon haben wir zum Glück noch eine ganze Menge.«
Richard starrte sie an. »Zeit?«, wiederholte er benommen.
»Ja. Um etwas anderes anzufangen. Wenn es stimmt, was du sagst, dann bedeutet das Aufsehen, Bloßstellung – du wirst in Ungnade fallen, und wir müssen etwas anderes anfangen. Lass uns nächstes Mal etwas Besseres wählen.«
Richard brauchte eine Weile, bis er begriff, was sie meinte. »Bloßstellung?«, rief er. »Würdest du es bitte unterlassen, so zu reden, als wäre ich ein gemeiner Dieb? Ich bin nicht Eustace. Für ihn kann öffentliches Aufsehen durchaus eine kriminelle Art von Ruin bedeuten. Aber ich habe nichts Ungesetzliches getan.«
»Entschuldige. Ich habe dich missverstanden. Aber du bestreitest zumindest nicht, dass du der Peerswürde Lebewohl sagen musst. Wenn die Affäre Eustace, wie du sagst, demnächst Schlagzeilen in den Sonntagsblättern macht, dann fällt dabei mit Sicherheit auch dein Name. Und der deines Vaters. Auch wenn du nichts mit ihm zu tun hattest – in den Schlagzeilen wird man sich mit einem schlichten ›Finanzier‹ nicht begnügen. Da wird groß und breit ›Schwager des bekannten Parlamentariers‹ oder Ähnliches stehen.«
»Es bekümmert dich ja ungemein, dass meine Hoffnungen zunichte sind«, sagte Richard vorwurfsvoll.
»Nicht besonders«, gab sie ungerührt zu. »Aber, Richard, ich wünschte, du könntest die Sache mit mehr Abstand betrachten, könntest sehen, wie unwichtig das alles ist. Was so leicht in Stücke gehen kann, wird nie zu etwas Festem, für das es sich lohnt, sein ganzes Leben daran zu verschwenden. Es beruht einzig und allein auf Geld, und Geld ist stärker dem Zufall unterworfen als irgendetwas sonst. Arbeit, Idealismus und hohe Ziele spielen da keine Rolle, es ist die pure Vergeudung von Leben. Ich bin froh, dass ich jetzt Gelegenheit habe, die Wahrheit zu erkennen. Es gibt so viele Dinge, die wir gar nicht in Betracht gezogen haben, Dinge, die schon an sich befriedigend sind, unabhängig von irgendwelchen Belohnungen.«
Mit einer Leidenschaft, die Richard befremdete und die er in diesem Zusammenhang nicht zu billigen vermochte, wandte sie sich ihm zu, und es war, als hätte sie einen Sprung in ein neues Leben getan, in eine Farbigkeit, Vitalität und Heiterkeit, die er zwölf Jahre lang nicht mit ihr in Verbindung gebracht hatte. Genauso gut hätte ein toter Ast vor seinen Augen grüne Triebe hervorbringen können.
»Was für Dinge meinst du?«, rief er matt, durch ihren Elan aller Energie beraubt.
Sie standen ihr deutlich vor Augen: die Hoffnungen, die sie als junges Mädchen gehegt hatte, die hochgesteckten Ziele der Jugend – schon die Erinnerung daran ließ sie innerlich strahlen und erfrischte sie, obgleich sie sich bereits den mittleren Jahren näherte und die Jugend längst hinter sich gelassen hatte. Sie errötete vor reiner Freude beim Gedanken daran und fühlte sich angeregt und belebt, wie sie es in den vorsichtigen, farblosen Jahren ihres Ehefrauendaseins nie gekannt hatte.
Sie war verblüfft, als Richard plötzlich wieder mit einer seiner überaus gravitätischen und abweisenden Missfallensäußerungen in ihre Gedanken einbrach.
»Für einen Mann, der in der Öffentlichkeit steht, ist es nicht von Vorteil, wenn seine Frau sich so gar nicht für seine Ziele interessiert.«
»Das ist nicht unbedingt das Problem, Richard, sie sind nur all der Mühe und Energie nicht wert. Ist es nicht demütigend für dich, ihnen so viel Aufmerksamkeit zu widmen?«
Richard sah sie unverwandt an. Seine Hand spielte mit einem Buch, das er vom Tisch genommen hatte. Wenn er wütend war, erschienen seine Augen seltsamerweise viel heller als gewöhnlich. Jetzt waren sie fast farblos.
»Ich verstehe. Und trotzdem, so verachtenswert du es auch finden magst: Ich habe nicht vor, meine Position so ohne weiteres aufzugeben. Ich hatte einmal gehofft, deine Brüder würden es für geboten halten, ihren Einfluss geltend zu machen, aber leider haben sie ihre Chance verpasst. Man muss sie als verlorenen Haufen ansehen – oder nicht einmal das.«
»Allerdings«, stimmte Laura zu. »Alastair findet, man sollte nicht durch Begünstigung weiterkommen, der Meinung war er schon, bevor er seine politischen Ansichten geändert hat. Und Philip wäre genauso wenig eine Hilfe.«
Sie trat an den Frisiertisch, nahm eine silbergefasste Bürste und glättete eine Haarsträhne, die sich gelöst hatte. Verwunderung erfüllte sie. War es das, was sich hinter all der Gewichtigkeit und Würde verbarg, dieser kindische Kampf um Rang und Namen? Bestand Richards Rüstung wirklich nur aus Silberpapier und Pappe? Für Laura war das Leben eine weit hingestreckte Landschaft, ohne Mauern, ohne ein behagliches Haus mit Türen, die man abschließen konnte, damit der Pilger darin blieb. Richard aber wollte es zu etwas Sicherem, eng Begrenztem, Ausschließendem machen. Die absurde Leidenschaft seiner letzten Worte hing noch in der Luft, betäubte ihre Ohren und lähmte ihr Herz. Er hatte es ernst gemeint. Man hätte Mitleid empfinden sollen, nicht diesen kalten Ekel. Ihm war das alles so wichtig.