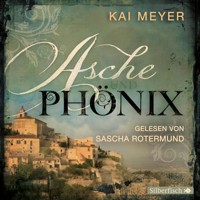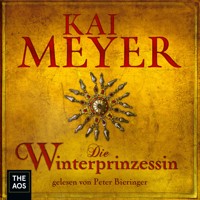Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Von Morgen Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Mittelalter Romane
- Sprache: Deutsch
Das große Mittelalter-Epos von Bestseller-Autor Kai Meyer Tauchen Sie jetzt ein! "Diese Pflanze", sagte der Mann im Schein des Kaminfeuers, "die Lumina, ist das letzte überlebende Gewächs des Gartens Eden. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Wir müssen sie dorthin zurücktragen, wo sich einst der Garten Gottes befunden hat. An den Ort, an dem sie vor langer Zeit aus einem Samenkorn entsprungen ist. Nur so werden wir einen neuen Garten Eden schaffen und der Menschheit eine Zukunft schenken. Neue Unschuld. Ein zweites Paradies auf Erden." Die Frau starrte ihn an. "Und daran glaubt Ihr wirklich?" Winter 1257. Zwei Reisende kämpfen sich durch Eis und Schnee bis zu einem einsamen Kloster in der Eifel. Der Novize Aelvin erkennt in einem der Fremden den berühmten Albertus Magnus, begleitet von dem todkranken Mädchen Favola. Sie trägt ein begehrtes Gut bei sich: die sagenumwobene »Lumina«, eine Pflanze, die der Legende nach aus dem Garten Eden stammt. Albertus und Favola wollen das rätselhafte Gewächs zurück an seinen Ursprungsort tragen, um so das Paradies auf Erden wieder erstehen zu lassen. Doch ein machtgieriger Erzbischof hat andere Pläne, er will die Lumina für sich allein. Seine Krieger sind den Fliehenden dicht auf den Fersen. Aelvin schließt sich den beiden an – und ahnt nicht, dass damit eine Odyssee bis ans Ende der bekannten Welt beginnt … Mit unvergleichlichem Geschick nimmt Kai Meyer seine LeserInnen mit auf eine abenteuerliche Reise vom winterlichen Europa bis in den Orient von Tausendundeiner Nacht. Freuen Sie sich auf atemberaubende Spannung, gewaltige Schlachten – und eine ergreifende Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1072
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
KAI MEYER
Die Suche nach dem verlorenen Paradies
Roman
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Copyright © Kai Meyer 2003
Covergestaltung: Jamie Designs
Copyright dieser Ausgabe © 2024 Von Morgen Verlag
Inhalt
Prolog
Erstes Buch: Hüter der Lumina
Libuse im Winterwald
Erdlicht
Das Mündel des Magisters
Die Gestalt im Schatten
Alte Schulden
Die Lumina
Des Bischofs Bluthund
Wolfsjagd
Zweites Buch: Die Gärten Gottes
Das Schwert des Großkahns
Burg Alamut
Die Blindheit eines Kriegers
Das Land Eden
Die Braut des Meuchelmörders
Die Karte des Jüngers
Der Nigromant
Über das Eis
Der Schlüssel zum Garten
Schlangenaugen
Der Wolfsritter
Drittes Buch: Zweierlei Himmel
Die Prophezeiung
Die Wege aller Welten
Oberons Fluch
Die Türen zum Garten
Der Besessene
Die Letzte der Nizaris
Schädelsammler
Im Dorf der Bestraften
Der Hinterhalt
Die Silberfeste
In den Minen
Berührungen
Viertes Buch: Das Paradies
Bagdad
Aelvins Codex (I)
Die Erzählung des Ritters
Die Gefangene
Im Haus des Diebes
Al-Mutasim
Die Kalifenmutter
Am Basra-Tor
Der Rudelführer
Schwerter bei Nacht
Abschied
Bis ans Ende der Welt
Das Teilen ihrer Tode
Der letzte Weg
Seelen im Sand
Aelvins Codex (II)
Epilog
Nachwort des Autors
Leseempfehlung
Manche von uns haben Lieblingsbücher, die sie nie gelesen haben. Manche sogar welche, die nie geschrieben wurden.
Dieses hier ist eines von meinen, und deshalb schreibe ich es auf.
Prolog
„Diese Pflanze“, sagte der Mann im Schein des Kaminfeuers, „die Lumina, ist das letzte überlebende Gewächs des Gartens Eden. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Wir müssen sie dorthin zurücktragen, wo sich einst der Garten Gottes befunden hat. An den Ort, an dem sie vor langer Zeit aus einem Samenkorn entsprungen ist. Nur so werden wir einen neuen Garten Eden schaffen und der Menschheit eine Zukunft schenken. Neue Unschuld. Ein zweites Paradies auf Erden.“
Die Frau starrte ihn an. „Und daran glaubt Ihr wirklich?“
„Mit meinem Leben“, sagte er. „Mit meiner Seele.“
Erstes Buch: Hüter der Lumina
Worin wir von Ungeheuerlichem erfahren. Und eine Ahnung von den Wundern der Welt erhalten.
Libuse im Winterwald
Die Eifel
Anno domini 1257
Es hatte aufgehört zu schneien, während der junge Mönch auf das Mädchen wartete.
Satt und schwer lag der Winter über den Wäldern. Längst war der Schnee durch das Dach der Tannenwedel und laublosen Äste gesunken und bedeckte kniehoch den zerklüfteten Boden. Fichtenwipfel verbargen sich unter weißen Hauben, spitz und Ehrfurcht gebietend wie Henkerskapuzen. Hin und wieder rieselten Vorhänge aus Eiskristallen in die Tiefe, wenn sich irgendwo ein Tier regte.
Das Mädchen kam spät an diesem Tag.
Aelvin rieb sich ungeduldig die steifgefrorenen Finger. Gewiss, er konnte ihr schwerlich einen Vorwurf machen; sie wusste ja nicht, dass er sie erwartete. Vielmehr wäre sie wohl gar nicht erst aufgetaucht, hätte sie geahnt, dass er sie aus seinem Versteck im Unterholz beobachtete. Oder, nein, verbesserte er sich im Stillen, sie wäre sogar ganz bestimmt gekommen – allerdings mit einem starken Knüppel in der Hand, und ehe er sich´s versah, hätte sie ihm wohl eine Tracht Prügel verabreicht.
Der Gedanke daran hätte ihn schmunzeln lassen, wären seine Züge nicht längst zu einer eisigen Maske erstarrt gewesen. Vor einer Weile hatte seine Haut zu brennen begonnen. Seine Finger und Füße taten weh, aber immerhin spürte er sie noch. Was in Anbetracht der Umstände durchaus ein Grund zur Freude war, Gott sei´s gedankt.
Libuse - das war ihr Name. Er hatte ihn aufgeschnappt, als sie einmal mit ihrem Vater zur Abtei gekommen war. Es geschah nicht oft, dass der furchteinflößende Alte seinen einsamen Turm in den Wäldern verließ, um die Mönche zu besuchen. Dass er dieses eine Mal gar seine Tochter mitbrachte, hatte tagelang für Gesprächsstoff gesorgt. Später wurde gemunkelt, er habe den Abt gebeten, das Mädchen am Unterricht der Novizen teilnehmen zu lassen. Was dieser – wen wundert´s? – unter schärfstem Protest abgelehnt hatte. Erzürnt hatte Libuses Vater daraufhin mehrere Monate lang nichts mehr von den Mönchen gekauft. Erst seit einer Weile verließ er gelegentlich die Wälder, um im Kloster das Nötigste zu besorgen und auf seinen mächtigen Ochsenschultern davon zu tragen. Manchmal ward er wochenlang nicht gesehen, dann wieder erschien er innerhalb weniger Tage gleich mehrfach an der Klosterpforte, wortkarg und nie um einen finsteren Blick verlegen, wenn ihm einer der Mönche zu nahe kam.
Aelvin zog den Rand der Kapuze unter seinem Kinn zusammen, damit sie sich noch enger um seinen Kopf legte. Nicht, dass es einen Unterschied machte. Der messerscharfe Wind drang durch den groben Wollstoff und schnitt in seine Ohren. Odo hatte ihn gewarnt, dass es Wahnsinn sei, sich bei solch einer Kälte im Wald auf die Lauer zu legen, nur um einen Blick auf Libuse zu erhaschen. Eine Hexe sei sie, erzählten manche im Kloster, weil sie es nicht ertrugen, junges Mädchenfleisch in ihrer Nähe zu wissen. Eine Hexe, jawohl, und mit dem Leibhaftigen im Bunde. Warum sonst kröche sie nachts in die Träume der braven Zisterzienser, um sich ihnen in Sünde feilzubieten?
Aelvin war nicht sicher, ob das, was ihm bei Libuses Anblick durch den Kopf ging, tatsächlich sündig war. Zugegeben, er schämte sich dann und wann dafür – so hatte man es ihn in den vergangenen Jahren gelehrt -, und in seinen Gebeten bat er den Herrn um Vergebung. Aber er hatte es sich abgewöhnt, das Mädchen in der Beichte zu erwähnen. Nicht so sehr aus Furcht vor Strafe oder dem mahnenden Blick seines Beichtvaters, sondern weil er fürchtete, sie in noch größeren Verruf zu bringen.
Aelvin war sechzehn, noch ein Novize, und wie alle Zisterzienser trug er außerhalb des Chors eine weiße Kutte mit schwarzem Skapulier, ein schulterbreites Wolltuch, das von der Kapuze herabfiel und Rücken und Vorderseite des Körpers bedeckte. Das Cingulum, ein schmales Lederband, gürtete Kutte und Skapulier in der Körpermitte; es war das Zeichen mönchischer Keuschheit und Würde. Abt Michael hatte einmal zornig vorgeschlagen, Aelvin das Cingulum lieber um den Hals zu schnüren: Vielleicht geriete ihm seine tiefere Bedeutung dann nicht gar so oft in Vergessenheit. Das war vor einem halben Jahr gewesen, als Aelvin dem Bruder Benediktus, Küchenmeister und ewig geizig mit dem Honig, frische Pferdeäpfel in die Kapuze gelegt hatte – was diesem erst aufgefallen war, als er sie im Beisein des Abtes hochgeschlagen hatte. Kindisch? Ganz sicher. Den Ärger wert? Himmel, ja! Das Ganze war eine alberne Wette gewesen, mit Aelvins Freund Odo, der zwar so groß und breit war wie ein Bär, aber mit dem Mut einer Maus gestraft.
Weiße Atemwolken nebelten um Aelvin empor und verdeckten seine Sicht, weil der Wind in dem rauen Waldland aus den unmöglichsten Richtungen wehte, sogar aus den Tälern und tiefen Senken herauf. Aelvin würde Acht geben müssen, dass Libuse die weißen Schwaden nicht entdeckte, sonst würde sein Versteck keinen Pfifferling mehr wert sein.
Herrgott noch mal, wo blieb sie nur?
Sie kam immer an den Montagen, und stets in der Stunde vor der Vesper. Das gemeinsame Abendgebet der Mönche war die feierlichste Zeit des Tages, und es würde keine Entschuldigung für Aelvins Abwesenheit geben. Was bedeutete, dass ihm eine harte Strafe in Haus stände, falls Libuse nicht bald auftauchte, und er nach einem kurzen Blick auf sie geschwind zum Kloster zurückkehren konnte. Er wagte viel mit diesem verbotenen Ausflug in die Wälder; aber zudem auch noch die Vesper zu verpassen, das überstieg seinen Wagemut, Verliebtheit hin oder her.
Verliebtheit. Aelvin schluckte und schlug schuldbewusst die Augen nieder, beinahe als beuge sich der Herr selbst aus den Schneewipfeln der Bäume herab, um ihn zu rügen.
Ganz unvermittelt horchte er auf, als das Geräusch stapfender Schritte ertönte. Irgendwo links von ihm brach die Eiskruste, ein fernes Scharren und Rascheln, das geschwind näher kam.
Sein Herzschlag hämmerte und pumpte heißes Blut bis in die Ohren. Für einen Augenblick vertrieb wallende Hitze den Frost aus seinen Gliedern. Alles drehte sich in seinem Kopf, und das nicht nur, weil er abrupt die Luft anhielt.
Libuse kam. Die schöne, süße, überirdische Libuse.
Aelvin entwich ein leises Keuchen, als er sie endlich, endlich, endlich erblickte.
Und fuhr abermals zusammen.
Libuse war nicht allein.
*
Die Luft schien zu knistern, der Wind für einen Augenblick zuzunehmen, um dann vollständig innezuhalten. Sogar die Welt vergaß das Atmen, als Libuse zwischen den Bäumen hervortrat, über den Rand eines Schneewalls kletterte und in die Senke unterhalb von Aelvins Versteck schlitterte. Selbst das tat sie mit einer Grazie, die womöglich allen Frauen angeboren oder aber Gottes Geschenk an dieses eine besondere Geschöpf war; Aelvin wusste es nicht, denn seit er im Kloster in den Eifelbergen lebte, war ihm kein anderes weibliches Wesen unter die Augen gekommen. Abgesehen von ein paar groben Bauersfrauen, aber die zählten nicht. Jedenfalls nicht, wenn man zuvor die Schönheit Libuses gekostet hatte.
Ein Großteil der Senke, in der Libuse nun niederkniete, wurde vom verschlungenen Wurzelwerk einer mächtigen Eiche eingenommen. Ihr Stamm war so breit wie sechs Männer – acht, legte man das Maß der mageren Zisterziensermönche zu Grunde -, und das Alter hatte sich mit Furchen, Knoten und Schrunden in ihre Rinde gefressen. Die Zweige des Baums breiteten sich wie ein Dach über die Mulde an ihrem Fuß. In wärmeren Monaten war das Erdreich zwischen den Wurzeln ein guter Nährboden für Pilze, manchmal auch für seltsame Beeren, die man besser nicht probierte.
Da war noch jemand jenseits des Schneewalls, auf der anderen Seite der Mulde.
Aelvin war ganz sicher. Er hatte Schritte von mehr als nur einem Menschen gehört, wenngleich keine Stimmen; er hatte ein tiefes Schnauben vernommen, rasselnd und laut und äußerst unangenehm. Konnte das ihr Vater sein? Falls Odo und die Anderen Recht behielten, dann mochte dort drüben der Teufel höchstselbst auf der Lauer liegen.
Aber sogar das war Aelvin jetzt gleichgültig. Libuse schaute sich um. Ihr Blick strich für einen Moment über das Geäst vor seinem Versteck. Ihre Blicke berührten sich, ganz kurz nur.
Sie hat mich bemerkt!, durchfuhr es ihn. Sie muss mich einfach bemerkt haben.
Aber dann wanderte ihr Blick weiter, ohne jedes Zeichen von Unruhe. Sie trug ein grobes braunes Kleid, das bis auf ihre derben Stiefel fiel. Über der Hüfte hatte sie es wie immer eng gegürtet. Heute war allerdings von ihrer zarten Gestalt unter all dem groben Webwerk wenig zu sehen. Sie hatte eine dicke Weste aus grauem Schaffell übergezogen, bedeckt von einer Kruste aus Eis. Zudem trug sie Handschuhe, so formlos wie all ihre Kleidung zu jeder Jahreszeit. Im herrlichsten Gegensatz dazu stand die Anmut ihrer Züge. Unter dunklen Augenbrauen leuchteten große, hellgrüne Augen. Ihr Gesicht war schmal, doch nicht so zerbrechlich wie das der geschnitzten Muttergottes hinter dem Altar der Abteikirche.
Libuse sah aus wie ein Mädchen auf dem besten Wege eine Frau zu werden. Aelvin hoffte, sie würde immer so bleiben, wie sie an diesem Tag war; und immer wieder in diesen Wald zurückkehren, zu diesem Baum; und niemals bemerken, dass er sie beobachtete, oder, Gott, vielleicht doch, und dann würde sie lächeln und mit ihm sprechen und vielleicht gar ein wenig näher kommen, noch ein wenig, und, ja, dann würde sie seine Hand nehmen oder er die ihre, und dann, in jener fernen oder auch nahen - hoffentlich, hoffentlich nahen – Zukunft, würde er auf ihre Lippen sehen, wie sie sich ganz leicht öffneten, nur für ihn, und dann würde er den letzten Schritt gehen und –
Libuse begann mit der Beschwörung.
Er wusste nicht, wie sie es tat, nicht einmal genau, was sie da tat. Es war das Gleiche, jedes Mal, wenn sie herkam.
Aber heute ist sie nicht allein, vergiss das nicht. Nicht allein.
Sie kauerte zwischen den Wurzeln der. Der Schnee knirschte und gab nach. Die Kälte schien ihr nichts anhaben zu können. Mit ihren Handschuhen scharrte sie das Eis beiseite, bis das schwarzbraune Wurzelholz zum Vorschein kam wie Adern unter totenbleicher Haut. Sie legte die Hände auf zwei armdicke Stränge und beugte den Kopf vor, so weit, dass ihr dunkelrotes Haar sich wie ein Schleier vor ihre Züge legte und die gewellten Spitzen den Schnee berührten. So kniete sie da, reglos, wortlos, mit tiefgebeugtem Rücken, und lange Zeit bewegte sich nichts mehr dort unten. Sie hätte tot sein können, erfroren, wären da nicht die weißen Atemwölkchen gewesen, die in ruhigem, gleichbleibendem Rhythmus unter der Haarflut empordampften und verrieten, dass noch Leben in ihr war.
Vergiß nicht, jemand ist hinter dem Wall! Irgendwer versteckt sich dort. Vielleicht um sie vor heimlichen Beobachtern zu schützen.
Aelvin wusste, was als nächstes geschehen würde. So war es immer, wenn sie den alten Göttern des Waldes huldigte.
Die Veränderung vollzog sich langsam.
Aelvins Herz dagegen schlug immer schneller.
Die Schatten unter Libuses Körper versickerten zwischen den Wurzeln der Eiche, wie Tinte in den Dielen des Skriptoriums, wenn Aelvin oder einer der anderen Schreiber ein Gefäß umstießen.
Nach wenigen Atemzügen waren die Schatten fort. Aus dem Holz der Wurzelstränge, aus der schartigen, borkigen Rinde, stieg ein Lichtschein auf, ein sanfter goldener Schimmer, der erst Libuse beschien, das Innere ihrer Haarflut zum Glühen brachte und schließlich in den sattgelben Tönen des Sonnenaufgangs die Senke erfüllte. Das Licht strahlte aus den Winkeln der Wurzeln, dort wo sie ineinander mündeten, verschlungen waren, sich kreuzten oder miteinander verwuchsen.
Es war kein Feuer, nichts das verzehren oder brennen konnte; es war pures, reines Licht, und es kam aus dem Inneren des Baumes. Der goldene Schein stieg aus den Tiefen seines uralten Holzes herauf, durchbrach die Rinde in Spalten und haarfeinen Rissen und badete die Senke und das rothaarige Mädchen in Helligkeit und Wärme.
Der Schnee begann zu schmelzen, rund um den Baum, rund um Libuse. Rinnsale reflektierten den überirdischen Glanz. Wasser sammelte sich und wurde aufgesogen, durchadert von Gold.
Aelvin sah kaum auf das Licht, denn er kannte es längst. Sah nicht auf den Baum, denn auch er war ihm vertraut. Er starrte nur Libuse an, die wundersame, verzauberte Libuse auf den Knien inmitten des Gleißens und Glosens, umspielt von Strahlen, die jetzt als breite Fächer zwischen den Wurzeln flirrten.
Laute ertönten. Hinter Aelvin!
Ein Schnauben und Fauchen. Scharrende Füße.
Dann das Brechen von Zweigen, gefolgt von einem infernalischen Toben. Das Unterholz explodierte.
Aelvin wirbelte herum. Zweige schlugen ihm ins Gesicht, eine Wolke aus Schnee und vertrocknetem Laub. Er stolperte rückwärts, aus seinen Träumen von Libuse gerissen wie von einer kräftigen Hand, die ihn an der Kutte packte und aus dem goldenen Licht in die frostklirrende Wirklichkeit zerrte.
Ihr Vater, schoss es ihm durch den Sinn. Er hat mich entdeckt.
Aber es war keine Hand. Und es war nicht ihr Vater.
Noch während ihm das bewusst wurde, traf sein Fuß nichts als Leere. Das verwobene Unterholz in seinem Rücken fing ihn auf, hielt ihn mehrere Herzschläge lang in der Schwebe – und gab nach.
Schreiend stürzte er hinterrücks in die Senke. Wärme empfing ihn, der Bronzeschein aus dem Inneren des Baumes, dann klatschte er mit dem Hinterteil in geschmolzenen Schneematsch, überschlug sich mit schlenkernden Armen und Beinen, spürte etwas Hartes über seinen Rücken schrammen, stieß sich schmerzhaft die Schulter und fiel weiter. Nochmals eisiger Schlamm, jetzt in seinem Gesicht, dann ein Schlag gegen seinen Hinterkopf, als er irgendwo anstieß, an einem der Wurzelstränge vielleicht.
Sie sieht mich, durchzuckte es ihn. Sie weiß, dass ich hier bin.
Natürlich, Dummkopf, wahrscheinlich bist du gerade auf sie gefallen!
Der Aufprall fuhr ihm durch alle Glieder. Er unterdrückte ein Stöhnen, keuchte nur leise und öffnete die Augen.
Grau. Weiß. Und schattiertes, unebenes Schwarzbraun.
Rinde und Schnee. Rinnsale, auf denen sich der Abenddämmer zwischen den Baumkronen spiegelte. Ein leises Plätschern und Tropfen von Schmelzwasser, das bereits versiegte und wieder erstarrte.
Keine Wärme mehr. Kein Licht.
Libuse war fort. Und mit ihr auch das große dunkle Etwas, das ihn von hinten angegriffen hatte. Kleine schwarze Augen. Stinkender Atem, ausgestoßen in gewaltigen Wolken. Verklebtes strähniges Haar oder, eher noch, Pelz. Und Zähne, Hauer ... Gott, diese Hauer! Lang und gelb und gebogen. Viel zu groß.
Kein Mensch, ganz bestimmt nicht.
Aelvin war auf dem Rücken zu Liegen gekommen, den Kopf auf einem verwachsenen Wurzelarm. Seine Füße hatten Furchen in den matschigen Schnee gestrampelt. Sein Mantel und das schwarze Skapulier waren völlig durchnässt. Am schlimmsten aber stand es um seine Kutte, deren weißer Stoff nun dem Waldboden unter dem aufgewühlten Schnee nicht unähnlich war. Er würde eine Menge zu erklären haben, wenn er zurück ins Kloster kam.
Wo aber war Libuse?
Dort, wo sie gekniet hatte, sah er eine seichte Mulde im Schnee, fast glatt geschmolzen. Auf der anderen Seite der Senke führten verwischte Stapfen die Schräge hinauf und über den Schneewall hinweg. Auch die Bestie im Unterholz zeigte sich nicht mehr, sie war gemeinsam mit dem Mädchen verschwunden. Es herrschte völlig Stille.
Er ließ den Kopf mit einem tiefen Seufzer nach hinten sinken. Er hatte alles verdorben. Er würde sie niemals wieder sehen. Selbst wenn sie noch einmal herkäme – was er bezweifelte, immerhin gab es im Umkreis zweier Tagesreisen Zigtausende von Bäumen -, konnte er sich hier nicht mehr sehen lassen. Sie war gewarnt. Sie würde vorsichtig sein.
Schlimmer noch: Ihr Vater würde ins Kloster kommen, um ihn zur Rede zu stellen. Ihr Vater, von dem die Brüder erzählten, er sei einst Ritter im Dienste des Erzbischofs gewesen. Ein Unhold von einem Mann, ein Troll nahezu, der zweifellos wusste, was man mit Kerlen machte, die jungen Mädchen nachstellten. Einer, der gewiss ein Schwert daheim hatte, und ganz bestimmt kein kleines.
Aelvin war so schlecht, dass er glaubte, sich übergeben zu müssen. Doch statt noch länger in seinem Elend zu schwelgen, riss er sich zusammen, stemmte sich mühsam und mit verhedderter Kutte auf die Füße und erklomm nach kurzem Zaudern die Schräge. Oben angekommen blickte er sich um, sah aufgewühlten Schnee und zerbrochene Haselnusszweige, wandte sich schaudernd ab und machte sich auf den Heimweg.
Er sah nicht zurück, nicht ein einziges Mal, denn er fürchtete, dass sie ihn beobachteten. Beide, das Mädchen und das Ungeheuer. Noch einmal ihrem Blick zu begegnen brachte er nicht über sich. Vor Scham wäre er am liebsten auf der Stelle gestorben, doch das hob er sich für später auf, wenn der Abt ihn zu sich zitieren und ihn Rosenkränze beten lassen würde, bis ihm die Finger bluteten.
Es sei denn, ihm käme vorher eine Idee.
Ein Einfall musste her. Auf der Stelle.
*
Odo erwartete ihn unter dem Mahnmal des Raubritters.
Wie hätte es anders sein können? Odo, der sich um ihn sorgte und versuchte, ihm die Flausen auszutreiben; der auch dann noch zu ihm hielt, wenn alle anderen die Köpfe schüttelten und drei Vaterunser für Aelvins Seelenheil beteten.
Unruhestifter, nannten sie Aelvin. Gotteslästerer und Schlimmeres. Er hatte jeden Fluch gehört, den ein Mönch zustande brachte, und das waren weit mehr, als das fromme Volk außerhalb der Klostermauern annehmen mochte.
Nur Odo war immer auf seiner Seite. Auch dann, wenn Aelvin selbst überzeugt war, dass er zu weit gegangen war. Wie damals, vor vier Jahren, er war gerade zwölf gewesen, als aus dem winzigen Feuer, an dem er sich in seinem Geheimversteck in den Ställen hatte wärmen wollen, ein böser Brand geworden war, der fast ein paar Rinder das Leben gekostet hatte. Er hatte sich schuldig gefühlt, wirklich schäbig. Alle anderen waren derselben Meinung gewesen, natürlich. Nur Odo nicht. Odo hatte versucht, ihn zu verteidigen, sogar vor dem Abt, der nicht einmal zugehört hatte. Aber Odo hatte geredet und geredet, hatte Stein und Bein geschworen, dass alles nur ein Missverständnis wäre. Vergeblich, natürlich. Und doch – Odo hatte ihn schützen wollen.
„Dafür sind Freunde schließlich da“, hatte er gesagt.
Auch heute wartete Odo auf ihn, frierend auf der Hügelkuppe, an dem hohen Pfahl mit der Ritterrüstung.
Der Erzbischof Konrad von Hochstaden hatte den Ritter dort aufhängen lassen, vor über zehn Jahren, wie es hieß; ein Raubritter sei er gewesen, dem die Mönche Unterschlupf gewährt hatten. Zwar hatte sich der Erzbischof überzeugen lassen, dass die Zisterzienser nichts von der Schuld ihres Gastes geahnt hatten – und das war die Wahrheit, jeder wusste das, auch von Hochstaden selbst, als er den Abt beschuldigt hatte -, dennoch hatte er verfügt, dass der Leichnam in voller Rüstung vor dem Tor des Klosters aufgepflanzt wurde. Dort sollte er hängen, bis der Allmächtige selbst ihn herabhob. Womit er womöglich Wind und Wetter gemeint hatte. Doch diese Gnade blieb den Mönchen versagt. Seither hing die Rüstung dort oben, lange schon ohne ihren Besitzer, denn ihn hatten bald die Krähen gefressen. Bei starkem Wind klapperten die mürben Knochen im Inneren des Harnischs, das hohle Scheppern einer Totenglocke. Der Rest war längst herabgefallen und von Tieren davon geschleppt worden. Keiner kannte den Namen des Toten, außer vielleicht dem Abt, und so hatten die Novizen ihm einen neuen gegeben, vielleicht das einzige Geheimnis, das auch nach zwei Generationen von Klosterschülern eines geblieben war. Den Leeren Ritter Ranulf nannten sie ihn, und niemand wusste so recht, warum Ranulf und nicht Wilhelm oder Ludwig oder, Gott bewahre, Konrad, wie der gnadenlose Erzbischof.
Es hatte wieder zu schneien begonnen, während Aelvin durch die Wälder zurück zum Kloster gestapft war. Einsam lag es auf einer Anhöhe über den Eifelwäldern.
Odo hatte seinen Mantel eng um den Körper gerafft und trat von einem Fuß auf den anderen. Der Harnisch von Ranulf schwebte eine gute Mannslänge über ihm, bizarr verdreht und gehalten von rostigen Ketten, mit denen man den Leichnam einst dort oben befestigt hatte. Ein Wunder, dass die Einzelteile des Eisenpanzers überhaupt noch zusammen hielten.
„Aelvin!“
Odo kam ihm auf dem letzten Stück entgegen, seltsam schwankend von seinem eigenen beträchtlichen Gewicht, aber auch von den Schneemassen, die das Laufen außerhalb der Pfade zu einer Tortur machten. „Bist du wahnsinnig geworden? Es wird nicht mehr lange dauern, ehe irgendwer nach dir sucht. Und wenn erst der Abt davon erfährt ...“
„Hat mich jemand vermisst?“
„Nein, ich glaube nicht.“ Odo baute sich vor ihm auf, ein Hüne von einem Mönch, mit Schultern und Oberarmen, die ihn für gröbere Arbeit als ausgerechnet den Dienst am Herrn befähigten. Odo war nicht fett, auch wenn man ihn auf den ersten Blick dafür halten mochte. Unter seiner Kutte, das wusste Aelvin, verbargen sich erstaunliche Muskelmassen. Er war stark wie ein Stier, obgleich er diese Stärke nie einsetzte. Als Kind hatte Odo einmal einen Mann geschlagen, weil der vom Marktstand seiner Mutter einen Laib Brot gestohlen und ihr im Gerangel die Nase gebrochen hatte; einen einzigen Schlag hatte Odo, damals acht, in den Magen des Diebes gelandet, und das hatte ausgereicht, den Kerl umzubringen. Pech, gewiss. Vielleicht hatte er ein Organ getroffen, das schon zuvor verletzt gewesen war. Doch das hatte keinen interessiert, auch nicht seine Mutter, die sogleich den Allmächtigen um Beistand anflehte und ihr „unseliges Mörderkind“ bald darauf in die Obhut der Zisterzienser gab. „Sie war wohl froh, ein Maul weniger stopfen zu müssen“, hatte Odo einmal zu Aelvin gesagt, kopfschüttelnd mit den roten Wangen geschlackert und das Thema gewechselt.
„Du siehst schrecklich aus.“ Odos breites Gesicht glühte unter der Kapuze. „War sie das?“
Aelvin grummelte ein „Nein“ zwischen halb geschlossenen Lippen.
„Wer dann?“ Odo ergriff einen Zipfel von Aelvins Skapulier und zerrieb mit einigem Widerwillen den Schmutz zwischen Daumen und Zeigefinger. „Schwarze Erde“, flüsterte er. „Teufelserde.“
„O, ich bitte dich ... Der Teufel hatte nun wirklich nichts damit zu tun!“
Über ihnen knirschte rostiges Eisen im Wind. Schüttelte der Leere Ritter Ranulf den Kopf ? Der Helm, in dem wohl noch immer ein Totenschädel auf ein christliches Begräbnis wartete, hatte sich halb aus einer Kettenschlaufe gelöst. Wahrscheinlich würde er bald herunterfallen, und dann wollte Aelvin nicht daneben stehen. Kein Zweifel, wem Abt Michael die Schuld an der Schändung des Toten geben würde, ganz gleich, wie oft Aelvin beteuern mochte, dass der Wind allein den Helm herabgeweht hatte.
„Komm“, sagte er, „lass uns rein gehen.“
Odo schüttelte energisch den Kopf. „So kannst du den Anderen nicht unter die Augen treten. Du siehst aus, als hätte dich eine eineKuh überrannt. Mitten im Schweinekoben.“
Aelvin zögerte und blickte zum Kloster hinüber. Die Stallungen, von denen es eine ganze Menge gab, drängten sich außerhalb der Mauer, ein schäbiges Spalier aus Hütten rechts und links des Weges. Das Tor stand offen, weil immer noch vereinzelte Bauern aus der Gegend ein und aus gingen; arme Schlucker, die den Mönchen ihre Rinder verkauften, damit diese aus der Kuhhaut Pergament für ihre Codices herstellen konnten.
Das Kloster bestand aus einer Ansammlung hölzerner Gebäude, die sich um eine schlichte Kirche scharten, das einzige Bauwerk aus Stein - mit Ausnahme der Mauer, mit der man die alte Holzpalisade ersetzt hatte, die während eines Sturms auseinandergebrochen war. Ein Sturm, der allerdings den klappernden Ritter Ranulf auf seinem Pflock gänzlich unbeschadet gelassen hatte.
Im Süden, gleich neben der Abtei und ihrer hohen Mauer, klaffte eine tiefe Schlucht. Die Kante der Steilwand war unbefestigt, und jeder, der im Kloster aufgenommen wurde, musste als Erstes eine Litanei von Warnungen über sich ergehen lassen, dem Abgrund nicht zu nahe zu kommen. Gefährlicher aber noch als die brüchige Felskante war das uralte römische Aquädukt, das sich auf hohen Steinsäulen über die Klamm zog, rund hundert Schritt von einer Seite zur anderen. Dort drüben führte es in den Wald, ein hellbraunes Band, das alsbald unter Moos und Gestrüpp verschwand. Auf der Klosterseite reichte die Wasserleitung bis nah an die Mauer und brach dort ab, sodass man in ihr Inneres blicken konnte – ein rabenschwarzer Tunnel, nur wenig über einen Schritt hoch und gerade mal halb so breit. Sie war bogenförmig gemauert, mit dicken Wänden, was sie von außen weit geräumiger erscheinen ließ als von innen. Es hieß - noch eine dieser Geschichten, um die Novizen zu erschrecken –, ein junger Mönch habe sich einmal dazu hinreißen lassen, in das Aquädukt hineinzu klettern, geradewegs über den Abgrund hinweg. Allerdings sei er nie auf der anderen Seite angekommen, denn auf halber Strecke war er stecken geblieben, unerreichbar für jede Hilfe von einem der beiden Enden. Dort habe er tagelang geschrieen, bis der Herr sich seiner erbarmte und ihn zu sich nahm. Seine Gebeine lagen angeblich noch immer irgendwo im Dunkeln, hoch über der Schlucht, weil danach niemand je gewagt hatte, hineinzuklettern. Mittlerweile war das Mauerwerk baufällig, und nach jedem Winter warteten die Mönche darauf, dass die Säulen nachgaben und die Wasserleitung hinab in die Tiefe stürzte.
„Also?“ Odos Zähne klapperten vor Kälte. „Was willst du tun?“
Aelvins Blick wanderte von seinem Freund zu den Ställen hinüber. Auf dieser Seite der Holzhütten war niemand zu sehen. Hinter einem windschiefen Gatter stand ein einzelnes dürres Schaf im Schnee und starrte aus dunklen Augen zu den beiden Novizen herüber. Irgendwo jenseits der Hütten bellte ein Hund.
Odo redete weiter auf ihn ein, machte Aelvin Vorwürfe, schimpfte auf das Teufelsmädchen aus den Wäldern, auf Aelvins Dummheit und über den Leichtsinn, mit dem er sein warmes Lager im Kloster aufs Spiel setzte.
Aelvin lächelte plötzlich. „Warmes Lager? Bei Gott, Odo, das ist es!“
Sein Freund runzelte die Stirn. Er ahnte, dass, was immer Aelvin in den Sinn gekommen war, nur zu weiteren Katastrophen führen würde.
„Ein warmes Lager!“ Aelvin sah von Odo zum Schafstall, dann hinüber zum des Aquädukts. „Wir werden erzählen, ich hätte zufällig beobachtet, wie ein Schaf ins Innere der Wasserleitung gelaufen sei. Natürlich bin ich sofort hinterher gelaufen und habe es unter Einsatz meines Lebens und mit dem Beistand des Herrn gerettet.“ Er strahlte. „Nur mein Ornat ist etwas schmutzig geworden. Und mein, sagen wir, linker Fuß, ist verstaucht. Tja, da werde ich die Nacht wohl im Infirmarium verbringen müssen.“
Odo starrte ihn mit offenem Mund an. „Das ist die abwegigste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Selbst von dir.“
„Ach was.“ Aelvin winkte ab.
„Der Abt wird dich aus dem Kloster jagen!“
„Von wegen. Ein gemütliches Feuer, weiche Decken, vielleicht ein Becher heißer Honigwein.“ Das Infirmarium, das Krankenquartier des Klosters, versprach alle nur denkbaren Annehmlichkeiten – jedenfalls für einen Novizen wie Aelvin, der die ersten Jahre seiner kirchlichen Erziehung in einer Bettlerabtei der Dominikaner zugebracht hatte. Erst mit elf war er zu den Zisterziensern übergetreten - nicht ganz freiwillig.
Nun aber sah er die Freuden des Infirmariums schon deutlich vor sich, ja, er spürte beinahe, wie die wohlige Wärme des Weins durch seine Glieder kroch. „Das ist das Paradies auf Erden, Odo! Das Paradies!“
„Das Paradies wirst du vielleicht sehen, wenn dir der Abt erst den Kopf abgerissen hat.“ Odo bekreuzigte sich. „Du kannst dich nicht schon wieder krank stellen.“
„Warum nicht?“
„Weil niemand dir abnehmen wird, dass du in drei Wochen zum zweiten Mal das Bett hüten musst. Niemand schläft so oft im Infirmarium wie du.“
„Vielleicht friert einfach keiner so sehr wie ich.“
„Ich schon.“
„Nicht genug. Sonst hättest du längst die Nase voll von zugigen Novizenzellen und kratzenden Decken voller Flöhe.“
„Das ist es nun mal, was uns zusteht.“
„Papperlapapp!“ Aelvin begann sogleich, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er raffte seine Kutte ein Stück nach oben und stiefelte durch den Schnee auf das Gatter zu, hinter dem das Schaf ihn neugierig anglotzte. „Alle werden begeistert sein, dass ich das arme Tierchen gerettet habe. Nicht mal die Verletzung, die ich mir im Aquädukt geholt habe, hat mich von dieser Heldentat abhalten können.“ Und sogleich begann er, demonstrativ das linke Bein nachzuziehen.
Odo verdrehte die Augen. „Das wird übel enden.“
„Statt herumzuunken, solltest du lieber aufpassen, das uns keiner sieht.“
Odo schlug abermals ein Kreuz, sandte ein knappes Stoßgebet zum Himmel und folgte Aelvin widerwillig Und leise vor sich hin brummelnd zum Zaun. „Der Herr wird uns strafen, falls es der Abt nicht tut. Beide werden sie uns strafen, auf Erden und – gelobt sei der Herr – im Himmel!“
„Der Herr ist auf meiner Seite, das siehst du doch!“ Aelvin deutete aufwärts in die dichter fallenden Schneeflocken. „Bei dem Wetter wird niemand nach Spuren suchen. Das ist perfekt!“
Er blickte sich ein letztes Mal nach unliebsamen Zeugen um, dann öffnete er das Gatter und hob das magere Schaf vorsichtig mit beiden Armen hoch, quer vor seine Brust. Das Tier machte ein überraschtes Geräusch, wehrte sich aber nicht; es schien eher verdutzt über so viel Aufmerksamkeit als verängstigt. Aelvin redete beruhigend auf das Schaf ein und stapfte dann ungelenk durch den hohen Schnee Richtung Klostertor. Er hatte das Gewicht des Tiers unterschätzt, und so drohte er bei jedem Schritt zu stürzen.
„Sie nehmen´s dir nicht ab“, sagte Odo überzeugt. „Niemals glauben sie dir solch eine Geschichte.“
„Wenn ... ein anderer ... sie bestätigt, dann schon“, keuchte Aelvin mühsam.
„Dann lass mich raten, wer dieser andere sein soll.“
Aelvin schenkte ihm über den Schafsrücken hinweg ein angestrengtes Lächeln. „Du hast was gut bei mir, Bruder Odo.“
„Ich habe mehr gut bei dir, als du jemals zurückzahlen kannst, Bruder Aelvin.“
„Du kannst dafür mein Abendessen haben.“
„Ich bin aber nicht hungrig.“
„Später wirst du es sein.“ Aelvin verlagerte stöhnend das Gewicht des Schafs. „Kein Anderer schleicht nachts so oft in die Küche wie du. Nicht mal ich.“
Odo kratzte sich unter der Kapuze im Nacken. „Das ist harmlos im Vergleich zu – “
Aelvin stolperte und hätte das Tier beinahe fallen lassen. Nun begann es zu strampeln.
„Herr im Himmel!“, entfuhr es Odo ungeduldig. „Wer kann das schon mit ansehen!“ Er nahm Aelvin das Schaf kurzerhand aus den Armen und trug es Richtung Tor. „Komm schon! Und, beim heiligen Benedikt, vergiss nur ja nicht zu humpeln.“
Erdlicht
Augen beobachteten Libuse aus der Dunkelheit zwischen den Bäumen. Große, schwarze Augen ohne menschliche Regung.
„Ich weiß, dass du hier bist“, rief sie, während sie durch das Unterholz preschte, unter eisbeladenen Fichtenzweigen hindurch tauchte und Stolperfallen im Schnee auswich. Sie kannte jeden Fingerbreit ihres Weges, jede Wurzel, jeden Erdspalt, jeden Baum. „Du warst das! Du hast den Jungen aus seinem Versteck getrieben, nicht wahr?“
Sie wusste, dass sie keine Antwort bekommen würde. Der Schatten, der ihr in einigem Abstand folgte, sprach niemals zu ihr.
Es war ein Eber. Größer als jedes andere Tier in diesen Wäldern. Und sie vertraute ihm, denn sie kannten einander schon lange, seit Libuse ihm als Kind zum ersten Mal im Dunkel eines Tannenhains begegnet war. Damals hatte sie ihm einen Namen gegeben: Nachtschatten.
„Ich hab dich nicht gebeten, das zu tun ... den Mönch aus den Büschen zu scheuchen.“ Ihr Atem jagte, eher vor Aufregung als vor Anstrengung von ihrem Lauf durch den stillen Winterwald. „Ich hab gewusst, dass er sich dort versteckt. Hast du gedacht, ich merk´ das nicht? Ich wäre auch allein mit ihm fertig geworden!“
Rechts von ihr brach etwas durch das Unterholz. Äste knackten, Schneemassen prasselten aus der Höhe herab. Irgendwo dort lief der Eber, jetzt parallel zu ihrem eigenen Weg. Wäre sie stehen geblieben, dann wäre auch er verharrt; aber weil sie rannte, stürmte er ebenfalls durch den Wald. Sie konnte ihn als schwarzen Schemen zwischen den Stämmen sehen, fünfzehn oder zwanzig Schritt entfernt, ein Umriss, der die Schatten verwischte und stets ein wenig davon mitzureißen schien.
Manchmal machte Nachtschatten ihr Angst, aber nicht an diesem Tag. Sie war viel zu wütend, um sich vor irgendetwas zu fürchten. Wütend auf ihn, wütend auf sich. Und auf den kleinen Mönch, diesen Dummkopf.
Ihr Vater hatte sie gewarnt, es zu weit zu treiben. Sie hatte ihm versprochen, nie wieder das Erdlicht heraufzubeschwören. Und, ja, sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie es trotzdem tat. Aber es fühlte sich so gut an; es wärmte jede Faser in ihr, besänftigte ihre Unruhe und vertrieb alle Fragen, die in ihr tobten und auf Antworten drängten. All die Fragen an ihre tote Mutter.
Das Erdlicht, der Schein aus dem Inneren der Bäume, war etwas Gutes. Es gab keinen Grund, es zu meiden. Libuse hatte das Talent, es zu wecken, und warum, zum Teufel, sollte sie es nicht nutzen? Früher hatte sie geglaubt, ihr Vater sei neidisch, weil er selbst keine Macht über das Erdlicht besaß. Jetzt wusste sie, dass das nicht stimmte. Es hatte ihn geschmerzt, dass die Mönche seine Bitte ausgeschlagen hatten, Libuse in ihrer Schule zu unterrichten. Und nun fürchtete er, dass sie in ihrer Angst vor Fremdem noch weitergehen würden, falls sich herumsprach, welche Fähigkeiten sie besaß.
„Sie werden behaupten, du seiest eine Hexe“, hatte er ihr erklärt, ihr dabei seine mächtigen Pranken auf die Schultern gelegt und ernst in die Augen geblickt. „Eine Hexe, Libuse! Und wenn sie dich erst fürchten, dann werden sie irgendwann kommen und fordern, dass ich dich herausgebe.“
„Herausgeben?“, hatte sie damals gefragt.
„Sie werden dich auf den Scheiterhaufen bringen. Oder dich aufhängen. Das ist es, was sie tun, mit Menschen die anders sind als sie.“
Sie hatte damals nicht verstanden, weshalb irgendwer sie würde aufhängen wollen, nur weil sie das Licht aus dem Holz der Bäume hervorlocken konnte und weil da eine Verbindung bestand zwischen ihr und dem Wald. Und dem, was zwischen seinen Stämmen umging, uralt und unsichtbar. Weshalb sollte jemand ihr deshalb den Tod wünschen?
Mit sechzehn Jahren war sie inzwischen alt genug, vieles über die Welt außerhalb des Turms, außerhalb der Wälder zu wissen. Nun war sie froh, dass sie nicht in die Schule der Mönche hatte gehen dürfen, denn ihr lag nichts an dem, was man ihr dort beigebracht hätte. Alles, was sie wissen wollte, konnte sie hier draußen im Wald lernen. Von ihrem Vater, von den Tieren, den Bäumen und dem Wind, der zu ihr wisperte.
Und dann war irgendwann dieser Junge aufgetaucht. Ein kleiner Mönch.
Er kam aus der Abtei wie die anderen, aber damals, als sie mit ihrem Vater dort gewesen war, war er ihr nicht einmal aufgefallen. Er war nur einer von vielen, die dort lebten, fünfzig oder sechzig waren es wohl. Und er war so einfältig wie sie alle, vielleicht sogar ein wenig zurückgeblieben, wenn man bedachte, wie grob und unbeholfen er sich im Wald bewegte. Hatte er denn nicht gelernt so zu schleichen, dass selbst der Fuchs ihn nicht witterte? Konnte er kein Versteck finden, in dem ihn der Adler nicht erspähte und das Reh nicht hörte? War er zu plump, sich vor Hase und Luchs und Eule zu verbergen?
Sie hatte mit ihm gespielt, hatte ihm das Erdlicht gezeigt, damit er Angst bekam. Sie hatte nicht geglaubt, ihn nach dem ersten Mal je wieder zu sehen. Tatsächlich hatte sie sich mit Vergnügen ausgemalt, wie er zitternd und schlotternd zu seinen Brüdern zurückkehren und ihnen von der dunklen Zauberin im Wald berichten würde. Dann aber hatte sie vor lauter Schadenfreude den Fehler begangen, ihrem Vater davon zu erzählen, von ihrem Triumph über das Mönchlein und wie sie Furcht in seinem Herz gesät hatte.
Der Vater war zornig geworden und hatte sie schwören lassen, das Erdlicht niemals wieder zu wecken. „Sie werden es sein, die zuletzt lachen, wenn du dummes Ding dich am Strick im Wind drehst.“ Er hatte noch einiges mehr gesagt, in einem Ton, den sie nur selten von ihm hörte, und zuletzt war sie so eingeschüchtert gewesen, dass sie allem zugestimmt hatte.
Kein Erdlicht mehr. Niemals wieder.
Ein paar Monte lang hatte sie sich daran gehalten, aber dann hatte sie ihr Versprechen gebrochen, weit genug vom Turm entfernt, damit er es nicht bemerkte. Sie war vorsichtig geworden, achtsam wie die Elster, die Silberschmuck vom Fensterbrett stibitzte. Aber wenn sie abends nach Hause kam, zurück zum Turm über den Wipfeln, dann hatte sie ihm angesehen, dass er es wusste. Er sprach sie nie wieder darauf an, aber seine Blicke sagten mehr als jeder Vorwurf. Er war enttäuscht, und er hatte Angst um sie.
Und dennoch konnte sie nicht vom Erdlicht lassen.
Erst recht nicht, als der Junge zum zweiten Mal aufgetaucht war. Und zum dritten, vierten und fünften Mal.
Sie hatte ihn unterschätzt. Statt ihm Angst einzujagen, hatte sie ihn neugierig gemacht, und so hatte sie die Regeln ihres Spiels geändert. Sie war bald sicher gewesen, dass er niemandem von ihr erzählte, sonst wären die Anderen längst gekommen und hätten bei ihrem Vater vorgesprochen oder sie eingefangen. Nein, sie war sein Geheimnis, so wie das Erdlicht das ihre war. Was sie auf seltsame Weise zu so etwas wie Verbündeten machte.
Obwohl er so unbeholfen war, ein grober Schleicher und gewiss ein tumber Tor, fühlte sie sich ihm verbunden. Zwei Menschen, die sich nicht kannten, nie ein Wort gewechselt hatten, und die doch so etwas wie ein stummes Abkommen geschlossen hatten. Ein Mönch und ein Mädchen, die von der Neugier immer wieder in den Bann des Verbotenen gezogen worden, ob sie wollten oder nicht.
Bestimmt hatte auch er ein schlechtes Gewissen, wenn er zu ihr in die Wälder kam. So wie Libuse sich vor den Blicken ihres Vaters schämte, wenn er wieder einmal ahnte, dass sein Vertrauen missbraucht hatte.
Und nun hatte Nachtschatten alles zunichte gemacht.
„Dummes, dummes Wildschwein“, fauchte sie im Lauf, obgleich sie natürlich wusste, dass Nachtschatten so viel mehr war als nur ein Wildschwein oder gar ein besonders großer Eber. Er war der Beschützer, den die alten Waldgötter ihr zur Seite gestellt hatten – daran glaubte sie ganz fest. So wie das Mönchlein einen Schutzengel haben mochte, so hatte sie Nachtschatten, der über sie wachte. Konnte sie ihm deshalb einen Vorwurf machen? Ja, verflixt, er wusste doch von dem Jungen, hatte seine Nähe zuvor schon ein halbes Dutzend mal ignoriert. Warum also hatte er ihn ausgerechnet an diesem Tag in seinem Versteck aufgescheucht? Nun würde der Novize nie mehr wiederkommen, und was sie anfangs noch gehofft hatte, machte sie nun ... traurig?
Pah, dachte sie, sie würde doch um kein dummes Mönchlein trauern! Nicht die Erbin der weiten Wälder, Kind der Wildnis, Tochter des Corax von Wildenburg.
Sie blieb stehen, trat in stummer Wut gegen einen abgebrochenen Ast und sah zu, wie loser Pulverschnee von den Zweigen rieselte. Es hatte wieder zu schneien begonnen, sie roch es in der Luft, sah hier und da auch ein paar Flocken durch das Dach der Baumwipfel fallen. Die Senke am Fuß der Eiche würde bald wieder in unberührtem Weiß daliegen und alle Spuren des Erdlichts wären verwischt.
Der Wald um sie herum war in vollkommener Stille erstarrt. Nachtschatten, wo immer er sein mochte, regte sich nicht. Keine berstendes Unterholz, kein Schnauben mehr aus dampfenden Nüstern. Sie glaubte seinen Blick zu spüren, aus einer Gruppe eng beieinander stehender Tannen, durch deren Nadeln kein Lichtstrahl fiel. Irgendwo dort wartete er, bis sie sich wieder in Bewegung setzte. Er folgte ihr niemals bis nach Hause, ließ sie immer auf dem letzten Stück allein.
Sie sprang mit einem übermütigen Satz über den gestürzten Ast hinweg und legte die letzten fünfzig Schritt bis zum Waldrand zurück. Dann sah sie den Turm vor sich, grau und düster vor dem dämmernden Abendhimmel.
Für ihren Vater, der auf einer Burg aufgewachsen war und sein Leben an Höfen und in steinernen Festungen zugebracht hatte, war dies ein ärmlicher Ort. Für Libuse aber war es das einzige Zuhause, das sie kannte.
Der Turm war aus Holz gebaut, aus dicken, festen Stämmen. Genau genommen hatte das Bauwerk mehr Ähnlichkeit mit einem Haufen aneinandergelehnter Baumstämme als mit einem echten Gebäude. Erst bei näherem Hinsehen waren die vereinzelten Fenster zu erkennen, so schmal wie Schießscharten, und die Tür, die eine Mannslänge über dem Boden ins Holz eingelassen war und nur über eine schmale Treppe zu erreichen war.
Corax von Wildenburg war Krieger gewesen, bevor er sich mit seiner Tochter in die Wälder zurückgezogen hatte, ein Ritter im Dienste edler Herrn. Den Instinkt, sich im Notfall verteidigen zu können, hatte er nie ganz ablegen können, obschon er von sich behauptete, kein Ritter mehr zu sein und Blut nur noch während der Jagd zu vergießen.
Eine Hand voll Krähen hockte auf den Vorsprüngen und Kanten in den unregelmäßigen Wänden des Turms. Einige stießen schnarrende Schreie aus. Ein Fuchs stob von rechts nach links durch den Schnee und verschwand wieder in den Wäldern. Die meisten Tiere schienen zu wittern, dass ihnen hier keine Gefahr drohte, denn Libuse und ihr Vater jagten niemals so nahe am Haus.
„Ich will den Tod nicht vor meiner Tür“, hatte Corax gesagt, als Libuse alt genug gewesen war, ihn zum ersten Mal auf die Jagd zu begleiten. Sie hatte sich gefragt, ob das nicht selbstverständlich sei. Damals hatte sie noch nicht viel über die Vergangenheit ihres Vaters gewusst.
Der Schneestreifen zwischen Turm und Waldrand maß etwa zwanzig Schritt. Sie rannte darüber hinweg, blinzelte die nassen Schneeflocken aus den Augen und stieg vorsichtig die Treppe zur Tür hinauf. Sie hatte die zehn Stufen am Morgen mit Asche aus der Feuerstelle bestreut, damit sich niemand auf dem vereisten Holz die Knochen brach. Doch inzwischen ging schon die Sonne unter, und die Asche war längst von frischem Schnee bedeckt.
Normalerweise rief sie nach ihrem Vater, wenn sie zur Tür hereinkam, doch heute Abend ließ ihr schlechtes Gewissen sie schweigen. Es konnte ihr nur recht sein, wenn sie ihm nicht gleich nach ihrer Heimkehr unter die Augen treten musste.
Vielleicht war er gar nicht zu Hause, sondern jagte noch irgendwo in den Wäldern. Doch es wurde langsam dunkel und Corax von Wildenburg hasste die Dunkelheit.
Libuse durchmaß die untere Halle mit raschen Schritten. Durch die schmalen Fensteröffnungen fiel der letzte Dämmer des Tages, ein Großteil des Raumes lag bereits in Finsternis. Stützbalken spannten sich als schwarze Streifen durch das fahle Grau. In der Feuerstelle glommen nur noch ein paar rote Funken, deren Schein kaum über die steinerne Umrandung hinausreichte.
Libuse entzündete im ganzen Raum die Kerzen, für den Fall, dass ihr Vater tatsächlich jetzt erst nach Hause käme; er wurde ungehalten, wenn ihn das Haus mit Dunkelheit empfing. „Zu viele Schatten“, pflegte er zu sagen. Auch deshalb hatte sie dem Eber den Namen Nachtschatten gegeben hatte, denn ihr Vater mochte das Tier nicht. Damals hatte sie sich kämpferisch gefühlt, aber Corax hatte nur stumm den Kopf geschüttelt, als sie ihm mit trotzig vorgerecktem Kinn davon erzählt hatte.
Kerzenschein erhellte den Tisch mit den beiden Stühlen unweit der Feuerstelle. Der Kessel mit Suppe, den sie am Morgen vorbereitet hatte, stand bereit, um am Haken über dem Feuer eingehängt zu werden. Bevor sie die Treppe hinauf nach oben lief, schürte sie die Flammen.Ihr Vater würde sicher hungrig sein, wenn er heim kam. Ihr selbst war der Hunger vergangen.
Die beiden Kammern im ersten Stock waren die seinen. In der kleineren schlief er, in der anderen bewahrte er Dinge, die aus der Zeit vor seinem Rückzug in die Wälder stammten. Waffen und Rüstzeug; Kleidung, wie er sie bei Hofe getragen hatte; allerlei Werkzeug, das nicht mehr in den überfüllten Schuppen passte, in dem er die meiste Zeit des Tage verbrachte; außerdem schwere lederne Codices und Schriftrollen, viele mit arabischen Zeichen beschrieben. Ihr Vater hatte Libuse das Lesen und Schreiben gelehrt, denn er verstand sich auf die Schriften des Abend- und Morgenlandes. Er hatte lange genug in den Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land gelebt, um die Sprache der Ungläubigen zu erlernen und ihre Schriften zu lesen; jedoch weigerte er sich, Libuse in diesen Zeichen zu unterweisen. Latein, gewiss, sogar ein Hauch von Griechisch, wie man es im alten Reich von Byzanz gesprochen hatte. Doch das Arabische verweigerte er ihr, und natürlich interessierte sie sich gerade deshalb dafür am meisten. Womit sonst, außer mit Suppekochen, sollte sie sich sonst den lieben langen Tag in dieser Einsamkeit beschäftigen? Durfte er sich da wundern, wenn sie sich die Zeit mit dem Erdlicht und den Tieren des Waldes vertrieb?
Er sagte oft, sie sei störrisch wie ein Esel und sturer als der älteste Ziegenbock. Außerdem widerborstig wie ... nun, wie ein erwachsenes Weib. Wobei ihm entgangen zu sein schien, dass sie eben dies längst war. Erwachsen. Eine Frau.
Im zweiten Stock des Turms lag ihre eigene Kammer, gleich unterhalb der Zinnen. Hier gab es keine Tür, die Stufen führten durch den Raum und endeten vor der Luke, durch die man hinauf auf die Plattform gelangte.
Zwei Dutzend Augenpaare starrten Libuse an, als sie die Kammer betrat. Vierundzwanzig Masken aus Lehm und Holz und Stroh gefertigt, manche bemalt, andere in irdenem Braun oder Grau. Sie hingen an den Wänden und Balken, einige verstaubt, weil sie nie von ihren Haken genommen wurden, andere abgegriffen von häufigem Anfassen. Da ragten Äste heraus wie Hahnenkämme, Bärte oder bizarre Dornenkronen; dort waren sie mit Kieselsteinen, Tannenzapfen und Baumrinde verziert.
Libuses Masken. Ihre Vertrauten. Ihre Freunde.
Sie grüßte sie, machte jedoch auf der Treppe nicht Halt, sondern hob mit beiden Händen die Luke nach oben. Schnee rieselte ihr entgegen. Ein eiskalter Windstoß öffnete den Fächer ihres flammendroten Haars wie das Feuer unten in der Halle. Mit einem leisen Fluch stieg sie hinaus auf das Dach des Turms, ein Quadrat von fünf mal fünf Schritt, dick verschneit. So weit oben war der Wind noch viel stärker, pfiff über die Tannenwipfel und fegte Schleier aus Eiskristallen heran. Der Schneefall hatte wieder nachgelassen, ein ewiges Hin und Her, als könne sich der Winter nicht entscheiden, ob er die Eifel unter sich begraben wolle oder nicht. So ging das schon seit Wochen.
Im Osten hatte sich der Himmel längst schwarz gefärbt, während im Westen die Schneewolken sachte zu glühen schienen, ein milchiges Rotgrau, das die Umrisse der Berge rahmte. Die Sonne war jenseits der Wälder versunken, aber noch reichte ihre Kraft, um den Horizont zum Leuchten zu bringen, selbst bei diesem Wetter.
Libuses Blick suchte ihre Spur im Schnee, aber es war bereits zu düster am Fuß des Turms, um die Fußstapfen von hier oben aus zu erkennen. Das Gesicht des Mönches kam ihr wieder in den Sinn, vor Schreck verzerrt, als er hinterrücks in die Senke stürzte. Er musste längst zurück im Kloster sein, nass und schmutzig und sicher mit einer Menge Schwierigkeiten, die er sich durch seinen Ausflug in die Wälder eingehandelt hatte. Es sei denn, er hatte sich eine gute Ausrede zurecht gelegt. Aber dazu war er gewiss zu dumm und ungeschickt.
Sie schaute nach Norden, wo sich jenseits der Schlucht das Kloster befand. Eine waldige Hügelkuppe verdeckte den Blick darauf. Wollte man dorthin gelangen, musste man einen weiten Umweg in Kauf nehmen, denn die Klamm, wo dierömische Wasserleitung verlief, ließ sich nur mühsam durchqueren. Nach der Schneeschmelze würde es dort wieder Sturzbäche geben. Irgendwann würden wohl die Wassermassen die Stützpfeiler des Aquädukts mitreißen und das mürbe Konstrukt zum Einsturz bringen. Als Kind hatte sie einmal versucht, darauf zu klettern, doch ihr Vater hatte sie zurückgerissen und ihr klargemacht, dass sie mit solcherlei Spiel ihr Leben riskierte. In der Zwischenzeit, beinahe zehn Jahre später, mussten die Steine noch brüchiger geworden sein, der uralte Mörtel aus den Fugen gebröckelt. Außerdem mochte der lange dunkle Tunnel über den Abgrund hinweg wilden Tieren als Unterschlupf dienen, denen nicht mal Libuse begegnen wollte.
„Hier bist du also.“
Die Stimme ihres Vaters ließ sie herumwirbeln.
„Ich war im Wald“, sagte sie und merkte sogleich, wie abwehrend sie klang. Als hätte sie etwas zu verbergen. Sie war eine so erbärmliche Lügnerin.
„Was hast du den ganzen Nachmittag getrieben?“, fragte er.
„Nachtschatten“, sagte sie rasch, obgleich sie wusste, dass ihm auch dies nicht gefallen würde. „Ich war mit Nachtschatten unterwegs."
„Ein Wildschwein ist kein Freund für ein Mädchen.“
„Kennst du einen besseren?“
Er sah sie ernst an, dann lächelte er plötzlich. „Du bist bissig geworden wie eine Schlange.“
„Und du besorgt wie eine Glucke. Ich kann selbst auf mich aufpassen.“
„Ja“, murmelte er beinahe ein wenig widerwillig, als fiele es ihm schwer, sich das einzugestehen. „Ich weiß.“
Corax von Wildenburg war ein Riese. Viele Jahre lang war er der einzige Mann gewesen, den Libuse gekannt hatte, und als er sie schließlich mit zum Kloster genommen hatte, war sie erschüttert gewesen, wie klein und schmächtig die Mönche dort waren. Bis sie allmählich begriffen hatte, dass nicht der Körperbau der frommen Männer ungewöhnlich war, sondern vielmehr der ihres Vaters. Manchmal kam es ihr vor, als sei er doppelt so groß wie sie, immer noch; sie wusste, dass dies nicht stimmte, und doch erschien es ihr, als überrage er sie so hoch wie der Turm, wenn man unten am Eingang stand. Sah man nur Corax´ Umriss, so wie jetzt als Silhouette vor dem grauen Abenddämmer, konnte man meinen, er trüge einen Harnisch, so breit wirkten seine Schultern. Und obwohl er bereits das fünfzigste Jahr überschritten hatte, besaß er noch immer die Kraft eines Bären.
Er hatte weißes Haar, das ihm bis auf die Schulter fiel, und einen grauen, kurz geschnittenen Bart, durch den sich eine einzelne schwarze Strähne von der Unterlippe bis zum Kinn zog. Gezackte Falten lenkten den Blick auf seine Augen, die so stählern blau waren wie der Himmel an einem eiskalten Wintermorgen. Er trug ein ledernes Wams, das sich über seinem gewaltigen Brustkorb spannte, Beinzeug mit gekreuzten Nähten und einen Umhang aus Schafsfell und Leder. Sein Haar war trocken, ohne eine Spur von Eis. Also war er bereits zu Hause gewesen, als Libuse kam.
Sie hatte Mühe, seinem bohrenden Blick standzuhalten. Hatte er den Schein des Erdlichts von hier aus beobachtet? Reichte es so weit hinauf in die Bäume? Dieser Gedanke kam ihr nicht zum ersten Mal, und sie fragte sich, ob das der Grund war, weshalb er stets über ihre Beschwörungen Bescheid zu wissen schien, auch wenn er es nicht aussprach. Seine Augen hatten im Alter nicht gelitten, wie überhaupt sein ganzer Körper nur ganz allmählich erste Anzeichen von Gebrechen zeigte.
Er musterte sie noch ein paar Herzschläge länger, dann trat er mit einem Ruck an ihr vorbei, legte beide Hände in den Schnee auf die Brüstung und blickte hinaus in die näherrückende Nacht.
„Ich habe in der Halle die Kerzen angezündet“, sagte sie und betrachtete ihn aufmerksam von der Seite. „Mach dir keine Sorgen wegen der Dunkelheit.“
„Das ist es nicht.“
„Aber über irgendwas machst du dir Gedanken. Das kann ich sehen.“
„Die Wälder sind in Aufruhr.“
Sie runzelte die Stirn. War nicht sie diejenige, die das hätte feststellen müssen? Ein Stich durchzuckte sie, fast ein Anflug von Eifersucht. Das waren ihre Wälder. Die Bäume, die Tiere, der Wind im Laub – das waren ihre Gefährten, ihre Geschwister.
Unsinn, sagte sie sich dann. Er lebt genauso lange hier wie du. Er kennt die Wälder ebensogut.
Aber er versteht sie nicht. Er hört nicht auf ihre Stimmen.
„Es sind Wanderer dort draußen“, sagte er, ohne den Blick von den Hügeln zu nehmen. „Und Reiter. Die einen laufen davon. Die anderen folgen ihnen.“
Im schwächer werdenden Licht bot sich die Landschaft als formlose Zusammenballung aus Schwärze und vereinzeltem Schneeschimmer dar.
„Wie kommst du darauf?“
„Ich habe Spuren entdeckt“, sagte er. „Im Westen. Zwei Menschen zu Fuß, in einem ziemlichen Zickzack, so als hätten sie sich verlaufen.“
„Hast du sie gesehen?“
Er schwieg eine Weile, dann nickte er langsam. „Von weitem.“
Sie legte eine Hand auf die seine.Seine Haut fühlte sich an wie Eis.
„Was ist los, Vater? Warum sagst du es mir nicht?“
„Nachdem ich sie gesehen hatte, bin ich hier heraufgestiegen. Und da hörte ich das Schnauben eines oder mehrerer Rösser, sehr weit entfernt. Dann schneite es wieder heftiger, und alles wurde still. Ich denke, die Reiter lagern jetzt irgendwo.“
„Und du denkst, sie verfolgen die Wanderer?“
„Die Beiden hatten es eilig, das konnte ich an ihren Spuren sehen. Sie haben mehrfach die Richtung gewechselt, wahrscheinlich haben sie im Schnee die Orientierung verloren. Aber sie haben keine Rast gemacht, sie sind immer weiter marschiert.“
„Wer waren sie?“
„Sie waren vermummt.“
Kein Wunder bei dem Wetter. „Glaubst du, sie wollen zur Abtei?“
„Wohin sonst?“
Zu uns, lag ihr auf der Zunge, doch das verkniff sie sich. Vielleicht wirkte ihr Vater so besorgt, weil er dieselbe Vermutung hatte. Fast als fürchtete er, nicht die Wanderer könnten eingeholt werden, sondern er selbst. Von seiner Angst.
Der letzte Schimmer am Horizont verblasste.
Corax atmete tief durch. „Lass uns nach unten gehen.“ Ins Licht, aber das musste er nicht aussprechen. Trotz seiner hünenhaften Statur, seines behänden Geistes und seiner Ausbildung zum Kämpfer gab es eines, das Corax von Wildenburg mehr fürchtete als den Leibhaftigen selbst – die Nacht. Das Dunkel. Vollkommene, lichtlose Schwärze, wie sie in diesen Augenblicken zwischen den Bäumen empor kroch.
Einmal, nur einmal, hatte Libuse miterlebt, was die Finsternis ihm antun konnte. Als verstörtes, zitterndes Bündel hatte er am Boden gekauert, kaum in der Lage zu sprechen. Das war vor vielen Jahren gewesen. Seitdem sorgte sie dafür, dass es im Turm niemals ganz dunkel wurde. Nie wieder wollte sie ihn in einem Moment absoluter Schwäche erleben. Sein Anblick, seine verstörten, leichenblassen Züge hatte sich zu tief in ihre Erinnerung geätzt.
Damals hatte sie ihn gefragt, woher seine rührte. Doch sie hatte keine Antwort erhalten. Wie auf so vieles andere auch. Auf die Fragen nach ihrer Mutter beispielsweise. Libuse wusste nur, sie war rothaarig gewesen wie sie selbst. Corax war ihr fern von hier im Morgenland begegnet, und dort war sie gleich nach Libuses Geburt gestorben. Corax war mit dem Kind in seine Heimat zurückgekehrt, hatte seine Ritterwürde abgelegt und sich in diesen Winkel der Wildnis zurückgezogen.
„Wenn die Wanderer unterwegs zum Kloster sind, dann sind sie vielleicht Mönche“, schlug sie vor, um sich selbst auf andere Gedanken zu bringen.
„Möglich.“
Die Kälte tat jetzt so weh an ihren Fingern, dass sie die Hand zurückzog. Seine aber blieb unverändert auf der Zinne liegen.
„Vater“, sagte sie sanft. „Deine Hand.“
„Hmm?“ Er blinzelte verwundert, blickte dann auf seine Linke herab und hob sie aus dem Schnee. Er ballte sie zur Faust, als wollte er einen Stein zwischen den Fingern zerquetschen. Dann drehte er sich abrupt zur Luke um. „Komm“, sagte er, „ich habe den Kessel übers Feuer gehängt. Die Suppe müsste bald heiß sein.“
Sie nickte und folgte ihm die Stufen hinunter. Die Luke fiel hinter ihr zu und abermals stob Schnee auf sie nieder.
Mitten in ihrer Kammer stand ein irdener Kerzenleuchter, den Corax jetzt aufhob; er musste ihn auf dem Weg nach oben dort abgestellt haben. Der wandernde Lichtschein erweckte die Masken an den Wänden zum Leben. Der Blick leerer Augenhöhlen folgte den Beiden auf ihrem Weg nach unten, bis das Kerzenflackern mit ihnen verschwunden war und zwei Dutzend Augenpaare zurück in die Finsternis sanken.
Das Mündel des Magisters
Schritte rissen Aelvin aus dem Schlaf. Ein Traum von Schnee und Eis zerschmolz in seiner Erinnerung. Obwohl im Kamin des Infirmariums ein Feuer brannte, fröstelte er.
Mit Ausnahme seines eigenen Lagers war das Krankenquartier unbenutzt. Sechs Betten gab es in dem lang gestreckten Raum, drei auf jeder Seite. Aelvin lag in einem der beiden hinteren. Am gegenüberliegenden Ende, neben der Tür, befand sich die offene Feuerstelle, in der Flammen über glühende Holzscheite tanzten. Auf der anderen Seite des Eingangs standen mehrere Regale mit Tiegeln und Schalen, ein Tisch voller Codices und einen dreibeinigen Schemel. Bruder Marius, der Heil- und Kräuterkundige der Abtei, hatte sich vor einer Weile in seine Zelle zurückgezogen, nachdem Aelvin ihm versichert hatte, dass es ihm an nichts fehle. Beim Gedanken an den gutmütigen Marius meldete sich Aelvins schlechtes Gewissen ein wenig und nagte arg an der Genugtuung über das Gelingen seiner List.
Er rieb sich die Augen. Horchte.
Schritte, die vor der Tür der Kammer verharrten.
War sein Betrug aufgedeckt? Kamen sie, um ihn zu holen? Abt Michael würde ihn womöglich davon jagen, sogar in der Nacht, wenn er erfuhr, dass Aelvin gelogen hatte.
Odo hatte gewiss nichts ausgeplaudert. Aber hatte irgendeiner der Brüder gesehen, wie Aelvin das Schaf aus der Umzäunung getragen hatte? Dabei war bisher doch alles so gut gegangen. Selbst die Mär vom verstauchten Fuß hatten sie ihm abgenommen. Bruder Marius hatte darauf bestanden, den Knöchel zu bandagieren, nachdem er ihn abgetastet und Aelvin im rechten Moment überzeugend aufgestöhnt hatte.
Freilich gab es neben Odo noch einen weiteren Zeugen. Einen, dem nicht das Geringste entging. Aber hatte der Allmächtige keine anderen Sorgen, als dem Abt während ihres allabendlichen Zwiegesprächs vom Betrug eines Novizen zu berichten?
Aelvin bekreuzigte sich und bat um Vergebung, ließ die Hände jedoch rasch wieder unter der Decke verschwinden und schloss die Augen, als die Tür des Infirmariums geöffnet wurde.
Zwei Gestalten erschienen im Rahmen. Genau genommen waren es drei, denn einer der beiden Männer, die in das warme Licht der Feuerstelle traten, trug einen schlanken Körper in den Armen.
Den Träger erkannte Aelvin nicht. Wohl aber den anderen. Die tief liegenden Augen des Abtes wirkten im schwachen Licht noch schattiger.
Aelvin blinzelte durch halb geschlossene Lider. Der zweite Mann trug eine ehemals weiße Kutte mit dunklem Überwurf. Er hatte die Kapuze hochgeschlagen, nur die untere Partie seines Gesichts war zu erkennen. Ein bartloses, scharf geschnittenes Kinn. Schmale Lippen, fast farblos – womöglich von der Kälte, denn so verschmutzt, wie sein Ornat war, musste der Mann eine lange Wanderung hinter sich haben.
Die dritte Gestalt, leblos in den Armen des Wanderers, war in weite Gewänder gehüllt. Auch sie trug eine Kapuze, ihr Gesicht war der Brust des Mannes zugewandt, sodass Aelvin keinen Blick darauf erhaschen konnte.
Er versuchte, sich nicht zu rühren und so gleichmäßig wie möglich zu atmen. Was nicht ganz einfach war angesichts seines Herzklopfens. Außerdem kam es ihm vor, als höbe sich die warme Wolldecke über ihm wie ein Blasebalg. Auf und nieder. Jeder Atemzug erschien ihm verräterisch. Sein Schicksal, daran zweifelte er nicht im Geringsten, war ein für alle Mal besiegelt.
„Wir sollten Bruder Marius wecken“, sagte Abt Michael leise.
Himmel, wollten sie etwa seinen Knöchel einer zweiten Untersuchung unterziehen?
„Er wird wissen, was zu tun ist“, setzte der Abt hinzu.
Der zweite Mann schüttelte unter seiner Kapuze den Kopf. „Nicht nötig, ehrwürdiger Abt.“ Auch seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. „Dem Mädchen fehlt nichts außer ein paar Stunden Schlaf und einem warmen Lager.“
Mädchen?, dachte Aelvin.
„Legt sie gleich hier ans Feuer.“ Der Abt schlug die Decke eines der vorderen Betten zurück. „Hier hat sie es warm und ist in Sicherheit. Wünscht Ihr etwas zu Essen für sie? Ich kann jemanden in die Küche – “
„Bemüht euch nicht, Bruder. Schlaf benötigt sie im Augenblick mehr als alles andere. Wir haben unterwegs gegessen, ein karges Mahl während der Wanderung. Nahrung konnten wir uns leisten, nicht aber eine Ruhepause.“
„Wie Ihr wünscht, Bruder.“
Aelvins Stirn kräuselte sich, ehe ihm bewusst wurde, wie verräterisch das war. Die Stimme des Fremden kam ihm bekannt vor. So bekannt, dass er unter der warmen Wolldecke eine Gänsehaut bekam.
War das möglich? Dass er es war?
„Was ist mit dem Bruder dort hinten?“, fragte der Fremde, nachdem er das verhüllte Mädchen auf dem Bett abgelegt hatte. „Er hat keine ansteckende Krankheit, hoffe ich.“