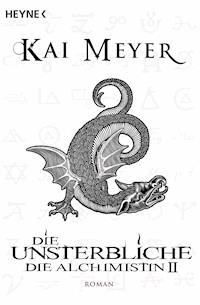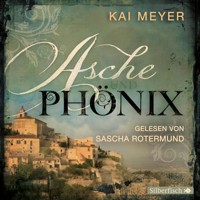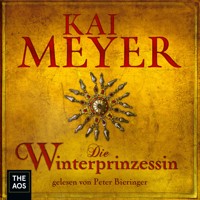Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wellenläufer
- Sprache: Deutsch
Ein gewaltiger Mahlstrom überzieht die Karibische See. Noch kann die schwimmende Stadt Aelenium ihm trotzen. Doch Heere von Klabautern rücken näher. Der Kreis um Aelenium schließt sich. Nur die Wellenläufer können den Untergang aufhalten: Jolly und Munk tauchen hinab zur Wurzel des Mahlstroms. Während ihre Freunde in Aelenium den Kampf aufnehmen, wandern die beiden Quappen über den Grund der Tiefsee. Durch bizarre Felslabyrinthe und Vulkanschluchten führt sie ihr Weg bis zu den Trümmern einer versunkenen Stadt. Hier stoßen sie auf das Mädchen Aina, das seit Jahrtausenden auf dem Meeresgrund gefangen gehalten wird. Im schwarzen Abgrund eines Tiefseegrabens treffen sich die Muschelmagier zum letzten Gefecht. Der dritte Band der Wellenläufer-Trilogie Band 1: Die Wellenläufer Band 2: Die Muschelmagier Band 3: Die Wasserweber
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Wasserweber
Band 3 der Wellenläufer-Trilogie
Kai Meyer
Copyright © Kai Meyer 2004
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlag- und Farbschnittdesign: Giessel Design
Bildmaterial: Shutterstock
Druck: Booksfactory
ISBN 978-3-95991-679-0
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Der träumende Wurm
Rochenflug
Im Strudel
Die Schwelle zum Krieg
Ankerschlacht
Die Hand des Mahlstroms
Aina
Die zweite Welle
Auf dem Klabauterpfad
Feuerregen
Die Schwere tiefer Wasser
Zwei Giganten
Die Flotte der Kannibalen
Ein Gespräch in der Tiefe
Tyrone
Der Schrund
Wenn Götter weinen
Der alte Rochen
Wo aller Zauber vergeht
Untergang
Wo ist Jolly?
Magisches Garn
Die neue Welt
Drachenpost
Der träumende Wurm
Am Morgen ihres letzten Tages in Aelenium besuchte Jolly den Hexhermetischen Holzwurm.
Sein Haus im Dichterviertel der Seesternstadt war schmal, gerade breit genug, um einer niedrigen Tür und einem Fenster nebeneinander Platz zu bieten. Wie überall in Aelenium gab es auch hier keine rechten Winkel und kaum eine gerade Wand. Die Gebäude der Stadt waren aus dem elfenbeinähnlichen Material der Koralle gearbeitet, manche auf natürliche Weise gewachsen, anderen von Steinmetzen und Künstlern geschaffen.
»Ich bin’s!«, rief sie, als sie an dem Wächter vorbeitrat und die Tür öffnete. »Jolly.«
Sie hatte nicht mit einer Antwort gerechnet und bekam keine. Sie wusste, wie es um den Wurm stand. Hätte sich sein Zustand verändert, hätte man sie darüber in Kenntnis gesetzt.
Jolly schloss die Tür hinter sich. Das, was sie dem Hexhermetischen Holzwurm zu sagen hatte, ging den Posten nichts an. Zudem fürchtete sie, Munk könnte ihr gefolgt sein und sich unbemerkt hinter ihr ins Haus stehlen. Dass er ihr Gespräch mit dem Holzwurm mit anhörte, war das Letzte, was sie wollte.
Dies hier war ihr Abschied. Ihrer ganz allein.
Sie stieg die unregelmäßigen Treppenstufen hinauf ins obere Stockwerk. Dort, im größten Raum des Hauses, hing der Wurm in seinem Kokon und träumte.
Das Zimmer unter dem Kuppeldach war zu einem guten Teil mit dem feinen Gespinst ausgefüllt, das der reglose Körper des Wurms absonderte – das einzige Zeichen, dass noch Leben in ihm war.
Vor einigen Tagen, als die ersten Anzeichen seiner Verpuppung sichtbar wurden, hatte Jolly gebeten, dass man ihn im Palast unterbringen möge, sogar in ihrem eigenen Zimmer. Doch Urvater und der Geisterhändler hatten das abgelehnt. Sie hatten ihre Entscheidung nicht begründet.
Jolly war nicht wirklich überrascht gewesen. Sie und Munk waren die beiden wichtigsten Menschen Aeleniums, das wurde ihnen immer wieder eingeredet. Keinem Unbefugten war es erlaubt, ihnen zu nahe zu kommen. Schon gar nicht etwas, das womöglich aus dem Kokon schlüpfen würde, wenn der Wurm seine Verpuppung abgeschlossen hatte. Falls etwas schlüpfen würde.
»Hallo, Wurm.«
Jolly blieb vor dem Wall aus Seidenfäden stehen. Die Fenster der Dachkammer waren mit lichtdurchlässigen Stoffen bespannt worden, zum Schutz vor Blicken aus den gegenüberliegenden Häusern, aber auch, weil man fürchtete, hungrige Möwen könnten den wehrlosen Kokon entdecken. Verglaste Fenster gab es nur in den Herrschaftspalästen Aeleniums, nicht aber in den Unterkünften des einfachen Volkes; hier schützte man sich vor Wind und Wetter mithilfe hölzerner Läden, die zugleich auch das Licht aussperrten. Das Gewebe, das man stattdessen vor die Fenster des Speichers gespannt hatte, machte die einfallende Helligkeit milchig und verwischte die Ränder der Schatten. Im ganzen Raum gab es nirgends mehr einen scharfen Übergang zwischen Licht und Dunkel, alles ging ineinander über, vermengte sich.
»Hallo«, sagte Jolly noch einmal, weil der Anblick des unheimlichen Seidendickichts ihr mehr zusetzte, als sie erwartet hatte. Buenaventure, der Pitbullmann, kam zweimal am Tag hierher, um nach dem Rechten zu sehen. Er hatte ihr von seinen Besuchen erzählt, aber dies war das erste Mal, dass sie das Ausmaß der Verpuppung mit eigenen Augen sah.
Die Seidenfäden waren zu einem gewaltigen Netz verwoben, das sich vom Boden bis zu den Dachschrägen erstreckte – einem Spinnennetz nicht unähnlich, nur viel feinmaschiger und ohne ein offensichtliches Muster. Das geisterhafte Fadendickicht reichte mehrere Schritt in die Tiefe. In seinem Zentrum hing eine ovale Verdickung – der Kokon des Wurms. Er schien zu schweben. Die Fäden, die ihn auf Schulterhöhe über dem Boden hielten, waren fast unsichtbar.
Der Hexhermetische Holzwurm war inmitten des Kokons nicht mehr zu erkennen, seine Form verbarg sich unter einer handbreiten Schicht aus Seide. Nur ein schwaches Pulsieren verriet, dass er lebte.
»Das ist ziemlich… beeindruckend«, sagte Jolly unsicher. Der Anblick schien ihren Mund zu verkleben, so als füllte auch er sich mit dem Gespinst. »Ich hoffe, es geht dir gut da drinnen.«
Der Wurm antwortete nicht. Buenaventure hatte sie gewarnt: Gespräche mit ihm waren derzeit eine einseitige Angelegenheit. Trotzdem war der Pitbullmann überzeugt, dass der Wurm sie hören konnte. Jolly war sich dessen nicht ganz so sicher.
»Du hast uns allen einen ziemlichen Schrecken eingejagt«, sagte sie. »Du hättest uns wenigstens warnen können, dass so was passieren würde. Ich meine, keiner von uns weiß besonders viel über Hexhermetische Holzwürmer.« Sie seufzte und streckte vorsichtig eine Hand aus, um die vorderen Fäden des Gespinsts zu berühren. Die Oberfläche wellte sich wie ein Vorhang. Es war, als hätte ein Lufthauch ihre Fingerkuppe gestreift.
»Ich bin hergekommen, um Lebewohl zu sagen.«
Sie zog die Hand zurück und hakte den Daumen linkisch hinter ihren Gürtel. »Munk und ich, wir werden aufbrechen. Zum Schorfenschrund. Alle hier in Aelenium hoffen, dass wir es schaffen, die Quelle des Mahlstroms zu versiegeln: die Edelleute, Hauptmann D’Artois, der Geisterhändler, Urvater. Wir selbst natürlich auch. Und, ich weiß nicht … Munk ist wirklich gut mit der Muschelmagie. Vielleicht bekommt er es tatsächlich hin.« Sie machte eine kurze Pause, dann fuhr sie fort. »Ich selbst bin noch nicht so weit, auch wenn keiner das wahrhaben will. Jedenfalls sagt es mir niemand ins Gesicht. Ich bin nicht mal halb so geschickt mit den Muscheln wie Munk. Er … na, du kennst ihn ja. Er ist so ehrgeizig. Wie besessen. Und immer noch ist er wütend auf mich – weil ich auf der Carfax die Muschelmagie gegen ihn gerichtet habe. Aber hat er mir denn eine Wahl gelassen?«
Sie begann, vor dem Gespinst auf und ab zu gehen. Sie hätte dieses Gespräch lieber mit jemandem geführt, der ihr einen Rat geben konnte. Aber auch wenn die Gefährten hier in Aelenium an ihrer Seite waren – die Piratenprinzessin Soledad, Kapitän Walker und sein bester Freund Buenaventure, der Hüne mit dem Hundegesicht –, keiner von ihnen konnte sich wirklich in ihre Lage versetzen.
Außer vielleicht Griffin. Aber Griffin war verschwunden. Sein Seepferd war allein nach Aelenium zurückgekehrt. Bei dem Gedanken an ihn spürte Jolly, dass ihre Knie weich wurden. Ehe sie nachgeben konnten, ließ sie sich ein wenig unbeholfen im Schneidersitz auf dem Boden nieder. Es war zu spät, um die Tränen zurückzuhalten, die über ihre Wangen liefen.
»Keiner kann mir sagen, was aus Griffin geworden ist. Alle behaupten, er ist tot. Aber das kann nicht sein. Griffin darf nicht tot sein. Das sagt man so, oder? Ich meine, darf … Ziemlicher Unsinn, was? Als gäbe es für so was irgendwelche Regeln und Gesetze.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube ganz fest daran, dass er noch lebt.«
Der Kokon im Herzen des Gewebes pulsierte ungerührt weiter. Bei jeder schwachen Ausdehnung, jedem Zusammenziehen lief eine Welle wie ein tiefer Atemzug durch die Seide.
»Was wird aus dir, wenn du aus diesem Zeug rauskommst?«, fragte sie. »Weißt du selbst das überhaupt? Wie steht es jetzt um die Weisheit der Würmer?«
Sie bemerkte, dass sie beim Sprechen die Finger um ihre Knie gekrallt hatte, so fest, dass es wehtat. Erschrocken ließ sie los.
»Urvater und der Geisterhändler tuscheln von morgens bis abends miteinander. Sie sagen, der Angriff auf Aelenium steht bevor. Und heute Morgen haben sie sich entschieden.«
Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Wir brechen auf«, sagte sie erschöpft. »Die Übungen sind abgeschlossen. Ich glaube, Munk und ich können nicht mal die Hälfte von dem, was wir können sollten. Aber es ist keine Zeit mehr. Spätestens in zwei oder drei Tagen ist Tyrones Flotte hier, und die Tiefen Stämme werden wohl gleichzeitig angreifen oder sogar noch früher. Keiner weiß, wie lange die Soldaten Aelenium halten können. Vielleicht ein paar Tage. Vielleicht nur ein paar Stunden.«
Wieder verging eine ganze Weile, in der sie kein Wort sagte und nachdenklich vor sich auf den Dielenboden starrte. Sie malte sich aus, was passieren würde, wenn die Diener des Mahlstroms die Stadt erreichten. Der riesige Strudel, der am Horizont auf offener See tobte, hatte die Klabauter unter seine Herrschaft gebracht. Tausende von ihnen zogen in Heerschwärmen auf Aelenium zu. Und auch der gefürchtete Kannibalenkönig Tyrone mit seiner Flotte würde auf der Seite des Mahlstroms kämpfen.
Früher oder später würde Aelenium sich geschlagen geben müssen. Erst recht, falls es Munk und ihr nicht gelang, den Mahlstrom zu besiegen. Doch genau dazu sollte ihnen der Kampf um die Seesternstadt die nötige Zeit verschaffen. Dutzende, vielleicht hunderte würden ihr Leben lassen, um kostbare Stunden und Minuten für die beiden Quappen herauszuschinden, die tief am Meeresgrund versuchten, den Mahlstrom in seine Muschel einzusperren.
Und neben allem anderen – Griffins Verschwinden, Munks Ehrgeiz und der Furcht vor dem ungeheuerlichen Strudel, der all das Böse nach Aelenium und über die Karibik brachte – war es gerade das, was Jolly am meisten beschäftigte: die Tatsache, dass Menschen sterben würden, um sie und Munk zu unterstützen. Weil alle ihre Hoffnungen in sie setzten.
»Ich habe so viel Vertrauen nicht verdient«, flüsterte sie niedergeschlagen. »Sie müssen das doch wissen, oder? Dass ich sie sicher enttäuschen werde.«
Sie war einfach noch nicht bereit. Würde es vielleicht niemals sein. Aber das spielte längst keine Rolle mehr. Ihr Aufbruch war beschlossene Sache.
Sie hatte sich gewehrt, sich dagegen aufgelehnt – alles vergeblich.
Der Schorfenschrund erwartete sie.
Ihr Schicksal.
Jolly erhob sich, warf dem Kokon im Herzen des Gespinsts eine Kusshand zu und wischte sich die Tränen aus den Augen.
»Die Rochen sind zum Aufbruch bereit«, sagte sie.
»Hauptmann D’Artois wird uns zum Mahlstrom führen. Der Geisterhändler begleitet uns.« Sie lächelte müde. »Und Soledad. Du kennst sie – sie hat einfach darauf bestanden, so weit wie möglich mitzukommen. Keiner traut sich, ihr zu widersprechen.«
Sie gab sich einen Ruck. »Leb wohl«, sagte sie traurig. »Als was auch immer, wenn du aus diesem Ding schlüpfst – leb wohl!«
Damit drehte sie sich um, verließ die Kuppelkammer und stieg langsam die engen Stufen hinunter. Der Wächter an der Tür beobachtete sie mit großen Augen, als er erkannte, dass sie weinte. Aber er sprach sie nicht an, und dafür war sie dankbar.
»Der Wal wird angegriffen!«
Griffin schrak auf. Er ließ den Hammer sinken, mit dem er gerade erst zum Schlag ausgeholt hatte, und löste den Blick von dem groben Holzstuhl, der vor ihm auf dem Boden lag. Der achtundzwanzigste, er hatte mitgezählt. Achtundzwanzig Stühle für Ebenezers Schwimmende Schenke – den ersten Gasthof im Inneren eines Riesenwals.
»Harpunen, Griffin! Sie attackieren Jasconius mit Harpunen!«
»Wer?«
»Wer, wer … Klabauter, natürlich!« Der ehemalige Mönch war mit fuchtelnden Armen hinter ihm in der Tür erschienen.
Griffin hatte geglaubt, dem sicheren Tod ins Auge zu blicken, als er vor Tagen von dem gigantischen Tier verschluckt worden war. Doch erstaunlicherweise war er quicklebendig im Magen des Wals gelandet und dort von Ebenezer aufgelesen worden.
Der Mönch musste in den langen Jahren des Alleinseins hier unten verrückt geworden sein, davon war Griffin überzeugt. Sein Plan, eine Gaststätte im Magen des Ungetüms zu eröffnen, war der beste Beweis dafür. Nur wegen dieses irrsinnigen Vorhabens verbrachte Griffin seine Zeit hier unten damit, Stühle und Tische zu zimmern. Bevor er nicht mit seiner Arbeit fertig war, hatte Ebenezer gedroht, würden sie kein Land anlaufen.
»Harpunen, Griffin!«, wiederholte der Mönch aufgeregt. »Die Klabauter haben Harpunen.«
Aufgebracht lief er in dem holzgetäfelten Zimmer auf und ab. Draußen vor der offenen Tür erstreckte sich die dunkle Magenhöhle des Riesentiers. Hier drinnen aber, jenseits des magischen Durchgangs, herrschte die Atmosphäre eines gediegenen Landhauszimmers: sehr gemütlich, sehr bequem, sehr komfortabel.
»Wie viele Klabauter sind es?«, fragte Griffin.
»Woher soll ich das wissen? Schon mal von einem Wal gehört, der zählen kann?«
Griffin machte den Mund auf, um etwas zu erwidern, doch in dem Moment erfüllte ein ohrenbetäubender Lärm die dunkle Grotte des Walmagens. Etwas schoss auf die offene Tür zu wie eine Wand aus Schatten, begleitet von einem Tosen und Toben, als hätte jemand ein Loch in den Rumpf des Wals gerissen.
»Flut!«, brüllte Griffin, und dann stürzten sie beide auch schon vorwärts, warfen sich gegen die Tür und stemmten sich gemeinsam mit aller Kraft dagegen.
Die haushohe Welle krachte gegen die Außenseite und fegte den Mann und den Jungen mitsamt dem Türflügel beiseite. Wasser ergoss sich ins Innere des Zimmers, spülte über das Parkett, schleuderte Werkzeuge und fertige Stühle durcheinander und zerschlug einige von ihnen an den Wänden. Griffin und Ebenezer brüllten beide vor Schmerz auf, als sie mit Kopf und Rücken gegen Ecken und hölzerne Kanten stießen.
Das Wasser zog sich ebenso schnell zurück, wie es gekommen war. Eine zweite Flutwelle blieb aus. In Windeseile begann die Nässe in den Ritzen des Bodens zu versickern. Als Griffin sich stöhnend hochrappelte, lag nur noch ein feuchter Film über allem – aber er reichte aus, um darauf auszurutschen. Mit einem wilden Piratenfluch segelte Griffin rückwärts aufs Hinterteil, fiel genau aufs Steißbein und hätte vor Schmerz und Wut am liebsten mit all den dummen Stühlen um sich geworfen, die er gerade so mühevoll gezimmert hatte.
Ebenezers Atem rasselte. Er saß auf dem Boden, den Rücken gegen die Wand gelehnt, und lauschte auf die Stimme des Wals. Er behauptete, er und der Wal verstünden einander allein durch die Kraft der Gedanken, und mittlerweile war Griffin davon überzeugt, dass da etwas dran war.
Plötzlich keuchte Ebenezer auf. »Er hat sie verschluckt«, sagte er. »Griffin, er hat die Klabauter verschluckt!« Sorgenvoll schweifte sein Blick zur offenen Tür und suchte die plätschernde und gurgelnde Dunkelheit dort draußen ab.
»Wie viele?«, fragte Griffin und war mit einem Satz auf den Beinen.
Ebenezer stöhnte. »Nicht viele. Aber ertrunken sind sie wohl kaum. Es sei denn, er hätte ein paar zerquetscht.«
Griffin eilte zu einer Kiste, in der Ebenezer einige der Waffen aufbewahrte, die sich im Laufe der Jahre im Magen des Wals angesammelt hatten. Ganze Schiffsladungen voller Säbel, Dolche, Schnappschlosspistolen und Büchsen waren von Jasconius verschluckt worden. Dummerweise nützten Schusswaffen im Magen des Wals wenig – das nass gewordene Schwarzpulver machte es unmöglich, sie abzufeuern. Außerdem war die Gefahr zu groß, das Ziel zu verfehlen und die Magenwand zu verletzen.
Griffin zog einen Säbel aus der Kiste, wog ihn prüfend in der Hand und steckte zusätzlich ein langes Messer in seinen Gürtel. Ebenezer blickte von der Tür zurück zu Griffin. »Willst du wirklich da rausgehen?«
»Irgendwelche besseren Vorschläge?«
Der Mönch war hin- und hergerissen. »Jasconius hat noch nie einen Klabauter verschluckt. Bislang sind sie ihm immer aus dem Weg gegangen.«
Griffin packte einen Lampenkäfig am Griff und drängte sich an Ebenezer vorbei durch die Tür.
»Bleib hier und verriegle die Tür. Ich werd zusehen, was ich tun kann.«
»Wir könnten uns beide verstecken.«
»Und was wird aus deiner Schenke? Außerdem müssen wir bald sowieso raus, um Nahrung zu suchen. Die Vorräte in der Küche werden nicht ewig reichen.«
Ebenezer nickte, aber es lag wenig Überzeugungskraft darin. Wider Erwarten war Griffin gerührt von der Sorge des älteren Mannes: Bislang hatte er sich eher als Gefangener des Wals und seines Bewohners gefühlt, gerade gut genug, die Stühle und Tische für Ebenezer s verqueren Wunschtraum zusammenzuhämmern. Jetzt aber wurde ihm klar, dass der Mönch ihn mochte. Und es war nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es ihm umgekehrt genauso ging. Gewiss, Ebenezer war ein wenig verrückt, ganz bestimmt kauzig; im Grunde aber war er ein liebenswerter Kerl.
»Ich bin bald wieder da.« Griffin sagte es mehr zu sich selbst als zu Ebenezer. Die Worte ließen ihn mutiger erscheinen, als er sich in Wahrheit fühlte. Sein Stimme schwankte, das musste auch Ebenezer bemerken.
Klabauter mit Harpunen. Selbst wenn sie ihre Waffen beim Sturz in den Schlund verloren hatten, machte sie das nicht ungefährlicher. Ihre langen Krallen und spitzen Zähne waren tödlich wie Messerklingen.
Griffin trat aus dem Lichtschein des Zimmers und stieg mit seiner Lampe langsam den Hügel hinab. Wachsam schaute er sich um und gab sich dabei alle Mühe, entschlossen zu wirken. Kein Opfer ist Klabautern lieber als eines, das Todesangst hat; sie macht es ihnen leichter, ihre Beute aus dem Hinterhalt zu schlagen.
Hinter ihm drückte Ebenezer die Tür ins Schloss. Griffin hörte den Riegel schnappen. Der Streifen aus Helligkeit um ihn herum wurde abgeschnitten und von dem schwächeren Schimmer der Lampe nur spärlich ersetzt. Die Ränder des Lichtkreises reichten gerade mal drei, vier Meter weit. Dahinter herrschte Finsternis.
Überall blubberte und plätscherte es, während das Wasser von Wrackteilen herabtropfte und im Morast versickerte. Die Laute unterschieden sich kaum von der zischelnden Sprache der Klabauter.
Nervös schob Griffin mit der Armbeuge einige seiner Zöpfe aus dem Gesicht. Er hatte sein blondes Haar zu Dutzenden davon flechten lassen. Eigentlich war das die Haartracht der Sklaven, die aus Afrika herüber in die Neue Welt verschleppt wurden. Nur selten sah man sie bei einem weißen Bewohner der Karibik, und deshalb war Griffin besonders stolz darauf.
Er hatte gerade den Fuß des Hügels erreicht, als ein Fauchen ertönte. Von rechts. Aus der Dunkelheit.
Er riss den Säbel hoch, und dann schoss auch schon etwas auf ihn zu, als wäre es mit einem Katapult in seine Richtung geschleudert worden – ein spindeldürrer Körper mit schuppiger Haut, auf der sich das Lampenlicht in öligen Regenbogenfarben brach. Der Klabauter hatte die Hände mit den langen Krallen weit geöffnet, sein Maul klaffte wie der Rachen eines Haifischs.
Griffin ließ sich fallen und stieß dabei die Klinge nach oben. Stahl schnitt durch zähe Haut und Muskelfleisch, ein Kreischen ertönte, dann verschwand der Körper irgendwo in den Schatten und rührte sich nicht mehr. Ein lang gezogenes Schmatzen verriet, dass er im Magenschlamm versank.
Das war leicht, dachte Griffin und rappelte sich auf. Traniger Glanz schillerte auf seiner Klinge. Der Klabauter mochte ihn für einen verwirrten, ausgehungerten Schiffbrüchigen gehalten haben. Die anderen aber waren jetzt gewarnt. Wenn er nur wüsste, mit wie vielen er es zu tun hatte.
Er hielt die Lampe am ausgestreckten Arm über seinen Kopf. Ein Rascheln ertönte irgendwo vor ihm, gefolgt von dem blitzschnellen Plitsch-Platsch huschender Füße.
Mindestens einer, dachte Griffin. Wahrscheinlich zwei oder drei. Hoffentlich nicht mehr.
Etwas traf ihn im Rücken und ließ ihn vorwärts stolpern. Er schrie auf, stolperte in eine Vertiefung zwischen den Trümmern und stürzte nach vorn. Erst einen Augenblick später wurde ihm klar, dass ihm der Sturz das Leben gerettet hatte: Ein Klauenschlag raste durch die Luft über seinem Kopf und hätte ihm vermutlich das Genick gebrochen.
So aber rollte er sich auf den Rücken und stieß sich die Wirbelsäule an irgendetwas Hartem. Die Lampe glitt aus seinen Händen und versank einen Schritt weit entfernt im Morast.
In ihrem letzten Widerschein erkannte Griffin seine Gegner. Sie waren zu zweit. Ihre verkniffenen, runzeligen Grimassen waren wie unfertiges Beiwerk um ihre aufgerissenen Mäuler angeordnet – so als hätte der Schöpfer der Klabauter all seine Kraft auf die riesigen Schlünde und scharfen Zahnreihen konzentriert, die übrigen Züge aber nur halbherzig geformt; wie ein Kind, das das Interesse an einem Stück Ton verliert und den Rest seiner Arbeit lustlos zusammenknetet.
Griffin hieb mit seinem Säbel blind über sich in die Dunkelheit und versuchte zugleich, seinen Körper mit der linken Hand hochzustemmen. Doch seine Finger versanken im schwarzen Schlamm, mit einem Laut wie von einem schmatzenden Kuss. Erneut holte er aus, doch sein Hieb ging fehl. Stattdessen spürte er, wie etwas im Dunkeln seinen rechten Knöchel packte und daran zerrte, gerade außerhalb seiner Reichweite. Eine zweite Hand griff nach seinem anderen Bein, und jetzt begannen die Wesen, in entgegengesetzter Richtung daran zu ziehen.
Ohne nachzudenken, ließ er seinen Oberkörper hochschnellen und führte einen verzweifelten Schlag in Richtung seiner Füße, über die gespreizten Beine hinweg. Der Schmerz, der bei der abrupten Bewegung durch seinen Rücken raste, war mörderisch.
Dann – Widerstand! Ein schneidender Laut, gefolgt von irrem Klabauterkreischen.
Sein linker Knöchel kam frei. Doch die Kraft des Wesens zu seiner Rechten riss ihn mit Gewalt weiter, fort von dem Verletzten.
Klabauter sind tückische, gemeine Kreaturen, aber sie sind auch dumm und fast ein wenig kindisch. Wenn sie einen Gegner langsam und schmerzhaft töten können, ist ihnen das lieber, als ihn auf schnellstem Wege zu erledigen – nicht, weil die Qual an sich sie erfreut, sondern weil Töten für sie wie ein Spiel ist, und je länger es dauert, desto größer ist ihr Vergnügen.
Dies kam Griffin jetzt zugute. Sie hätten ihn in der Finsternis leicht töten können. Doch der befürchtete Angriff blieb aus.
Griffin versuchte, die Klauen, die sein Bein hielten, fortzutreten. Vergeblich. Die langen Finger des Wesens saßen fest wie Schraubzwingen. Jetzt zerrte der Klabauter ihn mit sich durch den Morast, durch Pfützen und Schlammlöcher, über harte Holzkanten, Fischgräten und Knochen, die unter ihm zerbarsten und seine Kleidung und seine Haut zerschnitten. Einmal war ihm, als schleife sein Gesicht durch Gras – bis ihm bewusst wurde, dass er mit dem Kopf auf dem verfilzten Pelz eines Löwenkadavers lag.
Das Schreien des verwundeten Klabauters hinter ihm wurde leiser, ging in ein Röcheln und Schluchzen über. Dann brach es ab.
Plötzlich war Griffins Bein frei.
Wattige Dunkelheit umgab ihn von allen Seiten.
Schmatzende Schritte zu seiner Rechten.
Bevor er aufspringen konnte, packten Klauen seine Zöpfe und zogen seinen Hinterkopf zurück in den Schlamm. Aber noch immer tötete der Klabauter Griffin nicht. Mit einem Griff entriss er seinem Opfer den Säbel.
Ehe Griffin sich versah, war er entwaffnet. Stahl klirrte in der Ferne. Der Klabauter hatte die Klinge fortgeworfen.
Dumm, dachte Griffin. Klabauter waren wirklich gotterbärmlich dumm.
Nicht, dass ihm diese Einsicht weiterhalf.
Er spannte die Halsmuskeln an, stützte seine Arme auf und ließ sich hochschnellen. Es gab einen fürchterlichen Ruck, und mit einem Aufschrei wurde ihm klar, dass er Fetzen seiner Kopfhaut und mindestens ein, zwei Zöpfe eingebüßt hatte – sie blieben in den Krallen seines Gegners zurück. Doch er war frei.
Irgendwie kam er auf die Beine, während hinter ihm muskulöse Klabauterarme wie eine Schere ins Leere schnappten.
Diesmal stellte Griffin sich nicht zum Kampf, er hatte seine Lektion gelernt. Er rannte los, nahezu blind in der Dunkelheit. Plötzlich sah er in der Schwärze einen schmalen Lichtstreif schweben, hinter Wrackteilen, die gewaltigen Gerippen glichen: Ebenezer hatte die magische Tür geöffnet, ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit, an dem Griffin sich orientieren konnte. Der Mönch musste bemerkt haben, dass die Lampe erloschen war. Er wusste, dass Griffin ein Signal brauchte, das ihm die Richtung wies.
»Einer lebt noch!«, rief Griffin keuchend zur Tür hinüber. »Mindestens.«
Falls er eine Antwort bekam, ging sie im Schmatzen und Platschen seiner Schritte unter. Der Klabauter stürmte hinter ihm her, doch auch er verhedderte sich jetzt in Trümmerteilen und Algenschlingen. Ein schrilles Gackern ertönte in Griffins Rücken. Lachte der Klabauter? Oder rief er andere Überlebende seiner Brut herbei?
Griffin rannte. Stolperte. Fiel hin. Sprang wieder auf und stürmte weiter.
Er erreichte den Fuß des Hügels. Die Tür auf dem Gipfel stand weit offen. Flackerndes Licht ergoss sich über den Abhang und die notdürftigen Bretterstufen. Die Tür stand einsam auf dem höchsten Punkt der Erhebung, nur ein Rahmen mit einem Eichenflügel, und bis auf die Helligkeit verriet nichts, dass sich dahinter etwas befinden könnte. Ganz sicher keine Zimmer, denn der Hügel auf der anderen Seite war leer. Trotzdem fiel der Schein des großen Kaminfeuers durch den Rahmen.
Wo steckte Ebenezer?
Griffin kletterte jetzt auf allen vieren die Stufen hinauf. Seine Stiefel waren voller Schlamm, und er fürchtete, auf den Kanten abzurutschen, wenn er sich nicht zusätzlich mit den Händen stützte. Er sah über seine Schulter, entdeckte den Klabauter keine Mannslänge hinter sich – gleichfalls auf Vorder- und Hinterklauen, nur dass diese Haltung bei ihm ganz natürlich aussah. Das Licht aus der Tür tauchte ihn in schuppiges Schillern, eine irisierende Farbenpracht. Selbst beim Klettern fuchtelte er mit seinen Krallen, versuchte Griffins Beine zu packen, tastete, schnappte und fauchte.
»Griffin!« Ebenezers Stimme. »Bleib stehen!«
Stehen bleiben? Er dachte gar nicht daran.
»Vorsicht!«
Etwas Großes flog um Haaresbreite über ihn hinweg, und nur, weil ihn das doch noch verharren ließ, erwischte es ihn nicht. Stattdessen traf es den Klabauter.
Ein hohles Klong ertönte, dann krachte die Kreatur rückwärts auf die Stufen, verlor endgültig ihren Halt und verschwand in der Tiefe. Griffin fuhr herum und sah ihn am Rand des Lichtscheins aufprallen, eingeklemmt zwischen zwei Balken und halb begraben unter einer mächtigen Kugel, fast so groß wie er selbst.
Ebenezers Globus. Der Mönch musste ihn aus dem hinteren Zimmer herbeigerollt und beidhändig aus der Tür geschleudert haben.
Der Klabauter streckte zitternd eine Klaue aus, dann erschlaffte die Bewegung. Seine Krallenfinger fielen auf die Kugel, suchten ein letztes Mal nach Halt und rutschten dann mit einem schrillen Quietschen abwärts. Die Tücke in seinen glühenden Augen erlosch. Eine zerbrochene Rahe hatte sich beim Aufschlag von hinten durch seinen Körper gebohrt.
Ebenezers Hände packten Griffin und halfen ihm auf.
»Waren das alle?«
»Ich glaube … ja.«
»Bist du verletzt?«
»Ja. Nein. Nicht wirklich.« Er hatte das Gefühl, sich mit jedem Wort durch Mauern aus Kopfschmerz graben zu müssen. Schwindel drohte sein Bewusstsein zu trüben. »Nur ein paar Schrammen. Sonst nichts.«
Ebenezer zog ihn über die Türschwelle ins Licht. Auf dem Dielenboden brach Griffin in die Knie und stützte sich mit den Armen ab.
»Klabauter haben Jasconius noch nie zuvor angegriffen!«, sagte der Mönch, während Griffin zu ihm aufblinzelte. »Die Tiefen Stämme hätten das früher nicht gewagt.«
Griffin rang nach Luft. »Ich habe dir erzählt, dass die Klabauter in den Krieg ziehen. Du wolltest mir ja nicht glauben. Das wird nicht der letzte Angriff bleiben. Der Mahlstrom hat die Klabauter unter seine Herrschaft gezwungen. Sie machen nicht vor dem Wal Halt und auch nicht vor viel Größerem. Sie werden alles zerstören.«
Ebenezer machte ein paar unentschlossene Schritte durch das Zimmer, bevor er stehen blieb. »Ich darf nicht zulassen, dass so etwas noch mal passiert«, sagte er wie zu sich selbst. Seine Züge verhärteten sich, als er sich zu Griffin umwandte. »Und ich werde es nicht zulassen.« Eine neue Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit lag in seiner Stimme. »Sieht aus, als müssten wir unsere Pläne ändern.«
»Unsere Pläne?«
Ebenezer nickte langsam; es wirkte, als sei sein Schädel schwerer als sonst, und auch seine Worte schienen mit einem Mal mehr Gewicht zu haben.
»Die Schenke muss warten. Jetzt werden wir erst mal mit dieser Saubande aufräumen.«
Griffin schluckte, dann zuckten seine Mundwinkel in der Anwandlung eines Lächelns.
»Heißt das –«, begann er.
»Wir helfen deinen Freunden gegen diese Pest«, unterbrach ihn Ebenezer so entschieden wie ein Kapitän, der einen neuen Kurs an seine Mannschaft ausgibt. »Jasconius wird uns auf dem schnellsten Weg nach Aelenium bringen.«
Rochenflug
Die Stallungen der FlugrochenI befanden sich in der ausgehöhlten Kuppe des Korallenbergkegels, der Aelenium überragte. Der steile Gipfel, von dem dutzende Wasserfälle in die Tiefe stürzten und sich in Kanälen und Teichen verloren, sah aus, als hätte man seine natürliche Spitze vor langer Zeit abgetragen. Heute befand sich dort oben eine weite, geländerlose Plattform. In ihrer Mitte klaffte eine kreisrunde Öffnung, fünfzig Schritt im Durchmesser. Sie diente den Rochen zum Ein- und Ausflug in ihren Hort.
Jolly war nicht zum ersten Mal hier oben – Hauptmann D’Artois hatte sie und Munk schon einmal mit heraufgenommen –, aber der Anblick der zahllosen Rochengruben, ringförmig entlang der Höhlenwände angeordnet, erschien ihr noch immer so beeindruckend wie beunruhigend.
Ringsum war die Halle überdacht, nur durch die große Öffnung in der Mitte fielen Licht und manchmal Regen herein. Obwohl Flugrochen nicht im Wasser leben, mögen sie ihre Umgebung feucht – und so wurde das Regenwasser über Rinnen zu ihren Gruben geleitet, wo es sich sammelte. Dort lagen die merkwürdigen Tiere die meiste Zeit über flach in der Nässe am Boden und schienen zu schlafen, bis jemand sie weckte, um auf ihnen auszureiten.
Es war nicht genug Zeit gewesen, um viel mehr über die erstaunlichen Wesen zu erfahren, und Jolly begegnete ihnen mit zögerlichem Respekt. Anders als die Hippocampen, die trotz aller Unterschiede Ähnlichkeit mit Pferden hatten – nicht nur im Aussehen, sondern mehr noch im Verhalten –, waren ihr die Rochen nicht geheuer. Ausgebreitet am Boden ihrer Korallengruben, wirkten sie träge und schwer, aber wenn sie sich in die Luft erhoben, besaßen sie eine Majestät, die einem den Atem raubte. Sie waren langsam – die Seepferde glitten um ein Vielfaches schneller durchs Wasser –, und doch verfügten sie über enorme Kräfte. Jeder Rochen konnte drei Reiter tragen, notfalls sogar mehr. Ein Schlag ihres spitzen Schwanzes tötete einen Menschen in Sekundenschnelle.
Zwei Rochen waren bereit zum Aufbruch, als Jolly und Munk den Hort betraten. Die Tiere lagen nebeneinander ausgebreitet am Boden, nicht in den Gruben, sondern inmitten des Lichtkreises, der durch die Deckenöffnung in den Hort fiel. Der Hauptmann wartete bei einem von ihnen.
Jolly warf einen Blick über ihre Schulter. Sie sah direkt in die missmutige Miene von Captain Walker und musste zum ersten Mal an diesem Tag lächeln. Er, Buenaventure und die Prinzessin hielten sich dicht hinter ihr, und sie wirkten, als wollten sie jedem, der ihrem Schützling auch nur einen Schritt zu nahe kam, mit dem Messer an den Kragen. Jolly fühlte tiefe Zuneigung zu den drei Menschen, die ihr in den letzten Wochen so vieles gewesen waren: Freunde, Gefährten und nicht selten ihre Beschützer.
Die drei waren jedoch nicht die Einzigen, die gekommen waren, um Abschied von den Quappen zu nehmen. Ein ganzer Tross von Menschen folgte ihnen auf ihrem Weg zu den Rochen, darunter Graf Aristoteles und die Mitglieder des Rates in ihren Prachtgewändern, Umhängen und Seidenschals.
Jolly mochte die meisten dieser Männer und Frauen nicht besonders; sie fand sie arrogant, verwöhnt und undankbar. Gewiss, alle würdigten, was Jolly und Munk bereit waren zu tun. Und doch machten die meisten keinen Hehl daraus, dass sie das Vorhaben als eine Pflicht der Quappen ansahen – so als sei es das unumstößliche Schicksal der zwei, sich für Aelenium zu opfern, ganz gleich, wie Jolly und Munk selbst darüber dachten.
Aber Jolly hatte längst aufgehört, sich darüber zu ärgern. Ihre Sorge galt anderen Dingen. Dem Mahlstrom. Und den Meistern des Mare Tenebrosum, jenen Mächten einer anderen, unfassbaren Welt, die diesen gigantischen Strudel erst geschaffen hatten. Ursprünglich hatte der Mahlstrom den Meistern als Tor in diese Welt dienen sollen. Doch er hatte sich seinen Schöpfern verschlossen und übte nun ohne sie seine Schreckensherrschaft aus.
Jolly trat zu Hauptmann D’Artois. Aus den Augenwinkeln beobachtete sie, wie der einäugige Geisterhändler in seinem dunklen Gewand Munk beiseite nahm und auf ihn einredete. Der blonde Junge nickte immer wieder.
Es lag nahe, dass die beiden diese Reise gemeinsam antraten. Sie kannten sich seit vielen Jahren. Die ganze Zeit über hatte der Händler versucht, Munk ohne dessen Wissen auf diese Mission vorzubereiten.
»Alles klar?«, fragte Soledad.
Jolly drehte sich halb zur Piratenprinzessin um. Trotz des Altersunterschieds war Soledad ihr hier in Aelenium und auch schon früher eine echte Freundin geworden. »Nein«, erwiderte sie.
Die Prinzessin lächelte traurig. »Glaub mir, wenn ich könnte, würde ich gehen.«
»Munk und ich schaffen das schon.«
»Sicher.«
Keine von beiden klang besonders überzeugend, aber es gab nichts anderes mehr zu sagen.
Walker löste sich von den Übrigen und berührte Jolly am Arm. Er schien sich in der Gegenwart der Flugtiere noch unwohler zu fühlen als sie.
»Mach’s gut«, sagte er schlicht, doch seine Miene war verbissen vor Sorge. »Viel Glück.«
»Brauchen wir nicht. Wir sind ja Quappen.«
Er starrte sie einen Moment lang entgeistert an, ehe der Spott zu ihm durchdrang. Dann lachte er, vergaß die Nähe des Rochens und beugte sich so weit vor, dass er Jolly ein letztes Mal umarmen konnte. »Sieh zu, dass du mir bald wieder auf die Nerven gehst, ja?«
Sie konnte nichts sagen, nickte bloß und winkte Buenaventure zu, der die ganze Zeit über mit erhobener Braue dastand.
Bei ihm wusste man nie, ob das ein Zeichen von Sorge oder Skepsis war oder ob es einfach nur zu seinem Hundegesicht gehörte. Er kratzte sich hinter dem linken Ohr – was ihn, obwohl er es mit einer menschlichen Hand tat, noch animalischer aussehen ließ –, dann legte er den Kopf schräg und sah tatsächlich aus, als wollte er jeden Moment ein gequältes Jaulen ausstoßen.
Jolly senkte ihren Blick. Sie würde jetzt nicht in Tränen ausbrechen, nicht hier und nicht vor den Mitgliedern des Rates. Der Hauptmann schien zu ahnen, was in ihr vorging. Eilig ergriff er die Zügel, zog sich in den Sattel und bedeutete Jolly und Soledad, hinter ihm aufzusteigen. Während der Geisterhändler und Munk auf dem anderen Rochen Platz nahmen, erwachte ihr Flugtier auch schon aus seiner Starre. Wellenförmig liefen die ersten Bewegungen durch die ausgebreiteten Schwingen des Tiers.
Einen Augenblick später trug es sie mit sanften, wogenden Flügelschlägen aufwärts. Jolly spürte den Herzschlag des Tiers unter sich, ganz ruhig und sanft, und mit jedem Schlag gewann sie ein Stück weit ihre Fassung zurück.
Sie atmete seufzend ein und warf einen Blick in die Tiefe. Gerade löste sich der zweite Rochen ebenfalls vom Boden und schwebte durch die Höhlendecke ins Freie.
Walker und Buenaventure standen dicht beieinander und blickten ihnen nach, mit Mienen, die ihre Angst und Hilflosigkeit verrieten. Die Ratsmitglieder winkten überschwänglich, aber Jolly beachtete sie gar nicht. Munk dagegen winkte zurück, gelassen, beinahe herrschaftlich, wie ein König, der Abschied von seinen Untertanen nimmt. Er hatte in den vergangenen Wochen viele solcher Züge angenommen. Ihm gefiel es, von den Edlen Aeleniums hofiert zu werden. Durchschaute er denn nicht, dass sie ihn ebenso schnell vergessen würden, wie sie ihn in ihren Reihen willkommen geheißen hatten? Falls die Mission der Quappen erfolglos blieb, waren sie nur zwei weitere Opfer eines aussichtslosen Krieges.
»Hauptmann D’Artois?« Jolly beugte sich näher an ihn heran, als der Rochen über die Kante der Plattform schwebte und sich der Abgrund der Korallenhänge unter ihnen auftat.
»Ja?«
»Wenn Aelenium überlebt . ich meine, wenn der Mahlstrom besiegt wird, ich aber nicht von dort unten zurückkehre, können Sie dann etwas für mich tun?«
Er nickte ernsthaft, ohne sich zu ihr umzuschauen. »Wenn ich überlebe – natürlich.«
»Könnten Sie Griffin für mich suchen und ihm sagen .« Sie verstummte, überlegte und fasste sich dann ein Herz. »Könnten Sie ihm sagen, dass ich ihn sehr gern gehabt habe? Viel mehr, als er sich vorstellen kann?«
»Das will ich gerne tun.«
»Sagen Sie ihm, dass ich oft an ihn gedacht habe in den letzten Tagen. Ich hätte ihn gern noch mal gesehen, bevor wir aufgebrochen sind.«
»Das verstehe ich.«
Jolly wollte noch etwas hinzufügen, dachte sich aber dann, dass D’Artois sicher begriffen hatte, was sie meinte. Falls er Griffin wirklich traf, würde er die richtigen Worte finden, ganz bestimmt.
Sie warf einen letzten Blick zurück. Aus der Luft deutlich zu erkennen waren die Schutzwälle um die Stadt. Es gab zwei – einen am Fuß des Korallenbergkegels, dort wo die Zacken des Riesenseesterns mündeten, auf dem sich Aelenium erhob. Der zweite Barrikadenwall lag ein paar hundert Meter höher im Gewirr der Gassen, nur ein kleines Stück oberhalb des Dichterviertels. Falls er brach, war die Stadt verloren. Dann konnten sich die Bewohner nur noch im Häuserkampf wehren, und es war allein eine Frage der Zeit, ehe die Klabauter, Kannibalen und Piraten die letzten Stellungen überrannten.
Schweren Herzens wendete Jolly ihren Blick ab und schaute nach vorn. Die Rochen trugen sie auf die Nebelwand zu, die Aelenium von allen Seiten umgab. Einen Moment später tauchten die Tiere in die Schwaden ein und durchflogen die höchste Schicht des Nebelwalls. Hier oben war es, als schwebten sie über den Wolken dahin, ein wattiges Weiß und Grau, das sich unter ihnen erstreckte, als könnte es jeden, der jetzt aus dem Sattel stürzte, mühelos auffangen. Dunstige Tentakel streckten sich nach den Rochen aus, die sie dann und wann mit ihren Unterseiten berührten oder mit den Schwingen in Stücke schnitten.
Jolly räusperte sich. »Darf ich Sie noch was fragen, Hauptmann D’Artois?«
»Frag nur.«
»Gibt es jemanden… ich meine, haben Sie jemanden, der da unten auf Sie wartet? Für den Sie das alles hier tun?«
D’Artois’ Nackenmuskeln traten plötzlich deutlich hervor, sein Rücken spannte sich merklich. »Ich kämpfe für … « Er verstummte. Vielleicht hatte er »für alle Menschen Aeleniums« sagen wollen, aber im letzten Moment war ihm wohl aufgegangen, wie schal diese Worte geklungen hätten. »Meine Frau ist tot«, sagte er nach einer kurzen Pause. »Sie ist ums Leben gekommen, als die Klabauter die Nordzacke des Seesterns angegriffen haben. Sie hat einen der Hippocampen geritten, die von den Klabautern in die Tiefe gerissen wurden.«
Jollys Kehle wurde noch trockener. »Das tut mir Leid.«
D’Artois schien sich wieder ganz auf das Steuern des Rochens zu konzentrieren. Aber sie sah, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten, als er die Zügel fester umklammerte. Er atmete tief durch, so als könnte ihn das von den bösen Erinnerungen befreien.
Soledad legte Jolly eine Hand auf die Schulter, nur ganz kurz, um sich gleich darauf wieder am Sattel festzukrallen; ihr war der Flug nicht geheuer.
»Jeder hier hat Opfer gebracht«, flüsterte sie in Jollys Ohr. »Munk hat seine Eltern verloren; du Captain Bannon; ich meinen Vater. Die Soldaten machen da keine Ausnahme.«
Jolly wusste das, aber es war dennoch gut, dass Soledad es aussprach. In Anbetracht ihrer eigenen Angst und Unsicherheit drohte sie zu vergessen, dass auch andere mit Verlusten und mit Leid leben mussten. Sie war nur eine von vielen. Sie war nichts Besonderes, das hatte sie selbst immer gesagt, auch wenn Urvater und der Geisterhändler ihr etwas anderes hatten einreden wollen.
Nur ein Mädchen.
Irgendwie fand sie den Gedanken beruhigender als all das Gerede von Quappenzauber und Muschelmagie. Falls es ihnen tatsächlich gelingen sollte, den Mahlstrom zu schlagen, dann nicht, weil sie anders waren als andere. Falls sie ihn besiegten, dann nur, weil sie nicht vergaßen, was sie waren. Wer sie waren.
Und dass sich gerade dafür zu kämpfen lohnte.
»Kannst du etwas sehen?«
Der Wal trieb mit offenem Maul auf den Wellen. Ebenezer stand zwischen zwei Zähnen, hielt sich mit einer Hand fest und beugte sich so weit vor, dass er am Gaumen des Tiers vorbei nach oben blicken konnte. Der Himmel war tiefblau wie ein ausgehöhlter Edelstein. Möwenschwärme kreisten über dem Wal; sie folgten ihm auf all seinen Wegen durch die Weltmeere. Kam er an die Oberfläche, pickten sie Algen und kleine Schalentiere von seinem Rücken.
Griffin befand sich hoch oben auf dem Kopf des Wals. Es war ein mühsamer und beängstigender Weg gewesen, durch die tunnelartige Speiseröhre hinauf ins Maul. Von dort aus war er ins Wasser gesprungen, der Wal war abgetaucht und dann genau unter ihm wieder aufgestiegen. Dabei hatte er Griffin auf seinen Rücken gehoben.
»Griffin!«, rief Ebenezer unten im Maul. »Nun sag schon, kannst du den Nebel sehen?«
Griffin beschattete seine Augen mit beiden Händen, aber die Helligkeit blendete ihn noch immer. Angestrengt blickte er in alle Richtungen, auf der Suche nach der Nebelwand, hinter der sich Aelenium verbarg. Jasconius mochte für ein Seeungeheuer über beträchtliche Intelligenz verfügen, doch sein Orientierungssinn ließ mehr als zu wünschen übrig.
Woher auch sollte ein Wal die Himmelsrichtungen kennen? Oder Längen- und Breitengrade?
»Ich sehe nichts!«, brüllte Griffin zurück. »Es ist alles so hell!«
»Warte noch einen Moment«, erwiderte Ebenezer und gab sich Mühe, das Krachen der Wellen an den mächtigen Zahnsäulen des offen stehenden Walmauls zu übertönen. Über ihm spannte sich der Gaumen des Ungetüms als schwarze Kuppel. »Du wirst dich schnell wieder daran gewöhnen.«
Es war nicht leicht, auf der glatten Oberfläche des Wals genügend Halt zu finden. Griffin hatte seine Stiefel ausgezogen, um die Haut des Tiers nicht zu verletzen. Barfuß kauerte er auf dem höchsten Punkt des mächtigen Leibes, der sich wie ein gekenterter Bootsrumpf unter ihm erstreckte, so schwarz wie Teer und mit tausenden winziger Krabben und Muscheln überzogen.
Erst jetzt konnte Griffin erkennen, wie gewaltig der Wal tatsächlich war. Er vermutete, dass der Körper mehr als das Doppelte eines Viermasters maß – die riesige Schwanzflosse nicht eingerechnet.
Griffin blickte durch den wirbelnden Möwenschwarm zum Horizont. Je mehr sich seine Augen an das Tageslicht gewöhnten, desto blauer und leuchtender erschien ihm der Himmel; es war, als würde von irgendwo jenseits des Meeres Tinte in die Unendlichkeit gepumpt.
Aber noch immer sah er nirgends den Nebel. Hätte Ebenezer ihm nicht vorher sagen können, dass Jasconius seine Routen willkürlich wählte? Der Mönch konnte den Wal in eine ungefähre Richtung lenken, und in der vergangenen Nacht hatte Griffin den Kurs anhand der Sterne überprüft – das war das erste Mal gewesen, dass Ebenezer ihn durch die Speiseröhre ins Maul des Wals geführt hatte. Danach waren sie wieder abgetaucht und hatten die Reise fortgesetzt.
Um ganz sicherzugehen, hatte Griffin jedoch darauf bestanden, noch einmal bei Tageslicht Ausschau nach ihrem Ziel zu halten. Womöglich waren sie Aelenium näher, als sie dachten, und er wollte nicht das Risiko eingehen, die Seesternstadt zu verfehlen.
Doch außer Möwen, gleißender Helligkeit und dem schwarzen Ungetüm unter sich konnte er nichts erkennen. Keinen Nebel, nirgends. Vielleicht war er immer noch zu nah an der Oberfläche. Nicht umsonst befand sich jeder Ausguck auf dem höchsten Mast eines Schiffes. Ja, wenn er hätte fliegen können wie die Möwen, dann vielleicht – Ein höllischer Lärm ließ ihn aufschrecken. Aus einer Öffnung in Jasconius’ Rücken, nur etwa zehn Schritt entfernt, schoss eine turmhohe Wassersäule empor, begleitet von einem Rauschen und Prasseln, das in den Ohren schmerzte. Sekunden später war Griffins Kleidung, die gerade erst in der Sonne getrocknet war, erneut triefend nass. Beinahe hätten ihn die Wassermassen vom Rücken des Wals gespült.
Fluchend lag er auf dem Bauch und versuchte, sich festzuhalten, während die letzte Fontäne aus dem Inneren des Ungetüms auf ihn niederstürzte. Er schloss die Augen, um sie vor dem Salzwasser zu schützen, und presste die Wange ganz fest gegen die Haut des Wals.
»Griffin?«, rief Ebenezer von unten. »Alles in Ordnung?«
Stöhnend rappelte Griffin sich hoch. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass er das macht?«
»Ich hab gedacht, du kennst dich aus mit Walen.«
Griffin schüttelte seufzend den Kopf, rieb sich die Nässe aus dem Gesicht und blickte zu der Öffnung in Jasconius’ Rücken hinüber. Die Wasserfontäne war mindestens zehn Mannslängen hoch gewesen. Der Druck, der nötig war, um solche Massen auszustoßen, musste enorm sein.
»Griffin?«
»Warte. Moment.« Eine verrückte Idee nahm in seinem Kopf Gestalt an. Wirklich ziemlich verrückt.
»Ebenezer«, rief er schließlich, »wie oft macht Jasconius so was?«
»Oh, ich kann ihn bitten, eine Weile damit aufzuhören.«
»Nein, nein … Ganz im Gegenteil!«
»Ist dir zu heiß?« Ebenezer klang besorgt. Vielleicht glaubte er, Griffin habe sich auf dem ungeschützten Walrücken einen Sonnenstich geholt.
»Ich will nur was ausprobieren.«
»Was ausprobieren?«
»Kannst du ihm sagen, er soll das noch mal machen? All das Wasser auspusten, meine ich.«
»Sicher.«
»Auf Kommando?«
Ebenezer unten im Maul schwieg einen Moment. Griffin war ganz froh, dass er ihm in diesem Moment nicht ins Gesicht blicken musste.
»Ja, vermutlich schon«, erwiderte der Mönch nach einer Weile. Er klang skeptisch.
Griffin verscheuchte eine Möwe, die ihn für einen zu groß geratenen Einsiedlerkrebs hielt, und machte sich auf den Weg hinüber zur Öffnung. Aus der Nähe sah er, dass die Ränder sich geschlossen hatten.
Er atmete tief durch. Wenn er höher hinaufwollte, um nach Aelenium Ausschau zu halten, musste er es wagen.
Und wenn der Wasserdruck zu stark war und ihm alle Knochen brach?
Er zögerte noch einmal, dann kletterte er auf die Öffnung. Sie sah aus wie ein riesenhafter, zusammengekniffener Mund, der sich jeden Moment unter ihm auf tun konnte. Einen Moment lang suchte Griffin nach der besten Position und kniete sich schließlich hin, Beine und Knie zusammengepresst und die Hände im Schoß verschränkt.
»Ebenezer? Jetzt!«
»Was, zum Teufel, tust du da oben?«
»Sag’s ihm einfach.«
Der Mönch zögerte. »Sei froh, dass ich nicht raufkommen kann, um dir die Flausen auszutreiben, mein Junge.«
Griffin grinste. »Käme auf den Versuch an, alter Mann.«
»Die Hand des Seligen wird von Gottes Willen geführt, vergiss das nicht. Auch wenn sie Großmäulern das Hinterteil versohlt.«
»Wer behauptet das?«
»Ein Seliger.«
»Mach schon, Ebenezer! Wir haben’s eilig.«
Griffin rechnete mit neuerlichem Widerspruch. Stattdessen aber spürte er, wie Bewegung in die Walmuskeln unter seinen Knien und Füßen kam.
Er wappnete sich, spannte den ganzen Körper an und fürchtete, jeden Moment von einem Hammer aus Wasser getroffen zu werden, so schnell, dass er womöglich den Aufprall im Meer gar nicht mehr spüren würde.
»Er soll ganz langsam …«, begann er noch – dann wurde er plötzlich wie von einer Riesenhand emporgehoben, so sanft, als versuche Jasconius ein zerbrechliches Stück Keramik zu balancieren.
Griffin stieß vor Überraschung einen jubelnden Laut aus, den Ebenezer unten im Schlund falsch deutete.
»Stirbst du?«, erklang es durch das Wasserrauschen.
»Nach dir, Ebenezer.«
Griffin konzentrierte sich jetzt ganz darauf, auf der wachsenden Wassersäule das Gleichgewicht zu halten. Dazu streckte er die Arme zur Seite und entspannte sich ein wenig, um dem Druck mehr Fläche zu bieten. Es ging besser, als er befürchtet hatte. Schwankend, schaukelnd und mit einem argen Rumoren im Magen wurde er von dem Salzwasserstrahl in die Höhe gehoben, mit einer Sanftheit, die er einem Ungetüm wie Jasconius nicht im Traum zugetraut hätte.
»Das ist toll!«, rief er lachend.
Fünf Schritt, dann zehn schwebte er jetzt über dem Rücken des Wals – alles in allem sicher ein Dutzend Mannslängen über der Meeresoberfläche. Möwen schossen kreischend auseinander, empört über dieses Eindringen in ihr Herrschaftsgebiet. Wasser sprühte rund um Griffin empor, und doch gelang es ihm, Blicke in alle vier Himmelsrichtungen zu werfen.
Er entdeckte den Nebel. Ein grauer Streifen wie Blei, das jemand über dem Horizont verschüttet hatte. Weit weg, aber gewiss innerhalb eines Tages zu erreichen, vielleicht schneller, wenn Jasconius sich beeilte.
Kaum hatte er den Nebel gesehen, ließ der Druck nach, und der Wasserstrahl unter ihm versiegte allmählich. Wie auf einem fliegenden Teppich schwebte Griffin abwärts und wurde fast zärtlich über der Rückenöffnung abgesetzt.
Ein wenig schwindelig, aber erleichtert, ließ er sich auf dem Hosenboden die Wölbung des Walkörpers hinabrutschen und klatschte ins Wasser. Mit wenigen Schwimmstößen glitt er seitlich an Jasconius’ riesigem Auge vorüber, das ihn neugierig beobachtete. Griffin wollte erst weiterschwimmen, aber dann verharrte er paddelnd im Wasser und wandte sich dem mächtigen schwarzen Auge zu, mindestens doppelt so groß wie er selbst.
Es war das erste Mal, dass er den Wal direkt anschauen konnte. Die gewölbte Oberfläche des Auges spiegelte – es sah aus, als sei Griffins Ebenbild in einer dunklen Glaskugel gefangen. Aber da war noch mehr als nur Neugier im Blick des Tiers. Ein Hauch von Melancholie?
Griffin trieb so lange vor Jasconius’ Auge, bis Ebenezer besorgt nach ihm rief, und selbst dann gelang es ihm nicht gleich, sich von dem Anblick zu lösen. Er hatte noch nie etwas Schöneres gesehen. Etwas, das ihn zugleich mit einer unerklärlichen Trauer erfüllte, so als färbe etwas von der jahrhundertelangen Einsamkeit des Ungetüms auf ihn ab. Was ging vor im Schädel des Wals? Was dachte er über die Winzlinge in seinem Inneren? War er nach so langer Zeit froh über ein wenig Gesellschaft?
Ein tiefes Brummen ertönte, fast ein Trompeten – die Stimme des Wals. Es war ein warmer, freundlicher Laut, und plötzlich konnte Griffin nicht anders, als dem Walauge zuzulächeln und ihm mit einer Hand zuzuwinken. Es war ein wunderbarer, verwirrender Moment. Dann erst wandte er sich schweren Herzens ab, so als wäre da noch etwas gewesen, das der Wal ihm hätte mitteilen wollen, tausend Geschichten aus tausend Jahren.
Ebenezer streckte ihm beide Hände entgegen und half ihm, ins Innere des Schlundes zu klettern.
Griffin deutete aus dem Maul ins Freie. »Diese Richtung«, sagte er, dann fielen er und der Mönch sich erleichtert in die Arme.
Eilig machten sie sich auf den Rückweg in die Magenhöhle und zur Tür auf dem Trümmerhügel.
Hinter ihnen schloss Jasconius das Maul und wartete, bis sie die magischen Räume erreicht hatten. Dann tauchte er unter und schwamm mit mächtigen Flossenstößen der Seesternstadt entgegen.
Im Strudel
Jolly wußte nicht, wie lange sie schon unterwegs waren, als Hauptmann D’Artois den Kopf zu ihnen herumdrehte und wortlos nach vorn deutete. Sie reckte sich und kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, um im gleißenden Licht der Sonne etwas zu erkennen. Doch das Spektakel in der Ferne auf einen Blick zu erfassen war unmöglich. Sie musste den Kopf drehen, um von einem Ende zum anderen zu schauen.
»Er ist so groß«, flüsterte sie. Weit, weit entfernt löste sich die Linie des Meeres zu einem grauen Dunst auf, nicht unähnlich der Nebelwand rund um Aelenium, und doch viel höher und unfassbar breit. Das Wasser unter ihnen war aufgewühlt, hatte aber nichts von der Unruhe eines aufziehenden Sturms an sich, zumal die Luft beinahe windstill war. Je weiter Jolly nach vorn blickte, desto deutlicher erkannte sie, dass sie sich bereits über den äußeren Ausläufern eines titanischen Strudels befanden: Das Meer bewegte sich in breiten, geschwungenen Bahnen von Westen nach Osten, wie Jahresringe eines aufgeschnittenen Baumstamms. Und es führte ganz allmählich abwärts, was nach allen ihr bekannten Regeln eigentlich unmöglich war.
Immer wieder sprühte Gischt turmhoch empor in den Himmel, scheinbar ohne Grund, denn es gab keine Riffe oder Sandbänke, an denen sich die Wellen hätten brechen können. Die Oberfläche brauste und tobte, hier und da schienen die Wogen einen eigenen Willen zu besitzen, denn sie wandten sich auch gegeneinander, so als wären da manche unter ihnen, die gegen den grausamen Sog aufbegehrten. Schaum lag in Schlieren auf dem Wasser wie Hautfetzen auf gekochter Milch, und gespiegelt wurde hier nicht einmal mehr das Blau des Himmels, so aufgebracht, so vernarbt war die See. Stattdessen hatte sich die endlose Weite unter ihnen zu einem purpurnen Schwarz verfärbt, so als spülte der Aufruhr des Wassers die Finsternis aus der Tiefe empor wie die Tarnfarbe zehntausender Tintenfische.
»Es wird noch viel schlimmer, wenn man näher heranfliegt«, sagte D’Artois. Seine Stimme klang rau und belegt.
»Haben Sie das vor?«, fragte Soledad. »Den Mahlstrom zu überfliegen?«
Jolly schauderte bei der Vorstellung.
»Natürlich nicht. Das wäre viel zu gefährlich. Aber ich dachte, dass es gut wäre, wenn wir alle einmal sehen, mit was wir es zu tun haben. Mahlstrom ist nur ein Wort. Aber das dort unten, das ist …« Er schüttelte den Kopf, als ihm kein passender Begriff einfiel. »Ein Abgrund zwischen den Welten, sagt der Einäugige. Aber für mich sieht es eher nach dem Ende der Welt aus.«
Er hatte Recht. Hätte Jolly es nicht besser gewusst, dann wäre sie überzeugt gewesen, dass sie das Ende des Ozeans erreicht hatten, jenen Ort, von dem die Menschen früher einmal geglaubt hatten, das Wasser ergieße sich über eine Klippe vom Rand der Erdscheibe. Bannon, ihr Ziehvater, hatte Jolly erklärt, dass die Welt eine Kugel war und dass es so etwas wie ein Ende nicht gab. Der Anblick des Mahlstroms aber konnte einen vom Gegenteil überzeugen.
Jolly fühlte sich schrecklich klein, viel zu winzig, um es mit solch einer Naturgewalt aufzunehmen. Meile um Meile brüllender See erstreckte sich dort unten, und das war gewiss noch nichts gegen das, was sie im Zentrum all dieses Chaos erwartete. Im Schorfenschrund, im Herzen des Mahlstroms.
D’Artois gab dem Soldaten, der den zweiten Rochen flog, einen Wink, und sogleich wendeten beide Tiere in einem weiten Bogen.
»Wir fliegen jetzt zurück zu einer Stelle, an der das Meer nicht ganz so aufgewühlt ist«, erklärte er über die Schulter. »Es ist wichtig, dass ihr beiden senkrecht abtauchen könnt und dabei nicht in den Sog geratet.«
»Wir müssen doch sowieso näher heran«, entgegnete Jolly. »Früher oder später werden wir den Sog ohnehin zu spüren bekommen.«
»Nicht unbedingt. Ein Mahlstrom ist geformt wie ein Trichter. Hier oben mag er fünfzig Meilen breit sein, aber zum Meeresboden hin verjüngt er sich. Ihr werdet unbeschadet über den Grund wandern können, unter seinen Ausläufern hindurch.« Er machte eine kurze Pause. »Der Einäugige sagt, im Mittelpunkt ist der Mahlstrom nicht breiter als ein Turm, der aus einer gewaltigen Muschel am Grund des Schorfenschrunds entspringt.«
Jolly blickte zum Geisterhändler hinüber, dem Einäugigen, wie D’Artois ihn nannte. Der Händler redete eindringlich auf Munk ein, aber über die Entfernung hinweg konnte sie nicht hören, was er sagte. Vermutlich gab er ähnliche Instruktionen wie der Hauptmann.
»Wie viele Meilen werden wir gehen müssen?«, fragte Jolly.
»Wenn wir euch am Rande des Mahlstroms absetzen … nun, etwa zwanzig oder dreißig. Genau lässt sich das nicht sagen, weil er mit jedem Tag größer geworden ist und wir es aufgegeben haben, ihn zu vermessen.«
Dreißig Meilen, dachte Jolly erschüttert. Der Schorfenschrund selbst lag angeblich in einer Tiefe von dreißigtausend Fuß, hatte Urvater behauptet. Und all das sollten sie ohne Hilfsmittel zurücklegen? Nicht einmal einen Kompass konnten sie mitnehmen, der Wasserdruck würde das Glas sofort zerstören.
»Vergesst nicht, dass ihr euch nicht weit vom Meeresgrund lösen dürft«, wiederholte D’Artois eine Anweisung, die ihnen bereits der Geisterhändler und Urvater eingehämmert hatten. »Der Mahlstrom wird nach Gegnern suchen, die sich ihm nähern. Der Einäugige sagt, solange ihr euch dicht am Boden haltet, wird er euch nicht entdecken. Es wird am besten sein, wenn ihr tatsächlich lauft und nur im Notfall schwimmt.« Er schüttelte den Kopf, so als wäre er es leid, Regeln nachzuplappern, die er selbst nicht verstand. »Ihr solltet Acht geben auf starke Strömungen, auf einen veränderten Druck und so weiter. Das alles könnten Anzeichen dafür sein, dass der Mahlstrom gerade nach euch greift.«
Jolly nickte benommen. Sie hatte das alles in den letzten Tagen schon hundertmal gehört. Es aber nun von jemandem wie D’Artois erklärt zu bekommen, der Magie nicht als gegeben hinnahm, machte den bevorstehenden Schrecken noch greifbarer und bedrohlicher.