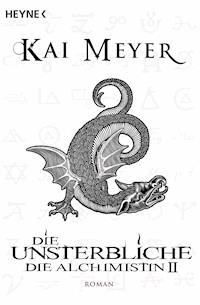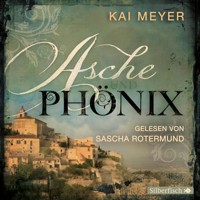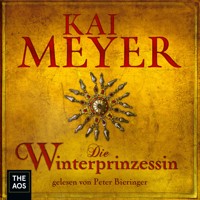Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Arkadien
- Sprache: Deutsch
Menschen, die sich in Raubtiere verwandeln. Kämpfe zwischen Mafiaclans. Die verbotene Liebe zu Alessandro. Rosa braucht dringend Abstand und kehrt der wilden Schönheit Siziliens vorübergehend den Rücken. In New York will sie ihrer eigenen Vergangenheit nachspüren. Doch auch dort herrschen Dynastien von Gestaltwandlern hinter den Masken der Mafia. Alle Antworten auf Rosas Fragen führen direkt in die Arme ihrer Gegner. Und entfernen sie immer weiter von Alessandro … Die Arkadien-Trilogie Band 1: Arkadien erwacht Band 2: Arkadien brennt Band 3: Arkadien fällt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arkadien brennt
Band 2 der Arkadien-Trilogie
Kai Meyer
Copyright © Kai Meyer 2009
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlag- und Farbschnittdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-809-1
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Das erste Kapitel
Flucht
Ohne dich
New York
Sein Gesicht
Valerie
Freaks
Blutsverwandt
Vergeltung
Eine von ihnen
Die Meute
Das Bootshaus
Die Verwandlung
Call it a dream
Gemma
Sizilien
Wiedersehen
Rache
Fundlings Schlaf
Artgenossen
Der Avvocato
Die Gefangene
Ein Pakt
Costanzas Vermächtnis
Apollonio
Drei Worte
Gewissheit
Das weiße Telefon
Lykaons Fluch
Das Serum
Auf See
Die Besucherin
Das Video
Experiment
Hundinga
Die Contessa
Der Dreimalgrößte
Totenstille
Aufstieg
Der Leopard
Suicide Queens
In Flammen
Arkadiens Stimme
Der Hungrige Mann
Die Alchimisten
Die Insel und der Mond
Drachenpost
Sie aber glänzt in bunten Farbenringen,
Und achtet nicht der Beute, die sie hält,
Die Macht nur ist’s, der Sieg und das Gelingen,
Es ist das grause Spiel, das ihr gefällt.
So bist auch Du! Dein Bild ist’s, das ich male,
Der dunklen Sterne unglücksel’ge Pracht;
Mit ihrem Glanz, mit ihrem Zauberstrahle,
Mit ihrem Reiz, mit ihrer Todesmacht.
Das Auge der Schlange
Joseph Christian von Zedlitz
Das erste Kapitel
Daddy?« Sie zog an seinem Ärmel. »Vor der Tür liegt eine tote Katze.«
»Gut. Eine weniger.«
»Wenn ich groß bin, will ich eine eigene. Eine nur für mich.«
»Katzen lassen sich nicht zähmen.«
»Meine schon.«
»Sie wird dich verletzen.«
»Niemals.«
Schweigen.
»Niemals. Niemals.«
Flucht
Draußen auf der Startbahn stieg eine Maschine in den Himmel, und die Welt um Rosa wurde still.
Nirgends eine Spur von Alessandro.
Während sie durch die Abflughalle hetzte, vorbei am Panoramafenster, blendete sie die Stimmen ihrer sechs Begleiter aus. Für einen endlosen Augenblick nahm sie nur den Flugzeugstart in Zeitlupe wahr, das Funkeln der Mittagssonne auf dem weißen Rumpf, dahinter die majestätischen Klippen der Bucht von Palermo.
Wo ist er?
Sie wusste, dass die sechs Männer sie nicht aus den Augen lassen würden. Dass sie ihr Ratschläge und Fragen und Belehrungen aufdrängen wollten. Aber Rosa lauschte nur ihrem eigenen Herzschlag, dem Blut in ihren Schläfen.
Mit wehendem Haar stürmte sie vorneweg, während ihre Berater ihr dicht auf den Fersen blieben, redend, gestikulierend, ein Chor aus Quälgeistern: Zecken in dem dicken Fell, das sie sich während der vergangenen Monate zugelegt hatte.
Ein halbes Dutzend Männer in feinen Anzügen, mit handgefertigten Schuhen und Seidenkrawatten, gut frisiert und manikürt – blitzsaubere Geschäftsleute für jeden, der sie sah, und in Wahrheit doch nur sechs von unzähligen Verbrechern, die das Vermögen des Alcantara-Clans verwalteten.
Rosas Vermögen.
Sie hätte sich dafür interessieren müssen. Stattdessen begegnete sie den Fragen und Forderungen ihrer Berater mit Gleichgültigkeit, als wäre es nicht ihr Geld, um das es ging. Die sechs sorgten sich ohnehin vor allem um ihre eigenen Beteiligungen. Aus Gründen, die ihnen gehörig gegen den Strich gingen, waren sie auf Gedeih und Verderb den Launen einer Achtzehnjährigen ausgeliefert.
Immerhin, das wusste Rosa zu schätzen. Nicht mit ihnen zu reden war ein bisschen, wie von ihnen zu stehlen. Damit kannte sie sich aus. Schwierig, lieb gewordene Angewohnheiten abzulegen. Schweigen gleich Stehlen gleich Adrenalin. Das war gerade so viel Mathematik, wie sie in einer übervollen Flughafenhalle ertragen konnte.
Ihr hellblondes Hexenhaar fiel wild und wirr über ihre schmalen Schultern, so resistent gegen Bürsten wie Rosas blasser Teint gegen Bräune. Die Schatten um ihre Augen ließen sich durch nichts vertreiben und waren im letzten Jahr noch dunkler geworden; einige hielten sie für Make-up, Kajalstift für den gemäßigten Gothic-Look, aber Rosa war damit geboren worden. Sie gehörten zu ihr wie so vieles, was sie nicht wieder loswurde. Ihre Schwächen: von Nägelkauen bis Neurosen. Und ihre Abstammung samt den gewöhnungsbedürftigen Eigenschaften, die damit einhergingen.
Wo, zum Teufel, steckte Alessandro? Er hätte hier sein müssen. »Zum Abschied bin ich bei dir«, hatte er gesagt.
Einer der Männer holte auf und versuchte, ihr den Weg zu verstellen. Ausblenden, taub sein. Seine Bemühungen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, wirkten wie absurde Pantomime. Sie trat an ihm vorbei und eilte weiter.
Alessandro, verdammt!
Vor vier Monaten, im Herbst, war sie auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit nach Sizilien gekommen. Und nun, Mitte Februar, floh sie abermals, diesmal vor der Gegenwart, fort von dieser Insel.
Nach außen war sie die Erbin eines Firmenimperiums. Seit ihrem achtzehnten Geburtstag vor zwei Wochen hielt sie auch vor dem Gesetz den Kopf hin für das Treiben ihrer Geschäftsführer. Selbst ihr wurde schwindelig, wenn sie an die Folgen dachte, die es haben mochte, einem Clan der Cosa Nostra vorzustehen.
Vor ihr tauchte die Sicherheitskontrolle auf. Kein Alessandro weit und breit. Mistkerl.
Sie beschleunigte ihre Schritte, ignorierte das Papier, das ihr einer der sechs im letzten Moment unter die Nase hielt, murmelte etwas von »In ein paar Tagen wieder da« und atmete erst wieder ein, als die Männer auf der anderen Seite der Sicherheitsschleuse zurückblieben.
Rosa schaute sich um. Die sechs traten fluchend den Rückzug an. Unter all den Menschen im Abflugbereich suchte sie den einen ganz bestimmten. Ein Gesicht, das ihr vertrauter geworden war als ihr eigenes.
War sie in ihrer Eile an ihm vorbeigehetzt? Wohl kaum. Hatte er sich ferngehalten, als er ihren Tross gesehen hatte? Schon eher. Ein Spross des Carnevare-Clans, der sich mit einer Alcantara abgab – viele Mitglieder der anderen Clans sahen darin noch immer eine Kriegserklärung. Rosa und Alessandro wussten beide, dass es genug Stimmen in ihren eigenen Familien gab, die hinter vorgehaltener Hand forderten, die Leichen der beiden im Meer zu versenken. Für Rosa hätte es ein gewagtes Spiel sein können, ihre nötige Dosis Risiko, wäre ihr nicht zu bewusst gewesen, dass sie bei diesem Balanceakt beide in den Abgrund stürzen konnten. Am Ende lief es darauf hinaus, sich zu trennen – oder für diese Liebe ihr Leben einzusetzen.
Die sechs Männer außerhalb der Absperrung ertrugen Rosas Desinteresse, weil sie wussten, dass für sie dadurch auf lange Sicht größere Befugnisse heraussprangen. Aber Rosas Verhältnis mit einem Carnevare wog schwer. Alcantaras und Carnevares waren seit jeher Todfeinde, die es nur einem mysteriösen Friedenspakt aus uralter Zeit verdankten, dass sie einander nicht längst ausgelöscht hatten. Mit erzwungener Koexistenz konnten die Clans notgedrungen leben. Ein Bündnis aber, das im Bett zweier Teenager geschlossen wurde, war für die meisten nicht zu tolerieren.
»Wie lange werden die anderen sich das ansehen?«, hatte Rosa einmal gefragt.
»Bis wir sie zwingen können, davor die Augen zu verschließen«, hatte Alessandro erwidert. »Und sie am besten gar nicht wieder aufzumachen.«
Wenn einer von ihnen verstand, was es bedeutete, der capo eines Mafiaclans zu sein, dann er. Rosa war gegen ihren Willen zum Oberhaupt ihrer Familie geworden. Alessandro aber hatte für seine Position gekämpft. Er hatte den Mörder seiner Eltern getötet; und in den vergangenen Wochen waren weitere seiner Widersacher verstummt, auf die eine oder andere Weise. Selbstschutz, er hielt sich den Rücken frei. Während Rosa vor der Verantwortung davonlief, stellte sich Alessandro allen Anfeindungen, warnte, drohte und bewies Konsequenz.
Shit. Er war tatsächlich nicht hier. Sie kämpfte mit Enttäuschung, mit Wut und Besorgnis, und davon bekam sie Bauchschmerzen.
Lass das nicht zu. Du bist nicht süchtig nach ihm.
Sie rückte den Schultergurt ihrer Umhängetasche zurecht. Dadurch spannte der schwarze Rollkragenpullover über ihrer Brust, was nun beileibe nicht alltäglich war. Wird noch, hatte ihre Schwester Zoe einmal gesagt, und Rosa hatte es manchmal nachgebetet. Jetzt lag Zoe im Grab und Rosas Oberweite nach wie vor im Argen.
Immer wenn Alessandro zu spät kam oder nicht rechtzeitig anrief, hatte sie Angst um ihn. Was sie taten, war Irrsinn. Sie hatten darüber gesprochen, gemeinsam wegzugehen, alles hinter sich zu lassen. Aber Rosa wollte nicht, dass er um ihretwillen etwas aufgab. Sie würde niemals Forderungen stellen. Wenn sie eines Tages wirklich gehen wollte, dann würde sie ihn auf keinen Fall mit sich zerren. Das war nicht ihre Art. Lieber wollte sie ohne ihn todunglücklich sein, als ihn zögern zu sehen. Es gab Risiken, auf die auch sie verzichten konnte.
Ihr blieb noch eine gute Stunde bis zum Abflug. Sie schlug den Weg zur Lounge ein, zeigte am Empfang ihr Ticket und betrat den Wartebereich für die Businessclass. Sessel und Sofas, zu Sitzgruppen angeordnet; ein üppiges Buffet, auch für Vegetarier wie sie; Reihen von Computerterminals mit Online-Zugang; klassische Musik aus Lautsprechern in der Decke. Und Kaffee, na also!
Geschäftsmänner taxierten sie. Ihr Rollkragenpullover fiel bis auf ihre Oberschenkel, dazu trug sie schwarze Jeans. Klapprig fand sie sich, mit ihren vorstehenden Hüftknochen und den viel zu dünnen Beinen. Offenbar sahen ein paar der Managertypen in den Sesseln das anders. Rosas Lippen formten ein herzliches »Kinderficker!« und lächelten lieblich.
Über eine der Trennwände zwischen den Sitzecken ragte ein Kopf hinaus. Wandte sich in eine andere Richtung, tauchte ab, kam wieder hoch. Der Blick traf direkt ihre Augen. Seine waren grün und leuchtend. Hätte sie ihn nicht gekannt, sie hätte sich beim Anblick dieser Augen ein Leben für ihn ausgedacht.
Seine Grübchen vertieften sich, sein Strahlen war so ansteckend wie am ersten Tag. Sein Gesicht machte die Welt zu einem besseren Ort.
»Ist nicht wahr, oder?« Sie fiel ihm um den Hals, quetschte dabei die Tasche zwischen ihren Körpern ein, ruckelte sie umständlich frei und presste sich wieder an ihn. Noch ein bisschen enger, damit die Gaffer was zu sehen bekamen.
Er küsste sie, betrachtete sie strahlend und küsste sie erneut. Das machte er oft so. Kurzer Kuss, Lächeln, langer Kuss. Wie ein geheimes Morsezeichen.
»Was tust du hier?« Sie klang atemloser, als ihr lieb war.
Er wedelte mit einem Ticket. »Hab ich gekauft.«
»Aber du hast gesagt, du fliegst nicht mit!«
»Tu ich auch nicht. Aber ich wollte dich noch mal sehen. Ohne deinen Anhang da draußen.«
Sie starrte ihn an. »Du hast viertausend Euro für ein Ticket bezahlt, nur damit sie dich in die Lounge lassen?«
»Mein Vater hat das Dreifache für ein Set Golfschläger ausgegeben. Dagegen ist das hier ’ne Spitzeninvestition.«
Sie drückte ihre Lippen auf seine und tastete nach seiner Zunge, bis sie beide keine Luft mehr bekamen. Eine Frau auf dem benachbarten Sofa erhob sich und zog ihren Mann eine Sitzgruppe weiter.
Rosa spürte ein kühles Kribbeln in ihrer Brust, blickte auf ihre Hand und sah, wie sich Reptilienschuppen auf den Fingern bildeten. Ihre Haut schien transparent, während darunter die Verwandlung begann. Erschrocken zuckte sie zurück, sah Besorgnis in seinem Blick und wusste, was er gerade in ihren blauen Augen entdeckte: Ihre Pupillen hatten sich zu Schlitzen verengt.
Nicht jetzt, dachte sie alarmiert.
Scheißhormone.
Ohne dich
Hey«, flüsterte Alessandro besänftigend und zog Rosa aufs Sofa. Die Sichtwände zwischen den Sitzecken schützten sie notdürftig vor Blicken.
Viel zu hektisch rieb sie die Hände an ihrer Jeans, als könnte sie die beginnende Metamorphose abwischen. Sie zwang sich, ein paarmal tief durchzuatmen. Allmählich zog sich die Kälte wieder zu einem winzigen Punkt in ihrem Herzen zusammen.
Sein Haar war nicht mehr dunkelbraun, sondern schwarz. Sie war ganz sicher: Hätte sie jetzt die Hände unter sein Hemd geschoben, hätte sie den feinen Flaum des Pantherfells auf seinem Rücken streicheln können.
»Kein guter Ort«, sagte sie und verkniff sich ein nervöses Lachen.
Seine Augen blitzten spöttisch. »Für den Preis sollte mehr drin sein als ein Sandwich aus der Kühltheke.«
Sie nahm seine Hand und massierte sie sanft zwischen den Fingern. Als er sich vorbeugen wollte, um sie abermals zu küssen, lächelte sie abwehrend. »Du siehst doch, was passiert. Solange wir es nicht kontrollieren können –«
»Kein Sex«, gelobte er grinsend.
Ihre Versuche, miteinander zu schlafen, hätten auf andere ziemlich befremdlich gewirkt. Meist endeten sie in einem Chaos aus Verwandlungen, das mal komisch, mal ärgerlich und oft nur peinlich war. Am schlimmsten war, dass sie dabei selten das Gleiche empfanden: Wenn es ihn zum Lachen brachte, wollte sie auf der Stelle sterben. Und sobald sie ihn mit seinem Pantherfell aufzog, begann er zu schmollen.
Starke Gefühle brachten bei ihnen beiden etwas zum Ausbruch, das in der Lounge für mehr als empörte Gesichter gesorgt hätte. Ohnehin fühlte Rosa sich auf Schritt und Tritt beobachtet, von den Spitzeln anderer Clans, Undercoveragenten der Polizei, von Raubtieraugen hinter den Masken biederer Normalität. Ganz sicher waren andere Arkadier im Raum.
»Themenwechsel?«, schlug sie vor. Die Alternative zu eiskaltem Wasser.
»Börsenkurse? Das Wetter?«
»Verantwortung.« Was aus ihrem Mund nun wirklich wie ein Fremdwort klang.
Sein Haar wurde schlagartig braun.
»Du hast die Typen ja gesehen«, sagte sie. »Sie haben vor dem Flughafen gewartet und mir Papiere vor die Nase gehalten, die ich unterschreiben soll. Konstruktionsaufträge für neue Windräder. Aktienoptionen. Subventionsanträge.« Sie verstand was von Romantik, keine Frage.
»Vielleicht solltest du hin und wieder zu ihnen in die Stadt fahren. Oder sie im Palazzo empfangen.«
»Ich unterschreibe jeden Tag irgendwas«, ereiferte sie sich. »Morgens telefoniere ich stundenlang mit obskuren Großcousinen in Mailand und Rom, nur weil sie Firmen führen, die zufällig mir gehören. Ich kenne die nicht mal! Bin schon froh, dass ich mir ihre Namen merken kann.«
»Solange dir nur klar ist, dass sie dich mit jedem Wort belügen.«
Im Oktober war die Leiche ihrer Tante Florinda Alcantara aus dem Tyrrhenischen Meer gefischt worden. Betroffener als die Schusswunde in Florindas Schädel hatte Rosa der Umstand gemacht, dass die Erbfolge von ihr verlangte, auf den Chefsessel des Clans nachzurücken. Niemand wollte sie dort und keiner hatte ernsthaft erwartet, dass sie die Herausforderung annahm. Wahrscheinlich hatte sie es gerade deswegen getan. Als der erste ihrer neuen engen Vertrauten und guten Freunde, die jetzt scharenweise im Palazzo Alcantara aufmarschierten, ihr nahegelegt hatte, freiwillig auf das Erbe zu verzichten, hatte sie ihren Entschluss gefasst. Sollten sie sehen, wie sie mit ihr klarkamen.
»Ich geb mir ja Mühe dazuzulernen« – das war eine freie Umschreibung ihres Desinteresses –, »aber ich bin nicht Florinda. Auch nicht Zoe. Ich komme mir vor wie ein Pilot, der auf zehntausend Metern merkt, dass er Höhenangst hat.«
»Das killt die Karriereoptionen.«
»Aber ich will diese Karriere nicht! Ich hab nicht darum gebeten, alles zu erben. Das ist was anderes als bei dir.«
Ebendas war der Unterschied zwischen ihnen. Alessandro hatte erreicht, was er immer gewollt hatte. Sie aber hatte nie etwas gewollt, und das hier schon gar nicht. Nur ihn. Ihn schon. Sogar sehr, sehr, sehr.
Aber bei aller Differenz in dieser einen Sache war da etwas, das sie verband: Keiner versuchte, den anderen zu ändern. Vielleicht fühlte sie sich gerade deshalb so wohl bei ihm.
Über sein Gesicht legte sich Nachdenklichkeit. Appetitzügler Nummer eins: die Geschäfte. Nummer zwei: seine Familie. Ihre Gespräche litten unter demselben Auf und Ab wie ihr Sex. Mal abgesehen davon, dass ihre Gespräche zumindest stattfanden und ihr Sex nicht viel mehr war als Spekulation. Sie hatten beide ihre Vorstellungen, wie er sich anfühlen würde – wenn es denn erst dazu käme. Nett wäre: ohne Schlangenschuppen und Katzenhaare im Mund.
»Ich hab angefangen aufzuräumen«, sagte er leise. »Mit einigem von dem Dreck, den Cesare und mein Vater angehäuft haben.« Jahrzehntelang hatten die Carnevares für andere Clans die Leichen von deren Opfern beseitigt, unter dem Asphalt von Autobahnen und im Beton grauer Bauruinen. Ein einträgliches Geschäft. Alessandro war kein Heiliger, aber er pfiff auf das Geld, das sein Clan damit verdiente. Eine Meinung, die nicht alle seine Teilhaber und capodecini teilten.
Sie ergriff wieder seine Hand, zögerte kurz und hauchte ihm einen raschen Kuss auf die Wange. »Damit hast du dir keine Freunde gemacht, hm?«
»Es wird immer schlimmer. Selbst die wenigen, die mich als capo akzeptiert haben, wenden sich allmählich von mir ab. Nicht offen, aber die meisten sind zu dumm, um subtil zu sein.« Er beklagte sich selten, und selbst jetzt blieb sein Blick glasklar, sein Tonfall entschlossen. »Manchmal weiß ich nicht mehr, ob es wirklich das ist, was ich gewollt habe.«
Rosa fragte sich oft, ob sein Ehrgeiz, capo zu werden, das Erbe seines Vaters anzutreten, vielleicht nur entstanden war, weil er seine Mutter rächen wollte. Nun, da Cesare tot war, wusste Alessandro nicht recht, was er mit alldem eigentlich anfangen sollte. Er hatte ein Ziel gehabt, aber als er es erreichte, war es viel größer und komplizierter, als er erwartet hatte.
»Cesare hat bekommen, was er verdient hat«, sagte sie.
»Ja, aber haben wir bekommen, was wir verdient haben?« Er hob eine Hand und streichelte ihre Wange. »Vielleicht sollte ich doch mit dir gehen. Nur für ein paar Tage woandershin, und danach vielleicht –«
»Für immer weg?« Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Da kenn ich dich besser.«
»Der Gedanke, dass du am anderen Ende der Welt bist und ich hier, macht mich schon jetzt verrückt.«
Sie legte den Zeigefinger an seine Lippen und ließ ihn sanft an seinem Kinn hinabwandern. »Wie oft sehen wir uns in der Woche? Dreimal? Und selbst das nicht immer. Ich bin nur für ein paar Tage weg. Du wirst es nicht mal merken.«
»Das ist unfair.«
Natürlich war es unfair. Aber sosehr sie sich auch nach seiner Nähe sehnte, wenn er nicht im selben Raum war – und erst recht, wenn er es war –, sowenig wollte sie, dass er sie ausgerechnet heute begleitete. Nicht nach New York. Nicht zu ihrer Mutter.
»Ich könnte ein paar Besprechungen absagen«, fügte er hinzu. »Noch bin ich ihr capo, ob es ihnen gefällt oder nicht.«
»Das ist Unsinn, und das weißt du. Sie würden dich lieber heute als morgen loswerden.« Rosa hielt seinen Blick mit ihren Augen fest und bewunderte sekundenlang die Intensität dieses Grüns und den Glanz darin. »Was würden sie wohl sagen, wenn du ausgerechnet in dieser Lage mit einer Alcantara ins Ausland fliegst? In die Ferien.«
Als Zoe in ihren Armen gestorben war, hatte Rosa ihr etwas versprechen müssen. Sie würde herausfinden, in welcher Beziehung ihr toter Vater Davide zu TABULA gestanden hatte, jener mysteriösen Organisation, die im Verborgenen einen Krieg gegen die Arkadischen Dynastien führte. Pech war, dass Rosa nur ein einziger Anknüpfungspunkt einfiel, nur eine Person, die ihr mehr über ihren Vater erzählen konnte: ihre Mutter, ausgerechnet.
Rosa kannte keinen Menschen auf der Welt, dem sie weniger gern begegnen wollte. Nicht nach allem, was gewesen war. Nicht nachdem sich Gemma sogar geweigert hatte, zu Zoes Begräbnis nach Sizilien zu reisen. Bitch.
Alessandro seufzte. »Ich wollte diese Familie anführen, und nun werde ich von ihr geführt.«
»Tja«, entgegnete sie mit einem Augenaufschlag, den sie hart trainiert hatte, »das hättest du dir früher überlegen müssen, nicht wahr?«
Eine Lautsprecherstimme meldete das Boarding für ihren Flug.
»Wahrscheinlich werde ich jede Nacht von dir träumen«, sagte er. »Und wenn ich aufwache, weiß ich, dass der beste Teil des Tages schon vorbei ist.«
»Das hast du irgendwo gelesen.«
»Hab ich nicht.«
Sie küsste ihn nun doch wieder, sehr lange und sehr zärtlich. Er schmeckte noch immer wie eine andere Welt. Die Schlange atmete schon in ihrem Brustkorb, als er die Arme um sie legte.
»Hey«, rief sie lachend. »Mein Flug. Das Gate. Ich muss –«
»Das hier darf niemals aufhören«, flüsterte er.
Sie strich durch sein widerspenstiges Haar. »Niemals.«
Dann löste sie sich aus seiner Umarmung, schnappte sich ihre Tasche und hastete zum Ausgang.
Sein Gesicht
Dass sie den Panther aus Bronze entdeckte, war Zufall.
Er kauerte auf einer Anhöhe im Central Park und schaute aus schwarzen Augen auf den East Drive herab, eine der beiden Straßen, die den Park von Norden nach Süden durchquerten. Von dort oben musste seine Sicht über die Baumkronen hinweg bis zur Skyline der Wolkenkratzer an der Fifth Avenue reichen. Er schien zum Sprung bereit, auf seinem Fels inmitten entlaubter Ranken von wildem Wein.
Rosa setzte sich auf eine Bank und betrachtete die Statue von weitem. Jogger und Spaziergänger kamen vorbei, dann und wann eines der Pferdegespanne, die Touristen und Liebespaare durch den Park kutschierten. Eiszapfen hingen wie gefletschte Zähne von den Lefzen der Raubkatze. Trotzdem fand sie in den dunklen Augen nur Traurigkeit, nichts Furchteinflößendes.
Bevor sie hergekommen war, hatte sie ihren Laptop aus dem Hotel geholt. Parkarbeiter hatten die Bänke enteist, dennoch drang Kälte durch ihre Jeans und die Strumpfhose.
Der Bronzepanther schien sie zu beobachten. Sie kannte den Effekt von anderen Standbildern, auch von den Ölgemälden im Palazzo Alcantara. Wäre sie aufgestanden und ein Stück weit gegangen, wären die Blicke der Statue ihr gefolgt.
Der Laptop lag zugeklappt auf ihrem Schoß, als sie Alessandros Nummer wählte. In Italien war es jetzt kurz nach neun. Sie hatte ihn einmal gefragt, was er an jenen Abenden tat, die sie nicht zusammen verbrachten. »Nichts«, hatte er geantwortet, »ich sitze da und tue nichts.«
»Du meinst, du liest? Oder schaust fern?« Noch während sie das sagte, kam sie sich so sterbenslangweilig vor, dass sie schreien wollte.
Alessandro schüttelte den Kopf. »Wenn es warm ist, gehe ich raus auf die Zinnen und schaue über die Ebene im Süden. Über die Hügel am Horizont. Wenn der Scirocco weht, kannst du Afrika riechen.«
»Ist das so eine Panthersache?« Sie gestikulierte unbeholfen. »Ich meine … Panther. Dschungel. Afrika.«
»Da kommen wir her. Ursprünglich jedenfalls.«
»Ich dachte, aus Arkadien.«
»Das, was menschlich an uns ist. Aber der andere Teil, die Wurzel der Panthera, liegt irgendwo in Afrika.«
»Und Schlangen?«
»Für die gilt das Gleiche, schätze ich.«
»Zeigst du’s mir? Wie man Afrika riecht, da oben auf euren Zinnen?«
»Sicher.«
Auch der Panther auf dem Fels sah aus, als träumte er von der Ferne.
Das Freizeichen riss sie aus ihren Gedanken. Kurz darauf meldete sich Alessandros Mailbox. Rosa zögerte kurz, räusperte sich, lächelte und sagte: »Ich denke gerade an dich. An das, was du über Afrika gesagt hast. Hier ist ein Panther bei mir. Er ist aus Metall, aber ich würde gern zu ihm raufklettern und ihn umarmen.«
Liebe Güte. Das war mit Abstand das Lächerlichste, was sie jemals von sich gegeben hatte. Panisch unterbrach sie die Verbindung und realisierte in derselben Sekunde, dass es zu spät war. Sie konnte es nicht mehr rückgängig machen. Zu ihm raufklettern. Ihn umarmen. Am liebsten hätte sie sich unter ihrer Parkbank verkrochen.
Der Panther aber sah weiter auf sie herab, und jetzt blitzte sein Eiszapfengebiss in einem Sonnenstrahl, so als würde er sie angrinsen und sagen: »Dann komm doch.«
Sie ließ das Handy in ihren Schoß fallen, hob es mit spitzen Fingern wieder auf und versenkte es tief in der Tasche. Vielleicht vergaß er, seine Mailbox abzuhören. Ungefähr die nächsten fünfzig Jahre lang.
Fast mechanisch wandte sie sich dem Laptop zu. Das Gehäuse fühlte sich eisig an. Sie brauchte dringend Handschuhe und ärgerte sich, dass sie im Gothic Renaissance keine gekauft hatte. Wobei schwarze Spitze bei der Kälte vielleicht nicht die beste Wahl war.
All die neuen E-Mails im Eingangsordner passten nicht auf einen Bildschirm. Eine Handvoll war direkt an sie gerichtet – die meisten stammten von den Männern, die ihr am Flughafen gefolgt waren –, doch der Großteil ging ihr nur als Kopie zu. Korrespondenzen zwischen Geschäftsführern ihrer Firmen, leeres Blabla, um den Überwachungsexperten der Polizei etwas zu tun zu geben. Manches schien in verwirrende Codes verschlüsselt, doch in Wahrheit waren das nichts als willkürliche Buchstaben- und Zahlenfolgen; jede Minute, die die Anti-Mafia-Kommission mit ihrer Decodierung verschwendete, fehlte den Polizisten anderswo.
Die übrigen Mails beschränkten sich auf die legalen Aktivitäten der Alcantara-Firmen, vor allem auf den Bau von Windrädern auf ganz Sizilien und die Lieferung von Wolldecken und Nahrungsmitteln in die Flüchtlingslager auf Lampedusa.
Eine der letzten Mails jedoch ließ sie die Stirn runzeln. Der Absender lautete Studio Legale Avv. Giuseppe L. Trevini. Rechtsanwalt Trevini arbeitete seit vielen Jahren ausschließlich für die Alcantaras, seit den Zeiten, in denen noch Rosas Großmutter den Clan geführt hatte. Rosa hatte ihn in den vergangenen Monaten dreimal besucht und festgestellt, dass er ein lückenloses Wissen über alle sauberen und unsauberen Geschäfte der Familie besaß. Wenn sie irgendeine Frage habe, hatte er gesagt, könne sie sich jederzeit an ihn wenden. Trevini war altmodisch, verschroben, aber auch durchtrieben und technophob; bis heute hatte er ihr keine einzige E-Mail geschickt. Was er aus Sicherheitsgründen nicht auf Papier archivierte, speicherte er im Gedächtnis. Rosa war noch niemandem begegnet, der über ein so exaktes Erinnerungsvermögen verfügte. Sie traute ihm nicht, trotz seiner engen Bindung an die Alcantaras. In den Tagen vor ihrer Abreise hatte er viermal um einen Termin gebeten. Das aber hätte bedeutet, dass sie zu ihm nach Taormina hätte fahren müssen. Trevini saß im Rollstuhl und er weigerte sich, das Grandhotel über der Bucht zu verlassen, in dem er seit Jahrzehnten lebte.
Dass der Avvocato ihr nun doch eine Mail schickte, war ungewöhnlich. Noch verblüffender aber war die Betreffzeile: Alessandro Carnevare – wichtig!
Der Anwalt hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er eine Beziehung zwischen einer Alcantara und einem Carnevare für untragbar hielt. Auch deshalb hatte sie kein gutes Gefühl, als sie die E-Mail öffnete.
Verehrte Signorina Alcantara, schrieb er, als langjähriger Rechtsbeistand Ihrer Familie möchte ich Sie bitten, einen Blick auf die anhängende Videodatei zu werfen. Zudem ersuche ich Sie erneut um ein persönliches Gespräch. Sie werden mir zustimmen, dass der Anhang und weiteres Material, das sich in meinem Besitz befindet, eine dringliche Besprechung erfordern. Bei dieser Gelegenheit würde ich Sie gern mit meiner neuen Mitarbeiterin, Contessa Avv. Cristina di Santis, bekannt machen. Ich verbleibe in tiefem Respekt vor Ihrer Familie und in der Hoffnung auf eine baldige Begegnung Ihr Avv. Giuseppe L. Trevini.
Rosa bewegte den Cursor auf das Symbol der Datei im Anhang, hielt dann aber inne. Noch einmal las sie verärgert den letzten Satz. Respekt vor Ihrer Familie. Womit er natürlich meinte: Vergiss nicht, zu wem du gehörst, dummes Kind.
Mit einem Schnauben klickte sie auf die Datei und wartete ungeduldig, bis sich das Videofenster öffnete. Das Bild war nicht größer als eine Zigarettenschachtel, verpixelt und viel zu dunkel. Aus dem Lautsprecher drangen blechernes Rauschen und verzerrte Stimmen.
Es waren Bilder von einer Party, augenscheinlich mit einem Handy gefilmt, verwackelte und diffuse Aufnahmen lachender Gesichter in einem Schwenk durch einen großen Raum. Die Gesprächsfetzen waren kaum zu verstehen, eine dumpfe Tonsuppe aus Sätzen, Gläserklirren und Hintergrundmusik.
Jetzt richtete sich die Kamera auf eine einzelne Person und verharrte dort. Rosa blickte in ihr eigenes Gesicht, glänzend von der Wärme im Raum. Sie trug Make-up. In einer Hand hielt sie ein Cocktailglas und eine Zigarette. Seit beinahe anderthalb Jahren rauchte und trank sie nicht mehr. Keinen Tropfen Alkohol seit jener Nacht.
Eine aufgekratzte Mädchenstimme fragte sie, wie es ihr gehe. Die Rosa im Film grinste und formte mit den Lippen ein Wort.
»Was?«, rief die Stimme.
»K – L – O«, buchstabierte Rosa. »Kommst du mit?«
Die Antwort war nicht zu hören, aber das Bild wackelte: Kopfschütteln. Rosa zuckte die Achseln, stellte ihr Glas auf einem Buffettisch ab und ging mit merklicher Schlagseite aus dem Bild. Sie hatte eine Menge getrunken an diesem Abend.
Der Bildausschnitt bewegte sich wieder. Gesichter wurden gestreift, auch mal länger fixiert, wenn es sich um männliche, gut aussehende handelte. Hin und wieder grinste jemand in die Kamera, mehrmals wurde die Besitzerin des Handys gegrüßt: »Hi, Valerie!« – »Wie geht’s?« – »Hey, Val!«
Valerie Paige. Rosa hatte seit Monaten nicht mehr an sie gedacht. Wie kam Trevini an eine Aufnahme, die Val während der Party im Village gefilmt hatte? Er musste erfahren haben, was damals geschehen war. Auch das noch.
Valerie blieb abermals stehen. Ein paarmal zoomte sie vor und zurück – noch mehr Gesichter, die meisten pixelig bis zur Unkenntlichkeit. Dann konzentrierte sie sich auf eine Gruppe junger Männer in einer Ecke des Raumes.
Fünf oder sechs Jungs, die sich unterhielten, drei mit dem Rücken zur Kamera. Einer winkte in Valeries Richtung und pfiff ihr anerkennend zu. Rosa hatte ihn noch nie gesehen. Val zoomte wieder nach vorn. Aus dem Off rief sie »Hey, Mark!«. Da drehten sich auch die anderen zu ihr um. Einer blickte genau in die Kamera und lächelte.
Das Bild fror ein. Der Ton brach ab.
Die Statusleiste zeigte an, dass die Datei noch nicht am Ende war, aber der Rest war mit dem Standbild dieses einen Gesichts gefüllt. Mit diesem stummen, versteinerten Lächeln.
Zitternd zog Rosa das Fenster größer, bis die Züge des Jungen aus bräunlichen Quadern bestanden. Sie verkleinerte es wieder, jetzt bis zum Minimum.
Das hätte sie sich sparen können. Sie hatte Alessandro erkannt, noch bevor er sich umdrehte. An der Bewegung selbst. Am widerspenstigen Haar.
Mit einem Fluch sank sie gegen die Lehne der Parkbank. Über den Rand des Laptops hinweg starrte unbewegt der Bronzepanther herüber, oben auf seinem Fels vor einem Hintergrund knochiger Zweige.
Alessandro war dort gewesen. In der Nacht, als es passiert war. In jener Wohnung im Village, die Rosa weder davor noch danach wieder betreten hatte.
Sein Haar war kürzer als heute; Internatsschnitt, hatte er das einmal genannt. Die anderen, die bei ihm standen, hatten ganz ähnliche Frisuren.
Er war, verdammt noch mal, dort gewesen.
Und er hatte es nie auch nur mit einem Wort erwähnt.
Valerie
Es war ein Trick. Eine Lüge. Irgendeine perverse List, um sie zu verunsichern und abzulenken, damit sie keine der Alcantara-Geschäfte verpfuschte, mit denen Trevini sein Geld verdiente.
Im Grunde war es leicht zu durchschauen. Er wollte sie aus der Fassung bringen und dadurch formbar machen, beeinflussbar. Die meisten Menschen glaubten, die Mafia räumte alle, die ihr im Weg standen, mit einer Maschinenpistole aus dem Weg. Das war Unsinn. Es gab viele andere Möglichkeiten, und der Avvocato Trevini kannte sie alle. Wer seit Jahrzehnten für die Cosa Nostra arbeitete, Mörder verteidigte, Schwerverbrecher aus dem Gefängnis boxte und Staatsanwälte in Misskredit brachte, wer alle Führungswechsel und sogar die blutigen Straßenkriege früherer Jahre unbeschadet überstanden hatte, der wusste Bescheid.
Eine Videoaufnahme ließ sich fälschen. Wie schwer konnte es sein, ein Gesicht durch ein anderes zu ersetzen? Trevini musste damit rechnen, dass sie ihm nicht traute. Dass sie selbstverständlich eher Alessandro als ihm glauben würde. Alles, was sie zu tun hatte, war, Alessandro anzurufen und ihn zu fragen. Dann würde der ganze Schwindel auffliegen.
Und dennoch hatte Trevini ihr das Video geschickt.
Sie zog das Handy aus der Tasche und wählte zum zweiten Mal an diesem Nachmittag Alessandros Nummer. Das Freizeichen kam ihr lauter und schriller vor. Wieder die Mailbox.
Auf dem Monitor des Laptops hing noch immer sein Lächeln, so diffus wie eine halb vergessene Erinnerung. Hatte sie ihn an jenem Abend gesehen? Valerie hatte die Angewohnheit, auf jeden, den sie scharf fand, mit dem Finger zu zeigen. Hatte sie Rosa damals auf ihn aufmerksam gemacht? Und, wichtiger noch, hatte er Rosa gesehen und ihr später nicht gesagt, dass er sie wiedererkannt hatte? Warum hätte er ihr das verschweigen sollen?
Aber er war schon einmal nicht aufrichtig gewesen, damals, als er sie mit zur Isola Luna genommen hatte, um sich durch ihre Anwesenheit vor Tanos Mordplänen zu schützen. Da waren sie noch nicht zusammen gewesen. Machte das einen Unterschied?
Sie beschloss, eine Mail an Trevini zu schreiben.
Sie sind gefeuert, tippte sie. Verpissen Sie sich aus meinem Leben.
Das löschte sie wieder und schrieb stattdessen: Sie hören von meinen Auftragskillern. Scheißanwalt. Scheißkrüppel. Ich hoffe, Sie übersehen eine Scheißtreppe in Ihrem Scheißhotel.
Das war fast schon Poesie.
Nach kurzer Überlegung überschrieb sie den Text: Sehr geehrter Signore Trevini, ich bin derzeit nicht zu Hause. In den nächsten Tagen melde ich mich zwecks Terminabsprache. Woher haben Sie dieses Video? Und was ist das für anderes Material, das Sie erwähnen? Hochachtungsvoll Rosa Alcantara.
P.S.: ICH HOFFE, SIE ERSTICKEN AN IHREN SCHEISSROLLSTUHLKRÜPPELANWALTSLÜGEN!
Sie starrte das Postskriptum an, dann löschte sie es Buchstabe für Buchstabe, sehr langsam. Schließlich klickte sie auf Senden und klappte den Laptop zu.
Im selben Moment klingelte ihr Handy. Sie sah Alessandros Namen auf dem Display, wartete einen Moment, dann ging sie dran.
»Hey, ich bin’s.«
»Hi.«
»Was machst du da mit diesem Panther?«
Irritiert blickte sie sich um, dann fiel ihr die Mailbox ein. Herzlichen Glückwunsch.
»Wo hast du gesteckt?«, fragte sie.
Er zögerte kurz. »Besprechungen?« Es klang wie eine Frage, als konnte er nicht glauben, dass sie das vergessen hatte. »Schön, deine Stimme zu hören.«
Sie hasste sich ein wenig dafür, dass sie sich nicht besser verstellen konnte. Dass sie es nicht fertigbrachte, wenigstens für ein, zwei Minuten so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Stattdessen sagte sie: »Du bist da gewesen.«
Wieder eine Pause. »Was meinst du?«
»Die Party. Damals, im Village. Du warst dort.«
»Sag mal, wovon redest du?«
Sie dachte erleichtert: Gut. Also doch ein Trick. Alles eine Lüge. Er hatte keine Ahnung, was sie überhaupt von ihm wollte.
Nur dass sie das nicht sagte. »Ich hab dich gesehen. Du bist auf einem Video. Du bist auf derselben Party gewesen wie ich, am selben beschissenen Abend.«
Seine Reaktion war sehr sachlich: »Wann genau war das?«
»31. Oktober. Halloweenparty ohne Kostüme. Wer trotzdem mit einem hingekommen ist, musste sich bis auf die Unterwäsche ausziehen und einmal durch die Wohnung laufen.«
Sie hörte, wie er scharf durchatmete. »Das war die Party? Wo sie … Das ist dort gewesen?«
Und wenn er jetzt gelogen hätte, um ihr nicht wehzutun? Wäre ihr das lieber gewesen? Sie wollte die Wahrheit wissen, egal wie verwirrend oder schlimm sie war.
»Ja«, sagte sie dumpf.
»Das hab ich nicht gewusst. Du hast das nie erwähnt.«
»Hast du mich dort gesehen?«
»Nein.« Er klang nun beinahe verstört, und das kannte sie nicht von ihm. Es gefiel ihr nicht, und es brachte sie nur noch mehr durcheinander. »Nein«, wiederholte er entschiedener, »natürlich nicht.«
»Bist du sicher?«
»Scheiße, Rosa … Ich hatte keine Ahnung! Da waren so viele Menschen, und wir waren damals oft auf irgendwelchen Partys. Die anderen und ich, wir sind vom Internat aus in die Stadt gefahren. Auch ins Village. Irgendwer kannte immer irgendwen, und irgendwo war immer was los.«
Das klang plausibel. Es gab überhaupt keinen Grund, ihm zu misstrauen. Und sie liebte ihn doch.
Nur war da ein Unterton, ein leichtes Zögern, das sie stutzig machte. Irgendwer kannte immer irgendwen.
»Hast du sie gekannt?«, fragte sie leise. »Die, die das getan haben?«
Und nun begriff er. »Du glaubst, ich hätte es gewusst und nichts gesagt? Die ganze Zeit über nichts gesagt?«
»Ich weiß nicht, was ich glaube.« Sie spürte ihre Finger am Handy nicht mehr. Die Sonne schien über dem Central Park, aber ein frostiger Wind jagte den East Drive herunter, wirbelte Eiskristalle auf und fuhr unter ihre Kleidung. »Ich weiß gar nichts mehr.«
»Du kannst doch nicht wirklich annehmen, dass ich so jemanden decken würde, oder?« Er war verletzt, und das tat ihr leid. »Ich würde den Scheißkerlen eigenhändig Kugeln zwischen die Augen jagen, wenn ich wüsste, wer es war.«
Sie rieb sich mit der freien Hand durchs Gesicht, noch immer unfähig nachzudenken. »Als ich dich gesehen habe, auf diesem Video … Ich hab nicht damit gerechnet.«
»Ich wäre jetzt gern bei dir.«
»Ist nicht gut, über so was am Telefon zu sprechen. Ich weiß.«
»Nein. Ich … tut mir leid, Rosa. Was soll ich sagen? Ich hab’s einfach nicht gewusst.«
»Du kannst ja nichts dafür.«
»Ich fliege nach New York. Gleich morgen früh!«
»Unsinn. Ich komm schon klar. Du kannst mir ohnehin nicht helfen. Ich bin zu feige, um mit meiner Mutter zu sprechen. Und jetzt auch noch diese Sache …« Sie rieb die Knie aneinander, um sie zu wärmen. »Ich muss nur wieder ein wenig runterkommen, dann ist alles in Ordnung.«
»Gar nichts ist in Ordnung«, widersprach er energisch. »Du klingst nicht in Ordnung.«
»Lass uns einfach später noch mal telefonieren.«
»Leg jetzt ja nicht auf. Sonst komme ich noch heute Nacht zu dir rüber.« Mit dem Privatjet der Carnevares war das nicht einmal abwegig.
»Wirklich, Alessandro … Tu das nicht.« Sie musste sich zusammenreißen. Es war nicht gut, dass sie diese Sache so aus der Bahn warf. Das bedeutete nur, dass Trevini sie richtig eingeschätzt hatte. »Ich komme hier allein zurecht. Vielleicht sollte ich das mit meinem Vater und TABULA einfach auf sich beruhen lassen.« Sie wussten beide, dass sie das nicht tun würde. Nicht nach dem, was sie der sterbenden Zoe versprochen hatte. »Es ist komisch, wieder zurück zu sein. New York ist … anders. Irgendwie.«
»Klar. Du hast dich verändert.«
»Früher hätte ich mich nicht so gehenlassen.«
»Tust du nicht. Du bist sauer. Ist doch klar.« Er räusperte sich, und sie stellte sich vor, wie er sich die Nase rieb; das tat er manchmal, wenn er nachdachte. »Von wem hast du das Video?«
»Trevini hat’s mir geschickt.«
»Dieser Drecksack.«
»Er sagt«, begann sie, verschluckte aber den Rest des Satzes: dass er noch mehr Material hat. Mehr Beweise? Wofür? »Er hat mir nicht gesagt, woher er es hat. Aber das wird er noch, keine Sorge.«
»Er ist wie die anderen. Es passt niemandem, dass wir –«
»Die anderen kann ich ignorieren. Ihn nicht. Er ist der Einzige, der den Überblick hat über alles, womit die Alcantaras ihr Geld verdienen.«
»Es gefällt ihm nicht, dass eine Achtzehnjährige ihm Anweisungen geben darf.«
»Kann man ihm nicht verübeln.«
»Hat er noch was gesagt? Irgendwas?«
»Dass er sich mit mir treffen will.«
»Vielleicht solltest du das lieber bleibenlassen.«
»Er kann mir nichts tun. Das wäre auch sehr dumm von ihm. Die Geschäftsführer trauen ihm nicht, keinem ist geheuer, wie viel er weiß. Würde er versuchen, mich umzubringen, würde er das selbst nicht lange überleben. Die anderen halten mich für naiv und anmaßend, aber sie glauben, dass sie mich früher oder später in eine Richtung steuern können, die für sie bequem ist. Trevini könnte niemals capo sein, keiner würde das akzeptieren. Dreißig oder vierzig Jahre Arbeit für die Alcantaras machen ihn noch nicht zu einem von uns.«
»Trotzdem, fahr nicht zu ihm. Er hat irgendwas vor. Warum sonst hätte er dir das Video schicken sollen?«
Allmählich wurde sie ruhiger. »Sagt dir der Name Cristina di Santis etwas? Contessa di Santis?«
»Wer ist das?«
»Trevinis neue Mitarbeiterin, schreibt er. Ich soll sie kennenlernen. Ist vielleicht nicht wichtig.«
»Mit dem Jet könnte ich in zehn Stunden bei dir sein.«
»Sieh du lieber zu, dass dir keiner deiner Leute in den Rücken fällt. Mit Trevini komme ich klar. Und mit meiner Mutter auch.«
Sein langes Schweigen verriet, dass er nicht überzeugt war. »Wer hat das Video gefilmt?«
»Eine Freundin … jedenfalls war sie das damals. Valerie Paige. Sie war diejenige, die mich mit dorthin geschleppt hat.« Sie spürte, dass er etwas sagen wollte, aber sie kam ihm zuvor: »Das war nicht das erste Mal. Sie hat in einem Club gekellnert und wurde dauernd irgendwohin eingeladen, und ein paarmal bin ich mitgegangen.«
»Und sie hat mich gefilmt?«
»Nicht nur dich. Eine Menge Leute, die dort waren. Mit ihrem Handy. Jemand hat das Bild nachträglich auf deinem Gesicht eingefroren. Ich nehme an, das war Trevini.«
»Wie kommt ein Anwalt, der auf Sizilien im Rollstuhl festsitzt, an das Handy einer Kellnerin aus New York?«
»FedEx?«
»Ich mein’s ernst, Rosa.«
»Ich hab keinen Schimmer. Ist mir jetzt auch egal. Aber es hat gutgetan, mit dir darüber zu reden … Und, Alessandro? Entschuldige, dass ich … Du weißt schon, oder?«
»Ich hab dich sehr, sehr gern«, sagte er sanft.
»Ich dich auch. Und ich freu mich drauf, dich wiederzusehen. Aber nicht hier in New York. In ein paar Tagen bin ich wieder zu Hause. Das hier ist etwas, das ich allein erledigen muss.« Sie zögerte kurz. »Und komm nicht auf die Idee, mit Trevini zu sprechen. Das ist meine Sache. Okay?«
»Es geht mich aber genauso –«
»Bitte, Alessandro! Sie werden mich niemals für voll nehmen, wenn sie glauben, ich schicke ausgerechnet einen Carnevare vor, sobald es brenzlig wird. Außerdem hast du genug eigenen Ärger.«
Sie wollte ihn küssen dafür, dass er nicht widersprach.
»Ruf mich jeden Tag an, ja?«, bat er.
»Mach ich.«
Sie verabschiedeten sich. Rosa steckte das Handy ein und horchte auf das wohltuende Echo seiner Stimme in ihrem Kopf. Das Gespräch mit ihm und die Tatsache, dass sie weit voneinander entfernt waren, laugten sie mehr aus als der verunglückte Besuch vor dem Haus ihrer Mutter. Sie hatte Sehnsucht nach ihm, aber sie konnte das ihm gegenüber nicht so ausdrücken, wie sie wollte. Dass er es sicher trotzdem wusste, machte es nicht besser. Dabei wunderte sie sich über ihren Drang, ihm ihre Gefühle auf die Nase zu binden. Das war nie ihre Art gewesen. Warum also jetzt so ein Mitteilungsbedürfnis? Peinlich. Zumindest ungewohnt.
Schließlich verklang seine Stimme in ihrem Kopf. Die Stille hatte sie wieder, mitten in der lautesten Stadt Amerikas.
Noch einmal checkte sie ihre E-Mails. Keine Antwort von Trevini. Kurz war sie versucht, sich das Video erneut anzusehen. Aber nicht hier im Park, nicht in dieser Kälte, wo sie nicht spüren würde, wenn die andere Kälte in ihr emporkroch.
Der Bronzepanther bleckte seine Eiszapfenfänge. Jetzt fand sie überhaupt nicht mehr, dass er wie Alessandro aussah. Lauernd folgte ihr sein Blick, als sie sich auf den Weg machte.
Wenn sie herausfinden wollte, wie Trevini an das Video gelangt war, gab es nur eine, die sie fragen konnte.
Freaks
Rosa und Valerie waren sich zum erste Mal online begegnet. In einer Community, die sich Suicide Queens nannte, kannte niemand den anderen persönlich. Alle wussten lediglich voneinander, wie sie aussahen in den verschiedenen Phasen von hellwach über benommen bis so-gut-wie-tot. Die Webcams waren unerbittlich, wenn es darum ging, ihr Sterben aufzuzeichnen und ins Netz zu stellen.
Nur Mädchen und junge Frauen waren Mitglieder. Wobei es geteilte Meinungen darüber gab, ob eine Mittzwanzigerin namens Lucille Seville nicht doch einmal ein Mann gewesen war. Jedenfalls trug sie eine Perücke; das wussten sie, weil die Sanitäter sie versehentlich beim Abtransport heruntergezogen hatten.
Die Regeln der Suicide Queens waren denkbar einfach. Jeden Abend war eine von ihnen an der Reihe: Eine Begrüßung vor laufender Kamera an alle, die eingeloggt waren, dann die Präsentation der Pillen. Für gewöhnlich fand diese Einleitung bereits vor dem Bett oder Sofa statt, auf dem sich alles Weitere abspielen würde. Die ersten Punkte gab es von den übrigen Queens für die Anzahl der Tabletten. Weitere Punkte für die Überzeugungskraft, die anschließend beim telefonischen Notruf an den Tag gelegt wurde. Manche schrien und heulten hysterisch; einige blieben ganz ruhig und sagten nur: »Gleich bin ich tot. Holt mich, wenn ihr könnt.«
Zu Letzteren gehörte Valerie. Sie schluckte mehr Pillen als alle anderen, und irgendwie kam sie an das ganz harte Zeug heran; als nächste Stufe wäre ihr nur Rattengift geblieben. Sie spülte die Medikamente mit Alkohol hinunter und blieb beim Notruf kurz angebunden. Danach legte sie sich aufs Bett, gut sichtbar für die Community draußen an den Monitoren, und wartete auf den Schlaf. Und auf die Rettungsmannschaft. Mal dauerte es nur ein paar Minuten, mal eine halbe Stunde. Valerie behauptete, sie hätte schon häufig das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Den Film ihres Lebens kenne sie in- und auswendig, weil sie ihn so oft vor ihrem inneren Auge habe ablaufen sehen.
Keine machte Val etwas vor. Sie schluckte die meisten Schlafmittel, sie blieb am längsten bei Bewusstsein und mindestens einmal hatte sie der Rettungszentrale die Nummer ihres Apartments verschwiegen. Die Sanitäter hatten sich erst durch den halben Block fragen müssen, ehe sie sie gefunden hatten. An jenem Abend hätte es Valerie fast erwischt. Aber eine Woche später saß sie erneut vor ihrer Webcam und war wieder im Rennen – mit dem höchsten Punktestand seit Gründung der Queens. Ihre zufriedene Miene zeigte allen, dass sie den Sinn ihres Lebens in der Erwartung des Todes gefunden hatte.
Rosa hatte sich nur ein einziges Mal aktiv am Wettbewerb beteiligt. Sie hatte tagelang gegoogelt und alles gelesen, was sie über Selbstmord durch Schlafmittel hatte finden können. Seiten um Seiten um Seiten, bis es der Sache beinahe die morbide Romantik genommen hatte.
Sie war nicht einmal eingeschlafen, als der Rettungswagen vor ihrer Haustür auftauchte. Die Einzige, die noch weniger Punkte bekommen hatte als sie, war eine Punkerin aus Jersey, die behauptete, Aspirin habe dieselbe Wirkung wie Zopiclone, und ihnen weismachen wollte, sie sei nach der fünften Tablette ins Koma gefallen. Rosa hatte auf weitere Teilnahmen verzichtet.
Eine Woche später traf sie Valerie im Club Exit an der Greenpoint Avenue. Valerie sprach sie an, so fröhlich und ungezwungen, als hätten sie sich beim Shoppen kennengelernt; Val trug ein T-Shirt mit dem Schriftzug Dein Hardcore ist mein Mainstream. Niemals hätte Rosa sie von sich aus erkannt. Die verzerrte Perspektive der Webcam, die Pixel, das schlechte Licht hatten ihr etwas Gespenstisches gegeben, das dem Titel einer Suicide Queen alle Ehre machte. In natura aber war Valerie ein blasser Teenager wie Rosa selbst, mit einem schwarzen Pagenschnitt, der sie wie einen Stummfilmstar der Zwanzigerjahre aussehen ließ. Sie war mager wie Rosa, geschminkt wie Rosa, und bei ihrer zweiten Begegnung im Three Kings war klar, dass sie in vielem auch dachte wie Rosa. Nach einem halben Dutzend Treffen, einige zufällig, andere geplant, gestand sie, dass ihre Auftritte bei den Suicide Queens getürkt waren. Die Pillen – Magnesiumtabletten. Der Bourbon – Apfelsaft. Die Sanitäter – Freunde aus dem Apartment ein Stockwerk über ihr.
Rosa war so fasziniert wie enttäuscht: »Was ist mit dem Ehrenkodex der Queens?«
Valerie starrte sie entgeistert an. »Aber das sind Freaks!«, entfuhr es ihr, und damit war die Sache erledigt.