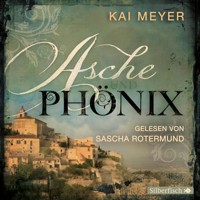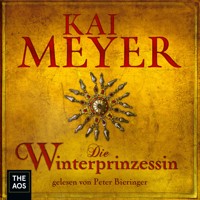9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Unheimlich und phantastisch.
Weimar im Jahr 1805. Die Brüder Grimm machen Schiller ihre Aufwartung, doch finden sie ihn todkrank vor. Verlegen überreichen sie die Arznei, die Goethe ihnen mitgegeben hat. Der sieche Dichter überlässt ihnen sein letztes Manuskript – doch wenig später wird ihnen diese Kostbarkeit gestohlen. Gegen ihren Willen geraten sie in eine finstere Verschwörung, in der Goethe, eine seltsame Gräfin, eine Geheimloge und exotische Rauschmittel eine Rolle spielen ...
„Meyers Stärke sind atmosphärisch dichte Breitwandpanoramen.“ Die Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Brüder Grimm auf der Jagd nach einem rätselhaften Manuskript. Durch Adelspaläste, finstere Spelunken und unterirdische Tempel führt die rasante Suche nach Schillers geheimnisvollstem Werk. Auf ihrer Spur: skrupellose Geheimbünde, ein wahnsinniger Mörder – und Goethe, der undurchsichtige Dichterfürst.
Ein phantastischer Abenteuerroman vom preisgekrönten Bestsellerautor Kai Meyer.
Weimar im Jahr 1805. Die Brüder Grimm machen ihre Aufwartung, doch finden sie Schiller todkrank vor. Verlegen übergeben sie die Arznei, die Goethe ihnen mitgegeben hat. Der sieche Dichter überlässt ihnen sein letztes Manuskript – doch wenig später wird ihnen diese Kostbarkeit gestohlen. Gegen ihren Willen geraten sie in eine finstere Verschwörung, in der Goethe, eine seltsame Gräfin, eine Geheimloge und exotische Rauschmittel eine Rolle spielen.
Kai Meyer
Die Geisterseher
Ein unheimlicher Romanaus dem klassischen Weimar
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Nachwort des Autors
Über Kai Meyer
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Prolog
Weimar, im März 1805
Am Morgen jenes Tages, an dem Gott, der Herr, von seinem Thron stieg und tot zusammenbrach, war die Milch in ihren Krügen geronnen wie Blöcke aus weißem Porzellan. Dorothea, die Dienstmagd, war atemlos zum Markt gelaufen, aufgescheucht wie die Hühner, die zwischen den Ständen gluckten, und hatte beim Bauer Rosenberg um neue gebeten. Sauer sei die alte gewesen, die er ihr am Vortag verkauft habe, sauer, wie die Miene des Herrn Geheimrat, wenn er von dem Mißgeschick erführe. Ja, ganz zweifellos.
Sie kam mit neuer Milch nach Hause, doch Gott, der Schöpfer, starb trotzdem. Dabei hatte er weder von der einen noch der anderen getrunken, und die Schuld an dem, was folgte, traf nicht die Dienstmagd Dorothea und nicht den Bauer Rosenberg.
Am Nachmittag erhob Gott, der Allmächtige, sich von seinem prächtigen Thron (der Bezug war mit schwarzem Zwirn geflickt, aber das sah nur der, der davon wußte), machte erst einen, dann einen zweiten tänzelnden Schritt und schien mit einem Mal zu schwanken. Er faßte sich an seinen langen, weißen Bart – der roch ein wenig nach Essensresten –, blinzelte, weil er glaubte, seine Brille sei verrutscht, und kippte schwer vornüber. Beim Aufschlag verrutschten die Gläser tatsächlich, sie zerbrachen, und ein Splitter bohrte sich in seinen linken Augapfel. Das Blut, das dabei austrat, verursachte einige Verwirrung und sorgte im Anschluß für gehörigen Streit über die wahre Todesursache.
Als sein Körper mit Getöse auf den Boden krachte, spritzten die himmlischen Heerscharen auseinander wie kochendes Fett auf kaltem Stein. Raphael und Michael, den beiden Erzengeln, blieben die Worte honigzäh am Gaumen kleben, und Gabriel verschluckte sich so furchtbar, daß sein Husten den Umstehenden in den Ohren klang wie meckerndes Gelächter.
Ausgerechnet Mephistopheles war es, der seine Sinne als erster wieder beisammen hatte und lautstark nach einem Mediziner rief. Seine Worte hallten über den Hof des Weimarer Bürgerhauses, so schrill, so schneidend, daß Dorothea, die Dienstmagd, vor Schreck einen Krug der frischen Milch vergoß und aufgeregt zum Fenster eilte.
Was sie sah, ließ ihren Atem stocken. Die Schauspieler, die im Hof den Prolog des neuen Stückes aufgeführt hatten, an dem ihr Herr seit Jahren schrieb, liefen kopflos auf und ab. Einige scharten sich um den Herrn Geheimrat, andere um etwas, das Dorothea vom Fenster aus nicht sehen konnte. Sie hörte nur, wie der Teufel – sein Name war für ihren Geschmack arg lang und kompliziert geraten – um Hilfe rief. Einen Augenblick lang überlegte sie, ob die Rufe vielleicht ihr galten, ob von ihr erwartet wurde, daß sie einen Doktor holte. Dann sah sie, wie der Stallknecht zum Tor eilte, und war froh, daß er die Verantwortung von ihren Schultern nahm.
Gütiger Himmel, dachte sie, als einer der Engel einen Schritt zur Seite machte und den Blick auf den reglosen Körper freigab. Das weiße Gewand lag über ihn gebreitet, so, wie der Sturz es hatte fallen lassen, als hätte sich der Zufall sein eigenes Leichentuch geformt. Das Gesicht des Schauspielers war aschfahl, fast so grau wie die Pflastersteine des engen Innenhofs. Mehr konnte Dorothea von hier aus nicht erkennen, doch wußte sie sehr wohl, wen der Mann im Drama ihres Meisters spielte. Einen Moment lang erwog sie die Möglichkeit, daß der Himmel einen wütenden Blitz herabgeschleudert hatte, dann verwarf sie den Gedanken; schließlich hatte es keinen Donner gegeben. Und überhaupt: Hätte Gott, der Herr, der Schöpfer, der Allmächtige, nicht den Meister Goethe strafen müssen? War doch er allein es, aus dessen Hirn die Verse und Figuren stammten.
Sie sah, wie der Stallknecht in Begleitung eines Herrn mit feinem Gehrock, Halstuch und Zylinder wiederkehrte. Während der Doktor sich über den leblosen Schauspieler beugte, beobachtete sie das Gesicht ihres Dienstherrn.
Geheimrat Goethe war kaum weniger bleich als der Mann, der auf seinem Hof zusammengebrochen war. Eine Strähne seines dunklen, gewellten Haars war ihm in die Stirn gefallen. Er sprach schnell, fast ein wenig zornig auf den Doktor ein. Dabei sah er ihn nicht an, schaute statt dessen mal hier-, mal dorthin, hinauf zum Dach, wieder zum Tor, dann prüfend durch die Reihen der Schauspieler. Das gute Dutzend Männer und Frauen, allesamt vom Weimarer Hoftheater, stand verwirrt, beschämt, verängstigt da.
»Sieh ihn dir an«, sagte hinter ihr eine knarrende Stimme. Mit aufgestellten Nackenhaaren fuhr Dorothea herum. Goethes Kammerdiener war von hinten herangetreten, ohne daß sie ihn in ihrer Aufregung bemerkt hatte. Er blickte an ihr vorbei durchs Fenster, sein Blick haftete an ihrem Herrn, als hätte er ein Insekt auf seinem Rockaufschlag entdeckt. Sie mochte den Diener nicht. Karottenfarbene Haut spannte sich straff über sein knochiges Gesicht, so daß die Leberflecken auf den Wangen zum Doppelten ihrer eigentlichen Größe anzuwachsen schienen; manchmal roch er nach dem Gift, das er gegen Ungeziefer zwischen der Kleidung seines Herrn verteilte.
»Ist er tot?« fragte sie, weil das erste, was ihr beim Anblick des Dieners einfiel, immer der Tod war.
Der dürre Mann hob die Schultern. Seine Kleidung raschelte trocken wie Herbstlaub, das der Wind gegen Grabsteine treibt. »Wer weiß? Wir werden es bald erfahren. Schau nur, diese Aufregung. Sieh dir den Herrn Goethe an und sag mir: Was stört’s ihn? Schreibt schon sein Leben lang übers Sterben und scheint nun ganz fassungslos.«
»Was wird aus dem Essen?« Die dritte Stimme, hinter ihrer beider Rücken, gehörte dem Koch. Der Herr hatte ihn nur für den heutigen Tag eingestellt, die vielen Gäste wollten beköstigt werden. Sein Gesicht war teigig, mit wulstigen Lippen, die Dorothea an den Kupferstich einer fleischfressenden Pflanze erinnerten, der einmal im Vorzimmer des Herrn gehangen hatte. Sein Kopf schien beständig hin und her zu rollen, die Arme hingen hilflos zu beiden Seiten seines Wanstes. Dorothea hatte gehört, wie er beim Kochen vor sich hin brabbelte, ganz leise; erst glaubte sie, er betete, dann wurde ihr klar, daß es Witze waren, die er vor sich hinmurmelte. Statt eines Lachens hüpften seine schmalen Augen auf und ab, und die weiße Haut seiner Wangen bewegte sich in fleischigen Wellen zum Kinn.
Dorothea wandte sich von ihm ab und betrachtete wieder ihren düster dreinblickenden Herrn im Hof. »Der arme Herr Goethe. Er wird wieder stundenlang im Regen stehen und traurige Gedichte schreiben.«
»In der Tat«, meinte der Diener, »ich fürchte, er wird den schwarzen Gehrock tragen wollen.«
Dorothea schüttelte den Kopf. »Lieber etwas Helles. Etwas, das seine düstere Stimmung hebt.«
Aus den Augen des Dieners traf sie der eisige Nordwind. Es stand ihr nicht zu, sich in seine Obliegenheiten zu mischen. »Es ist das Los des Dichters zu leiden, Dorothea. Davon leben seine Werke. Und, mit Verlaub, auch wir.«
Der Koch räusperte sich. »Was ist nun mit dem Essen?«
»Wirf es weg«, sagte der Diener.
»Wegwerfen? Denkt doch, welchen Festschmaus wir davon …«
»Koch«, sagte der Diener mit frostiger Stimme, »der Herr steht draußen auf dem Hof, gebeugt über einen Toten. Warum gehst du nicht hinaus und unterbreitest ihm persönlich deinen Vorschlag?«
Der andere fuhr zusammen, als hätte jemand in seine Hühnersuppe gespuckt. Dann zuckte er mit den Achseln, drehte sich um und ging. »Werfen wir es weg«, murmelte er. »Das zarte Fleisch, das frische Gemüse, den edlen Fisch. Weg damit.«
Dorothea hatte ihn kaum beachtet. Ihre Gedanken waren immer noch bei ihrem Herrn und dem Toten. »Warum tut Gott so etwas?«
Der Diener seufzte angesichts solcher Einfalt. »Nicht Gott. Der Tod.«
»Der Tod?«
Der knochige Mann nickte, seine Haut glänzte fahl im einfallenden Nachmittagslicht. »Manche sagen, der Tod sei ewig jung und neide uns das Alter. Je älter wir werden, desto häufiger schaut er vorbei. Holt erst Eltern und Großeltern, schließlich Freunde, zuletzt einen selbst. Dann ist er längst ein alter Bekannter. Aber Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Er tut das häufig und gern. Schicksal nennen wir das.«
Dorothea schüttelte langsam den Kopf. Sie verstand nicht, was er meinte.
Die Stimme des Dieners klang nun tief und geheimnisvoll, wie Zaubersprüche in einem alten Brunnenschacht. »Tatsache ist, er hat es wieder getan. Und Warum ist die älteste Frage der Welt.«
Erster Teil
Ein Gruß den Feiernden in Moskau – Nacht und Neider – Sprechen Ägypter Polnisch? – Horchen an der Wand – Um Himmels willen, sie trägt Hosen! – Spindels Schergen – Pistolenrauch, wie unerquicklich – Rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz – R-O-S-A – Warschau liegt in Preußen – Die Tür eines Amtsmanns
1
An einem Maiabend, ungewöhnlich warm und dennoch klar für jene Zeit des Frühlings, machten wir uns auf den Weg zu des Dichters Haus. Das verblassende Tageslicht hüllte Weimars Straßen in einen sterbenden Glanz und zog scharfe Grenzen zwischen den gierigen Schatten und jenen immer kleiner werdenden Flächen, welche die sinkende Sonne mit ihrem Bronzeschein legierte. Während wir beflügelt von hoher Erwartung einherschritten, flimmerten nach und nach in den Häusern die Fenster als leuchtende Rechtecke aus dem Zwielicht, dunkler, wo von einer Kerze nur der Stumpf geblieben, heller, wo man sie eben erst entzündet hatte. Einmal wehte uns der behagliche Duft von Pfeifentabak in die Nase, ein anderes Mal hörten wir in der Ferne leisen Gesang von Kinderstimmen.
Auf dem Weg zur Esplanade kam uns nur eine einzige Kutsche entgegen, wohl aber gab es verstreute Spaziergänger, welche die lauen Abendstunden zu frohem Gespräch oder brütendem Alleinsein nutzten. Unser Gastgeber hatte uns erklärt, man habe den gepflegten Corso vor einem halben Jahrhundert auf den Resten der ehemaligen Stadtbefestigung errichtet. Seither hatte sich die breite, gepflasterte Straße zum beliebten Wandelweg gemausert. Bebaut war nur die Nordseite; nach Süden hin blickte man hinab bis zur Lindenallee und in ihre stillen, üppigen Gärten.
Das Haus des großen Dichters unterschied sich in seiner Schlichtheit kaum von den übrigen Weimarer Stadthäusern. Barocke Mansardendächer reckten sich über den seitlichen Flügeln, während der Dreiecksgiebel des mittleren Teils und die spröde Putzgliederung der dotterfarbenen Fassade bereits dem Klassizismus entstammten. Der vielfingrige Schatten einer Linde hatte nach dem Haus gegriffen wie die fiebernde Hand der Krankheit, die seinen Besitzer plagte.
Mein Bruder und ich hatten lange gestritten, wer von uns die Hand zum Klopfen an des Meisters Tür würde heben dürfen. Daß schließlich er es war, dem diese Ehre zukam, lag nicht daran, daß er der Ältere war; er zählte zwanzig, ich neunzehn Jahre, und die dreizehn Monate, die uns trennten, hatten für keinen von uns eine Bedeutung. Tatsächlich – und im nachhinein scheint mir die Vorstellung mehr als nur ein wenig albern – hatten wir während der Kutschfahrt nach Weimar und selbst noch im Haus unseres Gastgebers die Qualität unseres Klopfens geprobt, den Klang unserer Hände auf Holz studiert, seine Wirkung nach den feinen Kriterien der Akustik beurteilt. Und mit welchem Bedacht, welcher Akribie wir das taten! Ich will die Details übergehen; erwähnt sei allein die Problematik, ein rechtes Holz zu finden, das dem in seiner Beschaffenheit gleichen mochte, welches wir an jener Pforte zu finden glaubten. Da wir des Meisters Tür weder gesehen, geschweige denn jemals berührt hatten, war dies ein Unterfangen von grenzenloser Pedanterie. Weshalb schließlich Jacob und nicht ich selbst an der Dichterpforte klopfte – sehr zögernd, sehr sachte, sehr höflich –, ist mir wohl nach all der Zeit entfallen.
Mein Bruder und ich erfreuten uns oft an derlei Nichtigkeiten, und wir gefielen uns darin, selbst in den schlichten Dingen des Alltags die Herausforderungen des Charakters, Verstands oder einfach nur des Herzens zu suchen. Zwei jungen Männern, die sich selbst für romantische Gelehrte hielten, fiel dergleichen nicht schwer.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!