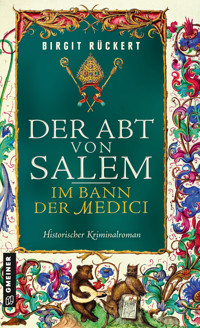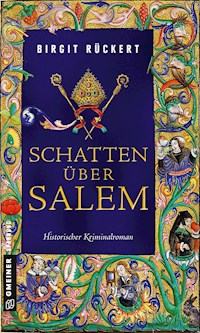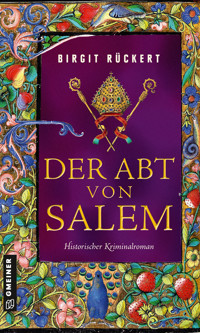Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zisterziensermönch Johannes
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1485: Das Zisterzienserkloster Salem erwartet den Besuch des Kaisers. Doch der plötzliche Tod eines jungen Mönchs überschattet die Festvorbereitungen. Der alte Kellermeister bringt den Todesfall mit lange zurückliegenden Ereignissen in Verbindung, bei denen ein Mönch in einem Weinfass ertrunken und ein wertvoller Reliquienbehälter verschwunden ist. Bruder Johannes, Leiter des Skriptoriums, macht sich auf die Suche nach dem rätselhaften Reliquiar. Wird er auch die ungeklärten Todesfälle lösen können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Birgit Rückert
Das Geheimnis von Salem
Eine fast wahre Geschichte
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Gedicht am Beginn: »http://de.wikisource.org/wiki/Vom_gro%C3%9Fen_Fa%C3%9F_zu_Salmannsweiler«
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Universitätsbibliothek Heidelberg
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salIXc/0042
ISBN 978-3-8392-5590-2
Vom großen Fass zu Salmannsweiler
Duplex gab’s in Salmannsweiler!
Reh’, Fasanen, Lachs und Keiler
Schmaust die fromme Reichsabtei:
»Vivat hoch dem gnäd’gen Abte!«
Heisa! wie’s Convent sich labte,
Trank zwei Fuder Weins und drei.
Volle Kannen, volle Züge!
Jedem Pater zur Genüge
Sprudelt heut das goldne Naß;
Denn im weiten Klosterkeller,
Angefüllt mit Muskateller,
Fertig stand das Riesenfaß.
Baß der Küperkunst erfahren,
Hat daran gebaut seit Jahren
Pater Kellermeister froh.
Losgelassen sind die Geister;
»Hoch der weise Kellermeister!«
Schallt’s im Refektorio.
»Heil, wer solch ein Werk ersonnen,
Alles Schönen Zauberbronnen,
Gott dem Herrn zu Preis und Ehr’!«
Feurig klang’s aus Aller Munde;
Kaum gefüllet, durch die Runde
Waren alle Krüge leer.
»Vivat Abt und Kellermeister!«
Näselt weindurchglüht ein feister
Mönch und bringt ein mächtig Glas.
Schwere Zungen, schwere Glieder;
Einer sinkt zum Andern nieder,
Lallt sein »Deo gratias.«
Bodenlos nur war ein Frater,
Krug für Krug ausstützen that er,
Und verschlang den letzten Lachs.
Schlau an Meisters Seite rückt er,
Und den Kellerschlüssel drückt er
In gestohlnes Kirchenwachs.
Sanft entschlafen liegen Alle;
Erst beim Morgenhoraschalle
Reißt von ihrem Blick der Flor.
Taumelnd durch der Kirche Hallen
Die ehrwürd’gen Väter wallen.
»Miserere!« hallt’s vom Chor.
*
Edler Labehort im Keller!
Wunderfaß voll Muskateller,
Glücklich, wer dir je genaht!
Aber selig, wem voll Wonnen
Täglich strömt dein Zauberbronnen,
Wer zu dir den Schlüssel hat!
Sel’ger, bodenloser Bruder!
Wie viel Ohme, wie viel Fuder
Floßen deinem Durste da!
Nächtlich, wenn die Mönchlein schnarchen,
Sitzt er vor der Weines-Archen,
Liegt er da in Gloria.
Einstens wieder nach der Mette,
Während Alle schon zu Bette,
Schleicht zum Faß er unverweilt.
Aber ach! zur Qual dem Kunden,
War der Hahnen draus verschwunden,
Und ein Zapfen eingekeilt.
Welch ein Seufzen, welch ein Bangen!
Ach! wie brennt er vor Verlangen –
Sieh da, eine Leiter winkt.
Stracks erklimmt er ihre Sprossen,
Find’t das Spundloch unverschlossen,
Drinn der Feuernektar blinkt.
Bäuchlings streckt er nun die Glieder
Auf des Fasses Wölbung nieder,
Wie der Vampyr lechzt nach Blut;
Ihm als Rüssel dient der Heber,
Saugend in die durst’ge Leber
Blüthenhauchumwallte Fluth.
Ha, wie saugt er, ha, wie schnaubt er!
Immer tiefer senkt das Haubt er
In die Würzedüfte schwer.
Selig aus die Arme breitend –
Aber, ach! dem Rand entgleitend,
Stürzt er in des Fasses Meer.
*
Lange hielt dafür der Orden,
Daß der Bruder flüchtig worden,
Bis der Kellermeister starb,
Offenbarend dem Konvente,
Als er nahm die Sakramente,
Wie der Arme einst verdarb.
Alle staunen dieser Kunde,
Lauschen schaudernd seinem Munde:
»Heimlich hab’ ich ihn verscharrt,
Unsers Kellers Ehr’ zu wahren
Und den edlen Wein zu sparen …«
Doch wohin? – Sein Mund erstarrt.
Unentdecket blieb die Leiche.
Nachts im Keller, sagt man, schleiche
Nun der Meister auf und ab,
Nie der Strafe Last entbunden,
Bis der Bruder einst gefunden
Auf geweihter Statt ein Grab.
Ignaz Hub.
(Original-Mittheilung.)
Vorbemerkung
Eine herzallerliebste Geschichte über Bruder Johannes, Mönch in Salem und späterer Abt daselbst; seinen Freund Hans von Savoy, Steinmetzmeister; Magdalena, Patriziertochter aus Überlingen; den Novizen Christoph aus einem churrätischen Patriziergeschlecht; Petrus aus Lindau, Konverse und Magister Operis; Johannes Stantenat, derzeitiger Abt in Salem, und Ludwig Jäger, Vaterabt aus Lützel; Kaiser Friedrich III. und dessen Sohn Maximilian; Georg Ruthart, Musiker und Organist in Salem; dessen Gehilfen Jakobus, Novize; den Bursarius Caspar und dessen Gehilfen Heinrich, Konverse; die Mönche in der Schreibstube Jodokus Ower, Amandus Schäffer, Jakob Roiber und den bleichen Theobald aus Lützel und noch viele andere mehr, und natürlich über den toten Mönch aus dem Weinfass!
Personen
Mönche in Salem:
Johannes Scharpfer, aus Mimmenhausen, Mönch in Salem, Leiter der Schreibstube, später Abt in Salem (reg. 1494–1510)
Christoph, Novize und Gehilfe des Johannes; Neffe des Heinrich Zili, Tuchhändler in Sankt Gallen
Jakob Roiber (gestorben 1516), Schreiber im Skriptorium
Amandus Schäffer, junger Mönch, später Abt in Salem (reg. 1529−1534), Schreiber im Skriptorium
Jodokus Ower (1459−1510), Archivar und Sekretär des Abtes
Caspar Renner, Bursarius, Gelehrter und Freund von Jodokus Ower (gestorben 1487)
Heinrich, Konverse, im Dienste des Bursarius
Georg Ruthart, Kantor, Organist und Lautenspieler (gestorben 1496)
Jakobus, Novize, Gehilfe des Georg
Pierre, Mönch und Sänger, vormals Kloster Lützel
Thomas, Mönch im Weinkeller, vormals Kloster Lützel
Bruder Cellerar
Stephan, junger Mönch
Petrus, aus Lindau, Konverse und »Magister Operis«
*
Wichtige Äbte in Salem:
Frowin, 1. Abt in Salem (reg. 1138−1165)
Eberhard I. von Rohrdorf, 5. Abt in Salem (reg. 1191−1240)
Ulrich II. von Seelfingen, 9. Abt in Salem (reg. 1282−1311)
Georg I. Münch, 16. Abt in Salem (reg. 1441−1453)
Johannes I. Stantenat, 18. Abt in Salem (reg. 1471−1494)
Thomas I. Wunn, 31. Abt in Salem (reg. 1615−1647)
Anselm II. Schwab, 38. Abt in Salem (reg. 1746–1778)
*
Personen aus dem Kloster Lützel (Mutterkloster Salems):
Ludwig Jäger, Vaterabt von Lützel (reg. 1471−1495)
Theobald Hillweg, Schreiber im Skriptorium, später Abt in Lützel (reg. 1495–1532)
*
Personen außerhalb des Klosters:
Magdalena, Tochter des Andreas Reichlin von Meldegg
Hans von Savoy, Steinmetz und Klosterbaumeister in Salem, Freund von Johannes
Georg Scharpfer, älterer Bruder von Johannes
Elisabeth, jüngere Schwester von Georg und Johannes
Andreas Reichlin von Meldegg, Patrizier und Arzt in Überlingen, 1477 verstorben und im Salemer Münster bestattet
Klemens, Sohn des Andreas, Bürgermeister in Überlingen
Jörg und Matthias, zwei weitere Söhne des Andreas, ältere Brüder des Klemens und der Magdalena
Bernhard von Clairvaux, (1090−1153), bedeutendster Mönch des Zisterzienserordens, 1. Abt von Clairvaux, 1174 heiliggesprochen
Friedrich III. (1415−1493), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches; besucht Salem im Jahr 1485
Maximilian I. (1459–1519), Herzog von Burgund, Sohn des Friedrich, später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
*
Klosterämter:
Prior: Stellvertreter des Abtes und Vorsteher des Konvents
Cellerarius, Kellerer, Kellermeister: zuständig für die Klosterwirtschaft, Aufsicht über die Vorratskammern und den Weinkeller
Bursarius, Bursier: zuständig für die Finanzen im Kloster
Portarius, Pförtner: Aufsicht über die Tore
Infirmarius, Krankenmeister: Aufsicht über das Krankenhaus; auch für Begräbnisse zuständig
Mesner, Sakristan: für die Sakristei und die liturgischen Geräte zuständig
Grangienmeister: Aufseher über die Grangien (Gutshöfe)
Magister Operis: Baumeister, Aufseher über die Bauarbeiten
Konversen (Laienbrüder): Brüder, die die handwerklichen und anderen vorwiegend körperlichen Arbeiten zu erledigen hatten; sie arbeiteten auf den Grangien und betrieben die Stadthöfe; sie lebten im Kloster getrennt von den Mönchen in eigenen Räumen (Konversenrefektorium/Laienrefektorium, Dormitorium).
*
Personen der heutigen Zeit:
Benedikt Schönborn, Museumsleiter in Salem
Sigi Seifert, Archäologe der Bodendenkmalpflege
Felix Baur, Baggerfahrer in Salem
Martin Schaible, Kellermeister in Salem
Gustl Auer, Mesner in Salem
Horst Kugler, Gästeführer in Salem
Theodor Gerstenmaier, Professor h.c.
und die Schüler Mark, Jannis und Dimitri
… und Fräulein Hummel, junge Adelige
*
Tagesablauf in einem mittelalterlichen Zisterzienserkloster
Vigilien
nächtliches Stundengebet, Beginn je nach Jahreszeit zwischen 2.00 und 3.00 Uhr morgens
Laudes
Morgengebet bei Tagesanbruch
Prim
Stundengebet zur 1. Stunde (das heißt bei Sonnenaufgang, je nach Jahreszeit), circa 6.00 Uhr
Terz
Stundengebet zur 3. Stunde, (circa 8.00 –– 9.00 Uhr), danach Messe
Sext
Stundengebet zur 6. Stunde (Mittagszeit, circa 11.00 –– 12.00 Uhr), danach Mittagessen
Non
Stundengebet zur 9. Stunde (circa 15.00 Uhr)
Vesper
Stundengebet zur 11. Stunde (Abendgebet, je nach Jahreszeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr), danach Abendessen
Complet
Nachtgebet zum Tagesabschluss (circa 20.00 Uhr, im Winter auch früher), danach Nachtruhe
Prolog
Ein lauer Märzabend im 21. Jahrhundert
Sie war von adeligem Geblüt. Insofern war es nur angemessen, dass sie in einem Schloss lebte – na ja, nicht direkt im Schloss, aber gleich nebenan, im alten Försterhaus beim Schlosspark neben der alten Sägemühle.
Gern machte sie sich von hier aus auf den Weg, die Gegend zu erkunden. Sie lebte noch nicht lange hier, erst vor kurzem war sie mit ihrer neuen Familie hierhergezogen. Darum war alles spannend, neu: der schöne Garten hinter dem Haus, um den sie viele Spaziergänger, die hier vorbeikamen, beneideten, die Haselnusssträucher, Ginster und anderes Gestrüpp am Bach, unter denen man so schön durchkriechen und Fährten aufnehmen konnte. Überhaupt die vielen Gerüche im jungen Frühling, die vom nahen Wald herüberwehten, hatten es ihr angetan. Am besten gefiel ihr der Nachmittagsspaziergang den Hügel hinauf, dann an der Pferdekoppel vorbei hinüber zum Schloss. Eigentlich durfte sie nicht so weit vom Haus weglaufen, sie war ja noch zu jung, ein Teenager sozusagen. Aber was es auf dem Schlossgelände alles so zu erschnüffeln gab, das war einfach zu verführerisch.
Hummel war ihr Name (wenn auch nicht der vollständige, denn nur ein Name mit Titel war ihrer vornehmen Herkunft angemessen), und er beschrieb doch recht gut ihren Charakter: nervös wie ein Insekt, immer in Bewegung, auf Entdeckungstour immer der Nase nach.
So auch heute – die Luft war lau, der Boden nicht mehr gefroren. Beste Voraussetzungen für neue Entdeckungen. Denn seit einigen Tagen gab es Löcher und Gräben in der Erde. Ein kleiner Bagger stand zwischen dem Pferdestall und dem Rentamt, einem großen klassizistischen Gebäude, in dem seit einigen Monaten Büros der Schulverwaltung des berühmten Internats, aber auch Klassenzimmer sowie Wohnräume für Schüler und Lehrer untergebracht waren. Früher, im 19. Jahrhundert – das Kloster Salem war aufgelöst, die Mönche hatten den Ort für immer verlassen – hatte hier die Verwaltung der Landesherrschaft Salem ihren Sitz. Später war hier das Forstamt und auch der Salemer Bürgermeister regierte einst dort.
Das allerdings interessierte unser Fräulein Hummel in keiner Weise. Sie drängte es zu den Gräben, die der Bagger hier gezogen hatte. Die Schüler waren – jetzt am späten Nachmittag – unterwegs im Schloss oder auf dem Weg nach Stefansfeld zum Supermarkt, um sich für einen gemütlichen Abend im Mentorat mit Cola und Tiefkühlpizza einzudecken.
Die Arbeiter der Baufirma, welche hier Gräben für neue Versorgungsleitungen ziehen mussten, hatten bereits Feierabend. Nicht mehr als 80 Zentimeter in die Tiefe gehen! Dies war die Vorgabe des Denkmalamts; dann sei auch nicht zu befürchten, historische Schichten aus der Klosterzeit zu durchstoßen.
So konnte Hummel, aufgeregt schnüffelnd, doch in aller Ruhe und völlig unbeobachtet, ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen: Beute aufspüren und apportieren, das hatte sie trotz ihrer Unerfahrenheit und Jugend schon gelernt, das war ihre Bestimmung. Und sie war ein Talent in diesen Dingen. Im weichen, feuchten Boden konnte sie ohne viel Mühe ein paar Zentimeter Erde wegbuddeln, genau dort, wo der Bagger seine Arbeit eingestellt hatte. Geschickt hob sie mit der Schnauze ihre Beute an, einen langen Oberschenkelknochen (was ihr natürlich einerlei war: Knochen ist Knochen), und barg ihn vorsichtig mit ihren Zähnen: Und auf geht’s, schnell, schnell zurück zum Försterhaus, die Beute heimbringen, so wie es sich für einen angehenden Jagdhund gehört.
Das Begräbnis
1453, im März
Es war eine eiskalte Märznacht, lange vor den Vigilien. Der Westwind verfing sich in den Baumwipfeln des Wäldchens im sogenannten Himmelreich, einer baumbestandenen Hügelkette oberhalb des Klosters. Schauriges Rauschen und Pfeifen, ein Knarren der sich biegenden Äste der alten hohen Bäume war im gesamten Klosterareal zu hören. Der Singsang des Windes begleitete eine ungewöhnliche Prozession, ein Leichenbegängnis, aber ohne Sarg, Priester und Trauernde.
Ein Mönch schritt hektisch der kleinen Prozession voran, in der Hand eine Laterne, das Licht nicht minder nervös flackernd als der Blick des Mönchs; ihm folgten zwei Bauersleute, einen schweren Leinensack mehr hinter sich herschleifend als tragend. »Kommt schon, schnell, bis zur Vigil muss alles vollbracht sein und Bruder Thomas seine ewige Ruhe haben bei den Schweinen.«
Und der Mönch führte die Prozession weiter, vorbei am Oberen Tor, hin zum Sennhof mit seinen niedrigen Wirtschaftsgebäuden, die sich an die uralte Klostermauer anschmiegten. Hier waren erst vor kurzem neue Ställe für die Schweine und andere Nutztiere gebaut worden; die Maurerarbeiten waren noch nicht abgeschlossen, sodass es niemandem aufgefallen war, dass in der Nacht zuvor – direkt an der Außenmauer des Schweinestalls – eine kleine Grube ausgehoben worden war, genügend tief, damit nicht die Schweine oder anderes Getier später darin wühlen konnten. Dorthinein befahl der Mönch, den Leichnam von Bruder Thomas zu legen. Der aufgedunsene Leib des so unglücklich Verstorbenen passte eben so in die Grube. Der Mönch – nur er kannte die Umstände des Todes seines Mitbruders – legte dem Leichnam ein silbernes Kreuz auf die Brust und murmelte ein stilles Gebet. Dazu schwenkte er ein kleines Weihrauchfass, das er aus der Sakristei mitgenommen hatte. So viel Andacht musste für den armen Bruder schon sein. Die beiden Bauern hatten ihren Hut abgenommen und verharrten ebenfalls im Gebet; ihnen befahl der Mönch nun, die Grube sorgfältig mit den bereitliegenden Schaufeln zuzuschütten und mit umherliegendem Holz, Reisig und Steinen abzudecken. »Wenn das Grab gefunden wird, geht es mir und euch an den Kragen und ihr findet kein Auskommen mehr hier im Kloster – habt ihr das kapiert?« Mit diesen Worten drückte er jedem von ihnen zwei Silbermünzen in die Hand und verschwand in der Dunkelheit. Die beiden Bauersleute bedankten sich mit stummem Kopfnicken und verrichteten ihren Auftrag vorbildlich – weder Mensch noch Tier konnten das heimliche Grab aufspüren. Der arme Bruder Thomas und der Grund seines Dahinscheidens gerieten beinahe in Vergessenheit – aber nur beinahe.
Denn Bruder Thomas war in ungeweihter Erde bestattet worden, und so quälte die umherirrende Seele des Verstorbenen nicht nur das Gewissen des Mönchs, sondern ließ gelegentlich auch manch einen Salemer Bewohner oder Bediensteten erschauern, vor allem diejenigen, die in den Weinkellern zu schaffen hatten. Hört man in den langen Gängen und Fluren Schritte auf den grauen Steinplatten, wie wenn genagelte Sandalen über den Stein kratzen, nimmt den stechenden Duft von Weihrauch wahr oder hört im Keller ein Geräusch, als ob jemand mit den Fingern über einen eisernen Fassreifen kratzt, so – sagt man – ist die arme Seele von Bruder Thomas nicht weit …
Im Weinkeller
Im März im 21. Jahrhundert
So ging es auch dem Kellermeister des markgräflichen Weinguts, Martin Schaible. Wie so oft war er abends nochmals im großen Weinkeller; dieser war noch zu Klosterzeiten, in der Regierungszeit des bedeutenden Salemer Abtes Thomas Wunn, erbaut worden – und heute noch reifen hier die Weine. Stämmige graue Steinsäulen stützen ein mächtiges Gewölbe aus Ziegelmauern. Die Ernte des Vorjahres war aus den großen Stahltanks zum großen Teil schon auf Flaschen gezogen, ausgewählte Weine reiften noch in den Holzfässern und nur der Spätburgunder vom Bermatinger Leopoldsberg, dessen Reifeprozess immer etwas länger dauerte, sollte am nächsten Morgen noch abgefüllt werden. Kellermeister Schaible begab sich also auf einen letzten Rundgang im Keller, um zu prüfen, ob alles zum Abfüllen vorbereitet war. Die Lehrlinge, die mit dem Fässerreinigen beschäftigt gewesen waren, waren schon gegangen. Und so wähnte er sich allein im nur spärlich beleuchteten Keller, wäre da nicht … »Hallo, ist da jemand?« Ihm war, als habe er einen Schatten hinter einer der Säulen vorbeihuschen sehen. Und tatsächlich, jetzt hörte er Schritte, mehr ein Schlurfen – und rums –, mit lautem Knall fiel das Fasstürchen eines der großen Stahlfässer ins Schloss. Glas klirrte. Unerschrocken ging Schaible in den hinteren Teil des Kellers, wo er die Ursache der Geräusche vermutete. Leichte Wut kochte in dem sonst gelassenen Mann hoch, als er vor einem Stahltank die Scherben eines zerbrochenen Probierglases auf dem Boden fand. »Wer hat denn da …?« Rotwein war auf dem Boden verschüttet, darauf merkwürdige Fußspuren, die aber nicht das Profil der Gummistiefel zeigten, die die Mitarbeiter im Keller zu tragen pflegten, sondern vielmehr das von genagelten Sandalen … Schaible wusste nicht so recht, ob er einen der Lehrlinge verdächtigen sollte, nein, bei der Arbeit war Trinken strengstens untersagt. Aber wer war es dann? Er beschloss, am nächsten Morgen der Sache nachzugehen.
Schaible stand just vor dem Fass mit dem Bermatinger, der zum Abfüllen bereit war. Sollte er sicherheitshalber noch mal probieren? War der Wein schon reif? Mit einer großen Pipette zog er den Bermatinger aus dem Fass und füllte ihn in ein weiteres Probierglas, das er in seiner Jackentasche bei sich trug. Der Kellermeister hob das Glas gegen das Kellerlicht: Rubinrot, leicht transparent schimmerte die Flüssigkeit, dem Glas entströmte ein würziger Duft nach Nelken und schwarzem Pfeffer, der Wein war köstlich im Gaumen – Schaible war hochzufrieden, noch nie war der Bermatinger so gut gelungen. Im Abgang glaubte der Kellermeister noch eine Weihrauchnote zu schmecken …
Der Fund
Im März im 21. Jahrhundert
»Zoindernei, Herrgottzack … was issn etz’ scho wieder!« Felix Baur, der Mitarbeiter der Salemer Baufirma Strasser, stoppte seinen kleinen Bagger. Heute bis 11.00 Uhr musste der Graben fertig sein. Der Auftrag war, einen Graben im Sennhof vom vormals markgräflichen Reitstall hinüber zum Rentamt zu graben, circa 60 Meter lang, gut einen Meter breit und nicht tiefer als 80 Zentimeter. Und das alles bis Dienstag 11.00 Uhr. Der Graben sollte neue Rohre und Versorgungsleitungen für das Rentamt aufnehmen, das nun seit einigen Monaten zur Schule gehörte und deshalb modernisiert und technisch aufgerüstet werden musste. Felix war mit seinen Baggerarbeiten bis auf wenige Meter an das Rentamt herangekommen. Inzwischen war man – das Gelände vom Sennhof zum Rentamt hin war abschüssig, und man musste ja auf Kellerniveau des Rentamts kommen – wesentlich tiefer im Erdreich angekommen, gut 1,50 bis 1,80 Meter tief. Das Baggern war beschwerlich, der Boden im März fast noch gefroren, auch wenn die stärker werdende Sonne die obere Erdschicht allmählich auftaute. Immer wieder holte Felix mit seiner Baggerschaufel größere Steine, Wacken oder auch Quader aus der Erde, jetzt aber musste er das Baggern unterbrechen, denn mit seiner Baggerschaufel hatte er eine größere Platte angehoben, die sich im Graben senkrecht verkeilt hatte. Felix stoppte unter Fluchen den Motor des Baggers und sprang in die Grube. Kaum hatte er die graue Steinplatte auf die seitlich des Grabens angehäuften Erdhügel gehievt, da kamen schon weitere Steine hervor, größere und kleinere Kiesel. Einige davon räumte er mit beiden Händen zur Seite. Er schickte sich an, aus dem Graben zu klettern, als er unter den Kieseln einen langen Knochen hervorzog. Mit Schwung beförderte Felix den Knochen auf den Erdhügel und kletterte wieder ins Führerhaus.
Zu dieser Zeit hatte der Museumsleiter des Schlosses, Benedikt Schönborn, bereits sein Büro im Unteren Tor verlassen und sich auf den Weg über das Schlossgelände zum Rentamt gemacht. Dort sollte er an einer Besprechung mit der Bauabteilung sowie Vertretern der Schule und des markgräflichen Hauses teilnehmen, um die weiteren Baumaßnahmen zu planen. In zwei Wochen, an Palmsonntag, war Saisonstart, dann sollte das Schloss mit seinen Museen wieder für die Besucher geöffnet werden; der Museumsleiter machte sich Sorgen um den Fortgang der Arbeiten, ob diese rechtzeitig abgeschlossen und die Gräben wieder zugeschüttet wären. Der touristische Erfolg hing doch wesentlich von einem ordentlichen Erscheinungsbild der Schlossanlage ab – und offene Baustellen konnte er da nicht gebrauchen. Er wusste, dass die Diskussionen über den Zeitplan der Baumaßnahmen heftig sein würden, denn die Bauabteilung des Schlosses baute eben gerne! Touristen hin oder her.
Just als Felix den Motor seines Baggers wieder anwarf, kam der Museumsleiter den Graben entlanggeschlendert. Er – selber ausgebildeter Archäologe und Historiker – ließ es sich nicht nehmen, öfter einen Blick in die Gräben zu werfen, mit Funden im historischen Gelände musste man immer rechnen. Die Baggerschaufel hatte eben ein paar Wacken beiseitegeschoben – Schönborn traute seinen Augen nicht. Mit einem Satz sprang er in die Grube vor den Bagger und rief dem verdutzten Felix zu: »Stopp, halt, halt, aufhören, hören Sie sofort auf!« Deutlich erkennbar, steckten menschliche Knochen im Erdreich, noch halb eingegraben die Kalotte eines menschlichen Schädels, mit einer lückenlosen Zahnreihe im Oberkiefer.
»Was isch denn, i muss fertig werden!« Felix stoppte unter Fluchen die Maschine. »Haben Sie das denn nicht gesehen, das sind menschliche Knochen! Hören Sie sofort mit dem Baggern auf!«
»Wisset Sie, was des koscht? Wenn i jetz nid fertig werd?«, rief Felix von seinem Führerhaus herunter. Der Museumsleiter war wütend: »Das ist mir wurscht, was das kostet. Sie hören jetzt mit dem Arbeiten auf … Das ist womöglich ein Grab, ein Fundort, das muss erst untersucht werden!«
Weitere Flüche und Verwünschungen vor sich hin murmelnd, hüpfte Felix aus dem Führerhäuschen und zündete sich erst einmal eine Zigarette an. Nachdenklich betrachtete er den Glimmstängel: Komisch, dachte er, es war ihm, als schmeckte er nach Weihrauch …
Unterdessen rannte der Museumsleiter die Treppen im Rentamt hoch und platzte, ohne anzuklopfen, ins Baubüro, wo die Besprechung schon begonnen hatte. Ein kurzes Nicken in die Runde war der einzige Gruß: »Wir haben einen Fund! Menschliche Knochen, möglicherweise ein Grab. Die Bauarbeiten müssen sofort aufhören, bis wir Näheres wissen.« Er blickte in die verdutzten Gesichter der Anwesenden: der zuständige Bauleiter vom Bauamt, der Leiter der örtlichen Immobilienverwaltung, der Architekt der Baufirma, der die Maßnahmen zu beaufsichtigen hatte, sowie die anderen Projektbeteiligten.
Mehr zu sich selbst fügte Benedikt Schönborn hinzu: »Ich hab’s ja gleich gesagt, wenn man auf historischem Gelände Gräben zieht, muss man auf alles gefasst sein.«
Als Erster hatte sich der Architekt wieder gefangen, der seine Kosten im Blick hatte. Ärgerlich polterte er los: »Wieso Grab? Da war doch kein Friedhof? Die Mönche wurden doch nicht im Sennhof bestattet? Überhaupt, das Denkmalamt hat doch gesagt, dort seien keine Funde zu erwarten!« Er fürchtete, dass archäologische Untersuchungen den Zeitplan der Baumaßnahmen ziemlich durcheinanderwerfen würden.
»Wir wissen, dass dort im Sennhof mit die ältesten Gebäude des Klosters standen«, antwortete Schönborn. »Dort ist häufig umgebaut worden, wir sind ja noch innerhalb der mittelalterlichen Klostermauern. Sie sehen ja, schon nach wenigen Zentimetern befinden wir uns in historischen Schichten.«
Der Immobilienverwalter, ein eher umgänglicher Zeitgenosse, versuchte die Gemüter zu beruhigen und fragte vorsichtig: »Und was ist jetzt zu tun?«
»Sie müssen auf jeden Fall erst einmal die Arbeiten stoppen. Ich rufe im Regierungspräsidium an, das Denkmalamt soll sich den Fund ansehen. Dann müssen Archäologen den Befund aufnehmen.« An den Bauamtsleiter gewandt, fügte Schönborn hinzu: »Und wir brauchen eine mit dem Ministerium abgestimmte Pressemitteilung.«
Das Grab
Im April im 21. Jahrhundert
Sigi Seifert, der zuständige Archäologe der Bodendenkmalpflege, hatte einen sorgfältig handgezeichneten Plan der Fundstelle an die Wand im Büro des Museumsleiters Benedikt Schönborn gepinnt. Beide – Sigi und Benedikt – kannten sich noch von gemeinsamen Tübinger Studienzeiten. So manche Grabungskampagne hatten sie als Studenten, und dann später als Assistenten an der Uni, gemeinsam durchgestanden, bevor sich – beruflich bedingt – ihre Wege trennten. Gelegentlich traf man sich bei wissenschaftlichen Kongressen, Ausstellungseröffnungen oder Institutsfesten im Tübinger Schloss, sodass der Kontakt nie ganz abgerissen war. So war es für Sigi eine Selbstverständlichkeit, dass er nach Benedikts Anruf bei der Bodendenkmalpflege, für die Sigi als Mittelalterarchäologe nun zuständig war, sofort persönlich mit einem kleinen Team studentischer Mitarbeiter in Salem anrückte, um den spektakulären Fund zu untersuchen. Entgegen allen Befürchtungen der Bauleitung, die archäologischen Untersuchungen könnten die Baggerarbeiten verzögern, schritt die Notgrabung zügig voran, ohne die Bauarbeiten wesentlich zu unterbrechen.
Knapp zwei Wochen war das nun her, und Sigi war nach Salem gekommen, um erste Ergebnisse zu präsentieren. »Also, das ist schon ein merkwürdiger Befund – das hat man nicht alle Tage«, begann Sigi mit seinen Ausführungen. »Das Skelett, das wir gefunden haben, lag praktisch in der Baugrube zu dieser Mauer hier.« Er zeigte mit dem Bleistift auf eine Seitenmauer eines langgestreckten Gebäudes, wie es auf dem Plan eingezeichnet war – zwischen Rentamt und heutigem Spielplatz gelegen. »Dort lagen meines Wissens die Stallungen des Klosters«, entgegnete Benedikt. »Schweineställe, Hühnerställe; soweit wir aus den Archivalien wissen, aus dem 15. Jahrhundert.«
»Ja, aber die Unterlagen im Generallandesarchiv geben nicht viel mehr her. Es gibt dort keine genauen Aufzeichnungen, keine alten Pläne, keine Handwerkerrechnungen, nicht für diese frühe Zeit. Wahrscheinlich sind die Bauarbeiten der Stallungen damals noch von den Konversen im Kloster ausgeführt worden. Erst für spätere Umbauten hat man dann ortsansässige Handwerker beauftragt, dafür gibt es dann auch Archivalien.«
»Du meinst aber, wenn das Grab in der Baugrube liegt, dass es älter oder zumindest zeitgleich zur Bauzeit der Stallungen ist?«
»Sieht so aus – und es ist tatsächlich ein Grab«, entgegnete Sigi. »Die Grube war sorgfältig ausgehoben worden und mit hochkant gestellten Dachziegeln seitlich begrenzt. Der Tote war dann einigermaßen ordentlich mit großen Wacken und einigen Sandsteinplatten, wie sie wohl auch zum Bau der Ställe verwendet worden waren, abgedeckt worden.«
»Also eine regelrechte Bestattung«, kommentierte Benedikt.
»Durchaus. Aber was soll ein Grab an dieser Stelle des Klosters? Die Friedhöfe für Mönche und Laien – das wissen wir – lagen ausschließlich am Münster, südlich vom Chor, im späteren Novizengarten, dann an der Ostseite des Chors und an der Nordseite des Münsters.«
Sigi fuhr mit seinen Erklärungen fort: »Wir konnten in der Kürze der Zeit natürlich keine umfangreicheren Grabungen bei den Ställen durchführen, aber wir haben schon die Mauer entlang gegraben und die nächste Umgebung untersucht – nichts, kein weiteres Grab, also kein Laienfriedhof. Auch keine weitere Architektur, weitere Knochenfunde stammen ausschließlich von Tieren wie Schweinen, Hunden, Hühnern.«
»Das Kloster hätte ein Grab außerhalb des Friedhofs, bei den Stallungen, also in ungeweihter Erde, nie gestattet. Oder handelte es sich um einen Selbstmörder?«
»Das kann ich dir natürlich nicht bestätigen. Alls, was uns die Untersuchung der Knochen liefert, ist Folgendes: Es handelt sich um ein männliches Individuum, zwischen 35 und 45 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß; die Zähne schon recht abgenutzt; Degenerationserscheinungen an der Wirbelsäule lassen darauf schließen, dass der Mann in seinem Leben recht hart arbeiten musste. Zu Ernährung oder Krankheiten können wir noch nichts sagen; wenn du möchtest, beantragen wir weitere Untersuchungen; übrigens liegt das Skelett bei den Anthropologen in Tübingen. Wenn es ordentlich bestattet werden soll, was durchaus angemessen wäre, könnte es aber zurückgebracht werden.«
»Warten wir erst einmal ab, bis unsere Bauarbeiten hier abgeschlossen sind. Vielleicht ergeben sich ja noch einige Fragen …«
»Die ergeben sich auf alle Fälle; denn offen gesagt, ist vieles äußerst merkwürdig. Zum Beispiel fehlt ein Oberschenkelknochen.«
»Ja, das weiß ich«, entgegnete Benedikt, »den hat doch der Baggerführer einfach aus der Erde gezogen und weggeworfen.«
»Nein, den meine ich nicht. Wir haben ja den Aushub genau untersucht und dabei auch diesen Knochen geborgen. Nein, der linke Oberschenkelknochen fehlt – nichts, keine Spur, noch nicht einmal Splitter.«
Benedikt schaute seinen Freund misstrauisch an.
»Du kannst sicher sein«, entgegnete Sigi, der den Blick richtig gedeutet hatte, »wir haben sehr sorgfältig gearbeitet – trotz des Zeitdrucks.«
»Das bezweifle ich ja gar nicht …«
»Aber ich hab auch ein paar gute Nachrichten: Wir haben organisches Material sicherstellen können, das man sehr gut zuordnen kann. Der Leichnam trug wohl ein Gewand aus recht grober Wolle, dann haben wir noch Reste von Sackleinen; er wurde also in seiner Kutte und dann in einen Sack gewickelt bestattet.«
»Es war also tatsächlich ein Mönch oder ein Konverse, jedenfalls jemand von niederem Stand. Sonst noch irgendwelche Funde?«
»Ja – und das ist wiederum äußerst merkwürdig: In Brusthöhe lag ein Kreuz aus Silber, was man bei einem gewöhnlichen Mönch oder Konversen nicht erwarten dürfte. Und, wie wir zweifelsfrei feststellen konnten, war das Kreuz zusätzlich in einen wertvollen, mit Goldfäden durchwirkten Seidenstoff gewickelt – Reste davon haben wir sicherstellen können.«
»Wirklich recht merkwürdig – könnt ihr aufgrund der Webart oder des Stoffmusters auf eine Datierung schließen?«
»Wir können es untersuchen lassen, sicher finden sich Vergleiche – auch das Silberkreuz schauen wir uns noch näher an.« Der Archäologe kramte in seiner ledernen, schon etwas abgewetzten Aktentasche. »Ach ja, noch etwas Bemerkenswertes!« Er zog ein paar Fotografien aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. Es waren Aufnahmen des Skeletts am Fundort, darunter einige Fotos des Schädels aus unterschiedlichen Blickwinkeln. »Sieh, hier, an der linken Schläfe ist ein dreieckiges Loch, eine Verletzung. Ob das die Todesursache war, können wir nicht sagen, noch nicht. Was die Verletzung verursacht hat, ist unklar. Ein Sturz? Ein Schlag? Wer weiß …«
Sigi reichte seinem Freund zum Abschied die Hand: »Meinen schriftlichen Bericht bekommst du noch.«
»Ja, danke, auch wenn das Grab bauhistorisch nicht viel hergibt, vielleicht sind wir einer interessanten Geschichte auf der Spur.«
Tod im Weinkeller
1485, im April
Seit Wochen herrschte unentwegt hässliches, nasses Wetter; Tag für Tag zogen graue Wolken von Westen her und regneten sich am Hang des Heiligenbergs ab. Nicht nur, dass es fast täglich wie aus Eimern goss, nein, es war auch ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit. Der Winter hatte außerordentlich lange gedauert, sogar an Karfreitag hatte ein Schneesturm Mensch und Natur durchgeschüttelt. Die Kälte hatte sich in den Mauern der Kirche und des Klosters festgesetzt, sie kroch den Mönchen den Körper hoch wie ein böses Tier, bis ins Herz, und lag schwer auf der Brust, sodass jede Bewegung zur Mühsal wurde und jede Betätigung der Überwindung bedurfte. So zogen viele in diesen Wochen das Orare dem Laborare vor und verbrachten mehr Zeit als gefordert in ihrer Zelle – die Holzdielen waren angenehmer als die kalten Steinplatten im Kreuzgang – bei der Lektüre. Einige wollten dagegen die Küche gar nicht mehr verlassen, schrubbten Fische und Krautköpfe, nur um dem wärmenden Herd nahe zu sein. Die Schreiber im Skriptorium hatten es angenehmer, denn die Schreibstube gehörte zu den wenigen geheizten Räumen im Kloster. Vielen schlug das trübe Wetter des Frühjahrs, in dem sich kaum die Sonne gezeigt hatte, auf das Gemüt; sie haderten mit sich, ihrem Dasein im Kloster und mit den Mitbrüdern, sodass bisweilen offener Zank ausbrach. Einige schlichen öfter als angemessen und erlaubt in den Weinkeller, um sich ein Fläschchen abzufüllen gegen die Einsamkeit in der kalten Zelle …
In den letzten drei Tagen im April suchten nun gewaltige Regengüsse das Salemertal heim. Es schüttete ununterbrochen. Schon standen die sauren Weiden und wenigen Äcker im Tal der Salemer Aach unter Wasser. Zwar war das Kloster selber, am westlichen Rand des einst sumpfigen Tales gelegen, nicht vom Hochwasser bedroht, doch mussten Aachkanal, Leitungen und Abwasserkanäle sorgfältig überwacht werden, damit durch Schlamm und Verunreinigungen aufgestautes Wasser nicht doch noch zu Überschwemmungen führte. Schon beim Bau der Klosteranlage hatten die Mönche einen Kanal von der Aach abgezweigt, Quellwasser in Leitungen eingespeist sowie ein ausgeklügeltes System von Frischwasser- und Abwasserleitungen angelegt, sodass Wasserzu- und -abflüsse je nach Bedarf reguliert werden konnten. Mit kleineren und größeren Schleusenanlagen an mehreren Stellen im Klostergelände konnte Wasser aufgestaut werden, das man brauchte für die Werkstätten, den Weinkeller oder zum Befüllen der Fischbecken nahe der Küche. Öffnete man die Schleusen, so konnte das Wasser abgeleitet werden in die Aach, die schließlich bei Seefelden in den Bodensee mündet.
Bruder Pirmin, Konverse und Wassermeister, oblag die Aufsicht über die Leitungen und Schleusen. Und so machte er sich mit einem großen hölzernen Zuber und weiterem Werkzeug auf den Weg, um Wasserstand und Schleusen zu überprüfen, die Leitungen und Kanäle von Unrat zu säubern oder, falls nötig, die Schleusen zu öffnen. Sein nächstes Ziel war der große Weinkeller. Seine Augen mussten sich in dem nur spärlich durch Oberlichter beleuchteten Keller erst an das düstere Licht gewöhnen. An beiden Längsseiten des Kellers standen die hölzernen Fässer, aufgestapelt in zwei, drei Lagen übereinander, die größeren unten, die kleineren in der zweiten und dritten Reihe darüber. Das aus Ziegeln errichtete Kellergewölbe bot so viel Raum, dass noch ein bis zwei Fassreihen bis oben hin Platz gehabt hätten.
Jedes der Fässer hatte vorne am Fassboden eine hölzerne Fassspange mit Schnitzereien oder eingeritzten Sprüchen oder Gebeten für das Gelingen eines guten Weins. Unterhalb der Fassspange war das Fasstürchen, jedes so groß, dass ein schlanker Mönch oder ein junger Gehilfe zum Säubern des Innern hineinklettern konnte. Als Pirmin die Fassreihen entlang den Keller durchschritt, um zur Schleusenstelle zu kommen, bemerkte er eine Lache auf dem Boden. »Das gibt’s doch nicht.« Konnte es sein, dass die unterirdisch verlegte Leitung schon verstopft war und Wasser durch den gestampften Boden drang? Er zuckte zusammen, vor Schreck ließ er Holzkübel und Werkzeug fallen. Auf dem Boden am Ende der Fassreihe lag ein lebloser Körper in einer Lache, daneben ein kleineres Holzfass, das wohl von der obersten Reihe herabgefallen war. Beherzt packte Pirmin den Leblosen an den Schultern und drehte ihn um. Tote Augen starrten Pirmin an – es war ein Entsetzen im Antlitz des Toten, als wäre er dem Leibhaftigen begegnet. Pirmin wich zurück und wäre vor Schreck fast in der Lache ausgerutscht. Der gesamte Körper war überströmt von einer roten Flüssigkeit. Blut? Nein, Pirmin merkte es sofort, die rote Flüssigkeit war kein Blut, der säuerlich-vergorene Geruch, wenn nicht Duft, ließ nur eine Schlussfolgerung zu: Rotwein!
Als Pirmin seinen ersten Schreck überwunden hatte, näherte er sich dem Toten, er glaubte, Bruder Stephan zu erkennen. Was hatte Stephan, ein junger Mönch, der sonst hauptsächlich in der Schreibstube beschäftigt war, hier im Keller zu suchen? Wie war er zu Tode gekommen? Hatte ihn das Holzfass beim Herunterfallen erschlagen? Ein merkwürdiger Schauer überkam ihn: Mit dem säuerlichen Geruch des Weins vermischte sich ein leicht beißender, süßlicher, aber nicht unangenehmer Geruch, den er sehr gut kannte. Es war ihm, als rieche er Weihrauch.
Johannes
1485, im April
Es war am selben Tag, als Pirmin den jungen Bruder Stephan, tot in einer Rotweinlache liegend, im Keller entdeckt hatte.
In der Zelle des Bruders Cellerar saß ein Novize auf einem Stuhl in der Ecke und las dem todkranken Cellerar, der in seinem Bettkasten lag, halblaut aus der Bibel vor. Sein Latein war noch ziemlich holprig, sodass er die Wörter bisweilen falsch betonte. Doch der Cellerar war in seinem Zustand, dem Tode nahe, sowieso nicht mehr fähig, zuzuhören. Zudem plagten ihn schlimmste Gedanken. Nicht wegen körperlicher Schmerzen, vielmehr aus Seelenpein, entwich dem Cellerar ein schauderhaftes Stöhnen. Der Novize, durch die seltsamen Laute des Alten aufgeschreckt, unterbrach seinen Vortrag und rückte mit dem Stuhl nahe ans Bett heran. »Was ist mit dir, Bruder? Sprich deutlich, ich verstehe dich kaum.« Mehr ein Röcheln als klare Worte waren aus dem Mund des Bruders Cellerar zu hören. »Ich will die Beichte. Ich bin schuldig, ich habe ihn getötet.«
»Wen hast du getötet?«, wollte der Novize wissen.
»Den jungen Bruder, Bruder Stephan …«, flüsterte der Cellerar.
»Aber woher … wieso? Du kannst ihn doch nicht getötet haben, erst heute wurde er gefunden, und du liegst schon seit Wochen schwer krank darnieder!«
»Ich bin schuld an seinem Tod, wegen meiner Geltungssucht musste er sterben. Schnell, die Beichte, hol Bruder Johannes … mit mir geht es zu Ende.«
Der Novize sprang auf und rannte aus der Zelle, die im Obergeschoss im Westflügel des Klostergebäudes lag, hinaus auf den Gang, stürzte die Treppe hinunter und lief – um Zeit zu sparen – quer durch den Kreuzgarten hinüber zum Küchentrakt. Fast rannte er den Küchenmeister um. »Langsam, Junge, was für ein Benehmen!«
»Der Kellermeister, er stirbt! Er ruft nach Bruder Johannes, weißt du, wo ich ihn finden kann?«
Der Küchenmeister schien die Nachricht vom im Sterben liegenden Mitbruder zu ignorieren. »Nicht nur, dass du dich ungebührlich bewegst, jetzt brichst du auch noch das Schweigegebot. Bruder Johannes ist beim Abt.«
»Danke!«, rief der Novize und rannte weiter auf das Abteigebäude zu, wo der Abt residierte. »Aber du kannst doch nicht einfach so zum Abt! Und sprich gefälligst Latein!« Die letzten Worte des Küchenmeisters hörte der Novize schon nicht mehr.
Das Abtei- oder Prälaturgebäude war an den Ostflügel des Konvents angebaut worden. Es hatte zwei Stockwerke, im Erdgeschoss befanden sich Verwaltungsräume für den Cellerar und den Bursar sowie Räume für das Klosterarchiv, in dem wichtige Schriftstücke, Urkunden, Verträge, Papstbullen, kaiserliche Dekrete sowie allerlei Briefe von Stiftern, Förderern, aber auch Bittstellern an das Kloster aufbewahrt wurden. Gleich neben den Archivräumen lag auch das Skriptorium, die Schreibstube des Klosters; denn die Aufgabe der Schreiber war nicht nur, Bücher abzuschreiben, die man sich von anderen Klöstern ausgeliehen hatte, sondern auch die Texte für Urkunden und allerlei andere Schriftstücke zu verfassen. Im oberen Stockwerk des Abteigebäudes befanden sich das Audienz- und Arbeitszimmer des Abtes sowie seine Wohnräume. Da die Prälatur als eigener Bau erst vor wenigen Jahren neu errichtet worden war – im Gegensatz zum Konventgebäude, das, kaum verändert, noch aus der Gründungszeit des Klosters stammte –, hatte der Abt verfügt, die Räume nach Art der Zeit ausstatten zu lassen. So war, so empfand es nicht nur unser Novize, ein recht komfortables Wohnhaus entstanden, das mit seiner Holzvertäfelung in den Innenräumen, den bemalten Deckenbalken, seinen Kachelöfen und prächtigen Deckenleuchtern sowie bequemem Mobiliar eher an ein Patrizierhaus denn an ein Kloster erinnerte.
Hastig klopfte der Novize an die schwere Eichentür des Audienzzimmers. Bruder Johannes, der junge Bibliothekar des Klosters, der zugleich die Oberaufsicht über die Schreiber hatte, öffnete die Tür; der Abt thronte auf einem Stuhl mit hoher gedrechselter Rückenlehne neben einem großen Holztisch. »Verzeihung, Vater Abt«, stammelte der Novize, dann erinnerte er sich, dass Novizen nur Latein sprechen durften. »Excusate me, Vater Abt, äh, reverendissime«, dann brach es wieder auf Deutsch aus ihm hervor, an Johannes gerichtet. »Kommt schnell, Bruder Johannes. Der Cellerar verlangt die Beichte.«
Der Abt, Johannes Stantenat, erhob sich. Er war von großer, kräftiger Statur; trotz seines fortgeschrittenen Alters war sein Haar, das er recht lang trug, pechschwarz. Sein energisches Kinn, seine kräftige Nase und seine dunklen, lebendigen Augen unterstrichen seinen Charakter, den seine Mitbrüder, aber auch die Untertanen und Freien seines Herrschaftsbereichs als mutig, tatkräftig und entschlossen beschrieben. Tatsächlich war er, der schon einmal Abt im Kloster Lützel, dem Mutterkloster Salems, gewesen war, umtriebig in vielerlei Hinsicht. Seiner Initiative verdankte das Kloster etliche Verträge mit Lehensträgern, Freien und Adeligen. Er legte Streitigkeiten in seiner Herrschaft bei, scheute aber nicht Auseinandersetzungen mit anderen, sogar dem Bischof von Konstanz, wenn es um Belange des Klosters ging. Das Kloster selber erneuerte er mit zahlreichen Bauten. Trotz seines Durchsetzungswillens, ja Härte sich selber und anderen gegenüber, galt er als gerecht und großzügig. Zudem war er äußerst kunstsinnig, förderte die Arbeit in der Schreibstube, indem er wichtige Abschriften mit wertvollen Auszierungen in Auftrag gab, und liebte die Musik. Die Mitbrüder konnten ihn ab und an Laute spielen hören.
Der Abt wandte sich an den Novizen. »Nun, Junge«, sprach er auf Deutsch. »Wenn unser Bruder unsere Hilfe in seiner letzten Stunde braucht, dann stehen wir ihm bei. Bruder Johannes, geh zu unserem Cellerar, nimm ihm die Beichte ab und erteile ihm, sobald nötig, die Sterbesakramente.«
Bruder Johannes verneigte sich wortlos und bekundete damit dem Abt seinen Gehorsam. Er wusste zu gut, Widerrede hatte beim Vater Abt keine Aussicht auf Erfolg. Er wandte sich zur Tür und verließ mit dem Novizen das Audienzzimmer. Gehorsam hin oder her, auf dem Gang entwich ihm ein ärgerliches »Warum immer ich«. Erschrocken wandte sich der Novize ihm zu – war er gemeint? Doch Johannes gebot ihm mit einer Geste, zu schweigen.
Eilig schritten sie hinüber in den Konventbau. Johannes haderte derweil mit seinem Auftrag, dem sterbenden Bruder die Beichte abzunehmen. Bruder oder nicht Bruder – Seelsorge, wozu die Abnahme der Beichte gehörte, empfand er nicht als seine vordringlichste Aufgabe, ja wie überhaupt Seelsorge seiner Auffassung nach nicht zu den Aufgaben eines Zisterziensermönchs gehörte. Hatte doch der Orden im Laufe seiner Geschichte deutlich ausgesprochen, Gottesdienst bestehe vor allem in Arbeit, Gebet und Studium, dadurch wirke man für das eigene und das Seelenheil anderer, nicht jedoch beim Messelesen, beim Erteilen der Sakramente oder gar bei der Seelsorge für Laien.
Abt Johannes Stantenat sah dies jedoch ganz anders. So hatte er das Kloster geradezu für die Seelsorge seiner Untertanen geöffnet, ließ Messen lesen für die gemeinen Leute und gestattete sogar die Grablege von Laien im Münster; zugegebenermaßen war dieses Privileg nur hochrangigen Persönlichkeiten vorbehalten, die dem Kloster durch Stiftungen und Zuwendungen auch nützten.
Johannes hätte die freie Zeit bis zur Vesper nun viel lieber seinem Studium oder der weiteren Katalogisierung der Klosterbücher gewidmet, war er doch vom Abt damit betraut worden, den Bestand an Büchern erstmals zu sichten und zu ordnen. Das Kloster hatte zwar seit seiner Gründung im 12. Jahrhundert eine Schreibstube, in der man die wichtigsten Schriften selber herstellte; einen Grundstock an für die Messfeier nötigen Büchern hatte Frowin, der erste Abt in Salem, aus dem Mutterkloster Lützel mitgebracht. Diese lagen in der Sakristei oder auf Pulten im Chor, andere befanden sich in den Räumen des Abtes, der Großteil der wertvollen Codices wurde im Armarium aufbewahrt, einer fensterlosen Bücherkammer, die neben der Sakristei unter der großen Treppe zum oberen Stockwerk lag. Eine Bibliothek hatte das Kloster noch nicht, obwohl vom Generalkapitel in Citeaux schon vor Jahren angeordnet worden war, zur besseren theologischen Unterweisung der Mönche Bibliotheken einzurichten. Denn die Bücher seien die wichtigsten Schätze des Klosters und schärfsten Waffen des Mönchs gegen Unbildung, Aberglauben und Häresie. Deshalb nannte man die Bücherkammer Armarium, also Waffenkammer.
Johannes, er zählte kaum mehr als 30 Lenze, hatte schon vor geraumer Zeit seine Gelübde abgelegt und sich damit auf Lebenszeit dem Klosterleben verpflichtet. Er entstammte nicht wie einige seiner Brüder dem niederen Adel, sondern kam aus einer Bauernfamilie aus dem Dorf Mimmenhausen, die schon seit Generationen im Dienst des Klosters stand. Etwa seit den Zeiten des großen Abtes Ulrich von Seelfingen nahm das Kloster gerne besonders geeignete und begabte Knaben und junge Männer aus den Reihen seiner Untertanen als Novizen oder Konversen auf statt unwillige Söhne aus vornehmen Geschlechtern, deren Benehmen nur allzu oft der Klosterzucht abträglich war. Anders bei Johannes. Das strenge Leben in der Klausur erschien ihm weit eher erträglich, als auf dem Hof seines älteren Bruders Georg als Knecht zu dienen. Im Kloster hatte er nicht nur eine gründliche Ausbildung in den freien Künsten und im Wirtschaften erhalten, nach seinem Noviziat hatte man ihn sogar zum Theologiestudium nach Heidelberg geschickt. Dort war vom Zisterzienserorden zur Ausbildung seiner Priestermönche eigens das Jakobskolleg eingerichtet worden. Johannes wäre natürlich viel lieber zum Studium nach Paris gegangen, wie es früher auch üblich war. Doch seit dem Streit des Heiligen Bernhard mit dem Pariser Gelehrten Abelard mied man bei den Zisterziensern die Pariser Hochschule.
An Johannes’ bäuerliche Herkunft erinnerte nur noch – trotz der kargen Mahlzeiten im Kloster – seine kräftige Statur und seine breiten Schultern, hatte er doch als Kind und junger Mann hart auf den Feldern mitarbeiten müssen. Seine Körperhaltung war aufrecht, zeigte nichts Demütiges oder gar Unterwürfiges, und auch seine ebenmäßigen Gesichtszüge mit dem markanten Kinn und der schmalen Nase wirkten vornehm, sodass man ihn gut und gerne für den Spross eines Adeligen hätte halten können. Der lebhafte Blick aus seinen dunkelbraunen Augen verbarg kaum sein für einen gewöhnlichen Mönch schon ungebührliches Selbstbewusstsein und brennende Neugier auf die Geschehnisse in der Welt. Nun, als Leiter des Skriptoriums, konnte er sich ganz den Büchern widmen, die ihm durchaus einen Blick auf die Welt jenseits der Klostermauern gewährten.
Ordnung in das Durcheinander des Bücherbestands in Salem zu bringen, das empfand Johannes als seine dringlichste Aufgabe, um vielleicht einmal eine richtige Bibliothek einrichten zu können – und nicht Sakramente erteilen oder die Beichte abnehmen, wozu hatte er denn studiert? Um sich mehr oder weniger lässliche Sünden seiner Mitbrüder anzuhören? So gab es zwar im Kloster allerlei Versuchungen zu kleinen Nickeligkeiten, Neid, Stolz, manchmal unzüchtige Gedanken oder Verfehlungen gegen die Klosterregeln, aber zu sündhaftem Verhalten oder gar Todsünden – so meinte Johannes – fehlte es im Kloster ganz und gar an Gelegenheiten.
Die Beschäftigung mit Büchern, das war seine Vorliebe seit seinem Studium in Heidelberg. So waren der Gehorsam gegenüber dem Abt, persönliche Armut und Askese im Kloster nicht wirklich Prüfungen für den jungen Mönch, denn er widmete sich ohnehin mit vollster Hingabe den Büchern und der Literatur.
Der Sonderauftrag, sich um den sterbenden Bruder zu kümmern, forderte nun seinen Gehorsam auf andere Weise – und machte ihm mit einem leichten Stich in der Brust bewusst, dass er in erster Linie ein Mönch war und kein Schriftgelehrter.
Mit leichtem Unbehagen – weil er gegen sein Gelübde, das Gehorsam verlangte, aufbegehrte und Eitelkeit und Stolz verspürt hatte, aber auch, weil ihm die Begegnung mit dem Sterbenden die Unausweichlichkeit des Todes deutlich machte – öffnete er die Tür zur Zelle.
Der Cellerar
1485, am selben Tag im April
Beim Anblick des alten Cellerars wurde Johannes sofort klar, dass der Tod nahe war. »Los, schnell, geh in die Sakristei, hol mein Chorgewand und die Garnitur mit dem Salböl für die Letzte Ölung«, befahl er dem Novizen.
Johannes war betroffen, als er den alten Mitbruder sah. Lange Wochen schon war dieser nicht mehr im Refektorium bei den Mahlzeiten erschienen, geschweige denn, dass er imstande gewesen wäre, an den Chorgebeten teilzunehmen, schon lange fesselte ihn seine Krankheit ans Bett. Das bleibt also am Ende eines Lebens von einem Menschen übrig, dachte Johannes, der bisher noch selten einem Sterbenden beigestanden hatte. Johannes’ Mutter war gestorben, als er noch ein Kind war – er kannte seine Mutter als eine lebendige junge Frau, die trotz der vielen Arbeit im Haus und auf den Feldern und der Aufzucht ihrer drei Kinder eine schier unbändige Lebensfreude ausstrahlte und ihre Fröhlichkeit an ihre Kinder und ihren Mann weitergab. Johannes erinnerte sich nicht mehr an ihr Gesicht, aber an die festen rotblonden Locken ihres Haares, das sie an Feiertagen mit Sesamöl zum Glänzen brachte. Auch der Geruch von Anis und Fenchel, woraus sie jeden Abend den Tee für sich und die Kinder kochte, blieb ihm in der Nase und im Gedächtnis, sobald er an sie dachte. Und jedes Mal, wenn er im Klostergarten an den Anisstauden vorbeiging, durchströmte ihn die Erinnerung an seine Mutter.
Sein Vater, seit dem Tod der Mutter schwermütig und wortkarg, nicht nur seinen Kindern gegenüber, hatte das Leiden an der unausweichlichen Vergänglichkeit des Daseins zum Lebensinhalt erhoben, litt fast zwanzig Jahre lang, ohne sich seinen kümmernden Verwandten oder seinen heranwachsenden Kindern mitzuteilen, und verstarb ebenso wortlos, plötzlich, ohne Anzeichen einer Krankheit, über Nacht. Johannes war damals nicht zugegen in Mimmenhausen, sondern lebte wegen seines Studiums gerade in Heidelberg.
Den todkranken Mönch anzublicken oder anzureden, fiel Johannes schwer. Den süßlichen Geruch, den der sterbende Körper in den durchschwitzten Laken verströmte, zu ertragen, kostete ihn noch mehr Überwindung. Der Cellerar versuchte, als Johannes sich näherte, sich mit letzter Kraft aufzurichten. »Ist es so weit mit mir, junger Bruder? Du bist doch Johannes, der Scharpfer, aus Mimmenhausen.« Mit einem Röcheln sank sein Oberkörper zurück auf das Strohkissen. »Es ist meine Schuld, wegen mir musste er sterben …«
»Was meinst du, Bruder?« Johannes verstand kaum, was der Cellerar sagte, er beugte sich zu ihm. »Wer musste sterben? Meinst du Bruder Stephan, der heute tot im Weinkeller gefunden wurde? Aber das kann ja nicht deine Schuld sein, du bist doch seit Wochen ans Bett gefesselt.«
»Ich hätte es wissen müssen, wegen meines Vergehens ist er gestorben, er hat ihn getötet … Hör zu, was ich dir jetzt erzähle.« Die eben noch schwache, zitternde Stimme des sterbenden Mönchs klang nun kraftvoll und entschlossen, so rückte Johannes den Stuhl im Zimmer zum Bettkasten und setzte sich, um die Geschichte des Cellerars zu hören.
»Der junge Bruder Stephan ist sein Opfer – er hat ihn auf dem Gewissen, und es ist meine Schuld«, fuhr der Cellerar fort.
»Aber was redest du? Wessen Opfer? Stephan ist beim Fassreinigen ausgerutscht und hat sich den Schädel eingeschlagen«, bemerkte Johannes lapidar.
»Nein, nein, er hat ihn getötet, hör mir zu. Es war vor mehr als dreißig Jahren, damals war unser gütiger Vater Georg, der Konstanzer, Abt in Salmansweil. Der Heilige Vater in Rom nannte sich Nikolaus. Zu dieser Zeit geschah es, was ich dir jetzt berichte. Ich war noch nicht Kellermeister, nein, noch lange nicht, ich war damals als Gehilfe im Weinkeller beschäftigt. Bruder Martin war damals unser Cellerar, er verwahrte nicht nur den Schlüssel zum Weinkeller und zu allen Vorratskellern, er war auch selber ein kundiger Weinbauer. Seine Weine gelangen ihm jedes Jahr, und jedes Jahr war der Ertrag höher und der Wein schmeckte noch besser. Schon bald verbreitete sich im Oberland und im schwäbischen Unterland der gute Ruf unseres Kellermeisters Martin, dass er ganz vorzügliche Weine herstellen und die Abtei damit höchste Preise erzielen konnte. Beste Abnehmer waren die Konstanzer, die in unserem Salmansweiler Hof dort eifrig kauften. Das Handwerk hatte unser Bruder Martin im Kloster Eberbach gelernt, eines unserer Schwesterklöster, das das Wissen um den Weinbau noch direkt von unseren burgundischen Brüdern mitgebracht hatte. Bruder Martin, unser Bester im Weinkeller, ist über jeden Zweifel erhaben, ihn beschuldige ich niemals, obwohl er wegen der Vorfälle damals im großen Weinkeller und dem großen Weinfass arg in Verdacht geraten war.«
»Welche Vorfälle? Was meinst du? In den Klosterchroniken habe ich dergleichen niemals gelesen …«
»Schweig still, sonst komme ich nicht zum Ende meiner Geschichte, viel Zeit bleibt mir nicht mehr.« Die Stimme des Mönchs legte an Kraft und Lautstärke zu. »Um die wachsenden Erträge der Reben aufzunehmen und damit auch die Leistungen unseres Kellermeisters zu ehren, gab unser seliger Abt Georg ein großes Fass in Auftrag, es war so groß und sorgfältig gearbeitet mit prächtig verzierten Fassspangen, dass man ihm einen Namen gab: Maise wurde es genannt. Die Ausbeute der besten Rebgärten am See sollte darin reifen.
Es gab damals ein besonders ertragreiches, sonnenreiches Jahr – Georg war nun schon im zwölften Jahr unser Abt – mindestens zwei Jahre sollte der Wein im Fass reifen, weil man sich dadurch mehr Güte versprach, so sollte es auch sein …«
»Doch was hat der gute Wein, das große Fass, Maise hast du es genannt, mit deiner Beichte zu tun, nach der du verlangst?« Johannes wurde allmählich ungeduldig, hatte er doch keine Lust, sich die immer gleichen Geschichten der alten Männer anzuhören … früher war alles besser, die Klosterzucht war strenger, die Gebete inbrünstiger, der Ertrag und die Ernte waren höher, sogar der Wein schmeckte besser … und die Fässer waren größer, natürlich …