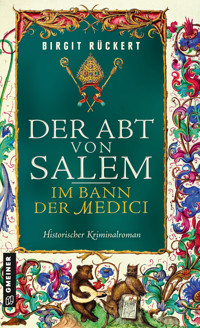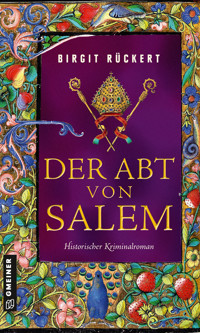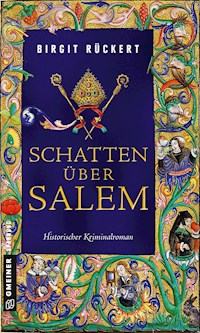
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zisterziensermönch Johannes
- Sprache: Deutsch
Rom 1489. Ein Mönch aus Kloster Salem wird auf offener Straße erstochen. Der Überlinger Arzt Matthias Reichlin von Meldegg, der dem Sterbenden zu Hilfe kommt, gerät selbst unter Mordverdacht und wird in der Engelsburg eingekerkert. Bruder Johannes, ambitionierter Leiter des Salemer Skriptoriums, wird nach Rom geschickt, um den Mord aufzuklären, aber auch, um die Selbständigkeit seines Klosters durchzusetzen. Wird es ihm gelingen, Matthias zu befreien und die Eigenständigkeit Salems zu bewahren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Rückert
Schatten über Salem
Eine fast wahre Geschichte
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Das Geheimnis von Salem (2018)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © Universitätsbibliothek Heidelberg, Codices Salemitani, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salIXc/0042
und https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/salVIII16/0086
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6166-8
Vorbemerkung
Die abenteuerliche Reise des Salemer Mönchs Johannes Scharpfer nach Rom, wo er einer gefährlichen Frau, nicht weniger gefährlichen, aber auch bedeutenden Männern begegnet – und Magdalena wiedersieht.
Auf die Sprache des 15. Jahrhunderts und das geschliffene Latein der römischen Humanisten mussten wir aus Gründen der Verständlichkeit leider verzichten. Alle in alemannisch, schwäbisch, lateinisch und italienisch gesprochenen Reden sind daher in heutigem Deutsch wiedergegeben.
Personen
Kloster Salem:
Johannes Scharpfer, aus Mimmenhausen, Mönch in Salem und Leiter des Skriptoriums (später Abt in Salem, reg. 1494–1510)
Johannes I. Stantenat, 18. Abt in Salem (reg. 1471–1494)
Jodokus Ower (1459–1510), Archivar und Sekretär des Abtes
Jakob Roiber (gestorben 1510), Schreiber, Archivar
Amandus Schäffer, junger Schreiber, später Abt in Salem (reg. 1529–1534)
Personen außerhalb des Klosters:
Hans von Savoy, Steinmetz und Klosterbaumeister in Salem, Freund von Johannes
Magdalena Reichlin von Meldegg, Tochter des Überlinger Arztes Andreas Reichlin von Meldegg
Matthias Reichlin von Meldegg (gest. 1510), Arzt, älterer Bruder der Magdalena
Heinrich Zili (1434–1500), Tuchhändler in Sankt Gallen
Christoph Zili, ehemaliger Novize in Salem, Neffe des Heinrich Zili
Elisabeth, Schwester des Johannes Scharpfer, verheiratet mit Christoph Zili, lebt im Haus des Tuchhändlers in Sankt Gallen
Ulrich Rösch (1426–1491), ab 1463 Abt des Klosters Sankt Gallen
Maximilian (1459–1519), Sohn von Kaiser Friedrich III. (1415–1493), Herzog von Burgund, ab 1486 römisch-deutscher König, ab 1508 als Maximilian I. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
Kloster Lützel (Mutterkloster Salems):
Ludwig Jäger, Vaterabt von Lützel (reg. 1471–1495)
Theobald Hillweg, Schreiber im Skriptorium, später Abt in Lützel (reg. 1495–1532)
Konstanz:
Otto von Sonnenberg, Truchsess von Waldburg und Graf von Sonnenberg, Bischof von Konstanz (reg. 1474/1481–1491)
Thomas Berlower, Domprobst in Konstanz, später Bischof von Konstanz (reg. 1491–1496), in Diensten von Kaiser Friedrich III. und an der Kurie tätig
Rom:
Bernhard Schulz (oder Sculteti, 1455–1518), Mitglied der Anima-Bruderschaft, seit 1482 in verschiedenen Funktionen an der Kurie tätig, als Prokurator, Skriptor und Notar
Julius Pomponius Laetus (oder Pomponio Leto, 1428–1498), humanistischer Gelehrter in Rom, Lehrer und Philologe, Herausgeber und Kommentator antiker Schriften, Erforscher antiker Stätten und Antiquitätensammler; er führt einen lockeren Kreis von Gelehrten und Schülern (Akademie oder Sodalitas) und bringt antike Theaterstücke zur Aufführung, unter Papst Paul II. Anklage wegen Häresie und Kerkerhaft, rehabilitiert unter Papst Sixtus IV.
Platina (Bartolomeo Sacchi, 1421–1481), humanistischer Gelehrter, enger Freund von Pomponius Laetus, unter Papst Sixtus IV. Bibliothekar der Vatikanischen Bibliothek
Eucharius Silber (oder Franck, gest. 1510 in Rom), deutscher Buchdrucker in Rom, für zahlreiche Gelehrte in Rom, Kardinäle und die Kurie tätig; auch Pomponius Laetus lässt bei ihm drucken
Alessandro Farnese (1468–1549), humanistisch gebildeter Adeliger, ab 1493 Kardinal, ab 1534 Papst unter dem Namen Paul III., eröffnet 1545 das Konzil von Trient und beruft Michelangelo zum Baumeister der Peterskirche
Giulia Farnese (1474–1524), jüngere Schwester von Alessandro Farnese, genannt »la Bella«, wird 1489 mit Orsino Orsini, einem jungen Adeligen aus dem römischen Geschlecht der Orsini, verheiratet, später wird sie Geliebte von Rodrigo Borgia
Giuliano della Rovere (1443–1513), Neffe von Papst Sixtus IV. (Francesco della Rovere, 1414–1484), ab 1471 Kardinal, ab 1503 Papst unter dem Namen Julius II., beginnt den Neubau der Peterskirche; Kunstsammler und Förderer von Künstlern (Bramante, Raffael, Michelangelo)
Ascanio Maria Sforza (1455–1505), aus der Familie Sforza, Bruder von Galeazzo Maria Sforza und Ludovico Sforza, Herrscher von Mailand, seit 1484 Kardinal, Verbündeter von Rodrigo Borgia gegen Giuliano della Rovere, später aber Gegner von Papst Alexander VI.; Onkel der Bianca Maria Sforza
Rodrigo Borgia (1431–1503), eigtl. Roderic de Borja aus Valencia, Neffe von Papst Kalixt III., ab 1456 Kardinal, 1457 Vizekanzler (Vicecancellarius) der Heiligen Römische Kirche, d. h. Leiter der päpstlichen Kanzlei, Kardinalprotektor des Zisterzienserordens, ab1492 Papst unter dem Namen Alexander VI.
Papst Innozenz VIII. (1432–1492) (Giovanni Battista Cibo) ab 1484 Papst, erlässt 1484 eine Bulle (Summis desiderantis affectibus), die als erstes und einziges päpstliches Schreiben die Hexerei anerkennt und damit Hexenverfolgungen ermöglicht
Paolo Pompilio (1455–1491), Humanist in Rom, Dozent an der römischen Universität und Privatlehrer, u. a. von Cesare Borgia, Sohn des Rodrigo, gehört zum Kreis des Pomponius Laetus
Alessio Stati (Alexius Eustathius), Humanist aus römischem Stadtadel, Freund des Paolo Pompilio, gehört zum Kreis des Pomponius Laetus
Filippo Lippi, gen. Filippino Lippi (1457–1504), Maler aus Florenz, Aufenthalt in Rom, u.a. zum Studium der Antike, Ausmalung der Carafa-Kapelle in der Dominikaner-Kirche Santa Maria sopra Minerva im Auftrag von Kardinal Oliviero Carafa
Zwei weitere Personen:
eine Spanierin
ein Agent im Dienste der Sforza
Personen der heutigen Zeit:
Benedikt Schönborn, Museumsleiter in Salem, einem ehemaligen Zisterzienserkloster am Bodensee
Sigi Seifert, Archäologe der Bodendenkmalspflege
Cornelius Bauer, Kunsthistoriker an einem kunsthistorischen Institut in Rom
Elena, Cornelius’ Frau, Mediävistin, Römerin und schön wie eine griechische Göttin
Theodor Gerstenmaier, Prof. h.c., Leiter eines renommierten, aber überflüssigen Marktforschungsinstituts
Klosterämter:
Prior: Stellvertreter des Abtes und Vorsteher des Konvents
Cellerarius (Kellerer, Kellermeister): zuständig für die Klosterwirtschaft, Aufsicht über die Vorratskammern und den Weinkeller
Bursarius, Bursier: zuständig für die Finanzen des Klosters
Portarius, Pförtner: Aufsicht über das Tor
Infirmarius, Krankenmeister: Aufsicht über das Krankenhaus; auch für Begräbnisse zuständig
Sakristan, Mesner: für die Sakristei und die liturgischen Geräte zuständig
Magister hospitum: für die Gäste und deren Verpflegung im Kloster zuständig
Magister operis: Baumeister, Aufsicht über die Bauarbeiten, oft von einem Konversen ausgeübt
Konversen (Laienbrüder): Brüder, die die handwerklichen und körperlichen Arbeiten zu erledigen hatten; sie arbeiteten auf den Grangien (klostereigene Gutshöfe) und betrieben die Stadthöfe (Salmansweiler Höfe); sie lebten im Kloster getrennt von den Mönchen in eigenen Räumen
Karte
Prolog
Rom, im Februar 1489
Matthias war zufrieden. Er hatte soeben die Gesellschaft im Haus des Gelehrten Julius Pomponius Laetus verlassen und lief den Hügel, der bei den Einheimischen Quirinale genannt wurde, hinunter. Er wollte nicht zu spät in seiner Unterkunft im Palast des Kardinals Ascanio Sforza, gleich bei der Kirche des Heiligen Laurentius in Lucina, ankommen, wo ihn sicher schon seine Schwester erwartete.
Es war schon dunkel geworden, aber das Viertel Pigna, zwischen der Rotonda und dem Kapitolshügel, war noch voller Leben, denn es war Karneval in Rom. Im Haus des Pomponius allerdings hatte man, in Erinnerung an die alten Römer, das Fest der Bacchanalien gefeiert – oder was die Humanisten dafür hielten: mit Tänzern, Musik, köstlichen Speisen und vor allem anregenden Gesprächen. Anders, als ein Christenmensch vielleicht vermuten mochte, war es bei diesem Fest doch recht gesittet zugegangen, dachte Matthias; auch der Wein war nicht im Übermaß geflossen. Da erinnerte sich Matthias an ganz andere Feste: Beim Mummenschanz in seiner Heimatstadt Überlingen ging es sehr viel derber zu.
Im Haus des Pomponius war Matthias auch mit einigen alten Freunden zusammengekommen, die er von seinem Studium in Pavia her kannte und nach längerer Zeit wiedergetroffen hatte. Einige waren an der Kurie untergekommen, andere wie Eucharius, der gleich beim Campus Florae eine kleine Buchdruckerwerkstatt betrieb, hatten sich als Handwerker oder Händler in Rom niedergelassen.
Pomponius hatte ihm eine Abschrift eines Werkes seines Freundes Platina versprochen – ein Buch über den Genuss und die Zubereitung von Speisen, damit sie der Gesundheit auch zuträglich seien. Und dazu noch schmeckten! Matthias war als Arzt an solchen Schriften natürlich ganz besonders interessiert. So hatte er in Italien Speisen, Kräuter und Gewürze kennengelernt, die man in seiner Heimat nicht kannte und über deren gesundheitsfördernde Wirkung man in Überlingen ganz gewiss nichts wusste. Wären die Ärzte am Bodensee doch etwas belesener, ein wenig gebildeter, so könnte man leicht dem Aberglauben den Garaus machen, und die Leute würden nicht hinter jeder Krankheit Hexerei vermuten.
Matthias kannte den Weg, er würde gleich bei einem alten, verfallenen Brunnen vorbeikommen, aus dem aber immer noch frisches Wasser plätscherte. Da bemerkte er, an einer Mauerruine angelehnt, eine Gestalt, vor Schmerzen sich windend und wimmernd. Matthias rannte hin, um zu helfen, und versuchte, den in sich zusammengesunkenen Oberkörper des Mannes aufzurichten. Er trug ein helles wollenes Gewand und einen schwarzen Mantel darüber. Das war kein Karnevalskostüm, wie Matthias sogleich erkannte: Der Verletzte trug den Habit der Zisterziensermönche! Inzwischen kamen Passanten vorbei, darunter einige für den Karneval Vermummte, und blieben neugierig, aber in sicherem Abstand stehen.
Matthias rüttelte den Mönch an der Schulter: »Was ist mit dir, was ist geschehen?«, fragte er auf Italienisch. Der Mönch riss angsterfüllt die Augen auf und bewegte die Lippen. Als Arzt erkannte Matthias sofort, dass er nicht mehr helfen konnte, dass dieser Mensch in wenigen Augenblicken sein Leben aushauchen würde. Matthias beugte sich über das Gesicht des Mönchs und hielt sein Ohr nah an dessen Mund. Mit letzter Kraft stammelte er, zur Verblüffung von Matthias, auf Deutsch: »Der Teufel ist noch nicht fertig mit uns …« Dann kippte sein Kopf zur Seite. Der Mönch war tot.
Als Matthias versuchte, den leblosen Körper sachte auf das Pflaster zu legen, da bemerkte er, wie eine warme, klebrige Flüssigkeit seine Hand benetzte. Matthias kannte den Geruch dieser Flüssigkeit nur zu gut: frisches Blut, das aus einer Wunde im Körper des Verstorbenen ausströmte und den weißen Habit des Zisterziensers rot färbte. Ein Dolch steckte zwischen den Rippen des Toten. Unwillkürlich zog Matthias den Dolch aus dem Körper des Mönchs, da kam Aufruhr in die Menschenmenge: Die Passanten fingen an, zu gestikulieren und durcheinanderzuschreien. Er hörte die Worte assassino und bestia. Matthias hatte den Dolch noch in der blutüberströmten Hand, als wenig später der herbeigerufene Wachtrupp des Kommandanten der Engelsburg ihn festnahm und abführte.
Theodor Gerstenmaier
Salem, im 21. Jahrhundert
Theodor Gerstenmaier, Prof. h.c. und Direktor eines renommierten, aber überflüssigen Marktforschungsinstituts, war zum wiederholten Male Teilnehmer eines hochrangig besetzten Kolloquiums zur klösterlichen Kultur am Bodensee. Irgendwann einmal war sein Name auf die Verteilerliste für Veranstaltungen in Schloss Salem gekommen – die Gründe hierfür waren ihm zwar schleierhaft, doch traf man immer Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Adel; ein Pressefoto mit dem einen oder anderen aus diesem Personenkreis war dem Ruf seines Instituts sicher zuträglich, und daher versäumte er keinen der Anlässe. Und deshalb nahm er auch diesmal die für seinen Geschmack viel zu ausufernden Vorträge in der Eiseskälte der unbeheizbaren Bibliothek in Kauf.
Der Bibliothekssaal im Schloss war gut gefüllt. Wissenschaftler aus ganz Deutschland, der Schweiz und aus Vorarlberg, ja sogar aus Liechtenstein waren zugegen – man durfte das Kolloquium daher mit gutem Grund als »international« etikettieren. Findige Marketing-Organisationen hatten vor einigen Jahren in bester Eintracht mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik den Begriff »Vierländerregion Bodensee« kreiert. Die gelegentliche Frage unbedarfter Zeitgenossen und Nicht-Einheimischer, welches denn eigentlich das vierte Land – neben Deutschland, Schweiz und Österreich – am Bodensee sei, stellte sich heute nicht angesichts der zahlreichen Gäste aus dem Fürstentum Liechtenstein.
Unter die Teilnehmer mit Professoren- oder zumindest Doktortitel hatten sich auch einige historisch interessierte Laien gemischt, darunter Bürger und Honoratioren Salems sowie Bürgermeister umliegender Gemeinden, selbstverständlich auch Vertreter der Landespolitik und des zuständigen Ministeriums, das die Veranstaltung ja zu finanzieren hatte. Auch einige schon aussortierte Politiker, ehemalige BürgermeisterInnen, Staatssekretäre, gar Minister, fühlten sich Salem im besonderen Maße verbunden und ließen sich bei solchen Gelegenheiten gerne sehen.
Theodor Gerstenmaier hatte sich bereits einige Vorträge angehört, deren Relevanz für den Fortbestand der Menschheit oder für sein eigenes Dasein er jedoch nicht erkennen konnte, hatten ihn doch historische Fragestellungen schon in der Schule, geschweige denn an der Hochschule in seinem Soziologiestudium kaum berührt. Die Anzahl der Teilnehmer, die klangvollen Titel der Referenten, die fantasievollen Fragestellungen der Vorträge verrieten ihm, dass es mit der Geschichte Salems etwas Besonderes auf sich hatte; richtig einschätzen konnte er das allerdings nicht, gründete doch sein historisches Wissen über Klöster allein in der schon lange zurückliegenden Lektüre von Ecos »Name der Rose«.
Gerstenmaier nutzte den Applaus für den Vortrag eines jungen Historikers, um den Bibliothekssaal zu verlassen. Eine Mitarbeiterin des Orga-Teams der Schlossverwaltung wies ihm freundlich den Weg den kalten Schlossflügel entlang zu den Toiletten. Im Gang waren auf gedeckten Tischen bereits Tassen, Gläser, Kaffeekannen und weitere Pausengetränke aufgestellt; auf silbern glänzenden Platten lagen – sorgfältig übereinandergestapelt – Berge wohlriechender Croissants einer einheimischen Großbäckerei und die bei offiziellen Anlässen im Land Baden-Württemberg obligatorischen Butterbrezeln. Gerstenmaier bevorzugte eigentlich, wie es bei den Bayern, in der Heimat seiner Vorväter, üblich war, den Verzehr von Brezeln im Verbund mit einem alkoholischen Getränk, ohne Butter, allenfalls mit Weißwurst und Senf, aber hier in diesem Landstrich konnte man der reinen Butterbrezel zur Kaffeepause kaum entrinnen. Als ein vor Jahrzehnten an den Bodensee Zugezogener hatte er den Akkulturationsgedanken schon längst verinnerlicht und sich integrationswillig den regionalen Gepflogenheiten unterworfen. Er schnappte sich also eine Butterbrezel: Schlimmer noch als eine Butterbrezel zum Kaffee wäre eine trockene Brezel gewesen.
Der bittere schwarze Kaffee machte den zähen Brezelteig in seinem Mund etwas geschmeidiger. Um das staubtrockene geflochtene Mittelstück der Brezel überhaupt kauen und schlucken zu können, brauchte er eine weitere Tasse Kaffee. Eine dritte Tasse Kaffee und ein darin eingetunktes Croissant oder Gipfeli, wie die Schweizer es nannten, reichten ihm, um den Laugengeschmack der Brezel zu neutralisieren.
Im Bibliothekssaal war inzwischen der Applaus verstummt; vor der allgemeinen Kaffeepause war aber noch eine Diskussionsrunde angesetzt, die der Moderator gerade eröffnete. Da Gerstenmaier für sich erkannt hatte, dass er keinerlei Fragen an den Vortragenden hatte, beschloss er, nicht wieder in den Vortragsraum zurückzukehren und seine Pause zu verlängern. Mit der Kaffeetasse in der Hand schritt er den langen Gang auf und ab, unter den Blicken von längst dahingegangenen Äbten, deren in Öl gemalte Porträts die Wände schmückten.
Vor einem der Gemälde blieb er unwillkürlich stehen. Es war ihm, als blickte ihn der unbekannte Abt direkt an. Gerstenmaier betrachtete das Gemälde genauer. Für seinen Geschmack war es zu überladen, zu bunt. Zwar nahm das Porträt des Abtes in seinem weißen Habit mit schwarzem Überwurf etwa Dreiviertel des Bildes ein, doch über dem Kopf des Abtes tummelten sich nackte Putten. Seitlich waren Buchrücken in verschiedenen Farben und Größen, quasi in Regalen aufgestellt, zu sehen. In der Linken hielt der Abt ein leicht zerknülltes, halb eingerolltes Blatt Papier, auf dem gut lesbar lateinische Wörter geschrieben standen, die Gerstenmaier freilich nicht verstand. Die Erinnerung an seinen wenig erfolgreichen Lateinunterricht bereitete dem sonst so erfolgverwöhnten Professor immer noch ein flaues Gefühl in der Magengegend.
Mit weit ausholender Geste deutete der Abt auf eine Landschaft mit Gebäuden im Hintergrund. Könnten diese Salem darstellen? Am meisten faszinierte Gerstenmaier das detailreich gemalte Pektorale des Abtes: ein Kreuzanhänger aus durchsichtig schimmernden hellblauen Schmucksteinen in Gold gefasst. Mehr zu sich selbst murmelte Gerstenmaier: »Für einen Zisterziensermönch erscheinst du mir wenig demütig.«
Gerstenmaier nahm noch einen Schluck Kaffee aus der Tasse und schritt zum nächsten Gemälde. Ihm war unwohl. Zudem hatte er das unangenehme Gefühl, jemand stehe hinter ihm. Langsam drehte er sich um. Nichts, niemand. Kein Mensch war auf dem langen, kalten Gang zu sehen. Obwohl Gerstenmaier ein ganzes Stück den Flügel entlanggegangen war, schien sich die Figur des Abtes auf dem Gemälde ihm zuzuwenden, ihn mit seinen Blicken zu verfolgen. Gerstenmaier wollte es wissen: Mit energischem Schritt ging er wieder auf das Gemälde zu. Dann schlenderte er vor dem Bild auf und ab. Ja, eindeutig: Die Augen des Porträts blieben aus jedem Blickwinkel auf ihn gerichtet. Der Abt ließ Gerstenmaier nicht aus den Augen! Gebannt starrte der Professor zurück. Er erinnerte sich an einen Vorfall vor ein paar Jahren, der sich auch hier in Salem zugetragen hatte. Wie aus dem Nichts war damals im Weinkeller eine unheimliche Gestalt aufgetaucht. Bevor Gerstenmaier seinen ganzen Mut zusammennehmen und die Gestalt zur Rede stellen konnte, war er bewusstlos zusammengebrochen. Man fand ihn erst Stunden später in einer Weinlache neben einem Fass liegend. Gerstenmaier war froh gewesen, dass man seine Ohnmacht auf plötzliche Blutzuckerschwankungen zurückführte. Wie, bitte schön, hätte er denn erklären sollen, dass ihn eine Gestalt im Mönchsgewand mit Weihrauchschwaden niedergestreckt hatte?
»Nein, diesmal nicht«, schoss es Gerstenmaier durch den Kopf. Der Goldglanz des Pektorales stach Gerstenmaier in die Augen wie Blitze. Er versuchte, dem strengen Blick des Abtes standzuhalten, dessen gemalte Augen plötzlich wie kleine Flammen zu lodern schienen, und es war ihm, als würden die Putten ihn auslachen. Gerstenmaier war noch imstande, dem Gemälde entschlossen die Worte entgegenzuschleudern: »Was willst du von mir?« Dann knickten seine Beine ein und er sackte zusammen. Er spürte noch, wie er hart auf den grauen Steinplatten aufschlug.
Einige Stunden später im Büro von Museumsdirektor Benedikt Schönborn, verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des Kolloquiums: Sigi Seifert, Archäologe der Bodendenkmalpflege, ehemaliger Studienkollege Benedikt Schönborns und Mitorganisator der Veranstaltung, hatte sich auf einen der Bürostühle niedergelassen und meinte zu Benedikt: »Wie geht es Professor Gerstenmaier? Was war denn mit dem schon wieder los?« Er nippte an einem Glas Weißwein, das ihm Benedikt frisch eingeschenkt hatte. »Hatte sich der Gerstenmaier nicht schon einmal den Kopf angeschlagen? Damals, im Weinkeller, nachdem der die Häppchen vom Büfett abgeräumt hatte?«
Benedikt Schönborn ging im Büro auf und ab. »Ja, das stimmt. Schon beim letzten Kolloquium, als es damals um die Ausgrabungen im Novizenhof ging, ist er zusammengebrochen. Aber auch diesmal ist es gut ausgegangen, er hat sich nur leicht verletzt. Der Notarzt hat die Platzwunde an seinem Kopf nur geklammert. Gerstenmaier ist schon auf dem Heimweg, sein Institut ist ja nicht weit von hier. Weißt du, was merkwürdig ist, Sigi? Gerstenmaier scheint jemandem begegnet zu sein. Unsere Dame von der Aufsicht, die gleich den Notarzt verständigt hat, meinte, der Gerstenmaier habe zu jemandem gesprochen.«
»Und?«, fragte Sigi neugierig.
»Außer unserer Aufsicht und dem Professor war weit und breit niemand«, erwiderte Benedikt.
Er betrachtete nachdenklich vier tropfenförmige glasklare Steine – Bergkristalle –, die dekorativ in einer kleinen Messingschale auf einem halbhohen Bücherregal standen. Einen dieser Steine hatte Benedikt bei Gerstenmaiers letztem Unfall im Weinkeller gleich neben der Unfallstelle gefunden, die drei anderen waren an verschiedenen Orten im Kloster aufgetaucht: in der Sakristei, im Münster, im Keller. Solche Bergkristalle schmückten alte Vortragekreuze, Reliquienbehälter oder auch Brustkreuze, wie die Äbte sie früher trugen. Benedikt konnte sich aber nicht vorstellen, dass sie über Jahrhunderte an den Orten, wo man sie schließlich gefunden hatte, gelegen hatten. Woher stammten sie also? Benedikt hatte dieses Rätsel noch nicht lösen können.
Er schüttelte gedankenversunken den Kopf und meinte zu Sigi Seifert: »Warum es den Gerstenmaier immer in unseren Gemäuern hinlegt? Salem scheint wortwörtlich ein gefährliches Pflaster für ihn zu sein.«
»Hoffentlich nicht für andere Professoren auch«, meinte Sigi. Er war erst vor wenigen Monaten zum außerplanmäßigen Professor ernannt worden. »Sonst kann ich nicht mehr zu dir nach Salem kommen, das wäre schade.«
Benedikt lachte: »Keine Chance, so schnell kommst du hier nicht weg; du bist mir noch einige Befunde aus den letzten Ausgrabungen schuldig. Und außerdem hast du sicher einen dickeren Schädel als Gerstenmaier.«
Seit einigen Jahren waren, bedingt durch verschiedene Baumaßnahmen in der ehemaligen Klosteranlage, Ausgrabungen im Gange, die Sigi Seifert mit seinen Studenten durchführte. Auch die Publikation lag in seiner Verantwortung. Für die Bearbeitung der Funde hatte man zudem Spezialisten herangezogen, die sich nun zum aktuellen Kolloquium zusammengefunden hatten, um ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren. Sigi schnaufte tief durch; er wusste, bis alles aufgearbeitet sein würde, konnten noch Jahre vergehen. Morgen wollte er das Grab eines Abtes vorstellen, das bei den jüngsten Ausgrabungen im Novizenhof gefunden worden war und das einige interessante Besonderheiten aufwies. »Nun, Benny, mit dem Mönchsfriedhof sind wir fertig; recht viel Spektakuläres außer jede Menge mittelalterliche Kanäle und Wasserleitungen ist wohl nicht mehr zu erwarten.« Sigi grinste: »Außer ihr habt noch ein paar Leichen im Keller …«
Das Grab des Abtes
Salem, im 21. Jahrhundert
»Hier sehen wir die Fundstelle vor der Freilegung.« Sigi Seifert zeigte mit dem Laserpointer auf die Leinwand. »Im Hintergrund sieht man – hier und hier – die Reste von zwei Mauerzügen, die zur Marienkapelle gehören.« Das Publikum in der Bibliothek richtete aufmerksam den Blick auf den roten, schnell hin und her springenden Punkt des Laserpointers und versuchte nachzuvollziehen, welche Mauerzüge der Archäologe bei den aufeinandergeschichteten Steinen, Ziegeln und Scherben da wohl erkennen konnte. Neben das Foto mit den Steinansammlungen wurde in die Präsentation eine Folie eingeblendet, welche exakt aus demselben Blickwinkel die einzelnen Steine, Ziegel und Scherben zeichnerisch abbildete.
Ein Teil der Zuhörer nickte wissend, während die meisten im Saal die Steinzeichnung nun gar nicht mehr deuten konnten. Auf einer weiteren Folie, die eingeblendet wurde, waren einige der gezeichneten Steine mit einer roten Linie umrandet. Aha, das meinte der Archäologe mit Mauerzügen.
Sigi Seifert fuhr mit seinen Erläuterungen fort: »Die Marienkapelle war nach der großen Brandkatastrophe von 1697 – obwohl sie nicht abgebrannt, nur leicht beschädigt war, wie uns die Quellen berichten – für den barocken Neubau der Klosteranlage ab 1705 abgerissen worden.«
Wiederum verständiges Nicken all derer, die sich in der Geschichte Salems auskannten.
»Die Marienkapelle war gegen Ende des 15. Jahrhunderts, genauer ab 1498, als Erweiterung des Infirmariums, des Krankenhauses im Kloster, neu gebaut worden. Über der Kapelle, also im zweiten Obergeschoss, ließ Abt Johannes II. eine neue Bibliothek einrichten. Baupläne aus dieser Zeit gibt es nicht, auch alte Ansichten geben keinen Aufschluss über die exakte Lage der Kapelle, wir haben nur vage Anhaltspunkte.«
Eine neue Folie zeigte einen Stein mit Spuren von Bemalung in blauer, roter und weißer Farbe. Für den nichtwissenden Teil des Publikums blendete der Archäologe eine weitere Zeichnung ein, die die farbigen Malereien in Umrissen wiedergaben und wohl Gebäude mit Dächern, gar zwei Türmchen, Fenstern und so weiter andeuteten. Auf den Gesichtern einiger weniger Zuhörer lag ein besonderes Lächeln, das sie als Insider auszeichnen sollte: Ja, das war die berühmte Spolie, die eine der ältesten Ansichten Salems zeigte!
Sigi Seifert benutzte wieder seinen Laserpointer. »Wir sehen hier, rechts neben dem Münsterdach, ein weiteres Dach mit einem kleinen Dachreiter. Wir gehen davon aus, dass es sich um den Glockenturm der Marienkapelle handelt. Sie war wohl zunächst als Einzelbau im Osten an den Kreuzgang angebaut und später in einen um 1620 neu gebauten Komplex einbezogen worden.«
Mittels weiterer Grundrisse und mehrerer digitaler Rekonstruktionen erläuterte der Archäologe, wie man sich das ursprüngliche Aussehen der Gebäude vorzustellen hatte.
Sowohl das wissende als auch das unwissende Publikum war beeindruckt. Wie im Vogelflug konnte man die Gebäude nun in einer animierten 3D-Rekonstruktion von allen Seiten und von schräg oben betrachten, einschließlich des Dachreiters mit einem kleinen spitzen Glockentürmchen. Was man nicht alles aus ein paar Steinen herauslesen konnte …
Zum Verdruss des Publikums hielt sich der Archäologe nicht lange bei den schönen Rekonstruktionen auf, sondern zeigte wieder das Grabungsfoto mit den Steinhaufen.
»Die Mauern der Kapelle mit der Bibliothek darüber waren zweischalig aus Rorschacher Sandsteinquadern aufgebaut, wie man hier sehen kann; die Deckengewölbe bestanden aus massivem Ziegelmauerwerk; dies verhinderte allzu großen Schaden beim großen Klosterbrand. Beim Neubau des Klosters nach 1697 war es allerdings im Weg, und man brach das Gebäude bis auf die Grundmauern ab. Wir erkennen nun hier«, dabei deutete Sigi Seifert abermals mit dem Laserpointer auf die Steinhaufen, »die etwa mittig an den Kreuzgang anstoßenden Reste der Grundmauern der Kapelle.«
Die nächste Folie zeigte ein weiteres Grabungsfoto. Inmitten brauner Erde lag – sowohl für Laien als auch Experten im Publikum einigermaßen gut erkennbar – ein vollständiges Skelett! Eine Umzeichnung machte deutlich, was man auf dem Foto nur vage erkennen konnte: Etwa auf Brusthöhe des Körpers lag unter dem angewinkelten Arm des Toten ein rechteckiger Gegenstand, den man leicht als Buch identifizieren konnte.
Sigi Seifert fuhr, ohne auf die Details des Fotos und der Zeichnung einzugehen, fort. »Der Fußboden der Kapelle ist nicht mehr erhalten und fiel wohl dem Klosterneubau zum Opfer. Der Fundort des Grabes liegt innerhalb der Grundmauern der Kapelle, und soweit wir der Stratigrafie entnehmen können, deutlich unter Fußbodenniveau. Es handelt sich demnach entweder um ein Grab, das zeitlich vor dem Bau der Marienkapelle angelegt wurde, oder wahrscheinlicher um eine Grablege einer Person, die man in der neuen Kapelle bestattet hat. Und es muss sich um eine höhergestellte Persönlichkeit handeln, denn wir haben besondere Grabbeigaben gefunden, auf die ich noch zurückkomme; außerdem haben sich Reste eines hölzernen Sarges erhalten, wohingegen gewöhnliche Mönche des Klosters ohne Sarg, wohl nur in ein Tuch gewickelt und gänzlich ohne Beigaben, bestattet wurden.«
Sigi Seifert machte nun einen Exkurs über Grablegen von Mönchen im Gegensatz zu denen adeliger Stifter oder Äbte in Salem. Der Friedhof der Mönche lag an der Südseite des Münsters im heutigen Novizengarten, was zahlreiche Skelettfunde bei den jüngsten Ausgrabungen bestätigten. Bedeutende Stifter und Gönner des Klosters fanden dagegen ihre letzte Ruhestätte im Konversenchor des Münsters, wohingegen Äbte im Mönchschor oder auch im Kreuzgang und im Kapitelsaal bestattet worden waren.
»Doch nun zurück zu unserem Grab in der Marienkapelle. Die Befunde stelle ich hiermit gerne zur Diskussion.«
Sigi Seifert zeigte eine Reihe von Abbildungen der Gegenstände, die man bei dem Skelett gefunden hatte. »Bei dem Toten handelt es sich um ein männliches Individuum, verstorben im Alter zwischen 55 und 65 Jahren. Zu den wenigen Beigaben zählt ein einfaches Holzkreuz mit filigraner Silberfassung, das allerdings eine Besonderheit aufweist: Als Anhänger, in Silberdraht gefasst, ist ein länglicher Bergkristall angebracht. Vergleichbares haben wir bei Kreuzen, etwa Brustkreuzen, wie sie Äbte trugen, nicht finden können. Ungewöhnlich bei dieser Bestattung ist auch das Buch, das dem Toten mit ins Grab gegeben wurde. Es handelt sich um Pergamentblätter zwischen hölzernen Buchdeckeln mit silbernen Beschlägen und Schließen. Das Buch befindet sich noch bei der Restaurierung. Wir versuchen, Blatt für Blatt zu sichern, und hoffen dadurch, etwas über den Inhalt zu erfahren.«
Sigi Seifert zeigte eine weitere Folie, auf der zwischen den skelettierten Fingern ein glänzend blaues Rechteck zu sehen war. »Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Bestatteten um ein Mitglied des Konvents handelte. Ein Fund jedoch wirft Fragen auf.« Der rote Punkt von Sigi Seiferts Laserpointer tanzte über die Folie mit dem Grabungsfoto. »In diesen blauen Seidenstofffetzen eingewickelt, fanden wir Haare. Die DNA-Analyse ergab eindeutig: Es sind Haare eines weiblichen Individuums.« Ein Raunen ging durch den Bibliothekssaal.
Magdalena
Rom, im Februar 1489
Magdalena stand am Fenster ihres Zimmers im Haus des Kardinals und blickte auf das Treiben in den Gassen Roms. Nun war sie war eine Gefangene – eine Gefangene der Familie ihres Gatten. Die guten Zeiten waren jäh zu Ende gegangen, das Blatt hatte sich gewendet, als ihr Gemahl Carlo gestorben war. Dessen Familie hatte sie von Mailand nach Rom geholt und hier in ihrem Stadtpalast untergebracht, den Kardinal Ascanio Sforza, Bruder des Herrschers von Mailand, bezogen hatte. Das Haus im Stadtviertel nahe dem kleinen Tiberhafen war zwar vornehm und geräumig, aber mehr Festung als Palast; auf Magdalena wirkte es wie ein Kerker. Ihr und ihrem Kind hatte man Gemächer im zweiten Stock zugewiesen, die sie selten verließ, außer zu den Mahlzeiten und zum täglichen Kirchgang. Matthias, ihr Bruder, war vor wenigen Tagen nach Rom gekommen, um sie heimzuholen; sie und ihren Sohn, heim nach Überlingen. Aber vor wenigen Stunden hatte ein Bote ihr ein Schreiben überreicht, das sie in tiefe Verzweiflung gestürzt hatte: Matthias wurde in der Engelsburg gefangen gehalten – des Mordes beschuldigt.
Sich ganz dem Kummer hinzugeben und sich in ihr Schicksal zu fügen, war allerdings Magdalenas Sache nicht: Das Gefühl der Aussichtslosigkeit hatte sie überwunden, sie war wieder gefasst. Sie musste handeln, um nicht nur sich, sondern auch ihren Bruder zu retten. Sie beschloss, Briefe in die Heimat auf den Weg zu bringen: einen an ihren jüngsten Bruder Klemens, Bürgermeister in Überlingen, einen weiteren an den Abt in Salem, den geistlichen Beistand ihrer Familie, und einen dritten an Maximilian.
Der Anblick des schlafenden Kindes in seinem Bettchen zauberte Magdalena – trotz der schier ausweglosen Situation, in der sie sich befand – ein zärtliches Lächeln auf ihr Gesicht. Nur einen ganz kurzen Moment gönnte sie sich die Erinnerung an eine längst vergangene glückliche Zeit.
Dann machte sie sich daran, die Briefe zu schreiben. Gleich morgen, nach der Messe in der Kirche Santa Maria dell’Anima, würde sie die Briefe einem ihrer Landsleute, die dort zum Gottesdienst zusammenkamen, anvertrauen, um sie in die Heimat zu schicken.
Meersburg
Burg Meersburg, im März 1489
Otto, Truchsess von Waldburg, Graf von Sonnenberg und zugleich Bischof von Konstanz stand am Schreibpult seines Zimmers und blickte über den Bodensee. Die Berge im Hintergrund waren jetzt im Frühjahr noch schneebedeckt. Seit Wochen schon musste er es in dieser zugigen Burg am Nordufer des Sees aushalten. Lieber wäre er in seiner etwas komfortableren Residenz in Konstanz gewesen, doch hatte er sich seit dem Weihnachtsfest vorsichtshalber nicht mehr in seiner Bischofsstadt blicken lassen. Konstanz war für ihn ein gefährliches Pflaster, obwohl er schon viele Jahre im Amt war, das ihm sein Gegner Ludwig von Freiberg streitig gemacht hatte. Einige lange Jahre hatte es sogar zwei Bischöfe gegeben, genauso lange hatte ihm der Heilige Vater die Bestätigung in seinem Amt verweigert, bis sich Kaiser und Papst auf ihn, Otto, geeinigt hatten und Ludwig das Weite suchte. Ludwig hatte sich nicht in sein Schicksal fügen und beim Papst intervenieren wollen und sich daher auf den Weg nach Rom gemacht, wo er unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen war.
Doch Otto, nun einziger, rechtmäßiger Bischof, hatte sich weder im Domkapitel noch bei den Konstanzern Freunde gemacht. Das allzu ausschweifende Leben der Domherren hatte er einzuschränken versucht, was diese ihm übelnahmen. Den Patriziern, Händlern und Handwerkern der Stadt versuchte er immer wieder Geld abzuknöpfen, denn die Finanzen des Bistums hatten arg gelitten, als Otto Unsummen für Bündnisse gegen seinen Konkurrenten um das Bischofsamt hatte ausgeben müssen.
So groß, alt und ehrwürdig das Bistum Konstanz auch war, der zugehörige Landbesitz war nicht der Rede wert, und die Einkünfte daraus reichten kaum für eine angemessene Hofhaltung, schon gar nicht für repräsentative Bauten oder einen ordentlichen Palast. Als Bischof war Otto zwar Herr über die Seelen, aber nicht unbedingt über die Geldbeutel seiner Schäflein.
Einer seiner Vorgänger hatte sich die alte Meersburg angeeignet, die den Bischöfen seither als sicherer Zufluchtsort diente, wenn ihnen die Konstanzer allzu sehr zusetzten. Doch hatte das Geld auch hier nie ausgereicht, das alte Gemäuer in eine standesgemäße bischöfliche Residenz zu verwandeln. Und jetzt, nach einem langen kalten Winter, ging auch noch das Feuerholz zur Neige. Der Bischof fror, während sich die Patrizier und Handelsleute am warmen Ofen den Bauch vollschlugen.
Otto wusste nur zu genau, dass auch die Prälaten der reichen Klöster rund um den Bodensee über ihn lachten. Vor allem der überhebliche Abt des Zisterzienserklosters Salem, dessen riesige Ländereien das kleine Fleckchen Erde um die alte Bischofsburg am See geradezu umzingelten, machte ihm schon seit Jahren Ärger und beharrte stur auf seinen Besitzansprüchen. Nicht das kleinste Gut, den verkommensten Weiler hatte sich der Salemer Abt abnehmen lassen, jede Streitigkeit mit dem Bischof focht er bis zuletzt aus. Ja, er hatte es sogar geschafft, sich weitere Güter einzuverleiben. Irgendwo fand sich immer noch ein altes Schriftstück, das den Salemer Besitz beglaubigte.
Doch damit sollte nun ein für alle Mal Schluss sein. Otto glaubte, einen Weg gefunden zu haben, die Kassen wieder zu füllen, und zwar schnell. Als Bischof würde er sich nicht mehr mit einem kleinen Stück des Salemer Besitzes, mit ein paar Weingärten, Teichen oder Wäldern zufriedengeben. Nein, das ganze Kloster samt seinen Ländereien, Grangien und Stadthöfen sollte bald ihm gehören. Mit diesem Reichtum hätte er dann auch den Konstanzer Stadtadel im Griff. Nur noch einige wenige Lieferungen an Bestechungsgeldern und ein paar Schriftstücke mussten auf den Weg gebracht werden.
Ein Kurier sollte das Schreiben, das er heute fertigzustellen gedachte, so schnell wie möglich nach Rom bringen.
Otto wickelte den langen fadenscheinigen Wollmantel mit dem abgewetzten Pelzbesatz enger um seinen Körper und versuchte, mit seinem Atem seine vor Kälte starren Finger anzuwärmen. Dann tauchte er die Feder in das Tintenfass und begann zu schreiben: »Treuer Freund, ein weiteres Mal, da du die Gepflogenheiten der apostolischen Kanzlei am besten kennst, bitte ich dich, für mich tätig zu werden. Und ich will dich nicht nur mit materiellen Gütern locken, sondern ich verspreche nicht zu viel, wenn ich dir sage: Wenn ich einst abtrete, sei dein Lohn der Bischofshut …«
Lützel
Kloster Lützel, im März 1489
Johannes lag engumschlungen in Magdalenas Armen, seinen Kopf hatte er an ihren Hals geschmiegt, ihre rotbraunen Locken bedeckten sein Gesicht. Er sog den leicht harzigen Duft ihres Haars ein. »Es ist schön, dass du bei mir bist, Magdalena«, flüsterte er. Er wusste nicht, wie lange er schon an ihrer Seite schlummernd lag. Im Halbschlaf hörte er von Ferne die Melodie einer Flöte – oder war es ein Glöckchen? Er zog sie noch enger an sich heran. Mit halb geöffneten Augen blickte er in ihr Gesicht, ihre braunen Augen schauten ihn zärtlich an, ihre vollen weichen Lippen flüsterten seinen Namen: Johannes, Johannes … Er schloss die Augen und spitzte seinen Mund, um sie zu küssen.
Da fasste ihre Hand ihn fest, zu fest, an seiner Schulter. Wieder hörte er seinen Namen: »Johannes, wach auf. Hast du die Glocke nicht gehört?«
Johannes gelang es nur mit Mühe, die Augen ganz zu öffnen. Dicht vor seiner Nase war das bleiche Gesicht von Theobald, dessen knöcherne Hand an Johannes’ Schulter rüttelte. Theobalds schmaler Mund verzog sich zu einem Lächeln. Johannes erschrak, fast hätten seine Lippen Theobalds Mund berührt. Da merkte Johannes, dass er mit beiden Armen einen dicken Pergamentcodex, der auf dem Schreibpult lag, umklammerte; sein Kopf lag auf dem aufgeschlagenen Buch, dessen leicht modriger Geruch seine Nase reizte.
Viel zu laut niesend, schreckte Johannes hoch und stieß dabei unsanft an Theobalds spitzes Kinn, der erschrocken zurückwich. »Ich muss wohl eingeschlafen sein«, entschuldigte sich Johannes.
»Ja, das musst du wohl«, bemerkte Theobald pikiert, »das passiert manchmal, wenn man zu sehr im Gebet versunken ist.«
»Im Gebet? Ich habe nicht gebetet«, entgegnete Johannes. Er versuchte, sich seinen Traum nochmals zu vergegenwärtigen, aber je mehr er in den Zustand des Wachseins gelangte, desto schemenhafter wurde die Erinnerung an das Traumbild.
»Du hast aber die heilige Maria Magdalena angerufen. Da dachte ich, du betest«, erwiderte Theobald, es lag ein beleidigter Unterton in seiner Stimme. »Die Glocke hat schon längst zur Vesper gerufen, ich wollte nur verhindern, dass du schon wieder zu spät zum Gebet kommst. Du weißt, unser Abt ist nicht so gut auf dich zu sprechen, und die Strafen fürs Zuspätkommen sind bei uns in Lützel sicher strenger als bei euch in Salem.«
Theobald machte auf dem Absatz seines Stiefels kehrt und verließ wortlos das Skriptorium. Johannes folgte ihm in den Kreuzgang, wo sich die anderen Brüder versammelt hatten, um zum Vespergebet in den Chor zu schreiten.
Theobald hatte recht, der Abt von Lützel, dem Mutterkloster Salems, war nicht gut auf Johannes zu sprechen seit ihrem ersten Zusammentreffen vor mehr als drei Jahren in Salem. Der Lützeler Vaterabt hatte sich damals mit seiner Delegation aus Lützel, der auch Theobald angehörte, einige Zeit in Salem aufgehalten. Damals hatten sich merkwürdige Ereignisse zugetragen, die Johannes aufzuklären versuchte. Einige Brüder waren zu Tode gekommen, ein lange Zeit verschwundenes Reliquiar war plötzlich wieder aufgetaucht. Für Johannes führte die Spur für des Rätsels Lösung nach Lützel, und Johannes verdächtigte gar den Vaterabt der Mitwisserschaft, was sich dieser jedoch vehement verbat.
Johannes klangen noch die harschen Worte des Vaterabts in den Ohren, er hatte die Zurechtweisung hinnehmen müssen und begegnete dem Vaterabt fortan mit der geforderten Ehrerbietung. Demut und Gehorsam, wie es von einem Mönch gefordert wurde, machte ihm die Aufgabe, weswegen er hierher nach Lützel gesandt worden war, doch etwas leichter.
Theobald, der Leiter des Lützeler Skriptoriums, betrachtete Johannes als einen wertvollen Ratgeber und Verbündeten: Beide wollten die Arbeit in den Skriptorien ihres Klosters verbessern und die Armarien, die Bücherschränke, zu regelrechten Bibliotheken ausbauen, wie sie etwa in einigen großen Klöstern der Benediktiner schon längst bestanden und nun auch vom Generalkapitel des Zisterzienserordens erlaubt, ja gewünscht wurden. So hatte Theobald für einen regen Austausch von Büchern zwischen Klöstern ihres Ordens gesorgt und Johannes, den Leiter des Salemer Skriptoriums, mit einigen seiner Schreiber nach Lützel eingeladen, um Schriften zu kopieren. Der Lützeler Abt hatte diesem Vorhaben trotz der Vorbehalte gegen Johannes zugestimmt, und auch Abt Stantenat von Salem hatte Johannes und die Brüder Jakob Roiber und Amandus Schäffer bereitwillig nach Lützel ziehen lassen – galt es doch von dem reichen Lützeler Bücherschatz zu profitieren.
Abt Stantenat verfolgte ein weiteres Ziel: Seit den Ereignissen um das verschwundene Reliquiar waren die Beziehungen Salems zum Mutterkloster Lützel durchaus angespannt gewesen. Johannes sollte die Möglichkeit bekommen, sich dem Lützeler Abt gegenüber als gehorsam zu erweisen und zugleich seine Fähigkeiten als kluger Organisator eines solch großen Vorhabens wie die Einrichtung einer Bibliothek unter Beweis zu stellen.
Schließlich sollte nach dem Plan von Abt Stantenat Johannes selber einmal, so er denn vom Konvent dazu erwählt wurde, dem Salemer Kloster als Abt vorstehen. Und dazu würde es einmal die wohlwollende Zustimmung des Vaterabts von Lützel brauchen.
Abt Stantenat war sich sicher, dass Johannes umso umsichtiger und pflichtbewusster dereinst seine Aufgabe in Salem ausfüllen würde, je mehr er von der Welt außerhalb der schützenden Klostermauern Salems gesehen und manch brenzlige Situationen tatkräftig gemeistert hätte.
Der Abt glaubte nicht, seine Brüder hinter Klostermauern einsperren zu müssen, um sie so vor Versuchungen zu schützen, sondern ganz im Gegenteil, sie diesen zu einem bestimmten Maß sogar auszusetzen, sodass sie ihnen aus freien Stücken widerstehen konnten und sie sich aus freiem Willen Gehorsam, Armut und Enthaltsamkeit verschrieben.
Das Risiko der freien Willensentscheidung konnte und wollte Abt Stantenat natürlich nicht bei jedem Bruder eingehen. Aber bei Johannes war es anders, blinder Gehorsam war nicht Johannes’ Sache und würde eher seine Fähigkeiten unterdrücken; je größer die Herausforderungen an ihn würden, desto willensstärker – da war sich Abt Stantenat sicher – würde Johannes werden, was der zukünftigen Entwicklung des Klosters Salem nur zugutekommen würde.
Nur bei einer Sache hatte der Abt Johannes’ Ehrgeiz, im Kloster Karriere zu machen, unterschätzt, als er Johannes zum Beichtvater der Patriziertochter Magdalena Reichlin machte. Zwar kannten sich Johannes und Magdalena schon von Jugend an, da Johannes vor seinem Noviziat im Hause der Reichlins als Schreiber diente; als sie sich nun wiederbegegnet waren, hatte sich zwischen beiden ein Band ernsthafter Zuneigung entwickelt. Hätte Johannes aus Liebe zu Magdalena seine Karriere im Kloster aufs Spiel gesetzt? Da war sich Abt Stantenat nun nicht mehr so sicher, und er meinte richtig zu handeln, wenn er die freie Willensentscheidung und – nun ja – vielleicht auch die göttliche Vorsehung in eine in seinen Augen richtige Richtung lenkte. Matthias Reichlin von Meldegg, Magdalenas Bruder, hatte in besonderen Angelegenheiten eine Reise nach Italien angetreten; und Abt Stantenat hatte dafür gesorgt, dass Magdalena ihren Bruder begleiten konnte. Das Band der Zuneigung zwischen Johannes und Magdalena, so war Abt Stantenat überzeugt, würde sich mit der Zeit lockern, wenn auch nicht durchschnitten werden, gerade so eng geflochten bleiben, wie es für einen Zisterziensermönch und zukünftigen Abt angemessen wäre. Denn selbst der Heilige Bernhard, der Ordensheilige der Zisterzienser, gönnte den Menschen, ob Laie oder Mönch, tiefe Zuneigung und Liebe zueinander. Doch schrieb Bernhard körperliche Askese in jeder Hinsicht vor, um die Seele zu retten. Da hatte Abt Stantenat eben eingegriffen, um wenigstens zwei Seelen zu retten. Von dessen Absichten wusste Johannes nichts, als er sich im Kreuzgang von Lützel in die Prozession der Mönche einreihte, die, den Introitus anstimmend, gemeinsam in die Kirche zum Vespergebet einzogen.
Johannes war schon einige Tage in Lützel, doch er hatte sich noch nicht so recht an die Umgebung gewöhnen können. Das Kloster war so gebaut wie zu Anfangszeiten des Zisterzienserordens. Die Klausur war strenger als in Salem, seit seiner Ankunft hatte Johannes die Klostermauern kein einziges Mal verlassen können, obwohl ihm ein Spaziergang in den bewaldeten Hügeln rund um das Kloster gutgetan hätte. Die Konversen, die zur körperlichen Arbeit verpflichteten Laienbrüder des Klosters, lebten wie in früheren Zeiten in einem eigenen Anbau, mit eigenem Speisesaal und Dormitorium, der streng von den Mönchen abgetrennt war. So etwas gab es in Salem nicht mehr, der Konversentrakt und die strenge Absonderung der Laienbrüder war in Salem schon länger aufgegeben worden, wie auch Abt Stantenat durch viele Umbauten und Lockerungen sowohl für die Mönche als auch Konversen und andere Klosterbedienstete für allerlei Annehmlichkeiten im beschwerlichen Klosterleben sorgte.
Hier in Lützel – das machte Johannes am meisten zu schaffen – schliefen die Mönche alle zusammen in einem riesigen Dormitoriumssaal, die Lager der Mönche waren nur durch dünne Leinenvorhänge abgetrennt. In Salem hatte schon seit Jahrzehnten jeder Bruder seine eigene Zelle, was dem friedlichen Zusammenleben im Kloster nur zugutekam, wie Johannes nun feststellte.
In Lützel gab es zwischen den Brüdern allerlei unterschwellige Animositäten, Sticheleien, ja gelegentlich sogar Handgreiflichkeiten, wenn sich einer der Brüder in den Augen eines anderen ungebührlich verhalten hatte. Dem meinte der Lützeler Abt nur durch ein strenges Regiment und eine harte Hand Einhalt gebieten zu können. Bei den täglichen Sitzungen im Kapitelsaal war es üblich, was in Salem schon längst abgeschafft war, dass Brüder wegen größerer oder kleinerer Verfehlungen vor der versammelten Mönchsgemeinschaft körperlich gezüchtigt, ja sogar ausgepeitscht wurden.
Ein Bereich, in den sich der Lützeler Vaterabt nicht einmischte, war das Skriptorium. Theobald genoss offenbar das Vertrauen des Abtes, der ihm freie Hand ließ. So verbrachte Johannes seine Zeit gerne im Skriptorium, um sich mit Theobald und den anderen Schreibermönchen auszutauschen. Dort arbeitete er zusammen mit seinen Salemer Brüdern Jakob und Amandus an der Abschrift zahlreicher Bücher, um den Salemer Bestand zu erweitern. Amandus, ein schüchterner junger Mönch mit hellem Verstand, wurde nicht nur wegen seiner schönen Schrift, sondern auch wegen seiner kunstvollen Buchmalerei sehr geschätzt. Jakob, einige Jahre älter als Amandus, war ein akribischer Schreiber, der keine Fehler durchgehen ließ. Mit den beiden hatte Johannes die Begabtesten der Salemer Schreibstube an seiner Seite. Aber außerhalb des Skriptoriums war es den Salemer Brüdern nicht gestattet, miteinander in Kontakt zu treten oder auch nur ein paar Worte zu wechseln – schon gar nicht bei den Mahlzeiten.
Seit der Ankunft in Lützel hatte Johannes auch seinen Freund Hans von Savoy nicht mehr zu Gesicht bekommen. Hans war mitgereist, um sich mit dem Lützeler Magister operis, dem Baumeister, zu verständigen, wie man wohl am besten ein Bibliotheksgebäude plante und ausstattete. Denn die alten Bauvorschriften des Ordens, die festlegten, wie ein Kloster auszusehen hatte, über welche Gebäudetrakte ein Kloster verfügen sollte, hatten noch keine eigenen Bibliothekssäle vorgesehen. Für die wenigen Bücher, die man zum Gottesdienst oder zur Unterweisung der Brüder brauchte, reichten ein paar Bücherschränke nahe der Sakristei oder im Skriptorium aus. Auch die Skriptorien waren gewöhnlich kleine Stuben, die keinen Platz für große Bücheransammlungen hatten. Eben weil sie klein waren, waren sie oft beheizbar, um den Schreibern die Arbeit ein wenig zu erleichtern. Nur nicht in Lützel: Derartige Annehmlichkeiten ließ der Lützeler Abt nicht zu, und so fror Johannes wie die anderen Schreibermönche im Skriptorium, das jetzt im Spätwinter nur wenige Stunden durch das einfallende Sonnenlicht erwärmt wurde.
Kaum angenehmer war das Arbeiten der Konversen und Bediensteten im Konversentrakt, wo Hans Quartier bezogen hatte und tagtäglich mit dem Magister operis zusammensaß. Die Konversen scherten sich allerdings wenig um die strengen Regeln in der Klausur, und so fanden sich in der Kohlsuppe stets ein gutes Stück geräucherter Speck, Fischköpfe oder Hühnerbeine. Von innen wärmte ein erhitzter und gewürzter Wein.
Das Amt des Magister operis, der alle Bauarbeiten zu verantworten hatte und meist von einem handwerklich ausgebildeten Konversen ausgeübt wurde, war in Salem schon vor einigen Jahren aufgegeben worden. Seither war Hans von Savoy, als Steinmetzmeister wie seine Vorfahren in Salem tätig, von Abt Stantenat mit allen Bau- und Renovierungsarbeiten in Salem betraut. Hans konnte sich noch gut erinnern: Der alte Magister operis in Salem, Petrus mit Namen, war damals, als die merkwürdigen Ereignisse das gesamte Kloster in Atem hielten, unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Ob Petrus durch einen Unfall oder die Hand eines Mörders gestorben war, konnte trotz Johannes’ akribischer Nachforschungen nie ganz aufgeklärt werden. Und obwohl Hans und Johannes von Kindesbeinen an befreundet waren, mochte oder durfte Johannes sein Wissen vor Hans nicht preisgeben.
Im Gegensatz zu Petrus, der ein aufbrausender Geselle gewesen war, war der Lützeler Magister operis ein umgänglicher Mann, der sein Handwerk verstand. Hans hatte in kurzer Zeit schon viel von ihm lernen können, zumal der Magister operis weit herumgekommen war und viele burgundische Zisterzienserklöster aus eigener Anschauung kannte.
Hans erhoffte sich von den Lützeler Brüdern einige Anregungen für den Neubau eines großen Bibliotheksgebäudes, wie es sich Abt Stantenat für Salem wünschte. Die vielen Pläne und Zeichnungen, die der Magister operis aus dem Burgund mitgebracht hatte und die sie nun gemeinsam eifrig studierten, konnten für das Salemer Vorhaben nur von Vorteil sein. Im regen Austausch ihrer Ideen und Entwürfe kamen die beiden Baumeister mit ihren Planungen rasch voran.
In Salem
Kloster Salem, im März 1489
Abt Johannes Stantenat saß in seinem Lehnstuhl am Fenster, als Jodokus Ower ins Audienzzimmer trat. Erst vor wenigen Jahren war das Abteigebäude, in dem der Abt residierte, neu gebaut und doch recht nobel ausgestattet worden. Die Klosterwirtschaft gedieh prächtig, sodass man einen Teil der Einkünfte nicht nur in die Gott wohlgefällige Ausschmückung der Kirche, sondern auch in die Renovierung der Klostergebäude steckte. Nach Abt Stantenats Vorstellungen, die in so manchen Fällen von denen des Generalkapitels in Citeaux abwichen, das sich noch sehr an die strengen Vorgaben des Heiligen Bernhard hielt, sollte ein Kloster nicht einem schmutzigen Bauernhof gleichen, sondern schon äußerlich seine Bedeutung erkennen lassen. Salem war schließlich eine freie Reichsabtei, Schutzherren waren der Kaiser und der Papst, und der Abt war im Rang einem Bischof gleichgestellt – auch wenn der Konstanzer Bischof das nicht wahrhaben wollte. Mit den neuen, zwar nicht übertrieben prächtig, aber doch gediegen ausgestatteten Gebäuden wie dem neuen Refektorium, dem Abteigebäude mit den Empfangs- und Gästezimmern war man vor einigen Jahren sogar in der Lage gewesen, den Kaiser höchstpersönlich mitsamt weiteren hochrangigen Gästen zu beherbergen.