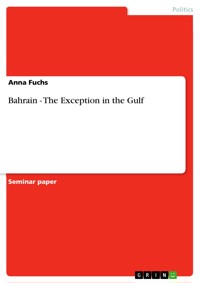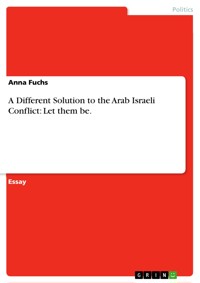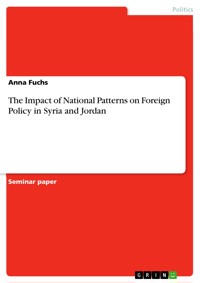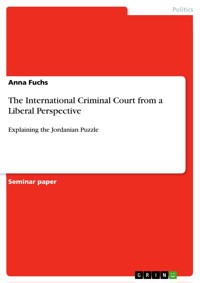Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Johanna Maipelt
- Sprache: Deutsch
Wien im späten Mittelalter. Schnepfen, Dirnen, Hübschlerinnen, alle tragen es als Erkennungszeichen: das gelbe Achseltuch. Doch Johanna Maipelt, eine in die Jahre gekommene freie Tochter Wiens hat genug von den Männern und möchte ihren Lebensabend im Büßerinnenkloster St. Hieronymus verbringen. Sie staunt nicht schlecht, als ihr die Stadtwachen ein verschrecktes Mädchen bringen und behaupten, es handle sich um eine Hure. Doch „Hannerl“ weiß es besser und versucht das Geheimnis auf ihre grantige Art und Weise zu lüften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Fuchs
Das gelbe Hurentuch
Hannerl ermittelt
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Die vier Elemente: Luft«
von Joachim_Beuckelaer 1570; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joachim_Beuckelaer_-_The_Four_Elements_-_Air_-_WGA02109.jpg
und »Wien aus der Schedel’schen Weltchronik« von Michel Wolgemut / Wilhelm Pleydenwurff 1493; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_chronicles_f_098v99r_1.png
ISBN 978-3-8392-4236-0
Dramatis Personae
Hauptpersonen
Johanna Maipelt Eine Kennerin der Liebe, der Männer und der Essigrezepte. Es gibt wenig Neues, das man ihr bei allen drei Dingen erzählen könnte.
Barthel Ein verliebter Hauerknecht, der zwar nicht mehr viele Zähne im Mund, fast keine Haare am Kopf, aber viel Herz in der Brust hat.
Gretlin Die wohl erste und einzige Jungfrau in einem Kloster für büßende Dirnen, die zwar herrlich mit einer Sticknadel, aber weniger mit dem wirklichen Leben zurechtkommt.
Alexander von Randegg, genannt Sander Ein ganz und gar verzogener Adelsspross, der im rauen Norden nicht nur seine südländische Weichheit, sondern vor allem sein Herz verliert.
Ewald von Wolkenberg Ein rotzfrecher, ewig lustiger Schelm, der das Augenzwinkern erfunden hat und zu jeder Katastrophe ein Lied dichten kann.
Büßerinnen und Schwestern im Kloster Sankt Hieronymus
Meisterin Cäcilie Deren starker Hang zur Habgier im krassen Gegensatz zu ihrer schmächtigen Erscheinung und ihrem dünnen, faltigen Hals steht.
Yrmel Eine unentbehrliche Helferin in der Klosterküche, der eine schlechte Erfahrung die Stimme gekostet hat und die sich seitdem viel besser ohne Worte verständlich macht.
Marlen Eigentlich Magdalena Apolonia, Schwester des Ordens der Magdalenerinnen, die trotz ihrer Jugend und Schwatzhaftigkeit mehr über das Leben zu wissen vorgibt als ihr guttut.
Meisterin Susanna Eine Art Schutzmantelmadonna, die Johanna vor den Folgen ihrer eigenen Dreistigkeit bewahrt.
Agnes Eine Pförtnerin, die gute Gedanken ins Kloster lässt, die schlechten draußen aussperrt.
Martha und Wuckerl Arbeitsame Büßerinnen im Kloster
Historische Personen
Margarete (1318 – 1369) Gräfin von Tirol
Albrecht III. mit dem Zopf (1349 – 1395) Herzog von Österreich
Beatrix von Hohenzollern (1362 – 1414) Seine zweite Gattin
Burggraf Friedrich von Nürnberg (1333 – 1398) Schwiegervater von Albrecht III. und Vater von Beatrix
Katharina Äbtissin im Kloster der Klarissen, Schwester von Albrecht III.
Personen am Habsburgerhof
Hofbedienstete
Truchsess Michael von Puchheim
Jägermeister Mathis von Kreusbach
Marschall Ewalt von Maissau
Hofmeister Johann von Fichtenstein
Gäste des Hofes
Bernhard von Randegg Patriarch von Aquileia
Ulrich von Schaunberg Oberhaupt des Grafengeschlechtes Schaunberg aus Eferding
Heinrich von Schaunberg sein Sohn
Adalbert von Winklern Bischof von Passau
Die Herren von Wallsee
Die Herren von Rosenberg
Im Frauenhaus bei der Laimgrube
Elsbeth Eine Dirne, deren Gemüt für diesen Beruf viel zu weich und mütterlich ist.
Dorthe Eine erfahrene Hübschlerin, die kein Mann aus der Ruhe bringt.
Fronika Die stark mit dem Zahn der Zeit zu kämpfen hat und fast ohne Gebiss auf Männersuche geht.
Ursel und Trude Freie Töchter, die am liebsten zeigen, was sie haben und das, was sie nicht haben, vortäuschen.
Merckel Ein Frauenwirt, der gern selbst seine Ware testet, bevor er sie auf die Straße schickt.
Die minderen Brüder
Konrad von Schaunberg
Pater Niclas
Pater Alfons
Das Wiener Volk: Fratschlerinnen, Händler, Hauerknechte und Würdenträger
Paul Holzkäufl Bürgermeister von Wien, der selbst den freien Töchtern Respekt zollt
Barbel Kräuterweibel und Wahrsagerin, die mehr von Geld und weniger von ihren eigenen Voraussagen hält.
Jobst und Krispin Die schwere Fässer Wein durch die Stadt schleppen und dabei auch so manch anderes in Erfahrung bringen.
Ignaz Mitterlehner Der Henker, der besonderes Augenmerk auf sein Äußeres legt und sich in einen fahrenden Sänger verliebt.
Valentin Frühauf Der Stadtrichter, dem schon so einiges untergekommen ist.
Weinberl
Eine räudige Hündin, die aus der Gosse vor das warme Feuer in der Klosterküche geflüchtet ist, Mut wie eine Löwin und Beharrlichkeit wie ein eingetretener Reißnagel besitzt.
Alle Personen und Handlungen dieses Romans sind, bis auf einige historische Anleihen, frei erfunden.
Die genaue Alltagssprache der Menschen vor unserer Zeit ist schwer rekonstruierbar. Anzunehmen ist, dass man in Wien – so wie bis heute – regional gefärbte Formulierungen verwendet hat. Um allen deutschsprachigen Lesern, den Sinn der oft abenteuerlichen Wortspielereien erklärbar zu machen, sind in vielen Fällen Fußnoten mit einem hochdeutschen Text angefügt. Diejenigen Leser, die mit der Wiener Lebensart bereits vertraut sind, mögen sich nicht aufhalten lassen und diese getrost überlesen!
Wien, das ist des Lobes wert,
Da findet man Roß und Pferd.
Großer Kurzeweile viel,
Sagen, singen, Saitenspiel.
Das findet man zu Wien genug.
Hübschheit und Ungefug.1
1 Freudenleere, der, sprechender Name eines ostmitteldeutschen Dichters, verfasste um 1280 den gegen die aufstrebenden Wiener Patrizier gerichteten Schwank »Der Wiener Meerfahrt«, eine frühe Heurigengeschichte, in der die Zecher ihre Trunkenheit als zunehmend stürmischere Seereise erleben.
Erster Teil
Burg Walbenstein, im Jahr des Herrn 1363
Das markerschütternde Schreien der Gebärenden, das nun schon die zweite Nacht von den dicken Mauern der Burg widerhallte, ging langsam in ein raues Wimmern über.
Der Gesandte des Kaisers wusste nicht, was ihm mehr zusetzte, das offensichtliche Leiden der jungen Frau oder die Gewissheit, dass ihre Kräfte langsam schwanden und sie sich bereits im Dunkel zwischen Leben und Tod befand. Blass und nachdenklich stand der hochgewachsene, kräftige Mann neben dem bequemen Sessel, den man ihm ins Schlafzimmer der jungen Frau gestellt hatte. Er konnte nicht mehr sitzen, fahrig strich er sich mit der rechten Hand durch seinen sorgfältig gestutzten Kinnbart. Der eckige, mit einem Amethyst versehene Bischofsring blitzte kurz im Schein der unzähligen Kerzen, die von den Dienstboten scheinbar lautlos immer wieder ersetzt wurden, sobald sie heruntergebrannt waren. Selbst am helllichten Tag kam nur wenig Licht durch die kleinen, mit Butzenscheiben verglasten Fenster, und jetzt, zwei Stunden nach der Vesper, war es draußen bereits dunkel. Es war warm im Zimmer, das Feuer im Kamin brannte lichterloh, und die Luft war zum Schneiden stickig.
Schweißperlen hatten sich auf der Stirn der Wehmutter gebildet, das Weiß ihrer Leinenhaube, das ein älteres, gutmütiges Gesicht mit lebhaften braunen Augen umrahmte, war fleckig und feucht. Stunden schon verbrachte sie am Bett der Gebärenden, schwankte zwischen beruhigendem Zureden und aufmunternden Worten. Mittlerweile war ihr die Verzweiflung anzusehen, und immer wieder trafen sich die angstvollen Blicke der stämmigen Frau mit denen des Gesandten. Beide wussten, dass die Lage aussichtslos war und beiden graute vor dem, was da noch kommen sollte.
Wieder kam eine Wehe wie eine schmerzvolle Welle, und gleich blutroten Schaumkronen ergoss sich ein weiterer Schwall Blut auf die auf dem Bett ausgebreiteten Laken. Die Gebärende schrie heiser auf. Ihr Leib krümmte sich und sie zitterte.
»Agnes, du musst mitpressen, Mädchen, so wird das nichts, komm meine Liebe, mein Augenstern …«
Der Gesandte hörte nur zu deutlich die Panik in der Stimme der Wehmutter mitschwingen, und er verfluchte den Tag, der ihm diesen Auftrag beschert hatte. Er schalt sich selbst, seines Ehrgeizes wegen die Bürde auf sich genommen zu haben und Zeuge bei dieser Geburt sein zu müssen.
Was tat er hier eigentlich, auf der einsamen Burg, hoch auf einem Felskopf? Lächerlich klein war die Anlage. Die Ringmauern nur etwas mehr als einen Meter dick, nicht einmal einen Bergfried gab es. Vom Wohngebäude, dessen Fensteröffnungen mit dicken Butzenscheiben versehen waren, sah man auch, warum ein Turm hier gar nicht notwendig war. Die Burg war so hoch gelegen, dass man schon von hier einen weiten Blick über das Sarntal hatte. Es war schlicht unmöglich, sie mit schwerem Kriegsgerät einzunehmen. Erst einmal musste der steile Saumweg hier herauf bezwungen werden.
»Eine gute Wahl, denn hier herauf kommen nicht so leicht ungewollte Besucher«, dachte der Bischof und rief sich jene Szene vor wenigen Tagen ins Gedächtnis, wo er der Gräfin am Hof von Meran gegenüberstand, um die Anweisungen der hohen Frau entgegenzunehmen. Die schlanke Gestalt in einem engen Kleid aus golddurchwirktem Stoff mit schwarzen Arabesken bestickt, duldete keinen Widerspruch. Entschlossen war ihr Blick aus stahlblauen Augen, gerade und ebenmäßig ihr Antlitz, das von einem purpurroten Schleier, der über die schmalen Schultern bis zum Boden fiel, eingerahmt war. Fassungslos wurde er sich in diesen Minuten bewusst, welche Prüfung ihm da bevorstand, wollte er bestehen und weiterhin als einer der verlässlichsten Diplomaten seines Kaisers gelten.
Mit unbeteiligtem, gefährlich ruhigem Ton sprach die Gräfin von dem, was er hier auf der versteckten Burg im Sarntal, auf hohem Felsen zwischen Bozen und Meran erbaut, für sie zu erledigen hatte. So ruhig sprach sie, so ohne Gefühl, als ginge es um irgendeinen willkürlichen Auftrag.
»Aber es ist nicht irgendein Auftrag, der Himmel möge mir beistehen, es geht schließlich um ihre eigene Tochter, die sich hier krümmt und schreit …«, lautlos formte der Bischof die Worte, lief auf und ab und versuchte, nicht in das Innere des hohen Bettes zu sehen, nicht hinter die halb zugezogenen Vorhänge zu blicken, wo Agnes erneut mit einer Welle anrollenden Schmerzes fertigwerden musste. Aber natürlich würde er wieder auf das schmerzverzerrte Gesicht blicken müssen, auf den sich windenden Körper, der unter einem großen Tuch verborgen war und dessen Inneres nur für die Wehmutter zu sehen war. Immer wieder prüfte sie den Muttermund, horchte am Bauch und schüttelte kaum merklich den Kopf.
Die kommende Wehe quälte den geschundenen Leib mit aller Macht, der nächste Schwall Blut tränkte die Laken. Die Wehmutter entfernte mit einem Ruck das Leinen, warf es achtlos zu Boden, breitete neues auf, schickte die Magd, die vor der Tür wartete, forsch und ungehalten um neues Wasser, redete beruhigend auf Agnes ein, tastete vorsichtig zwischen den Beinen der Gebärenden und schüttelte wieder verzweifelt den Kopf. Das Antlitz der jungen Frau Agnes war grau, die blonden Locken dunkel und verschwitzt am Kopf klebend. Sie verschwand in ihrem hohen Kopfkissen fast, und nur ganz leise hörte man ihr Röcheln, als der Schmerz langsam wieder abklang.
»Sie ist schon zu schwach und hat zu viel Blut verloren«, murmelte die Wehmutter und fuhr sich über das einfache graue Kleid aus dickem Wollstoff und die vorgebundene Leinenschürze, die mit Blutflecken übersät war. Mehr zu sich selbst, als zum anwesenden Bischof sagte sie: »Ich brauche meine Gerätschaften, wenn ich das Kind noch retten will, sie schafft es einfach nicht, es allein herauszupressen, es liegt verkehrt und kommt nicht vor und nicht zurück … ich kann es mit bloßen Händen nicht drehen …«
Fragend, wie um Zustimmung bittend, sah sie den hohen Herren, der rastlos auf und ab ging, an.
»Tu Sie, was getan werden muss«, antwortete dieser rau und wandte sich abrupt ab. Nein, um nichts in der Welt wollte er mit eigenen Augen sehen, wie diese verlässliche Frau die Marterwerkzeuge wer weiß wo einführte, den Kopf des Kindes zu fassen versuchte, um dann mit der nächsten Wehe dieses kleine Wesen ein Stück weiter durch den Geburtskanal zu ziehen. Nein, er war wirklich nicht der geeignete Mann, um dieser Szene beizuwohnen. Er wollte nicht wissen, wie das Kind lag, wer wo wie etwas drehen oder pressen musste. Ihm war die ganze Situation von Grund auf widerlich, barbarisch, und er fühlte sich fehl am Platz und überfordert. Warum nur hatte die Gräfin ausgerechnet ihn ausgesucht? Nicht nur, dass er ein Mann der Kirche war, dass er unverheiratet war, dass er Frauen in dieser Situation gar nicht sehen wollte, er war auch noch viel zu empfindsam. Ihn drangsalierte dieses heisere Schreien über alle Maßen, er musste seine schweißnassen Hände über die Augen legen und sich auf seinen rot gepolsterten Sessel aus Nussholz setzen, um die aufsteigende Übelkeit und den Schwindel, der ihn plötzlich erfasste, zu unterdrücken.
Wie lang noch muss ich mir diese Marter anhören, dachte er verzweifelt.
Kurz nahm er die Hände von den Augen. Er saß hinter der Wehmutter und konnte nur ihr konzentriertes Atmen und das grausame Klacken der Geburtszange hören. Sehen konnte er nur den linken Arm von Agnes, deren Haut wächsern und deren Finger unnatürlich verkrampft die Laken umklammerten.
Eine tiefe Traurigkeit überkam ihn, als er das Amulett aus Adlerstein an ihrem Handgelenk sah. Er wusste, was es zu bedeuten hatte. Verbunden mit einem innigen Gebet sollte es Schwangeren eine sanfte Geburt bescheren. Er stellte sich die blondgelockte, zierliche junge Frau vor, wie sie noch vor gar nicht langer Zeit hoffnungsvoll ihren Bauch umfasste und zur Jungfrau Maria betete …doch nach über 24 Stunden Geburtsschmerzen, nach jeder Wehe, die ein weiteres Stück ihres noch so jungen Lebens verzehrte, hatte die liebe Gottesmutter wohl anderes mit ihr vor.
»Er weiß, was Er zu tun hat in allen möglichen Fällen …« Hart drang die Stimme der Gräfin aus der Erinnerung an das Ohr des Bischofs. Wie benommen leierte er im Geiste herunter, was sie ihm gesagt hatte.
»Sollten beide nicht überleben, dann ist das Problem ein kleines«, begann sie, und er fühlte noch jetzt, wie sehr ihn schon dieser erste Satz erschütterte und sein Mitleid mit Mutter und Kind sein Herz beengte. Nie hätte er dieser eleganten Erscheinung eine solche Kaltschnäuzigkeit zugetraut. Aber es sollte noch viel schlimmer kommen.
»Wenn Mutter und Kind wohlauf sind, dann soll Er sie mit der Wehmutter nach Bozen bringen. Es wird dort für sie gesorgt werden, und Er ist entlassen …«
Das wäre wohl die beste Lösung, dachte der Bischof, sah zum Bett, wo die Wehmutter verzweifelt werkte, und schüttelte den Kopf.
»Stirbt das Kind«, hörte er weiter den Widerhall der Stimme »kommt Agnes nach Meran. Er wird dann alle Vorkehrungen treffen, dass sie gesund und vor allem ungesehen von dieser Burg herunterkommt. Er ist mir dafür im Wort …«
Scharf sog der Bischof die Luft ein, als er an den letzten Teil der Anweisungen dachte:
»Stirbt die Mutter, dann …«
Wieder erfasste ihn eine Welle der Übelkeit, und er wusste nicht recht, ob es an der stickigen Luft, dem Geruch von Blut, dem immer schwächer werdenden Wimmern oder an der Unerschütterlichkeit der Gräfin lag. Er sah sie vor sich stehen, schön, vornehm, unnahbar und unerbittlich.
»Stirbt die Mutter, dann …«
Noch fühlte er seine Bestürztheit, wie er die Gräfin zu einer reich mit Schnitzereien verzierten Truhe schreiten sah, wie sie mit ihren schlanken Fingern ein meterlanges besticktes Band herauszog. Der golddurchwirkte Stoff schimmerte sanft im Kerzenschein, die schwarzen aufgenähten Adler glänzten dunkel, und die Emailleplättchen funkelten. Der Bischof wusste, dass es wenige so kostbare Stücke wie dieses gab, und war sich sicher, dass er es mit einem wahrlich kaiserlichen Attribut zu tun hatte. Zu exakt waren die Stickereien, zu prachtvoll das Emaille, zu golden die Seide. Er hielt damals vor Spannung die Luft an und wagte fast nicht mehr, weiter zu atmen, als er sah, was die Gräfin mit diesem Kleinod an Handarbeitskunst anstellte. Einmal nur ließ sie die Stola durch ihre Finger gleiten und der Bischof meinte gesehen zu haben, wie ihre Unnahbarkeit Risse bekam, wie ihr Antlitz für einen Moment wie von innen erleuchtet schien. Umso mehr erschreckte ihn dann die abrupte Bewegung der hohen Frau. Fassungslos starrte er auf ihre Hände, die mit einem festen Griff die wunderschöne Stola fassten und nach einer geeigneten Stelle tasteten. Fast körperlich fühlte er den Schmerz, als die Seide mit einem hohen Ton nachgab und riss. Er konnte kaum mit ansehen, wie achtlos das kleinere, etwa eine Elle lange Stück schlampig und geknittert in einen Lederbeutel gestopft wurde, und der viel längere, übrig gebliebene Teil dieser Stola achtlos in die Truhe geworfen und diese mit einem lauten Klappen geschlossen wurde. Selbst jetzt in diesem dunklen heißen Zimmer, weit weg von der Gräfin, spürte er ihren brennenden Blick, als sie seine Trauer über das zerstörte Kleinod sah. Sie schwenkte fast triumphierend den Beutel vor seinem Gesicht und setzte in ihrer ruhigen Stimme wieder an, als hätte es diesen Anfall von Zerstörungswut nie gegeben:
»Stirbt die Mutter, Herr Bischof, dann …«
Er wagte es nicht, sich den ganzen Satz in sein Gedächtnis zu rufen, denn er wusste, nur noch eine geringe Zeitspanne und er würde dafür sorgen müssen, dass die Anweisungen der hohen Frau erfüllt würden.
Das neuerliche Wehklagen von Agnes war nicht mehr menschenähnlich, als die Wehmutter mit der nächsten Wehe den Steiß des Kindes herauszog. Doch Arme, Beine und vor allem der Kopf steckten noch fest. Es hörte sich wie Winseln und Jammern eines bis zur Grenze gemarterten Tieres an. Dann schwoll das Wimmern zu einem Schrei an, immer lauter, immer schriller. Die Wehmutter, die vor Kurzem noch geschluchzt hatte und deren Unterarme voll Blut waren, werkte mit ausdruckslosen Augen, weit entfernt jetzt von jeder Anteilnahme, wie unter Trance versuchte sie zu retten, was noch zu retten war. Der Bischof begann still zu beten, um nicht gänzlich die Kontrolle über sich zu verlieren. Zu unmenschlich, zu barbarisch war das, was er mit ansehen musste. »Nein, nein, nein«, schrie es in seinem Kopf, »Ich kann nicht mehr. Mein Gott, ich bin nicht der Richtige, das hier zu bezeugen und zu Ende zu führen …«
Plötzlich war es still. Kaum hörbar vernahm der Bischof die geflüsterten Worte der Wehmutter:
»Agnes, vergib mir. Ich konnte dir nicht mehr helfen. Friede deiner Seele.« Damit wandte sie sich mit Schluchzen dem blauen, mit Blut beschmierten Bündel zu, das sie aus der gemarterten jungen Frau gezogen hatte. Kein Laut erfüllte die Stille. Mit Bangen sah der Bischof, wie die Wehmutter den Säugling, der noch immer an der Nabelschnur hing, mit dem Kopf nach unten baumeln ließ. Dann schlug sie sanft auf das Hinterteil des Kindes. Ein Krächzen war zu hören, das dann in ein Gurgeln überging. Erleichtert drehte die Wehmutter das Kind um, sprach besänftigend auf das kleine Wesen ein, während sie die Nabelschnur durchschnitt und die Verbindung zur toten Mutter endgültig trennte. Dann deckte sie die Mutter mit einem sauberen Tuch zu und nickte kurz in die Richtung des hohen Herrn.
Der Bischof trat nun nahe an das Bett der toten jungen Frau, schloss die Lider in diesem viel zu jungen, von den erlittenen Schmerzen gezeichneten Gesicht. Bevor er ihr die Letzte Ölung gab, strich er eine der schweißnassen Locken von ihrer Wange und schalt sich augenblicklich selbst wegen dieser unangebrachten Gefühlsregung.
Ich kann nicht mehr, dachte er wieder und war sich bewusst, dass das erst der Anfang einer Katastrophe war, deren Ausmaße er sich jetzt noch gar nicht ausmalen wollte. Die Mutter war tot, das Kind lebte offensichtlich. Der schwierigste Fall war eingetreten. Unabänderlich. Er musste handeln, wie es ihm aufgetragen war. Nach seinem Gebet und seinem Segen deckte er Agnes zu und sah zur Wehmutter, die sich auf einem vorbereiteten Tisch mit weichen Tüchern zu schaffen machte. Aus einem bereitstehenden Tonkrug schüttete sie warmes Wasser in einen kleinen Holztrog, setzte ein paar Tropfen Öl dazu und begann das Kind mit einem Lappen vorsichtlich zu waschen.
Verstohlen sah der Bischof zum Neugeborenen. Es hatte den Kopf unnatürlich in die Länge gezogen, die Stirn war flach, die Augen von der anstrengenden, viel zu langen Geburt rot unterlaufen. Die Fingerspitzen waren blau, die kleinen Zehen und die Nasenspitze ebenfalls. Schwer konnte sich der Bischof vorstellen, dass dieses Wesen lebensfähig war. Augenblicklich keimte eine Hoffnung in ihm, dass vielleicht auch das Kind sterben könnte, und er dann der Gräfin nur den Tod von Mutter und Kind mitteilen musste – und fertig. Doch sofort schämte er sich seiner Gedanken, die ihm seine Feigheit eingaben. Nie würde er diese Sünde auf sich laden können, dieses noch so schwache Leben auszulöschen.
»Aber wie steht es dann um das, was du noch zu tun hast«, drängte sich ihm sein Gewissen auf, »das ist keine Sünde, nein?« Mit einer fahrigen Bewegung über seinen Hals wischte er die Gedanken weg.
Inzwischen hatte die Wehmutter unter leisem Schluchzen die Nabelschnur fein säuberlich abgebunden und sie mit Leinenstreifen, die in Olivenöl getaucht worden waren, um den kleinen Bauch gebunden. Nun machte sie sich daran, das Kleine mit einem warmen, weichen Tuch sorgfältig abzutrocknen. Zärtlich reinigte sie Ohren und Nase und gab einen Tropfen Öl auf jedes Auge. Unter Tränen wickelte sie den Säugling, beugte sich zu ihm und flüsterte: »Genauso hab ich es damals mit deiner Mutter gemacht«, dann brach ihr die Stimme, und sie schluchzte erneut auf.
Der Bischof wandte sich abrupt ab.
Warum nur, Herr, musste ich auch noch das mit anhören? Warum präsentierst du mir diese Frau als rechtschaffen, tüchtig und wertvoll?
Er krampfte seine Hände zusammen und blickte ausdruckslos ins Kaminfeuer. Es gab kein Zurück mehr, er wusste, dass der letzte, grausame Akt dieser Tragödie angebrochen war. Der Hauptdarsteller war er selbst.
Die Wehmutter wickelte mit geübten Handbewegungen die Glieder des Kindes, um ihm einen guten Wuchs zu sichern, die kleinen Arme, die Beinchen und sogar den Kopf. Dann zog sie es an und legte den Säugling behutsam in die vorbereitete Wiege. Lächelnd sah sie es noch einmal an, bevor sie sich dem Bischof zuwandte und meinte:
»Die Taufe wird wohl am Hof von Meran stattfinden!«
»Ja, in Meran«, murmelte der Bischof und fasste hinter seinem Rücken mit beiden Händen einen massiven Schürhaken, den er kurz zuvor unbemerkt vom Kamin genommen hatte.
»Wenn die Mutter stirbt …«, schrie es fast in seinem Kopf, »muss Er sich dafür verbürgen, dass keine Spuren hinterlassen werden, keine, versteht Er das? Ich meine wirklich nicht der kleinste Hinweis, dass ein Kind überlebt haben könnte, und vor allem … keine Zeugen!«
Die Wehmutter drehte sich wieder beflissen zur Wiege, und in diesem Moment atmete der Bischof tief ein, hob den Schürhaken hoch empor und schlug der Frau mit voller Wucht auf den Hinterkopf. Erstmals in seinem Leben war er froh, ein Mann zu sein, der über genügend Kraft verfügte. Froh für sich und vor allem froh für die arme Frau, die lautlos vornüber sank, und deren Oberkörper halb in der Wiege zum Liegen kam. Sofort färbte sich die Überdecke, mit der der Säugling zugedeckt war, rot mit Blut.
»Blut, Blut, nichts als Blut«, wimmerte der Bischof, zog, von plötzlicher Panik übermannt, die Leiche der Wehmutter weg und ließ sie zu Boden sinken. Er atmete durch, riss die blutige Überdecke weg und fasste das kleine Kind sanft mit denselben Händen, die kurz zuvor den Schürhaken geschwungen hatten. Er drückte den Säugling an sich, wickelte ungeschickt ein langes Tuch über seinen eigenen Oberkörper und das Kleine, nestelte an einem einfachen Knoten herum und breitete den schweren Bischofsmantel darüber. Mit einer Hand hielt er das Gesäß des Säuglings, mit der anderen griff er zum Türknauf.
Sein Blick schweifte noch einmal über das Zimmer, wo in den letzten Stunden das Grauen gewohnt hatte. Er sah die Gestalt im Bett und die zweite am Boden liegen mit einem faustgroßen Loch im Kopf. Dann hielt ihn nichts mehr. Wie von tausend Teufeln gejagt stürzte er die Treppe hinunter, ließ sein Pferd satteln und nickte dem gedungenen Diener zu. Der Bischof war sich sicher, dass der treu Ergebene alle Spuren verwischen würde, und der Burgherr selbst, der ja schon bald zurückerwartet wurde, nicht das Geringste ahnen würde. Alles Menschliche würde schweigen, und die dicken Mauern würden die Geschehnisse der letzten zwei Tage verschlucken.
Bewegungslos lag der Säugling im Tuch festgebunden, hatte sein kleines Köpfchen an die breite Brust gepresst, und der Bischof ertappte sich dabei, wie er zwei Finger an die kleine Nase hielt, um zu spüren, ob das Kind überhaupt noch atmete.
Er führte sein Pferd am Zügel und verfluchte das starke Gefälle und die Dunkelheit der Nacht. Er dankte Gott, dass es erst Anfang September war, denn ein paar Wochen später und hier heroben hätte bereits Schnee liegen können. Dann wäre der Abstieg von der Burg herunter ins Sarntal unmöglich gewesen. Die ganze Zeit über hielten seine großen, starken Hände das Kleine, das er sich vor die Brust gewickelt hatte.
»Was für ein Schicksal mag dich nur erwarten, du kleiner Erdenwurm …«
Er gedachte nun, den letzten Teil der Anweisungen zu befolgen und rief sich den genauen Wortlaut ins Gedächtnis.
»Dann nehme Er das Kind und stecke ihm das in die Windel«, damit schwenkte die Gräfin den Lederbeutel, »gebe es dem Minderen Bruder in meinem Tross, der sich in Bozen formiert hat und auf die Reise nach Wien wartet. Er vergesse nichts, das ist von unglaublicher Wichtigkeit, hat Er das verstanden?«, hämmerte es in seinem Gehirn.
Wie in Trance zog der Bischof den Lederbeutel mit dem abgerissenen Teil der Stola aus seinem Gürtel und steckte diesen in die Windel des Neugeborenen. Plötzlich stiegen ihm Tränen in die Augen, als er erkannte, wie klein, wie schutzlos und ausgeliefert dieses kleine Wesen war. Allzu bewusst war er sich, dass seine Nerven, die ihn sonst nie im Stich ließen, drohten, zu versagen. Als er vorsichtig, zitternd und schwach sein Pferd bestieg, sich vergewisserte, dass es dem kleinen Kind an seiner Brust unter dem Mantel gut ging, wusste er mit einer Klarheit, die sein ganzes Denken umfing: Nie in meinem ganzen Leben werden mich diese zwei Tage zur Ruhe kommen lassen. Und er wusste genau, dass er einen viel zu hohen Preis bezahlt hatte. Kein Amt der Welt war es wert, das mit ansehen und das tun zu müssen.
Grausam hallte der letzte Befehl der hohen Dame in ihm nach:
»Ich beschwöre Euch, nie zu vergessen: Es gibt KEINE Nachkommen. Es hat NIE ein Kind gegeben.«
*
Der schmächtige Knabe mit dem viel zu großen Kopf hockte mit angezogenen Knien auf seinem Lieblingsplatz, einem zwischen den dicken Mauern eingelassenen Holzbrett auf der Spitze des fünfeckigen Bergfrieds. Hier im älteren Hof der Burganlage sah er weit hinweg über die Donau, auf reich bestelltes Land, saftig grüne Ebenen, gesäumt durch eine ferne Hügelkette, die die weit entlegenen Besitzungen im Hausruckviertel, im Mühlviertel, ja bis zum Attersee im Salzkammergut erahnen ließen.
Er reckte seinen dünnen Hals und blickte hinunter auf die ausgedehnte Wehranlage zu Füßen des Aussichtsplatzes. Sehnsüchtig schaute er zur Schildmauer, wo ein neuer Wohntrakt angebaut wurde. Ein würdiges Herrenhaus mit einer großen Halle und vornehm ausgestatteten Schlafräumen. So nah und doch so weit und unerreichbar … Ein Schmerz, so tief und bohrend, wie ihn nur ein vierjähriges Kind empfinden kann, das sich ungeliebt und verstoßen fühlt, bemächtigte sich seiner und trieb dicke Tränen in seine kleinen, bernsteinfarbenen Augen. Nun – er wusste, hier beim Burgherrn würde er nur unerwünscht sein und schnell sah er weg. Sein großer Kopf auf den schmächtigen Schultern wandte sich ruckartig in die andere Richtung zum Kemenatenbau, dem Wohnbereich der Frauen im älteren, schon ein wenig heruntergekommenen Teil der weitläufigen Burg. Sofort verschwand sein sehnsüchtiger Blick, sein unterdrücktes Verlangen nach Zuneigung und Liebe machte einem spöttischen, abfälligen Grinsen Platz. Nur zu gut konnte er sich an den gestrigen Tag erinnern, alle Einzelheiten hatte er behalten und spielte sie immer wieder von Neuem in Gedanken durch. Gestern, wo er in der kleinen Stube dieser kränklichen Frau gegenübergestanden war. Wie sie sich keuchend mit behandschuhten Fingern an den spitzenumrüschten Hals gegriffen hatte, so wie immer, wenn sich ein neuer Anfall ankündigte. Wie ihr verzerrter Mund lautlos das Wort »Hilfe« geformt hatte, wie sie immer wieder auf die Flasche mit dem Kräutersud gezeigt hatte. Grenzenlos war die Macht, die das Kind in seiner noch so jungen Brust fühlte. Einfach berauschend war es, als der Knabe nur dastand, die Hände im Rücken verschränkt, den Blick ruhig auf die zitternde, um Haltung bemühte Frau gerichtet. Fasziniert beobachtete er, wie ihre Lippen immer blauer wurden, die schmalen Hände sich verkrampften, der Atem immer pfeifender und schneller ging. Mühsam hielt sie sich aufrecht, stützte sich ans Fensterbrett und bettelte mit tränenblinden Augen um ihre Medizin, denn sprechen konnte sie jetzt nicht mehr. Nur Verachtung war im Antlitz des Burschen zu lesen, als er weiter untätig zusah, wie die zerbrechliche Frau in sich zusammensackte, sich kurz am Boden wand, unkontrolliert zu zucken begann und schließlich regungslos liegenblieb. Ein paar Minuten noch stand er weiter da, sah sich im hohen, kalten Zimmer um, verabschiedete sich von jedem einzelnen Stück Mobiliar. Der dunkelroten Wandbespannungen, dem großen Kamin, der doch nicht genug Wärme spenden konnte, um die dicken Mauern aufzuheizen, der Truhe mit den Kleidern dieser Frau, die nichts lieber tat, als sich mehrmals am Tag umzukleiden und herauszuputzen, dem Kreisel, dem Holzpferd, der kleinen Holztruhe mit den bunten Murmeln. Mit sichtlicher Genugtuung gab der Knabe der Stickarbeit, die nahe dem Erkerfenster in einen Rahmen gespannt war, einen groben Fußtritt. Mit lautem Krachen zerschellte der Holzrahmen an der Wand, und die feine Stickarbeit, die eine halbfertige Figur des heiligen Rochus mitsamt einem kleinen braunen Hund erahnen ließ, hing zerfetzt herunter. Dann war wieder Stille. Nichts rührte sich. Ganz nahe ging er zu der reglosen Gestalt am Boden und tippte ihr mit der Fußspitze grob in den Bauch. Keine Erwiderung, kein Stöhnen, kein Seufzen mehr, kein Jammern, kein Weinen. Jetzt hatte er Gewissheit, er spürte es mehr, als er es sich mit seinem jungen Verstand erklären konnte. Sie war tot, endlich, sie würde nicht mehr aufstehen. Keine nassen, schlecht riechenden Küsse, keine zittrigen Umarmungen, kein Streichen über sein Haar mit Spinnenfingern und vor allem keine geschlossene Tür, kein verwehrter Weg nach draußen, in die Luft, in die Höhe, näher zur Sonne, hinein in den Wind …
Jetzt, einen Tag später, konnte er seine Freiheit immer noch nicht fassen. Vergessen war der Tumult von gestern, die vielen Leute, die mitleidsvollen Worte, das Heraustragen des leblosen Körpers, die weihrauchgeschwängerte Aura der kirchlichen Würdenträger. Alles vorbei, alles vergessen. Der kleine Knabe am Turm spannte die Ärmchen weit von sich, seine unnatürlich schwache Brust wölbte sich, ein kehliges, krächzendes Lachen, das sich eher wie der Ruf eines Raubvogels anhörte, entrang sich seinem Mund, den er weit aufgerissen hatte. Welch absonderliche Kreatur er hier auf der Spitze des fünfeckigen Turmes abgab, wie lachhaft und närrisch er sich auch gebärdete, er selbst sah das gar nicht so. Wie begeistertes Triumphgeschrei klang das kümmerliche Krächzen in seinen eigenen Ohren, stark wie Adlerschwingen fühlten sich seine dünnen Arme an, unbezwingbar und unverwundbar erlebte er seine verwachsene Gestalt.
Es war, als wollte er fliegen, so viel Luft zum Atmen hatte er plötzlich. Wie sehr berauschte ihn die Erinnerung an gestern, jenen Tag, an dem er seiner Mutter beim Sterben zugesehen hatte!
*
Mit verklärtem Blick, verklärter noch als der der Jungfrau Maria im Seitenschiff des nahen Stephansdoms zu Wien trug Meisterin Cäcilia fein säuberlich Zahlen in einer langen Spalte in das Wirtschaftsbuch ein. Gefällig betrachtete sie ihre verschnörkelte Handschrift, und ein wohliger Seufzer entfuhr ihrer schmalen Brust. Die Summen wurden immer höher, keine Frage, die Wiener Bürger kümmerten sich rührend um das Wohlergehen der reuigen Sünderinnen im Kloster Sankt Hieronymus. Oder die ehemals männliche Kundschaft hatte sprichwörtlich ›Dreck am Stecken‹ und wollte sich mit so manchen Gulden das Gewissen reinwaschen, wie der Badewaschel das mit ihrem Buckel machte, wenn sie einmal in der Woche im warmen Wasserschaff saßen. So entrichteten sie in schöner Regelmäßigkeit ihren Obolus an das Kloster, auf dass die ehemaligen Dirnen nur ja gründlich von den Schwestern der Heiligen Maria Magdalena von der Buße geleitet und aus seelischer Verwahrlosung hin zu Gottesfürchtigkeit erzogen werden konnten. Wenn es so einfach wäre, sich von früheren Ausschweifungen loszukaufen, dachte Meisterin Cäcilia mit säuerlichem Lächeln, doch ihr konnte es recht sein. Neben erklecklichen Summen auf der hohen Kante besaß das Kloster einen Garten in der Leopoldstadt und Weingärten in Grinzing und Nussdorf. Als Cäcilia gerade lustvoll dabei war, rein überschlagsmäßig die Einnahmen festzulegen, und so wie immer herzlich bedauerte, dass den Büßerinnen der Ausschank von Eigenbauwein strengstens untersagt war, drang absolut unheiliges, lautes Zetern und Schimpfen an das Ohr der Meisterin. Erschrocken fuhr Cäcilie auf, um gleich darauf wütend mit der Faust auf ihr Schreibpult zu schlagen, wobei das darauf liegende Buch einen Hüpfer nach vorn machte. Rasch stand sie auf, strich über ihr grobes weißes Habit und senkte demütig den Kopf.
»Geduld und Demut, Heilige Jungfrau, Geduld und Demut …«, murmelte die hagere Frau, umfasste mit ihrer rechten Hand ein hölzernes Kruzifix, das um ihren dürren Hals baumelte, und schickte sich an, ihre persönlichen Räume zu verlassen. Erstaunlich schnell für ihr doch schon fortgeschrittenes Alter bewältigte sie die steilen Stufen, hurtig lief sie an der Kapelle vorbei, schlug rasch ein Kreuzzeichen und beugte ihr spitzes, knotiges Knie, hastete weiter an den Schlafsälen der Büßerinnen vorbei und öffnete mit einem kräftigen Ruck die schwere Eichentür zum Wirtschaftshof.
»Geduld und Demut, Heilige Jungfrau …«, zischte sie, als sie augenblicklich mitsamt ihren Holzschuhen bis zu den Knöcheln im Schlamm versank, denn im ungepflasterten Hof bildete der schmelzende Schnee schmutzige Lachen. Fröstelnd wegen des scharfen Märzwindes, aber unbeirrt setzte Cäcilia ihren Weg fort. Immer lauter drang das Gezeter an ihr Ohr. Keine Frage, sie hatte wieder einmal untrüglich erraten, woher der ganz und gar unchristliche Lärm kam, der die kontemplative Stille des Klosters erschütterte. Vor dem Küchenhaus blieb die Meisterin plötzlich stehen. Leise öffnete sie die wurmzerfressene Holztür einen Spaltbreit, und sofort schlug ihr der beißende, fettgeschwängerte Rauch der offenen Herdstelle entgegen. Ihre kleinen, listigen Augen begannen zu tränen, doch fest wie ein Holzpflock blieb sie stehen und lugte angestrengt und schniefend in die Klosterküche.
»Yrmel, jetzt schau doch net so deppert … du tust ja grade, als ob du noch nie ein paar Mannsbilder gesehen hättest. Vor mir kannst di net verstellen, ich weiß, wo du noch vor wenigen Tagen dein Geld verdient hast. Also jetzt hör auf mit dem theatralischen Augenrollen und Zähnefletschen, schab die Rüben und putz den Kohl, sonst gibt’s am Abend keine Suppe!«
Schwitzend nach dieser Schimpftirade fuhr sich die beleibte Frau, die wie alle hier im Kloster das einfache helle Habit trug, über die Stirn. Nur mit einem Unterschied: Statt eines Gürtels, wie bei allen anderen, umfing eine Schürze in Leintuchgröße ihre nicht enden wollende Taille und bedeckte gnädig den vorstehenden Bauch. Wieder setzte sie an zu schimpfen:
»Herrschaftszeiten, Marlen, mach den Mund zu, es zieht! Du sollst den Teig da durchkneten, den brauch ich doch für das Fladenbrot. Hör sofort auf, den Jammergestalten da dauernd auf den Hosenschlitz zu schauen!«
Erschrocken hielt sich da Meisterin Cäcilie vor der Tür die Hand an die runzligen Lippen, um nicht laut loszuschreien. Langsam wurde ihr das, was sie hier zu sehen und zu hören bekam, zu viel.
»Schwester Magdalena Apolonia vom Orden der Magdalenerinnen, warte nur, bis ich dich in die Finger bekomme«, murmelte sie bitterböse und verfolgte weiter das Geschehen in der Küche.
»Aber Hannerl, jetzt sei doch net so, wenn die kleine Marlen einmal was Schönes sehen möcht«, brabbelte da ein derber, grobschlächtiger Mann von der anderen Seite und schlug seinen beiden Kumpanen, die sich anscheinend auch irgendwo in dieser Ecke aufhielten, auf die Schulter. Cäcilie reckte ihren Schildkrötenhals, um erkennen zu können, wer da noch in der Küche war.
»Natürlich, Barthel, der Hauerknecht, Jobst und Krispin, seine Gefährten, wer sonst …«, sagte sie zu sich und spürte, wie die nächste Welle Zorn Gewalt von ihr ergriff.
»Barthel, halt’s Maul, von wegen kleine Marlen. Für dich immer noch Schwester Magdalena. Sie ist Nonne, verstehst, sie dient Gott und nicht so schmierigen Haderlumpen, wie ihr das seid!«, damit wandte sich die Angesprochene an eine kleine, quirlige Person, die noch keine 14 Lenze zählte und mit leuchtenden Augen und geröteten Wangen die Männer wie eine Heiligenerscheinung anstarrte.
»Schwester Marlen hat ein Gelübde abgelegt, ein Ge-lübde«, damit puffte sie die Nonne grob in die Seite, »auch wenn sie es selbst oft vergisst, sie lebt, um der Jungfrau Maria und allen Heiligen zu gefallen, in Bescheidenheit und Demut!« Damit fixierte sie das junge Mädchen so lang, bis dieses den Blick beschämt senkte und entschlossen anfing, den Teig zu kneten, als gelte es, sein Seelenheil damit zu retten.
Wie zur Bestätigung nickte Cäcilie draußen und musste dann zu ihrem völligen Entsetzen erkennen, das einer der drei Männer sich an seinem verdächtig ausgebeulten Hosenlatz zu schaffen machte. Beschämt schloss sie die Augen, aber hörte umso genauer zu.
»Krispin, du Schweinehund, untersteh’ dich, hier im Kloster der Büßerinnen ein Gehabe wie im Haus der Dirnen an den Tag zu legen.«
Dann hörte Cäcilie ein Klatschen, riss die Augen auf, und konnte gerade noch erkennen, wie Johanna Maipelt, Wirtschafterin, Köchin und Büßerin im Kloster höchstpersönlich ihren groß dimensionierten Holzkochlöffel, mit dem sie eben noch den Haferbrei für das Frühstück gerührt hatte, mit voller Wucht auf das halb ausgepackte Stück Männerstolz des Knechtes Krispin sausen ließ. Unbeeindruckt vom Geschrei und Gewinsel des auf seiner empfindlichsten Stelle getroffenen Mannsbildes rührte sie längst wieder seelenruhig mit eben diesem Kochlöffel im Haferbrei.
»Also morgen keinen Haferbrei für mich«, hörte sich Cäcilie sagen und schüttelte vor Ekel ihren kleinen Kopf so heftig, dass die Falten am Hals sich wie zusammengefaltetes Pergament hin- und herschoben. Aber es ging weiter hoch her im Küchentrakt, und atemlos verfolgte die Meisterin die folgenden Geschehnisse. Gerade eben erhob ihre Wirtschafterin wieder lautstark das Wort.
»Ein für alle Mal, Barthel«, damit stellte sich Johanna vor den Hauerknecht. »Ihr seid hier, um die Fässer aus dem Keller zu holen und sonst für gar nix, verstanden. Wenn ihr’s so notwendig habt, dann geht vors Widmertor, da gibt’s Mädchen genug. Noch einmal so ein Auftritt, und du kannst dich mit Jobst und Krispin zum Teufel scheren …«
Zeitgleich schlug Meisterin Cäcilie vor der Tür und Marlen mit ihren Teighänden das Kreuz. Die eine mit klammen, vor Kälte steifen Fingern, die andere mit mehligen, vom Teig klebrigen Händen.
»Aber Hannerl, bitte sei doch nicht bös«, jammerte da der Barthel, »die beiden sind halt noch jung und blöd, und ich hab’ sowieso nur Augen für dich.«
»Dein Herumsulzen kannst dir sparen, Barthel, ich hab schon so viele männliche Körperteile in allen Variationen gesehen, jawohl in allen«, damit starrte sie Krispin an, der mit einem Stöhnen seinen Hosenlatz zumachte, »dass es für fünf Leben reicht. Merk dir eines, ich hab’ genug von euch Mannsbildern. Und jetzt tragt mir das eine Fass da nach oben, das brauch’ ich morgen für den Essigansatz und dann schleicht’s euch in Gottes Namen!«
»Den guaten Tropfen zu Essig werden zu lassen, ist in meinen Augen sowieso a Sünd’, Hannerl«, murmelte Barthel und senkte, wie aus Angst vor der eigenen Courage, verlegen seinen Kopf, sodass sein schütteres graues Haupthaar besonders gut zur Geltung kam.
»Jetzt red’ kan Schmarrn, Barthel«, fuhr Johanna den Alten grob an, »dir muss ich doch nicht erklären, dass wir Büßerinnen keinen Wein ausschenken dürfen, so wie alle hier in der Stadt. Ich bin froh, dass mir das mit dem Essig eingefallen ist, so verdienen wir wenigstens was an unseren eigenen Trauben!«
»Is ja gut, Hannerl, nur du bist immer so sauer in letzter Zeit, dass du schon deinen eingelegten Essiggurkerln Konkurrenz machen könntest …«
»Meine Essiggurkerln sind net sauer!«, schrie Johanna jetzt, stemmte ihre vom Arbeiten wuchtigen Unterarme gegen ihre ebenfalls sehr wuchtige Leibesmitte und baute sich vor dem zurückweichenden Barthel auf.
»Die sind pikant! Merk dir das, du Haderlump, elendiger! Pikant und von einer angenehmen Frische und würzigem Gusto.«
Stille breitete sich in der Küche aus. Ehrfurchtsvoll verstummten alle angesichts der pikanten Essiggurkerln der Johanna Maipelt. An einem Poltern und Rumpeln konnte Cäcilie hören, dass die drei Knechte jetzt endlich die verwinkelten Stufen zum Weinkeller hinabstiegen und wahrscheinlich bald mit einem Weinfass heraufkommen würden. Höchste Zeit, dass sie als Meisterin ihre Autorität geltend machte und festen Schrittes in die Küche stürmte! Hier musste ein Exempel statuiert werden, nein, so ging das nicht. Sankt Hieronymus war keine Bierschenke, kein Weinlokal, sondern immer noch ein Kloster! Sie umklammerte den kalten Türgriff, zog aber ihre Spinnenfinger gleich wieder weg. Konnte sie es sich gefallen lassen, dass im Kloster der Büßerinnen drei Männer in der Küche aus und ein gingen? Musste sie es aushalten, dass Johanna Maipelt, eine ehemalige Dirne, lautstark herumkeifte, obwohl sie als Büßerin bestenfalls Hymnen zu singen und sich ansonsten ins Gebet zu versenken hatte? Ja und warum sollte sie Johanna weiterhin eine stumme Magd und eine Nonne als Küchenhilfe zugestehen? Sollte sie die Arbeit doch allein machen, Herrgott noch mal! Wieder schlossen sich Cäcilies Spinnenfinger um den Türgriff, schon hatte sie die richtigen Worte auf ihrer spitzen Zunge liegen, schon öffneten sich ihre schmalen Lippen, um sich Gehör zu verschaffen – da verharrte sie einen kurzen Moment und ließ den Türgriff wieder los. Denn auf der anderen Seite, schoss es in ihr altehrwürdiges Oberstübchen, verstand es Johanna, mit der Hälfte des Wirtschaftsgeldes doppelt so gut zu kochen wie die Köchin vor ihr. Nie wieder wollte Cäcilie sich von Wassersuppe, ranzigem Getreidebrei und fauligem Krautkopf ernähren … Und das mit der Essigherstellung war ja wirklich ein guter Einfall gewesen! Viele der Büßerinnen hatten ihr Auskommen mit der Herstellung von Kräuteressig, eingelegtem Gemüse und Obst. Da blieb schon was hängen, viel mehr als früher, als sie ihre Trauben an die Weinbauern verkaufen mussten, weil sie selbst keinen Wein keltern und verscherbeln durften! Da konnte sie vielleicht bei der Johanna schon ein Auge zudrücken. Schwester Magdalena hingegen – nun die war ja noch jung, da war man halt etwas neugierig, und dass Johanna die Hand über Yrmel hielt, war vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn sie selbst als Meisterin konnte mit dem verstockten jungen Ding, das nie auch nur ein Wort sprach, mit den Armen herumfuchtelte und sich ständig angsterfüllt umblickte, sowieso wenig anfangen. Dann, so dachte Cäcilie weiter, sollte man den Dingen vielleicht ihren Lauf lassen, einfach Gottvertrauen haben! Außerdem standen dem Kloster arbeitsreiche Zeiten ins Haus. Der Herzog würde seine Braut in wenigen Wochen heimführen, und Cäcilia hatte vor, die Hochzeitsfeierlichkeiten, die in Wien vor allem mit übermäßigem Weingenuss und Tafelfreuden einhergingen, auszunutzen und die Spezialitäten des Klosters zu einem echten Geschäft für Sankt Hieronymus zu machen. Außerdem versprach der neue Verdauungsessig von Johanna eine echte Offenbarung gegen übersäuerte Mägen und Übelkeit zu werden. Nach den hochzeitlichen Fress- und Saufgelagen konnte man sich über Mangel an Kundschaft sicherlich nicht beschweren. Da konnte sie auf die Hilfe der tüchtigen Wirtschafterin nicht verzichten. Nachdenklich stand die Meisterin weiter unbemerkt vor der Tür zum Küchenhaus und wägte ab, wie weit sie der Sünde hier Einlass gewähren durfte, oder, um es einfacher auszudrücken, wie lang sie sich noch von Johanna auf der Nase herumtanzen lassen sollte. Nicht nur, dass sie gotteslästerlich schimpfte, dass sie aufmüpfig und herrisch war, nein, Cäcilie wusste von der Schwester Vikarin, dass Johanna hier und da sogar das Kloster verließ, um am Markt wie eine gewöhnliche Bürgersfrau einzukaufen. Und – das war dann doch der Gipfel an unklösterlichem Verhalten – jeden Nachmittag ein ruhiges Stündchen mit einem Glas gewürzten Wein und einer Spezerei verbrachte! Also gerade das, was verboten war, nämlich Wein. Keine Frage, Johanna zweigte sich so manch guten Schluck vor der Essigbereitung für ihre eigene durstige Kehle ab! Und das obendrein zu einer Zeit, wo die Büßerinnen und Regelschwestern in der Kapelle die Non beteten und Hymnen und Psalmen zu Ehren Gottes anstimmten! Zitternd vor Ärger presste sich Cäcilie die Hand auf ihren heillos übersäuerten Magen.
Männerstimmen und ein lautes Ächzen rissen die Meisterin dann jäh aus ihrer geistigen Versenkung – gleich würde Barthel mit seinen beiden Helfern da sein und das Weinfass heraustragen. Meisterin Cäcilie beschloss plötzlich, so schnell, wie sie ihre dünnen Beine tragen konnten, wieder in ihre Gemächer zu eilen. Es brauchte ja eigentlich niemand zu wissen, dass sie gelauscht hatte und bestens darüber unterrichtet war, was im Küchentrakt des Klosters so vor sich ging. Johanna sollte nur fuhrwerken wie bisher. Es konnte nur zugunsten des Klosters sein, wenn sie Wirtschaftsgeld sparen konnten und – hier erhellte ein diebisches, absolut unchristliches Lächeln die etwas verwitterten Züge der Meisterin – die andere Hälfte des Ersparten in schöner Regelmäßigkeit Cäcilias eigenen Geldsäckel füllte! Denn etwas abzweigen, das konnte sie selbst auch recht gut, da brauchte sie keine Johanna dazu! Nein nicht nur ein paar läppische Becher Wein … Zu Ehren Gottes auf der einen Seite und zur Befriedigung ihrer persönlichen Habgier auf der anderen mussten es bei der Meisterin Cäcilie schon eine paar Geldstücke sein!
*
Das Horn des Türmers schallte im Morgengrauen über die Burg, und es versprach, ein schöner Herbsttag zu werden. Der junge Mann, der sich versteckt hielt, schnupperte. In den Küchen wurde bereits gebraten und gekocht, in den Frauenkemenaten kleideten sich die Damen und Edelfräulein für die Jagd an. Die schweren Ritterpferde schnaubten unter den Sätteln, und ihr Atem dampfte in der kalten Morgenluft. Er sah über die Brücke die ersten Gäste reiten, allen voran der Bischof von Passau, der in seinem geistlichen Habit seltsam auf seinem Pferd aussah. Die Falkenjagd war zwar von oberster Stelle für Geistliche verboten worden, aber niemanden kümmerte das hier, weit weg von Kaiser und Herzog, inmitten der ausgedehnten Grafschaft rund um die Stadt Eferding. Immer wieder freute sich der Bischof, den Schlossherrn zu sehen, der soviel Macht und Reichtum besaß, dass er sogar den Habsburgern die Stirn bieten wollte. Es konnte also kein Schaden sein, sich von ihm herzlich begrüßen zu lassen! Der junge Mann grinste hämisch, sehr gut konnte er sich den fetten Geistlichen vorstellen, der schimpfend und schwitzend hier herauf geritten kam. Der Weg zur Burg Neuhaus war sicherlich beschwerlich gewesen für den übergewichtigen Bischof. Vom Kettensperrturm unterhalb der Festung, von wo aus der mit allen Wassern gewaschene Graf die Donau sperren konnte und Zoll einhob, begann der steile Aufstieg. Bis der Bischof endlich den fünfeckigen Turm mit der davorliegenden Schildmauer sehen konnte, rann ihm bereits der Schweiß den feisten Rücken hinunter. Sein Hinterteil schmerzte vom ungewohnten Reiten. Die Aussicht, die er von der Festung hatte, und die den Strom entlang bis zur meilenweit entfernten Donauschleife reichte, konnte ihn nicht für die Mühen entschädigen. Sehr gelegen dafür kamen dem Bischof das Warmbier und allerhand deftige Speisen, die sogleich im Burghof aufgetragen wurden. Er ergriff freudig die Gelegenheit, sich für die anstehende Jagd zu stärken.
Leise, um ja nicht gesehen zu werden, verließ der junge Mann flink sein Versteck in einer Nische neben der Kapelle und schlich sich zu einem entlegenen eingeschossigen Nebengebäude am entgegengesetzten Ende des Burghofes. Er schlüpfte durch einen Spalt des massiven Holztores. Sofort umfing ihn der ätzende Geruch von Vogelmist. Durchdringendes Geschrei kam von den Käfigen an der Längsseite, auf und ab liefen die Falkoniere und machten ihre Schützlinge fertig zur Jagd. Keuchend stand der Jüngling und lehnte sich an die Holzwand. Mit äußerster Disziplin versuchte er, gleichmäßig zu atmen. Unnatürlich heftig hob und senkte sich sein schmaler Brustkorb, und pfeifend sog er die Luft aus und ein. Er verfluchte diese Krankheit, dieses ungeliebte Erbe einer schwachen, lungenkranken Mutter.
»Jetzt steh nicht so herum, mach den Braun-Weißen und den Weißen fertig«, fuhr ihn der Falkenmeister gröber, als er eigentlich wollte, an. Aber heute war einfach zu viel zu tun und keine Zeit für Höflichkeiten. Wie um sicherzugehen, dass der Bursche ihn nicht missverstanden hatte, drehte er sich noch einmal kurz um und dachte:
Er schaut furchtbar aus, richtig verwachsen und rachitisch. Ein bedauernswerter Kerl, aber im Umgang mit den Vögeln kann ihm niemand das Wasser reichen!
»Ich, ich ganz allein, darf heute die …«, unterbrach der Junge verdattert die Gedanken des Älteren.
»Ja, du, du ganz allein«, hier musste der Falkenmeister trotz der Hektik um ihn herum lächeln, »du bist schon besser als manch einer meiner Burschen …« Damit fuhr er zornig einen jungen Mann an, der verzweifelt versuchte, einen Lannerfalken zu binden. Immer wieder drehte sich der Vogel weg, schrie durchdringend und ließ sich nicht bändigen.
»Verdammt, Kristof, so wird das nichts«, schimpfte der Falkenmeister, nahm ihm den Vogel aus der Hand, sprach beruhigend auf das aufgeregte Tier ein, zog ihm das Geschühe über und band ihn an den Sprenkel, einen lederumwickelten Stab, auf dem der Vogel gewohnt war zu sitzen. Dann drehte er sich halb um und sprach eindringlich mit dem dünnen Burschen.
»Jetzt geh schon, Junge, mach, was ich gesagt habe, mach die beiden für den Bischof und den Herrn fertig, wir haben nur mehr wenig Zeit!«
Das ließ sich der junge Mann nicht zweimal sagen, und ungelenk sprang er zu den Käfigen, wo die Vögel vom niederen Flug untergebracht waren. Sie würden bei der Jagd die am Boden lebende Beute wie Hasen oder Kaninchen reißen. Zwischen den Rotschwanzbussarden entdeckte er den Habicht. Mit einschmeichelnden Lockrufen brachte er den Vogel so weit, ruhig zu halten, sodass er ihn vorsichtig aus seinem Verschlag nehmen konnte. Der Habicht blickte ihn neugierig an, als er ihn auf seine behandschuhte Faust steigen ließ. Es war ein erfahrenes, ruhiges Tier, doch die allgemeine Aufregung hatte auch ihn ergriffen, und der Jüngling schob ihm sogleich eine Haube über den Kopf, damit er sich augenblicklich beruhigte und anbinden ließ. Dann ging er auf die andere Seite, wo sich ein Käfig neben dem anderen für die Vögel vom hohen Flug reihte. Hier waren die Falken zu Hause, die ihre Beute im Flug schlugen, vor denen sich Singvögel, Fasanen und Rebhühner zu fürchten hatten. Genauso ruhig wie vorhin verfuhr der Jüngling mit dem kostbaren Nordlandfalken, der für den Burgherrn bestimmt war. Ein wunderbares Tier, aufmerksam, nicht zu zahm, sondern wild genug, um seinem Herrn gute Erfolge zuteilwerden zu lassen. Dann übergab er beide Tiere an einen Burschen. Er wollte nicht hinaus in den Burghof, wo sich die Jagdgesellschaft bereits vom Essen und Trinken verabschiedet und sich für das Hornsignal, das Zeichen zum Aufbruch, formiert hatte. Zu vornehm und dämlich waren ihm die Damen im wallenden Reitkleid, zu grob und laut der Bischof und sein Gefolge. Aber am meisten ekelte sich der Jüngling vor den Hundeführern mit ihrer Meute. Er hasste die kleinen Münsterländer, die hechelnd und bellend um die Pferde herumsprangen, die nur darauf warteten, das Wild aufzustöbern und es dem Falken, der es geschlagen hatte und festhielt, abzunehmen. Geifernd warteten sie auf ihre Chance. Doch das alles hätte der junge Mann mit den schmalen Schultern, dem viel zu großen Kopf und dem pfeifenden Atem zur Not noch akzeptieren können, wäre da nicht der Burgherr gewesen, der nun auf seinem edelsten Pferd mit dem Nordlandfalken das Kommando für den Aufbruch gab. Ihm durfte er auf keinen Fall unter die Augen treten. Er sollte von seiner Gegenwart nicht das Geringste merken. Solang, bis seine Zeit gekommen war. Aber es war schwer, das jetzt zu akzeptieren und zu warten. Mit einem Seufzen sah der junge Mann zu, wie die Jagdgesellschaft, angeführt vom Burgherrn und vom Bischof, begleitet von Falkonieren und Hundeführern in das herbstbunte Land hineinritt.
Lang sah er dem immer kleiner werdenden Zug zu. Dann schüttelte er sich wie nach einem bösen Traum und sah sich blinzelnd um.
Stille hatte sich um ihn herum gebreitet, bis auf vereinzeltes Töpfeklappern vom Küchentrakt und dem Gackern der Hühner war nichts mehr zu hören. Langsam ging der Jüngling zum Falkenhaus. Die Ställe waren leer, die Raubvögel wahrscheinlich schon dabei, das erste Wild des jungen Tages in reißendem Flug zu schlagen. Doch ganz in der Ecke war noch ein Käfig besetzt. Mit leisen, einschmeichelnden Worten ging der junge Mann zum Verschlag und griff mit geübter Hand nach dem jungen Terzel, einem männlichen Wanderfalken. Wie immer konnte er sich nicht sattsehen an der Geschmeidigkeit und Schönheit dieses Vogels. Er hatte ihn fasten lassen, das kleine Tier hungerte nun schon ein paar Tage. Ein erster Schritt, ihn gefügig zu machen und für die Ausbildung vorzubereiten. Ruhig sprach der Jüngling mit ihm: »Du verachtest die Menschen, ihr Geschrei, ihr Getue, ihren Gestank. Du lebst allein, und niemand versteht dich wirklich. Sie lassen dich hungern, um deine Wildheit zu bändigen. Sie binden dich fest, damit du nicht entfliehst, und sie stülpen dir die Haube über die Augen, dass du stolzes Tier im Dunkeln tappen musst und die Welt und die Freiheit um dich herum nicht siehst.«
Während er sprach, berührte er den jungen Vogel sanft. Geduldig sprach er weiter und gab ihm ein wenig Fleisch, nur ein bisschen, nicht um seinen Hunger zu stillen, sondern um ihn gefügig zu machen und ihm die Hoffnung zu geben, dass er noch mehr bekommen könnte. Neugierig neigte der Vogel den Kopf, sah mit seinen dunkelbraunen Augen mit den gelben Lidern zum Jüngling auf.
»Aber stark bist du, viel stärker als die Menschen, du kennst kein Selbstmitleid, keine Furcht, voller Selbstvertrauen bist du, sogar am Rande des Todes bist du mutig und stark …«
Der Vogel streckte seine schwarz-weiß gesprenkelten Flügel und entspannte sich. Beruhigend sprach der junge Mann weiter.
»Bald wirst du meterhoch in die Lüfte flattern, reglos über deiner Beute verharren und dann …«, der junge Mann keuchte vor Vorfreude »wirst du dich mit ungeheurer Geschwindigkeit und halb geöffneten Schwingen zu Boden stürzen, geradewegs in die Flugbahn deines Opfers.« Wieder strich der junge Mann über das glatte Gefieder des Wanderfalken, um ihn an die menschliche Berührung zu gewöhnen. Erregt sprach er weiter:
»Bevor diese niedrige Kreatur überhaupt merkt, was geschieht, wirst du sie mit den Klauen ins Rückgrat schlagen und damit …«, hier strich der Jüngling sanft über den gelben Schnabel des Tieres und fühlte die spitze, zahnartige Ausbuchtung auf beiden Seiten des Oberschnabels, »die Schädeldecke mit einem einzigen Hieb sprengen.«
Der Mann leckte sich die Lippen und gurrte vor Vergnügen.
»Niemand kann deinen Geist brechen, du hast keinen Instinkt zum Gehorsam. Du tötest den, der dir im Weg ist, du bist der Stärkere. Und wenn du fliegst, bist du frei und hast genug Luft zum Leben … zum Atmen … bist frei …«
Behutsam setzte der Jüngling den jungen Wanderfalken in seinen Verschlag. Kaum konnte er das Zittern seiner Hände unterdrücken. Längst schon hatte er die Grenze zwischen Wunsch und Wirklichkeit überschritten. Er selbst war der Falke, stand regungslos in der Luft und beobachtete mit scharfem Blick sein Opfer, bereit zuzustoßen, bereit zu töten.
Mein liebes Kind!
Heute ist ein guter Tag in meinem ach so bedauernswerten Dasein. Dieses Labsal hast ganz alleine Du mir beschert, und dafür danke ich dir aus übervollem Herzen. Wie eine Gefangene, aller Lebensfreude beraubt, friste ich mein Dasein hier im Kloster. Doch heute, als ich mich auf der Empore, von der steinernen Säule vor ungebetenen Blicken geschützt, verbarg, da klopfte mein Herz wie rasend. Ich wusste, dass Du heute mit Deiner Ziehmutter kommen würdest, und betete zu allen Heiligen, dass dem auch wirklich so sein und der Allmächtige Gott nicht anderes an diesem Tag mit Dir vorhaben möge. Als ich Deine kleinen, kindlichen Füße auf dem Steinboden tapsen hörte, da wollte meine Brust schier zerspringen vor Freude, Dich zu sehen. Was bist Du doch für ein wunderschönes Kind geworden! Vielleicht wirst Du mir nie vergeben, wie forsch und herrisch ich in Dein ach so junges Leben eingegriffen habe … Ja ganz gewiss wirst Du mich eines Tages verfluchen und mein Handeln Hass und Härte zuschreiben. Doch gerade das Gegenteil hat mich dazu bewogen, Dich aus Deinem vorgezeichneten Leben zu werfen, ja, Dich gleich einem unbedeutenden Kieselstein weit wegzuschleudern und in ein ungewisses Schicksal fallen zu lassen. Glaube mir, mein liebes Kind, ich habe aus weiser Voraussicht, aus Sorge und Zuneigung gehandelt. Ich habe Dich zu diesem scheinbar wertlosen Kieselstein gemacht, um Dich zu schützen, um Deinen goldenen Kern nicht für jedermann sichtbar zu machen. Denn die Welt ist grausam, mein Kind, und die Menschen morden, meucheln und schlachten einander ab, um das zu beherrschen, was golden glänzt. Ich habe aus Liebe gehandelt und weiß zu gut, dass Du das nie verstehen wirst … mein Kind …
Lucca, im Herbst des Jahres 1373
»Alessandro, Alessandro«, drang es dumpf durch die mit Schnitzereien verzierte Holztür, »jetzt wach auf …!«
Mühsam öffnete der Jüngling die Augen und sah – überhaupt nichts. Stockdunkel und kalt war es im Zimmer. Wie so oft in Italien kühlte es im Herbst über Nacht bereits empfindlich ab, und der große Palazzo wurde jetzt noch nicht geheizt. Frierend wickelte er sich in seine Seidendecke und kuschelte sich in die Matratze des großen Himmelbettes.
»Alessandro, die packen schon auf, jetzt komm doch!« Mit einem leisen Knarren öffnete Ella, die Tochter des Hausknechts, die Tür und trat mit einer Kerze an das Bett des Jünglings.
Da wurde dieser plötzlich hellwach, sprang auf die Füße und schrie:
»Ella, raus aus meiner Kammer, jetzt reicht es!«
Kichernd drehte sich das Mädchen um und lief eilends aus dem Zimmer. Sicherheitshalber ließ sie die Kerze auf einer Truhe stehen. Im Hinauslaufen schrie sie noch: »Pass auf deine Beinkleider auf, Alessandro, in Wien ist es noch sehr viel kälter als hier, du könntest dir dort wer weiß was holen.«
Erschrocken sah der junge Mann, dass sich der Gürtel seiner weiten, langen Brouche gelöst hatte und er halbnackt neben dem Bett stand. Hektisch zog er die Unterhose wieder an ihren Platz. Als er sich überzeugt hatte, dass das Mädchen verschwunden war, machte er Anstalten, wieder unter die verlockend warme Decke zu kriechen. Da hörte er von der Piazza di San Michele das Wiehern der Pferde und das Klirren der Ketten und Zaumzeuge. Dazwischen waren immer wieder die Kommandorufe der Kaufleute zu hören. Keine Frage, ganz Lucca war da draußen und wollte dabei sein, wenn der Patriarch von Aquileia seine weite Reise über die Alpen nach Augsburg, Regensburg und letztendlich nach Wien antrat. Dumm nur, dass er darauf bestand, seinen Großneffen Alexander von Randegg mitzunehmen, der seiner Geburtsstadt Augsburg einen Besuch abstatten und dort den Winter verbringen sollte. Aber wie sollte Alexander seinem Onkel erklären, dass er sich hier mehr als wohlfühlte, die Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten dieses vornehmen Haushaltes über die Maßen genoss und ihm sein Sinn überhaupt nicht danach stand, nördlich der Alpen in Augsburg zu verweilen! Schon gar nicht, nachdem er über die Hälfte seines noch jungen Lebens in Lucca zugebracht hatte. Und wie sollte es der altehrwürdige Patriarch verstehen, dass sein Mündel Besseres vorhatte, als jetzt im Herbst, wo der Winter schon an die Tür klopfte, die Alpen zu überqueren, um nach einigen Aufenthalten im Frühjahr bei einer Wiener Fürstenhochzeit dabei zu sein. Außerdem würden seine Verwandten in Augsburg nur mehr Fremde für ihn sein, wilde, stinkende und Blutwürste verschlingende Barbaren … So jedenfalls schilderten seine Freunde aus den wohlhabenden Familien, die bereits eine Reise in den Norden hinter sich hatten, die Menschen jenseits der Alpen. Alexander schüttelte sich angeekelt. Was dachte sich sein Oheim nur?
Alexander wollte den Frühling in der Toskana erleben, das Treiben auf der Piazza del Mercato und auf der Via Fillungo, wenn die ersten wirklich warmen Sonnenstrahlen lachten, das Zwitschern der Vögel, der Blick auf die Stadt von einem der Wohntürme … Und vor allem den goldenen Herbst mit all den Festlichkeiten, der Weinernte, den Lustbarkeiten und Gaumenfreuden wollte er ja auch überhaupt nicht versäumen.
Außerdem: Man erzählte sich haarsträubende Geschichten aus dem kalten Norden. Derb sollten die Leute dort sein, nicht so elegant wie hier, die niederen Hütten stinkend von Sauerkraut und Kohlsuppe, keine Geflügelpastete weit und breit, Hopfenvergorenes wurde getrunken, kein samtener Schluck Rotwein.
Doch im Innersten wusste Alexander, dass er sich dem Wunsch des Onkels beugen und mit ihm ins Land seiner Väter ziehen musste. Einerseits war er es ihm schuldig, war doch der Oheim nach dem Tod seiner Eltern Mutter und Vater gleichzeitig für den kleinen Burschen gewesen. Außerdem war Bernhard von Randegg beinahe schon im siebzigsten Jahr, und auf einer weiten Reise konnte wer weiß was passieren. Tragische Bilder von Räubern, Seuchen, Wegelagerern, wilden Tieren und Schneestürmen zogen an Alexanders innerem Auge vorbei, bis er sie resolut mit einer Handbewegung wegwischte, als wären es lästige Fliegen, die sich an einem großen Stück Parmaschinken zu schaffen machten.
Seufzend zog sich der 14-Jährige an, die ledernen Beinkleider, das Unterhemd, sein wattiertes Wams, die bequemen Stiefel. Den großen, weiten Reisemantel und den breitkrempigen Hut würde er mit nach unten nehmen. Vorerst hatte er Hunger und wollte frisches Gebäck und seine warme Honigmilch serviert bekommen, so wie jeden Tag. Auch wenn er zu so früher Stunde normalerweise noch nichts zu sich nehmen konnte.
»Alexander, da bist du ja endlich«, stieß sein Onkel erleichtert hervor, als er seinen Neffen aus dem Palazzo ducale kommen sah. Er selbst war bereits reisefertig und stieg in seinem fortgeschrittenen Alter noch recht gelenkig auf den Rücken seines prachtvollen Pferdes. Fackeln erhellten zu so früher Stunde die Piazza San Michele und warfen pittoreske Schatten auf das bunte Treiben rund um den Patriarchen. Ein ganzer Tross von Panzerreitern, Kaufleuten, Händlern und kirchlichen Würdenträgern begleitete den Zug. Eine Herde von Packpferden wurde mit Stoffballen beladen, Seide, Brokat und feinstem Leinen, das hier in Oberitalien von hervorragender Qualität war. Olivenöl und Wein, in Steinkrügen und Fässern, wurden als wertvolles Gut auf bereitstehende Maultiere gepackt. Alexander, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, mit welchem Aufwand sein Oheim die Reise antrat, sah sich staunend um.
»Die wollen alle über die Alpen?«, fragte er ungläubig.
»Gewiss«, antwortete sein Onkel.
»Kommen sie auch wieder mit uns zurück?«, fragte er unsicher.
»Aber nein, die haben einen viel weiteren Weg vor sich. Wenn sie ihre Waren verkauft haben, gehen sie den Goldenen Steig von Reichenhall bis nach Böhmen!«, erwiderte der Patriarch.
»Gold?«
»Ja, mein Sohn, weißes Gold, Salz! Und jetzt hör auf, hier in der Gegend herumzustehen und mir Löcher in den Bauch zu fragen. Dein Pferd ist gesattelt, steig auf, es geht los!«
Als sich Alexander gewandt in den Sattel schwang, hielt er kurz inne.