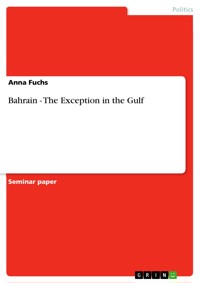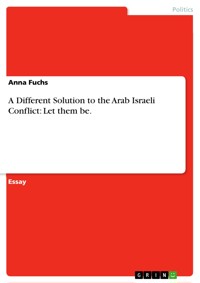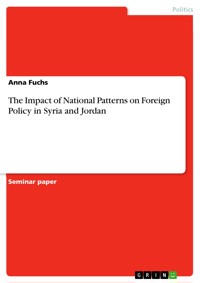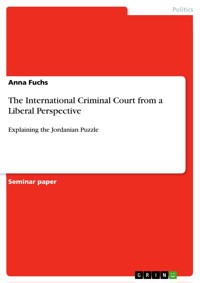Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Johanna Maipelt
- Sprache: Deutsch
Wien 1384. Der Klosterköchin Johanna hat man den Wein weggesoffen, den sie dringend für ihren Essig benötigt. Ihr Grant verschlimmert sich, als ihr die Meisterin Nachhilfe in Frömmigkeit aufs Aug’ drückt. Wie unpassend, dass just jener Mönch, der sie unterrichtet, tot in der Küche liegt! Doch der Anschlag auf die Herzogsfamilie bringt das Fass zum Überlaufen - Hannerl wird als Giftmischerin zum Tode verurteilt! Helfen kann da nur mehr ein Wunder, von denen es in Wien ja Gott sei Dank genug gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Fuchs
Der blaue Liebesknoten
Hannerl ermittelt
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Kunsthistorisches Museum Wien
sowie eines Stiches von: © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_chronicles_f_098v99r_1.png
ISBN 978-3-8392-4438-8
Hannerls Welt – Wien im Spätmittelalter
Die Verwicklungen rund um ein gemaltes blaues, kunstvoll verschlungenes Tuch beginnen im Winter 1383 und dauern fast ein ganzes Jahr. Dann löst sich der Knoten. Die geschichtliche Ebene im Buch entspricht den historischen Tatsachen, die Personen könnten so gesprochen, gelebt und gehandelt haben, wahrscheinlich ist es aber nicht.
Die Figur der Johanna Maipelt, Klosterköchin im Büßerinnenkloster Sankt Hieronymus ist frei erfunden. Das mittelalterliche Wien in der geschilderten Art und Weise, die Straßen, Gassen, Plätze und Kirchen haben so ausgesehen. Und gibt es noch immer, meist gut verborgen unter den Annehmlichkeiten der modernen Stadt.
Johanna Maipelt
Genannt Hannerl oder Hanna. Eine ehemalige Hübschlerin, Dirne, Fensterhenne, die ihr gelbes Hurentuch an den Nagel gehängt hat und sich jetzt mit einem blauen gemalten Stofffetzen herumschlagen muss. Recht sauer macht sie sich an die Zubereitung süßer Marmeladen und Kompotte, weil ihr für die pikanten Köstlichkeiten der Essig ausgegangen ist.
Weiberleut, mit denen Hannerl immer wieder zu tun hat
Meisterin Susanna: Eine Art Schutzmantelmadonna, die dieses Mal versagt und Johanna nicht vor den Folgen ihrer eigenen Dreistigkeit bewahren kann.
Barbel: Kräuterweibel und Wahrsagerin, die für alle, die es haben wollen, das richtige Kräutel bereithält.
Yrmel: Die Küchenhilfe des Klosters, die sich bisher stumm im Verborgenen gehalten hat, aber nun hinaus ins Licht treten muss.
Ela: Die zweite Küchenhilfe, ein fröhliches, bezauberndes Mädchen, das jedes Mal, wenn sie hereinstolpert, den Frühlingswind mitbringt.
Büßerinnen im Kloster, die eher nix mit der Hannerl zu tun haben möchten:
Marlen: Eigentlich Magdalena Apollonia, Schwester des Ordens der Magdalenerinnen, deren Schwatzhaftigkeit ihr mehr schadet, als ihr guttut.
Agnes: Eine Pförtnerin, die gute Gedanken ins Kloster lässt, die schlechten aussperrt.
Martha und Wuckerl
Else und Sigrid
Mannsbilder, die Hanna das Leben schwer machen
Barthel: Ein verliebter Hauerknecht, der unermüdlich um Hannas Gust buhlt und wohl selbst am meisten überrascht wäre, wenn er Erfolg hätte.
Krispin: Hauerknecht und Laufbursche
Wenzeslaus von Wittingau:Ein durch und durch sanfter Student der Theologie und junger Augustinerpater aus Böhmen, der lieber malt als predigt. Doch ausgerechnet er muss den Büßerinnen das Wort Gottes näher bringen.
Conrad Eysfogl:Bettelstudent und arme Verwandtschaft der großen Baumeisterfamilie Parler, der es jedem zeigen will, doch so nach und nach seine besten Freunde verliert.
Rolf Thyrnau: Ein vom Leben gezeichneter melancholischer Medizinstudent, der den Interessen der Reichen und Mächtigen immer wieder in die Quere kommt und den selbst seine eigene Heilkunst nicht retten kann.
Historische Personen, die für Hannerl unerreichbar sind
Wenzel von Luxemburg: Römisch-deutscher König (1361 – 1419)
Jobst von Mähren: Sein Vetter (1351 – 1411)
Albrecht III. mit dem Zopf (1349 – 1395): Herzog von Österreich
Beatrix von Hohenzollern (1362 – 1414): Seine zweite Gattin
Johann von Hohenzollern: Genannt Janik, Bruder von Beatrix
Katharina: Äbtissin im Kloster der Klarissen, Schwester von Albrecht III.
Böhmische Herren, die der Hannerl ganz und gar fremd sind
Herr von Rosenberg
Herr von Neuhaus
Figuren am Prager Hof, die Hannerl nur vom Hören und Sagen kennt
Thimo von Kolditz: Der Hofmeister
Peter von Wartenberg: Der Burggraf
Martin Rotlöw: Der Münzmeister
Peter Parler: Der Baumeister
Personen am Wiener Hof, über die Hannerl hie und da ›stolpert‹
Berthold von Wehingen: Domprobst und Hofkanzler
Johann Fichtenstein: Hofmeister
Hans von Thyrnau: Ehemaliger Bürgermeister und Münzmeister
Adalbert von Ala: Hofarzt
Mathias Bonus: Apotheker
Wenzel Parler: Baumeister des Südturmes
Leopold von Wien: Hofkaplan
Mathis von Kreusbach: Jägermeister
Michael Hirssmann: Hofmarschall
Geschöpfe aus Hannerls Vergangenheit
Dorthe: Eine erfahrene Hübschlerin, die auf der Karriereleiter geklettert und jetzt sogar Frauenwirtin ist.
Ursel und Trude, Marie und Lena Freie Töchter, die am liebsten zeigen, was sie haben und das, was sie nicht haben, vortäuschen.
Alles, was Hannerl sonst noch so unterkommt:
Ignaz Mitterlehner: Der Henker, der seine schmutzige Arbeit mit schöner Kleidung erledigt.
Valentin Frühauf: Der Stadtrichter, dem schon so einiges untergekommen ist.
Eine Pfarrersköchin: in Maria Lanzendorf.
Michael Cnab: Ein enttäuschter Baumeister und gottbegnadeter Steinmetz.
Paul Thyrnau: Ein verwirrter Jüngling.
Perchtold Schutzberger: Ein Apotheker auf Abwegen.
Knecht Martin: Sein Diener mit dem Herz am rechten Fleck.
Cola di Rienzo: Ein italienischer Kaufmann, der nicht nur Olivenöl über die Alpen karrt.
Zofe Anna: Ein keckes junges Mädchen.
Maroni: Eine räudige, schon recht betagte Hündin, die aus lauter Futterneid einen Bissen zu viel macht.
Janus: Ein Querdenker unter den Hunden, der denkt, sein Lebenszweck ist es, quer durch die Stadt zu seinen Hündinnen zu laufen.
Viele Wienerinnen und Wiener, die feiern, saufen, essen, lamentieren, granteln, schimpfen und dabei recht glücklich sind, dass sie in der schönsten Stadt des Abendlandes leben.
Sonett
Es gibt Geschöpfe, die der Sonne Pracht
Mit ihrem stolzen Blick ertragen können,
Vom Lichtschein müssen sich die andern trennen
Und ziehn aus ihrem Dunkel erst bei Nacht.
(16. Sonett von Francesco Petrarca 1304 – 1374 nach einer Übersetzung von Bettina Jacobson)
Prag, Tag des Heiligen Jodokus (13. Dezember) 1378
Das aufgeregte Wiehern der Klagerösser klang noch immer in seinen Ohren, der gleichförmige Schritt der vermummten Sargträger pochte in seinem Inneren, und das Echo des Singsangs aus über 7000 Kehlen ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. Verzweifelt presste er seine schmalen Lippen zusammen, dass sie so weiß wurden wie seine zarte Haut. Seine blonden Locken klebten ihm verschwitzt im Nacken und gaben ihm das Aussehen eines kleinen Jungen, der, erhitzt vom Herumtollen, eine kurze Rast einlegt. Obwohl er nun schon 17 Lenze zählte, sah er bedeutend jünger aus und er wirkte verletzlicher, als es bei einem Jüngling seines Alters üblich war. Seine knochigen Knie schmerzten, und seine hellgrauen Augen tränten vom Rauch der unzähligen Kerzen, die das Innere der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche erhellten. Kurz hob er seinen vor Müdigkeit schweren Kopf und horchte auf das Mitternachtsgebet, die Matutin, das die Geistlichen eben anstimmten. Noch ganze sechs Stunden bis zur Prim, bis sich der Leichenzug wieder in Bewegung setzen würde! Sein Blick fiel auf die Regenmadonna, das Gnadenbild, zu dem alle beteten, wenn Dürre die Ernte zu vernichten drohte, und dann schaute er gleich wieder auf den aufgebahrten Leichnam, vor dem er nun schon seit Stunden kniete. Ein grimmiges Lächeln umspielte seine Lippen, denn größer konnte der Gegensatz wohl kaum sein: Die stillende Muttergottes mit ihrem nackten Busen einerseits und die eingefallenen Wangen des Toten andrerseits, umkränzt von Symbolen der Macht. Leben und Tod, Geburt und Sterben, zusammengepfercht auf wenige Zoll. Beschämt über seine unziemlichen Gedanken lehnte er die heiße Stirn in seine verschränkten Finger, die gepflegt und samtweich noch für keinerlei körperliche Arbeit herhalten mussten. Ein Kälteschauer ließ ihn erzittern, wenn er an die nächsten Tage dachte, wo der Leichnam weitergeschleppt werden würde. Von der Prager Hochburg zum Konvent des Heiligen Jakob, von dort in die Johanniterkirche und dann zum Veitsdom, wo bereits der Erzbischof und sieben weitere Bischöfe warteten, um die sterblichen Überreste in einer pompösen Zeremonie in Empfang nehmen zu können. Viel Vergnügen dabei, dachte er grimmig, denn nach den vergangenen 15 Tagen Trauerzeremoniell hatte der Leichnam, obwohl gewaschen, von Herz und Eingeweiden befreit und einbalsamiert, schon einen sehr eigentümlichen Geruch angenommen. Genauer gesagt bereitete dem Knienden der Verwesungsgestank, der sich im kerzenerhellten Inneren der Kirche nur umso schneller seinen Weg bahnte, bereits Brechreiz. Kurz hob er wieder seinen Kopf, um etwas durchzuatmen, und konnte gerade noch die Umrisse zweier hoher Herren ausmachen, die sich demütig dem Aufgebahrten näherten. Schnell senkte er wieder den Blick auf seine gefalteten Hände, denn alles andere käme einer Verhöhnung des Toten gleich und würde, von Hunderten von Augenpaaren beobachtet, hämischen Gesprächsstoff für Wochen geben. Aber das würde ihm nicht passieren, denn er wusste genau, wie er sich zu benehmen hatte, was von ihm verlangt wurde, und an erster Stelle stand der uneingeschränkte Respekt vor dem, der da lag und vor sich hin stank. Doch der kurze Blick auf seine französische Verwandtschaft, die sich näherte, um dem Verstorbenen ihre Referenz zu erweisen, reichte völlig, um ihn gedanklich in den vergangenen Sommer zu tragen, in den unermesslich großen Park, die acht voneinander getrennten Gärten, die Menagerie, die Volieren und Aquarien. Dorthin, wo einst Ludwig der Heilige seine Burg baute, war er an der Seite seiner beiden Vettern durch die neu errichteten Räume mit kostbaren Hölzern, Malereien und Wandteppichen geschritten. Hier am Rande der Stadt Paris, deren von Gestank und Krankheit benetzten Arme die Idylle von Hotel Saint-Paul nicht erreichen konnten, fühlte er sich sicher und unbeschwert wie noch nie in seinem Leben. Er vergaß damals schnell, dass sie zu politischen Gesprächen angereist waren, dass die Polenfrage erörtert werden musste, die gegenseitige Wertschätzung erneuert und gesichert, all das trat in den Hintergrund, als er vor der Büchersammlung von Karl und Johann stand. Während er jetzt in der Kirche kniete, und die Nacht nicht enden wollte, während immer wiederkehrende Gesänge der Nonnen und Mönche an sein Ohr drangen, trugen ihn seine Gedanken mit aller Kraft und Herrlichkeit in die Bibliothek des Königs von Frankreich. Er konnte ihn direkt erschnuppern, den süßen Duft der Ledereinbände. Er konnte das vornehme Knistern des Pergaments hören, die Erhabenheit der goldunterlegten Malereien an seinen Fingerkuppen spüren und die gestochen schwarzen Buchstaben mit seinen Augen gierig aufsaugen. Als wäre er gestern erst im warmen sonnenbeschienenen Frankreich gewandert und nicht auf der Brücke über die dezemberkalte und graue Moldau inmitten des Leichenzuges dahin getrottet, so unmittelbar und intensiv war die Erinnerung an diese kostbare Zeit. Den Kopf tief gesenkt, stöhnte er, nicht aus Gram und Kummer, wie die Umstehenden durch bedächtiges Kopfnicken und mitleidige Blicke zu bemerken schienen, sondern aus purer Lust. Das Gedenken an die kostbaren Stundenbücher Johanns, des Herzogs von Berry, trieb ihm einen wohligen Schauer über den Rücken. Diese Horarien, die für jede dritte Stunde des Tages Merkverse und Gebete in prächtigster Schrift und ausdrucksvollsten Illustrationen bereithielten, waren das Schönste, was er bisher an Kunstvollem gesehen hatte. Noch bedeutungsvoller war es für seine junge Seele, dass die Liebe zu den Büchern ein Vertrauen zu seinen Anverwandten schaffte, das er bislang in Hofkreisen vermissen musste. Karl, der König, und Johann, der Herzog von Berry, waren genauso bezaubert und hingerissen von den kostbaren Handschriften wie er selbst. Unermüdlich erklärten und beschrieben sie einander das, was das feine Pergament ihnen offenbarte: die Farbigkeit der Miniatur, den Kontrast der Goldtöne, die aufgesetzten Weißhöhungen und das unendlich tiefe Blau des Hintergrundes. Sie betrachteten es als ergötzliches Spiel, all die Andeutungen aufzudecken, die die geknoteten Tücher, Spruchbänder und Randfiguren demjenigen eröffneten, der die Symbole zu deuten verstand. Hier ein Anfangsbuchstabe des Stifters, dort ein kleiner Vogel auf einer Ranke aus weißen Lilien. Es war wie Rätselraten, aufregend und amüsant und sehr befriedigend, wenn sich all die Anspielungen, der Text und die Illustration zu einem Ganzen formten. Es schien, als ob die abgebildeten, kunstvoll verknoteten Tücher auch die drei Seelen verbinden würden und sie in ihrer innigen Liebe zu den Büchern einem Minneknoten gleich in ewiger Freundschaft vereinten. Berauscht von der Erinnerung hob er leicht seinen Kopf und versuchte, sie auszumachen in der Schar des Klerus und der Höflinge. Hier unter den allerhöchsten Gästen, denen die Ehre der Totenwache in vorderster Reihe zuteil wurde, mussten sie sein, seine Bücherfreunde. Heiße Freude stieg von seiner Brust auf und prickelte auf seiner Kopfhaut, als sich endlich seine Blicke geradewegs mit denen des Herzogs von Berry, seinem Vetter Johann, kreuzten. Kindlich naiv wollte er da weitermachen, wo sie unter der französischen Sonne geendet hatten, in schönen Handschriften blättern und sich an der Kunstfertigkeit in einem intellektuellen Spiel erfreuen, vereint und heiter. Umso unerwarteter und härter traf ihn dessen Mienenspiel bis ins Mark. Keine Freude des Wiedersehens, sondern Habgier, nicht Besorgnis über den Tod, sondern blanke Gewalt, nicht Toleranz mit der Jugend, sondern Rebellion sah er im Antlitz seines Verwandten. Da legte sich die Gewissheit, dass nichts mehr so sein würde wie bisher einem schweren Leichentuch gleich auf seine federleichte Seele und erdrückte sie. Denn wie die Aasgeier warteten sein Vetter und all seine Mitstreiter darauf, dass sie sich einen großen Brocken des reichen Erbes für sich selbst sichern konnten. Um ihn, den kunstsinnigen Jüngling, ging es längst nicht mehr, er war nur der, der ihnen kurzzeitig im Weg stehen würde. Da barst etwas in seiner Brust, die Erschütterung drang bis in die kleinste Ader vor, umspülte seinen Kopf, lähmte kurz all sein Denken. Aber er verstand und blickte angeekelt in die entstellten Gesichtszüge der Leiche, in der noch vor etwas mehr als zwei Wochen das Herz eines Löwen geschlagen hatte und unter dessen Schutz er seine ihm innewohnende Zartheit und Empfindsamkeit ausleben konnte. Nichts als eine graugrüne stinkende Hülle war übrig geblieben, verbrämt mit den Insignien des Herrschers des Heiligen Römischen Reiches. Und da sah er sich selbst knien, bar jedes Schutzschildes, ausgeliefert den Launen seiner Gegner, die keinen Augenblick zögern würden, ihn mit Waffengewalt und Intrige zu knechten. Nie wieder würde er sich seiner Liebe zu den Büchern so uneingeschränkt hingeben können wie bisher. Wenzel, Wenzel, du hast deine Liebe verloren, sie war der Preis für die Macht. Diese Einsicht traf ihn mit aller Wucht, und tief in seinem Inneren riss das zarte Band seiner Seele in einem qualvollen Schmerz entzwei, und er weinte laut und hemmungslos über das Bild, das sich vor seinem geistigen Auge auftat. Die losen Enden des gesprengten Liebesknotens baumelten verwirrt umher. Aus einem Ganzen waren zwei Hälften geworden, die nicht zueinander passten, die sich ewig bekämpfen und nicht mehr finden würden. Krieg um ihn herum, Rebellion und Blut, aber – was viel schlimmer war – erbitterter Kampf auch in seinem innersten Wesen, der ihn einmal in diese und einmal in jene Richtung taumeln lassen würde. Kein festes Band würde ihm helfen, kein sicherer Knoten Halt geben. Langsam und stetig war König Wenzel, Herrscher über das Heilige Römische Reich von Gottes Gnaden bereits jetzt dabei, sich selbst zu verlieren und in einem bedrohlichen, undurchschaubaren Blau zu ertrinken.
Burg Kreuzenstein, eine Tagesreise von Wien entfernt zu Maria Empfängnis (8. Dezember) 1383
»Kennst du die Stephansminne?«, fragte er so heiter und unbeschwert, als sei er bei einer Festlichkeit an einem Herzogshof und nicht in diesem stinkenden Loch.
»Verschon mich bloß mit deinem elenden Geschwätz!«, kam es unwirsch vom anderen.
»Schön, ich will ich dir darüber erzählen, es ist wieder so ein lächerliches Zauberzeugs!«, meinte er mit einem Grinsen, als habe er die Bösartigkeit in der Stimme seines Gegenübers schlichtweg überhört.
»Ich will dein Gewäsch nicht hören, elendes Gequassel …«
»Die Stephansminne soll ein wundersames Mittel sein, du wirst dich sicherlich fragen …«
»Nein, du irrst, ich frage mich nicht …«
»Es ist ein Wein, ein besonderer. Ein Wein, so rot wie das Blut des Märtyrers Stephan – das alleine ist ja schon ein Witz …«
»Ich pfeif auf deine Witzchen, Alter …«
»Gesegnet und geweiht soll er vor Zauberei, Vergiftung, Blitzschlag, und Ertrinken helfen, gar vortrefflich in …«
Zornig stampfte der andere nun mit dem Fuß auf den kalten Boden: »Ich hab gesagt, du sollst aufhören damit, ich will nichts davon hören, ich …«
Unbeeindruckt setzte der Alte mit seiner ruhigen Stimme fort: »Dieser Wein soll so mächtig sein, dass er Männer stark macht, Frauen schön, dass er helfen soll in allen erdenklichen mühevollen Lasten des Lebens. Wenn er gar nichts bei den Lebenden bewirken kann, so …«
»Sei still, ich bitte dich, sei still …«
»… bringt er wenigstens einen schönen Tod.« Ruhig und fest blickte der Alte dem Jüngeren in dessen dunkle Augen. »Glaubst du an diesen Unsinn, oder bist du bereit, dich eines Besseren belehren zu lassen?«
Da brach der junge Mann schluchzend zusammen und krallte seine schmutzigen Finger in sein schwarzes Haar. Der Alte erhob sich langsam, kauerte sich neben ihn und legte seinen Arm schützend um die bebenden Schultern des Weinenden. Beruhigend strich er über das grobe Leinenhemd. Doch auf einmal nahm etwas anderes seine Aufmerksamkeit gefangen. Witternd wie ein Hund sog er plötzlich die Luft ein und wandte seinen Blick starr geradeaus. Angestrengt horchte er in die Stille, die sich, nur unterbrochen von vereinzelten Schluchzern des Jüngeren, wie ein schweres feuchtes Tuch über die beiden senkte. Dennoch schien er etwas zu hören.
»Na endlich, sie kommen«, murmelte er und setzte sich gerade hin, um zu warten, dass das eintrat, was sein Verstand längst als beschlossen erachtete.
Denn keine 1000 Schritte entfernt kämpfte sich eine kleine erschöpfte Gruppe von Reisenden, die mit einem Maulesel und einem Handpferd unterwegs war, durch den nasskalten Dezembertag. Allesamt froren sie erbärmlich. Jetzt, als der Morgen dämmerte, wappneten sie sich, um die letzte Etappe zur Burg zu erklimmen. Wie schweres Gewicht legte sich die kalte Luft bei jedem Atemzug auf die Lungen der stumpf dahinstapfenden Männer. Niemand von ihnen verstand, warum sie mitten in der Nacht aufbrechen mussten, um den im Winter sowieso schon gefahrvollen Weg durch die undurchdringlichen Donauauen mit lächerlichen Laternen, die gegen die Dunkelheit nicht viel ausrichten konnten, zurückzulegen. Von höchster höfischer Stelle, sagte man, und das musste genug sein. Schimpfend und fluchend kämpften sie sich über zugefrorene Pfützen, stolperten über mit Eis überzogene Wurzeln und rutschten mit ihren dünnen Sohlen über vereinzelte Schneebretter. Dann, zunehmend erleichtert und völlig ausgefroren, sahen sie im blaugrauen Licht des frühen Morgens schemenhaft den alten Palas mit den zwei rundbogigen Fenstern und die flankierenden Türme mit den Erker-Aufbauten auf der Anhöhe. Jenseits der Zwingermauer erhob sich der gewaltige Bergfried mit seinen bis zu drei Klafter dicken Mauern. »Hier entlang«, murmelte der Anführer und deutete hinter die Burgkapelle, wo sich neben Gesindehäusern auch die Stallungen und Speicher befanden. »Lebt nicht schlecht, unser Landrichter«, bemerkte der alte Mann und pfiff durch die Zähne. Doch weil er wegen der bitteren Kälte sein Gesicht hinter einem dicken Tuch aus Wolle verborgen hatte, konnte ihn keiner seiner Mitreisenden hören. Müde sattelten sie ihre Tiere ab, setzten sich gleich zu ihnen ins Stroh und bemühten sich, vor lauter Müdigkeit nicht sofort wegzudämmern. Fast lautlos betrat ein Knecht der Burg die Stallungen, beladen mit Eimern voll Hafer für Pferd und Maultier und einem kleinen Korb, wo ein karges Frühstück, bestehend aus Graubrot und warmem Met, für die Reisenden in grobe Tücher gewickelt war.
»Der Herr lässt euch ausrichten, dass ihr ein wenig rasten könnt, bevor es wieder zurück geht.« So schnell, wie er gekommen war, verschwand der Knecht und ließ die übermüdete Reisegruppe fassungslos zurück. In ihrer Bestürzung vergaßen sie kurz auf gefrorene Zehen und klamme Finger, auf die bleierne Müdigkeit und ihre schweren Beine. Wie ein mächtiges Gebirge, schwarz und unbezwingbar, tat sich der Gedanke an den beschwerlichen Rückweg durch den kalten Wintertag vor ihnen auf. Verzweifelt ließen sie den Kopf in die Knie sinken.
Indessen dort, wo der Palas in Wohnräume unterteilt war, weit weg von der müden Gruppe, lächelte der Alte im finsteren Loch. Siegessicher grinste er in sich hinein und sah dann wieder mitleidig zu seinem jüngeren Mitgefangenen.
»Diese feigen Schweine, wenn ich sie in die Finger bekomme, ich bring sie um …«, ertönte es sogleich von diesem. Polternd erhob sich dessen schlanke Gestalt vom feuchten Stroh, das in der dunklen Ecke aufgeschüttet war. »Er kommt und kommt nicht, ich versteh das nicht!« Unruhig durchmaß der junge dunkelhaarige Mann, der sich offensichtlich von seinem Weinkrampf erholt hatte, nun die kleine muffige Kammer in wenigen langen Schritten, bevor er sich umdrehte und händeringend wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrte. Mit seinen dunklen Augen starrte er durch die Schlitze des kleinen, mit groben Holzlatten vernagelten Fensters und zischte: »Es graut schon der Morgen, mein Gott, so lange haben sie ihn ja noch nie da drüben festgehalten.« Wieder nahm er seine unruhige Wanderung auf, verharrte und fasste sich mit Daumen und Zeigefinger an seine Nasenwurzel. Plötzlich war wieder leises Schluchzen zu hören: »Ich halte das nicht mehr aus. Was machen sie nur mit ihm? Wie soll ich ihm denn nur helfen?« Wieder ging er auf und ab, wehklagend und sich mit den Händen durch die struppigen Haare fahrend. Dann mit einem Mal drehte er sich um und trat mit solcher Wucht gegen die massive Holztür, dass der schwere Riegel, der von außen vorgelegt war, erzitterte. »Lasst mich raus, hört ihr, nehmt mich, ihr feigen Schweine, nicht ihn …« Immer wieder trat er mit seinem groben, an einer Stelle der Sohle bereits eingerissenen Stiefel an die Tür und schrie wie ein Besessener: »Nehmt mich, wenn ihr euch traut, da und da …« Die Tür erbebte unter den massiven Schlägen, die Angeln quietschten leise, doch das Holz war zu stark, um nachzugeben. Da packten ihn unversehens zwei starke Hände von hinten und rissen ihn zurück in die Mitte der Kammer: »Lass gut sein, mein Junge, lass gut sein!«, murmelte der alte Mann, der seine Arme gleich ehernen Klammern um den Oberkörper des Wütenden geschlungen hatte. Doch der junge Mann wehrte sich, stieß weiter mit seinem Stiefel nach vorne, obwohl er nun zu weit weg war, um die Tür erneut zu treffen. Wie von Sinnen schlug er weiter in die Luft, versuchte, sich von den starken fremden Armen zu befreien, schüttelte seinen Kopf und spürte doch, dass der Griff des anderen zu fest war, um sich zu befreien. Da ließ er nach, und sein Körper erschlaffte von einem Augenblick auf den anderen. Er sank in sich zusammen und weinte wieder hemmungslos. Nur langsam lockerte der andere seinen Griff und ließ sich mit dem Jungen zu Boden gleiten. Ihn weiter von hinten umfassend, murmelte er: »Hör auf zu toben, so kannst du ihm nicht helfen!«
»Aber wie, wie denn?«, stammelte dieser unter weiteren Schluchzern mühsam.
»Indem du Ruhe bewahrst und deinen Verstand benutzt!«, antwortete der Ältere, überzeugte sich noch einmal, dass der Anfall von Jähzorn verebbt war, und hockte sich ihm gegenüber auf den kalten Boden aus gestampftem Lehm.
»Wie kann ich ruhig sein, wenn ich mir vorstelle …, nein, wenn ich weiß, was diese Schweine mit ihm da unten im Bad anstellen, wie …« Weinend verstummte er und vergrub sein Gesicht in den schmutzigen Handflächen.
»Bleib ruhig, mehr kann ich dir nicht sagen!« Seufzend erhob sich der Ältere, fasste sich mit der Hand in den Rücken und richtete sich schwerfällig gerade auf. Wie wenn nichts passiert wäre, murmelte er belanglos: »Verdammte Kälte, die mir in die Knochen fährt, und erst Maria Empfängnis, da dauert es noch so lang …«
»Zur Hölle sollst du fahren, du und alle anderen hier mit deinem blöden Geschwätz!« Mit vor Wut heiserer Stimme stemmte sich nun auch der junge Mann in die Höhe und lehnte sich an das kalte Mauerwerk gegenüber der Tür, die er nicht aus den Augen ließ.
»Dass du deine ganze Wut an mir auslassen willst, wird dir auch nicht helfen, mein Sohn!«, antwortete der Ältere gelassen und blickte ihm ruhig in die Augen.
Verzweifelt flüsterte dieser: »Ich komm ja zurecht, aber der Kleine, der jetzt da drüben …«
»Ach hör doch auf damit!«, entnervt schüttelte der Ältere seinen Kopf, »natürlich suchen sie sich den Schwächeren aus, wen denn sonst? Was kann man denn von denen schon erwarten, diesen Speichelleckern, die auf die Unteren treten und die Oberen hoffieren. Ist doch immer dasselbe. Ich bin froh, wenn ich da raus bin, das kann ich dir sagen!«
»Was macht dich denn so sicher, dass du freikommst?«, fragte ihn der Jüngere und sah ihn verdattert an.
»Weil ich meinen Kopf benutze und nicht so wie du deine Fäuste oder was sonst noch!«, damit zeigte er auf die Stiefel, »du musst nur eins und eins zusammenzählen. Mein Wissen hat gestört bei dunklen Machenschaften, also wurde ich sicher verwahrt. Jetzt dürften sie ihre Geschäfte mit den Dummen unter Dach und Fach haben, also darf ich wieder gehen. So einfach ist das!«
»Über wen sprichst du jetzt?«
»Ich bin nicht so dumm, hier in der Burg des Landrichters seinen Namen zu nennen, mein Sohn. Und außerdem, denk nach, du weißt es ja ohnehin. Ich spreche über ihn, der glaubt allmächtig zu sein, weil er im Dunstkreis des Herzogs agiert, weil er ihm seine Schuhe putzen darf, ihm seinen Trank reichen, seinen Holzlöffel abwaschen oder sonst etwas Wichtiges …«
»Was macht dich so sicher?«, ungehalten unterbrach ihn der junge Mann.
»Ich störe ihn nicht mehr, ich kann bald gehen.«
»Und wenn er beschließt, dich länger hierzubehalten, dich einfach hier wie Dreck verfaulen zu lassen? Was ist, wenn er dich einfach … vergisst?«
Grimmig lächelte der Ältere und fuhr sich über seinen viel zu großen Mund: »Das würde er nicht wagen, dieser feige Schnösel! Dafür hat er zu wenig Mumm in den Knochen und ich zu viel Wissen in meinem Kopf! Schau, nicht einmal in den Kerker zu den anderen armen Seelen hat er uns geworfen, sondern uns eine eigene feine Kemenate gegeben. Wir sind etwas Besonderes!« Grinsend sah der Ältere auf das faulige Stroh, den schmutzigen Aborteimer, den kalten Boden und die rauen Wände.
Unbeteiligt nickte der junge Mann. »Wenn du meinst«, seufzend fuhr er fort, »so sieht es vielleicht bei dir aus. Bei uns, meinem Bruder und mir, da liegt die Sache freilich anders. Ich glaube nicht, dass er da nachgeben wird, dafür ist die Gefahr, selbst unter die Räder zu kommen, zu hoch.«
»Wart’s ab«, antwortete der Ältere.
»Ich hab es verlernt, zu warten, mein Freund«, seufzte der junge Mann, und Stille breitete sich zwischen den beiden aus, belastende und unheilschwangere Ruhe in der kleinen finsteren Kammer, die mehr Verlies als Wohnraum, mehr Kerker als Schlafstatt war. Die Gedanken des jungen Mannes wanderten Monate zurück, als sie festgenommen in einem Kaff inmitten von Böhmen ihrer Verurteilung harrten. Bis jetzt wussten sie nicht, wer ihren Zufluchtsort verraten hatte. Als sie zurückgebracht wurden nach Wien, die Stadt, wo ihrer aller Verderben den Anfang genommen hatte, wo die Intrigen bei Hof Gewalt und Unrecht für jene bedeuteten, die unabsichtlich in den Weg der Mächtigen traten, konnten sie bereits erahnen, was ihnen bevorstand. Da fragte niemand mehr nach dem Verräter, da galt es nur mehr, das Leben, so erbärmlich und armselig es auch war, zu retten. Unbarmherzig wurden sie gefoltert und gequält, um dann wie ein lebloser Sack beiseite geschafft zu werden. Mit Schaudern dachte er an die Tage im Kärntnerturm, als der Pöbel an ihrem Gefängnis vorbeimarschierte, Schimpftiraden brüllend, spuckend und grölend. Angstschweiß trat noch heute auf seine Stirn, als die Bilder der Überstellung ins Schergenhaus in der Rauhensteingasse in sein Gedächtnis traten. Das völlige Ausgeliefertsein an den Henker und seine Knechte verursachte dem jungen Mann, der sich inzwischen wieder auf das Lager aus schmutzigem Stroh begeben hatte, schon bei der Erinnerung wieder Beklemmungen, und er griff sich unweigerlich an den Hals. Aber er konnte die Gedanken nicht bremsen, wie Giftstachel drangen sie in sein Bewusstsein und ließen ihn den Gang über den Lichtensteg zur Schranne immer wieder von Neuem durchleben, ließen ihn das Urteil, das von der Balustrade aus verlesen wurde, immer wieder hören. Wie sie dastanden, er und sein junger Bruder, mit der Schandfiedel um den Hals, kaltes Eisen, das sie nur keuchend atmen ließ. Als die Leute sie geifernd anstarrten, als sie mehr gestoßen und getreten als geführt, mehr geschlagen und geschunden als gelenkt wurden. Dann die schneidende Stimme des Henkers, des Hochverrats angeklagt und dem Landesgericht zugewiesen. Nach fünf Stunden in einem offenen Wagen erreichten sie schließlich halb erfroren die Burg und warteten seitdem in diesem stinkenden Loch. Wieder verbarg er sein Gesicht in den Händen und weinte leise um seinen jüngeren Bruder, der immer ein wenig mehr angespuckt, geschlagen, getreten und gequält wurde als er selbst, und er erkannte, dass allein diese Tatsache ihn mehr schmerzte als alle Demütigungen und Schläge, die er einstecken musste.
»Aber mein Junge, das bringt dich nicht weiter, sieh nach vorne«, der Ältere war zu seiner Lagerstatt gekommen und tätschelte ihm die Schulter. Einmal mehr vermeinte der Angesprochene, die Aura des Unheimlichen um diesen alten Mann zu spüren, und er war fest überzeugt, dass dieser seine Gedanken lesen konnte. Umso heftiger entzog er sich dieser Erkenntnis durch Wut und Zorn.
»Du … du hast ja keine Ahnung, was mein Bruder und ich durchgemacht haben!«
»Oh doch, mein Lieber. Oh doch!«
Um ihn abzulenken, fragte ihn der Ältere, obwohl er die Antwort bereits kannte: »Wie hoch ist das Bußgeld? Sag es mir noch einmal und alles, was dir dazu noch einfällt, es könnte wichtig sein! Gebrauch deinen Verstand, das ist alles, was du noch hast!«
Seufzend begann der junge Mann: »100 Pfund. Wenn nicht bezahlt wird, trennen sie uns nacheinander Körperteile ab, eines nach dem anderen. So lautete das Urteil. Bei den Händen beginnen sie und arbeiten sich dann bis zu den Füßen weiter. Aber das ist ihnen nicht genug. Sie wollen nicht warten und vertreiben sich die Zeit, inzwischen meinen Bruder seelisch zu verstümmeln.«
»100 Pfund, sagst du?«, der Ältere ging bewusst nicht auf die weiteren Worte ein und senkte nachdenklich seinen Kopf, »eine nicht unerhebliche Summe.«
»Zu hoch für unseren Vater, denn er hat bereits all seine Pfründe verkauft. Es ist nichts mehr da.« Abwesend rupfte der junge Mann die graubraunen Strohhalme. »Nur mehr das Haus für die Familie und ein kleineres unter den Goldschmieden.«
»Warum hast du mir das nicht schon früher erzählt?«, fragte der Ältere überrascht.
»Das habe ich doch! Ich erzähle doch dauernd nur davon! Mein Vater hin, mein Bruder her. Ich dreh mich im Kreis …«
»Das mit dem Bußgeld hast du erzählt, das mit deinem Vater, dem Elternhaus, ja. Aber von dem kleineren höre ich zum ersten Mal! Was sagst du da, unter den Goldschmieden, nahe dem Dom und dem Stock im Eisen?«, fragte der Ältere interessiert.
Der junge Mann nickte gleichgültig, um gleich darauf auf die Beine zu springen und sich eng an die Wand zu drücken. Lautes Poltern war von draußen zu hören, grölendes Lachen und dazwischen Jammern und Wehklagen, das er nur zu gut kannte. »Oh mein Gott, sie bringen ihn, oh mein Gott!« Wütend wollte er zur Tür stürzen, dessen Riegel mit einem Ruck zurückgeschoben wurde. Aber der Ältere war schneller und fasste ihn einmal mehr an den Armen. Dicht an seinem Ohr zischte er: »Mäßige dich, mach euch beide nicht unglücklich! Bleib stehen!« Unerbittlich fest war sein Griff, und beide sahen schwer atmend zu, wie die Tür geöffnet und ein schmächtiger Jüngling, etwa 14 Lenze zählend, bei dieser Kälte nur mit einem groben Hemd bekleidet, das gerade einmal sein nacktes Gesäß bedeckte, wie ein Bündel Heu von zwei Knechten hereingeworfen wurde.
»So, jetzt ruh’ dich ein wenig aus, du Lustknabe, dass du abends wieder zu gebrauchen bist!« Lachend nickten sie den beiden Männern in der Kammer zu und grinsten frech, als sie die zornerfüllten Blicke des einen sahen und das beschwichtigende Murmeln des anderen hörten. Als der junge Mann Anstalten machte, sich vom Griff des Älteren zu befreien, zogen sie es jedoch vor, sich schnell umzudrehen, die Tür von außen wieder zu verriegeln und polternd das Weite zu suchen. Vorsichtig näherten sich der Alte und der junge Mann dem am Boden Liegenden. Als ihm sein Bruder helfen wollte, sich umzudrehen, begann der Jüngling zu schreien: »Fass mich nicht an, geh weg!« Zitternd und unter großer Anstrengung ging er in die Hocke und umfasste mit seinen Armen seine Oberschenkel. Mit stumpfem Blick starrte er zu Boden und begann, sich hin und her zu wiegen. Doch sobald einer der beiden Anstalten machte, auf ihn zu zu gehen, begann er wieder laut zu schreien. Der Jüngere blickte auf den Älteren und deutete entsetzt auf die Würgemale am Hals, die Blutergüsse an den Schenkeln und die Druckmale an den Handgelenken. »Heiliger Morandus, hilf!«, murmelte er, schlug ein Kreuzzeichen und wandte sich wimmernd von seinem Bruder ab. Da hielt ihn der Ältere mit festem Griff zurück und widersprach zornentbrannt: »Dieses ewige Heiligengeschwätz von euch Stümpern, das niemandem hilft. Hör mir nur ja auf damit! Was habe ich dir die letzten Wochen hier unentwegt gepredigt? Hast du das schon vergessen? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!« Verdutzt starrte ihn der junge Mann an. Nur selten wurde der Alte so laut. Und noch immer hatte er sich nicht beruhigt und schimpfte etwas von »nutzloser Knochenverehrung« und »Schindluder treiben«. Dann sah der Junge zu, wie dieser in einem ledernen Reisebeutel, den er unter dem Stroh versteckt hatte, kramte und ihm ein kleines Fläschchen Tinktur in die Hand drückte. Der Alte deutete auf den am kalten Boden hockenden Bruder. »Da – sieh zu, dass er das nimmt.«
Unsicher ergriff der junge Mann das kleine, fein gearbeitete irdene Fläschchen und fragte leise. »Melisse? Oder Baldrian?«
»Nein«, erwiderte der Ältere unwirsch, »da hilft kein Melissenkraut mehr. Schlafmohn. Schau, dass du es ihm irgendwie einflößt, sonst kommt er gar nicht mehr zur Ruhe.«
Damit drehte er sich schroff um und überließ es dem anderen, dem Jüngling ein paar Tropfen der Tinktur auf die aufgesprungenen Lippen zu träufeln. Unter aller Aufbietung von Geduld und sanftem Zureden gelang es diesem endlich, seinem jungen Bruder etwas mehr von dem Zeug einzuflößen. Nach kurzer Zeit wurden die Lider des Jungen schwer, und gemeinsam machten sich die beiden Männer daran, ihn, so gut es ging, auf das Stroh zu betten und seine Wunden anzusehen. Während der Ältere Honig und Hanfstücke aus seinem Beutel zutage förderte und die offenen Schürfwunden versorgte, säuberte der Jüngere den geschundenen Körper mit ausgefransten Lappen. Dabei schimpfte der Ältere unentwegt und meinte ernst: »Lange wird dein Bruder dem nicht mehr standhalten können. Diese Schweine werden ihn nicht in Ruhe lassen.« Damit strich er dem Schlafenden den blonden Haarschopf zurück und fluchte, als er eine große Beule hinter dessen Ohr bemerkte. »Abgesehen von solchen Blessuren hat er bereits Angstzustände, verbunden mit Atemnot und Schweißausbrüchen.«
»Was soll ich machen?«, fragte der junge Mann verzweifelt.
»Auf keinen Fall den Heiligen Morandus oder wen auch immer anrufen, auch wenn er gegen Besessenheit wirken soll!« Wieder mischte sich Zorn in seine Stimme, der aber sofort verschwand, als er dem Jüngling über den aufgeschürften Hals strich und sich daran machte, eine Heilsalbe aufzutragen. »Der hier ist nicht besessen, der ist geschunden und geschändet, da hilft kein Kreuzzeichen, sondern nur dein Verstand.«
Betreten schwieg der junge Mann.
»Jetzt sag mir, wo dein Vater dieses Haus hat!«, polterte der Ältere weiter.
»Unter den Goldschmieden gleich gegenüber …«
»Wo erreiche ich deinen Vater?«, unterbrach ihn der Alte schroff, »in deinem Elternhaus?«
»Ja, dort hat er sich verkrochen, bei Hof ist er ja längst nicht mehr zugelassen«, meinte der junge Mann resigniert.
»Gut, ich werde sehen, wie schnell ich das Geld auftreiben kann«, murmelte der Ältere eher zu sich selbst als zu seinem Gegenüber.
»Ich hoffe, du hast ein wenig von dem, was ich dir gezeigt habe, behalten. Merke: Gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Gegen fast alles, nur nicht gegen die Dummheit der Menschen. Du hast Talent, mein Guter, nutze die Macht der Säfte und Salben! Mach dir die Wirkung der Pflanzen und Kräuter zu eigen! Du willst dich rächen?«
Entschlossen nickte der junge Mann.
»Nur zu, aber mit deinem Verstand, mit deinem Wissen, denn das fürchten die Dummen dieser Welt mehr, als alle Waffengewalt es vermögen könnte! Merkst du dir das?«, fragte er drängend.
Der Jüngere nickte stumm.
»Gut. Denn es würde mir leidtun, wenn ich die Zeit, die ich hier absitzen musste, gänzlich vergeudet hätte! Und hör mir zu: Ich habe hier«, damit zog er einen Tiegel aus seiner Tasche, »ein ganz spezielles Fett zum Einreiben. Es macht die Haut warm und hitzig, und so, wie ich es bei deinem Bruder einschätze«, hier strich er dem Schlafenden über die helle, zarte Haut, »wird er ziemlich stark darauf reagieren.«
»Was heißt das?«, fragte der junge Mann argwöhnisch.
»Er wird Pusteln und Quaddeln bekommen, die hitzen und jucken werden! Fürchterlich jucken! Er wird sich andauern kratzen, wird jammern und wehklagen …«
»Aber …«
Ungeduldig unterbrach ihn da der Ältere: »Das musst du in Kauf nehmen. Lass dir was einfallen, erfinde irgendeinen Aussatz. Die haben ja sowieso keine Ahnung, aber es wird diese Schweine auf Abstand halten, nicht lange, aber doch einige Zeit.«
»Du meinst, ich soll sagen, dass er krank ist, mein Bruder?«
»Schwerkrank. Aussatz und Fieber. So, und jetzt lass mich machen. Ich werde mich um eure Belange kümmern. Verlass dich auf mich und auf deinen Verstand und lass mir die Heiligen in der Kirche. Dort, wo sie hingehören!«
Dann nahm er seelenruhig seine Tasche und trommelte mit den Fäusten so lange an die Tür, bis sie von einem finster dreinschauenden Knecht geöffnet wurde. Der Junge traute seinen Augen nicht und hörte den Alten sprechen: »Ich war jetzt lange genug hier. So wahr ich Mathias Bonus von Venedig bin, führe mich auf der Stelle zu deinem Dienstherrn. Ich gedenke, deine Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch zu nehmen.« Verdutzt starrte ihn der Knecht an. »Na, wird’s?«, donnerte der Alte und gab – der junge Mann hielt den Atem an – dem Knecht eine schallende Ohrfeige. »Wenn du nicht auf der Stelle das tust, was ich verlange, dann wird dich der Fluch des Heiligen Rochus treffen, und ich wünsche dir die Pest an den Hals!« Augenzwinkernd drehte sich der Ältere um und grinste den jungen Mann, der über seinen Bruder gebeugt war, an. Der Knecht indessen bekreuzigte sich und trat beflissen zur Seite, um den Alten vorbei zu lassen. Sprachlos blickte der Jüngere dem Älteren nach, als dieser sich umdrehte und ihm schnell noch ein kleines Fläschchen zuwarf. Ungeschickt konnte er es gerade noch auffangen, bevor es zu Boden fiel. Lächelnd winkte ihm der Alte zu und verschwand, den verdutzten Knecht hinter sich her ziehend. Der junge Mann sah nach seinem schlafenden Bruder und stellte sich in Gedanken versunken zum Fenster. Nach einer geraumen Zeit konnte er zwischen den fingerbreiten Ritzen gerade noch einen Trupp Reisender sehen, die, von den Stallungen kommend, die Burg verließen. Auf einem Pferd vermeinte er, seinen ehemaligen Mitgefangenen zu erkennen. Nachdenklich drehte er das Fläschchen in seiner Hand und, als ob er erst jetzt gewahr wurde, dass er etwas in seinen Händen hielt, starrte er auf das Etikett. Stephansminne stand darauf in schönen, schnörkeligen Buchstaben geschrieben, für einen schönen Tod.
Darunter stand dann noch in weniger gestochener Schrift: Nur für die, die daran glauben! Alle anderen müssen so ihr Leben meistern!
In diesem Augenblick verfluchte der junge Mann seinen scharfen Verstand, nur zu gerne wollte er nach einem Schluck aus dem Fläschchen selig dahintreiben und sich leise fortstehlen aus dieser Welt, bar jeder Verantwortung, frei von der erdrückenden Last seiner Sorgen.
Wien, am Tag des Heiligen Blasius (3. Februar) 1384
»Des brauch i nimmer, des konnst da sonst wohin stecken!« Die ganz und gar nicht mehr junge Frau im grauen Habit der Büßerinnen lief geduckt über den Wirtschaftshof des Klosters. Es war später Vormittag, doch noch immer hatte sich die Sonne nicht durch den dichten, kalten Nebel gekämpft. Es würde heute den ganzen Tag bewölkt und grau bleiben, was aber die geringste Sorge der Flüchtenden war. Knapp neben ihr fiel nämlich ein irdener Krug, der schon einmal bessere Zeiten gesehen hatte und dessen Henkel auf einer Seite abgebrochen war, mit einem lauten Krachen zu Boden und zerbarst in lauter kleine rote Tonsplitter. Schützend hielt die Frau die Arme über den Kopf und lief noch ein wenig schneller, denn das nächste irdene Trumm war bereits im Anflug und verfehlte ihre abgetretenen ledernen Sandalen nur um wenige Zoll. Bestürzt kam ihr eine weitere Büßerin zu Hilfe und schrie in Richtung Küchentür, aus der schon wieder etwas angeflogen kam: »Ja spinnst jetzt endgültig, Hanna, haben sie dir ins Hirn g’macht, oder bist von selber wo angrennt!« Damit half sie der alten Büßerin weiter, indem sie beherzt deren welke Unterarme ergriff und sie schnell aus der Wurflinie zog. »Ach lass gut sein, Wuckerl!«, meinte diese abwehrend, »kennst doch unsere Hanna!« Damit retteten sich beide Frauen in den nächsten Durchlass, der zum großen Schlafsaal der Büßerinnen führte. Schnaufend sahen sie sich an. Als sie wieder halbwegs zu Atem gekommen waren, bemerkte Wuckerl trocken: »Weißt, Martha, nur weil die Johanna gut wirtschaften kann und eine vortreffliche Köchin ist, kann sie sich nicht alles erlauben. Mir stinkt es jetzt langsam, wie sie uns alle herumkommandiert, und von ihren Wutausbrüchen hab ich erst recht die Nase voll!«
»Aber, aber«, winkte Martha erneut ab und ließ sich schwerfällig auf den kalten Steinboden sinken, »die weiß zurzeit ja gar ned, was sie macht!«
»Ein Grund mehr, um es ihr einmal tüchtig zu mischen. Ich werd’s der Meisterin stecken, dass sie sich aufführt wie das ärgste Marktweib, so was kann man nicht durchgehen lassen!«, entrüstete sich Wuckerl mit hochrotem Gesicht und steckte sich ein paar ihrer inzwischen angegrauten widerspenstigen Locken unter die Haube, was aber wenig Sinn hatte, denn umso resoluter sie diese hineinstopfte, umso mehr Haare kringelten sich wieder heraus. Entnervt strich sie sich über die Stirn und seufzte.
Mit einem kleinen Lächeln schaute Martha zu ihrer alten Freundin auf: »Ach lass, Wuckerl, die Hannerl kannst genauso wenig ändern wie dein Haar. Machen beide, was sie wollen. Und schwer hat sie es ja auch zurzeit unsere Hannerl …« Nachdenklich wiegte sie den Kopf.
»Aber geh!«, wischte Wuckerl die Bemerkung Marthas mit einer eindeutigen Handbewegung weg, »nur weil ihr der Essig ausgegangen ist, braucht sie nicht das ganze Kloster zu tyrannisieren. Du siehst das durch die nachsichtigen Augen einer langjährigen Freundin, Martha.«
»Nein, du siehst das durch deinen engstirnigen Blick!«, unterbrach Martha heftiger als beabsichtigt, und fuhr versöhnlicher fort: »Schau, Wuckerl, die Hanna hat es geschafft, uns Frauen hier im Kloster der Reuigen Büßerinnen mitsamt unseren Bälgern, die wir von Berufs wegen gleich dazu bekommen haben, Arbeit zu geben! Das ist schon was!«
»Ja mei«, lenkte Wuckerl ein, »wir haben mit dem Wein auch so genug verdient, die ganze Essigbrauerei, ich weiß nicht … auch die jungen Frauen unter uns meinen, dass dieses saure Gebräu …«
»Nein und nochmals nein«, Martha reagierte nun eher zornig als heftig, »du müsstest es wirklich besser wissen, als die dazugekommenen jungen Dinger, die keine Ahnung haben. Uns ehemaligen Dirnen im Kloster Sankt Hieronymus ist der Ausschank von Wein bei Strafe verboten!«
»Wer sagt das?«
»Niemand Geringerer als der Herzog und der Bürgermeister. Es steht in unseren Satzungen, schwarz auf weiß.«
»Aber warum haben wir dann so weitläufige Weingärten in Grinzing als Stiftungen? Sollen wir den ganzen Rebensaft selber saufen?«
Verzweifelt schüttelte Martha den Kopf: »Du hast gar nix verstanden, Wuckerl. Schau, die Stiftungen sollen uns helfen, über die Runden zu kommen. Die Trauben haben wir vor der Essigbrauerei den bestbietenden Weinbauern verkauft und davon haben wir recht und schlecht gewirtschaftet.«
»Eben!«
»Nix eben. Die haben uns das Weiße aus den Augen genommen, uns über den Tisch gezogen, weil sie genau gewusst haben, dass wir keinen Ausschank betreiben dürfen. Erst als unsere Hannerl aus dem Wein Essig gemacht hat, haben wir gute Geschäfte gemacht. Wir müssen uns selbst erhalten, Wuckerl, bis auf ein paar milde Zuwendungen von hohen Bürgern aus dem Rat, ein Fass Heringe da, ein paar Ziegen und Geflügel dort, spielt sich nix ab. Das ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig.«
»Schön. Aber findest du nicht, dass die Johanna übertreibt? Wir legen ja schon alles in den Essig, nicht nur Gurken, Knoblauch, Fleisch, Fisch, jedes Kraut, das es gibt, sondern Äpfel, Birnen, Marillen und Kirschen. Und dieses Mailufterl, der Gurgelsaft mit Salbei und Veilchen, also weißt du …«
»Ja, des Mailufterl!«, lachte da Martha, als sie daran dachte, wie Johanna sich ihr Hirn zermartert hatte, bis ihr eine Essigzubereitung eingefallen war, die Gretlin, ein junges Mädchen, das ihr gleich einem Haufen Unrat in die Küche geschwemmt worden war, im Kloster mit Arbeit versorgen könnte. »Des Mailufterl hat der Gretlin die Möglichkeit gegeben, schöne Tücher für die Verpackung zu sticken, und den Wienern ein bisserl einen angenehmeren Atem beschert. Da ist der Hannerl schon was Gutes eingefallen, und das war bei der geizigen Meisterin, der Cäcilie, unter deren Fuchtel wir alle gestanden haben, gar nicht so einfach!«
»Da haben wir es jetzt mit der Susanna schon besser!«, lenkte Wuckerl ein.
»Na, besser schon, aber die ist zurzeit auch ein wenig sauer auf uns.«
»Warum?«
»Sag mal, Wuckerl«, entgegnete Martha scharf, »träumst du den ganzen Tag oder denkst du auch ein bisschen praktisch? Es ist alles wegen dem Essig!«
»Wegen dem Essig is jeder sauer! Da hammas.« Wuckerl grinste verhalten.
»Bist du jetzt ganz dumm oder stellst du dich nur so?« Unsanft rempelte Martha die Büßerin, die schon wieder an ihren Haaren herumnestelte, an. »Aus ist er – der Essig!«
»Warum?«
»Warum, warum, warum. Weil der Barthel im Herbst den ganzen Wein ausgeschenkt hat. Darum!«
»Warum schenkt der alte Barthel den Wein aus, der soll ihn doch lesen und keltern, der ist doch der Hauerknecht!«
»Kruzifix, Wuckerl«, schnell bekreuzigte sich Martha und fuhr leise, aber eindringlich fort, »weil sie um ein Haar die Gretlin unten bei der Donau ersäuft hätten, wegen Wiederbetätigung – also weil sie angeblich wieder um die Männer herumscharwenzelt ist. Aber Wuckerl, das müsstest du doch wissen, du warst doch dabei?« Zweifelnd sah Martha zur Büßerin.
»Ja, jetzt isses mir wieder vor Augen, der Henker, der Pfarrer, wir haben alle gewartet, bis der junge …, wie hieß er doch gleich?«, fragte diese und kratzte sich am Kopf.
»Sander.«
»Ja genau, bis der junge Sander mit der Begnadigung vom Herzog gekommen is. Mei, war des knapp!«
»Eben und da hat der Barthel unsern ganzen Wein und den vom Regensburger Hof auch noch ausgeschenkt, um alle bei Laune zu halten.«
»Mei, waren die alle besoffen. Der Pfarrer am meisten, und dann kam schon der Barthel.«
»Genau, und jetzt verstehst auch, warum die Johanna mit leeren Essigkrügen um sich schmeißt.«
»Du meinst, dass der Barthel auch da drin is?«, damit zeigte Wuckerl auf den Eingang zur Küche, »der Arme!«
»Na, ich glaub, lange ist der nicht mehr da drinnen!«, grinste Martha, als just in diesem Augenblick ein alter Mann, bekleidet mit einem groben Hemd, einer löchrigen Hose und mit nur einem Schuh krumm und humpelnd herausgestürzt kam.
»Ja da siehst, dass er immer noch mehr als unten durch is bei der Hannerl.« Belustigt traten die beiden Frauen ein paar Schritte in den Hof und machten dem Hauerknecht ein Zeichen, dass er sich hierher zu ihnen flüchten konnte. Mit knapper Not entkam er einem weiteren Tonscherben, der mit Wucht in seine Richtung geschleudert wurde, und wankte völlig außer Atem auf die beiden zu.
»So wüd wie heit hob i mei Hannerl no gor nia gsegn.« Verschwitzt wischte er sich mit zittrigen, von der harten Arbeit schwieligen und geröteten Händen über seine in tiefe Höhlen gebetteten Augen. Martha betrachtete den Alten schweigend. War sie auch so in die Jahre gekommen wie Barthel? Sah man das Alter nur an den anderen und nicht an einem selbst? Fast erschrocken registrierte sie Barthels krumme Glieder, seine faltige Haut, die sich über einen kahlen Schädel spannte, aber sie sah auch das spitzbübische Lächeln, das er seinem mittlerweile fast zahnlosen Mund entrang, als er bemerkte:
»Seit sie dieses Gebräu nicht mehr pantschen kann, is ned gut Kirschen essen mit meiner Hannerl. Recht gschiacht ihr, hot eh kana mögn, des graupate Zeigs. Jedes Mal hot’s ma den Magen umdraht, wann i gsehn hob, dass sie mein Wein in die pralle Sunn gstöd hot. So a Verschwendung.«
Wuckerl nickte, Martha stöhnte, und Barthel fuhr ungeniert fort: »Spinnat is halt a scho, de oide Schastrommel. Amoi zwickts sie’s da, amol dort, dann regt sa si wieder unnedig auf. Mei, is halt a scho a oide Gleschn …« Barthel grinste schief und stemmte die Hände in seine Hüften, wohl um sein Kreuz, das ihm immer höllisch weh tat, zu entlasten.
»Und du, du wirst ja sowieso immer jünger!«, meinte Martha zwinkernd.
»Scho, i konservier mi ja auch im Rebensaft!«
»Woher kriegst denn jetzt an Becher Wein, wennst im Herbst alles ausgeschenkt hast?«, fragte Wuckerl interessiert.
»Mei, da gibt’s scho a ganze Menge Leit, die no a guats Tröpferl im Keller haben. Aber ned dem Hannerl sogn.« Listig wackelte er mit seinem ausgestreckten Zeigefinger vor Marthas Nase hin und her.
»Wenn die erfährt, dass du weitersaufst, als wär nix gwesen, während ihr selbst der Wein für ihren Essig fehlt, dann hängt sie dich am nächsten Hollerbusch auf, Barthel. Aber ned so wie den Heiligen Koloman, sondern kopfüber! Des sag i dir!«
»Waas i doch eh, oba wos sie ned waas, des mocht sie ned haas.«
»Jetzt bist mutig, Barthel, aber wart nur, bis sie dir auf die Schliche kommt, dann kannst was erleben!«, Martha wollte gerade zu einem Lachen ansetzen, als sie sich vorstellte, wie der alte Hauerknecht vor der lauten Hannerl Reißaus nehmen würde, als ihr das Grinsen im Gesicht gefror. Sich immer wieder nach hinten drehend und Ausdrucke wie »Spinnate«, »blödes Weib« oder »Rutsch mir doch runter« schreiend kam eine weitere Büßerin über den Hof gelaufen, um etliche Jahre jünger als Martha und Wuckerl. Mit Spannung warteten die drei, zitternd vor Kälte, zu erfahren, was denn jetzt schon wieder in der Küche vorgefallen war. Verschwitzt vom Dunst des Herdes und vor Wut spuckend kam die kleine, quirlige Gestalt im grauen Habit um die Ecke gehastet und schrie: »Also wenn der jetzt nicht bald einer sagt, wo es lang geht, dann dreh ich ihr eigenhändig den Hals um, der blöden Kuh, was bildet die sich eigentlich ein?«
»Wen meinst denn?«, fragte Barthel scheinheilig.
»Die Johanna mein ich, die, die mir nichts anderes als Schimpfereien an den Kopf werfen kann!«, schrie die Büßerin und schüttelte ihren Kopf vehement, wie um alles, was sie eben gehört hatte, abzuschütteln wie ein nasser Hund das Wasser.
»Also beim Schimpfen bleibt ihr beide euch wohl nichts schuldig«, grinste Wuckerl.
»Pahh«, rief die neu Angekommene und band sich mit unterdrückter Wut ihre Haube fester, »so eine Laune, wie die nun schon seit Tagen hat, da ist eine trächtige Hündin ein Lamm dagegen.« Etwas ruhiger fuhr sie fort: »Nichts passt ihr, einfach gar nichts. Einmal schneide ich die Rüben zu groß, plötzlich braucht sie die kleineren Stücke doch nicht, dann knete ich den Teig zu fest, dann wieder soll ich aufpassen, dass er nicht patzert zusammenfällt. Mein Gott, ich wünschte, ich wär nicht mehr im Küchendienst, das halt ich nicht aus, diese alte Schreckschraube sitzt mir ständig im Nacken und nörgelt und schimpft und wirft mit Geschirr herum!«
»Aber geh, Marlen, du hast dich nach der Abreise von der Gretlin doch förmlich darum gerissen, die Küchenarbeit zu übernehmen«, entgegnete Martha, die nur zu gut wusste, warum. Magdalena Apollonia, die bereits blutjung nach Sankt Hieronymus gekommen war, war eine der drei Regelschwestern vom Orden der Reuerinnen vor dem Schottentor, die Dienst bei den Büßerinnen versahen. Doch es gab schon immer etwas, was Marlen, wie die kleine, unentwegt lauter wichtige Sachen plaudernde Nonne genannt wurde, mehr als ihr keusches Nonnenleben interessierte: Männer. Männer in allen nur erdenklichen Erscheinungsformen. Wie eine graue Katze schlich sie um die Beine eines jeden, der sich zufällig ins Kloster verirrte, mit Ausnahme des Domprobstes Berthold, der die Bücher der Meisterin prüfte und durchdringend nach Weihrauch und Schweiß roch, und dem alten Barthel, der sowieso nur Augen für die Hanna hatte, was überhaupt keiner so recht verstehen konnte. Keiner der Zulieferer von Gemüse und Getreide, niemand von den Handwerkern, die dies und das instand zu setzen hatten, war vor Marlens Avancen sicher. Da konnte sie Hanna noch so oft an ihr Gelübde der Keuschheit, der Gottesliebe und vor allem der Schweigsamkeit erinnern: Kaum betrat ein Mann ihren Dunstkreis, benahm sich Marlen wie eine der Laufenten im Gemüsegarten des Klosters. Laut quakend watschelte sie hinter demjenigen her und ließ nichts unversucht, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Deswegen kam ihr die frei gewordene Stelle als Küchenhilfe damals gerade recht, denn nirgends sonst im Kloster gingen Lieferanten, Kaufleute und Knechte aus und ein, und nirgends war die Wahrscheinlichkeit größer, einem Mannsbild über den Weg zu laufen als bei Johanna in der Küche. Verwunderlich war es daher umso mehr, dass Marlen freiwillig den Dienst quittieren und sich vermehrt den Messen und dem Singen der frommen deutschen Hymnen widmen wollte – eine lästige Pflicht, von der das Küchenpersonal weitgehend befreit war. Denn was könnte alles passieren, während die Köchin und ihre Helferinnen in der Kapelle waren: die Milch überkochen, der Kochwein verdunsten – Johanna wurde nicht müde, all diese Möglichkeiten immer wieder aufzuzählen, wenn sich die Meisterin beschwerte, dass im Küchentrakt allzu weltliche Sitten einzogen, und anregte, dass Johanna sich einmal wieder die Kapelle von innen anschauen sollte.
Auch Wuckerl staunte nicht schlecht, als sie vernahm, dass Marlen nicht mehr bei Johanna arbeiten wollte. »Was heißt, dass es nicht mehr auszuhalten ist, die Yrmel schafft das doch auch!«, bemerkte sie entrüstet und meinte damit niemand anderen als die zweite Küchenhilfe Johannas, die vor über neun Jahren als junges Ding in einem bedauernswerten Zustand ins Kloster gekommen war. Niemand wusste genau, was der damals etwa Zwölfjährigen passiert war, und man konnte sie auch nicht fragen, denn dem Mädchen kam nicht ein Wort über die Lippen. Mit unerwarteter Sanftmut und großem Einfühlungsvermögen hatte sich Johanna der Kleinen angenommen, ihre krampfartigen Anfälle wurden weniger und ihre Angst kleiner. Doch bis heute hat sie ihre Sprache nicht wieder gefunden.
»Was geht das alles die Yrmel an? Der ist das wurscht, die ist stumm«, schrie Marlen zornig, denn schon von Anfang an hatte die männerjagende Nonne den Verdacht, von der inzwischen jungen Frau mit den sanften braunen Augen völlig durchschaut zu werden.
»Aha. Stumm. Na des ko ma von dir ja ned unbedingt behaupten, Marlen, dir geht die Pappn jo andauernd wia a Wirtshaustir. Imma auf und zua, auf und zua …«1, Barthel zeigte sein zahnloses Kiefer und klopfte sich mit der Hand auf den Oberschenkel.
»Aber Schmarrn«, antwortete Marlen resolut, »lasst mich auch da in den Durchgang, macht ein bisserl Platz, wie komm ich dazu, mir den Arsch abzufrieren, nur weil die Johanna schlechte Laune hat!« Damit zwängte sie sich zwischen Barthel und die beiden anderen Büßerinnen. Da vernahmen alle vier ein Jaulen, und ein alter rachitisch gebeugter Hund kam schnellen Schrittes zu ihnen gelaufen. Plötzlich zeigten sich auf der ohnehin schon sehr zerfurchten Stirne Barthels Zornesfalten. »Oiso, wenn’s jetzt ihren Gift an der Maroni auslässt, dann schlogts 13, alles was Recht ist, so a spinnate Gurkn!«2 Damit ging er stöhnend und ächzend in die Knie und umfing mit seinen großen Pranken die alte Hündin, die schnurstracks zu ihm gelaufen war und ihre schon ganz und gar weiße Schnauze an seine Brust drückte. Langsam wurde es eng in diesem Gang zu den Schlafgemächern, doch niemand der Anwesenden hatte Lust, in die Küche zu gehen, die ansonsten an einem so kalten Tag nicht nur die gefrorenen Glieder, sondern auch die Seele wärmte. Nach einer Zeit müßigen Herumstehens wurde ihnen die Entscheidung, was sie denn nun machen sollten, abgenommen. Deutlich waren hinter ihnen schnelle Schritte zu hören und wenig später erschien die Meisterin Susanna. Sie war so in Eile, dass sie um ein Haar in die kleine Menschengruppe hineingelaufen wäre. Abrupt blieb sie stehen, und ihre wachen Augen verengten sich zu Schlitzen. »Was ist da los?«, fragte sie halblaut, und jeder der Anwesenden wusste, dass lügen zwecklos war. Susanna schien einen direkten Draht zum Himmel zu haben, denn sie sah es jedem, der die Unwahrheit sagte, an der Nasenspitze an. Oder – was Johanna immer behauptete – sie wartete so lange, bis sich der bedauernswerte Erdenwurm in seinen eigenen Ausflüchten und Lügen verhedderte und von selbst zu Fall kam. Wie auch immer, Susanna wartete und fixierte einen nach dem andern. Obwohl es vorerst schien, dass sie sehr in Eile war, hatte sie plötzlich Muße, sich das gesenkte, peinlich berührte Gesicht von Martha anzusehen, Wuckerls widerspenstige Haare zu begutachten, Barthels Loch in der Hose missbilligend zu taxieren und Marlens trotzigen Blick zu erwidern. Nur Maroni bekam ungefragt Streicheleinheiten. »Na?«, war alles, was sie von sich gab, und schon begannen alle vier gleichzeitig zu sprechen.
»Die schmeißt mit Tonkrügen herum!«
»Alles nur wegen dem Essig!«
»Spinnat is hoit.«
»Das lass ich mir nicht gefallen!«