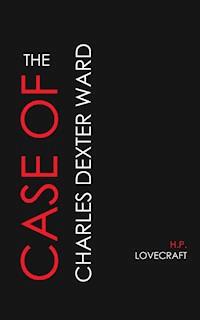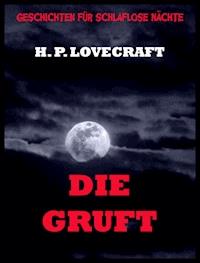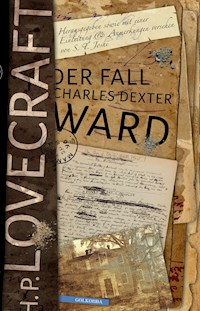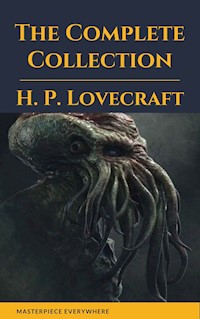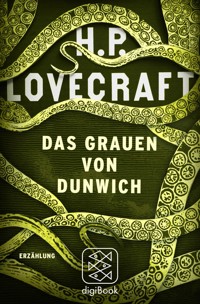
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Arkham-Erzählungen
- Sprache: Deutsch
Wilbur Whateley, Sohn einer missgestalteten und labilen Mutter und eines unbekannten Vaters (der nur einmal beiläufig als »Yog-Sothoth« bezeichnet wird), wächst erschreckend schnell heran und erreicht schon nach einem Jahrzehnt das Mannesalter. Bald wundern sich die anderen Einwohner des abgelegenen Örtchens Dunwich, warum Wilburs Großvater so viel Vieh kauft, obschon sich seine Herde nicht vergrößert ... H. P. Lovecrafts einzige Geschichte, in der sich ein längerer Auszug aus dem Necronomicon findet, in ungekürzter Neuübersetzung, der es erstmals gelingt, Lovecrafts speziellen Stil und die besondere Atmosphäre seiner Erzählung in deutscher Sprache schillern zu lassen. »H. P. Lovecraft ist der bedeutendste Horror-Autor des 20. Jahrhunderts.« Stephen King Unter dem Titel »The Dunwich Horror« erstmals veröffentlicht 1929 in der Zeitschrift »Weird Tales« Erstdruck der Übersetzung in»H. P. Lovecraft – Das Werk« (FISCHER Tor, 2017)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
H. P. Lovecraft
Das Grauen von Dunwich
Erzählung
Über dieses Buch
Wilbur Whateley, Sohn einer missgestalteten und labilen Mutter und eines unbekannten Vaters (der nur einmal beiläufig als »Yog-Sothoth« bezeichnet wird), wächst erschreckend schnell heran und erreicht schon nach einem Jahrzehnt das Mannesalter. Bald wundern sich die anderen Einwohner des abgelegenen Örtchens Dunwich, warum Wilburs Großvater so viel Vieh kauft, obschon sich seine Herde nicht vergrößert ...
H. P. Lovecrafts einzige Geschichte, in der sich ein längerer Auszug aus dem Necronomicon findet, in ungekürzter Neuübersetzung, der es erstmals gelingt, Lovecrafts speziellen Stil und die besondere Atmosphäre seiner Erzählung in deutscher Sprache schillern zu lassen.
»H. P. Lovecraft ist der bedeutendste Horror-Autor des 20. Jahrhunderts.« Stephen King
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
H. P. Lovecraft (1890-1937) ist der einflussreichste und beliebteste Horror-Autor des 20. Jahrhunderts. Seine Erzählungen erschienen zu seinen Lebzeiten vor allem in Magazinen wie »Weird Tales« und werden heute in Millionenauflagen gedruckt und gelesen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Inhalt
Prolog
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Gorgonen und Hydren und Chimären – grässliche Geschichten von Celaeno und den Harpyen – mögen sich in abergläubischen Gehirnen fortzeugen – aber sie waren schon vorher da. Es sind Transkriptionen, Typen – die Archetypen sind in uns, und sie sind ewig. Wie sonst könnte eine Erzählung, von der wir bei wachem Bewusstsein wissen, dass sie falsch ist, überhaupt eine Wirkung auf uns haben? … Ist unser Erschrecken vor solchen Dingen ein natürlicher Reflex, weil wir sie für fähig halten, uns körperlichen Schaden zuzufügen? Das zuallerletzt! Diese Schrecken sind älterer Herkunft. Sie gehen dem Leib voraus – oder, anders gesagt, ohne den Leib wären sie dieselben gewesen … Dass die Furcht, um die es hier geht, rein geistig ist – dass sie umso heftiger wird, je mehr es ihr an einem irdischen Gegenstand fehlt, und dass sie in der Zeit unserer sündlosen Kindheit am stärksten ist – wenn wir diese Rätsel lösen, begreifen wir vielleicht etwas von unserem vorgeburtlichen Zustand und erhaschen zumindest einen flüchtigen Blick in das Schattenland der Präexistenz.
Charles Lamb, Hexen und andere Nachtängste
I.
Wenn der Reisende im nördlichen Zentral-Massachusetts an der Kreuzung der Mautstraße nach Aylesbury hinter Dean’s Corners die falsche Abzweigung nimmt, gerät er in eine einsame und merkwürdige Gegend. Das Gelände steigt an, und die von Dornengestrüpp überwachsenen Steinmauern drängen sich dichter und dichter an die Windungen der zerfurchten, staubigen Straße heran. Die Bäume der Waldgürtel, die man immer wieder durchfährt, wirken zu groß, und die Wildpflanzen, Brombeerbüsche und Gräser wuchern so üppig, wie man es in besiedelten Gegenden selten findet. Zugleich gibt es erstaunlich wenig bestellte Felder, und wenn, dann wirken sie merkwürdig unfruchtbar, während die spärlichen, weit in der Landschaft verstreuten Häuser einen überraschend gleichförmigen Eindruck von Alter, Ärmlichkeit und Verfall hinterlassen. Ohne zu wissen, warum, zögert man, eine der verkrümmten, einsamen Gestalten, die man hier und da auf einer bröckelnden Türschwelle oder auf den abschüssigen, geröllübersäten Wiesen erblickt, nach dem Weg zu fragen. So still und verstohlen wirken diese Gestalten, dass man irgendwie das Gefühl hat, man befinde sich in Gegenwart verbotener Dinge, von denen man sich besser fernhält. Wenn die Straße dann mit einem Mal ansteigt und über den dichten Wäldern die Berge in Sicht geraten, nimmt das Gefühl seltsamen Unbehagens noch zu. Die Berggipfel sind zu abgerundet und symmetrisch, um anheimelnd und natürlich zu wirken, und manchmal zeichnen sich gegen einen außergewöhnlich klaren Himmel die sonderbaren Kreise großer Steinsäulen ab, mit denen die meisten von ihnen bekrönt sind.
Man überquert Schluchten und Klüfte von ungewisser Tiefe, und die roh gezimmerten hölzernen Brücken wirken allesamt nicht sonderlich vertrauenerweckend. Wenn die Straße wieder abfällt, kommt man durch ausgedehntes Marschland, das instinktiven Widerwillen, ja geradezu Furcht einflößt, wenn des Abends dem Auge verborgene Nachtschwalben zwitschern und die Glühwürmchen in ungewöhnlicher Fülle aufsteigen, um zu den heiseren, schaurig eindringlichen Rhythmen schrill quakender Ochsenfrösche zu tanzen. Die dünne, glänzende Linie des Oberlaufs des Miskatonic mutet merkwürdig schlangenartig an, wie sie sich dicht am Fuße der kuppelförmigen Berge entlangwindet, zwischen denen der Fluss entspringt.
Sobald die Berge näher an die Straße heranrücken, achtet man mehr auf ihre bewaldeten Hänge als ihre steinbekrönten Kuppen. Diese Hänge ragen so dunkel und steil auf, dass man sich wünscht, sie würden einen größeren Abstand halten, aber es gibt keine Straße, auf der man ihnen entgehen kann. Jenseits einer überdachten Brücke erblickt man ein kleines Dorf, das zwischen dem Fluss und dem senkrechten Abhang des Round Mountain kauert, und staunt über die dicht zusammengedrängten modrigen Mansarddächer, die einer früheren Architekturepoche zu entstammen scheinen als die, die man üblicherweise in dieser Gegend findet. Es trägt nicht zur Beruhigung bei, wenn man bei näherem Hinsehen bemerkt, dass die meisten Häuser verlassen und dem Verfall preisgegeben sind und dass die Kirche mit dem eingestürzten Kirchturm jetzt den einzigen schmuddeligen Gemischtwarenladen des Fleckens beherbergt. Man scheut davor zurück, sich dem düsteren Tunnel der Brücke anzuvertrauen, aber es gibt keine Möglichkeit, ihn zu umgehen. Wenn man das andere Ufer erreicht hat, fällt es schwer, sich des Eindrucks zu erwehren, dass ein schwacher widerwärtiger Geruch über der Dorfstraße liegt, wie von jahrhundertelang angehäuftem Moder und Verfall. Es ist immer eine Erleichterung, wenn man den Ort hinter sich gelassen hat und der engen Straße um den Fuß der Berge und durch die Ebene folgt, bis sie wieder auf die Mautstraße nach Aylesbury stößt. Später erfährt man manchmal, dass man durch Dunwich gefahren ist.
Auswärtige Besucher meiden Dunwich nach Möglichkeit, und seit einer gewissen Zeit des Schreckens hat man alle Wegweiser dorthin abmontiert. Nach allen ästhetischen Maßstäben ist die Landschaft außergewöhnlich schön, allerdings verirrt sich niemals ein Künstler oder Sommergast hierher. Vor zwei Jahrhunderten, als die Erwähnung von Hexenverwandtschaft, Teufelsanbetung und merkwürdigen Erscheinungen im Wald noch keinen Anlass zum Lachen bot, war es üblich, Gründe zu nennen, warum man den Ort mied. In unserem aufgeklärten Zeitalter – und nachdem das Grauen, das Dunwich im Jahr 1928 heimsuchte, von denjenigen, denen das Wohl der Stadt und der ganzen Welt am Herzen lag, vertuscht worden war – machen die Leute einen Bogen um das Dorf, ohne genau zu wissen, warum. Vielleicht liegt es daran – obwohl dies eigentlich für unwissende Fremde keine Rolle spielen dürfte –, dass die Einwohner mittlerweile abstoßend dekadent und heruntergekommen sind, wie man es in so vielen abgelegenen Gegenden Neuenglands beobachten kann. Im Lauf der Zeit haben sie sich zu einer eigenen Rasse entwickelt, der die wohlbekannten geistigen und körperlichen Stigmata von Degeneration und Inzucht anhaften. Ihre durchschnittliche Intelligenz ist beklagenswert niedrig, während ihre Überlieferungen voll von offener Bösartigkeit und halbversteckten Morden, Blutschande und Taten von beinahe unaussprechlicher Gewalttätigkeit und Perversität sind. Die alte Oberschicht, die aus den zwei oder drei wappentragenden Familien besteht, die 1692 aus Salem kamen, hat sich ein wenig über dem allgemeinen Niveau des Niedergangs halten können, obwohl viele ihrer Nachkommen so vollständig in der gemeinen Bevölkerung aufgegangen sind, dass nur noch ihre Namen auf jene Ursprünge hindeuten, denen sie Schande machen. Manche Whateleys und Bishops schicken ihre ältesten Söhne immer noch nach Harvard oder an die Miskatonic University, doch diese Söhne kehren nur selten zu den modrigen Mansarddächern zurück, unter denen sie und ihre Ahnen geboren wurden.
Niemand weiß genau, was mit Dunwich nicht stimmt – selbst diejenigen nicht, die mit den Tatsachen des jüngst über Dunwich hereingebrochenen Grauens vertraut sind. Alte Legenden erzählen jedoch von unheiligen indianischen Ritualen und Versammlungen, bei denen bedrohliche schattenhafte Gestalten aus den großen abgerundeten Bergen herausgerufen wurden, und von wilden orgiastischen Gebeten, die von lautem unterirdischen Krachen und Grollen beantwortet wurden. Im Jahre 1747 hielt der Reverend Abijah Hoadley, der gerade die kongregationalistische Kirche von Dunwich Village übernommen hatte, eine denkwürdige Predigt über die Allgegenwart des Teufels und seiner Heerscharen, in der er ausführte:
»Es muss uns zugestanden werden, dass die Gotteslästerungen jenes höllischen Zugs von Dämonen eine Sache von zu allgemeiner Bekanntheit sind, um geleugnet zu werden. Mehr als zwanzig glaubwürdige Zeugen, die heute am Leben sind, haben mit eigenen Ohren die verfluchten Stimmen von Azazel und Buzrael, von Beelzebub und Belial gehört, wie sie aus der Erde drangen. Mir selbst kam vor weniger als zwei Wochen eine äußerst deutlich vernehmbare Unterhaltung böser Kräfte in dem Berge hinter meinem Haus zu Ohren. Es erklang dort ein Rütteln und ein Schütteln, ein Stöhnen und ein Kreischen und ein Pfeifen, wie sie kein irdisch Ding erheben kann und welches aus jenen Höhlen gekommen sein muss, die nur vermittels schwarzer Magie entdeckt und allein vom Teufel selbst geöffnet werden können.«
Kurz nachdem er diese Predigt gehalten hatte, verschwand Mr. Hoadley spurlos; der in Springfield gedruckte Text hat sich jedoch erhalten. Von Geräuschen aus dem Inneren der Berge wurden im Laufe der Jahre immer wieder berichtet, und bis heute stellen sie Geologen und Physiogeographen vor ein Rätsel.
Andere Überlieferungen berichten von widerlichen Gerüchen in der Nähe der Steinsäulen, welche die Berggipfel krönen, und von unsichtbar vorbeistreichenden Dingen in der Luft, die man zu gewissen Stunden an bestimmten Stellen am Grund der großen Schluchten undeutlich hören kann. Noch andere versuchen, den sogenannten Teufelsacker zu erklären: einen öden, verdorrten Berghang, an dem kein Baum, Strauch oder Flecken Gras wachsen will. Nicht zuletzt haben die Einheimischen eine Todesangst vor den zahlreichen Nachtschwalben, deren Stimmen in warmen Nächten erklingen. Man versichert, dass die Vögel Unterweltsboten sind, die auf die Seelen der Sterbenden warten, und dass sie ihre unheimlichen Rufe im Gleichklang mit den mühsamen Atemzügen der Dahinscheidenden ausstoßen. Wenn es ihnen gelingt, die Seele in dem Moment zu ergreifen, in dem sie den Körper verlässt, dann flattern sie augenblicklich davon und zwitschern in dämonischem Gelächter. Wenn die Seele ihnen jedoch entkommt, dann verstummen sie nach und nach zu enttäuschtem Schweigen.
Diese Geschichten sind natürlich albern und werden von niemandem mehr geglaubt, da sie aus uralten Zeiten stammen. Dunwich ist in der Tat unglaublich alt – weitaus älter als alle Gemeinden im Umkreis von dreißig Meilen. Südlich des Dorfes kann man noch immer die Kellermauern und den Kamin des alten Bishop-Hauses entdecken, das vor 1700 erbaut wurde, wohingegen die Ruine der Mühle an den Wasserfällen, die 1806 errichtet wurde, das modernste Bauwerk der Gegend ist. Das Gewerbe gedieh hier nicht, und die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts erwies sich als kurzlebig. Die ältesten Bauwerke sind die großen Kreise grobbehauener Steinsäulen auf den Berggipfeln, die jedoch zumeist eher den Indianern als den Siedlern zugeschrieben werden. Reste von Schädeln und Knochen, die innerhalb dieser Kreise und um den ziemlich großen tischartigen Felsen auf dem Sentinel Hill gefunden wurden, stützen die verbreitete Ansicht, dass diese Orte früher Begräbnisplätze der Pocumtuck-Indianer waren. Allerdings beharren viele Ethnologen darauf, dass es sich bei den Knochen um die sterblichen Überreste von Weißen handelt – so völlig unwahrscheinlich eine solche Theorie auch klingen mag.