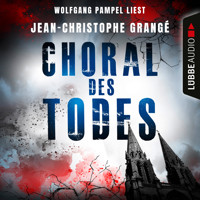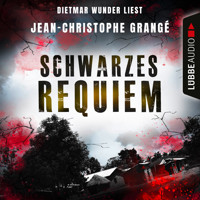7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Atemberaubende Spannung von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1
- Sprache: Deutsch
Wären sie besser für immer tot geblieben ...
Der Pariser Kripobeamte Mathieu Durey ist schockiert: Sein bester Freund und Kollege Luc liegt nach einem Suizidversuch im Koma. Mathieu möchte herausfinden, was seinen Freund in den Selbstmord getrieben hat. War es einer seiner letzten Fälle? Der Mord an einer Frau, die - zerfressen von Chemikalien und Insekten und mit einem Kruzifix geschändet - in einem Kloster gefunden wurde? Die Spur führt Mathieu zu einer ganzen Serie von satanischen Morden und einer absolut verstörenden Entdeckung: Alle mutmaßlichen Mörder waren Koma-Patienten, die wieder ins Leben zurückgekehrt sind ...
»Jean-Christophe Grangé führt seine Leser wieder mitten in die Thrillerhölle.« BILD AM SONNTAG
Der Autor des Weltbestsellers Die purpurnen Flüsse führt uns in eine Welt, in der Grausamkeit und dunkle Gesetze herrschen. Weitere spannende Meisterwerke des Thriller-Genies Jean-Christophe Grangé bei beTHRILLED:
Der Flug der Störche
Der steinerne Kreis
Das Imperium der Wölfe
Das schwarze Blut
Choral des Todes
Der Ursprung des Bösen
Die Wahrheit des Blutes
Purpurne Rache
Schwarzes Requiem
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1018
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Teil 1: mathieu
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Teil 2: sylvie
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Teil 3: agostina
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Teil 4: manon
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Teil 5: luc
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Der Pariser Kripobeamte Mathieu Durey ist schockiert: Sein bester Freund und Kollege Luc liegt nach einem Suizidversuch im Koma. Mathieu möchte herausfinden, was seinen Freund in den Selbstmord getrieben hat. War es einer seiner letzten Fälle? Der Mord an einer Frau, die – zerfressen von Chemikalien und Insekten und mit einem Kruzifix geschändet – in einem Kloster gefunden wurde? Die Spur führt Mathieu zu einer ganzen Serie von satanischen Morden und einer absolut verstörenden Entdeckung: Alle mutmaßlichen Mörder waren Koma-Patienten, die wieder ins Leben zurückgekehrt sind …
JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
DAS HERZ DER
HÖLLE
Aus dem Französischen von Thorsten Schmidt
Für Laurence und unsere Kinder
Teil 1mathieu
Kapitel 1
»Zwischen Leben und Tod.«
Eric Svendsen hatte eine Schwäche für Floskeln. Ich hasste ihn dafür, jedenfalls heute. Ein Gerichtsmediziner sollte sich auf einen klaren, präzisen Bericht beschränken – basta. Aber der Schwede konnte nicht anders: Er war ein hoffnungsloser Phrasendrescher…
»Luc wird entweder jetzt aufwachen«, fuhr er fort, »oder gar nicht mehr. Sein Körper funktioniert, aber sein Bewusstsein ist an einem toten Punkt. Er schwebt zwischen zwei Welten.«
Ich saß im Wartezimmer der Intensivstation. Svendsen stand im Gegenlicht. Ich fragte ihn:
»Wo ist es eigentlich passiert?«
»In seinem Landhaus in der Nähe von Chartres.«
»Weshalb wurde er hierher verlegt?«
»Das Krankenhaus in Chartres ist für so schwere Notfälle nicht ausgerüstet.«
»Warum wurde er ausgerechnet hierher, ins Hôtel-Dieu, gebracht?«
»Weil alle verletzten Polizisten hier behandelt werden.«
Ich rutschte auf meinem Stuhl nach hinten. Ein Schwimmer bei den Olympischen Spielen, bereit zum Kopfsprung. Mir wurde übel von dem Geruch der Desinfektionsmittel, der durch die geschlossene Doppeltür drang und sich mit der Hitze vermischte. Alle möglichen Fragen schwirrten mir durch den Kopf:
»Wer hat ihn gefunden?«
»Der Gärtner. Er hat ihn im Fluss entdeckt, in der Nähe des Hauses, und ihn in letzter Minute aus dem Wasser gezogen. Um 8 Uhr morgens. Zufällig war ein Notarztwagen in der Nähe. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen.«
Ich stellte mir den Schauplatz vor. Das Haus in Vernay, die Rasenfläche mit den angrenzenden Feldern, den hinter üppigem Grün verborgenen Fluss, das dichte Unterholz am anderen Ufer. Wie viele Wochenenden hatte ich dort verbracht…? Ich sprach das verbotene Wort aus:
»Wer hat von Selbstmord gesprochen?«
»Die Rettungssanitäter. Sie haben es in ihrem Bericht geschrieben.«
»Wieso kann es kein Unfall gewesen sein?«
»Der Körper war mit Gewichten beschwert.«
Ich blickte auf. Svendsen breitete zum Zeichen seiner Ratlosigkeit die Arme aus. Im Gegenlicht wirkte er wie ein Scherenschnitt. Ein hagerer Körper und fülliges krauses Haar, rund wie eine Mistelbeere.
»Luc trug an der Hüfte mit Draht befestigte Brocken von Betonsteinen. Eine Art Bleigürtel, wie ihn Taucher benutzen.«
»Könnte es nicht Mord sein?«
»Red keinen Stuss, Mat. Dann hätte man ihn sicher mit drei Kugeln im Bauch gefunden. Aber es gibt keinerlei Hinweise auf Gewaltanwendung. Er hat sich ertränkt, daran gibt es nichts zu deuteln.«
Ich dachte an Virginia Woolf, die sich ihre Taschen mit Steinen vollgestopft hatte, bevor sie sich in Sussex, in England, in einem Fluss ertränkt hatte. Svendsen hatte recht. Der Schauplatz der Tat ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Jeder andere Polizist hätte sich mit seiner Dienstwaffe eine Kugel in den Kopf gejagt. Luc aber hatte Sinn für Rituale – und für heilige Stätten. Vernay, für dessen Erwerb, Restaurierung und Einrichtung er sich krummgelegt hatte. Ein perfektes Refugium.
Der Gerichtsmediziner legte mir die Hand auf die Schulter.
»Er ist nicht der erste Polizist, der Selbstmord begeht. Ihr bewegt euch am Rand des Abgrunds und…«
Wieder Floskeln. Ich hörte nicht mehr hin und dachte an die Statistiken. Im Vorjahr hatten sich in Frankreich fast einhundert Polizisten erschossen. Seine berufliche Laufbahn mit Selbstmord zu beenden schien gang und gäbe.
Im Flur war es noch dunkler geworden. Äthergeruch, drückende Hitze. Wann hatte ich zum letzten Mal mit Luc gesprochen? Seit wie vielen Monaten hatten wir nichts mehr voneinander gehört? Ich sah Svendsen an.
»Und du, was machst du hier?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Sie hatten mir eine Leiche gebracht. Einen Einbrecher, Schlaganfall während eines Einbruchs. Die Typen, die ihn brachten, kamen vom Hôtel-Dieu und haben mir von Luc erzählt. Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin hergekommen. Meine Klienten können warten.«
Seine Worte riefen mir die Stimme von Foucault, meinem Gruppenleiter, in Erinnerung, der mich vor einer Stunde angerufen hatte: »Luc hat Schluss gemacht!«
Die Migräne in meinem Kopf wurde stärker.
Ich musterte Svendsen genauer. Ohne weißen Kittel kam er mir unwirklich vor. Doch er war es, kein Zweifel: Seine kleine Hakennase und seine kneiferähnliche Brille waren unverwechselbar. Ein Pathologe an Lucs Bett… Er würde ihm Unglück bringen.
Die Doppeltür am Eingang der Station ging auf. Ein untersetzter Arzt in einem zerknitterten grünen Kittel tauchte auf. Ich erkannte ihn sofort: Christophe Bourgeois, Anästhesist und Intensivmediziner. Vor zwei Jahren hatte er versucht, einen psychopathischen Zuhälter zu retten, der bei einer Razzia im 18. Arrondissement, in der Rue Custine, in die Menge geschossen hatte. Der Mann hatte zwei Polizisten niedergestreckt, bevor eine Kugel vom Kaliber .45 sein Rückgrat durchschlug – eine Kugel aus meiner Pistole.
Ich stand auf und ging Christophe entgegen. Er runzelte die Stirn.
»Sie kommen mir bekannt vor.«
»Mathieu Durey, Commandant bei der Mordkommission. Der Fall Benzani im März 2000. Ein Ganove, der niedergeschossen wurde und hier verstarb. Letztes Jahr haben wir uns vor dem Gericht in Créteil wiedergesehen, wo der Prozess in Abwesenheit stattfand.«
Der Mann machte eine Geste, die besagte: »Ich begegne so vielen Leuten…« Er hatte dichtes weißes Haar, ein beeindruckender, vitaler Mann. Er sah zur Intensivstation hinüber.
»Sind Sie wegen des Polizisten da, der im Koma liegt?«
»Luc Soubeyras ist mein bester Freund.«
Er verzog das Gesicht, als bedeute das noch mehr Ärger.
»Wird er überleben?«
Der Arzt öffnete das Band seines Kittels in seinem Rücken.
»Es ist ein Wunder, dass sein Herz wieder schlägt«, sagte er schnaufend. »Als man ihn aus dem Wasser zog, war er tot.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Klinisch tot. Wäre das Wasser nicht so kalt gewesen, hätte man nichts mehr für ihn tun können. Aber durch die Unterkühlung war die Durchblutung des Körpers schwächer. Die Notärzte in Chartres haben unglaubliche Geistesgegenwart bewiesen und das Unmögliche versucht, indem sie sein Blut künstlich erwärmten. Und das Unmögliche hat funktioniert. Eine echte Auferstehung.«
»Was haben sie getan?«
Svendsen, der näher gekommen war, schaltete sich ein:
»Ich erkläre es dir.«
Ich warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Der Arzt sah auf seine Uhr.
»Ich habe jetzt wirklich keine Zeit.«
Ich explodierte:
»Mein bester Freund liegt hier nebenan. Also nehmen Sie sich die Zeit gefälligst!«
»Verzeihen Sie«, sagte der Doktor lächelnd. »Die Diagnose ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen noch herausfinden, wie tief sein Koma ist.«
»Wie steht es mit seinen Körperfunktionen?«
»Die Vitalfunktionen sind wieder normal, aber wir können nichts tun, um ihn aus dem Koma aufzuwecken… Und falls er aufwacht, können wir nicht vorhersagen, in welchem Zustand. Alles hängt von den Hirnverletzungen ab. Unser Freund hatte die Schwelle des Todes überschritten, verstehen Sie? Die Sauerstoffversorgung war eine Zeit lang unterbrochen, was zweifellos Schäden verursacht hat.«
»Gibt es nicht verschiedene Formen des Komas?«
»Ja, mehrere. Den vegetativen Zustand, in dem der Patient auf gewisse Reize reagiert, und das echte Koma. Ihr Freund scheint sich genau an der Grenze zwischen den beiden zu befinden. Aber Sie sollten den Neurologen, Éric Thuillier, aufsuchen.« Ich schrieb den Namen in mein Notizbuch. »Er führt gerade die Tests durch. Melden Sie sich für morgen an.«
Er sah erneut auf die Uhr und senkte dann die Stimme:
»Etwas anderes… Ich habe nicht gewagt, seine Frau danach zu fragen, aber hat Ihr Freund Drogen genommen?«
»Nein. Wieso?«
»Wir haben in seiner Ellenbeuge Einstichstellen gefunden.«
»War er vielleicht in ärztlicher Behandlung?«
»Seine Frau sagt, nein.«
Der Arzt zog seinen Kittel aus und reichte mir die Hand:
»Ich muss jetzt auf eine andere Station.«
Ich sah, wie die Türen ein weiteres Mal aufgingen. Laure. Auch Lucs Frau trug einen Kittel aus Zellstoff und eine Haube. Sie taumelte eher, als dass sie ging. Ich eilte auf sie zu. Sie wich zurück, als ob ihr meine Stimme oder meine Anwesenheit Angst einjagte. Ihr Gesichtsausdruck war kalt und unergründlich.
»Laure, wenn du irgendetwas brauchst…«
Sie schüttelte den Kopf. Sie war noch nie eine Schönheit gewesen, aber jetzt glich sie einem Gespenst. Sie sprach leise und hastig:
»Gestern Abend hat er uns gesagt, wir sollten ohne ihn zurückfahren. Er wollte in Vernay bleiben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht…«
Ihr Flüstern wurde unhörbar. Ich hätte sie in den Arm nehmen sollen, aber ich brachte es nicht über mich. Weder jetzt noch zu einem anderen Zeitpunkt. Ich sagte aufs Geratewohl:
»Er wird durchkommen, ganz bestimmt. Man…«
Sie warf mir einen eisigen Blick zu. Ihre Augen funkelten feindselig.
»Das kommt nur von eurem Job, eurem bescheuerten Job.«
»Aber…es ist…«
Ehe ich den Satz zu Ende bringen konnte, brach Laure in Tränen aus. Wieder hätte ich gern mein Mitgefühl zum Ausdruck gebracht, aber ich konnte Laure nicht berühren. Ich schlug die Augen nieder und bemerkte, dass sie den Mantel, den sie unter dem Kittel trug, falsch zugeknöpft hatte. Es hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre angesichts dieses Details selbst in Schluchzen ausgebrochen. Nachdem sie sich die Nase geschnäuzt hatte, sagte sie leise:
»Ich muss gehen… Die Kinder warten.«
»Wo sind sie?«
»In der Schule. Ich habe sie dort gelassen.«
Ich hatte ein Rauschen in den Ohren. Unsere Stimmen wurden wie von Watte gedämpft.
»Soll ich dich hinfahren?«
»Ich bin mit dem Auto gekommen.«
Während sie sich abermals schnäuzte, beobachtete ich sie. Schmales Gesicht, Hasenzähne, an der Seite graue Locken, die den Schläfenlocken von Rabbinern glichen. Ungewollt musste ich an eine Äußerung von Luc denken. Eine jener zynischen Floskeln, auf die er sich so ausgezeichnet verstand: »Das Problem Frau muss man so schnell wie möglich lösen, um es ad acta legen zu können.«
Genau dies hatte er getan, indem er die junge Frau aus ihrer Heimat, den Pyrenäen, hierher verpflanzt und mit ihr schnell hintereinander zwei Kinder gezeugt hatte. Ich sagte, weil mir nichts Besseres einfiel:
»Ich ruf dich heute Abend an.«
Sie nickte und verschwand in Richtung Umkleideraum. Ich drehte mich um: Der Anästhesist war verschwunden. Nur Svendsen stand noch da – der unvermeidliche Svendsen. Mein Blick fiel auf den Kittel, den der Doktor auf einem Stuhl zurückgelassen hatte. Ich griff danach:
»Ich gehe zu Luc rein.«
»Lass es sein.« Er stoppte mich mit einem festen Handgriff. »Der Doktor hat uns doch gerade gesagt, dass sie Tests mit ihm durchführen.«
Ungehalten machte ich mich von seinem Griff los. Da sagte er in beschwichtigendem Tonfall:
»Komm morgen wieder, Mat. Das wäre für alle besser.«
Mein Zorn legte sich. Svendsen hatte recht. Ich musste die Ärzte ihre Arbeit machen lassen. Was hätte ich davon, meinen Freund zu sehen, wie er an Schläuchen und Infusionen hing.
Mit einer Handbewegung verabschiedete ich mich von dem Gerichtsmediziner und stieg die Treppe hinunter. Mein Kopfweh ließ nach. Gedankenverloren ging ich in Richtung Station für Strafgefangene, auf der verletzte Tatverdächtige und Drogenabhängige auf Entzug behandelt wurden. Doch dann blieb ich stehen. Bloß keinem mir bekannten Polizisten begegnen! Ich wollte keine rührseligen Beileidsbezeigungen oder mitfühlenden Worte hören.
Ich nahm den Weg zur Haupteingangshalle. Am Ausgang zog ich mein Paket Camel ohne Filter heraus und zündete mir eine an. Ich atmete den ersten Zug tief ein.
Mein Blick fiel auf den Warnhinweis, der auf das Paket geklebt war: RAUCHEN KANN EINEN LANGSAMEN UND SCHMERZHAFTEN TOD ZUR FOLGE HABEN! Ans Gitter gelehnt, nahm ich einige Züge und ging dann nach links, zum Gebäude, das den Mittelpunkt meines Lebens bildete: Quai des Orfèvres, Nr.36. Plötzlich besann ich mich anders und wandte mich nach rechts, dem zweiten Angelpunkt meines Lebens zu.
Der Kathedrale Notre-Dame.
Kapitel 2
Schon am Portal begannen die Warnhinweise: Vorsicht, Taschendiebe! Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von Gepäckstücken verboten! Bitte ruhig verhalten… Ungeachtet der vielen Menschen hatte ich immer das gleiche Gefühl, wenn ich das Innere von Notre-Dame betrat.
Ich gebrauchte die Ellbogen und erreichte das marmorne Weihwasserbecken. Ich tauchte die Fingerspitzen ins Wasser und bekreuzigte mich, während ich mich gleichzeitig vor der Madonna verneigte. Ich spürte, wie der Kolben meiner USP 9-mm-Para gegen meine Hüfte drückte. Lange Zeit hatte ich ein Problem mit meiner Dienstwaffe gehabt. Durfte man eine Pistole mit in die Kirche nehmen? Zunächst hatte ich sie unter dem Sitz meines Wagens versteckt, dann wollte ich nicht länger jedes Mal den Umweg über den Parkplatz des Hauptquartiers der Mordkommission machen. Ich wollte unter den Flachreliefs der Kathedrale nach einem Versteck suchen, aber das wäre zu gefährlich gewesen. Schließlich stand ich zu dieser Freveltat. Hatten die Kreuzritter vielleicht ihre Schwerter abgelegt, als sie in den Jerusalemer Tempel eindrangen?
Im Lichtschein großer Kerzen ging ich den rechten Gang entlang, vorbei an Beichtstühlen. Mit jedem Schritt wurde ich ruhiger – das Halbdunkel im Innern der Kirche tat mir wohl. Ein Ort der Gegensätze: Ein schwerer Frachter aus Stein auf einem dunklen Meer, zugleich von betörend herber und würziger Leichtigkeit: Weihrauch- und Wachsdüfte und die kühle Frische von Marmor.
Der Warteschlange vor der Schatzkammer wich ich aus und gelangte am Ende des Chors in »meine« Kapelle – die Stätte der Andacht, in der ich jeden Abend betete.
Unsere liebe Frau der Sieben Schmerzen. Einige schwach erleuchtete Bänke, ein Altar, auf dem unechte Kerzen und liturgische Gegenstände standen. Ich schlüpfte in eine Bank auf der rechten Seite und ging bis ans Ende durch, wo ich mich ungestört fühlte. Kaum hatte ich die Augen geschlossen, ertönte auch schon eine Stimme in mir:
»Schau dir die Penner an!«
Luc stand neben mir – Luc im Alter von vierzehn Jahren, hager und rothaarig. Ich war nicht mehr in Notre-Dame, sondern in der Kapelle der Realschule Saint-Michel-de-Sèze, im Kreis der Schüler der 9. Klasse. Mit seiner schneidenden Stimme fuhr Luc fort:
»Wenn ich Priester bin, stehen all meine Schäfchen. Wie in einem Rockkonzert!«
Lucs Mut beeindruckte mich. Mein Glaube erschien mir damals als ein unerhörter Makel, denn die anderen Schüler hassten den Religionsunterricht. Und da kam dieser Bengel und behauptete, Priester werden zu wollen – ein Priester mit einer Schwäche für Rock ’n’ Roll!
»Ich heiße Luc«, sagte er, »Luc Soubeyras. Ich hab gehört, dass du unter deinem Kopfkissen eine Bibel versteckst. Wie kann man nur so blöd sein. Aber du bist nicht allein, es gibt hier noch einen zweiten: mich.« Er faltete die Hände. »Selig sind diejenigen, die verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich.« Dann hielt er die flache Hand Richtung Chordecke, damit ich einschlug.
Das Geräusch unserer aufeinanderschlagenden Hände holte mich in die Wirklichkeit zurück. Ich blinzelte und befand mich wieder in meinem Refugium in Notre-Dame. Das kalte Gemäuer, die Weidenruten der Betstühle, die hölzernen Rückenlehnen… Wieder tauchte ich in die Vergangenheit ein.
An jenem Tag hatte ich den eigenwilligsten Schüler von Saint-Michel-de-Sèze kennengelernt. Er redete wie ein Wasserfall, war arrogant und sarkastisch, aber zugleich von einer glühenden Gläubigkeit. Es waren die ersten Monate des Schuljahrs 1981–1982. Luc, der in die 9b ging, war schon seit zwei Jahren auf dieser Schule. Er war groß und dürr, wie ich, aber auch nervös und hektisch. Abgesehen von unserer Statur und unserem Glauben hatten wir noch eine weitere Gemeinsamkeit: Wir trugen die Namen von Aposteln. Er den des Evangelisten, dem Dante den Beinamen »der Schriftgelehrte« gegeben hatte, weil sein Evangelium mit besonderer Kunstfertigkeit geschrieben ist. Ich den des Matthäus, des Zöllners und Gesetzeshüters, der Christus folgte und jedes seiner Worte aufzeichnete.
Doch das war es dann auch schon mit unseren Gemeinsamkeiten. Ich war in Paris geboren, im vornehmen 16. Arrondissement. Luc Soubeyras stammte aus Aras, einem Geisterdorf im Departement Hautes-Pyrénées. Mein Vater hatte in den siebziger Jahren in der Werbebranche ein Vermögen gemacht. Luc war der Sohn von Nicolas Soubeyras, einem Lehrer, Kommunisten und Amateur-Höhlenforscher, der in der Region bekannt war, weil er sich ohne Uhr oder sonstigen Zeitmesser tief in Gebirgshöhlen vorgewagte hatte und vor drei Jahren in einer dieser Höhlen verschollen war. Ich war als Einzelkind in einer Familie aufgewachsen, die Zynismus und Großspurigkeit zu absoluten Werten erhoben hatte. Wenn Luc nicht im Internat war, lebte er bei seiner Mutter, einer beurlaubten Beamtin und alkoholkranken gläubigen Christin, die nach dem Tod ihres Mannes durchgeknallt war.
So viel zu unserem sozialen Hintergrund. Auch unser Status als Schüler war unterschiedlich. Ich besuchte das Jesuitenkolleg Saint-Michel-de-Sèze, weil es eines der renommiertesten und teuersten Privatinternate in Frankreich, aber vor allem sehr weit weg von Paris war. Es bestand keine Gefahr, dass ich mit meinen trübseligen Gedanken und meinen mystischen Krisen am Wochenende bei meinen Eltern hereinschneite. Luc dagegen besuchte das Kolleg, weil er als Waise ein Stipendium von den Jesuiten erhalten hatte, die das Internat führten.
Schließlich begründete dies eine letzte Gemeinsamkeit zwischen uns: Wir waren allein. Und so vertrieben wir uns die Zeit an den endlosen Wochenenden, an denen das Kolleg verwaist war, mit stundenlangen Gesprächen darüber, was wir später einmal werden wollten.
Wir gefielen uns darin, unsere jeweiligen Erweckungserlebnisse literarisch zu verklären, indem wir uns mit Claudel verglichen, dem sich Gott in Notre-Dame offenbart hatte, und mit Augustinus, der in einem Garten in Mailand das göttliche Licht empfing. Mein Erweckungserlebnis hatte ich im Alter von sechs Jahren zu Weihnachten. Als ich mein Spielzeug unter dem Tannenbaum betrachtete, rutschte ich buchstäblich in eine kosmische Spalte hinein. Ich hielt einen roten Spielzeugwagen in Händen, als ich plötzlich begriff, dass sich hinter jedem Gegenstand eine unsichtbare, unermessliche Wirklichkeit verbarg. Ich blickte kurz hinter die Kulissen der Erscheinungswelt, die ein Geheimnis verschleierten; von dort vernahm ich einen Ruf. Ich ahnte, dass dieses Mysterium die Wahrheit in sich barg. Obgleich – oder vielmehr: gerade weil – ich noch keine Antwort besaß. Ich stand am Anfang des Weges – und meine Fragen stellten bereits eine Antwort dar. Später las ich bei Augustinus: »Der Glaube sucht, die Vernunft findet…«
Lucs Erweckungserlebnis war anders als meines nicht diskret und intim, sondern explosiv und spektakulär gewesen. Er behauptete, mit eigenen Augen die Macht Gottes gesehen zu haben, als er seinen Vater auf einen Erkundungsgang ins Gebirge begleitete, wo er nach einer Höhle suchte. Das war 1978. Er war damals elf. Auf einer schimmernden Felswand hatte er das Antlitz Gottes gesehen. Und in diesem Moment hatte er begriffen, dass die Welt eine große Einheit bildete und Gott, der Herr, in allen Dingen war – in jedem Stein, jedem Grashalm, jedem Windstoß. Anders gesagt: Jeder Teil, selbst der winzig kleinste, enthielt das Ganze. Luc hatte diese Überzeugung nie mehr in Frage gestellt.
In Saint-Michel-de-Sèze hatte sich unsere Inbrunst – bei ihm eher laut und extrovertiert, bei mir eher leise – entfalten können. Nicht weil die Schule katholisch war – im Gegenteil, wir verachteten unsere Lehrer, die jesuitische Frömmler waren –, sondern weil die Gebäude des Internats um ein Zisterzienserkloster auf einer Anhöhe lagen.
Dort trafen wir uns. Vom Fuß des Kirchturms aus bot sich ein Rundblick auf das Tal. Der zweite, unser Lieblingstreffpunkt, lag unter dem Gewölbe des Kreuzgangs, der von Apostelstatuen gesäumt wurde. Im Schatten der verwitterten Gesichter von Jakobus dem Älteren mit seinem Pilgerstab oder von Matthäus mit seiner Axt ließen wir die Vergangenheit wieder lebendig werden.
Mit dem Rücken an die Säulen gelehnt, drückten wir unsere Zigarettenkippen aus und beschworen unsere Helden herauf – die ersten Märtyrer, die in die Welt hinauszogen, um das Wort Gottes zu verbreiten, und die in römischen Arenen ihr Ende fanden –, aber auch Augustinus, Thomas von Aquin, Johannes vom Kreuz und so weiter. Wir sahen uns in Gedanken selbst als Glaubenskrieger, Theologen, Kreuzritter der Moderne, die das Kirchenrecht von Grund auf erneuerten, die alten Kurienkardinäle auf Trab brachten und neue Strategien ersannen, um das Christentum weltweit zu verbreiten.
Während die anderen Internatsschüler Ausflüge in die Schlafsäle der Schülerinnen unternahmen, diskutierten wir endlos über das Mysterium des Abendmahls, redeten uns die Köpfe über das Zweite Vatikanische Konzil heiß, das uns nicht weit genug gegangen war. Ich roch wieder den Duft von geschnittenem Gras im Innenhof des Klosters, spürte das zerknüllte Papier von Gauloises-Päckchen in meiner Hand und hörte unsere pubertären Stimmen, die sich schrill überschlugen und schließlich in schallendem Gelächter endeten. Unser Getuschel endete immer mit den letzten Worten aus dem Tagebuch eines Landpfarrers von Georges Bernanos: »Was macht das schon? Allein die Gnade zählt.« Damit war alles gesagt.
Die Orgeln von Notre-Dame holten mich zurück in die Gegenwart. Es war 17.45 Uhr. Die Montagsvesper begann. Ich stand auf. Da durchzuckte mich ein heftiger Schmerz. Ich erinnerte mich daran, wie ernst die Lage war: Luc zwischen Leben und Tod; ein Selbstmordversuch, eine Tat tiefster Verzweiflung.
Ich setzte mich wieder in Bewegung, halb hinkend, die Hand auf der linken Leiste. Ich hielt mich an der Heckler & Koch fest, die an meinem Gürtel schon lange die vorschriftsmäßige Manhurin ersetzt hatte. Ein Gespenst von einem Polizisten, dessen Schatten sich vor ihm herschlängelte, passend zu den langen weißen Stoffbahnen am Gerüst um den Chor, der restauriert wurde.
Draußen traf mich ein weiterer Schlag. Nicht wegen des Tageslichts, sondern aufgrund einer Erinnerung, die mich wie ein Dolch durchbohrte. Das schneeweiße Gesicht von Luc, der in lautes Gelächter ausbricht. Sein rötliches Haar, seine gekrümmte Nase, seine fein geschwungenen Lippen und seine großen grauen Augen.
In diesem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Ich hatte das Wichtigste übersehen. Luc Soubeyras würde sich niemals das Leben nehmen. So einfach war das. Ein Katholik seines Schlags brachte sich nicht um. Das Leben war für ihn ein Geschenk Gottes, über das der Mensch nicht verfügen sollte.
Kapitel 3
Zentrale der Pariser Kriminalpolizei, Quai des Orfèvres Nr.36. Lange Flure. Dunkelgrauer Boden. Stromkabel, die an der Decke kleben. Büros mit schrägen Wänden. Ich nahm diese Räume schon gar nicht mehr bewusst wahr und bewegte mich darin wie ein Fisch im Wasser. Selbst der Geruch von Tabak oder Schweiß hätte meine Aufmerksamkeit nicht mehr wecken können.
Allerdings hatte ich ein leicht unangenehmes Gefühl von Nässe, das mich nicht mehr verließ, als bewegte ich mich in einem lebenden Organismus, der im Begriff war, sich aufzulösen. Das war natürlich nur eine Halluzination, die mit meinem Aufenthalt in Afrika zusammenhing. Meine Wahrnehmung hatte sich dort auf seltsame Weise verändert; feste Gegenstände erschienen mir als feuchte Lebewesen.
Durch die einen Spalt weit offen stehenden Türen schnappte ich unmissverständliche Blicke auf – alle wussten Bescheid. Ich ging schneller, um nicht Fragen nach dem Befinden Lucs beantworten oder Banalitäten über die Verzweiflung, in die uns unser Beruf trieb, austauschen zu müssen. Ich nahm die Post, die sich in meinem Fach angehäuft hatte, heraus und zog die Tür zu meinem Büro hinter mir zu.
Diese Blicke gaben mir einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen würde. Jeder würde sich nach dem Motiv von Lucs Tat fragen. Eine Untersuchung würde eingeleitet werden. Die Jungs von der Abteilung Interne Ermittlungen würden sich einschalten. Zwar würde die Hypothese einer Depression vorrangig verfolgt, aber die Typen von der Internen Ermittlung würden in Lucs Vergangenheit herumschnüffeln. Überprüfen, ob er vielleicht spielsüchtig oder verschuldet war, ob er vielleicht krumme Geschäfte mit seinen Spitzeln ausgeheckt und sich strafbar gemacht hatte.Routineermittlungen, bei denen bestimmt nichts herauskam, die jedoch alles in den Schmutz ziehen würden.
Übelkeit, Lust zu schlafen. Ich zog meinen Trenchcoat aus, behielt aber trotz der Hitze mein Sakko an. Das vertraute Gefühl des Seidenfutters beruhigte mich. Eine zweite Haut. Nachdem ich mich auf meinen Stuhl gesetzt hatte, betrachtete ich meine dritte Haut: mein Büro. Fünf Quadratmeter ohne Fenster, wo sich die Akten fast bis an die Decke stapelten.
Ich warf einen Blick auf den Stoß von Schriftstücken, die ich im Vorbeigehen mitgenommen hatte. Vernehmungs- und Festnahmeprotokolle, Telefonrechnungen, Kontoauszüge von Verdächtigen, Beschlagnahmeverfügungen, die mir endlich von den Richtern bewilligt wurden. Und außerdem: die kriminalpolizeiliche Presseschau, die morgens und abends herauskam und vom Innenministerium erstellt wurde, sowie Fernschreiben, die die wichtigsten Kriminalfälle im Großraum Paris zusammenfassten. Das übliche Schlammbad. Und alles von meinen Stellvertretern mit Haftnotizen beklebt, auf denen sie die Erfolge und Misserfolge des Tages verzeichnet hatten.
Starker Widerwille. Nicht einmal meine Nachrichten wollte ich abhören. Stattdessen rief ich die Gendarmerie von Nogent-le-Rotrou an, der Stadt, die Vernay am nächsten lag, und verlangte, mit dem Capitaine zu sprechen, der die Rettungsmaßnahmen bei der Bergung Lucs geleitet hatte. Der Mann bestätigte Svendsens Angaben. Der mit Ballast beschwerte Körper, die Einlieferung in der Notaufnahme, die Reanimation.
Ich legte auf, tastete meine Sakkotaschen ab, fand meine Zigaretten. Ich zog eine heraus, nahm mein Feuerzeug und genoss, während ich nachdachte, das Ritual in allen Einzelheiten. Das behagliche Rascheln der Schachtel; der orientalische Duft, der ihr entströmte, vermischt mit dem Benzingeruch des Zippo; die Tabakkrümel, die an meinen Fingern klebten, und schließlich der heiße Rauch, den ich tief einsog…
18 Uhr. Ich begann endlich damit, die Dokumente zu entziffern. Die Haftnotizen. Erste Zeichen der Solidarität: »Mit Dir. Franck«, »Noch ist nicht alles verloren. Gilles«, »Jetzt gilt es, ruhiges Blut zu bewahren! Philippe«. Ich löste die Zettel ab und legte sie beiseite.
Dann erst stürzte ich mich in die Arbeit und machte eine Bestandsaufnahme der positiven und negativen Punkte des Tages. Foucault informierte mich, dass die Kriminalpolizeidirektion von Louis Blanc uns die Akte über eine mit Schnitten übersäte Leiche nicht herausgeben wollte, die in der Nähe der Métro-Station Stalingrad gefunden worden war. Dieser Mord konnte etwas mit einer Abrechnung unter Dealern in La Villette zu tun haben, in der wir seit einem Monat ermittelten. Die Weigerung erstaunte mich nicht weiter. Es ging immer um die alte Rivalität zwischen Kriminalpolizeidirektion und Mordkommission. Jeder für sich, und die Leichen werden eifersüchtig gehütet.
Die folgende Nachricht war konstruktiver. Vor fünfzehn Tagen hatte mich ein Kollege aus meinem Jahrgang, der bei der Kriminalpolizeidirektion Cergy-Pontoise arbeitete, in einem Mordfall um Rat gefragt: Eine neunundfünfzigjährige Kosmetikerin war ermordet auf ihrem Parkplatz aufgefunden worden. Sechzehn Schnitte mit einem Rasiermesser. Kein Raubüberfall, keine Vergewaltigung. Kein Zeuge. Die Ermittler tippten zunächst auf ein Verbrechen aus Leidenschaft, dann auf einen perversen, psychopathischen Täter – aber beide Ansätze verliefen im Sand.
Als ich die Fotos der Leiche betrachtete, fielen mir mehrere Details auf. Die Angriffswinkel des Rasiermessers verrieten, dass der Mörder die gleiche Größe hatte wie sein Opfer, das eher klein war. Die Waffe war ungewöhnlich: ein kurzer, altmodischer Säbel, den man nur noch in Trödelläden fand und der auch von einer Frau benutzt worden sein könnte. Bei Abrechnungen zwischen Prostituierten beispielsweise kam diese Waffe zum Einsatz – eine Waffe, die die Gegnerin entstellte –, wohingegen Männer eher Messer einsetzten und dem anderen Stichverletzungen im Bauchraum zuzufügen versuchten.
Vor allem aber konzentrierten sich die Verletzungen aufs Gesicht, die Brust und den Unterleib. Der Mörder hatte sich die Körperregionen ausgesucht, in denen sich das Geschlecht des Opfers ausdrückte. Er hatte vornehmlich auf das Gesicht gezielt und auf die Nase, die Lippen und die Augen eingestochen. Durch die Entstellung des Opfers wollte sich der Mörder oder die Mörderin womöglich selbst treffen, indem er sein Spiegelbild zerstörte. Auch das Fehlen von Abwehrverletzungen, die durch Kampf- und Schutzbewegungen hervorgerufen werden, war mir aufgefallen: Die Kosmetikerin hegte keinen Argwohn. Sie kannte den Angreifer. Ich hatte meinen Kollegen von der KPD Cergy gefragt, ob die Tote eine Tochter oder Schwester habe. Mein Jahrgangskumpel hatte mir versprochen, die Angehörigen erneut zu vernehmen. Auf der Haftnotiz stand lediglich: »Die Tochter hat gestanden!«
Ich legte die Telefonrechnungen und die Kontoauszüge beiseite, weil ich zu zerstreut war, um sie gründlich auszuwerten. Ich wandte mich einem anderen Aktenbündel zu, das frisch gedruckt worden war: eine Tatbestandsaufnahme von einem Tatort, den ich am Vortag verpasst hatte. Der dritte Mann in meiner Gruppe, Meyer, war der Pedant des Teams, sein »Schriftsteller«. Als studierter Philologe verwandte er große Sorgfalt auf die Abfassung dieser Protokolle – und verstand es, die Tatorte von Morden plastisch zu schildern.
Ich war sofort in der Geschichte drin. Le Perreux vor zwei Tagen. Um die Mittagszeit hatten ein oder mehrere Angreifer ein Schmuckgeschäft überfallen, bevor die Geschäftsführerin Alarm auslösen konnte. Sie hatten die Kasse, den Schmuck – und die Frau – mitgenommen. Am nächsten Morgen war die Juwelierin tot in einem Waldstück am Ufer der Marne aufgefunden worden, zur Hälfte mit Erde bedeckt. Meyer beschrieb den Fundort der Leiche, den Humus und das Laub. Und die Schuhe, die im rechten Winkel zum aufgeschütteten Grab standen. Was hatte das mit den Schuhen zu bedeuten?
In meinem Gedächtnis nahm eine Erinnerung Gestalt an. Während meiner »humanitären« Phase, bevor ich Afrika bereiste, war ich in den nördlichen Pariser Vororten in einem Bus herumgefahren und hatte Lebensmittel, Kleidung und Medikamente an obdachlose Familien verteilt, die unter den Brücken des Boulevard Périphérique hausten. Bei dieser Gelegenheit hatte ich mich mit der Kultur der Roma beschäftigt. Hinter ihrem heruntergekommenen, verwahrlosten Äußeren verbarg sich eine straff organisierte Gemeinschaft, bei der insbesondere die Beziehung zwischen den Geschlechtern und die Beisetzung der Toten strengen Regeln unterlagen. Bei einer Beerdigung, an der ich teilnahm, war mir ein rätselhaftes Schuhritual aufgefallen. Die Roma hatten dem Leichnam vor der Bestattung die Schuhe ausgezogen und die Stiefel neben das Grab gestellt. Weshalb? Ich erinnerte mich nicht mehr, aber ich hielt es für angezeigt, dieser Parallele auf den Grund zu gehen.
Ich griff zum Telefon und rief Malaspey an, den Kühlsten und Verschlossensten meiner Leute. Der Einzige, der mit Sicherheit nicht mit mir über Luc sprechen würde. Ich bat ihn, einen Experten für die Roma-Kultur aufzutreiben und etwas über ihre Bestattungsriten herauszufinden. Falls sich mein Verdacht bestätigte, müssten wir bei den Roma-Gemeinschaften im Departement Val-de-Marne Nachforschungen anstellen. Malaspey stimmte mir zu und legte auf, ohne dass ein persönliches Wort gefallen wäre – genau so, wie ich es erwartet hatte.
Zurück zum Papierkram. Vergeblich. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich legte die Vernehmungsprotokolle zur Seite und betrachtete meine Rumpelkammer, an deren Wänden sich die Akten der ungelösten Fälle stapelten. Fälle, deren Akten ich nicht schließen wollte. Ich war der einzige Ermittler in der Mordkommission, der diese Dokumente aufhob. Der Einzige, der ihre Verjährungsfrist – bei Bluttaten zehn Jahre – voll ausschöpfte, indem ich hin und wieder eine Vernehmung durchführte oder einem neuen Hinweis nachging.
Mein Blick fiel auf das mit Reißzwecken auf einer Aktenmappe befestigte Foto eines jungen Mädchens. Cecilia Bloch, deren verbrannter Körper 1984 einige Kilometer von Saint-Michel-de-Sèze entfernt aufgefunden worden war. Der Täter war nie gefunden worden – das einzige Indiz waren die Aerosol-Spraydosen, mit deren Hilfe die Leiche angezündet worden war. Damals war ich Internatszögling in Sèze, und die Tat ging mir nicht aus dem Sinn. Eine Frage ließ mir keine Ruhe: Hatte der Mörder die Kleine zuerst getötet oder sie bei lebendigem Leib verbrannt? Nachdem ich Polizist geworden war, hatte ich die Akte ausgegraben, den Tatort besichtigt und die Gendarmen sowie die Anwohner befragt – ohne Ergebnis.
Das Foto eines weiteren Kindes hing an der Wand. Ingrid Coralin. Eine Waise, die mittlerweile zwölf Jahre alt sein musste und ihre Kindheit in Heimen verbracht hatte. Ich war indirekt für den Tod ihrer Eltern im Jahr 1996 verantwortlich und überwies ihr anonym eine feste Summe.
Cecilia Bloch, Ingrid Coralin.
Meine vertrauten Phantome, meine einzigen »Kinder«…
Ich schüttelte die Gedanken ab. Es war fast 20 Uhr – Zeit zu handeln. Ich stieg eine Etage nach oben, gab den Zugangscode zum Rauschgiftdezernat ein und betrat die Räumlichkeiten. Rechter Hand kam ich an dem Open Space des Ermittlungsteams von Luc vorbei. Kein Mensch. Man hätte meinen können, dass sie sich alle irgendwo anders versammelt hatten – vielleicht in einem ihrer Stammlokale, um in Ruhe einen zu heben. Lucs Männer waren die hartgesottensten Burschen in der Kripozentrale am Quai des Orfèvres. Ich wünschte den Typen von der Internen Ermittlung, die sie vernehmen würden, viel Glück. Aber sie würden bei ihnen auf Granit beißen.
Ich kam an der Tür von Lucs Dienstzimmer vorbei; ohne stehen zu bleiben, warf ich einen Blick in die Nebenzimmer: niemand. Ich kehrte um, drückte die Türklinke herunter – abgeschlossen. Aus meiner Tasche zog ich einen Schlüsselbund und hatte das Schloss nach wenigen Sekunden geöffnet. Lautlos betrat ich den Raum.
Luc hatte aufgeräumt. Der Schreibtisch blitzeblank. An den Wänden nicht ein Steckbrief. An der Magnettafel keine Tatortfotos. Auf dem Boden keine einzige liegen gebliebene Akte. Wenn Luc wirklich hätte Schluss machen wollen, wäre er nicht anders vorgegangen. Der Hang zur Verschwiegenheit war einer seiner hervorstechenden Charakterzüge.
Einige Sekunden verharrte ich reglos und ließ den Raum auf mich wirken. Lucs Büro war nicht größer als meines, hatte jedoch ein Fenster. Ich ging um den Schreibtisch herum – ein Möbelstück aus den dreißiger Jahren, das Luc in einem Trödelladen gekauft hatte – und näherte mich der Korktafel hinter dem Sessel. Dort hingen einige Fotos. Porträts des achtjährigen Camille und der sechsjährigen Amandine. Im Halbdunkel schwebte ihr Lächeln auf dem Glanzpapier wie auf der Oberfläche eines Sees. Auch Kinderzeichnungen waren zu sehen – von Feen, von Häusern, in denen eine kleine Familie wohnte, von »Papa« der, mit einer übergroßen Pistole bewaffnet, Jagd auf »Drogenhändler« machte. Ich legte meine Finger auf die Aufnahmen und flüsterte: »Was hast du getan? Verdammt, was hast du nur getan…?«
Ich öffnete sämtliche Schubladen. In der ersten Büroartikel, Handschellen, eine Bibel. In der zweiten und dritten Schublade Fälle aus jüngster Zeit – erledigte Fälle. Tadellose Berichte, minutiöse Dienstanweisungen. Noch nie hatte Luc so viel Ordnungssinn bei der Arbeit gezeigt. Eine echte Inszenierung. Das Büro eines Klassenbesten.
Ich blieb vor dem Computer stehen. Der PC würde wohl kaum den Schlüssel zur Lösung des Falles enthalten, aber ich wollte auf Nummer Sicher gehen. Ich drückte automatisch die Leertaste. Der Bildschirm leuchtete auf. Ich griff nach der Maus und klickte auf eines der Icons. Eingabe eines Passworts. Aufs Geratewohl gab ich das Geburtsdatum Lucs ein. Fehlermeldung. Die Vornamen Camille und Amandine. Wieder Fehlermeldungen. Ich wollte eine vierte Möglichkeit ausprobieren, als das Licht anging.
»Was machst du denn da?«
In der Tür stand Patrick Doucet, genannt »Doudou«, die Nummer zwei in Lucs Team. Er trat einen Schritt vor und fragte noch einmal:
»Was, verdammt nochmal, machst du in diesem Büro?«
Er zischte diese Worte zwischen zusammengepressten Lippen hervor. Mir verschlug es die Stimme. Doudou war der gefährlichste des ganzen Teams. Ein Hitzkopf, der sich mit Amphetaminen zudröhnte, seine ersten Sporen beim Sondereinsatzkommando verdient hatte, und der nichts lieber tat, als Verbrecher auf frischer Tat zu ertappen. Er war an die Dreißig, hatte das Gesicht eines gefallenen Engels und die breiten Schultern eines Bodybuilders, die in einem abgewetzten Lederblouson steckten. An den Seiten trug er die Haare kurz, im Nacken lang. Eigenwilliges Detail: An der rechten Schläfe hatte er sich drei Krallen ausrasieren lassen.
Doudou zeigte auf den beleuchteten Bildschirm.
»Immer in der Scheiße rumwühlen, wie?«
»Wieso Scheiße?«
Er antwortete nicht. Er zuckte nur herausfordernd mit den Schultern. Sein Blouson ging auf, und zum Vorschein kam der Kolben einer Glock 21 Kaliber .45, der regulären Pistole der Gruppe.
»Du hast ’ne Fahne!«, sagte ich.
Doudou kam näher. Mit einem flauen Gefühl in der Magengrube wich ich zurück.
»Was ist schon dabei, mal einen zu heben?«
Meine Vermutung war richtig gewesen. Lucs Männer waren losgezogen, um sich einen hinter die Binde zu gießen. Wenn jetzt die anderen auftauchten, würden sie mich vielleicht lynchen.
»Was suchst du hier?«, fauchte er mich an.
»Ich will herausfinden, wieso es mit Luc so weit kommen konnte.«
»Schau dir nur dein Leben an. Dann weißt du’s!«
»Luc würde nie Selbstmord begehen, egal, wie schlimm er dran wäre. Das Leben ist ein Geschenk Gottes und…«
»Verschon mich mit deinen Predigten.«
Doudou ließ mich nicht aus den Augen. Nur der Schreibtisch trennte uns. Mir fiel auf, dass er leicht taumelte. Diese Beobachtung beruhigte mich. Stockbesoffen. Ich beschloss, kein Blatt vor den Mund zu nehmen:
»Wie war er in den letzten Wochen drauf?«
»Was geht dich das an?«
»Woran hat er gearbeitet?«
Doudou fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Ich schlich an der Wand entlang und wich vor ihm zurück:
»Irgendetwas muss vorgefallen sein…«, fuhr ich fort, ohne ihn aus den Augen zu lassen. »Vielleicht eine Ermittlung, die ihn am Boden zerstört hat…«
Doudou grinste höhnisch:
»Wonach suchst du? Ein Fall, der einen in den Tod treibt?«
In seinem Suff hatte er das passende Wort gefunden. Wenn ich zu dem Schluss gelangen müsste, dass Luc Selbstmord begangen hat, wäre dies eine meiner Hypothesen: Ein Ermittlungsverfahren, das ihn in tiefste, ausweglose Verzweiflung stürzte. Ein Fall, der seinen katholischen Glauben erschütterte. Ich bohrte nach:
»Woran habt ihr, verdammt nochmal, gearbeitet?«
Doudou verfolgte mich aus den Augenwinkeln, während ich weiter vor ihm zurückwich. Statt zu antworten, rülpste er laut. Ich grinste nun auch:
»Spiel dich ruhig auf. Morgen werden dich die Typen von der Internen durch die Mangel drehen.«
»Die können mich mal!«
Er schlug mit der Faust auf den Computer. Sein Gliederarmband funkelte golden. Er schrie:
»Luc hat sich nichts vorzuwerfen, kapiert? Wir haben uns nichts vorzuwerfen! Verdammt!«
Ich kehrte um und schaltete vorsichtig den Computer aus.
»Wenn das so ist«, sagte ich leise, »solltest du deine Einstellung ändern.«
»Jetzt schwafelst du wie ’n Anwalt.«
Ich pflanzte mich vor ihm auf. Ich hatte seine verächtliche Art satt:
»Hör gut zu, Schwachkopf, Luc ist mein bester Kumpel, okay? Also stier mich nicht an wie ein Ochse. Ich werde herausfinden, weshalb er das getan hat. Und du wirst mich nicht daran hindern.«
Mit diesen Worten strebte ich der Tür zu. Als ich den Fuß über die Schwelle gesetzt hatte, zischte Doudou in meinem Rücken:
»Niemand wird singen, Durey. Aber wenn du in der Scheiße stocherst, wirst du uns alle in den Schmutz ziehen.«
»Wie wär’s dann, wenn du mir ein bisschen mehr erzählen würdest?«, versetzte ich.
Statt zu antworten, zeigte er mir nur einen starr nach oben gerichteten Mittelfinger.
Kapitel 4
Unter freiem Himmel.
Eine Treppe unter freiem Himmel. Als ich die Wohnung zum ersten Mal besichtigt hatte, wusste ich sofort, dass ich sie genau deswegen nehmen würde. Mit Terrakottafliesen belegte Stufen einer Wendeltreppe mit einem efeuumrankten Eisengeländer in einem Innenhof aus dem 18. Jahrhundert. Auf Anhieb fühlte ich mich hier wohl. Ich stellte mir vor, wie ich von der Arbeit nach Hause kam und alle Sorgen des Alltags auf der Treppe von mir abfielen.
Ich hatte mich nicht getäuscht. Ich hatte mein Erbe in diese Drei-Zimmer-Wohnung im Marais investiert, und seit vier Jahren spürte ich tagtäglich die magische Wirkung der Treppe. Auch wenn die Arbeit nervenaufreibend und zermürbend war, hatte ich das Gefühl, auf der Wendeltreppe eine Art Entgiftungsschleuse zu passieren. Gleich hinter der Wohnungstür entkleidete ich mich, stopfte meine Klamotten in einen Wäschesack und stieg unter die Dusche.
An diesem Abend aber schien die Treppe ihre Macht verloren zu haben. Als ich im dritten Stock ankam, blieb ich stehen. Ein Schatten saß auf der Treppe und wartete auf mich. Im Zwielicht erkannte ich den Wildledermantel, das violette Kostüm. Es war die Person, die ich am allerwenigsten sehen wollte: meine Mutter.
Während ich oben ankam, machte mir eine heisere Stimme erste Vorwürfe:
»Ich habe dir auf den Anrufbeantworter gesprochen, und trotzdem hast du nicht zurückgerufen.«
»Ich hatte heute viel zu tun.«
Es bestand kein Anlass, ihr von dem Vorfall zu erzählen, denn meine Mutter war Luc nur ein- oder zweimal begegnet, als wir noch Halbwüchsige waren. Sie hatte nichts gesagt, aber ihr Gesichtsausdruck hatte Bände gesprochen – das gleiche Gesicht hatte sie gezogen, wenn sie eine Familie mit lärmenden Kindern in der Erste-Klasse-Lounge am Flughafen Roissy oder einen Fleck auf einem ihrer Sofas entdeckte: Es waren die störenden Misstöne, die sie nicht aus ihrem mondänen Leben verbannen konnte.
Sie machte keine Anstalten aufzustehen. Ich setzte mich neben sie, ohne mir die Mühe zu machen, die Flurbeleuchtung einzuschalten. Wir waren vor Wind und Regen geschützt, und für einen 21. Oktober war es recht mild.
»Was willst du? Etwas Dringendes?«
»Ich wollte dich besuchen, das ist alles.«
Sie schlug die Beine übereinander, und ich sah den Stoff ihres Rocks jetzt besser – ein Tweed aus Bouclégarn. Fendi oder Chanel. Ich sah an ihr herab bis zu den Schuhen. Schwarz und golden. Manolo Blahnik. Diese Geste, diese Details… Ich sah sie vor mir, wie sie auf ihren Diners ihre Gäste begrüßte. Andere Bilder kamen hinzu. Mein Vater, der mich zärtlich mein »kleines Christkind« nannte und mich dann ans Tischende setzte; meine Mutter, die immer zurückwich, wenn ich zu ihr wollte, aus Angst, ich könnte ihre Kleider zerknittern. Und mein stummer Stolz angesichts ihrer Distanziertheit und ihres armseligen Materialismus.
»Es ist Wochen her, seit wir zum letzten Mal zusammen zu Mittag gegessen haben.«
Sie brachte ihre Vorwürfe immer in dem gleichen sanften Tonfall vor. Sie trug seelische Kränkungen zur Schau, an die sie selbst nicht glaubte. Meine Mutter, die nur für Markenklamotten und für Weine aus kontrolliertem Anbau lebte, bewegte sich in einer Welt unechter Gefühle.
»Tut mir leid«, log ich, »dass die Zeit so schnell vergeht!«
»Du liebst mich nicht.«
Sie hatte die Gabe, im Verlauf einer harmlosen Unterhaltung tragische Sentenzen zum Besten zu geben. Dieses Mal hatte sie es im Tonfall eines schmollenden kleinen Mädchens gesagt. Ich konzentrierte mich auf den Duft des feuchten Efeus, den Geruch der Wände, die vor Kurzem neu gestrichen worden waren.
»Im Grunde liebst du niemanden.«
»Ganz im Gegenteil: Ich liebe alle Menschen.«
»Das sage ich doch. Dein Gefühl ist allgemein und abstrakt. Es ist eine Art… Theorie. Du hast mir niemals eine Braut vorgestellt.«
Ich betrachtete das Stück Nachthimmel, das sich über dem Treppengeländer abzeichnete.
»Wir haben tausendmal darüber gesprochen. Mein Herz ist anderweitig gebunden. Ich versuche, meine Mitmenschen zu lieben. Alle Mitmenschen.«
»Auch die Verbrecher?«
»Vor allem die Verbrecher.«
Sie schlug ihren Mantel über ihre Beine. Ich betrachtete ihr vollkommenes Profil.
»Du bist wie ein Psychologe«, fügte sie hinzu. »Du interessierst dich für alle und daher für niemanden. Jemanden lieben heißt, sein Leben für ihn aufs Spiel setzen, mein Junge.«
Ich war mir nicht sicher, ob gerade sie das Recht hatte, mich zu belehren. Trotzdem zwang ich mich dazu, ihr zu antworten, denn sie wollte zweifellos auf etwas hinaus.
»Ich habe in Gott eine lebhaft sprudelnde Quelle gefunden. Einen Born der Liebe, der nie versiegt und der bei den anderen das gleiche Gefühl wecken soll.«
»Immer deine Predigten. Du lebst in einer anderen Zeit, Mathieu.«
»Der Tag, an dem du begreifst, dass das Wort Gottes zeitlos ist…«
»Behandle mich nicht so herablassend.«
Ihr Gesichtsausdruck ließ mich plötzlich stutzen: Meine Mutter war genauso sonnengebräunt und elegant wie immer, aber heute kam so etwas wie Müdigkeit und Überdruss zum Vorschein.
»Weißt du, wie alt ich bin?«, fragte sie plötzlich, »Ich meine, wie alt ich wirklich bin?«
Das war eines der bestgehüteten Geheimnisse von Paris. Sobald ich Zugriff auf das zentrale Personenregister hatte, hatte ich es als Erstes überprüft. Um ihr zu schmeicheln, sagte ich:
»Fünfundfünfzig, sechsundfünfzig…«
»Fünfundsechzig.«
Ich war fünfunddreißig. Mit dreißig Jahren hatte meine Mutter plötzlich den Wunsch gehabt, ein Kind zu bekommen, kurz nachdem sie in zweiter Ehe meinen Vater geheiratet hatte. Sie hatten sich über dieses »Projekt« verständigt, so wie man sich über den Kauf eines neues Segelboots oder eines Gemäldes von Soulages verständigt. Meine Geburt hatte sie zunächst bestimmt gefreut, aber dann waren sie meiner schnell überdrüssig geworden. Vor allem meine Mutter, die ihrer Launen immer schnell müde wurde. Egoismus und Müßiggang raubten ihr all ihre Energie. Echte Gleichgültigkeit ist eine Vollzeitbeschäftigung.
»Ich suche einen Priester.«
Meine Besorgnis nahm zu. Ich dachte plötzlich an eine tödliche Krankheit, eines jener erschütternden Ereignisse, die eine innere Umkehr auslösen.
»Du bist nicht…«
»Krank?« Sie lachte hochmütig. »Nein. Überhaupt nicht. Ich will beichten, das ist alles. Aufräumen. Wieder eine Art…Jungfräulichkeit finden.«
»Ein Facelifting, wie?«
»Mach dich nicht lustig.«
»Ich habe immer gedacht, du würdest der fernöstlichen Schule zuneigen«, spottete ich, »oder dem New Age.«
Sie schüttelte langsam den Kopf und sah mich schief an. Die hellen Augen in ihrem dunklen Gesicht waren noch immer beeindruckend verführerisch.
»Du findest das wohl witzig, wie?«
»Nein.«
»Dein Ton ist sarkastisch. Deine ganze Person ist sarkastisch.«
»Überhaupt nicht.«
»Du merkst es schon gar nicht mehr. Immer diese Distanz, diese Arroganz…«
»Wieso willst du zur Beichte gehen? Willst du nicht darüber sprechen?«
»Mit dir schon gar nicht. Kannst du mir jemanden empfehlen? Jemanden, dem ich mich anvertrauen könnte. Jemand, der Antworten hätte…«
Meine Mutter steckte mitten in einer Sinnkrise. Dies war offensichtlich ein besonderer Tag. Sie flüsterte, während es wieder anfing zu regnen:
»Es ist wohl das Alter. Keine Ahnung. Aber ich möchte eine… höhere Bewusstseinsstufe erreichen.«
Ich zückte einen Kuli und riss ein Blatt aus meinem Taschenkalender. Ohne nachzudenken, schrieb ich Namen und Anschrift eines Priesters darauf, den ich häufig besuchte. Geistliche sind nicht wie Psychologen: Man kann sie innerhalb der Familie weiterempfehlen. Ich hielt ihr den Zettel mit den Daten hin.
»Danke.«
Sie stand auf, eine Parfumwolke aufwirbelnd.
»Möchtest du nicht reinkommen?«
»Ich bin schon zu spät dran. Ich ruf dich an.«
Sie verschwand auf der Treppe. Die Gestalt im Wildledermantel fügte sich harmonisch in die glänzenden Efeublätter und den weißen Anstrich. Sie besaß die gleiche Frische, die gleiche Klarheit. Auf einmal fühlte ich mich alt. Ich drehte mich um und ging in den Flur hinein, an dessen Ende meine smaragdgrüne Tür leuchtete.
Kapitel 5
Nach vier Jahren hatte ich einen Teil der Umzugskartons noch immer nicht ausgepackt. Kisten mit Büchern und CDs stapelten sich in der Diele und gehörten mittlerweile zum Dekor. Ich legte meine Pistole darauf, ließ meinen Regenmantel fallen und zog meine Schuhe aus – meine unvermeidlichen Sebago-Mokassins, denen ich seit meiner Jugend treu war.
Ich machte Licht im Bad und betrachtete unwillkürlich mein Spiegelbild. Ein vertrauter Anblick: ein abgewetzter dunkler Markenanzug, helles Hemd, eine dunkelgraue Krawatte, ebenfalls verschlissen. Ich sah eher aus wie ein Winkeladvokat als wie ein Polizist. Ein Advokat auf Abwegen, der allzu lange Umgang mit Ganoven gepflegt hatte.
Ich näherte mich dem Spiegel. Mein Gesicht erinnerte an eine sturmzerzauste Heide, an einen vom Wind geschüttelten Wald – an eine Turner’sche Landschaft. Der Kopf eines Besessenen mit tief liegenden hellen Augen und braunen Locken. Ich hielt mein Gesicht in den Wasserstrahl und dachte an das Koma von Luc und den Besuch meiner Mutter.
In der Küche schenkte ich mir eine Tasse grünen Tee ein – die Thermoskanne stand seit dem Morgen bereit. Dann stellte ich eine Schale Reis in die Mikrowelle; am Wochenende kochte ich mir immer einen Vorrat für die ganze Woche. Mein Lebensstil war von zenbuddhistischer Askese geprägt. Ich mochte keine organischen Gerüche – weder Fleisch noch Obst, noch Braten. Meine ganze Wohnung war von dem Duft von Weihrauch erfüllt, den ich ständig verbrannte. Aber vor allem konnte ich den Reis mit Holzstäbchen essen. Das klirrende Geräusch von Metallbesteck und den Kontakt mit ihm ertrug ich nicht. Aus diesem Grund speiste ich nicht gern außer Haus.
An diesem Abend hatte ich keinen Appetit. Nach zwei Bissen warf ich den Inhalt der Schale in den Mülleimer und goss mir aus einer zweiten Thermoskanne einen Kaffee ein.
Meine Wohnung bestand aus einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer und einem Arbeitszimmer. Das klassische Triptychon des Pariser Singles. Alles war weiß, außer den Böden, die aus schwarzem Parkett bestanden, und der Wohnzimmerdecke mit den sichtbaren Balken. Ohne Licht zu machen, ging ich direkt ins Schlafzimmer, streckte mich auf dem Bett aus und überließ mich meinen Gedanken.
Luc, natürlich.
Doch statt fruchtlos über seinen Zustand oder das Motiv seiner Tat zu grübeln, entschied ich mich für eine Erinnerung. Eine jener Erinnerungen, in denen sich einer der seltsamsten Charakterzüge meines Freundes widerspiegelte.
Sein starkes Interesse an der Figur des Teufels.
Oktober 1989
Zweiundzwanzig Jahre, Institut Catholique de Paris.
Nach vierjährigem Studium an der Sorbonne hatte ich meine Magisterarbeit über »Die Überwindung des Manichäismus bei Augustinus« fertiggestellt und wollte mit dem gleichen Schwung weitermachen. Ich war unterwegs zum Institut, wo ich mich einschreiben wollte, um zu promovieren. Das Thema meiner Doktorarbeit, »Der Einfluss der frühchristlichen Autoren auf die Entwicklung des Christentums«, würde mir erlauben, mehrere Jahre mit meinen Lieblingsautoren zu verbringen: Tertullian, Minucius Felix, Cyprian…
Damals hielt ich die drei Mönchsgelübde – Gehorsam, Armut, Keuschheit. Ich lag also meinen Eltern nicht schwer auf der Tasche. Mein Vater missbilligte meine Einstellung. »Der Konsum ist die Religion des modernen Menschen!«, erklärte er barsch. Doch meine Unbeirrbarkeit nötigte ihm Respekt ab. Meine Mutter heuchelte Verständnis für meine Berufung, die ihrem Snobismus schmeichelte. In den achtziger Jahren war es schicker zu erzählen, dass sich der Sohn aufs Priesterseminar vorbereitete, als zu gestehen, dass er seine Zeit in Nachtklubs und auf Kokainpartys vertat.
Aber sie täuschten sich. Ich führte weder ein freudloses noch ein übermäßig sittenstrenges Dasein. Mein Glaube basierte auf Freude. Ich lebte in einer Welt des Lichts, einem riesigen Kirchenschiff, in dem ununterbrochen Tausende von Kerzen flackerten.
Ich begeisterte mich für meine lateinischen Kirchenväter. In ihrem Werk spiegelte sich die große Wende in der abendländischen Geschichte wider. Ich wollte die ungeheure Erschütterung durch das christliche Denken beschreiben, das in diametralem Gegensatz zu allem stand, was zuvor gesagt oder geschrieben worden war. Die Ankunft Christi auf Erden war ein spirituelles Wunder, aber auch eine philosophische Revolution. Eine physische Verwandlung – die Fleischwerdung Jesu – und eine Verwandlung des Wortes Gottes.
Ich stellte mir vor, wie fassungslos die Hebräer auf Seine Botschaft reagiert haben mussten. Das auserwählte Volk, das die Ankunft eines mächtigen, kriegerischen Messias auf einem flammenden Streitwagen erwartete und aus dessen Mitte plötzlich jemand hervortrat, der Mitleid und Nächstenliebe predigte und versicherte, dass jede Niederlage ein Sieg und alle Menschen auserwählt seien. Ich dachte auch an die Griechen und die Römer, die Götter nach ihrem Ebenbild erschaffen hatten, voller innerer Widersprüche, und die plötzlich erlebten, wie ein unsichtbarer Gott Menschengestalt annahm. Ein Gott, der die Menschen nicht vernichtete, sondern zu ihnen herabgestiegen war, um sie über alle Widersprüche zu erheben.
Diese bedeutsame Wende wollte ich beschreiben. Dieses gesegnete Zeitalter, in dem das Christentum eine langsam aus einem Klumpen Lehm herauswachsende Tonfigur auf einer Töpferscheibe, ein Kontinent in Bewegung war. Und die frühchristlichen Schriftsteller waren die treibende Kraft, das Spiegelbild und die Bürgen dieses Vorgangs. Nach den Evangelien und den Apostelbriefen traten säkulare Schriftsteller auf den Plan; sie sichteten, erläuterten und kommentierten das schier unendliche Material, das ihnen überlassen worden war.
Ich durchquerte den Innenhof des Instituts, als mir plötzlich jemand auf die Schulter klopfte. Ich drehte mich um. Luc Soubeyras stand vor mir. Käseweißes Gesicht unter einem rötlichen Haarschopf; hagere Figur in einem viel zu weiten Dufflecoat, um den Hals ein Schal. Verblüfft fragte ich:
»Was treibst du denn hier?«
Er warf einen Blick auf die Immatrikulationsunterlagen, die er in Händen hielt.
»Das Gleiche wie du, nehme ich an.«
»Du willst promovieren?«
Er rückte seine Brille zurecht, ohne zu antworten. Ich stutzte ungläubig:
»Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Seit wann haben wir uns nicht mehr gesehen? Seit dem Abitur?«
»Du warst zu deinen großbürgerlichen Wurzeln zurückgekehrt.«
»Unsinn. Ich habe immer wieder versucht, dich anzurufen. Was hast du gemacht?«
»Ich habe hier am Institut Catholique studiert.«
»Theologie?«
Er schlug die Hacken zusammen und stand stramm:
»Yes Sir! Und einen Magister in Altphilologie hab ich auch noch gemacht.«
»Wir haben also den gleichen Weg eingeschlagen.«
»Hast du das je bezweifelt?«
Ich antwortete nicht. Luc hatte sich in der letzten Zeit auf dem Kolleg in Saint-Michel verändert. Aus dem gläubigen Christen war ein Spötter geworden, der alles mit Ironie und Hohn überschüttete. Ich gab nicht mehr viel auf seine Berufung. Nachdem er mir eine Gauloise angeboten und sich ebenfalls eine angezündet hatte, fragte er:
»Worüber schreibst du?«
»Die frühen Kirchenväter. Tertullian, Cyprian…«
Er pfiff voller Bewunderung.
»Und du?«
»Weiß noch nicht. Vielleicht über den Teufel.«
»Den Teufel?«
»Ja, als die triumphierende Kraft des 20. Jahrhunderts.«
»Was erzählst du da?«
Wir schlängelten uns durch mehrere Studentengruppen und gingen zu den Gärten im hinteren Teil des Hofs.
»Seit einiger Zeit interessiere ich mich für die Kräfte des Bösen.«
»Kräfte des Bösen?«
»Weshalb, glaubst du, ist Jesus auf die Erde gekommen?«
Ich antwortete nicht, weil ich die Frage als zu plump empfand.
»Er ist gekommen, um uns zu retten«, fuhr er fort. »Um uns von der Sünde zu erlösen.«
»Und?«
»Das Böse war demnach schon da. Lange vor Jesus. Eigentlich schon immer. Das Böse ist Gott immer vorausgegangen.«
Ich tat diesen Gedanken mit einer Handbewegung ab. Ich hatte nicht vier Jahre Theologie studiert, um mich auf eine so unausgegorene Argumentation einzulassen. Ich entgegnete:
»Das ist doch nichts Neues! Das Buch Genesis beginnt mit der Schlange und…«
»Ich rede nicht von der Versuchung. Ich spreche von der Kraft in uns, die auf die Versuchung anspricht, die sie rechtfertigt.«
Die Rasenflächen waren übersät von welken Blättern. Kleine dunkelbraune oder ockerfarbene Punkte, herbstliche »Sommersprossen«. Ich schnitt ihm das Wort ab.
»Seit Augustinus wissen wir, dass das Böse keine ontologische Wirklichkeit besitzt.«
»In seinen Werken verwendet Augustinus das Wort ›Teufel‹ 2300-mal, ganz abgesehen von den Synonymen…«
»Als Figur, Symbol, Metapher… Man muss die Zeit sehen. Aber eines ist sicher: Nach Augustinus kann Gott niemals das Böse erschaffen haben. Das Böse ist für ihn lediglich ein Mangel an Gutem. Eine Schwäche. Der Mensch ist geschaffen, um das Licht der Erkenntnis zu empfangen. Er ›ist‹ das Licht, da er Wissen um Gott ist. Er muss lediglich angeleitet und hin und wieder zur Ordnung gerufen werden. ›Alle Lebewesen sind gut, denn ihrer aller Schöpfer ist vollkommen gut.‹«
Luc seufzte hörbar.
»Wenn Gott so groß und mächtig ist, wie lässt sich dann erklären, dass Er durch einen bloßen ›Mangel‹ in Schach gehalten wird? Wie ist es zu erklären, dass das Böse überall ist – und jedes Mal triumphiert? Gott zu rühmen heißt, die Erhabenheit des Bösen zu rühmen.«
»Du lästerst Gott.«
»Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Grausamkeit, der Gewalt und der Zerstörung. Niemand kann das leugnen. Wie erklärst du das?«
Der Blick hinter seiner Brille missfiel mir. Seine Augen glänzten fiebrig. Ich antwortete nicht, weil ich nicht auf jenes große Rätsel eingehen wollte, das so alt ist wie die Welt: Die Anfälligkeit des Menschen für Gewalt, das Böse und Verzweiflung.
»Ich werde es dir sagen«, fuhr er fort, während er eine Hand auf meine Schulter legte, »weil das Böse eine eigenständige Kraft ist. Eine Macht, die dem Guten mindestens ebenbürtig ist. In der Welt ringen zwei gegensätzliche Kräfte miteinander. Und dieser Kampf ist noch lange nicht entschieden.«
»Das ist ein glatter Rückfall in den Manichäismus.«
»Und was spricht dagegen? In allen monotheistischen Religionen verbirgt sich Dualismus. Die Geschichte der Welt ist die Geschichte eines Duells. Ohne Schiedsrichter.«
Das Laub raschelte unter unseren Schritten. Meine Freude über den Beginn des Semesters war so gut wie verflogen. Ich hätte gut auf dieses Wiedersehen verzichten können. Ich beschleunigte meinen Schritt Richtung Immatrikulationsbüro.
»Ich weiß nicht, was du in den letzten Jahren studiert hast, aber du bist dem Okkultismus verfallen.«
»Im Gegenteil«, sagte er, während er mich einholte, »ich habe eingehend über die modernen Wissenschaften nachgedacht! Überall ist das Böse am Werk. Als eine physische Kraft und als eine psychische Bewegung. Das Gesetz vom Gleichgewicht, so einfach ist das.«
»Du rennst offene Türen ein!«
»Allzu oft vergisst man diese Türen unter dem Vorwand der Komplexität und der Tiefe. Auf kosmischer Ebene beispielsweise hat die negative Kraft die Oberhand. Denk nur an die gewaltigen Explosionen von Sternen, die schließlich zu schwarzen Löchern werden, zu Abgründen des Nichts, die alles in sich einsaugen, was ihnen in den Weg kommt…«
Mir wurde klar, dass Luc bereits an seiner Dissertation schrieb. Er entwickelte irgendwelche aberwitzigen Thesen über die Schattenseite der Welt. Eine Art Anthologie des universellen Bösen.
»Nimm die Psychoanalyse«, sagte er, während er an seiner Zigarette zog. »Womit beschäftigt sie sich? Mit unseren finsteren Begierden, unseren verbotenen Wünschen, unserem Zerstörungsdrang. Oder der Kommunismus. Eine ursprünglich glänzende Idee. Und was wurde daraus? Der größte Völkermord des Jahrhunderts. Was immer man tut, was immer man denkt, man stößt auf jenen Teil in uns, der verdammt ist. Das 20. Jahrhundert zeigt dies besonders deutlich.«
»Du könntest jede menschliche Errungenschaft auf diese Weise deuten. Das ist viel zu einfach.«
Luc zündete sich eine neue Zigarette an seinem Stummel an:
»Aber das ist das allgemeine Muster. Die Weltgeschichte ist nichts als ein Kampf zwischen zwei Kräften. Aufgrund einer seltsamen Kurzsichtigkeit will uns das Christentum, das dem Bösen überhaupt erst einen Namen gegeben hat, weismachen, dass es sich um ein zweitrangiges Phänomen handelt. Aber man gewinnt nichts, wenn man seinen Feind unterschätzt!«
Ich war beim Büro angekommen. Ich ging die erste Stufe hinauf und fragte gereizt:
»Was willst du beweisen?«
»Trittst du nach deiner Promotion ins Priesterseminar ein?«
»Schon während der Promotion. Nächstes Jahr möchte ich nach Rom gehen.«
Ein krampfhaftes Lächeln verzog sein Gesicht.
»Ich sehe dich schon in einer halb leeren Kirche predigen, vor einer Handvoll alter Leute. Ein sicherer, bequemer Weg, den du da einschlägst. Du kommst mir vor wie ein Arzt, der eine Klinik sucht, in der nur Gesunde liegen.«
»Was willst du?«, schrie ich plötzlich. »Soll ich Missionar werden? Soll ich in den Tropen Animisten bekehren?«
»Das Böse«, erwiderte Luc ruhig, »ist das Einzige, was von Bedeutung ist. Gott zu dienen heißt, das Böse zu bekämpfen. Es gibt keinen anderen Weg.«
»Was wirst du tun?«
»Ich gehe an die Front, dem Teufel in die Augen schauen.«
»Du lässt das Priesterseminar sausen?«
Luc zerriss seine Immatrikulationsunterlagen: