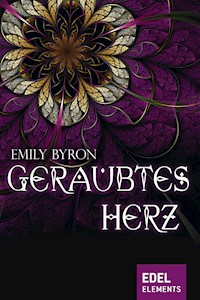Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als die introvertierte Jordis eines Abends in einer Bar den attraktiven Cayden kennenlernt, ahnt sie noch nichts von den lebensverändernden Folgen ihrer Begegnung. Die Verbindung zu dem mysteriösen Mann mit den silbernen Augen reißt nicht ab - immer wieder scheint das Schicksal sie zusammenzutreiben. Als Jordis endlich hinter sein Geheimnis kommt, ist es fast zu spät: Cayden ist Teil einer Macht, die so alt ist wie die Menschheit selbst ... und ebenso lebensgefährlich ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch:
Als die introvertierte Jordis eines Abends in einer Bar den attraktiven Cayden kennenlernt, ahnt sie noch nichts von den lebensverändernden Folgen ihrer Begegnung. Die Verbindung zu dem mysteriösen Mann mit den silbernen Augen reißt nicht ab - immer wieder scheint das Schicksal sie zusammenzutreiben. Als Jordis endlich hinter sein Geheimnis kommt, ist es fast zu spät: Cayden ist Teil einer Macht, die so alt ist wie die Menschheit selbst ... und ebenso lebensgefährlich ...
Emily Byron
Das Herz und die Dunkelheit
Der Fluch der Ewigen
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2016 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2016 by Emily Byron
facebook.com/EmilyByronthedarkworldofemilybyron.blogspot.de
Lektorat: Anika Beer Korrektorat: Julia Jochim Covergestaltung: Marie Graßhoff Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-831-5
facebook.com/edelelementswww.edelelements.de
„Hingabe ist das größte Geschenk, das man einander machen kann, sei es im Leben wie auch im Tod.“
1)
Was hatte ich mir eigentlich dabei gedacht?
Ich hatte ja noch akzeptiert, dass uns Nine diese schwarzen T-Shirts mit der riesigen Aufschrift „Tschüss Freiheit!“ und den pinken Handschellen darunter verpasst hatte. Ich hatte auch nicht gemeckert, als die Ladies wie verrückt gackernd in der vor Menschen wimmelnden Spitalerstraße hinter Irina hergelaufen waren, damit jene im Austausch gegen Küsschen Etiketten aus fremden Männerunterhosen schnitt. Mit den jeweiligen Männern noch in der Unterhose, wohlgemerkt, und das mitten in der Hamburger Innenstadt. Ja, ich hatte sogar eingewilligt, zum krönenden Abschluss dieser Unternehmung, am Ende unserer Route im beschaulichen Ortsteil Farmsen, in einer ziemlich verrauchten Spelunke einen Feigling nach dem anderen zu klopfen. Musste ich zwangsläufig, denn anders waren weder meine betrunkenen, johlenden Begleiterinnen, noch der stechende Uringeruch, der aus der Herrentoilette in den Schankraum wehte, zu ertragen. Alkohol war nicht meins. Egal, in welcher Form er daherkam, Rotwein, Wodka oder Sekt, ich fand einfach nichts daran, mich zu berauschen. Aber jetzt, da kam ich einfach nicht drum herum. Gott sei Dank hatte ich mir vorher beim Mexikaner mit Enchiladas de Queso eine gute Promillegrundlage aufgebaut. Zudem gelang es mir, manche Runde mit ein wenig Schummelei auszusetzen. Bei jedem Fläschchen aber, das mir Nine hinstellte, biss ich in den sauren Apfel, hielt die Luft an, setzte mir das lächerliche Käppchen auf die Nase und schüttete den Inhalt der kleinen Pullen meine Kehle hinunter. Leider hatte ich den kleinen Blechdeckel nicht gut genug befestigt, so dass er im Handumdrehen auf die Theke purzelte. Es ließ sich nicht bestreiten, dass ich inzwischen ein kleines Motorikproblem hatte. Das zeigte sich auch darin, dass ich immer häufiger an dem Wasser, das ich zusätzlich bestellt hatte, vorbeigriff, was Nine wiederum zum Kreischen komisch fand. Sie hatte vehement darauf bestanden, dass ihre Freundin Irina mich mitnahm, weil sie dachte, ich müsste unbedingt mehr unter Leute kommen, und wenn Nine sich so etwas in den Kopf gesetzt hatte, war jeder Protest zwecklos. So war sie, seit wir uns an einem heißen Sommertag im Lehrerzimmer des Johannis-Gymnasiums zum ersten Mal begegnet waren: Immer um mein Wohl besorgt. Ich war damals neu an der Schule gewesen und neu im Kollegium – da verstand es sich also fast von selbst, dass ich fünf Minuten vor Beginn meiner ersten Unterrichtsstunde den Inhalt meiner Kaffeetasse großzügig einmal quer auf meiner Bluse verteilte. Ich war kurz davor gewesen, mich einfach krankzumelden und auf der Stelle nach Hause zu fahren, als Nine auftauchte, die gerade aus der Turnhalle kam. Sie hatte die Situation sofort erfasst und sich ohne viel Federlesens vor versammelter Mannschaft ihres knappen Blüschens entledigt, um es mir zu borgen, ehe sie in ihrer Sporttasche nach einem T-Shirt kramte, das sie sich stattdessen überwerfen konnte. Auf meinen entgeisterten Protest hin hatte sie nur gelacht sie und erklärt: „Du kannst nicht im verschwitzten Shirt vor deine Klasse, Hase – ich schon!“ Und so war dieser Tag der Beginn einer dicken Freundschaft und zugleich der Beginn Nines unermüdlicher Mühen, mich von einer skeptischen Pessimistin zu einem lebhaften, fröhlichen Menschen umzuerziehen. Ihre Methoden waren dabei meist eher unkonventionell. Aber ob es nun darum ging, sich mit dem Alt-68er-Erdkundelehrer anzulegen, weil der mich meines Alters wegen nicht für voll nahm, oder darum, mich einfach mal aus meiner kuschligen Wohnzimmer-Komfortzone mitten ins Partyleben zu werfen, indem sie mich auf den Junggesellinnenabschied ihrer Fitnessstudio-Bekannten mitschleppte – sie wollte immer, dass es mir gutging. Und ich wäre wirklich gern dankbarer dafür gewesen. Aber an Abenden wie diesen war das geradezu unmöglich. Nine allerdings schreckte das nicht. Und mitkommen musste ich trotzdem.
Und so saß ich nun also hier, mit der sturzbetrunkenen zukünftigen Braut, ihrer noch sturzbetrunkeneren Trauzeugin und Nine höchstpersönlich und dachte, schlimmer könnte es nicht mehr kommen.
Weit gefehlt.
„Siehst du den Kerl da hinten?“, riss mich Nine aus meinen Gedanken.
Ich schaute zu dem Mann am Tresen in der hintersten Ecke der Bar.
Oh nein.
Nein, nein, nein.
Schnell drehte ich mich wieder weg und schaute direkt in Nines von Alkohol gerötetes Gesicht. Mir schwante, was jetzt kommen würde.
„Kommt nicht in Frage!“, zischte ich leise und ließ dabei keinen Zweifel daran, dass ich nicht gewillt war, bei diesem Partygag mitzumachen.
„Jetzt hab dich nicht so! Dir ist der Verschluss runtergefallen, also musst du eine Aufgabe lösen, die wir dir stellen.“
Die Regeln bei Trinkspielen waren mir zwar gänzlich unbekannt, aber ich war mir trotzdem sicher, dass das so ganz bestimmt nicht lief.
„Du weißt, dass ich das nicht kann!“
„Wenn du dich weigerst, musst du morgen im BH vor die Klasse!“, grölte Irina lautstark und hielt sich im letzten Moment an ihrer Trauzeugin Maria fest, um nicht vom Barhocker zu rutschen. Im Anschluss lagen sich die beiden prustend in den Armen. Ich beobachtete dieses bizarre Schauspiel mit gemischten Gefühlen. Nine hatte die beiden Damen vor über einem Jahr auf einem mehrtägigen Sportseminar kennengelernt und machte seither regelmäßig mit ihnen abwechselnd das Fitnessstudio und das Hamburger Nachtleben unsicher. Beide waren durchaus sympathische Frauen Mitte Zwanzig, die ein gesundes Selbstbewusstsein ausstrahlten. Allerdings trübte sich dieser positive Eindruck immer weiter ein, je weiter der Abend fortschritt. Denn wenn ich etwas noch weniger mochte als Alkohol, dann waren es alkoholisierte Frauen mit ihren schnapsgeschwängerten Ideen. Nine musste meinen Widerwillen förmlich riechen. Glucksend schaute sie von der johlenden Braut in spe zu mir und raunte mir lallend entgegen:
„Sei kein Frosch, Jordis, und gönn Irina den Spaß. Der Typ ist doch eh rotzbesoffen. Der gibt dir seine Nummer garantiert ohne Probleme.“
Am liebsten hätte ich Nine durch den Fleischwolf gedreht. Männer und ich, das war an sich schon ein heikles Thema. Und jetzt sollte ich auch noch irgendeinen wildfremden Kerl in einer heruntergekommenen Spelunke anbaggern, weil ich es nicht geschafft hatte, diesen blöden Metalldeckel auf der Nase zu behalten.
Ich konnte das nicht. Schon spürte ich, wie meine Handflächen klamm wurden.
Ich wollte das auch überhaupt nicht. Das war schließlich Irinas Junggesellinnenabschied, nicht meiner. Meiner Meinung nach war es an diesem Abend allein die Aufgabe der Braut, sich zum kompletten Fallobst zu machen.
Aber ein Blick in die dreckig grinsenden Gesichter meiner drei Begleiterinnen verriet mir, dass ich verloren hatte. Sie würden nicht eher Ruhe geben, bis ich tat, was sie von mir wollten. Wenn ich mich weigerte, da war ich mir sicher, konnte ich mir den Rest des Abends anhören, was für ein Spielverderber ich war. Und darauf hatte ich dann zugegebenermaßen noch viel weniger Lust.
„Los jetzt!“
Nine mochte zwar so blau sein wie Harald Juhnke zu seinen schlimmsten Zeiten, doch das diebische Funkeln in ihren Augen verriet, dass sie in diesem Moment genau wusste, was sie von mir verlangte. Ich kannte sie und konnte mich deshalb des Eindrucks nicht erwehren, dass sie mit dieser Aktion noch etwas anderes beabsichtigte, als einfach nur eine dumme Spielschuld einzufordern. Leise stieß ich eine Verwünschung in ihre Richtung aus.
„Das gibt Revanche, das schwör ich dir.“
Danach machte ich mich mit drei sturzbesoffenen, kichernden Weibern im Rücken daran, mich einem meiner größten Albträume zu stellen.
2)
Mein Herz raste wie ein Ferrari auf einem Autobahnabschnitt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Atmen fiel mir mit jeder Sekunde schwerer. Mit wackeligen Schritten bewegte ich mich auf das potenzielle Opfer meiner Saufrundenaufgabe zu. Insgeheim betete ich inständig dafür, dass er für eine normale Konversation zu benebelt war. Ich versuchte mich von dem tosenden Blutrauschen in meinen Ohren abzulenken, indem ich den Fremden genauer inspizierte. Er trug schwere Bikerboots, eine dunkle Hose und eine schwarze Lederjacke. Seine rechte Hand hielt ein Glas mit einer braunen Flüssigkeit so fest umklammert, als würde er vom Hocker stürzen, sobald er losließe. Der linke Arm war auf dem Tresen aufgestützt. Den Kopf hielt der Mann gesenkt, so dass sein Gesicht von den fast weißblonden Haaren völlig verdeckt wurde. Ich schaute genauer hin. Seine Haare waren so lang, dass sie ihm in dieser Haltung bis zu den angewinkelten Knien auf dem Barhocker reichten. Wäre sie nicht so strähnig gewesen, hätten meine Begleiterinnen und ich – da war ich mir sicher – umgehend einen Mord für diese Mähne begangen. Gewaschen musste sie einfach der Traum jeder Frau sein. So aber wirkte sie wie der gesamte Rest des Mannes nicht sehr gepflegt. Die Hose war mit Schlammspritzern übersät, und auch die Lederjacke hatte eindeutig schon bessere Tage gesehen. Ein leicht säuerlicher Geruch stieg mir in die Nase, je näher ich an den Unbekannten herantrat. Er hatte eindeutig seit Längerem nicht mehr geduscht. Deshalb ging ich dazu über, nur noch durch den Mund zu atmen.
Danke Mädels, schimpfte ich im Stillen.
Noch ein Schritt, dann stand ich direkt vor dem Fremden.
Und jetzt?
Hilflos drehte ich mich zu meinen Begleiterinnen um, die allesamt noch immer so breit grinsten, dass es einmal um den jeweiligen Kopf ging. Fragend gestikulierte ich ihnen, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Während Irina und Maria prustend auf der Theke zusammenklappten, bedeutete mir Nine unmissverständlich, dass ich mich nicht länger rumdrücken und einfach improvisieren sollte. Wie ich sie in diesem Moment verfluchte! Ich schwor mir, wenn sie das nächste Mal eine Ausrede für eins ihrer Horrordates suchte, brauchte sie mit meiner Hilfe garantiert nicht mehr zu rechnen.
„Hallo“, sagte ich unsicher zu dem Fremden und versuchte, mich betont locker mit dem Ellenbogen auf dem Tresen abzustützen. Mir schlotterten die Knie dermaßen, dass alles, was mich aufrecht hielt, willkommen war. „Bist du öfter hier?“
Der Unbekannte gab keinen Mucks von sich. Er schaute nicht mal zu mir auf. Entweder war er taub oder doch so stark betrunken, dass er nichts mehr um sich herum mitbekam.
„Ähm, hallo?“, sagte ich erneut und kam mir immer lächerlicher vor. Um so schnell wie möglich aus dieser Situation herauszukommen, beschloss ich, alle Anmachsprüche über Bord zu werfen und einfach die Wahrheit für sich sprechen zu lassen. „Entschuldigung, ich bin mit meinen Freundinnen hier, und es läuft so eine Art Wette, ob ich es schaffe, dass Sie mir Ihre Telefonnummer geben. Sie müssen mir nicht mal Ihre richtige Nummer geben, es reicht, wenn Sie mir ein paar Zahlen auf eine Serviette schreiben. Würden Sie das bitte für mich tun? Wenn ich ohne Nummer zurückkomme, hab ich den ganzen Abend das Geläster am Hals.“
Weiterhin keine Regung von meinem Gegenüber. Jetzt war ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht konnte ich bei den Mädels auf ein klein wenig Gnade hoffen, wenn ich ihnen erklärte, dass der Typ zu blau war, um noch irgendetwas auf die Reihe zu bekommen.
„Okay, ich verstehe. Danke jedenfalls und nichts für ungut“, sagte ich resigniert, nachdem weiter keine Antwort kam. Ich wandte mich bereits zum Gehen, als plötzlich eine dunkle Stimme hinter mir ertönte.
„Tolle Freundinnen, die solche Dinge von dir verlangen.“
Ich fror mitten in meiner Bewegung ein.
Diese Stimme war die schönste und wärmste, die ich jemals bei einem Mann gehört hatte. Ihr wunderbarer Klang vibrierte in meinem Magen und verursachte mir umgehend Gänsehaut. Nie hätte ich damit gerechnet, dass ein derart ungepflegter Mann einen so reinen Bass haben könnte.
Ich löste mich aus meiner Starre und drehte mich erneut zu dem Unbekannten um. Er hatte sich noch immer kein Stück bewegt.
„Wie meinen Sie bitte?“
„Ich sagte, dass das tolle Freundinnen sind, die zu ihrer eigenen Belustigung von dir verlangen, fremde Männer anzusprechen, obwohl dir das offensichtlich sehr unangenehm ist.“
Wieder schickte mir diese Stimme leichte Schauer über die Haut. Am liebsten hätte ich mich darin eingewickelt wie in eine weiche Decke. Wie wundervoll sie klang. Weniger schön war dagegen, was er gesagt hatte. Zu meiner Verblüffung hatte der Mann die Situation nämlich vollkommen richtig erfasst. Er war wohl doch nicht so betrunken, wie ich zunächst angenommen hatte.
„Naja, es ist ein Junggesellinnenabschied. Da macht man eben solche Sachen.“
Keine Ahnung, welcher Teufel mich in diesem Moment ritt, mich vor einem völlig Fremden zu rechtfertigen. Vielleicht wollte ich unterbewusst die Unterhaltung aufrechterhalten, um seine Stimme noch einmal zu hören.
„Soso. Macht man das also so? Was haben denn die anderen heute schon Peinliches gemacht, worüber du gelacht hast? Ich schätze nichts.“
Autsch.
Treffer versenkt.
Tatsächlich war bisher keiner meiner Begleiterinnen irgendeine ihrer Aktionen unangenehm gewesen. Nur ich hatte mich alle fünf Minuten stellvertretend in Grund und Boden geschämt.
„Das … das geht Sie nichts an“, konterte ich perplex und wunderte mich immer mehr, welchen Scharfsinn dieser Typ an den Tag legte.
Ein tiefes Lachen ertönte und verursachte ein Kribbeln in meiner Körpermitte. So eine klare Stimme und so eine abgewetzte Optik bekam ich gerade einfach nicht auf die Reihe.
Da plötzlich drehte der Fremde seinen Kopf und fixierte mich.
„Aha. Geht mich also nichts an. Aber für euer kindisches Spielchen war ich gerade gut genug.“
Ich weiß nicht, was mich in dieser Sekunde mehr aus den Schuhen fegte. War es dieses wie in Marmor gemeißelte, makellose Gesicht mit einer Haut wie Alabaster? Oder die hellblauen, fast silbrig schimmernden Augen, die wirkten, als sei der Unbekannte einem Märchen aus Schnee und Eis entsprungen, frostig kalt wie der Zorn, der in seinen Worten vibrierte?
Ich öffnete meinen Mund, nur um ihn wortlos wieder zu schließen. Wie gern wollte ich etwas erwidern, aber es hatte mir im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen.
„Schon gut“, sagte der Mann stattdessen, nahm einen großen Schluck aus seinem Glas und wandte sich wieder dem Barmann zu, der ihm ungefragt einen Whiskey nachschenkte.
„Es ist immer leichter, an der Oberfläche zu bleiben, als hinter die Fassade zu blicken. Da lebt es sich für Menschen wie euch sowieso viel sorgloser.“
Empörung ballte sich heiß in meinem Inneren zusammen.
Oberfläche?
Menschen wie uns?
Was bildete sich dieser Kerl eigentlich ein?
„Nur weil Sie hier herumhängen wie ein stinkender Trauerkloß und keine Lust auf einen harmlosen Spaß haben, brauchen Sie noch lange nicht beleidigend werden.“
Ich hörte, wie das Gackern hinter mir schlagartig verstummte.
Erschrocken fasste ich mir an den Mund. Super, Jordis, dachte ich, eine hervorragende Idee. Provozier einen Mann, der so groß ist wie ein Schrank und auch noch seine Hemmschwelle durch Alkohol gesenkt hat. Besser kann der Abend ja kaum werden.
In meinem Rücken spürte ich die entgeisterten Blicke von Nine, Irina und Maria, und ich verstand sehr gut, warum sie so aus allen Wolken fielen. Ich war schon immer eher der verschlossene Typ gewesen, und es war nicht leicht, mich hinter dem Ofen hervorzulocken. Aber wenn mich eines wütend machte, dann war es herablassende Arroganz. Da brannten bei mir zuverlässig die Sicherungen durch. Allerdings wünschte ich mir diesmal, ich hätte vielleicht doch besser meine Klappe gehalten.
Der Fremde griff nach seinem Glas, leerte es in einem Zug und drehte sich im Anschluss komplett zu mir um. Mein Herz machte einen Satz nach unten und verkroch sich auf Nimmerwiedersehen in meiner Unterhose. Obwohl ich in diesem Augenblick am liebsten das Weite gesucht hätte, blieb ich wie festgenagelt an meinem Platz stehen. Nach außen musste es wirken, als hätte ich keine Angst, mich der Konfrontation zu stellen. In Wirklichkeit aber war ich vor Panik einfach nur gelähmt. Der Mann musterte mich eingehend durch den Vorhang aus strähnigen Haaren vor seinem Gesicht. Mich beschlich das Gefühl, dass er abwog, ob es sich lohnte, sich noch weiter mit mir abzugeben. Seine hellen Augen besaßen trotz des Alkohols eine solche Klarheit, dass ich mich unweigerlich fragte, ob wirklich Whiskey in seinem Glas gewesen war.
„Du wirfst mir also vor, beleidigend zu sein, und bist dabei im gleichen Zug um keinen Deut besser?“
Mist, durchfuhr es mich siedend heiß, da hatte er sogar recht. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass er stank. Aber entschuldigen konnte und wollte ich mich jetzt auch nicht. Er hatte mich schließlich erst zu diesem Ausbruch getrieben. Aus Mangel an Alternativen nahm ich allen Mut zusammen und holte trotzig zum Gegenschlag aus.
„Wollen Sie etwa leugnen, dass Sie nicht gerade nach Rosen duften? Das ist eine Tatsache, die jeder hier bestätigen kann. Sie haben sich ein Urteil über mich als Mensch erlaubt, obwohl Sie mich überhaupt nicht kennen. Das ist ja wohl ein himmelweiter Unterschied.“
Als sein Blick den meinen traf, fuhr mir ein solcher Stich ins Herz, dass ich dachte, es würde in meiner Brust in zwei Hälften gespalten. So sehr mich dieser Kerl auch aufregte, so musste ich mit jeder weiteren Sekunde, die ich ihn anstarrte, unweigerlich feststellen, dass unter all dem Schmutz ein sehr attraktiver Mann steckte. Seine Augen funkelten wie tanzendes Sonnenlicht auf einem klaren Bergsee, der mich einlud, in ihn einzutauchen. Ich konnte das Wasser auf meiner Haut förmlich spüren, wie es mich lockend umschmeichelte. Im Geiste sah ich den Fremden und mich inmitten des Sees, wie sich unsere Körper, umgeben vom kühlen Nass, aneinander rieben, wie wir uns unter Wasser leidenschaftlich küssten, während seine Hand …
„Lerne erst einmal, Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Dann reden wir weiter.“
Der Schreck fuhr mir in alle Glieder, als ich mit rasendem Herzen aus meinem Wachtraum herausgerissen wurde. Ich musste mich einmal kurz schütteln, um wieder in der Realität anzukommen. Was zum Geier war da nur gerade passiert? Der Mann hatte sich inzwischen von seinem Platz erhoben und mit dem Gesicht so nah zu mir herabgebeugt, dass sich sein warmer Atem auf meiner Haut niederschlug. Er war so unglaublich groß, und sowohl das enge Shirt als auch die dunkle Jeans ließen keinen Zweifel daran, dass der Stoff einen bemerkenswert durchtrainierten Körper verhüllte. Er hätte mir Angst machen sollen. Stattdessen wurden mir die Knie weich, während der Nachklang seiner Worte noch wie ein Messer durch mein Ego schnitt.
„Ich… ich…“, stammelte ich und fluchte innerlich wie ein Rohrspatz, weil ich nur dämliches Gestottere zustande brachte. Auf der einen Seite wäre ich dem Fremden am liebsten mit dem nackten Hintern ins Gesicht gesprungen, weil er mich einfach so als oberflächliche Partypute abstempelte. Auf der anderen erzeugte gerade diese Vorstellung erneut eine derart erotische Fantasie hinter meiner Stirn, dass ich nur schwer an mich halten konnte, trotz der speckigen Aufmachung nicht sofort vor allen Anwesenden über den Fremden herzufallen. Himmelherrgott, was war denn nur los mit mir?
Ein herablassendes Lächeln blitzte im Gesicht des Fremden auf. Es wirkte fast, als wüsste er, was für Szenen sich gerade im meinem Gehirn abspielten. Ich merkte, wie mir sengende Hitze in die Wangen schoss. Nur eine Sekunde später zog sich der Mann von mir zurück, legte dem Barkeeper einen Schein mit der Bemerkung „stimmt so“ auf den Tresen und verließ, ohne mich noch eines weiteren Blickes zu würdigen, die Bar.
Immer noch völlig von der Rolle drehte ich mich mit offenem Mund zu meinen Begleiterinnen um. Auch ihnen stand die Fassungslosigkeit noch immer ins Gesicht geschrieben.
Nine war die Erste, die sich wieder fing.
„Was zur Hölle war das denn?“
Benommen setzte ich mich wieder auf meinen Platz und hielt kommentarlos die Hand in ihre Richtung auf, woraufhin sie mir ohne weiter zu fragen einen Schnaps reichte.
„Das weiß ich auch nicht“, antwortete ich wahrheitsgemäß und leerte diesmal ohne mit der Wimper zu zucken das Fläschchen in einem Zug.
Nein, ich wusste wirklich nicht, was da gerade passiert war.
Ich wusste auch nicht, welches Hormon mich da in wilder Rodeomanier geritten hatte, so dass ich mich vor Verlangen fast vergessen hätte – und das, obwohl die Konversation alles andere als erfreulich verlaufen war. Am Alkohol, da war ich mir trotz meines schwimmenden Kopfes sicher, lag es nicht. Aber was auch immer es gewesen war, mein immer noch vor Aufregung pochendes Herz ließ keinen Zweifel daran, dass ich diesen Mann unbedingt wiedersehen musste.
3)
Es war kein schöner Anblick gewesen, als Irina sich lautstark hatte übergeben müssen. Schon auf der Damentoilette war meine Begeisterung fürs Haarehalten überschaubar geblieben, und irgendwo war ich auch ein klein wenig sauer auf Nine, dass sie selber zu betrunken war, um ihrer Freundin zu helfen. Aber ich konnte auch nicht riskieren, dass die Hochzeit wegen dem Tod der Braut durch Ertrinken in einer Kloschüssel buchstäblich ins Wasser fiel. Also hatte ich Irina die Haare hoch- und gleichzeitig den Atem angehalten, während sie das Porzellan umarmte. Nur wenig später hatte der hilfsbereite Barkeeper einen Anruf getätigt, während ich die drei Schluckspechte auf einer kleinen Seitenbank platzierte und mühsam aufrecht hielt. Es war so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Nine sich mit diesem Kater für morgen in der Schule krankmelden würde müssen. Die Wahl der mit Käse überbackenen Enchiladas erwies sich nun als äußerst vorausschauende Entscheidung, denn ihr Fett bot dem Alkohol bei mir weitaus weniger Angriffsfläche als bei den anderen, die sich lediglich Nachos und natürlich Cocktails bestellt hatten. War ja gerade Happy Hour gewesen. Was als exzessive Partynacht angedacht gewesen war, war so bereits um Mitternacht gelaufen. Mir war das nur recht, denn so hatte ich neben der Aussicht auf eine ausreichende Mütze voll Schlaf auch noch etwas Gelegenheit, mir diesen seltsamen Abend in Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen.
„Taxi ist da!“, rief der Barkeeper und half mir, die torkelnden Damen nach draußen zu bugsieren, nachdem ich die komplette Zeche übernommen hatte.
„Die kotzen mir doch nicht etwa alles voll?“, beäugte der Fahrer uns misstrauisch, als wir die Schnapsdrosseln ins Wageninnere manövrierten.
„Keine Sorge“, lachte der Barkeeper, „die eine hat gerade alles von sich gegeben und die beiden anderen schlafen schon.“ Als wollte sie das Ganze unterstreichen, meldete sich Maria in diesem Moment mit einem lauten Schnarcher von der Rückbank, bevor sie sich umdrehte und an Irinas Hals kuschelte.
„Na dann“, antwortete der Taxifahrer, aber machte keinen sonderlich beruhigten Eindruck. „Und Sie, junge Dame, wollen Sie nicht mitfahren?“
„Nein danke“, sagte ich, reichte ihm meinen letzten Zwanziger und einen Zettel mit Nines Adresse. „Bitte liefern sie die drei Schnapsdrosseln dort ab.“
Kurz überlegte ich, doch mitzufahren, verwarf die Idee dann aber wieder. Egal wie betrunken Nine war, alles war ich nicht gewillt für sie zu organisieren. Wer dermaßen bechern konnte, der konnte auch selbst seine Wohnungstür aufschließen.
„Sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ist nicht gerade ratsam, als Frau allein um die Zeit zu Fuß zu gehen.“
„Ist schon in Ordnung. Ich habe es nicht weit von hier.“
„Wie Sie meinen“, antwortete der Fahrer schulterzuckend und schaltete die Automatik seines Wagens auf Drive.
„Auch auf die Gefahr hin zu nerven“, sagte der Barkeeper zu mir, nachdem das Taxi bereits abgefahren war, „aber wollen Sie wirklich laufen?“
„Ja, ich will noch etwas frische Luft schnappen, bevor ich schlafen gehe“, erwiderte ich. Natürlich war es immer ein Risiko, mitten in der Nacht alleine irgendwo herumzudackeln, aber hätte ich Nine erst nach Hause gebracht, wäre mein Heimweg locker eine halbe Stunde länger ausgefallen – und deutlich teurer, als ich es mit 20 Euro bezahlen konnte. Die Alternative wäre natürlich gewesen, ebenfalls bei Nine zu übernachten, aber darauf, mir ein Bett mit lauter Schnapsleichen teilen zu müssen, hatte ich reichlich wenig Lust. Schon gar nicht, wenn ich am nächsten Tag fit und motiviert vor meinen Schülern stehen und mit ihnen über die stoffwechselphysiologischen Auswirkungen von Opiaten und Amphetaminen sprechen sollte Außerdem kannte ich mich hier in der Gegend ganz gut aus und wusste, dass sie im Vergleich zu anderen Stadtteilen als vergleichsweise sicher galt. Meinem kleinen Drehwurm, den ich mir durch den Genuss noch einiger weiterer Schnäpse eingefangen hatte, würde die Bewegung an der frischen Luft sicherlich auch entgegenwirken. Lauter gute Gründe also, mich nicht zu einer Taxifahrt mit den drei Damen vom Tresen nötigen zu lassen.
„Wie Sie meinen. Ich muss wieder rein, bevor die mir da drin die ganze Bar leer trinken. Dann kommen Sie gut nach Hause und passen auf sich auf.“ Damit verschwand der Barkeeper wieder in der kleinen Kneipe.
„Mach ich. Danke und gute Nacht!“, rief ich noch hinterher. Dann atmete ich einmal tief durch und ließ die plötzlich eintretende Ruhe auf mich wirken. Endlich war dieser verrückte Abend vorüber, und ganz besonders diese oberpeinliche Situation mit dem merkwürdigen Fremden. Während ich mich langsam auf den Heimweg machte, ließ ich das Geschehene noch einmal im Geist Revue passieren. Es war mir nach wie vor unbegreiflich, wie mich nur ein Blick aus diesen kristallinen Augen so dermaßen hatte umwerfen können. Ich war noch nie der Typ Frau gewesen, der von einer heißen Beziehung zur nächsten flatterte, sich jedem attraktiven Mann an den Hals warf und einfach nicht allein sein konnte. Im Gegenteil: Ich konnte sehr gut auf eigenen Füßen stehen. Oder hatte es zumindest gekonnt. Bevor ich Dani traf … Ich seufzte unwillkürlich, als die Erinnerung sich wie ein fieses Kneifen in meinen Eingeweiden bemerkbar machte. Dani. Er hatte alles geändert. Durch ihn hatte ich endlich geglaubt zu verstehen, wie ein Mensch sich völlig in seine Emotionen fallen lassen konnte, und wie die Liebe zwischen zwei Menschen die eigenen Füße vollkommen überflüssig machte, weil man ohnehin die ganze Zeit schwebte. Und als er mich dann aus heiterem Himmel verlassen hatte, um sich nur noch auf seine wahre Liebe, die Musik, zu konzentrieren, war da kein Boden mehr gewesen, auf dem ich hätte stehen können. Ich schluckte mühsam. In solchen Momenten wurde mir stets bewusst, dass der Schmerz der Trennung mich noch immer verfolgte, auch wenn es schon fast zwei Jahre her war. Dabei hatte er das gar nicht verdient! In dem Moment, als Dani die Tür hinter sich ins Schloss hatte fallen lassen, hatte ich beschlossen, so schnell keinen Mann mehr in mein Leben zu lassen und mich vor allem niemals mehr selbst zu vergessen. Folgerichtig hatte ich kurz darauf meinen Kleiderschrank und das Badezimmer einer radikalen Ausmistaktion unterzogen. In der Zeit mit Dani hatte ich mich figurbetont gekleidet, täglich Make-up benutzt und schon mal Schuhe mit höheren Absätzen getragen – weil es ihm gefiel, weil er es sexy fand, und weil es mir völlig normal erschien, mich für ihn schön zu machen. Dabei wäre ich lieber in Pulli und Turnschuhen durch die Gegend gestiefelt, anstatt mir trippelnd Blasen zu laufen. Und wofür? Für nichts. Schlimmer als nichts: für die tiefste Demütigung. Damit mir das nie wieder passierte, hatte ich unnötigen Schminkkram ebenso verschenkt wie alles, was auch nur annähernd sexy aussah. Ich brauchte keinen Kajal, keinen Minirock und keine Kontaktlinsen. Für mich taten es auch ein simpler Pferdeschwanz, eine alte Jeans, ein gemütliches Shirt und eine Brille mit schwarzem Rand, die meinen braunen Maulwurfsaugen genug Sehschärfe verlieh. Das waren die Dinge, mit denen ich mich wohlfühlte. Da konnte Nine noch so oft schimpfen, dass kein Mann der Welt auf graue Mäuse stand. Umso besser. Ich wollte ja gar keinen Mann mehr, für eine lange Zeit, Ende offen.
Deshalb war ich auch ziemlich sauer auf Nine, denn sie kannte meine Vorgeschichte ganz genau. Während sie mich anfangs noch mein Mauerblümchendasein unkommentiert ausleben ließ, versuchte sie mit der Zeit immer häufiger, mich gegen meinen Willen an den Mann zu bringen. Das hatte ich Gott sei Dank jedes Mal unterbinden können, was Nine aber nicht entmutigte. Es war mir schon klar, dass sie es auf ihre Art – wie immer – nur gut mit mir meinte. Nach dem diebischen Funkeln zu urteilen, das ich in ihren Augen gesehen hatte, hatte sie sich wohl erhofft, dass durch die Aufgabe neben der Truppenbelustigung ein netter One-Night-Stand für mich heraussprang.
Genau.
Als ob ich für so etwas zu haben gewesen wäre. Und dann noch mit einem stinkenden Säufer. Nines Engagement in allen Ehren, aber das ging definitiv zu weit. Ich ärgerte mich im Nachhinein immer mehr, dass ich nicht den Mumm gehabt hatte, bei der Aktion schlicht und ergreifend Nein zu sagen. Es widerstrebte mir zwar, ihm recht zu geben, aber letztendlich war es genau, wie der Fremde gesagt hatte: Echte Freunde ließen einen nicht so eiskalt auflaufen. Gut gemeint oder nicht. Bei dem Gedanken sah ich den Unbekannten plötzlich wieder vor mir, wie er sich zu mir umgedreht und mich so durchdringend angeschaut hatte, als würde er binnen Sekunden bis auf den Grund meiner Seele blicken. Ein Flattern meldete sich in meinem Bauch, und das Gedankenkino, das sein fesselnder Blick in mir hervorgerufen hatte, begann sich erneut vor mir abzuspielen …
Energisch schüttelte ich den Kopf. Nein. Schluss damit. Das war doch völlig hirnrissig.
Ich blieb stehen, schaute nach oben und hoffte, die Sterne zu sehen. Ihr Anblick hatte mich schon immer beruhigt. Und auch heute besänftigten sie meinen rasenden Herzschlag sofort. Sie funkelten wie Millionen kleiner Glühwürmchen, die mich auf meinem Heimweg begleiteten. Ich mochte diese wunderbaren Spätsommer, und ganz besonders mochte ich sie in meiner Lieblingsstadt Hamburg. Meine Heimat im nördlichen Bezirk Wandsbek lag zwar außerhalb vom Hauptgeschehen dessen, was der restlichen Welt von der Elbmetropole bekannt war, aber genau das gefiel mir. Der Trubel der Großstadt blieb hinter mir, wann immer ich in die U-Bahn nach Norden stieg und an meiner Haltestelle Farmsen-Berne ankam. Tief atmete ich den vom Sommerwind herangetragenen Duft des Berner Gutparks ein, der sich ums Eck befand. Das Aroma von frisch geschnittenem Gras umarmte das intensive Apfelbukett der prachtvollen Kletterrosen, die einer der Anwohner auf seinem kleinen Balkon gepflanzt hatte. Ich schloss kurz die Augen und ließ das betörende Zusammenspiel der verschiedenen Aromen und Gerüche auf mich wirken. Wie schön es hier doch war. Wegen dieser leisen Glückmomente liebte ich mein Stadtviertel.
Im nächsten Moment spürte ich, wie eine Hand meine linke Schulter packte. Ich riss die Augen auf und stieß vor Schreck einen lauten Schrei aus. Ein Adrenalinstoß durchflutete meinen Körper wie eine Explosion und ließ mich instinktiv herumwirbeln. Mit voller Wucht donnerte ich dem Angreifer meine Handtasche ins Gesicht. Ein lautes Knacken erklang, als sie hart auf die Nase des Unbekannten aufschlug.
„Scheiße!“, rief dieser aus, taumelte einige Schritte rückwärts und fasste sich mit einer Hand in sein Gesicht, das durch eine große Kapuze verdeckt wurde. Mein Puls pochte so stark in meinem Körper, als würde er gleich in abertausend Teile zerspringen. Ich dachte nichts mehr. Wie ferngesteuert drehte ich mich um und hastete los – weg, nur weg! Doch in meiner Panik übersah ich den Bordstein, mein rechter Fuß erwischte nur den Rand und ich flog der Länge nach auf den harten Teer. Die Haut an meinen Handflächen gab unter dem beißenden Druck der rauen Oberfläche nach und riss spürbar großflächig auf. Ein Brennen schoss mir durch sämtliche Nervenbahnen, gefolgt von einer dumpfen Schmerzwelle. Meine Brille hatte sich im freien Fall irgendwohin verabschiedet. Hinter mir stieß mein Angreifer mehrere laute Flüche in einer fremden Sprache aus. Durch das Tosen des Blutes in meinen Ohren hörte ich seine Schritte näherkommen. Mist! Ich hatte ihn nicht ausgeschaltet, und an eine Flucht war nach dem Sturz nicht mehr zu denken. Mir blieb nur ein Ausweg. Ich wälzte mich trotz meiner Schmerzen auf den Rücken. Ich konnte zwar nicht abhauen, aber mit etwas Glück konnte ein kräftiger Tritt seine Glocken ordentlich zum Klingeln bringen.
„Hau ab, lass mich in Ruhe!“, schleuderte ich ihm entgegen – und bereute es sofort, als mein Kopf von meinem eigenen Schrei wie das Innere einer geschlagenen Kirchturmglocke zu vibrieren begann. Ich hätte doch mit Nine mitfahren sollen, dachte ich verzweifelt und trat zu, so fest ich konnte. Wenn schon untergehen, dann mit voller Gegenwehr.
Doch mein Fuß traf – Luft. Denn in diesem Moment stürzte sich wie aus dem Nichts ein riesiger Schatten auf den Angreifer und riss ihn von mir weg. Völlig perplex hörte ich mehr als dass ich sah, wie erst ein Fausthieb und dann noch einer in einem dumpfen Aufprall mündeten, gefolgt von einem gurgelnden Röcheln.
„Verschwinde!“, hörte ich eine tiefe Stimme brüllen und nahm immer noch reichlich benebelt wahr, wie eine der beiden Gestalten gekrümmt das Weite suchte. Ich rollte mich auf die Seite, und versuchte aufzustehen. Mein Kopf wummerte, als sei gerade eine Marschkapelle hindurchgestampft. Ich musste langsam machen, damit mir nicht übel wurde.
„Warten Sie, ich helfe Ihnen“, sagte die Stimme, die gerade so laut gerufen hatte, auf einmal direkt vor mir.
„Danke“, antwortete ich leise und ließ mir bereitwillig von meinem Retter auf die Beine helfen. Sie zitterten so sehr, dass ich fürchtete, sie würden jeden Augenblick wieder unter mir nachgeben.
„Meine Brille“, sagte ich und schaute auf die großen Hände, die mich an meinen Oberarmen festhielten. Ohne Sehhilfe konnte ich sie nur verschwommen wahrnehmen.
„Können Sie allein stehen?“
„Ich versuch‘s“, ächzte ich, woraufhin mein Retter mich losließ und sich bückte.
„Hier“, sagte er, „nicht erschrecken.“ Behutsam setzte er mir meine Brille wieder auf und stützte mich erneut, als ich kurz strauchelte. „Sie ist zum Glück nicht zerbrochen.“
Mein Blick begann sich wieder scharf zu stellen, sodass ich mein Gegenüber endlich näher betrachten konnte – nur um einen Moment später erneut fast in die Knie zu gehen. Diesmal vor Überraschung.
Eisblaue, fast silbrige Augen leuchteten zwischen langen, verfilzten Strähnen hervor und drangen mit ihrem Blick geradewegs durch mich hindurch.
„Sie sind das“, stammelte ich und wusste nicht, was mich mehr schockierte. Der Umstand, dass mein Held der ruppige Kerl aus der Bar war, oder das Blut, das sich aus einer Platzwunde unterhalb seines linken Auges großzügig auf der gesamten Wange verteilte.
„Was sagt man dazu?“, antwortete der Mann. Er wirkte nicht im Geringsten überrascht.
„Das … das muss genäht werden“, sagte ich und spürte, wie mir gleichzeitig heiß und kalt wurde. Das war eindeutig der Schock. Ganz bestimmt.
„Nein, muss es nicht. Das ist nur ein Kratzer“, antwortete der Unbekannte barsch und fuhr sich wie zur Betonung des Gesagten grob über die Wunde. „Sind Sie verletzt?“, fragte er, während er mich weiter festhielt.
„Geht schon“, murmelte ich und wollte mir die zahlreichen Strähnen aus dem Gesicht streichen, die sich beim Sturz aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatten und mir die Sicht verdeckten. Ein stechender Schmerz durchzuckte meine Handflächen. Erst jetzt fiel mir wieder ein, dass ich mich beim Aufkommen auf dem Asphalt mit ihnen abgefangen hatte und unterzog sie einer ersten Inspektion. Sie sahen aus wie ein blutiges Schlachtfeld. Kaum hatte ich mir das gedacht, begannen sie wie auf Kommando so zu brennen, als hätte ich glühende Kohlen angefasst.
„Au Mist, tut das weh“, fluchte ich.
„Sie müssen zur Polizei und vor allem ins Krankenhaus, nicht, dass Sie sich beim Sturz etwas gebrochen haben“, hörte ich meinen Retter sagen. Da hatte ich schlagartig wieder alle sieben Sinne zusammen. Krankenhäuser waren für mich so ziemlich das Schlimmste, was es gab. Seit dem Verlust meiner Eltern in meiner Kindheit waren sie für mich der Inbegriff allen Leides und Unheils auf dieser Welt. Obwohl ich wusste, welch wichtiger Dienst dort an kranken Menschen geleistet wurde, ging eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ich freiwillig eine Klinik betrat.
„Nicht nötig, es sieht heftiger aus, als es ist.“
Das war zwar gelogen, aber in dieser Sache war ich nun mal stur wie ein Ochse.
„Das hoffe ich für mich auch“, antwortete der Mann, während die Platzwunde unter seinem Auge munter weiterblutete. Erneut wischte er grob darüber, was den Blutfluss allerdings eher förderte, als dass es ihn stoppte, und ein kurzes Zischen seinerseits verriet mir, dass die Verletzung doch schmerzvoller war, als er zugab. Fast hätte ich gelacht. Woher kannte ich dieses Verhalten nur? Da standen wir also, beide verletzt und doch zu stur, die Notaufnahme aufzusuchen.
„Gut“, sagte ich und grinste ein wenig schräg, „so wie ich das sehe, haben wir beide mächtig eins auf den Deckel bekommen, aber keiner von uns will zum Arzt.“
Wortlos zuckte der Fremde die Schultern, während sein Blick die Umgebung sondierte. Rechnete er etwa mit einem erneuten Angriff? Bei dem Gedanken durchlief mich ein eiskalter Schauer. Ich wollte so schnell wie möglich weg von hier. Allerdings hatte ich keine Lust mehr, den Rest des Wegs allein zurückzulegen. Ein Taxi brauchte ich aber auch nicht mehr rufen, denn bis das hier angekommen war, war ich schon längst nach Hause gelaufen. Was also tun? Zähneknirschend musste ich mir eingestehen, dass es für dieses Dilemma nur eine Lösung gab.
„Ich wohne nicht mehr weit von hier und habe Verbandszeug und Desinfektionsmittel bei mir daheim. Damit können wir unsere Wunden behandeln“, sagte ich und fragte mich, wie bizarr der Abend noch werden konnte. Ich brauchte einerseits einen gewissen Schutz für den weiteren Nachhauseweg, wollte aber dem Fremden gegenüber nicht zugeben, wie viel Angst ich hatte, dass der Angreifer noch irgendwo auf mich lauerte.
„Aha“, sagte der Mann knapp und wischte sich erneut mit dem Handrücken das Blut von der Wange. „Und was ist mit der Polizei?“
So notwendig es tatsächlich war, den Überfall zur Anzeige zu bringen, so wenig war mir im Moment danach, das Geschehene erneut zu durchleben.
„Später. Ob jetzt oder in ein paar Stunden, es macht keinen Unterschied. Der Kerl ist weg.“ Zumindest hoffte ich das. Dann hatte ich einen Geistesblitz. „Sie sollten damit wirklich nicht rumlaufen. Was passiert, wenn Sie mit diesen Blutspuren im Gesicht aufgegriffen werden? Das wird eine Menge Fragen mit den Uniformierten nach sich ziehen.“
Erneut traf mich ein Blick aus Eis und Schnee. Doch anstelle einer Erwiderung begann es hinter den kühlen Augen zu arbeiten.
„Ist ein Argument. Gehen wir.“
Mit diesen Worten ließ der Fremde auch meinen anderen Arm los und deutete mir voranzugehen.
„Tut mir leid, das vorhin in der Bar“, sagte ich, nachdem wir einige Zeit schweigend die Straße entlanggelaufen waren. Auch wenn die Situation genau genommen nicht meine Schuld gewesen war, so fand ich doch, dass eine Entschuldigung das Mindeste war, was ich neben der Versorgung mit Pflastern und Jodlösung für meinen Retter tun konnte. Sicher, er hatte sich mir gegenüber auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dafür aber hatte er mich soeben vor dem Verlust meiner Wertsachen oder etwas noch Schlimmeren bewahrt, und das wog um ein Vielfaches schwerer.
„Schon gut“, antwortete er, ohne mich auch nur anzuschauen. Das gab mir Zeit, ihn aus den Augenwinkeln heraus genauer zu mustern. Er war wirklich riesig, ich schätzte fast zwei Meter. Kein Wunder, dass der Angreifer die Flucht ergriffen hatte. Gegen den hätte selbst Bigfoot wie Herr Nilsson gewirkt.
„Übrigens, mein Name ist Jordis.“
Sogleich wollte ich ihm die Hand entgegenstrecken, als ein fieses Brennen aus der Innenfläche durch meinen gesamten Arm schoss.
„Autsch“, winselte ich und wollte meine Hand wieder zurückziehen, als der Fremde stehen blieb und sie behutsam in die seine nahm.
„Mit Begrüßung per Handschlag wird es die nächste Zeit erstmal nichts werden“, erklärte er nüchtern.
„Nein, wohl eher nicht“, bestätigte ich seufzend. „Mal sehen, wie der Alltag mit zwei verbundenen Pfoten funktioniert.“
Vorsichtig, als wäre sie aus kostbarem Porzellan, hob der Unbekannte meine Hand an sein Gesicht und betrachtete die Innenseite für eine Weile. Dann griff er nach der anderen und studierte sie ebenfalls sehr eingehend. Eine stattliche Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen, als seine ungewöhnlich zarte Berührung ein leichtes Beben durch meinen Körper schickte. Zum Glück trug ich eine Strickjacke, so dass der Fremde die verräterische Antwort meines Körpers wenigstens nicht sehen konnte. Ich fragte mich derweil ernsthaft, ob ich noch ganz bei Trost war, bei einem schmutzigen, streng riechenden Kerl so eindeutig zu reagieren. Ja, er war ein Mann und hatte mir in einer Notsituation geholfen, aber deswegen brauchte ich noch lange nicht eine wie auch immer geartete Zuneigung für ihn zu entwickeln. Oder war das gerade eher eine psychologisch-logische Reaktion auf das Erlebte? Wenn doch nur diese hypnotischen Augen nicht wären …
„Keine Sorge, das sind nur oberflächliche Schürfwunden. In zwei Wochen wird davon nichts mehr zu sehen sein.“
„Hoffen wir’s“, antwortete ich geistesabwesend und wunderte mich, dass wir auf einmal so etwas wie ein normales Gespräch führten. Nun ja, zumindest in Ansätzen.
„Wird schon“, bekräftigte der Fremde, während wir die letzten Meter zu meiner Wohnung gingen.
„Da wären wir“, sagte ich und fasste vorsichtig nach meiner Tasche. Zwar schaffte ich es, den Reißverschluss mit nur zwei Fingern zu öffnen, doch als ich ungebremst in eine spitze Ecke meines Taschenkalenders griff, musste ich schmerzerfüllt aufgeben.
„Darf ich?“, fragte sogleich mein Retter und fischte nach einem bestätigenden Nicken meinerseits gekonnt den kleinen Bund mit meinen vier Schlüsseln heraus.
„Der große Runde“, sagte ich und verspürte umgehend eine Welle der Erleichterung, als wir das Treppenhaus betraten. Endlich in Sicherheit. Schweigend nahmen wir die Stufen bis in den fünften Stock. Vor meiner Tür wies ich den Fremden erneut an aufzusperren.
„Ich muss Sie allerdings warnen. Meine Wohnung ist sehr klein. Außerdem habe ich zwei Katzen.“
„Ich mag Katzen“, antwortete der Mann, während er den Schlüssel im Schloss herumdrehte. Wie zur Bestätigung ertönte in diesem Moment hinter der Tür ein wahres Maunzkonzert.
„Da freut sich aber jemand sehr.“
„Ich würde mich auch freuen, wenn der Dosenöffner endlich nach Hause kommt“, gab ich zu bedenken und wollte gerade die Tür aufschubsen, als der Mann mir seine Hand auf den Arm legte. Verwundert schaute ich zu ihm auf.
„Was ist?“
„Man sollte keine fremde Wohnung betreten, ohne sich richtig vorgestellt zu haben. Das gehört sich nicht.“
Bei soviel guten Manieren blieb mir tatsächlich die Spucke weg. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich nicht mal seinen Namen kannte. Wie gebannt starrte ich in das kühle Blau seiner Augen, das mich an den rauen Atlantik aus meiner frühen Kindheit in Island denken ließ. Ich erinnerte mich an die tosende Gischt und den salzigen Geruch des Meeres. Es war, als würde ich auf einmal wieder am Strand stehen und auf den endlosen Horizont blicken, während der Wind an meinen Haaren zog und die Möwen in der Luft tanzend ihre Lebensfreude herausschrien. In dem Moment, als ich begann, mich endgültig in dieser Erinnerung zu verlieren, nannte mir der Fremde einen Namen, der so außergewöhnlich war wie das, was gerade zwischen uns passierte.
„Mein Name ist Cayden.“
„Jor…dis“, stotterte ich benebelt. Ich fühlte mich, als sei ich gerade eben wie durch Magie in die Vergangenheit gereist. Noch immer konnte ich den Duft der unbändigen Freiheit wahrnehmen, den ich als Kind so sehr geliebt hatte.
„Ja, das sagtest du bereits“, riss mich Cayden aus meiner Trance und öffnete die Tür.
Nur zwei Sekunden später wurde ich erneut das Opfer eines Überfalls.
Diesmal aber waren die Angreifer klein, flauschig weich und hatten außer einem vollen Napf keine unlauteren Absichten.
4)
„Sagt mal, was ist denn nur los mit euch?“
Noch während ich mehr schlecht als recht mit meinen Fingerspitzen im Badezimmerschrank nach dem Erste-Hilfe-Set kramte, hörte ich es aus dem Gang ununterbrochen maunzen und schnurren. Das lautstarke Verhalten meiner felligen Mitbewohner war mehr als ungewöhnlich, und so rief ich in Richtung Flur: „Normalerweise suchen die beiden bei Fremden sofort das Weite. So redselig kenne ich sie gar nicht.“ Ich kniff bedacht eine Ecke des weißen Verbandsbeutels zwischen Daumen und Zeigefinger und zog ihn langsam zwischen Tamponbox und Wattebehälter hervor. „Hab ihn“, jubilierte ich und wartete darauf, dass Cayden das Bad betrat. Aber nichts tat sich. Verwundert lugte ich um den Türstock herum und ließ vor Überraschung glatt das kleine Täschchen fallen. Cayden stand mitten im Flur und hatte meinen schwarzen Kater Jen wie ein Baby im Arm, während der getigerte Berry sich an seiner Hose rieb, als sei sie mit Katzenminze weichgespült worden. Das Taschentuch, das ich dem blonden Riesen als provisorischen Druckverband für den Weg ausgehändigt hatte, lag vollgeblutet auf dem frisch geputzten Parkettboden.
„Gibt’s ja nicht“, sagte ich verblüfft mehr zu mir selbst als zu Cayden.
„Ich sagte doch, ich mag Katzen“ erwiderte er, während er weiter unablässig Jens Bauch kraulte, was dieser mit anhaltendem Schnurren quittierte.
„Ja, schon“, stammelte ich, „aber normalerweise lassen sie sich von keinem Fremden anfassen. Ich habe ewig gebraucht, bis sie mir so vertraut haben.“
„Was ist denn passiert?“
Ein erneuter Schnurrer von der Lautstärke eines verstopften Auspuffrohrs ertönte unter Caydens Fingern. Jen genoss seine Extraportion Schmuseeinheiten sichtlich, während sich Berry eine Etage tiefer nahezu um den Verstand rubbelte.
„Keine Ahnung“, antwortete ich und erinnerte mich daran, wie scheu die beiden bei unserem ersten Kennenlernen gewesen waren. „Man hat sie eines Herbstmorgens vor der Tierheimtür gefunden, eingepfercht in eine Transportbox. Sie waren in einem erbärmlichen Zustand und mussten mühsam wieder aufgepäppelt werden. Berry fehlte ein Stück vom Schwanz und die Wunde war schon so schlimm entzündet, dass man ihm seinen Launenanzeiger schließlich bis auf einen kleinen Stummel amputieren musste.“
Wie zur Bestätigung seines Schicksals ließ der Tiger in diesem Moment einen herzerweichenden Maunzer ertönen. Das Ergebnis war offenbar das gewünschte – Cayden ging in die Hocke und nahm auch den zweiten Kater mit auf den Arm. Ich konnte über die plötzliche Vertrauensseligkeit meiner Stubentiger gegenüber einem Fremden nur noch den Kopf schütteln.
„Der Tierarzt meinte, so gerade, wie die Wunde verlief, sei der Schwanz wohl absichtlich abgetrennt worden. Ich mag gar nicht daran denken, was der Kleine für Schmerzen durchlitten haben muss.“ Bei der Vorstellung schüttelte es mich vor Entsetzen.
„Menschen können grausam sein.“
Auch, wenn ich dem inhaltlich nicht viel hinzuzufügen hatte, bemerkte ich doch, wie sich der bisher so neutrale Klang von Caydens Stimme bei diesem Satz veränderte. Ich konnte es nicht richtig greifen, aber ich hatte das Gefühl, die Worte würden weniger dem kleinen Stummelschwanz als ihm selbst gelten. Auf einmal schwang in ihnen eine solch schwere Traurigkeit mit, dass ich meinte, unter ihrem Gewicht ersticken zu müssen. Leider konnte ich Caydens Mimik nicht erkennen, denn sein Gesicht verbarg er gekonnt hinter den langen, fast schon dreadlockartig verfilzten Strähnen.
„Wieso heißen sie Jen und Berry?“ fragte er abrupt, wie um vom Thema abzulenken. Inzwischen hatte das Stummelchen begonnen, ihm unablässig über den Handrücken zu schlecken.
„Es gibt da so eine Eismarke“, antwortete ich und ging in die Hocke, um den Verbandsbeutel aufzuklauben. „Die mag ich sehr gern. Hab einfach nur die Anfangsbuchstaben vertauscht.“
Caydens silberne Augen warfen mir einen Blick zu, als sei ich nicht mehr ganz bei Trost.
„Du nennst deine Katzen nach einer Eiscreme?“
„Warum nicht? Immer noch besser als Allerweltsnamen wie Maunzi, Schnurri oder Miezi.“
Kurz schien Cayden darüber nachzudenken.
„Stimmt“, bestätigte er knapp.
Besten Dank fürs Einverständnis. Als ob ich das von einem völlig Fremden brauchte.
„Können wir dann langsam mal hiermit anfangen?“ fragte ich leicht genervt und hielt mit schmerzverzerrtem Gesicht das Verbandszeug hoch. „Meine Hände brennen wie Feuer und du hast wieder zu bluten begonnen.“
Wie zur Untermalung fiel just in diesem Moment ein dicker Blutstropfen aus Caydens Wunde auf Jens Bauch. Das missfiel dem Kater hörbar. Er fauchte einmal laut und sprang wie ein geölter Blitz von seiner bisherigen Schmuseposition auf den Boden. Berry schaute seinem Kumpel zunächst irritiert hinterher, bis auch er einen Tropfen abbekam und angewidert das Weite suchte.
Im Bad versuchte ich derweil, das Verbandsmäppchen aufzubekommen, aber scheiterte kläglich, zu sehr stachen meine Handflächen.
„Lass mich das machen“, sagte Cayden und öffnete den Beutel. Fachmännisch durchforstete er den Inhalt und fischte schließlich ein Wundgel, Kompressen und einige Pflaster hervor. „Ich kümmere mich erst um mich, damit ich nicht alles vollblute. Danach schaue ich mir deine Hände an.“
Diese vorausschauende Planung überraschte mich etwas. Aber mehr als ein verwundertes „Okay“, brachte ich nicht hervor. Caydens Stimme hatte einen so bestimmenden, sicheren Ton, dass ich mich des Gefühls nicht erwehren konnte, er habe solche Maßnahmen womöglich schon öfter vornehmen müssen. Vielleicht war er ja ein Arzt oder zumindest jemand, der genau wusste, was im Fall solcher Wunden zu tun war. Erst jetzt wurde mir wirklich klar, wie unbekannt mir der Mann war, der sich hier mit mir in mein winziges Badezimmer quetschte. Dabei wusste ich es eigentlich besser, als meine Meinung über einen Menschen von seinem Äußeren abhängig zu machen. Nun ja, rechtfertigte ich mich vor mir selbst, aber wenn der Betreffende ein müffelnder Griesgram war, war es natürlich etwas schwerer als gewöhnlich, keine Vorurteile zu haben. Ich setzte mich auf den Badewannenrand und wartete, bis ich an der Reihe war. Während Cayden erst sein Gesicht sowie die Platzwunde mit Wasser säuberte und danach das Gel auftrug, nutzte ich die Gelegenheit, mich noch ein wenig über mich selbst zu wundern. Nach der Trennung von Dani hatte ich doch einen Bannkreis gegen alles Männliche drei Meter rings um meine Wohnung gezogen. Und doch saß ich nun hier auf engstem Raum mit einem Mann, mit dem ich mich Stunden zuvor noch aufs Heftigste angelegt hatte, nur um mich dann von ihm retten zu lassen. In der Kneipe war er mir wie ein arrogantes Arschloch vorgekommen. Aber Arschlöcher halfen keinen Frauen in Not ...
„Fertig“, riss mich Cayden aus meiner Grüblerei heraus, strich sich noch einmal das große Pflaster auf der Wange glatt und drehte sich zu mir um.
„Aber das könnte eine dicke Narbe geben, wenn nicht noch mehr“, gab ich zu bedenken. Platzwunden mussten meines Wissens umgehend genäht werden, und mich irritierte Caydens Verfahrensweise. Dieser aber wischte mit einer Handbewegung meine Bedenken vom Tisch. Gut, dann nicht, dachte ich. Er war schließlich erwachsen und wusste selber, was er tat. Nur meine Vermutung, dass er ein Arzt oder jemand mit medizinischem Fachwissen sein könnte, verwarf ich nun doch ganz schnell wieder.
„Das Pflaster reicht völlig aus. Jetzt lass du mal sehen.“
Mit diesen Worten kniete sich Cayden vor mir auf den Boden. Brav zeigte ich ihm meine Handflächen. Bis zu mir nach Hause hatte ich sie notdürftig mit Taschentüchern bedeckt gehalten, die ich sofort in die Badewanne befördert hatte, als ich nach dem Verbandstäschchen suchte. Die Heilung hatte bereits eingesetzt und das Blut hatte zusammen mit einigen Fetzen Zellulose eine erste, leichte Kruste gebildet. Dieser Umstand blieb auch Cayden nicht verborgen.
„Das müssen wir noch einmal aufmachen.“
„Was?“ Ich dachte, mich verhört zu haben, und schaute entsetzt von meinen Handflächen auf.
Unerwartet traf mich Caydens direkter Blick. Mein Herz machte einen solchen Satz, dass es mich fast vom Badewannenrand gefegt hätte. Sein Gesicht war mir so nah, dass ich meinte, seinen Atem auf meinen Wangen spüren zu können. Dann packte er wortlos meine Handgelenke mit einer seiner riesigen Pranken, öffnete den Wasserhahn über der Badewanne und zog meine Handflächen unter das laufende Nass.
„Autsch, spinnst du?“, fluchte ich und versuchte, mich aus dem festen Griff zu befreien, während das warme Wasser über meine Handinnenseite lief als sei es ein Strom aus unzähligen, feinen Nadeln.
„Halt still, das muss komplett gesäubert werden, sonst entzündet es sich und beginnt zu eitern.“
Caydens Tonfall war abermals sehr bestimmend, doch diesmal besaß er eine zusätzliche Schärfe, die mir sagte, dass er nicht zögern würde, sich notfalls mit noch gröberen Mitteln durchzusetzen. Also hielt ich widerwillig still, biss die Zähne zusammen und schaute an die Decke, während Cayden meine Hände hielt und mit den Fingern über meine beißenden Verletzungen schrubbte.
„Handtuch?“ fragte er kurz darauf knapp.
„Unterm Waschbecken“, knurrte ich und gab mir keine Mühe, mein Missfallen zu vertuschen. Allerdings hütete ich mich davor, wie ein Rohrspatz zu schimpfen, auch wenn ich nicht übel Lust dazu hatte. Erstaunlich vorsichtig tupfte Cayden im Anschluss meine Hände trocken, bestrich die Handflächen mit dem Gel, das er bereits für sich selbst verwendet hatte, und klebte danach zwei sterile Kompressen großflächig auf die fies brennenden Wunden. Misstrauisch beäugte ich meine neuen Accessoires.
„Nicht sehr schick“, brummte Cayden, „aber erfüllt seinen Zweck.“
Irritiert schaute ich auf. Sollte das gerade etwa witzig gewesen sein? Caydens Mimik war ernst wie eh und je. Nein, wohl eher nicht.
„Lass sie drauf, bis es durchnässt. Wird wahrscheinlich in ein paar Stunden soweit sein. Dann wechselst du sie.“
„Danke“, erwiderte ich in Ermangelung einer anderen Antwort.
Wortlos erhob sich Cayden und machte sich auf den Weg in Richtung Wohnungstür.
Überrascht sprang ich auf und lief ihm hinterher. „Wo willst du hin?“
„Weg“, war seine karge Antwort, als er die Türklinke herunterdrückte.
„Aber …“, sagte ich und wusste selbst nicht, was ich sagen sollte. Es war völlig verrückt. Aber irgendetwas in mir schrie förmlich, dass ich ihn jetzt nicht gehen lassen durfte. Ich hatte plötzlich das überwältigende Gefühl, dass sich hinter dem Schmutz der letzten Tage und Wochen etwas verbarg, das es verdient hatte, entdeckt zu werden. Das ich entdecken wollte. Mein Herz wummerte lautstark in meinen Ohren, während ich mich innerlich noch entgeistert fragte, was um alles in der Welt auf einmal in mich gefahren war.
In diesem Moment ertönte ein Doppelmiauen hinter uns. Cayden und ich schauten wie auf Kommando in Richtung Wohnzimmer. Jen und Berry lugten mit großen funkelnden Katzenaugen um die Ecke und setzten sich wie abgesprochen nebeneinander in Positur. Da hatte ich endlich eine Idee.
„Ich habe mich noch gar nicht richtig für deine Hilfe bedankt. Du hast doch sicher auch so einen Hunger wie ich? Wir könnten uns was kochen. Magst du Tortellini? Ich hab …“
Der Anflug eines Lächelns stahl sich ins Caydens Eiswasseraugen, als sein Blick von den unablässig miauenden Gesellen zu mir wanderte. Eine unsichtbare Faust boxte mir in den Magen, als ich erkannte, dass er mein Vorhaben durchschaut hatte.
„Pass auf dich auf“, sagte er, trat hinaus in den Gang und zog, ohne sich noch einmal umzudrehen, die Tür hinter sich zu.
Dann war er weg.
Vollkommen perplex blieb ich im Flur stehen, als hätte man mir soeben eine schallende Ohrfeige verpasst. Erneut erklang das Katzenkonzert in meinem Rücken, diesmal aber mit einem eher fragenden Unterton. Langsam drehte ich mich zu meinen pelzigen Mitbewohnern um.
„Was zur Hölle war denn das?“, fragte ich die beiden und fühlte mich auf einmal einfach nur leer. Jen legte seinen Kopf schief, während Berry an mir vorbeilief und zweimal halbherzig an der Tür kratzte. Dann schaute auch er mich fassungslos an.
‚Warum bloß hast du ihn so einfach gehen lassen?’, schien er mich mit seinen großen Augen zu fragen.
Und auch ich wunderte mich noch einmal, warum ich mir just in diesem Moment denselben Vorwurf machte.
5)
Nach einer unruhigen und sehr kurzen Nacht hatte ich am Freitagmorgen in der Schule angerufen und mich bei der Schulleiterin für den Tag krankgemeldet. Patricia war der fürsorgliche Muttertyp und hatte sofort gerochen, dass hinter der Krankmeldung mehr steckte als nur ein dummer Sturz und aufgeschlagene Hände. Auf ihre hartnäckige Nachfrage hin hatte ich sie schließlich ins Vertrauen gezogen, mit der Bitte, die Sache nicht im Kollegium breitzutreten. Patricia hatte mir daraufhin versprochen, die Angelegenheit für sich zu behalten, allerdings nur unter der Bedingung, dass ich sofort zur Polizei ging und Anzeige gegen Unbekannt erstattete. Die gute Seele hatte sogar gefragt, ob sie am Wochenende mal bei mir vorbeischauen sollte, falls ich irgendetwas brauchte. Ich fand ihre Anteilnahme rührend, lehnte aber dankend ab. Die nächsten drei Tage wollte ich erstmal zur Ruhe kommen und alles verdauen. Am Montag, so sagte ich, würde ich wieder einsatzbereit sein, wenn auch mit verletzungsbedingten Einschränkungen.
Wie von Cayden angekündigt, hatten sich die Verbände im Verlauf der letzten Stunden mit Wundwasser und Gel vollgesogen. Bevor ich mich auf den Weg zur Polizei machte, entschloss ich daher, sie abzunehmen und die Wunden nochmals zu begutachten. Das Ergebnis war erleichternd. Auch wenn meine Hände weiterhin schlimm aussahen, so war der Heilungsprozess bereits erkennbar fortgeschritten.
Vor dem Duschen zog ich mir als Notlösung zwei Plastiktütchen über die Hände und befestigte sie mit Gummibändern. Das war zwar eine anstrenge Aktion und tat auch ziemlich weh, aber ermöglichte mir, im Anschluss nicht wie eine Spelunke stinkend in frische Klamotten zu schlüpfen. Die Anbringung der neuen Verbände mit Leukoplast war ebenfalls eine langwierige Geschichte, doch gelang es mir mit zusammengebissenen Zähnen. Es musste einfach klappen, schließlich war niemand anderes da, der mir helfen konnte. Wenn Cayden doch nur hiergeblieben wäre …
Schnell schüttelte ich den Kopf und klebte den letzten Tapestreifen notdürftig auf meine rechte Hand. Wieso stahl sich dieser merkwürdige Typ immer wieder in meine Gedanken? Und weshalb machte mein Herz jedes Mal einen Satz, wenn ich an ihn dachte? Ich konnte meine eigene Reaktion nicht einordnen. Recht ungeschickt versorgte ich nach dem Duschen noch meine zwei Stubentiger mit ihrem täglichen Mahl und kleckerte den Inhalt der Päckchen hier und da neben die Schalen. Aber das war kein Problem, denn die beiden Staubsauger schleckten die verirrten Fleischstücke in Windeseile wieder auf.
Der Weg zur Wache mit den Öffentlichen gestaltete sich recht unangenehm, zu intensiv starrte meine Sitznachbarin im Bus auf meine eingepackten Hände.
„Verbrüht“, sagte ich peinlich berührt mehr aus der Not heraus, damit sie endlich aufhörte, mich anzuglotzen. Leider ging der Plan nicht auf, so dass ich eine Station früher ausstieg und den restlichen Weg zu Fuß zurücklegte. Auf der Wache nannte ich mein Anliegen und wurde nach wenigen Minuten von einer jungen, blonden Polizistin in einen separaten Raum geführt. Sie ließ mich in aller Ruhe das Geschehene berichten und tippte währenddessen protokollgerecht alles in ihren Computer. Cayden ließ ich bei der ganzen Geschichte unerwähnt. Was sollte ich auch sagen? Dass mir ein Fremder, von dem ich nichts wusste außer seinen Vornamen, zu Hilfe geeilt war, mich bis nach Hause begleitet und dort verarztet hatte, nur um danach im Handumdrehen zu verschwinden? Kurz überlegte ich, doch die ganze Wahrheit zu sagen, verwarf den Gedanken dann aber wieder. Es tat einfach nichts zur Sache und selbst, wenn ich Cayden als Zeugen aufgeführt hätte, hatte ich keinen Anhaltspunkt, wie er zwecks Aussage kontaktiert werden konnte. Ich betrachtete die junge Beamtin, wie sie konzentriert auf den Bildschirm starrte. Warum ich nicht sofort gekommen sei, wollte sie wissen. Der Schock, antwortete ich und beruhigte mich damit, dass das nicht mal gelogen war. Anschließend stellte die Polizistin mir Fragen darüber, ob ich das Gesicht des Angreifers gesehen oder sonst etwas Auffälliges bemerkt hätte, was ich jedoch verneinen musste. Mit Blick auf meine verbundenen Hände riet sie mir eindringlich, einen Arzt aufzusuchen, woraufhin ich einfach nickte, um mich nicht länger als nötig in der Wache aufhalten zu müssen. Ich war ja bereits fachmännisch versorgt worden, was ich aber ebenso für mich behielt. Die Beamtin war sichtlich unzufrieden mit meiner Reaktion, respektierte aber meine Entscheidung. Was sollte sie auch sonst tun? Sie half mir beim Unterschreiben des Protokolls, indem sie mir den Stift zwischen die Finger klemmte und gab mir abschließend noch einige Standardverhaltensratschläge für die Zukunft. An oberster Stelle stand ganz klar, nie wieder allein im Dunkeln nach Hause zu gehen. Ab sofort war abends Taxi Pflicht, das musste ich ihr regelrecht versprechen. Offenbar hatte das tollpatschige Setzen meiner Unterschrift mit zugeklebten Händen ihren harten Berufspanzer ein Stück weit aufgeweicht und doch noch einen kleinen Mitleidsschalter umgelegt. Ich versicherte ihr, dass nächtliche Kneipentouren für alle Zeit gestrichen seien. Dass ich eigentlich sowieso nie wegging, musste ich ihr ja nicht unbedingt auf die Nase binden.
Mit mehr Aufwand als sonst drehte ich daheim den Schlüssel im Schloss um und vernahm, wie die beiden Wohnungstiger bereits ungeduldig auf der anderen Seite maunzten.
„Ich hab’s gleich“, rief ich ihnen entgegen und öffnete die Tür. Wie geölte Blitze schossen Jen und Berry an mir vorbei auf den Flur, um an der obersten Treppenstufe wie gebannt nach unten zu stieren. Irritiert schaute ich den zwei Katern hinterher.
„Was habt ihr denn?“, rief ich und griff mit beiden Händen äußerst vorsichtig nach der Dose mit den Leckerlis, die auf der Kommode im Gang stand. Meine Hände brachten mich um, aber es half nichts. Durch diese Schmerzen musste ich die nächsten Tage einfach durch. Kurz schüttelte ich die Leckerchen klackernd in ihrem silbernen Behälter. Normalerweise war das ein Lockmittel mit unschlagbarer Erfolgsquote, aber dieses Mal dauerte es einige Sekunden, bis sich meine vierbeinigen Mitbewohner wieder auf den Weg zurück in die Wohnung machten. Ich gab jedem einen kleinen Snack und schloss die Tür hinter ihnen.