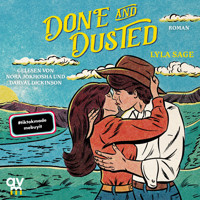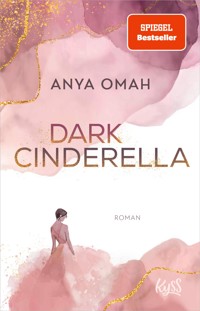Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris im Frühling 1925. Die junge Berlinerin Ann-Sophie von Schoeller ist gerade in die französische Hauptstadt gezogen, wo ihr Ehemann in der renommierten Anwaltskanzlei seines Onkels einer vielversprechenden Karriere entgegensieht. Ann-Sophie hingegen spaziert gelangweilt durch die Straßen. Eines Tages landet sie in der Rue de l'Odéon vor einer Buchhandlung namens Shakespeare and Company, vor der eine rauchende Frau in Männerkleidung steht: die Buchhändlerin und Verlegerin Sylvia Beach. Als Ann-Sophie den Laden betritt, ist sie augenblicklich fasziniert, auch von den Frauen, denen sie dort begegnet. Sie fängt als Aushilfe an, und wird bald Teil der »Company« aus Literatinnen, Künstlerinnen und Freigeistern. Bald erkennt sie, dass sie mehr will vom Leben und auch in der Liebe. Ann-Sophie muss sich entscheiden zwischen bürgerlicher Sicherheit und dem Wagnis eines selbstbestimmten Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Veronika Peters
Das Herz von Paris
Roman
Kampa
Für Carla Dorothea Peters
I
Someday beneath some hard
Capricious star –
Spreading its light a little
Over far,
We’ll know you for the woman
That you are.
Djuna Barnes: The Book of Repulsive Women
She had gone to Paris in order to read
and to be away from home.
N.R. Fitch: Sylvia Beach
1Eine zornige junge Frau
Der erste Anblick von Notre Dame entspricht wahrscheinlich nicht den Erwartungen, die der berühmte Name erweckt, warnte der Baedeker in dem Kapitel Cité und linkes Ufer.
Das, dachte Ann-Sophie von Schoeller an diesem milden Frühlingsnachmittag im April 1925, kann man getrost von ganz Paris behaupten. Wobei sie diesbezüglich nicht objektiv war, und das wusste sie auch. Vier Wochen zuvor war sie bereits übellaunig an der Gare du Nord aus dem train rapide gestiegen, und bislang hatte nichts an ihrem Gemütszustand etwas ändern können. Im Gegenteil. Ihr war unbegreiflich, was alle an dieser Stadt fanden. Die Leute saßen bereits am Vormittag trinkend und lärmend auf den überfüllten Caféhausterrassen herum, Hütchenspieler, Jongleure und sonstige Schausteller krakeelten in den Gassen und zogen gutgläubigen Passanten die Sous aus der Tasche, vagabundierende Musikanten schmetterten anzügliche Gassenhauer, Blumenmädchen versuchten jedem, der den Fehler beging, in ihre Nähe zu geraten, halbverwelkte Veilchenbouquets oder zerrupfte Trockenrosen aufzunötigen, das Röhren und Knattern der unzähligen Motordroschken, Automobile und Omnibusse war ohrenbetäubend, und das verdampfende Benzin stank viel ekelhafter als in Berlin. Vollkommen überschätzt, das Ganze!
Sie blieb auf dem Pont Saint-Michel stehen und wandte sich nach Osten, um die Fassade der Kathedrale zu betrachten, auf die man von hier aus eine gute Sicht hatte.
Der Gesamteindruck, den das ehrwürdige Gebäude nach dem Besuch hinterlässt, ist allerdings als wahrhaft majestätisch zu bezeichnen, fuhr der Text im Reiseführer fort.
Vielleicht wäre es tatsächlich interessant, sich diesen Dom mit den eigenartig abgeschnittenen Türmen von innen anzuschauen, dachte sie, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Sie wollte gar nicht, dass dieser Spaziergang durch die Stadt, die ihr Ehemann mit provozierender Hartnäckigkeit »unsere neue Heimat« nannte, einen Eindruck hinterließ, schon mal gar keinen majestätischen.
Ann-Sophie beugte sich über das Brückengeländer, überlegte einen Augenblick, ob sie das kleine Buch mit dem roten Ledereinband einfach fallen lassen sollte. Sie sah es schon auf dem Wasser aufschlagen, hörte es platschen, sah, wie es unterging, auseinanderdriftende Kreise auf der Wasseroberfläche hinterließ und zum schlammigen Grund der Seine trudelte, wo es noch vor Sonnenuntergang von Flusskrebsen aufgefressen sein würde. Dann fiel ihr ein, dass sie mit ihren dreiundzwanzig Jahren für derart überspannte Phantastereien zu alt war und dass ein trotzig in der Seine versenktes Reisehandbuch rein gar nichts an ihrer Situation änderte. Außer vielleicht, dass sie nicht zurück zur Wohnung fände, und das würde alles noch schlimmer machen. Was für eine grauenhafte Vorstellung, orientierungslos durch die verwinkelten Gassen von Paris zu irren, womöglich noch jemanden nach dem Weg fragen zu müssen. Zwar beherrschte sie die französische Sprache fließend, sie hatte sechs lange Jahre in einem Mädchenpensionat am Genfer See verbracht, wollte aber nicht in ein Gespräch verwickelt werden. Womöglich würde man sie nach ihrer Herkunft fragen, danach, wer sie war, warum allein unterwegs … Ich wünsche keine neuen Bekanntschaften, dachte sie. Nicht hier, nicht in dieser Stadt. Hier bin ich eine Fremde und will es auch bleiben.
Sie legte den Baedeker auf dem Steinsims des Brückengeländers ab, klappte den Kartenteil auf, fand die Stelle, an der sie gerade stand. Mit dem Finger auf dem Papier zog sie eine schnurgerade Linie den Boulevard Saint-Michel entlang, direkt bis zur Ecke Rue Cujas, wo sie und Johann im zweiten Stock über einer Brasserie wohnten. »Nur, bis ich etwas Besseres für uns gefunden habe«, hatte er beim Einzug in diese spartanische Behausung gesagt, die ihnen sein neuer Arbeitgeber und Mentor zur Verfügung gestellt hatte. Keine zehn Minuten Fußweg wären das von hier aus, schätzte sie, laut Karte außerdem kinderleicht zu finden. Weil sie aber, sowenig sie bislang von ihrem Stadtspaziergang angetan war, noch weniger Lust hatte, schon jetzt den Rückweg anzutreten, blätterte sie erneut im Reiseführer, auf der Suche nach allem und nichts.
Der Boulevard St-Michel kreuzt etwa 300 m südlich der Seine den Boulevard St-Germain. Links blickt man in den Vorgarten der römischen Thermen, rechts erstreckt sich die École de Médicine.
Unwillkürlich musste sie an ihren Vater denken, der womöglich in diesem Augenblick im großen Lehrsaal der Charité einer armen Seele das Skalpell ins kranke Fleisch drückte, während ihm eine Gruppe Studenten von den Rängen aus ehrfürchtig dabei zusah. Ann-Sophie schüttelte sich, als ob sie ein lästiges Insekt loswerden wollte. Was nützte ihr die Erinnerung an Papa? Als es darauf angekommen war, hatte er ihr nicht geholfen.
»Exposition internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes! Die Welt zu Gast in unserer Hauptstadt!«
Ein Zeitungsjunge, sie schätzte ihn kaum älter als vierzehn Jahre, fuchtelte mit der neuesten Ausgabe von Le Temps vor ihrer Nase herum. Sie war vor Schreck einen Schritt zurückgewichen, schaute dann demonstrativ in eine andere Richtung. Von all den Passanten, die an diesem Nachmittag die Brücke überquerten, musste er ausgerechnet sie belästigen?
»Neueste Nachrichten für Sie, Mademoiselle?«
»Geh weg, ich kaufe nichts!«, fuhr sie den Jungen an, gröber, als sie eigentlich beabsichtigt hatte. Sie wollte noch etwas Versöhnliches hinzufügen, aber da war er bereits fluchend weitergeeilt.
Achselzuckend wandte sie sich wieder der Karte und ihrer Wegplanung zu. Sie beschloss, mit der Medizinischen Fakultät als Orientierungspunkt noch einen Bogen durch die Gegend östlich des Boulevard Saint-Michel zu schlagen. In diesem Teil des Quartier Latin würde es vermutlich genauso unerfreulich sein, wie überall, wo sie bereits entlanggegangen war, aber so durchquerte sie immerhin ein paar unbekannte Straßen, ohne sich allzu weit von der Rue Cujas zu entfernen. Sie versuchte, sich die entsprechenden Straßen, Plätze und Kreuzungen ihrer geplanten Route einzuprägen, musste sich widerwillig eingestehen, dass ihr das Büchlein mit seinen Karten und Beschreibungen gute Dienste leistete. Tatsächlich hatte es sogar den Ausschlag dafür gegeben, endlich einmal das Haus für mehr als den Gang zum nächstgelegenen Lebensmittelgeschäft zu verlassen und mit diesem Tag etwas anderes anzufangen, als missmutig die Zeit totzuschlagen und dem unermüdlichen Akkordeonspieler im Bistro gegenüber die Pest an den Hals zu wünschen. Ihrem Mann würde sie das nicht erzählen, denn es hieße, ihm einen Triumph zu gönnen, den er ihrer Ansicht nach nicht verdiente.
Der Baedeker war ein Geschenk von ihm gewesen. Vor etwas über vier Monaten hatte Johann ihr damit eröffnet, dass sie ihr geliebtes Berliner Leben aufgeben musste. Ihr Entsetzen, all ihre tausend Einwände waren vollkommen sinnlos gewesen. Nach endlosen Diskussionen hatte sie sich schließlich weichklopfen lassen.
»Du wirst Paris lieben, ich verspreche es dir!«, hatte er gesagt.
Sie hatte letztendlich nur noch zu allem genickt. Am nächsten Morgen war sie dann mit dieser Übellaunigkeit aufgewacht, die seitdem ihre ständige Begleiterin war.
Vom Fluss her stieg ein moderiger Geruch nach fischiger Verwesung zu ihr hoch, irgendwo hinter ihr stank es nach den Hinterlassenschaften eines der wenigen Pferdefuhrwerke, die dieser Tage noch unterwegs waren. Der süße Duft der Stadt der Liebe? Von wegen! Ann-Sophie rümpfte die Nase, steckte den Reiseführer in ihren Beutel und setzte ihren Weg fort. Jenseits der Brücke überquerte sie die Place Saint-Michel in Richtung Süden. Über die Rue Danton erreichte sie den Boulevard Saint-Germain, verzichtete darauf, in einem der unzähligen Straßenlokale, die den Boulevard säumten, eine Pause einzulegen, obwohl ihr die Füße bereits schmerzten. Die Mauer entlang der Medizinischen Fakultät ließ sie links liegen, bog an der nächsten größeren Kreuzung nach links ab und erreichte einen Platz, von dem mehrere kleine Straßen abgingen. Sie verlangsamte ihre Schritte, um zu entscheiden, welche sie am besten zum Jardin du Luxembourg einschlagen sollte, da stieß plötzlich jemand von hinten unsanft gegen ihren Ellenbogen. Ohne sich in irgendeiner Weise für seine Ruppigkeit zu entschuldigen, eilte ein junger Mann in Knickerbockern und Schirmmütze an ihr vorbei auf eine Horde junger Leute in einem Straßencafé zu. Der Neuankömmling wurde johlend begrüßt: »Na endlich, André! Kommst du also auch noch aus der Anatomie gekrochen!«
Medizinstudenten, dachte Ann-Sophie. Mit dem flegelhaften Rempler drängten sich sechs weitere junge Männer um einen Bistrotisch, auf dem völlig ungeniert ein Mädchen mit lackschwarzen kurzen Haaren in einem leichten sonnengelben Baumwollkleid saß, ein Glas mit einer giftgrünen Flüssigkeit in Händen, und die bis über das Knie nackten Beine baumeln ließ. Die ganze Erscheinung hatte etwas von einer lässig leuchtenden Überheblichkeit, die Ann-Sophie irritierte. Sie selbst kam sich in ihrem langen Rock unter dem schlichten Damenmantel auf einmal altbacken und démodé vor, auch der einfache Knoten, mit dem sie ihr Haar im Nacken zusammengesteckt hatte, sowie der schmucklose braune Hut, den sie trug, waren alles andere als Dernier Cri. Neben dem Mädchen lag eine aufgeklappte ledernde Umhängetasche, aus der ein wüstes Durcheinander von Papieren und Schreibheften ragte. Ann-Sophie fragte sich, ob die junge Frau ebenfalls Studentin war, und wenn ja, was ihr Vater wohl dazu sagen würde und wie er über ein derartiges Auftreten in der Öffentlichkeit befinden würde. Wahrscheinlich schaute Ann-Sophie eine Sekunde zu lang auf die Gruppe ausgelassener junger Menschen, denn einer der Studenten, ein schlaksiger Kerl mit rotblondem Haarschopf, wurde jetzt auf sie aufmerksam.
»Bonjour Mademoiselle!«
Er starrte sie unverhohlen an.
»Suchen Sie Anschluss? Kommen Sie her, trinken Sie ein Glas mit uns!«
»Nein, danke!«
Ann-Sophie beschleunigte ihre Schritte.
Der Rotblonde sprang ihr mit einem affigen Hüpfer direkt in den Weg. »Mademoiselle, um Himmels willen! Die Sonne scheint, haben Sie Erbarmen, schenken Sie uns ein Lächeln!«
Seine schrille Stimme plärrte über den ganzen Platz, er maßte sich sogar die Frechheit an, sie am Arm zu fassen.
»Hände weg! Sofort!«
Zu spät bemerkte Ann-Sophie, dass sie ihn in ihrer Aufregung auf Deutsch angeschrien hatte. Sämtliche Besucher des Straßencafés schauten zu ihr her, einige begannen zu kichern, andere schüttelten den Kopf, niemand machte Anstalten, ihr zu Hilfe zu kommen.
»Mon Dieu! C’est la guerre, une boche!« Der Rothaarige schlug die Hacken zusammen und salutierte mit durchgedrücktem Rücken.
Ein anderer Student grölte in holprigem Deutsch: »Gib uns das Ehre, werte Fräulein!«
Im nächsten Moment war Ann-Sophie umstellt. Mit dem Rotschopf rückten vier weitere Männer aus der Studentengruppe immer dichter an sie heran, feixten, grinsten, forderten sie auf, zu ihnen an den Tisch zu kommen, nicht mehr böse zu sein, mit ihnen auf den Weltfrieden zu trinken, die Erbfeindschaft zu vergessen. Das Mädchen in dem gelben Kleid hingegen blieb auf der Tischplatte sitzen und beobachtete die Szene.
»Lassen Sie mich in Ruhe, oder ich rufe die Polizei!«
Ann-Sophies Stimme überschlug sich.
Die Männer beeindruckte das kaum.
»Oh, là, là, sie wird uns doch nicht etwa inhaftieren lassen, das böse deutsche Fräulein?«
»Sie sehen uns erzittern, Mademoiselle!«
»Jetzt seien Sie doch mal nicht so garstig!«
Ann-Sophie glaubte zu ersticken.
Schließlich mischte sich das Mädchen ein, sagte mit aufreizend kühler Gleichgültigkeit in der Stimme: »Jungs, spart euch die Mühe! Sie sieht nicht danach aus, als stünde ihr der Sinn nach euren Spielchen.«
Die jungen Männer schienen Respekt vor der jungen Frau zu haben, schauten jedenfalls zu ihr hin, als warteten sie auf weitere Anweisungen.
Ann-Sophie nutzte den Moment, indem sie sich unter Einsatz ihrer beiden Ellenbogen den Weg frei kämpfte. Kopflos flüchtete sie über den Platz in eine der Gassen. Hinter ihr hörte sie es rufen: »Kommen Sie zurück, Fräulein, wir sind harmlos!« Lautes Gelächter, Pfiffe. Zum Glück folgten sie ihr nicht.
Ann-Sophie hastete weiter die Gasse entlang, blickte einige Male hinter sich und wäre beinahe gegen einen hölzernen Kasten geprallt, der vor einem Geschäft aufgestellt war. Sie blieb stehen, kam etwas zu Atem, dann fluchte sie laut: »Wie ich absolut alles an dieser verdammten, stinkenden und verkommenen Drecksstadt hasse!«
Da lachte jemand. Ganz in ihrer Nähe.
Ann-Sophie sah zunächst nur eine Hand mit Zigarette, umwölkt von bläulichweißem Rauch im Eingang des kleinen holzvertäfelten Ladens, vor dem sie stand.
SHAKESPEAREANDCOMPANY
Bookshop, Lending Library
Hinter den Schaufensterscheiben wurden Bücher präsentiert, Bücher in englischer Sprache, wie sie bei näherem Hinsehen feststellte.
Aus der Rauchwolke trat eine kleine, schlanke Frau mit dichtem, im Nacken gerade abgeschnittenem Haar, das sich, streng aus der Stirn gekämmt, in brünetten Wellen um ihren Hinterkopf legte. Sie trug ein ockerfarbenes Tweedjackett, darunter ein Herrenhemd mit dunkler Krawatte, und der Anblick ihres Gesichts war das Erste in Paris, das Ann-Sophie nicht zuwider war. Es waren nicht nur die hellwachen Augen und die warme, kluge Heiterkeit, die aus ihnen leuchtete, es war noch irgendetwas anderes, das sie in diesem Augenblick nicht benennen konnte, ihr aber, zu ihrer eigenen Überraschung, gefiel.
»Also wirklich, Mademoiselle! Ich habe zwar nicht genau verstanden was, aber doch wie Sie gerade etwas gesagt haben. Als brave Bürgerin möchte ich meine Zweifel an der Damenhaftigkeit Ihrer Wortwahl anmelden.«
Die Frau schaute Ann-Sophie an, als gefiele auch ihr, was sie sah. Ihr Akzent war amerikanisch. Cynthia, eine ehemalige Mitschülerin im Pensionat, Tochter eines Diplomaten aus New York, hatte ähnlich geklungen, wenn sie abends auf dem Zimmer heimlich Rimbaud vorgelesen hatte.
»Excusez-moi Madame!«, sagte Ann-Sophie. »Ich habe Sie gar nicht bemerkt.«
Noch einmal lachte die Frau auf diese glockenhelle, entwaffnende Art.
»Sie sind Deutsche.«
Keine Frage, eine Feststellung. Es schien sie nicht im Geringsten zu stören.
Ann-Sophie nickte.
»Und zornig«, fügte die Frau hinzu. Sie lächelte noch immer derart einnehmend, dass Ann-Sophie nicht anders konnte, als das Lächeln zu erwidern. »Ja. Vielleicht …«
»Sehr gut. Ich bin Sylvia. Kommen Sie herein, drinnen sind noch mehr zornige Frauen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Tee trinken und das richtige Buch für Sie finden!«
2Das Herz von Paris
Ihre Augen mussten sich nach der hellen Frühlingssonne draußen zunächst an das trübe Licht im Innenraum gewöhnen. Was für eine zugeräucherte, chaotische Bücherhöhle, schoss es ihr durch den Kopf. Gleichzeitig war diese Höhle auf eine fast beunruhigende Art einladend, zog sie förmlich hinein. Der Vorsatz, auf keinen Fall neue Kontakte zu knüpfen, war jedenfalls wie weggeblasen. Sie vergaß ihn einfach. Unter grob gewebten schwarz-weißen Teppichen, die die Schritte weich abfederten, knarzten die Dielen, die Wände waren größtenteils mit überfüllten Regalen verstellt. Antik anmutende Möbelstücke verteilten sich im Raum, ein blauer Polstersessel, kleine Tische und Hocker, ebenfalls vollgepackt mit Bücher- und Zeitschriftenstapeln. Weiter hinten befand sich ein Kamin, über dem dicht an dicht gerahmte Fotografien an einem mit Sackleinen bespannten Stück Wand hingen, daneben war ein Durchgang zu einem weiteren Raum, aus dem Stimmen und das Klappern von Geschirr drangen.
Ann-Sophie trat näher an den Kamin heran, um die Fotografien zu betrachten. Es waren ausnahmslos Porträts: ernste Gesichter, scharf geschnittene Profile, Denkerposen, gewichtige Blicke in Frontalaufnahme, kein einziges Lächeln. Quer über das Profil einer Frau, deren fast schon überirdisch schönes Gesicht zur Hälfte von einem breitkrempigen Hut verdeckt wurde, stand mit dickem blauem Stift geschrieben:
I kiss your deepest deep cheek, Syl!
Auf dem Sims waren weitere Bilderrahmen mit Porträtaufnahmen aufgereiht, jeweils mehrere hintereinander, wie in einer Warteschlange, als müssten sie sich den ihnen gebührenden Platz an der Wand erst noch verdienen. Dazwischen stand eine kleine Porzellanbüste, deren bunte Glasur speckig glänzte.
»William Shakespeare«, murmelte Ann-Sophie.
»Der höchstselbige«, sagte Sylvia. »Und das hier«, sie wies mit ausholender Geste auf die Fotografien, »ist Mr Shakespeares Pariser Kompanie, die sich meinen bescheidenen kleinen Laden als Feldlager auserkoren hat. Damen und Herren des Wortes, des Geistes, teilweise auch des Irrsinns.«
Sylvia lachte, als sie Ann-Sophies Irritation bemerkte. »Keine Sorge, meine Liebe, in unserem Zirkuszelt hier werden sie alle zahm. Auch die Verrückten.«
Ann-Sophie hatte nicht die geringste Idee, was sie auf diese Aussage erwidern sollte.
»Deine Dompteusenphantasien kannst du absolut vergessen, Syl!«
Die Person, zu der die Stimme gehörte, lehnte lässig im Durchgang zum Hinterzimmer, und zweifellos war sie die Frau, deren Porträt Ann-Sophie gerade bewundert hatte. Ich küsse deine tiefste tiefe Wange. Das klang bezaubernd und verstörend zugleich. Und genau so hätte sie auch den Eindruck beschreiben können, den die leibhaftige Erscheinung jetzt auf sie machte. Sie war mindestens einen Kopf größer als Ann-Sophie und trug einen seidig schimmernden Smoking mit gestärktem weißem Hemd, wie er für Herren zum Besuch der Oper oder bei ähnlich förmlichen Anlässen üblich war. Ihre schmalen, langgliedrigen Hände steckten in weißen Glacéhandschuhen, um den Hals hatte sie ein smaragdgrünes Seidentuch drapiert, die blauen Augen waren dezent geschminkt, der Mund glühte in tiefdunklem Rot.
»Darf ich vorstellen«, sagte Sylvia. »Miss Djuna Barnes, begnadete Dichterin und Romancière sowie geniale Zeichnerin und unbestechliche Journalistin. Darüber hinaus zelebriert sie ihren ureigenen Wahnsinn hier selbstverständlich frei und unzähmbar. Richtig, Djuna?«
Djuna lächelte. »So ist’s brav!«
Ann-Sophie wurde sich bewusst, dass sie die Frau anstarrte, verfiel daraufhin in einen Knicks, für dessen Albernheit sie sich augenblicklich schämte.
»Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Miss Barnes!«
»Du kannst dir die Förmlichkeiten sparen, so etwas brauchen wir hier nicht. Ich bin Djuna. Wie war noch dein Name?«
Ann-Sophie nannte ihren vollständigen Namen.
»Du lieber Himmel! Wir werden dich schlicht Ann nennen, das passt sowieso besser, du siehst nicht halb so deutsch aus, wie dein Name klingt«, sagte Djuna.
Ann-Sophie war einen kurzen Moment irritiert, aber es gefiel ihr: Än.
»Natürlich«, erwiderte sie, bemühte sich dabei möglichst ungezwungen zu klingen, was ihr, wie sie selbst merkte, misslang. Sie biss sich auf die Lippen, spürte ihr Gesicht erröten.
Sylvia hakte sich bei ihr unter, als wären sie bereits Freundinnen. »Wusstest du eigentlich, dass jeder Mensch mit sieben Namen zur Welt kommt?«
Djuna trat mit einer theatralischen Verbeugung zur Seite, Ann-Sophie ließ sich an ihr vorbei ins Hinterzimmer führen. In dem ebenfalls weitgehend mit Regalen zugestellten Raum stand zwischen einem Kachelofen und einer winzigen Kochstelle ein mit Teegeschirr und Büchern gedeckter Holztisch, um den zwei weitere Frauen saßen. Die eine war, bis auf die Tatsache, dass sie eine Krawatte statt eines Halstuchs trug, exakt so gekleidet wie Djuna. Die Handschuhe hatte sie allerdings abgestreift und zusammengeknüllt vor sich auf dem Tisch abgelegt. Ann-Sophie schätzte ihr Alter, wie das von Djuna, auf Anfang bis Mitte dreißig. Im Vergleich zu Djunas vornehmer Eleganz wirkte an dieser Frau alles herb und kantig. Zwischen ihren schmalen, leicht zusammengekniffenen Lippen klemmte eine Zigarre, und ihre dunklen Augen musterten Ann-Sophie, als gälte es, eine komplizierte Diagnose zu stellen, die in jedem Fall verheerend ausfallen würde. Sie würde sich erst recht von niemandem als »zahm« bezeichnen lassen, dachte Ann-Sophie und strich sich reflexhaft eine Haarsträhne hinters Ohr. Die andere Frau am Tisch war das komplette Gegenteil. Den fülligen Leib in ein weites Leinenhemd gehüllt, trug sie über dem Hemd eine hellbraune Weste aus grobem, mönchisch anmutendem Stoff, dazu einen bodenlangen Rock aus dickem grauem Filz. Ihr rundes Gesicht erinnerte an einen hübschen, gut gelaunten Bär, als sie Ann-Sophie begrüßte: »Bonjour Mademoiselle!«
»Madame«, entfuhr es Ann-Sophie. »Ich bin verheiratet.«
Hinter sich hörte sie Djuna schrill auflachen. »Die bedauernswerte Kleine hat sich in ihrem zarten Alter schon in den Hafen der Ehe steuern lassen. Bravo, Madame!« Sie klatschte dreimal in die Hände. »Einen ähnlichen Fehler, zum Glück nicht ganz so amtlich, wie es deiner zu sein scheint, habe ich mit achtzehn ebenfalls gemacht. Oh my God, die jungen Mädchen lernen es anscheinend nie!«
»Ich bin dreiundzwanzig«, entgegnete Ann-Sophie. »Und ich denke nicht, dass die Ehe ein Fehler ist.«
Die Zigarrenraucherin stimmte in Djunas spöttisches Gelächter ein.
Ann-Sophie merkte, was für einen lächerlichen Auftritt sie in den Augen der anderen gerade hingelegt haben musste, und sie versuchte, sich zu rehabilitieren, indem sie einfach mitlachte. Sie war selbst davon überrascht, wie sehr sie sich wünschte, dass diese Frauen sie mochten.
»Immerhin scheint sie Humor zu haben«, sagte Djuna und legte Ann-Sophie die Hand auf die Schulter. »Wir werden es noch ein bisschen weiter herauskitzeln, wollen wir?«
Sylvia kam Ann-Sophie zu Hilfe: »Lasst Gnade walten! Diese junge Dame ist offenkundig neu in Paris und scheint noch etwas überfordert zu sein. Das kennen wir doch selbst nur zu gut.«
»Musst du wieder ein Mädchen retten, Beach?«, fragte die Zigarrenraucherin.
»Dass sie kein Mädchen mehr ist, haben wir ja gerade erfahren.«
»Setzen Sie sich zu uns!« Die Frau im Filzrock klopfte auf den freien Stuhl neben sich. »Ich bin Adrienne Monnier. Mir gehört die Buchhandlung schräg gegenüber, die Maison des amis des livres. Kennen Sie mein Geschäft?«
»Nein, tut mir leid.«
»Nicht schlimm, das lässt sich ändern. Die Maison ist so etwas wie Shakespeares and Companys Zwillingsschwester. Bei Sylvia hält die angelsächsische, bei mir die französische Literatur Hof. Lesen Sie in einer der beiden Sprachen?«
»In beiden. Einigermaßen«, sagte Ann-Sophie. »Ich bin auf eine französischsprachige Schule gegangen und hatte außerdem ein belesenes englisches Kindermädchen.«
»Bestens gerüstet also! Willkommen in Odéonia, der freien Republik der Bücherliebenden, dem wahren Herzen von Paris!«, sagte Adrienne. »Hier wird Literatur nicht nur verkauft, sondern auch verliehen, verlegerisch begleitet sowie in eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Zeitschriften gefeiert. Habe ich etwas vergessen?«
»Ich glaube nicht«, sagte Sylvia.
»Und ob!«, sagte Djuna. »Ihr habt eure wahren Kernbereiche noch gar nicht genannt: Postamt, Kummerabladestation, Rettungsinsel für exilierte Literaten sowie Aufwärmstube für Schriftstellerinnen, die es sich im Winter nicht leisten können, einen Ofen zu beheizen.«
»Fest steht: Wer hier nicht zur Literatur findet, dem ist im Leben nicht mehr zu helfen!«, sagte Adrienne.
Djuna nickte feierlich. »Amen!«
»Und jetzt gib mir deinen Mantel, nimm den Hut ab und setz dich endlich«, sagte Sylvia.
»Ich bin Janet«, sagte die kantige Anzugträgerin, als Ann-Sophie zwischen ihr und Adrienne Platz genommen hatte. Sie tippte sich mit zwei Fingern an die Stirn und schien dies als Vorstellung für ausreichend zu halten.
»Janet ist ebenfalls Amerikanerin, wie Djuna und ich«, sagte Sylvia. »Und wie Djuna verfügt auch sie über eine brillante Feder. Von ihren Reportagen wird die Welt noch in hundert Jahren sprechen.«
Janet winkte ab. »Übertreib nicht, Sylvia. Djuna ist das Genie, ich arbeite mir einfach nur die Finger wund.«
»He!« Djuna schnappte sich einen freien Stuhl, drehte die Lehne zu sich und schwang sich rittlings auf die Sitzfläche. »Als ob ich mich nicht genauso zu Tode arbeiten muss für die paar Kröten, die man mir für meine Texte zahlt!«
Sylvia holte eine Porzellantasse aus dem Schränkchen über dem kleinen Kochherd, stellte sie vor Ann-Sophie hin und nahm ebenfalls am Tisch Platz. »Janet hat jüngst eine Stelle als Korrespondentin für eine neu gegründete amerikanische Zeitschrift angeboten bekommen. Ab September wird sie für den New Yorker eine ständige Kolumne übernehmen, ›Letters from Paris‹. Ist das zu fassen? Wir werden uns in Acht nehmen müssen, denn die fabelhafte Miss Flanner wird künftig jeden Unfug, den wir von uns geben, auf Kolumnentauglichkeit prüfen und skrupellos verwenden.«
»Ich will einen Drink für jedes gestohlene Zitat!«, rief Djuna.
»Träum weiter!«, sagte Janet.
»Bei mir kriegt ihr nur Tee«, sagte Sylvia.
»Wetten nicht?« Djuna schnipste in Janets Richtung. Janet griff in die Innenseite ihres Jacketts, zog eine flache silberne Flasche hervor, schraubte sie auf und reichte sie Djuna, die gierig daraus trank, bis Janet sie ihr wieder abnahm.
»Auch einen Schluck?«
Bevor Ann-Sophie antworten konnte, goss Janet ihr bereits etwas von der goldbraunen Flüssigkeit in die Tasse. »Du machst mir den Eindruck, als könntest du es brauchen.«
»Ist das Brandy?«
Janet hielt den Flachmann hoch. »Da, wo ich herkomme, ist es Medizin.«
»Da, wo wir herkommen, gibt es für unsereins nichts als den ekelhaftesten Prohibitionsfusel«, sagte Djuna. »Ich will mehr! Vive la France! Hier sind die Drinks gut, legal und billig!«
Sylvia schüttelte den Kopf. »Kinder, es ist noch nicht mal fünf Uhr.«
Djuna zog eine Grimasse. »Spielverderberin!«
Adrienne bat Janet per Handzeichen, die Flasche wieder in ihrem Jackett verschwinden zu lassen. Janet gehorchte, was Ann-Sophie jetzt doch überraschte.
»Wir waren, bevor Sylvia nach draußen gegangen ist, gerade dabei, uns über Möglichkeiten zu beraten, für Shakespeares’ Geld zu beschaffen«, sagte Adrienne. »Das sollten wir noch einmal aufgreifen.«
Sylvia blies die Backen auf und ließ mit einem betrübten Seufzer die Luft entweichen. »Ich bin es so leid, über Finanzen zu sprechen.«
»Es nützt nichts, davor wegzulaufen!«
»Ja, ja, ich hab’s verstanden.«
Sylvia schaute Ann-Sophie an, als wollte sie sich bei ihr für das unschöne Thema entschuldigen.
»Unsere frischgebackene Korrespondentin hier«, sagte Djuna, »könnte zur Abwechslung mal eine amerikanische Millionenerbin bezirzen, die wir dann um stattliche Beträge erleichtern.«
»Wirklich sehr lustig!«
Sylvia rollte entnervt mit den Augen. »Der Alkohol tut dir nicht gut, Liebes.«
»Ich bin nüchtern, jedenfalls so gut wie!«, sagte Djuna.
»Ihr weicht schon wieder vom Thema ab«, sagte Adrienne.
»Ich schlage vor, dass ihr endlich wieder eine literarische Soiree veranstaltet, mit Eintrittsgeld und Spendenbüchse«, sagte Janet. »Djuna könnte aus ihrem aktuellen Manuskript lesen. Es ist großartig!«
»In hundert Jahren kann ich vielleicht einmal drei Wörter daraus vorlesen, allenfalls Einsilber und auch nur dann, wenn jemand mir einen Mandarin sprechenden Papagei auf die Schulter setzt!«
Janet griff sich scheinbar wahllos ein Buch aus einem der Stapel auf dem Tisch, hielt es in die Höhe wie ein Signalschild und sagte: »Dann eben Colette!«
»Was ist mit Colette?«, fragten Adrienne und Sylvia gleichzeitig.
»Engagiert sie!«, sagte Janet.
Djuna war begeistert. »Ich liebe Colette! Sie ist herrlich, sie mobilisiert die Massen, sie soll vortragen! Oder Gertrude Stein? Am besten beide. Vielleicht haben wir Glück, und sie fangen Streit miteinander an. Organisiert zwei Lesungen zur selben Zeit. Colette deklamiert drüben in der Maison, Gertrude hier im Shakespeares. Ihr reißt die Türen auf, nein, besser: Ihr stellt die Damen vor den Schaufenstern auf Podeste und lasst sie gegeneinander antreten. Zweisprachig. Entfacht ein Sprachfeuerwerk! Beschallt die Straße! Macht Krach, schreibt ein Manifest, erobert die Klanghoheit für Odéonia! Druckt irgend so einen reißerischen Blödsinn auf die Handzettel, und der Erfolg ist garantiert.«
»Gertrude würde sich an einem solchen Spektakel niemals beteiligen«, sagte Sylvia.
»Sie ist außerdem immer noch böse, weil sie denkt, du priorisierst den anspruchsvollen Iren zu sehr«, sagte Adrienne.
»Also in dem Punkt kann ich sie ein bisschen verstehen«, sagte Janet.
Djuna und Sylvia setzten beide zu einem Protest an, aber Adrienne fiel ihnen ins Wort: »Genug von Mr Joyce! Wir sollten in dieser Saison die Frauen in den Vordergrund rücken, Sylvia, es gibt in dieser Stadt weiß Gott genug davon, die etwas zu sagen haben!«
Sylvia schaute sie skeptisch von der Seite an. »Ich dachte, es soll Geld verdient werden.«
»Ach, wenn’s ein bisschen schlüpfrig wird, fließt auch was in die Kasse. Gerade wenn es von den Ladys kommt«, sagte Djuna.
»Sind wir also wieder bei Colette.« Janet paffte, sichtlich zufrieden mit sich, Rauchwolken in die abgestandene Luft.
Sylvia konnte sich ebenfalls das Grinsen nicht verkneifen. »Etwas mehr Respekt vor dem kühnen Werk einer Schriftstellerin von außergewöhnlichem Format, wenn ich bitten darf!«
»Wie wär’s mit Mina Loy?«, schlug Adrienne vor. »Lasst die schöne Mina mit ihrer festen Stimme endlich das sterbenslangweilige Gebäude der Konventionen einreißen, so wie sie es sich erträumt!«
»Mina hat momentan andere Sorgen«, sagte Janet.
Djuna sah sich zu einer leidenschaftlichen Rede veranlasst über »die absurden Schlachten, die wir schreibenden Frauen um den Preis unserer Unabhängigkeit zu schlagen haben«. Daraufhin entspann sich eine lebhafte Diskussion. Ann-Sophie lauschte zunehmend fasziniert, obwohl sie nur teilweise verstand, wovon die Rede war. Die anderen schienen ihrer Anwesenheit keine weitere Beachtung schenken zu wollen, was ihr einerseits recht war, sie andererseits aber auch ein wenig verunsicherte. Wurde von ihr erwartet, dass sie sich am Gespräch beteiligte? Warum sonst duldeten diese in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Frauen sie, die zufällig hereingeschneite Fremde, in diesem verrauchten Hinterzimmer, das offenbar die Kommandozentrale einer, wenn nicht revolutionären, so doch auf jeden Fall skandalträchtigen Bewegung war? Einzig Sylvia machte den Eindruck, sich Ann-Sophies Gegenwart weiterhin bewusst zu sein. Sie schaute immer wieder zu ihr herüber und schien erfreut, dass ihr neuer Schützling derart aufmerksam die Unterhaltung verfolgte.
Die Gespräche wurden hitziger, wechselten häufig zwischen dem Englischen und Französischen. Man fiel sich gegenseitig ins Wort, knallte sich die Sätze um die Ohren wie schnelle Bälle, nannte Namen, Buchtitel oder Artikelüberschriften, von denen Ann-Sophie noch nie etwas gehört hatte. Dazwischen tauchten Theorien zu Dingen wie »Textauffassung und Form weiblich autonomen Schreibens« auf, während Ann-Sophie realisierte, dass sie über solche Fragen noch nie nachgedacht hatte. Und das, obwohl sie selbst früher Seite um Seite ihrer Schreibhefte gefüllt hatte – größtenteils mit zusammengesponnenen Geschichten voller Gefühl, die über das tatsächlich Erlebte weit hinausgegangen waren. Wie sie ihn geliebt hatte, diesen rauschartigen Zustand, der sich gelegentlich dabei eingestellt hatte, vorzugsweise wenn sie in der Nacht schrieb. »Ungesunde Phantastereien, die an der Wurzel ausgemerzt gehören«, hatte Madame Merle, die Pensionatsvorsteherin, sie eines Tages im Anschluss an eine Zimmerkontrolle gerügt. Ann-Sophie hatte hundert Seiten aus Goldene Regeln für die besonnene Haushaltsführung abschreiben müssen, nachdem das entsprechende Heft konfisziert und im Kaminfeuer des Aufseherinnenzimmers vernichtet worden war. Danach hatte sie das Schreiben aufgegeben. Auch das Lesen von Romanen wurde im Pensionat nicht gerne gesehen. »Es lenkt die jungen Damen zu sehr von ihrer eigentlichen Bestimmung ab«, war die Begründung gewesen. Was die Frauen in dieser Runde wohl dazu sagen würden? Immer wieder sprang eine von ihnen vom Tisch auf, um ein Buch oder eine Zeitschrift zu holen und etwas daraus vorzulesen – nicht selten Textpassagen, die Madame Merle zweifellos als »jeglichen Anstand aufs Gröbste verletzend« ebenfalls im Kamin hätte verschwinden lassen. Verglichen damit waren Ann-Sophies kleine Phantasiegeschichten absolut harmlos gewesen. Meistens wurde der jeweilige Vortrag mit Anekdoten oder privaten Details aus dem Leben der Verfasserin garniert – überhaupt machten sie den Eindruck, als würden sie sämtliche Menschen persönlich kennen, die in diesem Jahrhundert auch nur eine Zeile zu Papier gebracht hatten.
Nach einer ganzen Weile – Adrienne Monnier hatte gerade eine flammende Hymne auf eine Dichterin beendet, die »mit ihrer radikalen Absichtslosigkeit den Weg zum tieferen Kern einer poetischen Wahrheit weist« –, da schien Djuna mit einem Mal wieder einzufallen, dass jemand Neues in ihrem Kreis saß: »Jetzt aber mal zu dir, kleine Madame. Was führt dich zu uns?«
»Ähm …« Ann-Sophie war derart überrumpelt davon, wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, dass ihr nichts einfiel.
»Ich hab sie vor der Tür aufgelesen und hereinkomplimentiert«, sagte Sylvia. »Sie stand allein und schimpfend auf der Straße, das arme Ding. Irgendetwas muss sie mächtig verärgert haben. Ich glaube, es ging um Paris. Janet, was bedeutet das deutsche Wort Drecksstadt?«
»Genau das, was du denkst.«
»Ihnen gefällt es hier nicht?«, fragte Adrienne.
»Doch!« Ann-Sophie fühlte zu ihrem Verdruss schon wieder die Röte auf ihren Wangen aufflammen. »Also hier, ich meine hier drin bei Ihnen gefällt es mir. Sehr sogar!«
Und das war die Wahrheit.
Adrienne schien sich mit dieser Information zufriedengeben zu wollten. Djuna jedoch insistierte: »Komm schon, Ann, erzähl! Was zur Hölle kann unser aller Lieblingsstadt dir angetan haben?«
Sämtliche Anwesenden am Tisch hatten sich jetzt Ann-Sophie zugewandt.
»Eigentlich … also … nichts.« Sie holte tief Luft, räusperte sich. »Paris hat mir rein gar nichts angetan.«
»Na, seht ihr!«, sagte Adrienne.
Djuna brachte Adrienne mit einem Wink zum Schweigen, zeigte mit dem Finger auf Ann-Sophie. »Warum warst du dann so aufgebracht, dass Syl meinte, dich retten zu müssen?«
Ann-Sophie rutschte auf die Kante des polsterlosen Holzstuhls, rückte die Tasse vor sich ein Stück nach links, schaute zu Sylvia, die zwar aufmunternd lächelte, aber diesmal keinerlei Anstalten machte, ihr das Antworten abzunehmen.
»Ich hatte eine unliebsame Begegnung mit einigen Studenten.«
Djuna und Janet schauten etwas enttäuscht.
Ann-Sophie fühlte sich gedrängt, fortzufahren: »Vielleicht sind es aber viel mehr die mein Hiersein begleitenden Umstände, die mich mit heftiger Ablehnung reagieren lassen. Womöglich ist mein Urteil deswegen getrübt und eventuell sogar ungerechtfertigt.«
Sie grämte sich wegen ihrer umständlichen Ausdrucksweise, fand vor lauter Aufregung nur mühsam die passenden Worte.
»Was für Umstände sind es denn?«, fragte Sylvia.
»Ich bin nicht aus freien Stücken hier. Und bis zum heutigen Nachmittag dachte ich, ich könnte niemals irgendwo anders als in Berlin glücklich sein.«
»Du lieber Himmel!«, sagte Djuna.
»Versucht sie uns zu schmeicheln, oder meint sie es ernst?«, sagte Janet.
»Sie müssen das bitte verstehen: In Berlin hatte ich ein schönes Leben, eines, das ich um keinen Preis aufgeben wollte.«
»Berlin ist ja nun nicht gerade als gemütliches Pflaster bekannt«, sagte Janet.
Ann-Sophie widersprach: »Für mich schon! Soweit es meine Lebensumstände betraf, war dort alles perfekt. Vielleicht zu perfekt, so etwas rächt sich mitunter. Mein Mann und ich, wir haben erst letzten Sommer geheiratet, hatten in Berlin alles, was man sich nur wünschen kann: einen gepflegten Freundeskreis, ein ausreichendes Einkommen, die Liebe füreinander und eine Wohnung, wie sie schöner nicht sein konnte – Beletage mit modernem Aufzug, fließend Wasser, eigenem Fernsprechapparat und allem denkbaren Komfort. Ich selbst habe sie nach meinen Wünschen einrichten lassen, habe Wochen mit der Planung und der Überwachung der Ausführung zugebracht. Als Johann, das ist mein Mann, mich in der Hochzeitsnacht dann über die Schwelle getragen hat, ist unser Glück vollkommen gewesen. Jedenfalls dachte ich das in diesem Moment. Genau so soll es bleiben, habe ich zu mir gesagt, auf immer und ewig! Aber es dauerte nicht einmal ein halbes Jahr.«
»Interessant, dass du der Beschreibung der Wohnung mehr Aufmerksamkeit schenkst als der der Freunde oder gar des Gatten«, sagte Janet.
»Lass mich raten: Der Kerl hat dich wegen einer Revuetänzerin verlassen, oder noch besser: Du hast ihn in flagranti mit dem Hausmädchen erwischt?«, sagte Djuna.
»So etwas würde Johann niemals tun!«
»Also weißt du, ich habe schon Pferde kotzen sehen.«
Adrienne kicherte und boxte Janet gegen den Oberarm. »Wo willst ausgerechnet du denn ein Pferd kotzen gesehen haben?«
»Was ist denn nun passiert?«, fragte Sylvia.
»Ja, was hat dein ach so perfektes Dasein dermaßen betrüblich degradiert?«, fügte Djuna hinzu.
Weil sich eine Mischung aus Gereiztheit und Ungeduld in Raum breitmachte, beschloss Ann-Sophie, ungeschönt zu erzählen, wie es gewesen war: »Es begann damit, dass mir mein Mann am Silvesterabend ein flaches, mit einer hübschen goldenen Schleife umwickeltes Paket überreicht hat. Beim Auspacken fand ich dies hier.« Sie holte den Baedeker aus dem Beutel und legte ihn als Beweisstück auf den Tisch. »Zunächst war ich begeistert, habe angenommen, dass Johann mich mit einer romantischen Reise überrascht. In Gedanken war ich bereits dabei, die Koffer zu packen, fragte mich, wie viele Abendgarderoben ich brauchen würde und ob die Zeit zur Abreise noch reichte, die Schneiderin mit einem neuen Kleid zu beauftragen. Mitten in meinen Freudenausbruch hinein sagt Johann dann zu mir, dass wir keine gewöhnliche Reise unternehmen würden. ›Wir brechen unsere Zelte hier ab und ziehen fort‹, hat er gesagt. Einfach so. Auf meinen mehr als erstaunten Blick hin hat er zunächst etwas von schwierigen Zeiten gefaselt, dass der Aufschwung in Deutschland nicht mehr lange fortdauern wird, dass sich auch politisch einiges am Horizont zusammenbraut, was ihm Sorgen bereitet.«
»Da hat er vermutlich recht, der Gatte«, sagte Janet.
»Zum Glück habe sich aber ein großartiger Ausweg für uns aufgetan, eine Chance sei ihm geboten worden, wie man sie nur einmal im Leben erhält, und er gedenke nicht, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen. ›Wir werden dieses Land und seinen unsicheren Kurs bereits Anfang März verlassen‹, hat er gesagt, gejubelt hat er, als würde er mir verkünden, in den höheren Adelsstand erhoben worden zu sein. ›Bist du verrückt geworden?‹, habe ich ihn gefragt. ›Im Gegenteil‹, hat er gesagt, ›ganz im Gegenteil!‹ Dann erklärte er mir, dass ein Onkel von ihm, der Mann der Schwester seiner Mutter, eine namhafte multinationale Kanzlei in der Rue Montmartre führt, und weil besagter Onkel selbst kinderlos und ohne Erben ist, wünscht er ihn, Johann, als Partner und späteren Nachfolger einzusetzen. ›Wir müssen dafür nur nach Paris übersiedeln‹, hat er gesagt. Nur! Als wäre das nicht weiter der Rede wert! ›Und ich‹, habe ich ihn gefragt, ›wo bin ich in diesem Spiel?‹ Da hat er ganz erstaunt geschaut und gesagt: ›Wo sollst du schon sein? Du bist an meiner Seite. Die Ehefrau eines aufstrebenden jungen Juristen in einer der glanzvollsten Metropolen der Welt. Freust du dich etwa nicht?‹ Auch noch freuen sollte ich mich! Da habe ich ihm natürlich die Meinung gegeigt! Aber ich konnte noch so heftig widersprechen, es nützte nichts. Alles war bereits beschlossene Sache. Ich wurde nicht nach meinen Wünschen gefragt, sondern lediglich in Kenntnis gesetzt. In meiner Not habe ich dann damit gedroht, mein Vater würde es niemals zulassen, dass ich ins Ausland gehe, aber Johann hatte mit Papa bereits gesprochen. Können Sie sich das vorstellen? Noch bevor er mich, seine Frau, auch nur informiert? ›Ob es mir gefällt oder nicht‹, soll Papa ihm gesagt haben. ›Du bist ihr angetrauter Mann, und sie muss gehen, wohin du sie führst.‹ Was hätte ich tun sollen? Ich musste mich fügen. Und jetzt hause ich in einer winzigen Wohnung über einem zwielichtigen Lokal in der Rue Cujas, während in Berlin mein wunderbarer Salon einstaubt. Nicht einmal ein Dienstmädchen habe ich mehr. Wie soll man da nicht wütend sein? Mein Mann verbringt all seine Zeit in der Kanzlei, treibt seine Karriere voran, und ich bin dazu verdammt, allein und wehrlos in einer mir völlig fremden Stadt zu sein und mit diesem unseligen Reiseführer in der Hand sinnlos durch die Straßen zu wandern. Ich habe noch nie so viel geweint und mit meinem Schicksal gehadert wie in den vergangenen Wochen, das können Sie mir glauben!«
Ann-Sophie atmete schwer, schnappte nach Luft, als wäre sie vier Stockwerke hinaufgerannt. Sie hatte sich mehr und mehr in Rage geredet, aber das war gut gewesen. Jetzt würden die anderen Frauen mit ihr fühlen, und sie würde nicht mehr so einsam mit ihrem Kummer sein. Eine Träne rann über ihre Wange, sie zog ein Taschentuch aus ihrem Beutel, tupfte sich die Augen, schaute dann erwartungsvoll in die Runde. Die Stille, die ihr entgegenschlug, war schwer zu deuten. Alle blickten sie an, niemand sagte etwas. Selbst Sylvia war das Lächeln aus dem Gesicht gefallen. Schließlich war es Djuna, die nach einer für Ann-Sophie quälend langen Weile das Schweigen beendete: »Du bist vergrätzt, weil du zu feige warst, für dich selbst einzutreten, und deshalb in Berlin deine frisch eingerichtete Luxusweibchenexistenz aufgeben musstest? Soll das ein Witz sein?«
Das war nun wirklich nicht die Reaktion, die Ann-Sophie erwartet hatte. Hätte sie ihrem ersten Impuls stattgegeben, wäre sie empört aus dem Laden gestürmt und niemals wieder zurückgekehrt, aber irgendetwas hielt sie zurück. Sie blieb, wo sie war, und nahm, wenn auch zunächst noch zögernd, Djunas Herausforderung an.
»Nein, so ist es nicht«, sagte sie leise, flüsterte beinah.
»Umso besser«, sagte Djuna, den Flüsterton aufgreifend, um plötzlich so laut zu werden, dass Ann-Sophie zusammenzuckte: »Wie ist es aber dann? Das kann doch nicht alles sein! Denk nach, ich will es wissen!«
Ann-Sophies Herz schlug bis zum Hals, sie blickte erneut in die Runde, hoffte auf Beistand, versuchte mit aller Kraft, nicht in Tränen auszubrechen. Sylvia berührte sanft ihren Arm, schwieg aber weiterhin. Adrienne löffelte Zucker in ihren Tee, Janet zündete sich zum gefühlt hundertsten Mal ihre Zigarre wieder an und kippelte mit dem Stuhl gegen die Bücherwand hinter ihr. Djuna hielt den Blick weiterhin fest auf Ann-Sophie geheftet und begann rhythmisch mit den schwarz lackierten Fingernägeln auf einem Bucheinband zu trommeln. Mrs Dalloway. Sie hatten vorhin noch über die Autorin gesprochen, eine ebenso kapriziöse wie kluge Engländerin, die den anderen gut bekannt zu sein schien. Solchen Geschichten hätte Ann-Sophie jetzt viel lieber weiter zugehört. Warum hatte sie sich breitschlagen lassen, etwas von sich zu erzählen? Und warum hatte sie nicht an sich halten können und gleich ihr halbes Herz ausschütten müssen?
Der Rhythmus von Djunas Nägeln wurde schneller, fordernder. Sie will es tatsächlich wissen, dachte Ann-Sophie, und sosehr sie das einerseits in Bedrängnis brachte, schmeichelte es ihr andererseits auch. Für einen Moment schloss sie die Augen, dachte nach. Djuna würde sich nicht mit irgendeiner Plattitüde abspeisen lassen – keine der anwesenden Frauen würde das.
»Die Wahrheit ist«, hörte Ann-Sophie sich sagen, nachdem die Stille unerträglich geworden war, »dass mich so viel mehr wütend macht als das, was ich jüngst hinter mir lassen musste.«
Das Klopfen von Djunas Nägeln stoppte, der Druck von Sylvias Hand auf ihrem Arm wurde stärker, Adrienne hörte auf, in ihrer Tasse zu rühren. Ann-Sophie fuhr fort: »Ich glaube, nein, ich weiß, dass mein Zorn tiefer sitzt und dass er auf eine Weise, die ich selbst noch nicht genau definieren kann, alt ist. Es gibt ihn schon so lange, schlummernd, lauernd, stumm gärend. Er wurde lediglich aufgeweckt, und jetzt ist er da. Überall, permanent, wie ein Gift, das durch meine Adern kriecht. Ja, so könnte man es umschreiben.« Sie hob die Tasse zum Mund, nahm einen Schluck, schmeckte die rauchige Schärfe des Brandys, setzte die Tasse wieder ab. »Jedenfalls möchte ich seitdem am liebsten alles kurz und klein schlagen, obwohl ich im Grunde gar nicht weiß, wieso eigentlich.«
»Ah!«, sagte Djuna. »Jetzt wird es interessant!«
Das fand Ann-Sophie auch, denn ihr selbst war die dunkel brodelnde Schicht unter ihrer Übellaunigkeit bis zu diesem Moment gar nicht bewusst gewesen.