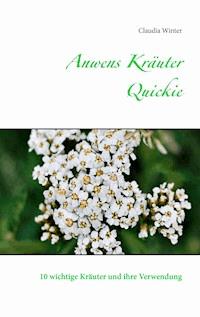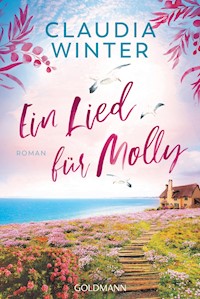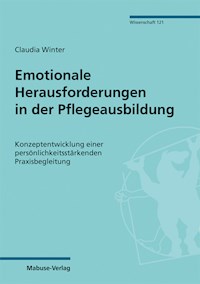3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die alleinerziehende Camilla kämpft an allen Fronten: Täglich muss sie sich im väterlichen Delikatessenhandel beweisen, während ihre fünfzehnjährige Tochter Marie gegen sie rebelliert. Und dann wird sie auch noch nach Südfrankreich geschickt, um mit einer Honigmanufaktur zu verhandeln – im Gepäck das tobende Mädchen und ihren nervtötenden Nachbarn, der sich ihnen spontan angeschlossen hat. Kein Wunder, dass sich das pittoreske Bergdorf Loursacq zunächst als wenig heilsam für die angespannten Gemüter erweist. Doch Camilla krempelt die Ärmel hoch – und lernt zwischen Tomatenstauden, Rebstöcken und Olivenbäumen, dass die guten Dinge im Leben erst dann auf zarten Flügeln herbeifliegen, wenn man bereit für sie ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Die alleinerziehende Camilla kämpft an allen Fronten: Täglich muss sie sich im väterlichen Delikatessenhandel beweisen, während ihre fünfzehnjährige Tochter Marie gegen sie rebelliert. Und dann wird sie auch noch nach Südfrankreich geschickt, um mit einer Honigmanufaktur zu verhandeln – im Gepäck das tobende Mädchen und ihren nervtötenden Nachbarn, der sich ihnen spontan angeschlossen hat. Kein Wunder, dass sich das pittoreske Bergdorf Loursacq zunächst als wenig heilsam für die angespannten Gemüter erweist. Doch Camilla krempelt die Ärmel hoch – und lernt zwischen Tomatenstauden, Rebstöcken und Olivenbäumen, dass die guten Dinge im Leben erst dann auf zarten Flügeln herbeifliegen, wenn man bereit für sie ist …Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Claudia Winter
Das Honigmädchen
Roman
Originalausgabe Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe März 2019
Copyright © 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Redaktion: Angela Troni
CN · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-19909-8V003
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Nichts gleicht der Seele so sehr wie die Biene.Sie fliegt von Blüte zu Blüte wie die Seele von Stern zu Stern,und sie bringt den Honig heim,wie die Seele das Licht …
Victor Hugo
Prolog
SÜDFRANKREICH IM MAI 1956
Es war der erste richtige Frühlingstag nach jenem Winter, den die Leute aus Loursacq l’hiver des oliviers noirs nannten – den Winter der schwarzen Olivenbäume.
Henri marschierte den steinigen Pfad entlang, den er zweimal täglich gehen musste, die Daumen hinter die Schulterriemen des Tornisters geklemmt, den Blick fest auf die drei weißen Streifen auf seinen Schuhen gerichtet. Er konnte noch immer kaum glauben, was Maman da für ihn getan hatte.
Direkt nach dem Aufwachen hatte sie ihm das braune Päckchen in die Hand gedrückt, mit leuchtenden Augen, als hätte sie Geburtstag und nicht er. Was darin war, hatte er sofort gewusst – wegen der vielen ausländischen Briefmarken. Geheult hatte er, o ja, und das Papier mit den kostbaren Marken zerrissen, weil er sie so dringlich in den Händen halten wollte: die Fußballschuhe, denen die Deutschen ihren Sieg im WM-Endspiel gegen die Ungarn verdankten. Was für ein atemberaubendes Finale!
Seit jenem Tag hatte Henri felsenfest an die Zauberkräfte der Stollenschuhe geglaubt, über die damals sogar in Pépères Sonntagszeitung berichtet wurde. Sie tatsächlich zu besitzen war das beste Geburtstagsmorgengefühl, das er in den vergangenen zwölf Jahren gehabt hatte. Wobei er sich freilich nicht mehr an alle Geburtstage erinnerte.
Was die Zauberschuhe anging, war er leider noch am selben Nachmittag eines Besseren belehrt worden, in einer beschämenden Sportstunde mit etlichen verpassten Torchancen. Ein paar läppische Nägel unter den Sohlen reichten eben doch nicht aus, damit ein Außenseiter gegen einen unschlagbaren Gegner gewann. Dabei hatte er so gern an das Wunder von Bern glauben wollen.
Henri seufzte, froh, dass ihn seine Überlegungen vom Anblick der knorrigen Baumskelette ablenkten. Wie verbrannte Kriegsverletzte ragten sie aus dem Boden, dort, wo einmal ein zartgrünes Blätterdach seinen Schulweg gesäumt hatte. Grün war hier trotzdem noch so einiges, das war es in der Haute Provence eigentlich immer, wie Maman andauernd betonte, mit ihrem komischen Wohlwollen für all das Gestrüpp, das angeblich gut für die Bienen war. Wegen ihnen liebte Aurélie Lambert jedes Kraut, solange es Blüten trug, den Ginster, die Mimosen, die Wildblumen. Ganz besonders mochte sie den Lavendel, der unter der Aprilsonne die ersten silbrigen Blätter trieb, scheinheilig, als hätte es die legendäre Kältewelle nie gegeben.
Die Olivenbäume hingegen, die Henris Ururgroßvater gepflanzt hatte, trugen das Frostopferschwarz einer Schlacht, die in einer einzigen Februarnacht entschieden wurde, als die Temperatur innerhalb weniger Stunden auf über minus zwanzig Grad gesunken war. Im Radio hatten sie behauptet, jener Nacht seien in ganz Frankreich drei Millionen Olivenbäume zum Opfer gefallen, überall im Land habe das tödliche Knacken der Stämme die Obstplantagen durchdrungen. »Von innen erfroren und dann geplatzt. Bum! Fini!«, hatte Pépère gerufen und mit der Faust auf den Küchentisch gehauen, das Faltengesicht hummerrot, weshalb Maman rasch das Radio ausgeschaltet hatte, ehe ihre Fayence-Teller daran glauben mussten.
Henri kickte einen Stein vor sich her. Drei Millionen. Gestern hatte er die Zahl in sein Rechenheft geschrieben, spaßeshalber, um das »Bum! Fini!« schwarz auf weiß zu sehen. Er hätte es lassen sollen. Es war nicht schwer zu erraten, was die vielen Nullen auf dem karierten Blatt für Pépères Oliven und die kleine Ölmühle bedeuteten, die ihnen neben Mamans Honig ein leidliches Auskommen bescherte.
Da war es besser, über Fußball nachzudenken oder sich Arthur Pelletiers gequälte Miene ins Gedächtnis zu rufen, als Henri auf dem Fußballplatz die neuen Fußballschuhe aus dem Tornister geholt hatte. Zwar hatte er kein Tor damit geschossen, und er musste sich zweimal böse von Pelletier foulen lassen – aber eine kostbare Stunde lang war Henri Lambert endlich einer von ihnen gewesen. Vielleicht war das auch eine Art, mit Stollenschuhen einen Kampf zu gewinnen.
»Henri!«
Er hob den Kopf. Die glockenhelle Stimme war längst bei ihm angekommen, bevor er das weiße Baumwollkleid erspähte, das sich im Wind bauschte. Für einen Moment überlegte er tatsächlich, ihr Winken nicht zu erwidern. Nicht, weil er seine Mutter nicht liebte. Er kam nur allmählich in ein Alter, in dem es ihm peinlich war, wenn sie ihm auf halber Strecke entgegenlief, als könne er sich verirren. Doch je näher sie kam, desto schneller wurden seine Beine, bis er ganz von selbst in Mamans Umarmung flog, die nach Bienenwachs, Pépères Pfeifentabak und ein bisschen nach Frauenschweiß roch.
»Hattest du einen erfolgreichen Tag?«
Ihre Kornblumenaugen erforschten sein Gesicht, vorsichtig tippte sie ihm mit dem Finger auf die blutverkrustete Nase, die noch immer wehtat.
»Drei Tore verschossen, Arthurs Ellenbogen abgekriegt.« Er rang sich ein Lächeln ab, das bestimmt genauso schief war wie die dazugehörenden Vorderzähne. Dass Arthurs Freund Baptiste ihm einen Tritt verpasst und Serge, der Sohn des Konditors, ihm ins Gesicht gespuckt hatte, erzählte er nicht.
»Aber ich hab mitgespielt.«
»Das freut mich für dich«, antwortete Aurélie ernst, und Henri wusste, dass sie es auch so meinte. Wer sonst, wenn nicht sie, hatte Verständnis dafür.
Um weiteren Fragen und mühsam abgerungenen Antworten zu entgehen, schob Henri sich an Maman vorbei und rannte auf das Steinhaus mit dem roten Tonziegeldach zu.
»Was gibt es zum Mittagessen?«, rief er über die Schulter und fühlte sich schuldig, weil er in letzter Zeit ständig hungrig war.
Er hatte die blaue Haustür fast erreicht, als er bemerkte, dass Maman am Tor stehen geblieben war, neben dem einst prächtigsten Olivenbaum ihres Hofs, den Pépère bis auf den Torso gekappt hatte. Wie ein verkrüppelter Veteran kauerte er in der Wiese, amputiert an Armen und Beinen, und Henri brauchte einen Moment, um zu erkennen, dass Maman gar nicht den Baumstumpf anstarrte, der seinen Großvater nach getaner Arbeit zum Weinen gebracht hatte. Was sie sah – oder vielmehr spüren musste, da es sich außerhalb ihres Sichtfelds befand –, lag hinter dem Olivenhain, am Waldrand. Dort, wo die Bienenkästen standen.
Aurélie Lambert lauschte mit geneigtem Kopf, ihr Körper blieb unter dem Kleid vollkommen reglos, als hätte er vergessen, wie man atmet. Sekunden nach dem Lächeln, das scheinbar grundlos auf ihren Lippen erschien, ertönte das Geräusch. Ein tiefes Brummen, das zum Dröhnen eines Langstreckenbombers anschwoll. Noch ehe Henri begriff, was die schwarze Wolke über den Baumwipfeln bedeutete, gellte Mamans Stimme in seinen Ohren.
»Hol die Schwarmkiste, Henri. Schnell. Lauf!«
Und Henri lief – nein, er flog förmlich. Am Haus und an der Steinmauer vorbei, um die Ecke in den Schuppen hinein, den Pépère an die Scheune gemauert hatte. Auf seinen Stollen schlitterte er über die Fliesen und stieß aus Versehen den Abfülleimer neben der Honigschleuder um, doch Henri machte sich nicht die Mühe, die penible Ordnung in der Honigküche wiederherzustellen. Er holte den Handkehrbesen, fischte die Wassersprühflasche aus der Spüle und legte die Utensilien in den Holzkasten. Dann schwankte er mit seiner Last hinaus.
Maman kam ihm auf dem Schotterweg entgegen, die Augen auf den brummenden Insektenschleier am Himmel gerichtet, gefolgt von Pépère. Henri erinnerte sich nicht, wann er den Großvater das letzte Mal so schnell humpeln sah.
Vorsichtig stellte Henri die Kiste ab, öffnete den Deckel und suchte die wortlose Verständigung mit Maman. Sie hatten oft genug bei diesem Spiel mitgemacht und den Wettlauf meist auch gewonnen – sofern der Schwarm nicht auf die Idee kam, sich wie im letzten Frühling auf dem Dach niederzulassen. Gott sei Dank verschmähte die Königin diesmal das sonnengewärmte Plätzchen auf dem Ziegelsteinkamin. Als hätte jemand die Luftzufuhr unter den Abertausenden zarten Flügeln gekappt, sank die Insektenwolke keine zwei Meter vor Henri zur Erde herab. Er hielt den Atem an, fühlte, wie ihm das Herz gegen die Rippen prallte. Die Bienen machten ihm Angst, wenn sie ihm zu nahe kamen, weil er bereits einmal erlebt hatte, welch verheerende Folgen ein Stich für ihn haben konnte. Dennoch verfolgte Henri gebannt, wie die Tiere eine etwa fußballgroße Traube an den Tomatenstauden bildeten, die Maman an der Hauswand gepflanzt hatte. Das Summen wurde träger, und die Kundschafterinnen machten sich unverzüglich auf die Suche nach einem geeigneten Nistplatz, während der Rest des Schwarms das Wertvollste in seiner Mitte beschützte: die Königin.
Eigentlich hätte Maman die Flasche nehmen müssen, um die pelzigen Körper zu besprühen, damit sie enger zusammenrückten. Es war dann ganz leicht, den ganzen Schwarm in die Kiste zu schütteln, welche die Bienen hoffentlich als neues Zuhause akzeptieren würden. Aber Aurélie Lambert tat nichts dergleichen.
»Tomaten. Natürlich«, flüsterte sie. »Sie sind ja so klug, unsere Schätzchen.«
Henri drehte sich verwundert zu ihr um. Sie sah glücklich aus, aber auch irgendwie traurig.
»Tomaten?« Er kam sich dumm und sehr klein vor, als Maman seine Schultern umfasste und ihn an sich drückte.
»Tomaten«, bestätigte sie. »Außerdem Zucchini, Auberginen, Paprika. Salat und Kräuter. Aber die Tomaten werden der Anfang von etwas ganz Neuem.«
Henri verstand nicht, wovon sie redete, doch er kannte den Namen für den Gesichtsausdruck, den sie hatte. Entrückt nannten es die Erwachsenen, zumindest diejenigen, die Bücher schrieben. Solche wie die, aus denen Maman ihm abends vorlas, obwohl er für die Kriminalromane mit commissaire Maigret eigentlich noch zu jung war.
»Henris Vater hat uns damals geraten, Gemüse anzubauen, weil es resistenter gegen Frost ist.« Die Stimme seiner Mutter klang jetzt sehr bestimmt, während Pépère seine Tochter ansah, wie die Leuten aus dem Dorf sie so oft anschauten: als wäre sie une folle – eine Verrückte.
Vielleicht war sie das ja, überlegte Henri und fand es komisch, dass ihm der Gedanke gefiel. Man sagte ja auch über ihn, er sei un enfant maudit – ein verdammtes Kind. Da passte es ganz gut, wenn man seine Mutter für nicht ganz richtig im Kopf hielt.
»Der Gott der Bienen ist die Zukunft, das sagst du doch immer, Papa.« Mamans Finger schwenkte wie eine Kompassnadel von Pépères Brust auf den Schwarm zu ihren Füßen, den sie schleunigst einfangen sollten, ehe er sich auf und davon machte. »Gestern meintest du noch, dass du nicht weißt, wie es mit dem Hof weitergehen soll. Aber sieh doch … heute geben uns die Bienen ein Zeichen. Lass uns darauf vertrauen, dass sie recht haben.«
Es dauerte lange, bis der Alte aus seiner starren Haltung erwachte, die dem schiefen Olivenbaumtorso auf der Wiese ähnelte.
»Haben wir was zu verlieren?«, erwiderte er, drehte sich auf dem Absatz um und humpelte davon.
»Ist Pépère wütend?«, traute Henri sich zu fragen, nachdem sein Großvater türeschlagend in der Scheune verschwunden war.
Aurélie lachte leise. »Nur bis morgen.«
»Maman?« Er holte tief Luft, weil er für die zweite Frage viel davon brauchte. »Stimmt es, dass … Papa …« Merde! Obwohl Maman ihn gelehrt hatte, keinen Zorn für den Mann zu empfinden, den er nur von einem Foto kannte, fiel es ihm schwer, das Wort auszusprechen, so als handele es sich bloß um ein paar Buchstaben, die man an einer Hand abzählen konnte. »Hat er wirklich gesagt, wir sollen Tomaten pflanzen?«
»O ja, mon ange – mein Engel, das hat er.« Wieder erhellte ihre Züge dieses besondere Lächeln, das nur für Henri gedacht war. »Aber zuerst bedanken wir uns bei unseren treuen Freundinnen für ihre Weitsicht und schenken ihnen ein hübsches neues Zuhause.«
Maman gab ihm die Arbeitshandschuhe und den Kehrbesen. Dann versetzte sie ihm einen sanften Schubs, der ihn überrascht nach vorn taumeln ließ. Er wusste nicht, dass diese zwei Stolperschritte die bedeutendsten seines bisherigen Lebens werden sollten.
»Da unten krabbelt dein erster eigener Bienenschwarm, mein Sohn. Du solltest dir das Glück in die Kiste holen, ehe es davonfliegt.«
Eins
MÜNCHEN IM JULI 2017
Es war immer derselbe unverkennbare Geruch. Sogar mit geschlossenen Augen und ohne den Widerhall ihrer Absätze in den Bogengängen hätte sie erkannt, dass sie sich in einem Schulgebäude befand. Feuchte Jacken, vergessene Turnbeutel, lauwarmes Kantinenessen. Darunter lagen der sehr viel ältere Duft von Staub, Papier und Büchern – und das allgegenwärtige Seifenaroma des Bohnerwachses, das wohl alle Münchner Schulen seit zwanzig oder mehr Jahren vom selben Hersteller bezogen. Ist es wirklich schon so lange her?
Camilla presste die Lippen zusammen und eilte weiter. Das Geländer der Freitreppe fühlte sich an, wie es aussah: seidig glatt, über Jahrzehnte von schwitzigen Handflächen poliert. Sie hob das Kinn, nur so viel, um die Schrecksekunde zu überwinden, in der ihr war, als wäre sie plötzlich selbst wieder Schülerin.
Im ersten Stock kam ihr eine Gruppe Jugendliche entgegen, Camillas Mund lächelte, ohne dass ihre Augen ebenfalls dazu imstande gewesen wären – dafür war sie zu nervös. Automatisch trat sie beiseite und wartete, bis das Turnschuhquietschen und die neugierigen Blicke an ihr vorbei waren. Von irgendwoher drang Kindergesang an ihr Ohr, begleitet von klappernden Plastikbechern. Die Trommler hatten hörbar Spaß, aber keinen Funken Rhythmus.
Nun lächelte Camilla doch. Sie sangen den Cupsong aus dem Film über eine Mädchen-A-cappella-Band, den sie mit Marie bestimmt schon zehnmal angeschaut hatte, eng aneinandergekuschelt unter dem rot gemusterten Plaid, mit Chips und Limonade. Wann war das gewesen, vor zwei oder vor drei Jahren? Vor einer Ewigkeit, antwortete ihr Herz und zog sich zusammen.
Das Büro der Schulleitung lag am Ende des Flurs. Das tat es immer, egal ob es sich um das altehrwürdige Mariengymnasium oder welche gottverdammte Schule auch sonst handelte. Der Weg dorthin zog sich endlos.
Atmen, Camilla. So schlimm wird es schon nicht werden.
Dr. Ellen Eckart-Schmidt/Schuldirektorin, stand in Blockbuchstaben auf dem Türschild. Bewusst langsam ließ Camilla die Luft aus der Lunge entweichen, dachte an Kartoffelchips, an die Wärme von Maries Kinderkörper in ihrer Achselbeuge. An die Zigarette, die sie nachher nicht rauchen würde, egal was sie auf der anderen Seite der Tür erwartete.
Auf ihr Klopfen hin öffnete sich die Tür so unvermittelt, als hätte Frau Dr. Eckart-Schmidt bereits die Klinke in der Hand gehalten.
»Frau Monhof. Schön, dass Sie gekommen sind.«
Die Schulleiterin war eine überraschende Erscheinung. Winzig, rund. Eine farbenfroh gekleidete Hobbitfrau mit festem Händedruck, der Camilla umstandslos über die Schwelle dirigierte. Wäre sie der Frau im Supermarkt begegnet, hätte Camilla ihr nie im Leben dieses Türschild zugetraut. Noch weniger die rauchige Whiskystimme, die ihrer Sekretärin am Telefon verdeutlicht hatte, dass Frau Schuldirektorin das Kundenmeeting reichlich schnuppe war, aus dem sie die Mutter ihres Schützlings herausbeorderte.
Ihre Tochter war bereits da. Natürlich war sie das. Sie saß auf dem Besuchersessel, in dem sie unter normalen Umständen herumgelümmelt hätte, doch davon konnte jetzt keine Rede sein. Kerzengerade hockte sie auf der Polsterkante, ein Mädchen, das derzeit nur aus Knien und Ellenbogen bestand. Ihre Augen klebten auf der lindgrünen Tapete, als wäre sie eine Kinoleinwand, auf der ein gähnend langweiliger Film lief.
Das »Himmelherrgott, Marie!« entfuhr Camilla zu schnell, zu unbedacht. Verdammt!
Der verbale Peitschenhieb zeigte augenblicklich Wirkung. Maries Rücken versteifte sich, und Camilla begriff, dass ihr das Mädchen entglitten war, ehe sie überhaupt begonnen hatten zu reden. Es machte sie traurig und wütend zugleich. Auf Marie. Auf sich selbst.
Mit festen Schritten durchquerte sie den Raum und sank auf den zweiten Besucherstuhl. Ihr Blick glitt über den Mahagonischreibtisch zum Bogenfenster, das eine fantastische Aussicht auf den Englischen Garten bot. Dann schaute sie Marie an, die durch sie hindurchsah, als wäre sie ein Geist. Viel zu dünn war sie, eine tiefe Müdigkeit lag auf ihrem Gesicht, trotz des Make-ups, das die Unreinheiten an Nase und Kinn überdeckte. Aber womöglich täuschte der Eindruck, und es lag nur an dem diffusen Licht, das alles in diesem Raum kränklich wirken ließ.
Frau Dr. Eckart-Schmidt nahm hinter dem Schreibtisch Platz. »Möchten Sie einen Kaffee? Oder ein Glas Wasser?«
Ihre Freundlichkeit war wie lackiert, eine glatte Fläche, bei der man nicht genau wusste, welche Unebenheiten sie verbarg. Camilla verneinte höflich, sie war auf der Hut.
Eine Weile sagte keiner von ihnen ein Wort, bis die sachliche Stimme der Schuldirektorin das Tapetenmuster erzittern ließ.
»Wir wissen mit Marie im Augenblick wirklich nicht mehr weiter, Frau Monhof.«
Falls dieser Satz irgendetwas in Marie berührte, machte sich das nicht körperlich bemerkbar, sie wirkte wie eingefroren. An Camilla hingegen ging er nicht spurlos vorbei.
»Könnten Sie mir bitte zunächst erklären, worum es geht?«, sagte sie spröde, darum bemüht, sich den Schreck nicht anmerken zu lassen.
»Nun denn, vielleicht möchte Marie das übernehmen«, antwortete die Schulleiterin, diesmal an ihre Schülerin gewandt.
Im Zeitlupentempo drehte das Mädchen den Kopf, seine Augen scannten das Gesicht der älteren Frau, die einen Gegenstand aus der Schublade holte und auf den Tisch legte.
»Nö.«
»Das dachte ich mir schon.« Frau Dr. Eckart-Schmidt nickte, während Camilla sich nach vorn beugte.
Ein Notizbuch. Vielmehr war es mal eins gewesen, vermutete sie, bevor jemand versucht hatte, damit Feuer zu machen. Ihr Herz klopfte schneller.
»Was ist das?«
»Das ist das Notenbuch von Maries Klassenlehrerin. Offenbar hat Ihre Tochter es an sich genommen und versucht, es in der Toilette zu verbrennen, bevor der Feuermelder losgegangen ist. Wir mussten deshalb heute früh den gesamten Schulkomplex räumen.«
»Sie hat was?«
Camilla riss die Augen auf, Marie verdrehte ihre zur Stuckdecke und tippte kurz darauf etwas in ihr Smartphone, so schnell, dass Camilla befürchtete, es könnte ebenfalls in Flammen aufgehen.
»Ehrlich gesagt ist das nicht alles. Ihre Tochter hat in diesem Schuljahr dreiundvierzig Fehltage, was es einigen Lehrern derzeit unmöglich macht, Maries Leistungen zu bewerten. Am Sportunterricht hat sie beispielsweise so gut wie nie teilgenommen.«
Die Luft knisterte. Benommen schaute Camilla ihre Tochter an, die noch immer keinerlei Regung zeigte, ihre großen Augen mit den schwarzen Spinnenbeinwimpern verloren sich irgendwo im Raum.
»Davon weiß ich nichts. Weshalb … warum haben Sie mich denn nicht schon früher darüber informiert?«
Frau Dr. Eckart-Schmidt zog die Mundwinkel weiter nach oben, allmählich ging Camilla dieses selige Hobbitlächeln auf die Nerven.
»Das haben wir, Frau Monhof. Mehrfach sogar. Die Schreiben kamen alle mit Ihrer Unterschrift versehen zurück, aber auf unsere Kontaktversuche erfolgte keine Reaktion Ihrerseits.«
»Marie?«, fragte Camilla scharf. »Weißt du etwas darüber?«
Marie zuckte die Achseln. Camilla sah sie dennoch, die Röte, die den schlanken Hals hinaufkroch, als das Mädchen den Nacken beugte und erneut auf sein Handy schielte.
Hat sie die blauen Briefe verschwinden lassen? Meine Unterschrift gefälscht? Camilla zitterte. Vor Wut. Vor Hilflosigkeit. Aus Schuldbewusstsein, weil sie ihrer Tochter das alles tatsächlich zutraute.
Die Schulleiterin seufzte. »Leider zeigt Marie sich in den letzten Monaten zunehmend unkooperativ. Von ihrer mangelnden Leistungsbereitschaft abgesehen verhält sie sich den Lehrern gegenüber äußerst respektlos. Wir haben den Fall letzte Woche in unserem Disziplinarausschuss diskutiert, zu dem wir Sie ebenfalls schriftlich eingeladen hatten.« Sie holte Luft, als nähme sie Anlauf für eine besonders schwierige Hürde in diesem Gespräch. In diesem völlig absurden Gespräch, das … »Unter diesen Umständen sehen wir leider keine Möglichkeit, Marie weiter in dieser Einrichtung zu beschulen.«
»Moment.« Camilla lachte auf. Ungläubig, entsetzt. Es kostete sie unbändige Beherrschung, nicht aufzuspringen und vor dem Gesicht der Schulleiterin die Faust zu schütteln. Vor diesem ach so gütigen Gesicht, das gar nicht aussah, als könnte es Sätze mit derart vernichtendem Inhalt ausspucken. »Sprechen Sie da gerade von einem Schulverweis? Einfach so? Weil Marie ein paar Stunden gefehlt hat und … das hier ist ein Privatgymnasium! Ich bezahle viel Geld dafür.«
»Das stimmt. Wir sind eine Privatschule und genießen einen ausgezeichneten Ruf. Deshalb pochen wir besonders auf gewisse Grundregeln, zu denen unter anderem die regelmäßige Teilnahme am Unterricht gehört. Von einem respektvollen Umgang mit Lehrern und Mitschülern mal ganz abgesehen.« Frau Dr. Eckart-Schmidt überlegte kurz und wandte sich dann an Marie. »Lässt du mich bitte einen Augenblick mit deiner Mutter allein?«
Es war eindeutig keine Frage, sondern eine Anweisung, der Marie unverzüglich folgte, mit gesenktem Kopf und so eilig, als hätte man ihr gerade ein blutiges Steak angeboten.
Am liebsten wäre Camilla ihr hinterhergelaufen, um ihre Tochter vor der Tür zu schütteln, bis ihr Hören und Sehen verging. Doch sie hielt eisern die Stuhllehne umklammert, fühlte, wie sich der gepolsterte Stoff unter ihren Nägeln spannte. Schön sitzen bleiben. Sie hatte ihr Kind noch nie angefasst, das würde sich auch heute nicht ändern. Selbst wenn sie sich nach dieser Unterredung in der Schultoilette einschließen und irgendwelche Edding-Schmierereien auf der Klotür lesen musste, bis sie sich beruhigt hatte. Gott, sie war todmüde. Weil sie zu hart und zu lange arbeitete. Weil sie viel zu wenig schlief, seit dieser schreckliche neue Nachbar nebenan einge…
»Frau Monhof?«
Verwirrt sah Camilla auf die sommersprossige Hand, die über den Tisch auf sie zukroch. Der Impuls, samt Stuhl zurückzuweichen, war übermächtig, aber irgendwie hatte die Geste dieser Frau auch etwas Einladendes, Tröstliches.
»Schulschwänzerei ist eine ernste Sache und weist oftmals auf tief sitzende familiäre Probleme hin. Sie müssen nicht allein damit klarkommen. Es gibt Hilfe für Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind«, sagte die Schulleiterin milde. »Das Jugendamt wäre eine gute Anlaufstelle und wenn Sie Unterstützung brauchen, dann gebe ich Ihnen gern eine entsprechende Adresse.«
So weit war es also schon, dass eine Fremde ihr riet, sich professionelle Hilfe zu holen. Als ob das Psychotherapeutenthema nicht längst durch wäre. Als ob sie es nicht beide schon durchhätten, sie und Marie.
»Wir haben keine Probleme, Frau Doktor Eckart-Schmidt.« Camilla hob eine Braue. Ironie war eine gute Fassade, die sich schnell mauern ließ, wenn man Betroffenheit verbergen musste. Sehr schnell.
Bedacht, ihrer Stimme einen flehenden Klang zu verleihen, beugte sie sich nach vorn. Pädagogen mochten es, wenn ihr Gegenüber Einsicht zeigte. »Ich werde mit meiner Tochter sprechen und dafür sorgen, dass sie ab sofort keinen einzigen Fehltag mehr hat. Geben Sie Marie noch eine Chance, in Anbetracht dessen, dass ich«, Camilla legte die Hand auf die Stelle, wo es viel zu schnell pochte, »von alldem keine Ahnung hatte.«
Es war schwer, das Mitgefühl in der Miene der Schulleiterin auszuhalten. Endlich, nach einer halben Ewigkeit, rang sie sich ein abwägendes Zeitlupennicken ab, das sich anfühlte, als hege sie keine großen Hoffnungen.
»Eine letzte Chance, wenn Marie das Schuljahr wiederholt. Im Gegenzug versprechen Sie mir, dass Sie sich Hilfe holen, falls es nicht funktioniert.«
»Es wird funktionieren!« Camilla stand rasch auf. Sie brauchte frische Luft, dringend. Und dieses Zimmer würde sie hoffentlich nie wieder betreten. Ein letztes Mal das klebrige Schulleiterinnenlächeln, das sie vermutlich noch den ganzen Tag auf der Haut spüren würde.
»Glauben Sie mir«, antwortete Frau Dr. Eckart-Schmidt ernst. »Es gibt nichts, was ich mir mehr für Marie wünsche.«
»Wie bist du bloß auf die dämliche Idee gekommen, das Notenbuch im Schulgebäude zu verbrennen? Hätte es nicht auch eine Mülltonne im Park getan?«
Auf der gesamten zehnminütigen Fahrt hatte Camilla sich überlegt, wie sie anfangen sollte. Vielleicht war es für ihre mütterliche Autorität nicht gerade zielführend, es auf diese Weise zu versuchen, flapsig und mit der einzigen Art von Humor, zu dem sie imstande war.
Immerhin erfolgte eine Reaktion seitens ihrer Tochter, die bis dato mit angezogenen Knien auf dem Beifahrersitz gesessen und still aus dem Fenster geschaut hatte, sodass Camilla beinahe das Gewicht ihrer Gedanken spürte. Nun zuckte Maries Kopf herum, ihr Blick unter den Ponysträhnen war starr und herausfordernd, gewappnet für den unausweichlichen Streit.
»Die Schule ist Mist«, sagte sie und verzog den Mund, der seit einem Jahr nichts anderes tat. Als wäre die Pubertät ein Magnet, der alles, was vorher noch an der richtigen Stelle gewesen war, an den falschen Platz verschob.
»Trotzdem wirst du weiter hingehen.« Camilla atmete flach, konzentriert darauf, den Mini in die winzige Parklücke auf der Herzogstraße zu manövrieren. Ein Glückstreffer für Schwabinger Parkplatzverhältnisse, zumal sie sich direkt auf Höhe des gelben Jugendstilhauses befand, in dem sie wohnten. »Wir haben einen Deal mit deiner Schuldirektorin.«
»Du meinst, du hast einen.«
»Es reicht, Marie.«
Es rumste, doch Camilla achtete nicht weiter auf den silberfarbenen Mercedes, dessen Stoßstange sie touchiert hatte. Sie stellte den Motor aus, zog den Schlüssel ab und legte die Hände aufs Lenkrad.
Marie kniff die Augen zusammen. »Voll krass. Du hast gerade das Auto gerammt.«
»Und du hast Briefe unterschlagen und meine Unterschrift gefälscht. Davon abgesehen möchte ich wissen, was du an den dreiundvierzig Tagen getrieben hast, an denen ich dachte, du drückst die Schulbank. Dreiundvierzig Tage übrigens, die ich damit verbracht habe, für unseren Lebensunterhalt zu sorgen.« Sie wusste, dass sie Marie damit noch weiter von sich wegtrieb. Doch das Mädchen reizte sie bis aufs Blut, seit es sich in ein hormongesteuertes Pulverfass verwandelt hatte, dessen Lunte von Tag zu Tag kürzer wurde.
Maries Schultern sanken herab, ein winziges Zeichen der Kapitulation. Leider erkannte Camilla zu spät, dass sie nur Anlauf nahm.
»Du willst doch gar nicht wissen, was ich gemacht hab, Camilla! Weil es dich einen Scheiß interessiert. Dich interessiert alles einen Scheiß, solange du es nicht in ein blödes Schraubglas stecken kannst!«, schrie Marie, das spitze Mausgesicht hochrot und ganz Christoph, der sich auch nie beherrschen konnte. »Lebensunterhalt, pah, dass ich nicht lache. Als ob Opa zulassen würde, dass wir uns um irgendwas sorgen müssten.«
Hektisch beugte sie sich zum Fußraum hinunter, raffte den Rucksack an sich, zusammen mit der geliebten schwarzen Lederjacke, ohne die kein Mädchen ihres Alters auskam, und stieß die Autotür auf.
Sprachlos sah Camilla ihrer Tochter hinterher, wie sie über die regennasse Straße rannte, ohne nach rechts oder links zu sehen. Eine Hupe ertönte, dann war sie Gott sei Dank auf der anderen Seite. Camilla schloss die Augen, als der Kleintransporter im Vorbeifahren eine Pfützenwasserfontäne gegen das Seitenfenster spritzte. Als sie die Augen wieder öffnete, schlüpfte Marie durch die Haustür.
»Toll gemacht«, murmelte Camilla, richtete den Rückspiegel aus und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn, wo eine blonde Locke klebte. Sie verdiente die Auszeichnung Mutter des Jahres. Mit Schleifchen.
Grimmig zog sie den Zündschlüssel ab, fischte eine Visitenkarte aus der Mittelkonsole und stieg aus dem Wagen. Die Delle, die sie an der Stoßstange verursacht hatte, war kaum sichtbar, dennoch klemmte sie die Karte pflichtbewusst hinter den Scheibenwischer des Mercedes. Dann schulterte sie die Handtasche, ein weiches Ledertier, das plötzlich an ihren Rippen vibrierte. Vor lauter Marie-Stress hatte sie vergessen, ihr Handy auf laut zu stellen.
Sie musste nicht rangehen, um zu wissen, dass sie den Kunden der Hamburger Feinkostladenkette verloren hatten, so abrupt, wie sie die Telefonkonferenz beendet hatte. Pechmarie-Tage hatte Marie solche Tage früher genannt, bloß dass es diesmal nicht um abgeschnittene Puppenhaare oder eine verlorene Lieblingsmütze ging. Um den Auftrag hatte Camilla monatelang gekämpft, er wäre ein Meilenstein für Feinkost Monhof geworden, feinstes Olivenöl aus Kreta, ein Einkaufswert von dreihunderttausend Euro. Die passende Gelegenheit, Papa zu beweisen, dass sie gut in dem war, was sie tat, obwohl kein BWL-Diplom an ihrer Bürowand hing. Stattdessen hatte sie den Lorbeerkranz der schwarzen Zahlen gegen das Gebrüll einer Fünfzehnjährigen eingetauscht, die sie neuerdings beim Vornamen nannte. Camilla hätte gelacht, wäre es nicht zum Heulen gewesen – dennoch würde sie es immer wieder tun. Für Marie.
Im Hausflur roch es nach Dosenravioli, ein Geruch, der Camilla bewusst machte, dass sie heute nur ein eilig geschmiertes Butterbrot und viel zu viel Kaffee zu sich genommen hatte. Sie leerte den Postkasten, was eigentlich zu Maries täglichen Aufgaben gehörte – normalerweise, nicht an Tagen wie diesen. Ihrer war der dritte von acht, Camillas Blick streifte ganz von selbst den Kasten daneben, weil der handgeschriebene Name frech aus der Reihe der einheitlich gedruckten Schilder tanzte.
Tobias Leitner.
Wer sonst! Sogar hier unten benahm er sich, als wäre er gerade in irgendeine x-beliebige Studentenbude gezogen.
Sie schüttelte den Kopf und erschrak, weil sich hinter ihr ein Schlüssel im Schloss drehte. Reflexartig trat sie beiseite, wobei ihr der Wochenanzeiger aus der Hand glitt. Resigniert ging sie in die Hocke, als über ihrem Scheitel Sonnenlicht und Gelächter ins Foyer fielen. Ein Mann und eine junge Frau stolperten zur Tür herein, als flüchteten sie vor einem Platzregen. Camilla sah auf, das Lächeln auf ihren Lippen gefror.
»Ah. Die Frau Nachbarin«, sagte er.
Seine blonde Begleitung, dünn und kaum älter als Mitte zwanzig, kicherte.
»Herr Leitner.« Camilla drückte die Zeitung an die Brust und die Knie durch, was sie auf Augenhöhe mit ihm brachte – obwohl sie relativ flache Pumps trug.
»War ein ziemlich schwungvolles Manöver vorhin.« Er deutete mit dem Daumen nach draußen und zwinkerte, als hätte er bei einem Klingelstreich Schmiere gestanden.
»Das … war keine Absicht.« Camilla ärgerte sich, dass sie beschämt klang. Dieser Mensch war mit Sicherheit der Letzte, vor dem sie sich verteidigen wollte. Zumal es seltsam genug war, ihm jetzt so nah gegenüberzustehen, dem Grund, weshalb sie nachts kein Auge zutat … und das bestimmt nicht, weil sie ihn attraktiv fand. Gott bewahre!
»Gehört der Mercedes etwa Ihnen?«
Natürlich eine rein rhetorische Frage, die sie mit erhobener Braue stellte. Ob sein Bart noch als Dreitagebart durchging? Wohl eher nicht. Und seit wie vielen Tagen und Nächten er wohl das ausgeleierte T-Shirt trug, das einen leicht modrigen Geruch verströmte – typisch für Klamotten, die man zu lange feucht gelagert hatte. Sie verzog das Gesicht, er tat das Gleiche, wenn auch wesentlich amüsierter.
»Sehe ich aus wie jemand, der einen Kombi fährt?« Er tippte auf den Motorradhelm, den er unter dem Arm trug, Signal für das Mädchen, erneut zu kichern.
»Tooobi und Kombi, nee, is klar«, sagte sie gedehnt, hängte sich an Tooobis Arm und musterte Camilla mitleidig.
»Schön, dass wir darüber geredet haben«, gab Camilla zurück und widerstand dem Impuls, ihren Nachbarn wegen der nächtlichen Partys anzupflaumen. Vom letzten Streitgespräch wegen der Mülltüten, die er tagelang im Hausflur deponiert hatte, klangen ihr noch heute die Ohren. Auf den Mund gefallen war der Herr Leitner jedenfalls nicht.
Betont sorgfältig schloss sie die Briefkastenklappe, unterdessen federte das Mädchen die Stufen hinauf, die Haare schwangen auf Taillenhöhe. Kurzer Rock. Sehr kurzer Rock, dazu ein ausgesprochen fragwürdiger Männergeschmack. Camilla unterdrückte ein Schmunzeln und gab vor, in einer Baumarktbroschüre zu blättern.
»Komm schon, ich hab Kohldampf.« Das Mädchen machte einen Schmollmund, der aussah wie der Zipfel eines rosa Luftballons. Der Nachbar nickte mit nachdenklichem Blick auf Camillas Finger, die sich beflissen durch die Prospektseiten raschelten. Tomatenstauden, Gartenscheren, Geranientöpfe. Zu ihrem Leidwesen machte er keinerlei Anstalten, Röckchens Aufforderung nachzukommen.
»Sie hat Hunger.« Camilla deutete mit dem Kinn nach oben, befriedigt über das winzige Zucken, das ihrer Bemerkung folgte, kaum sichtbar unter dem Bart.
Seine Schultern strafften sich. »Also dann. Wir sehen uns«, sagte er mit diesem spöttischen Lächeln, mit dem er über alles, was Camilla ärgerte, das Pflaster der Belanglosigkeit klebte. »Und grüßen Sie Marie von mir.«
Damit folgte er seiner Freundin in den zweiten Stock, polternd und zwei Stufen auf einmal nehmend.
Camilla schnaubte leise. O ja, zweifelsohne würden sie einander wiedersehen. Weil Tooobi Tür an Tür mit Marie und ihr wohnte. Und Wand an Wand, was eindeutig das größte Übel von allem war.
Nach wie vor fand sie es gewöhnungsbedürftig, nach Hause zu kommen und mit dem Duft frisch gebrühten Kaffees empfangen zu werden. Marie hatte erst vor Kurzem angefangen, welchen zu trinken, mit viel Milch und Süßstoff. An die Spüle gelehnt löffelte sie den Kaffee wie Suppe, während sie Camilla mit diesem unbehaglichen Halblächeln entgegensah, das alles überdeckte, was sie nicht aussprechen konnte. Camillas Sternebecher wartete unter dem Auslass des Kaffeevollautomaten, bis jemand den Knopf drückte.
So war es immer. Auf den Sturm folgte Stille mit der wortlosen Gefälligkeit, Maries Art, Missstimmungen ad acta zu legen, ohne sich entschuldigen zu müssen – und jedes Mal rührte Camilla die kleine Versöhnungsgeste, ob sie wollte oder nicht. Langsam zog sie die Strickjacke aus, hängte sie an den Garderobenhaken und schlüpfte aus den Pumps.
Hinter der Wand schepperte es, nichtein Topfdeckel, sondern wahrscheinlich gleich mehrere, die auf Küchenfliesen fielen, lautes Gelächter folgte. Funkstille, dann rumste es erneut, wieder das schrille Mädchengekreische. Danach blieb es verdächtig still auf der anderen Seite.
Camilla verdrehte die Augen. Barfuß ging sie in die Küche, wo sie die Handtasche auf einen Stuhl stellte und an ihrer Tochter vorbei die Kaffeetaste drückte. Sie spürte Maries Nervosität wie elektrische Spannung, ohne den mageren Körper berühren zu müssen, der sich in einem Stadium befand, in dem er noch unentschlossen war, ob er die weichen Rundungen einer Frau wirklich haben wollte.
Mit dem Becher kehrte sie an den Tisch zurück, um die Tasche auszupacken, das Smartphone, die Unterlagen des Hamburger Kunden, den Terminkalender. Marie verlagerte das Gewicht von einem auf den anderen Fuß. In allen Farben besaß sie diese klobigen Sneakers, zog jedoch nur dieses eine Paar an, rosa mit lila Streifen. So unverzichtbar wie die Lederjacke, die sie selbst im Haus trug wie eine zweite Haut.
»Es gibt Salat mit Schafskäse«, sagte Camilla. Ihr Handy zeigte etliche verpasste Anrufe an, dazu drei Nachrichten. Zwei von ihrer Sekretärin Nora, eine von ihrem Vater.
»Aber ich will heute keinen Salat«, murrte Marie.
Das Telefon klingelte. Papas Foto erschien auf dem Display, darunter der Name, den sie in Großbuchstaben eingegeben hatte, warum auch immer. PETERMONHOF.
»Ich bin kein Restaurant, Marie.« Camilla überlegte, ob sie das Gespräch annehmen sollte. Sie schielte zu Marie hinüber, die das Smartphone in Camillas Hand förmlich hypnotisierte. Ihre schwarz umrandeten Augen waren dunkel, traurig. Und wütend – wütend waren sie auch.
»Stimmt. Ein Restaurant bist du wirklich nicht, Camilla«, konterte sie. »Aber du hättest eins haben können, wenn du nicht alles versaut hättest!«
Maries Becher knallte in die Spüle, Camilla atmete scharf ein, spürte die Zornesfalte in der Stirnmitte. Das Telefon läutete unbeirrt weiter, während Marie durch den Flur rannte. Kurz darauf schlug die Zimmertür hinter ihr zu, ebenso anklagend wie das, was sie gerade herausgeschrien hatte, das rote Do-not-disturb-Schild schwang hin und her. Die finale Kirsche auf der Torte ihres Protests.
Kopfschüttelnd wandte Camilla sich der Balkontür zu, stupste lustlos das grüne Display an.
»Hallo, Papa. Ich bin jetzt zu Hause und komme heute nicht mehr in die Firma, weil ich gleich noch etwas mit Marie klären muss«, sagte sie übergangslos in die Sprechmuschel. Ihr Blick glitt an den verdorrten Petunien im Balkonkasten vorbei zum Pflanzkübel in der Ecke. Wenigstens das Olivenbäumchen sah beruhigend gesund aus und trug sogar ein paar erbsengroße Früchte. »Die Maifeld-Unterlagen habe ich mitgenommen. Ich rufe den Einkaufsleiter gleich an, krieche zu Kreuze und tüte den Auftrag von hier aus ein. Tut mir leid, dass ich so kopflos aus der Besprechung …«
»Luft holen«, unterbrach sie die Stimme am Telefon. Es war fast unheimlich, wie der sachlich-väterliche Ton sie gehorsam einatmen ließ. »Geht es Mariechen gut?«
»Du weißt, dass gut gehen bei ihr derzeit relativ ist«, antwortete sie spitz.
»Was hat sie angestellt?« Papa klang belustigt, das tat er immer, wenn es um Mariechens Eskapaden ging.
»Sie hat versucht, die Schule abzufackeln«, sagte sie in der stillen Hoffnung, dass er so etwas wie Unwillen über seine einzige Enkeltochter äußerte. Dass er nur ein Mal ihrer Meinung war.
Er lachte. Laut und dröhnend, sie musste den Hörer vom Ohr weghalten. »Das ist nicht witzig, Papa. Geschwänzt hat sie auch, sie wird von der Schule fliegen.«
»Sie ist fünfzehn.«
»Zu jung, um sich das Leben zu ruinieren«, schnappte sie und fühlte sich missverstanden. Schon wieder.
Jetzt schwieg er. Zeit für sie, sich auf sicheres Terrain zu begeben, eines, das nur halb so schlüpfrig war wie das Mutterparkett.
»Übrigens habe ich mir am Vormittag die Lieferantenliste und die betriebliche Auswertung des letzten Geschäftsjahres angesehen. Dabei ist mir aufgefallen …« Sie räusperte sich für den heiklen Teil. Jenen Teil, den Peter Monhof garantiert nicht hören wollte. »Wir generieren mit dem provenzalischen Honiglieferanten keinerlei Gewinn. Die Einkaufspreise des Franzosen sind höher als die Verkaufspreise der anderen, der Zwischenhandel lohnt sich nicht für die Firma. Ich denke, wir sollten deshalb …«
»Ich diskutiere nicht über diesen Lieferanten.«
»Wie bitte?« Camilla schnappte nach Luft, weniger aus Überraschung, was, sondern wie er es gesagt hatte. Als hätte sie ihm den unerhörten Vorschlag gemacht, mal eben kurz die Sonne auszuknipsen.
»Du hast mich schon verstanden. Die Honigmanufaktur in Loursacq ist tabu für deinen Rotstift.« Freundlich, aber entschieden. Sein letztes Wort, egal wie logisch und fundiert ihre Argumentation daherkam.
»Aber ich …«
»Camilla. Warum machst du nicht einfach mal Feierabend?« Er sprach mit ihr, als wäre sie wieder fünfzehn Jahre alt. So alt wie Marie, auch wenn Camilla ein völlig anderes Kind gewesen war, ein glücklicheres Kind, dem alles zugeflogen war. Eines, das beide Eltern hatte. Ihre Kehle verengte sich. Drei Jahre. Und noch immer war alles so schrecklich verfahren.
»In Ordnung«, erwiderte sie und auf einmal waren sie da, die Schuldgefühle, die sie monatelang verdrängt hatte. Sie war eine furchtbare Mutter, ob nun mit oder ohne Schleifchen.
»Der Hamburger Kunde kann sich bis morgen gedulden. Familie geht vor, also kümmere dich bitte um deine Tochter, Camilla. Denn egal, was sie sagt oder tut, Marie braucht dich.«
Wenn du wüsstest! Noch lange nachdem sie sich kleinlaut von Papa verabschiedet hatte, presste sie die Lippen aufeinander. Damit das Unvorstellbare nicht doch noch hinausdrängte, sondern in ihrem Kopf blieb, in der Schublade mit den verbotenen Gedanken. Und in ihrer Brust, wo es ohnehin schon alles zusammendrückte, was weich und nachgiebig war. Denn Marie brauchte sie nicht. Sie brauchte ihren Vater.
Stunden später stand Camilla an dem Bett, in dem ihre Tochter schlief. Der Abend war ein Desaster gewesen, das mit vorsichtigen Tönen und unverfänglichen Themen am Esstisch begonnen hatte. Möchtest du Brot zum Salat? Mehr Käse? Tomaten? Maries Antworten blieben einsilbig, ihre Stimme klang wund gescheuert vom Weinen. Die über den Küchentisch hinweg ausgetauschten Floskeln besaßen etwas Trügerisches, als wären sie ein harmloser Nieselregen, der kurz vor dem richtigen Gewitter einsetzte. Das unweigerlich folgte, mit Blitz und Hagelschlag, sobald Camilla das Gespräch auf die Schule lenkte. Wieder Geschrei, Tränen.
Gähnend langweilig ist der Unterricht! Du verstehst mich einfach nicht, keiner tut das, außer Opa vielleicht, aber der hält sich ja aus allem raus. Ich ziehe zu Papa, das hast du dann davon!
Noch mehr Krokodilstränen, dazu herzzerreißende Schluchzer, denen Camilla nur ein schwaches Lächeln entgegenzusetzen wusste – und die oft gestellte Frage, wo ein Spitzenkoch in seinem Vierzehnstundentag eine Fünfzehnjährige unterbringen sollte.
Am Ende hatte sie ihrer Tochter mühsam das Versprechen abgerungen, es wenigstens zu versuchen. Freiwillig gab Marie nicht nach, erst nachdem Camilla ihr angedroht hatte, Sylt zu streichen. Kein Papa-Urlaub beim Jetset im schicken Sternerestaurant, Surfen und Reiten am Strand, Selfies mit irgendwelchen Millionärstöchtern. Stattdessen Nachhilfeunterricht in Mathe, Chemie und Physik. Camilla fühlte sich schlecht deswegen, doch vielleicht musste man sich schlecht fühlen, wenn man als Mutter den Sieg davontrug.
Sie betrachtete ihr Kind im Halbdunkel der Nachtlampe, einem Clown mit orangefarbenem Bauch, der sie schon als Dreijährige in die Traumwelt begleitet hatte. Bis heute wollte Marie nicht im Dunkeln einschlafen, immer musste irgendwo ein Licht brennen, der Clown oder wenigstens eine spaltbreit geöffnete Tür, durch die das Flurlicht hereinschien.
Ihr Gesicht war vom Weinen gerötet, aber es sah friedlich aus, kindlicher als sonst. Camillas Herz weitete sich. Die Lederjacke lag wie ein schwarzer Hund auf der Sommerdecke am Fußende des Bettes. Zärtlich fuhr sie über das Leder, als steckte Marie noch darin. Durch das geöffnete Fenster hörte sie die Stimme des nächtlichen Münchens, Autos, die Straßenbahn. Gedämpftes Geplauder drang vom Schwabinger Wassermann herauf, wo die Leute bis zur Sperrstunde auf dem Gehsteig saßen und den Sommer feierten. Wann bin ich eigentlich das letzte Mal ausgegangen? Camilla seufzte. Sie hatte keine Lust, sich allein an einen Bistrotisch zu setzen, während sich an den Nachbartischen verliebte Paare tief in die Augen schauten oder Händchen haltend vorbeischlenderten. Vielleicht würde sie sich später auf dem Balkon ein Weißbier gönnen, oder besser einen Chardonnay – auch wenn es schwerfiel, sich die Zigarette dabei wegzudenken.
Selbst um diese Uhrzeit blinkte Maries Handy auf dem Nachttisch und zeigte neue Nachrichten an. Camilla verwarf den Gedanken, sie zu lesen, küsste Marie auf die Stirn, vorsichtig und mit der heimlichen Angst, sie zu wecken. Im Hinausgehen sammelte sie ein paar Klamotten vom Boden auf, wobei ihr Blick über die Hundeposter an der Wand glitt. Ein Labradorwelpe blinzelte über den Körbchenrand, ein Husky sprang ins Zimmer hinein. Dazwischen hing ein halb nacktes, melancholisches Bürschchen. Keine Ahnung, wer der Kerl war und womit er sich den Platz in der Bravo verdient hatte. Auf dem Schreibtisch herrschte ein einziges Durcheinander aus Hundezeitschriften und Schulheften, garniert mit Puderdosen, Lippenstiften, benutzten Wattepads.
Kein Zentimeter Platz zum Arbeiten, dachte Camilla und überlegte, wann sie Marie zuletzt an irgendwelchen Hausaufgaben gesehen hatte. Wieder pikste sie das Schuldgefühl, sachte, aber hinterlistig gemein, mittig zwischen Magen und Brust. Lautlos zog sie die Tür hinter sich zu, achtete jedoch darauf, sie nicht zu schließen. Wegen des Lichtstrahls.
Sie duschte lauwarm und schlüpfte nackt in das kühle Seidennachthemd, das die Hitze der Hochsommernacht erträglicher machte. Den Chardonnay ließ sie im Kühlschrank, die Müdigkeit war wieder einmal drängender. Vom Bad aus tappte Camilla in das Zimmer mit der einzigen Tür, die man in dieser Wohnung nicht mit voller Wucht zuknallte, kroch unter das Laken und löschte das Licht.
Minuten später riss sie die Augen auf.
Die Wände bebten, sie spürte es, als sie die Handfläche auf die Tapete legte, um sich zu vergewissern, dass sie nicht träumte. Rapmusik, Gelächter und Möbelrücken auf Parkett. Nicht von unten, wo der Kellner die Stühle auf dem Bürgersteig zusammenstellte, behutsam, aus Rücksicht auf die Nachbarschaft. Der Lärm kam eindeutig von nebenan, wo ihr unseliger Nachbar offenbar die Party seines Lebens feierte. Die dritte in dieser Woche.
Ein Glas zerschellte, kommentiert von einem mehrstimmigen und unverkennbar alkoholisierten »Ich hab meine Posse bei mir«. Der schiefe Gesang dröhnte ihr in den Ohren, als befände sich lediglich eine Spanplatte zwischen den beiden Wohnungen. Stöhnend vergrub Camilla das Gesicht im Kissen.
Hatte sie tatsächlich gedacht, Marie wäre ihre schwerste Geduldsprüfung? Falsch gedacht, madame. Dieser Punkt ging eindeutig an Tobias Leitner.
Zwei
»Ich soll nach Frankreich fahren? Wieso das denn?«
Gereizt spielte Camilla mit dem Bleistift, der Versuch, ihn zwischen den Fingern wandern zu lassen, misslang ihr gründlich. Zu müde für eine Reaktion sah sie zu, wie der Stift über den Schreibtisch davonrollte und auf das Parkett fiel.
»Das ist doch völliger Blödsinn«, sagte sie finster in Richtung Fenster, wo Papa mit verschränkten Armen am Sims lehnte, eingerahmt von einem nahtlos blauen Himmel. »Als ob ich mich persönlich davon überzeugen müsste, dass der Franzose eine unterirdische Preispolitik betreibt. Sein Honig ist völlig überteuert, außerdem liefert er weder termingerecht noch die vereinbarten Mengen.«
»Es geht nicht immer nur um Zahlen.« Peter Monhof starrte unbeeindruckt auf die Excel-Tabelle, die Camilla in die Höhe hielt wie ein Gerichtsurteil. »Lambert liefert. Solange er das tut, werden wir unseren Kunden die Produkte seiner Manufaktur ganz sicher nicht vorenthalten. Pfeif auf den Gewinn.«
»Wir haben ein Unternehmen, Papa.«
»Du meinst, ich habe ein Unternehmen. Ein Feinkostunternehmen übrigens, das seit Generationen eine Philosophie lebt, die du offensichtlich noch verstehen lernen musst. Manche Dinge kann man nicht bewerten, indem man ein Blatt Papier aus dem Drucker zieht. Lamberts Honig mag mehr kosten, dafür ist er auch um Klassen besser als das Zeug aus diesen Massenbetrieben. Davon solltest du dich mit eigenen Augen überzeugen, statt dich mir nichts, dir nichts von einem Geschäftspartner zu trennen, auf den schon dein Großvater geschworen hat.«
Eine verbale Ohrfeige, die direkt auf Camillas Selbstbewusstsein zielte – und traf. Sie ballte die Faust unter dem Tisch, wo Papa es nicht sah.
»Soll das eine Anweisung sein? So von Chef zu Angestellter?«, fragte sie, gereizt, weil ihr mal wieder aufging, von wem Marie ihren Starrsinn geerbt hatte.
»Es ist eine Bitte. Von Vater zu Tochter.« Er löste sich vom Sims und ging auf Camillas Schreibtisch zu.
Peter Monhof war ein großer weißhaariger Mann mit geradem Rücken, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Ebenso aufrecht wie seine Haltung war sein pottascheblauer Blick, der nun über die Bilanzordner und die Herstellerkataloge glitt, deren Seiten Camilla mit bunten Klebezetteln versehen hatte, und schließlich auf dem Bilderrahmen neben dem Laptop verweilte. Camilla und Marie, auf dem Foto war seine Enkelin erst ein paar Monate alt. Ein Schnappschuss, entstanden in einem staunenden Moment des Glücks.
Sie schluckte, weil die Erinnerung wehtat. Und weil das zufriedene Baby in ihren Armen nichts mit dem zornigen Persönchen gemein hatte, das heute früh die Eingangstreppe zum Schulgebäude hinaufgetrottet war, flankiert von zwei steinernen Löwen, die darüber wachten, dass sie auch wirklich hineinging. Kein Abschiedsgruß, erst recht kein letzter Blick zurück zum Auto, ehe ihre Tochter von den altehrwürdigen Mauern verschluckt wurde.
»Wann hast du eigentlich das letzte Mal Ferien mit Marie gemacht?«, fragte Papa zusammenhanglos in das Schweigen, das sich über den Raum gelegt hatte wie eine Wolldecke, die alles dämpfte, was sonst laut geworden wäre.
Camilla stierte auf die Excel-Liste, als wäre sie der einzige Ankerpunkt in ihrem Leben. Was zweifellos stimmte, denn Feinkost Monhof war ihre große berufliche Chance, nachdem sie ihr halbes Leben in Christophs sternefunkelndem Schatten gestanden hatte. Ihr Neuanfang, den sie bis dato nicht gerade gut hinbekam, wenn man der leisen Enttäuschung in Peter Monhofs Augen glaubte. Umso dringlicher wollte Camilla ihm beweisen, dass sie das Unternehmen revolutionieren konnte. Die Produkte des Delikatessengroßhandels sollten in Zukunft nicht nur sprichwörtlich in aller Munde sein.
»Ich brauche keinen Urlaub«, antwortete sie nach einer kleinen Ewigkeit, gekränkt, weil die Frage wie eine inoffizielle Kündigung geklungen hatte.
»Das habe ich auch nicht behauptet. Doch die Sommerferien beginnen bald, und ein wenig gemeinsame Zeit würde euch beiden sicher guttun. Die Provence ist wunderbar, wir waren früher öfter da, aber daran erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr.« Peter Monhof rieb sich den Bart zwischen gespreiztem Daumen und Zeigefinger, eine für ihn typische Geste. »Du könntest den Urlaub mit einem Besuch in Loursacq verbinden. Betrachte es meinetwegen als Geschäftsreise, die neben der Inspektion von Lamberts Manufaktur eine Gelegenheit böte, um Marie näherzukommen.«
»Um ihr näherzukommen?« Sie kniff die Augen zusammen. Über sein sonnengebräuntes Gesicht war ein Schatten gehuscht, den sie als Sorge deuten würde – hätte sie ihn nicht besser gekannt. Papa sorgte sich nie, was eben genau das Problem war. »Was willst du damit sa…«
Erschrocken fuhr sie zusammen, als Nora die Tür aufriss. Ihre Sekretärin war kein Mensch, der sich leicht aus der Ruhe bringen ließ, vor allem vergaß sie niemals anzuklopfen. Kaum verwunderlich, dass Camillas Puls sich beschleunigte, während die junge Frau angestrengt blinzelnd auf der Türschwelle stand und offenbar vergessen hatte, was sie sagen wollte.
Camillas ungute Vorahnung bestätigte sich, als Marie sich an Noras gestreifter Bluse vorbeidrückte, die Schultern hochgezogen, das Gesicht genauso kalkweiß wie Noras, aber nicht so durcheinander, o nein. Ihre Tochter wusste anscheinend genau, warum sie in diesem Moment ins Büro ihrer Mutter schlich, obwohl sie eigentlich woanders sein sollte. Automatisch sah Camilla auf die Wanduhr. Es war kurz vor Mittag und damit lange vor Schulschluss. Verdammt.
Sie tauschte einen Blick mit Papa, der fragend eine Braue hob. Dann ging sie steif auf die beiden fremden Männer zu, die mit ernsten Mienen hinter Marie das Büro betreten hatten. Sie trugen Uniform.
»Wo, sagten Sie gleich noch mal, haben Sie meine Tochter gefunden?« Camilla war, als befände sie sich unter Wasser. Anders konnte sie sich nicht erklären, weshalb die Worte des Polizisten nichts als ein dumpfes Dröhnen waren, das von sehr weit her zu kommen schien. Als ob er gar nicht im Zimmer wäre.
Der Beamte schielte zu seinem älteren Kollegen hinüber, der mit hinter dem Rücken verschränkten Händen vor Camillas Whiteboard stand und die Kundenanalyse begutachtete. Seit bestimmt fünf Minuten tat er das schon, obwohl er sicher nicht wusste, was er da vor sich hatte.
»Wir haben sie im Englischen Garten am Monopteros aufgegriffen«, wiederholte der Polizeibeamte. »Sie fiel uns bei der Personenkontrolle einiger Obdachloser auf, weil sie sich nicht ausweisen konnte und versucht hat wegzulaufen.«
»Er hat mir wehgetan«, schallte es vorwurfsvoll von der Sitzecke herüber, wo Marie sich demonstrativ den Arm rieb.
»Irgendwie mussten wir dich ja festhalten, junge Dame. Falls es dich tröstet, meine Rippen werden sich bestimmt noch ein paar Tage an deinen Ellenbogen erinnern.« Der Beamte zeigte ein schiefes Jungenlächeln, das ihn beinahe sympathisch wirken ließ, wären da nicht das gewaltsam gescheitelte Haar und die Polizeiuniform gewesen.
»Obdachlose.« Camilla sah wie betäubt zu Marie hinüber, die ihren Blick trotzig erwiderte.
»Das sind Freunde von mir. Sie haben Hunde. Ich krieg ja keinen … Dabei findet Tobias auch, dass ein Hund eine prima Sache für mich wäre.«
»Tobias?« Camilla fixierte die Vase auf dem Couchtisch, während das Wort wie ein Wurm am Haken zappelte. »Welcher Tobias?«
»Na, unser Nachbar. Der ist auch ein Freund von mir. Wenn du mir ab und an mal zuhören würdest, dann wüsstest du das auch.«
Was erzählt sie da? Die Vase verschwamm vor Camillas Augen, doch was da unvermittelt in ihr hochkochte, ließ sich nicht kontrollieren. Tobias Leitner.
»Herrgott, Marie, es ist mir völlig egal, was dieser Taugenichts meint! Wir hatten eine Abmachung.« Angespannt schielte sie zu ihrem Vater hinüber, der am Schreibtisch Platz genommen hatte und das Gespräch stirnrunzelnd verfolgte.
Marie blies die Backen auf. »Ich erinnere mich bloß, dass du mich erpresst hast … mit Papa. Total mies.«
Der junge Beamte räusperte sich. »Es ist ja nichts passiert. Noch nicht. Vielleicht achten Sie zukünftig darauf, mit wem Ihre Tochter Kontakt hat, Frau Monhof. Davon abgesehen, dass sie vormittags in der Schule sein sollte, sind diese Leute nicht unbedingt der geeignete Umgang für eine Minderjährige.«
Er zog ein zigarettenähnliches Stäbchen aus der Jackentasche und hielt es ihr zwischen Daumen und Zeigefinger entgegen. Ein Joint. Zweifelsfrei, auch wenn sie schon länger keinen mehr gesehen hatte.
»Was denn?« Maries Gesicht glühte. »Ich rauch das Zeug ja nicht.« Und nach einer winzigen, abwägenden Pause: »Schmeckt nämlich scheiße.«
»Marie!« Camilla schnappte nach Luft.
»Das genügt.« Es war Papa, der sich nun umständlich aus Camillas Bürosessel schälte, um diesem peinlichen Gespräch ein Ende zu bereiten. Gut für Camilla, der es unmöglich war, den Polizeibeamten in die Augen zu schauen. »Vielen Dank, dass Sie sich um meine Enkelin gekümmert haben, meine Herren. Alles Weitere klären wir im Kreis der Familie.«
Es war faszinierend zu sehen, was die leise Stimme des Mannes bewirkte, der seinen Maßanzug trug wie die Beamten ihre Uniform. Marie schrumpfte auf der Couch zusammen, die Gesetzeshüter strafften die Schultern und verabschiedeten sich höflich.
Der ältere Beamte hielt im Hinausgehen inne. »Sehr interessant übrigens, dieses Kundenanalysediagramm.« Er deutete auf das Whiteboard und grinste Camilla an, die perplex zurücklächelte, obwohl ihr nun wirklich nicht zum Lachen zumute war. Dann verließ er hinter seinem Kollegen das Büro, die Hände noch immer auf dem Rücken, als wären sie dort festgebunden.
»Ich verstehe dich nicht, Marie.«
»Erzähl mir was Neues, Camilla. Und jetzt mach die Tür auf, sonst fange ich an zu schreien. Dann bist du wegen Freiheitsberaubung dran.«
Die Situation wäre zum Totlachen, wäre Camilla nicht so verzweifelt. Wieder saßen sie im Auto, diesmal rund hundert Meter von dem gelben Haus mit der Nummer 82 entfernt. Sie musterte ihre Fingerknöchel – weiß hervortretende, schroffe Felsen am Lenkrad – und fragte sich, was es über sie aussagte, dass sie ihre Tochter mittels Kindersicherung im Auto einsperren musste, um mit ihr sprechen zu können.
Marie rutschte auf dem Sitz herum, ihre Augen rasterten unruhig das Innere des Minis: das Armaturenbrett, das Sorgenfresserchen, das am Rückspiegel baumelte, den nutzlos gewordenen Türöffner. Dann schaute sie auf den Gehweg wie ein Äffchen im Käfig, das am liebsten die nächstbeste Passantenhand ergreifen und mitgehen würde. Seit Christoph sie einmal versehentlich in der Besenkammer eingesperrt hatte, waren enge geschlossene Räume ein Problem für sie. Aber welche Wahl hatte Camilla schon?
»Keine Sorge, ich lass dich bestimmt nicht hier drin übernachten … vorausgesetzt, wir finden eine Lösung für das Problem.«
»Also, ich hab kein Problem. Bei dir bin ich mir da allerdings nicht so sicher«, versetzte ihre Tochter und sah sie endlich an, aus geröteten Augen, die Pupillen fast unheimlich geweitet.
Camillas Herz setzte aus. »Sag mal, bist du high?«
»Nein, ich bin höchstens ein bisschen bekifft. Das ist es doch, was du hören willst, oder?«
»Mensch, jetzt sei nicht so verdammt pubertär!«
»Sagt die, die in den Wechseljahren ist.«
»Marie …« Camillas Stimme bröckelte. »Wir sollten wirklich nicht in diesem Ton miteinander reden. Davon abgesehen bin ich vierunddreißig, da ist man noch lange nicht in den Wechseljahren.«
»Umso schlimmer«, ätzte Marie und kramte in ihrem Rucksack. »Ich hab eben keinen Bock auf diese total antiquierte Schule. Meinetwegen kannst du dich auf den Kopf stellen, ich geh da nicht mehr hin. Tobias sagt …«
»Und warum nicht?«, unterbrach Camilla sie. »Was ist passiert?«
Maries Augen flackerten, eine Antwort gab sie nicht. Stattdessen fand sie, was sie gesucht hatte, steckte sich die Ohrstöpsel ihres iPods in die Ohren und stellte die Lautstärke höher, bis Camilla den provokanten Text des Rapsongs verstehen konnte. Kein Wunder, dass Marie sich mit ihrem Nachbarn verstand. Offenbar hatten sie denselben Musikgeschmack.
Camillas Reaktion erfolgte rein instinktiv und zu schnell, um vorher abwägen zu können, ob sie klug war. Ihre Hand schoss nach vorn und riss das Kabel aus Maries Ohren.
»Hey! Was machst du da?« Marie fuhr herum und machte Anstalten, sich auf Camilla zu stürzen.
Blitzschnell drückte sie das Mädchen in den Beifahrersitz zurück, ließ das Seitenfenster herunter und warf den Kopfhörer samt dem daran baumelnden iPod hinaus.
»Ich versuche, mit dir zu reden, aber das kann ich nicht, wenn du diese Dinger im Ohr hast.«
»Du hast meinen iPod weggeschmissen!«
»Der Zweck heiligt die Mittel, wie dein Großvater sagen würde. Zukünftig wirst du einen Bogen um den Englischen Garten machen, damit das klar ist. Ich verbiete dir, mit diesen Leuten abzuhängen, selbst wenn sie einen ganzen Hundezirkus halten«, gab Camilla ruhig zurück, obwohl ihr Puls raste. Ergab es Sinn, Marie zu sagen, dass ihr dieser Kampf gerade genauso wehtat? Dass sie ihr kleines, zorniges Mädchen viel lieber in den Arm nehmen und trösten wollte? »Außerdem möchte ich nicht, dass du mich beim Vornamen nennst. Ich bin immer noch deine Mutter.«
Marie zitterte jetzt am ganzen Leib. Ungläubig öffnete sie den Mund und schloss ihn wieder, ein machtloser Stichling im Glas, der furchtbar dringlich zurück zu seinem Schwarm wollte.
»Ich hasse dich«, murmelte sie mit erstickter Stimme und hielt sich die Ohren zu. »Ich hasse dich, Camilla!«
Ein metallisches Klacken gab sie frei. Benommen sah Camilla auf ihre Hand, auf den Finger, der die Kindersicherung entriegelt hatte. Wortlos stieß Marie die Autotür auf und lief davon.
Sechsundneunzig Stufen waren es in den vierten Stock, beleuchtet von acht Stahllaternen aus satiniertem Glas. Die Pfeiler des Geländers hatte sie nie gezählt, die Steinfliesen, die Tobias Leitners Tür von ihrer trennten, auch nicht. Vor der Nachbarwohnung standen seit heute früh zwei Kästen mit leeren Weizenflaschen, der Geruch nach schalem Bier hatte sich auf der kompletten Etage ausgebreitet.
Mit einer verwaisten Wohnung hatte Camilla zwar gerechnet, die Stille kroch ihr dennoch unter die Haut. Sie drückte die Tür zu, behutsam und mit dem Bedürfnis, dem Geschrei der letzten halben Stunde etwas Leises, Sanftes entgegenzusetzen. Erschöpft lehnte sie sich an die Raufasertapete im Flur, ihre Hand beschützte den iPod, den sie unversehrt von der Straße aufgelesen hatte.
Ob sie Marie suchen sollte? Weit konnte das Mädchen nicht sein, wahrscheinlich war sie in den Englischen Garten gelaufen.
Ich muss sie holen.
Natürlich musste sie das.
Warum, zum Teufel, fühlte sie sich dann wie mit dieser Wand verwachsen, dankbar für jede Sekunde, die sie allein war? Reiß dich zusammen, beschwor sie sich. Einen Kaffee nur, danach würde sie sich sofort ins Auto setzen und …
Überrascht hielt sie im Flur inne, als sie aus dem Kinderzimmer Maries Stimme und gedämpftes Gelächter vernahm. Hin- und hergerissen zwischen Entrüstung und maßloser Erleichterung umfasste sie die Klinke. Marie war also hier, fröhlich plaudernd am Telefon, als wäre alles in bester Ordnung.
Camilla holte Luft, ließ im Ausatmen zuerst ihren Zorn, dann die Türklinke los. Diesmal würde sie nicht vorschnell handeln. Sie brauchte bloß ein wenig Geduld und … Zeit. Sie überlegte, fischte schließlich ihr Mobiltelefon aus der Handtasche und stammelte auf dem Weg zur Küche eine Lüge auf den Anrufbeantworter des Mariengymnasiums. Magen-Darm, ganz plötzlich, das volle Programm, wirklich schlimm. Eine Galgenfrist für ihre Tochter. Vielleicht auch für sie selbst.
Zehn Minuten später stützte Camilla sich auf die Balkonbalustrade, den Sternebecher in der Hand, und betrachtete die kaminbesetzten Dächer Schwabings, dem Stadtteil ihrer Kindheit, den sie über alles liebte. Breite, gepflegte Straßen unter dem Blättergewölbe ausladender Linden, restaurierte Altbauten. Darüber der Sommerhimmel, der ihr demonstrativ vor Augen führte, dass er im Gegensatz zu ihr mit allen Trübsalwolken gründlich aufgeräumt hatte.
Camilla nippte an dem Kaffee und verzog das Gesicht, weil das Handy in ihrer Jackentasche vibrierte. Welch launische Macht auch immer in ihrem Leben derzeit das Sagen hatte, sie gönnte ihr nicht mal eine Verschnaufpause. Mit geschürzten Lippen musterte sie das Display. Eine Nachricht von Christoph. Er schrieb nur noch Kurznachrichten, seit jedes zweite Telefonat in irgendeinem hanebüchenen Streit endete, weil sie sich, was Marie betraf, in nichts einig waren. Andere Themen vermieden sie sowieso tunlichst, sein Haus mit Meerblick, das zweite Restaurant, das er eröffnete. Seine Souschefin Katja und ihren kleinen Sohn.
Camilla las die SMS. Nicht nur einmal, sondern gleich dreimal, weil sie zunächst nicht glauben wollte, was da stand.
Kann Marie diesen Sommer nicht nehmen. Probleme mit der Baustelle in Kampen, hier geht alles drunter und drüber. Sag der Maus, es tut mir leid. C.
Vorsichtig, als befände sich ein Zeitzünder darin, legte Camilla das Telefon auf den Mosaiktisch, die Tasse stellte sie im Pflanzkasten ab, mitten in das vertrocknete Petuniennest.
»Verdammt«, murmelte sie und dachte an Maries pinkfarbenen Trolley, der seit einer Woche gepackt im Flur stand. »Verdammt, verdammt!«
»Schlechte Nachrichten?«, fragte eine Stimme vom Nachbarbalkon, sie klang träge, aber ausgesprochen gut gelaunt.
Natürlich, was sonst. Es gab diese Menschen, Paradiesvögel und ewige Strandtänzer, deren Leben eine einzige Kirmes war. Nicht dass sie sich daran störte – sofern der Prototyp nicht ausgerechnet nebenan wohnte.
Camilla drehte den Kopf, langsam und in der Hoffnung, ihren Gesichtsausdruck schnell genug anpassen zu können.
»Ich wüsste nicht, was Sie das anginge, Herr Leitner.« Kühl musterte sie ihren Nachbarn über die viel zu niedrige Trennwand hinweg.
Er lag in Shorts und Feinrippshirt im Liegestuhl, die Hände im Nacken verschränkt, ein Buch auf dem Bauch, in dem er offensichtlich nicht las – zumindest nicht in diesem Moment. Das Lächeln am Fuße der Leiter von Henry Miller. Camilla hob die Brauen, bemerkte Tobias Leitners durchdringenden Blick und schaute rasch weg. Ging dieser Mensch denn nicht arbeiten?
»Ich weiß zwar ebenfalls nicht, was Sie das angeht, Frau Monhof. Aber die Antwort lautet: Doch, ich arbeite. Andauernd sozusagen.«
»Das war nicht so gemeint. Ich habe nur …« Camillas Wangen brannten. Peinlich berührt griff sie nach der Kaffeetasse und zuckte zurück, weil sie etwas Kleines, Lebendiges berührt hatte. Die Biene rutschte vom Henkel und krabbelte desorientiert auf der trockenen Erde des Balkonkastens herum.
»Sie haben bloß laut gedacht, schon klar.«
Camilla starrte die Biene an. Warum fliegt das Tier nicht weg, Herrgott noch mal?
Ihr Nachbar legte das Buch beiseite und hievte seinen drahtigen Körper geradezu provokant umständlich aus dem Liegestuhl. Instinktiv wich sie zur Seite wie ein nervöses Pferd, als er sich neben sie ans Geländer lehnte und den silbrig geschuppten Horizont aus Dächern betrachtete. Irgendwo unter ihnen schlug eine Tür und sperrte das Kläffen eines Hundes ein.