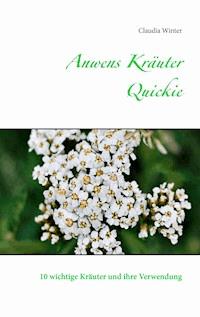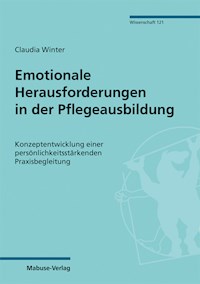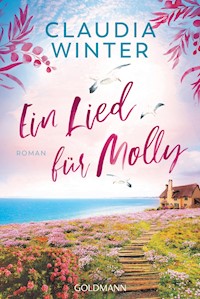
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 28-jährige Bonnie Milligan lebt mit ihrem kleinen Sohn Josh in Dublin. Eines Tages entdeckt sie im Bus ein Bündel handschriftlicher Musiknoten. Spontan fasst sie den Entschluss, den Besitzer ausfindig zu machen. Ihre Nachforschungen nach dem geheimnisvollen Komponisten führen sie an die Westküste Irlands, wo sie in einem malerischen Ort am Meer auf eine Reihe eigenwilliger Charaktere stößt – und ohne es zu ahnen, auf ein lange verborgenes Familiengeheimnis. Der Schlüssel dazu scheint ein Liebeslied für eine Unbekannte zu sein, das auf magische Weise auch für Bonnies Leben eine ganz besondere Bedeutung erhält ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Die 28-jährige Bonnie Milligan lebt mit ihrem kleinen Sohn Joshua in Dublin. Eines Tages entdeckt sie im Bus ein Bündel handschriftlicher Musiknoten. Spontan fasst sie den Entschluss, den Besitzer ausfindig zu machen. Ihre Nachforschungen nach dem geheimnisvollen Komponisten führen sie an die Westküste Irlands, wo sie in einem malerischen Ort am Meer auf eine Reihe eigenwilliger Charaktere stößt – und ohne es zu ahnen, auf ein lange verborgenes Familiengeheimnis. Der Schlüssel dazu scheint ein Liebeslied für eine unbekannte Frau zu sein, das auf magische Weise auch für Bonnies Leben eine ganz besondere Bedeutung erhält …
Weitere Informationen zu Claudia Winter und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Claudia Winter
______________________
Ein Lied für Molly
Roman
OriginalausgabeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe Mai 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Umschlaggestaltung: buxdesign GbR
Umschlagmotiv: buxdesign | Lisa Höfner unter Verwendung von Motiven von © GettyImages/Rob Tilley, GettyImages/ Roberto Moiola/Sysaworld, Getty Images/Carol Avila/EyeEm, Shutterstock und buxarchiv
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-23613-7V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Moni. Regentänzerin, Kämpferherz.
Eine gute Geschichte kann alles ändern.
Claudia Winter
Prolog
__________________
__________________
CAMPBELL PARK SCHOOL. DUBLIN, SEPTEMBER 2001.
Robert.
Die Frau war zunächst nur eine Silhouette, die für einen flüchtigen Moment das ohnehin schon spärliche Licht in der Bibliothek verdunkelte. Robert sah auf und blinzelte zu dem vergitterten Fenster, unsicher, ob er nicht über seiner Lektüre eingenickt war und es sich nur um ein Trugbild handelte. Dass sie keine Halluzination war, erkannte er, als das Quietschen des Putzwagens durch den Säulengang hallte, in dem es zu dieser Uhrzeit sonst nur eine Form menschlicher Präsenz gab: die Gedanken großer Männer und Frauen, versteckt hinter ledergebundenen Rücken. Natürlich hatte er die Bücher der Schulbibliothek nie gezählt, doch es waren gewiss an die zehntausend. Penibel sortiert nach Fachbereich und Autor reichten sie über die Galerie hinweg bis zu dem imposanten Tonnengewölbe hinauf, das ihn stets an eine gekenterte Arche Noah denken ließ.
Das Wägelchen rollte unaufhaltsam näher. Instinktiv machte Robert einen Buckel für den ebenso peinlichen wie unsinnigen Versuch, sich hinter dem grünen Glasschirm der Schreibtischlampe unsichtbar zu machen. Insgeheim ärgerte er sich über sich selbst. Er hatte jedes Recht, hier zu sitzen, auch nachdem die Bibliothekarin ihm mit einem mütterlichen Lächeln einen schönen Feierabend gewünscht und hinter sich abgeschlossen hatte, wohl wissend, dass jeder Lehrer einen Zentralschlüssel besaß. Feierabend. Ein Wort aus seiner Heimat, das schon lange nicht mehr für ihn galt. Hatte es nie, wenn er ehrlich war.
Eine geraume Zeit hatte er auf die Tür gestarrt und sich vorgestellt, wie Mrs Finnegan zu ihrem Mann und den Kindern heimkehrte, gedanklich bereits bei den Zutaten fürs Abendessen, auf den Teelöffel korrekt wie die von ihr geführten Verleihlisten. Vermutlich würde es Irish Stew oder irgendwas anderes mit Kartoffeln geben, denn kein Kochtopf in diesem Land kam ohne die heilige Knolle aus.
Sein Magen knurrte, im Gang klapperte ein Plastikeimer, Wasser plätscherte. Wie lange war die Finnegan schon weg? Zwanzig Minuten? Eine Stunde? Die Putzfrau summte beim Wischen vor sich hin. Obwohl sie nicht alle Töne traf, erkannte er den Song sofort. »Ain’t No Mountain High Enough«. Er war ein Fan von Marvin Gaye und ein noch größerer von Diana Ross.
Neugierig setzte er sich auf. Es war eine Frage von Sekunden, bis sie ihn in der Nische hinter der Shakespeare-Büste entdecken würde, oul Will, wie ihn die Kollegen scherzhaft nannten. Aber noch genoss er den Vorteil des heimlichen Beobachters, was ihn nur so lange beschämte, bis er sich ins Gedächtnis rief, dass nicht er hier der Eindringling war.
Sie war ungewöhnlich groß für eine Irin. Schlank, sofern er das unter dem unförmigen Kittel, den sie trug, beurteilen konnte, aber kräftig genug gebaut für die beschwerliche Arbeit. Brandrote Strähnen lugten unter dem blassblauen Tuch hervor, das sie sich als Turban um den Kopf gebunden hatte. Etwas enttäuscht registrierte er ihre elfenbeinfarbene, makellose Haut. Keine Sommersprossen.
»Jesus Christ!«
Er zuckte bei ihrem leisen Schrei zusammen. Hastig schloss er das Buch und erhob sich von dem Holzstuhl, auf dem er eindeutig zu lange gesessen hatte. Wie versteinert klammerte die Frau sich an ihren Wischmopp und starrte ihn aus schreckgeweiteten Augen an. Grün. Sie sind grün, dachte er und zog den Bauch ein, ein Reflex.
Sie öffnete den Mund, ohne dass ihm ein Laut entwich, und fing dann zu lachen an, über ihre eigene Schreckhaftigkeit oder den fremden Mann, der sich auf die Shakespeare-Büste stützte, als sei der gute alte William sein Saufkumpan. Ihr Gelächter war laut, ungeniert und verstörend schön. Es tat ihm beinahe leid, als sie damit aufhörte.
»Meine Güte, haben Sie mich erschreckt!«
»Tut mir leid, Madam. Das lag nicht in meiner Absicht.« Mit einer vagen Geste zum Schreibtisch bemühte er ein Halblächeln, das sich genauso steif anfühlte wie sein Rücken. »Ich habe … gearbeitet.«
Die Pause in seinem Satz war winzig gewesen. Nicht winzig genug, denn ihr Blick folgte seiner Handbewegung. Aufmerksam musterte sie den Buchdeckel des Romans. Der Club der toten Dichter. Sein Herz klopfte.
»›Ain’t No Mountain High Enough‹ stammt aus dem Haus Motown. 1967. Der erste Hit des Labels.« Er wusste nicht, warum er das sagte. Doch diese Frau hatte etwas an sich, das ihn glauben ließ, er müsse davon ablenken, dass er die Buchvorlage eines Hollywoodfilms inspirierender fand als die Fachwälzer, zwischen denen er den Roman entdeckt hatte. Da das Buch keine Registernummer trug, musste es jemand an Mrs Finnegans Argusaugen vorbeigeschmuggelt haben. Ein Seelenverwandter, ein Schüler vielleicht, oder jemand, der unerkannt zwischen den biederen Gestalten im Lehrerzimmer saß. Einer, dem die verstaubte Gesinnung der katholischen Privatschule genauso gegen den Strich ging wie ihm selbst.
Er schnaubte. Trotz der beruflichen Neuausrichtung war und blieb er Musiker, eine kreative Seele. Ihm grauste vor Regelwerken. Das hatte der Schuldirektor gewusst, bevor er ihm den Anstellungsvertrag über den Schreibtisch geschoben hatte, in der Hoffnung, ein ehemaliger Konzertpianist könnte etwas Glitzer auf die bröckelnde Fassade der Campbell Park School stäuben. Das Problem war nur, dass Robert Brenner längst nicht mehr glitzerte.
Die Putzfrau hob eine Braue. Nicht verwundert oder pikiert, nur abwartend. Das spontane Bedürfnis, sich ihr wegen des Buchs zu offenbaren, verwarf er dennoch. Wenn zum Lehrerzimmer durchsickerte, dass er sich von derartigem Stoff inspirieren ließ, würden sie ihn demnächst mit »O Captain! My Captain!« begrüßen und sich grölend auf die Schenkel klopfen. Die Iren lachten gern. Vor allem über andere.
»Der Song, den Sie da vorhin gesummt haben«, erklärte er hastig. »Wussten Sie, dass er …«
»Haben Sie ihn gesehen?«, fiel sie ihm ins Wort. Sie hatte den Mopp in die dafür vorgesehene Halterung am Wägelchen gesteckt und kam näher. »Den Film zu diesem Roman, meine ich. Er ist wunderbar.«
Sie trocknete sich die Hände am Kittel und nahm das Buch vom Tisch. Ihm rutschte das Herz in die Hose, als sie die von ihm mit einem Eselsohr markierte Seite aufschlug.
»Nein, ich kenne den Film nicht. Aber der Roman ist interessant.« Nervös musterte er die senkrechte Falte, die beim Lesen auf ihrer Stirn erschienen war. »Ich gehe nicht oft ins Kino.«
»Sie sind Deutscher, oder?«, murmelte sie, die Augen fest auf eine Textpassage gerichtet, die er frevelhaft mit Bleistift unterstrichen hatte:
Die meisten Menschen führen ein Leben in stiller Verzweiflung. Finden Sie sich nicht damit ab. Brechen Sie aus. Stürzen Sie nicht in den Abgrund wie die Lemminge. Haben Sie den Mut, Ihren eigenen Weg zu suchen.
»Deutscher, ja. Ich stamme aus Freising«, antwortete er unbehaglich. »Das liegt in der Nähe von München.« Er war nicht gut darin, mit Leuten, die älter als fünfzehn waren, Small Talk zu betreiben. Nicht spontan. Und schon gar nicht mit hübschen Frauen, denen man spätabends in einer Schulbibliothek begegnete.
Schweigen kroch über den feuchten Steinboden, dickflüssig und schwer verdaulich wie der Lammeintopf, der in diesem Moment vermutlich auf Mrs Finnegans Herd vor sich hin köchelte. Was sollte er jetzt tun? Die Frau machte keine Anstalten, mit der Arbeit fortzufahren. Stattdessen musterte sie ihn neugierig, das Licht der Schreibtischlampe sprenkelte Gold in ihren Blick. Sie war höchstens Mitte dreißig. Rund fünfzehn Jahre jünger als er.
»Haben Sie es getan? Sind Sie ausgebrochen?«, fragte sie unvermittelt und tippte auf die Textstelle.
»Nun, ich bin in Irland, Madam«, entgegnete er und beschloss, die Herausforderung zu diesem erstaunlichen Gespräch anzunehmen. »Wie sieht es mit Ihnen aus?«
»Ich bin Irin, Sir.« Um ihre Augen bildeten sich Fältchen. »Wir gehören zur ersten Sorte in dem Zitat. Wir führen ein Leben in stiller Verzweiflung und finden uns damit ab. Could be worse. Könnte schlimmer sein.«
»Could be worse. Das habe ich in den letzten Monaten öfter gehört.«
»Der Spruch passt zu allem«, erwiderte sie achselzuckend. »Zum Regen, dem verspäteten Bus … Im Zweifelsfall sogar zu einer Beerdigung.«
»Zu einer Beerdigung?«
»Solange man nicht selbst in der Kiste liegt und es zum Leichenschmaus genügend Guinness gibt?«
»Verstehe.«
»Nein, das tun Sie nicht«, erwiderte sie sanft. »Ich habe gehört, Sie sind erst vor Kurzem nach Irland gekommen. Aber wenn Sie erst eine Weile in unserem Land sind, werden Sie es bestimmt selbst erleben. Bis dahin sollten Sie genau dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.« Mit dem Daumen glättete sie das Eselsohr, ehe sie das Buch auf den Schreibtisch zurücklegte. Aufgeschlagen dort, wo seine Bleistiftmarkierung war. Eine Aufforderung. »Tut mir leid, dass ich Sie bei der Arbeit gestört habe, Professor.«
»Aber Sie haben mich überhaupt nicht gestört.« Zu viel Atem, zu viele Pausen im Satz. Sein Protest überzeugte kaum, das wusste er schon, bevor sie sich mit einem wissenden Lächeln dem Putzwagen zuwandte. Dabei hätte er eigentlich froh sein müssen. Das Gespräch fand ein Ende, bevor er sich hinreißen ließ, mehr über sich und seine Beweggründe, Deutschland den Rücken zu kehren, preiszugeben. Einzuräumen, dass er keinen Professorentitel besaß, die falsche Anrede aber nie korrigierte, weil sie ihm schmeichelte.
Er überlegte, wie er das Gespräch wieder aufnehmen könnte, während die Frau den Wischmopp routiniert aus der Verankerung löste und fortfuhr, den Boden zu wischen. Verflixt, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, dachte er, ehe er, vollkommen entgegen seiner Natur, das Denken einstellte. Er drückte sich an oul Will vorbei und trat, den bohrenden Blick des Dichters im Rücken, in eine Pfütze aus Seifenlauge.
»Ich bin Robert«, sagte er und streckte ihr die Hand hin. »Robert Brenner. Der neue Musiklehrer.«
Sie hielt inne, sah aber nicht auf. »Oh, ich weiß, wer Sie sind, Professor Brenner. In dieser Schule sprechen sich Neuigkeiten schnell rum. Sogar bis in die unteren Ränge.«
Sprachwitz. Selbstironie. Er öffnete den Mund, doch es kam nichts heraus, weshalb er ihn rasch wieder zuklappte, damit er nicht aussah wie ein Karpfen. Weiß Gott, er erinnerte sich nicht daran, wann ihn ein Mensch zum letzten Mal überrascht hatte. Er wollte, nein, er musste diese Frau näher kennenlernen.
»Ich heiße Molly.«
Ihre Finger waren feucht vom Wischwasser, ihr Händedruck fest. Kein Ehering, was ihn mit einer kindischen Freude erfüllte.
»Molly. Und weiter?«
»Nichts weiter. Einfach Molly.« Ihre Augen funkelten. »Das muss für die erste Viertelstunde genügen, Robert.«
Sein Herz klopfte, während er ihr nachsah. Die Campbell Park School war nicht besonders groß, und Molly gehörte zum Reinigungspersonal. Es lag in der Natur der Sache, dass sie einander erneut über den Weg laufen würden – vorausgesetzt, er machte es sich zur Gewohnheit, den Feierabend in der Bibliothek zu verbringen. Warum auch nicht? Zu Hause warteten ohnehin nur ein paar ungeöffnete Umzugskartons auf ihn. Er lauschte dem gleichmäßigen Wischgeräusch im Gang. Draußen war es dunkel geworden, Regen rauschte, das Licht der Schreibtischlampe reichte kaum drei Regalreihen weit.
»Sehen wir uns morgen wieder? Um die gleiche Uhrzeit?« Seine Frage hallte durch den Saal wie eine falsch gestimmte Violinsaite. Früher wäre er nie auf die Idee gekommen, bei einer Frau den ersten Schritt zu machen. Es war schlichtweg nie notwendig gewesen.
»Gut möglich, Professor Brenner«, kam es fröhlich aus dem Halbdunkel.
Ihr Name ist Molly. Und ich werde sie morgen wiedersehen.
Er zog den Tweedmantel an und verstaute den Roman zusammen mit dem Federmäppchen in seiner Tasche. Beim Hinausgehen – er beherrschte sich, sich nicht nach ihr umzudrehen – fühlte er sich ungewöhnlich beschwingt.
Eine Viertelstunde. Das waren läppische fünfzehn Minuten. Oder neunhundert Sekunden, wenn er die Begegnung mit Molly-nichts-weiter auf ein paar Atemzüge herunterbrach. Ein lächerlich kleiner Zeitraum, gemessen an den zwei Dritteln Lebenszeit, die hinter ihm lagen. Als die Glastür in seinem Rücken ins Schloss fiel, lächelte er.
Gott wusste, dass er kein schicksalsgläubiger Mensch war. Aber in diesem Augenblick war er davon überzeugt, dass fünfzehn Minuten genügen konnten, um die Dinge auf Anfang zu stellen.
1. Kapitel
__________________
__________________
DUBLIN. SEPTEMBER 2019.
Bonnie.
Das Wasser lief aus der Wand. Im ersten Augenblick war sie fasziniert. Ungläubig, dass so etwas überhaupt möglich war, trat Bonnie näher an die Flurwand und streckte die Hand aus. Ma’s geliebte Rosentapete. Sie war warm und fühlte sich merkwürdig aufgebläht an. Stellenweise löste sie sich bereits vom Mauerwerk.
»Ach du heilige Scheiße«, murmelte sie.
»Ich hab’s dir ja gesagt. Ist ein Desaster.« Sheila, die kaugummikauend am Türrahmen lehnte, deutete mit dem Kinn auf das Linoleum. »Das Wasser kam schon unter der Tür raus. Reiner Zufall, dass ich grad den Müll rausgebracht hab, sonst hätte ich dich früher angerufen. Nachbarschaftshilfe und so, is doch klar.«
»Danke, Sheila, ich …« Die Blütenranken bewegten sich, als würden sie Atem holen. Mit einem entkräfteten Seufzen blätterte eine Tapetenbahn ab. Ihr Herz zog sich zusammen, während Sheila ungerührt weiterplapperte.
»Unglaublich … Das wird ein Scheißgeld kosten … Wenn du willst, kann ich … Igitt! Haben die damals die Tapeten mit Spucke festgeklebt, oder wieso kommen die runter?«
Benommen starrte Bonnie auf die entblößte Steinwand. Sie war dunkel vor Nässe und von Stockflecken übersät.
»Mam? Was ist hier los?«
Joshs zittrige Stimme holte sie sofort in den Hausflur zurück. Seine Augen wirkten ohnehin schon riesig hinter den dicken Brillengläsern, jetzt schienen sie sein Gesicht geradezu auszufüllen. Erschrocken sah ihr Sohn zu, wie das Wasser über seine roten Sneaker schwappte. Im ersten Moment schien er nicht zu wissen, ob er besorgt oder entzückt wegen der Überschwemmung sein sollte, die ihr Haus in den Drehort eines Katastrophenfilms verwandelte. Ein übel gelauntes Maunzen aus der Küche signalisierte, dass Sir Francis das Entzücken keinesfalls teilte. Das arme Tier.
Bonnie atmete aus und zog die Mundwinkel hoch. Ungeachtet des dampfenden Wassers, das ihre Knöchel umspülte, ging sie in die Hocke und musterte das blasse Kindergesicht, das ihrem eigenen so unglaublich ähnlich sah: eine spitze Himmelfahrtsnase, darunter ein schmaler Mund, in dem die unteren Schneidezähne fehlten, die hohe Stirn, die für einen Sechsjährigen viel zu oft knitterte. Nur seine tintenblauen Augen gehörten zu einem anderen Menschen, der schon lange aus ihrem Leben verschwunden war.
Josh zwinkerte rasch hintereinander. Das tat er oft, wenn er verunsichert war. Dagegen half nur ein Abenteuer.
»Bereit für die Mission?«, flüsterte sie und beugte sich nach unten, um Joshs Hosenbeine hochzukrempeln. »Klingt, als bräuchte unser Smutje dringend Hilfe. Traust du dir zu, Sir Francis aus der Kombüse zu retten, bevor unser Schiff untergeht? Die Katzenbox ist in der Besenkammer.«
Kurz wirkte Josh unentschlossen, ob er sich auf das Spiel einlassen sollte, doch dann nickte er heftig und salutierte.
»Aye, aye, Sir! Bin schon unterwegs.« Er überlegte und fuhr dann feierlich fort: »Falls uns die Haie fressen, war es Smutje Francis und mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Captain.«
»Die Ehre ist ganz meinerseits, Erster Offizier Milligan. Ich bin mir sicher, dass wir uns unversehrt wiedersehen, sobald ich das Leck gestopft habe. Dieser dämliche Eisberg.«
»Dieser dämliche Eisberg!«, echote Josh mit leuchtenden Augen.
»Soll ich vielleicht ein Schlauchboot und eine Pfeife besorgen? Oder Schwimmflügel?«, kam es belustigt von der Tür, dann imitierte Sheila mit hoher, zittriger Stimme aus dem Film Titanic: »Jack! Jack, da ist ein Boot! Jack!«
Bonnie schnappte nach Luft, um ihre Nachbarin in die Schranken zu weisen, doch ihr Sohn war schneller.
»Ich kann doch schon schwimmen! Mam hat’s mir letzten Sommer beigebracht, im Schwimmbad.« Er verzog den Mund, als habe sie eine wirklich dumme Bemerkung gemacht. »Schwimmflügel sind was für Babys.«
»Natürlich sind sie das«, erwiderte Sheila seufzend. »Kann ich sonst etwas tun?«
Sheila vergötterte Josh. Trotzdem sprach ihr Blick Bände, als der Junge, armrudernd und Dampfergeräusche nachahmend, in die Küche watete.
»Es wäre lieb, wenn du Eimer und Lappen besorgen könntest.« Bonnie drehte Sheila den Rücken zu, bevor sie weiterstichelte. Ihre Nachbarin meinte es gut und war bestimmt eine großartige Verkäuferin. Allerdings reichte ihr Feingefühl höchstens bis in die betonierten Vorgärten ihrer Kundinnen, denen sie ihre Tupperdosen aufschwatzte. »Und einen Schrubber«, warf sie über die Schulter zurück, bevor sie die Tür aufstieß und mitansehen musste, wie ihre grimmige Entschlossenheit zusammen mit dem Wasser die Kellertreppe heruntergespült wurde.
Als ob ich nicht selbst wüsste, dass das Leben kein Spiel ist. Es ist eine Ansammlung kleiner und großer Katastrophen, von denen man nie weiß, welche als Nächstes kommt. Und das liegt nicht nur daran, dass wir in Finglas wohnen. Es ist nicht das Viertel und auch nicht das Haus, sondern die verzwickte Gesamtsituation, in der wir stecken, seit Ma nicht mehr da ist.
»Bonnie?«
»Ja?« Sie drehte sich nicht um. Wenn sie Sheila jetzt ins Gesicht sah, würde sie sich nicht mehr beherrschen können. Aber Tränen halfen niemandem. Sie musste das Desaster rational angehen, sich sammeln, die klatschnassen Sneaker auf die Erde drücken. Schleunigst den Hauptwasserhahn abdrehen und beten, dass der Schaden nicht allzu groß war.
»Der Kumpel von meinem Cousin Nathan ist Klempner. Er ist ein elender Halsabschneider, aber ich kann dafür sorgen, dass er direkt vorbeikommt. Soll ich ihn anrufen?« Sheilas heisere Raucherstimme klang ungewohnt sanft und goss etwas Warmes in ihr Inneres. Sie schloss die Augen und gab sich für einen Moment dem tröstlichen Gefühl hin, doch nicht ganz allein zu sein.
»Das ist der erste vernünftige Satz, den ich heute von dir höre, Sheila.«
Ihre Nachbarin erwiderte ihr Lächeln, und zum ersten Mal fiel Bonnie auf, wie müde sie unter dem blondierten Pony aussah. Zuerst schien sie etwas Aufmunterndes hinzufügen zu wollen, aber in Finglas war Trost etwas, mit dem man unter Erwachsenen sparsam umging. Jeder in diesem Viertel hatte eigene Sorgen, und wenn nebenan eine Schüssel zu Bruch ging, redete man dem anderen nicht ein, sie habe bloß einen Sprung. Man stellte sich dem Offenkundigen – besonders wenn Tapeten von Wänden abpellten wie Mandarinenschalen.
»Freu dich nicht zu früh, Kleines.« Sheila bohrte ihren mit Strasssteinen verzierten Fingernagel in eine aufgeweichte Rosenknospe und verzog angewidert den Mund. »Das da braucht vermutlich mehr als einen Klempner, der dich finanziell bis auf den Schlüpfer auszieht. Mach dich also besser auf in den Keller zum Haupthahn, bevor wir tatsächlich ein Schlauchboot organisieren müssen, um deinen Sohn aus der Küche zu fischen.«
***
Ian Mahony war Ende dreißig, trug einen Trainingsanzug und einen Dreitagebart, der unter seinem Kinn mit einem Tribal-Tattoo verschmolz. Er war mit zwei Kollegen in einem klapprigen weißen Van ohne Firmenlogo aufgekreuzt, der jetzt mit heruntergelassenen Fensterscheiben und aufgedrehtem Radio auf dem Gehsteig parkte. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte Bonnie sein Gangsta-Gehabe amüsiert, aber die Flüche, die er beim Betreten ihres Hauses ausgestoßen hatte, hatten ihr verdeutlicht, dass es überhaupt nichts zu lachen gab.
Nachdem sie die Überschwemmung mit Schrubbern und Bodenabziehern aus dem Haus gekehrt hatten, rissen die Männer auf der Suche nach dem Leitungsleck den Flur auf und meißelten sich wie Drogenspürhunde an der Küchenwand entlang in den ersten Stock, wo sie ihr zerstörerisches Werk fortsetzten. Bonnie flüchtete unter dem gestammelten Vorwand, den Männern einen Tee kochen zu wollen, nach unten. In der Küche stellte sie den Wasserkessel auf den Herd und schmierte Erdnussbuttersandwiches, während über ihr die Fliesen zu Bruch gingen, die Ma und sie angebracht hatten. Sie machte zu viele Sandwiches, aber die Tätigkeit war so beruhigend alltäglich, also fuhr sie fort, bis das Erdnussbutterglas leer war.
Danach stand sie am Fenster und starrte auf den gepflasterten Vorgarten, in dem außer Fugenunkraut nichts blühte, und versuchte sich daran zu erinnern, dass es genügend gute Dinge in ihrem Leben gab. Das Wetter war für den Dubliner Herbst zum Beispiel ungewöhnlich mild. Sie waren trocken zur Haltestation gekommen, und der Bus war pünktlich gewesen. Sie hatten ein Zuhause, und der Job in O’Driscolls Fish-’n’-Chips-Imbiss brachte sie einigermaßen über die Runden. Ihr Chef Paddy erlaubte ihr sogar, Josh mit zur Arbeit zu nehmen, weil sie sich derzeit keine Kinderbetreuung leisten konnte. Sheila nicht zu vergessen, die sich bei aller Kaltschnäuzigkeit trotzdem um ihr Wohlergehen scherte, obwohl sie sich vorhin unter einem fadenscheinigen Vorwand davongemacht hatte, als es ans Aufwischen ging. Und dann war da natürlich noch ihr kleiner Jackpot, der in diesem Augenblick mit der Katzenbox auf dem Schoß auf der Grundstücksmauer hockte und dem fauchenden Kater einen Vortrag über seenotrettungstaugliches Verhalten hielt.
Wie erwartet war ihr Ablenkungsmanöver erfolgreich gewesen. Es zählte nicht, dass Sir Francis die Katzenbox hasste und das sinkende Schiff für Bonnie gallebittere Realität war. Ihr Sohn genoss einen glückseligen Kindheitsmoment, und sie konnte sich einreden, es sei ganz normal, dass sein einziger Spielgefährte ein einäugiger Streuner aus dem Tierheim war.
»Miss?« Ein gekünsteltes Räuspern in ihrem Rücken signalisierte, dass Mahony bereit für den geschäftlichen Teil des Gefallens war, den er Sheila schuldete.
»Auf dem Tisch steht was zu essen, in der Kanne ist Tee. Bedienen Sie sich ruhig.« An den Fenstersims gelehnt beobachtete sie, wie Mahony sich ein Sandwich nahm. Der andere Teil ihrer Aufmerksamkeit blieb bei den beiden heranschlendernden Jugendlichen hängen, deren Gesichter ihr nicht fremd waren. Der eine trug das grüne Trikot der Irish Rugby Football Union, sein Kumpan steckte in einer überweiten Jogginghose, in die locker zwei von ihm reingepasst hätten. Sie presste argwöhnisch die Lippen zusammen, aber an diesem Tag schienen die beiden Taugenichtse sich ausnahmsweise einmal nicht für den kleinen Freak aus der 59 Berryfield Road zu interessieren. Umso neugieriger beäugten sie Mahonys Van.
»Sie haben hoffentlich keine Wertsachen auf dem Beifahrersitz gelassen«, murmelte sie und bemerkte zu spät, dass der Handwerker neben sie ans Fenster getreten war – zu nah, als angenehm gewesen wäre. Nicht mal die Erdnussbutter überdeckte seine süßlichen Ausdünstungen, typisch für einen Kiffer. Überwältigt von einem Bild aus der Vergangenheit, an das sie sich eigentlich nie wieder erinnern wollte, rückte sie von ihm ab.
»Also, Mr Mahony. Wie schlimm ist es?«
»Auf ’ner Skala von eins bis zehn?«, entgegnete Mahony kauend und winkte den beiden Halbstarken zu, die einen überraschten Blick wechselten. »’ne glatte Zwölf, würd ich sagen.«
»Und das bedeutet?«
Mahony sah sie aufmerksam an. Sie kannte diese Art von Blick. Er checkte sie ab, versuchte herauszufinden, ob er eine Frau vor sich hatte, die man über den Tisch zog oder besser gleich dort flachlegte. Sie klebte ein Lächeln auf ihr Gesicht, woraufhin Mahony zurück zum Tisch schlenderte und sich Tee einschenkte. Offenbar fand Mr Gangsta es spaßig, sie zappeln zu lassen.
»Wir haben das Leck gefunden, und das war’s mit den guten Nachrichten. Handelt sich um ’ne verrostete Wasserleitung, oben im Bad.« Mahony klaubte ein weiteres Sandwich von der Platte. »Hinter dem Waschbecken ist ’ne Menge Wasser ausgetreten. Boden, Wände … Sieht übel aus. Man müsste das Haus trockenlegen und danach das komplette Leitungssystem erneuern.« Er zeigte auf die hässlichen Wunden, die seine Jungs der Küchenwand zugefügt hatten. »Sonst haben Sie nächste Woche das gleiche Problem woand…«
»Wie viel, Mr Mahony?« Bonnie zog die Schultern hoch und drückte die Fingerkuppen so fest in die Oberarme, dass es sicher blaue Flecke geben würde.
»Zehn, sollten Sie eine Rechnung für die Versicherung brauchen. Neun, wenn ich’s schwarz mache«, kam es wie aus der Pistole geschossen zurück.
Neuntausend Euro! Ein glatter Bauchschuss, nur mühsam gelang es ihr, nicht nach Luft zu schnappen.
»Ich habe keine Versicherung«, erwiderte sie leichthin, während die Gedanken in ihrem Kopf umherflitzten wie Kugeln in einem Flipperautomaten. Sie hatte die Hausratversicherung gekündigt. Ebenso wie die Lebensversicherung, den Festnetzanschluss und das Zeitungsabo. Eine Beerdigung war teuer.
»Dann kennen Sie jetzt den Preis. Neuntausend, und Sie kehren in drei Wochen in ein nagelneues Haus zurück.« Ian Mahony beäugte die bunt zusammengewürfelte Kücheneinrichtung, die kein einziges Möbelstück ohne Kratzer oder abgeschlagene Kanten vorzuweisen hatte. »Na ja, so gut wie.«
Drei Wochen. Es dauerte, bis die Information bei ihr ankam, nachdem sie die schwindelerregende Summe verdaut hatte. Jetzt würde also ihr Sparbuch dran glauben müssen. Siebentausendvierhundert Euro und einundzwanzig Cent hatte sie gespart, das Geld war eigentlich für Josh gedacht gewesen. Für die Reparatur reichte es trotzdem nicht, selbst wenn sie Mahony um einen Tausender runterhandelte. Von den zusätzlichen Kosten für ein Hotel- oder Pensionszimmer ganz zu schweigen.
Bonnie schluckte schwer. Wo sollten sie drei Wochen lang unterkommen? Sie hatten keine Familienangehörigen, ihre ehemaligen Schulfreundinnen waren nach und nach in bessere Gegenden gezogen. Bedingt durch Ma’s Krankheit und wegen des Schichtdiensts im Imbiss war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ihre losen Kontakte schließlich ganz abgebrochen waren. Das war die traurige Wahrheit. Es gab niemanden, den sie um Hilfe bitten konnte.
»Können wir während der Sanierung nicht hierbleiben?« Sie wunderte sich, wie gefasst sie klang. Sozialfürsorge, Mutter-Kind-Heim, Obdachlosenunterkunft. Manche Wörter juckten wie Ausschlag auf der Haut.
»Miss.« Jetzt schaute Mahony mitleidig. »Mal ganz davon abgesehen, dass wir vom Wasser bis zur Elektrik alles abstellen müssen … Hier werden Trocknungsgeräte und Ventilatoren vierundzwanzig Stunden lang den Krach von Laubbläsern machen. Glauben Sie mir, das wollen Sie weder sich noch Ihrem kleinen Jungen antun.«
»Aber ich kann nicht drei Wochen …«
»Sie zahlt siebentausend und keinen Cent mehr!« Sheilas Stimme ließ die ohnehin schon arg mitgenommene Küchenwand erzittern. Mahony schrak zusammen, als ihre Nachbarin mit langen Schritten auf den Handwerker zumarschierte.
»Hi Shee.« Er lächelte. Nicht besonders erfreut, sondern eher so, als müsse er einen knurrenden Pitbull beschwichtigen.
»Ian Thomas Mahony!« Ihr Zeigefinger berührte fast Mahonys Stirn. »Muss ich dich wirklich daran erinnern?«
Mahony bereitete es sichtlich Schwierigkeiten, den letzten Bissen des Erdnussbuttersandwiches herunterzuschlucken.
»Logo. Siebentausend sind ein fairer Preis«, stammelte er und wich Bonnies Blick aus.
»Das will ich meinen. Deine Jungs können gleich loslegen. Und du …«, Sheilas Ton wechselte übergangslos von Minusgraden in Frühlingstemperatur, als sie Bonnie ansprach. »Du und Josh, ihr kommt vorläufig zu mir. Bequem wird’s nicht, aber für ein paar Nächte wird die Wohnzimmercouch schon reichen – bis wir eine andere Lösung gefunden haben.«
»Die findet sie bestimmt«, versetzte Mahony. »Mrs Doyle versteht sich nämlich meisterhaft darauf, andere genau dorthin zu bringen, wo sie garantiert nicht sein wollen.«
»Halt die Klappe, Ian, sonst steck ich dem alten Hugh O’Neill, wer damals seinen Kiosk ausgeräumt hat.«
»Das ist zwanzig Jahre her!« Mahony lief rot an. »Nate und ich waren halbe Kinder und … Herrgott, die Sache ist doch längst verjährt.«
»Mal sehen, ob Hugh das auch so sieht.«
»Schon gut.« Seine Schultern sanken herab. »Ich sag den Jungs, sie sollen die Entfeuchter aus dem Van holen.«
»Das ist der erste vernünftige Satz, den ich heute von dir höre, Ian.« Sheila grinste sie triumphierend an, und erstaunlicherweise – trotz allem, oder vielleicht gerade weil die ganze Situation zum Verzweifeln war – fiel Bonnie in das heisere Gelächter ihrer Nachbarin mit ein.
Mahony verdrehte die Augen und stiefelte nach draußen. Durchs Fenster beobachteten sie, wie er den Männern händefuchtelnd Anweisungen gab. Die Teenager hatten sich getrollt, vermutlich suchten sie auf dem nahen Sportplatz ein anderes Opfer, dem sie das Taschengeld abnehmen konnten. Josh sammelte Kieselsteine im Hof. Diejenigen, die ihm gefielen, steckte er in die Brusttasche der Latzhose, die anderen warf er Sir Francis hin, den er inzwischen aus der Box befreit hatte. Ob er das Ausmaß der Katastrophe begriff, die ihrem Spiel eine traurig reale Kulisse bescherte? Plötzlich wünschte sie sich brennend ein kleines Stück seiner Unbekümmertheit. Was auch geschah, er war stets felsenfest davon überzeugt, dass seine Mam alles in Ordnung brachte. Es mochte komisch klingen, aber das Urvertrauen ihres Kindes hatte ihr im letzten Jahr viel Kraft gegeben.
Entschlossen straffte sie die Schultern. Sheila hatte recht. Sie würde eine Lösung finden, und bis dahin würde sie so tun, als sei ihr Leben lediglich ein bisschen in Schieflage geraten. Nichts Wildes, nichts, worüber ein Sechsjähriger sich Gedanken machen musste.
»Okay, Kleines. Packst du ein paar Sachen und kommst nachher mit Josh rüber? Ich hab Shepherd’s Pie für meine Jungs gemacht und mich mal wieder mit den Mengenangaben vertan.« Sheila zog eine Grimasse. »Wär cool, wenn ich behaupten könnte, ich hätte absichtlich für ein halbes Rugbyteam gekocht.«
»Dienstag«, murmelte Bonnie mit einem abwesenden Blick auf die Wanduhr über der Spüle. »Heute ist Dienstag.«
Es dauerte einige Augenblicke, bis sich Verstehen auf dem Gesicht ihrer Nachbarin zeigte, dem sie durch pfundweise Make-up und grellbunten Lidschatten ein paar Jährchen Jugend abtrotzte.
»Stimmt, heute ist Dienstag.« Die Finger auf ihrem Arm waren kühl und unbeholfen, aber das machte nichts. Sheilas Stimme war voller Zuneigung. »Wir werden mit dem Essen auf euch warten.«
2. Kapitel
__________________
__________________
DUBLIN, SEPTEMBER 2019. EINE STUNDE SPÄTER.
Bonnie.
Kurz nach vier betrat sie mit Josh den Glasnevin Cemetery. Wie jedes Mal benutzten sie den Eingang an der Ostseite des Friedhofs, weil man am Kiosk auf dem Prospect Square günstigere Blumen als bei der Konkurrenz am Haupteingang bekam. Außerdem entgingen sie so den Touristen, die sich hauptsächlich für den alten Teil des Friedhofs interessierten, den man in den Reisebroschüren als Dublins Antwort auf Père Lachaise in Paris belobhudelte. Dort, wo der Weg zum Besucherzentrum und zu den Toiletten am kürzesten war, warteten die klickstärksten Fotomotive für die sozialen Medien: monumentale Grabmäler, Keltenkreuze und vermooste Grabplatten, unter denen all die berühmten Leute lagen, die das heutige Irland geprägt hatten.
Ganz anders gestaltete sich der neue Teil neben dem Botanischen Garten. Zwischen dem dunklen Grün von Eiben, Zypressen und Wacholder herrschte militärische Ordnung, alle Gräber befanden sich in Reih und Glied. Still war es, friedlich, so wie man es von einem Friedhof erwartete. Nur in der Ferne brummte ein Rasenmäher, Vogelgezwitscher erinnerte daran, dass das Leben auch dort war, wo der Tod wohnte. Es war ein guter Ort, und jeden Dienstag, wenn sie Ma besuchten, fühlte Bonnie sich nicht nur näher bei Gott, sondern auch ein klein wenig so, als kehrte sie heim.
»Ein Eisberg ist für Schiffe deswegen so gefährlich, weil man nur seine Spitze sieht. Unter Wasser kann er siebenmal größer sein.« Josh hopste an ihrer Hand auf und ab. »Weißt du, dass es grüne Eisberge gibt, Mam?«
»Ernsthaft? Grün?« Sie riss die Augen auf, allerdings nicht allzu weit. Josh besaß ein feines Gespür dafür, ob Erwachsene ihn ernst nahmen. Übertriebene Begeisterung steckte er rasch in denselben imaginären Schuhkarton, in dem er bereits die Babysprache seiner ehemaligen Kita-Erzieherin und das Essiglächeln von Mrs Drake aus Hausnummer 7 verwahrte. Er wusste ja nicht, dass seine Mam innerlich hin- und hergerissen war. Sollte sie stolz auf ihren Sohn sein, weil er all diese unglaublichen Dinge wusste, von denen sie keine Ahnung hatte? Oder musste sie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einen Sechsjährigen lieber stundenlang vor dem Fernseher parkte, statt ihn in die Schule zu schicken? Was für eine Art Mutter war sie in den kritischen Augen anderer Mütter?
Eine, die ihr Kind zur Arbeit mitnehmen muss und froh ist, dass ihr Boss für ihren Sohn eine Spielecke eingerichtet hat und einen Doku-Sender im Fernseher über dem Tresen laufen lässt. Ich bin die Sorte Mutter, die keine Wahl hat und trotzdem nicht aufgibt. Eine, die aus den Brotkrumen, die ihr das Leben hinwirft, das Beste macht. Den Rest erledigen Bücher, Lieder und zusammengesponnene Geschichten von Antarktis-Expeditionen, Eisbergen und sinkenden Schiffen. Und was die Schule angeht … Could be worse. Es könnte schlimmer sein.
»Mam! Du musst fragen.« Josh zog an ihrem Arm.
»Was denn?«, antwortete sie zerstreut. Auf einer Bank, etwa zwanzig Meter vor ihnen, saß ein Mann in einem dunkelblauen Anzug.
»Warum sind manche Eisberge grün, Josh?«, soufflierte ihr Sohn und verdrehte die Augen wie bei Sheila, wenn sie mal wieder nicht kapierte, wovon er redete.
»Warum sind sie grün?«, wiederholte sie gehorsam.
Der Mann trug Bart und Sonnenbrille, was es unmöglich machte, sein Alter zu schätzen. Sein Anzug wirkte altmodisch und eine Nummer zu groß, ein Kleiderschrankhüter, den man nur zu besonderen Gelegenheiten herausholte. Er sah aus, als würde er seit Stunden auf dieser Bank sitzen und auf jemanden warten, der nicht kommen würde.
Sie hatte kaum zu Ende gedacht, als er unvermittelt den Kopf in ihre Richtung drehte. Beschämt senkte sie den Blick und ging schneller. Ein Fehler. Kaum hatten sie den Mann passiert, stolperte sie in den ungewohnten Absatzschuhen und ließ Joshs Hand los. Er trabte los wie ein Pony, das man nach tagelangem Boxenaufenthalt endlich vom Halfter befreite.
»Algen!«, warf er über die Schulter zurück. »Es sind umgekippte Eisberge, die an der Unterseite mit Algen bewachsen sind. Deswegen sind sie grühün!«
Beinahe hätte sie laut aufgelacht. Doch dann purzelte noch ein Satz aus seinem Mund, so beiläufig wie die Frage nach einem Schokoladenkeks, den man sowieso nicht bekam.
»Müssen wir jetzt draußen schlafen, Mam?«
Er hatte sie schon einmal so erschreckt, vor einigen Tagen. Da hatte er gefragt, ob sie wegen des Mikroplastiks in der Nahrungskette alle sterben müssten.
»Ob wir draußen …? Aber nein!«, rief sie ihm nach, obwohl er längst in den Seitenweg zu Ma’s Grab eingebogen und aus ihrem Sichtfeld verschwunden war.
Warum sie sich nach dem Mann auf der Bank umdrehte, wusste sie selbst nicht genau. Vielleicht, um sich zu vergewissern, dass er keine Illusion gewesen war, geboren aus ihrer eigenen Trauer und dem Bedürfnis, sich mit jemandem verbunden zu fühlen, dem es so erging wie ihr. Doch die Bank war leer. Enttäuscht sah sie seinem Rücken nach, bis er zu einem unscharfen Fleck am Ende des Kieswegs zusammengeschrumpft war.
Was hatte sie erwartet? Dass er sie herwinkte und zu einem Plausch aufforderte? Dass er einen Tullamore aus der Jackentasche zauberte, um mit ihr auf die Toten anzustoßen? Auf manchen irischen Beerdigungen war es üblich, dass die Trauergäste einander abklatschten und so ihre Erleichterung kundtaten, dass es sie selbst nicht erwischt hatte. Tatsächlich besaß die Vorstellung eines High five mit diesem Fremden etwas verboten Tröstliches. Ma hätte es ganz sicher gefallen. Mit einem selbstvergessenen Lächeln schloss sie die Faust fester um den Nelkenstrauß und setzte ihren Weg fort.
***
Josh saß mit baumelnden Füßen auf dem Grabstein seiner Großmutter. Glatter schwarzer Marmor mit goldener Inschrift. Sie hatten extra einen ausgesucht, der nicht so hoch und ein bisschen breiter war, damit ein sechsjähriger Junge genau das tun konnte. Eigentlich gehörte es sich nicht, auf Grabsteine zu klettern, aber Ma hatte es gemocht, wenn sie einander nah waren. Auf der gepolsterten Küchenbank, auf der Couch. Sonntagmorgens im Bett mit aufgebackenen Tiefkühl-Scones und dem Kreuzworträtsel aus der Sonntagszeitung, die jetzt nicht mehr im Briefkasten lag.
»Rutschst du ein Stück für mich beiseite?«
»Nur wenn es heute Abend Boxty gibt«, erwiderte Josh. Sein hoffnungsloser Tonfall erinnerte sie daran, dass es wirklich kein gewöhnlicher Dienstag war. Normalerweise machten sie nach dem Friedhofsbesuch Kartoffelpuffer – zwei für sie, drei für Josh, die er unter einer dicken Zimtzuckerschicht begrub und mit den Fingern essen durfte.
»Tut mir leid, Kumpel, aber das müssen wir verschieben.« Sie steckte das Nelkensträußchen in die Grabvase. »Wir essen bei Sheila. Du magst Shepherd’s Pie doch, oder?«
Josh nickte lustlos und rückte ein paar Zentimeter nach rechts, sodass sie mit dem halben Hinterteil auf den Stein passte. Automatisch befühlte sie die Vertiefungen der schnörkellosen Schrift in der Oberfläche unter ihr. Ruth Milligan stand dort, auf ein Porträtfoto im Stein hatte sie nicht nur aus Kostengründen verzichtet. Sie brauchten kein Bild, um sich an sie zu erinnern, und es wäre ihr falsch vorgekommen, das sanfte, immer etwas erschöpfte Lächeln ihrer Mutter der morbiden Neugier irgendwelcher Leute auszusetzen, die Ma nicht mal gekannt hatten.
»Die Sache ist die, Josh …«, wagte sie einen Vorstoß. »Im Moment können wir nicht nach Hause zurück. Wäre es sehr schlimm für dich, wenn wir ein paar Tage bei Sheila wohnen würden?«
Josh blinzelte und schob die Brille nach oben.
»Wir müssten allerdings im Wohnzimmer schlafen«, fuhr sie fröhlich fort, »es könnte also ein bisschen kuschelig werden.«
»Kann Sir Francis mitkommen?«
Die Frage hatte sie befürchtet. Sheila war ohnehin schon keine große Katzenliebhaberin, doch seit Sir Francis ihr eine kopflose Amsel auf den Fußabtreter gelegt hatte, hielt sie ihn für den reinkarnierten Jack the Ripper.
»Ich weiß es nicht. Aber es wird ihm nichts ausmachen, draußen zu schlafen. Er ist daran gewöhnt, schließlich hat er auf der Straße gelebt, bevor wir ihn adoptiert haben.«
»Aber ich bin es nicht gewohnt!«
Das stimmte. Josh war erst zwei Jahre alt gewesen, als Ma das schicksalhafte Flugblatt des Tierheims aus dem Briefkasten gezogen hatte. Nach den Weihnachtsfeiertagen platzte die Auffangstation aus allen Nähten, und man suchte verzweifelt neue Familien für all die unbequem gewordenen Geschenke, die von ihren überforderten Besitzern ausgesetzt oder gleich im Müllcontainer entsorgt worden waren. Obwohl sie stets gegen ein Haustier gewesen war, hatte Ma darauf bestanden hinzufahren. Bis zu diesem Tag hatte Bonnie den Anblick vor Augen, gestochen scharf, als sei es erst gestern passiert: ihre völlig entrückt vor dem nach Katzenpisse stinkenden Käfig kniende Mutter, an dem kein Besucher stehen blieb.
»Er ist genauso beschädigt wie ich«, hatte sie geflüstert, und ihre Augen waren feucht geworden, während der dreifarbig gescheckte Katzenteenager sie mit flach angelegten Ohren anschrie. Er besaß etliche kahle Stellen im Fell und nur ein hasserfülltes Auge, in dem zweifelsohne die Absicht schwelte, seine zukünftige Familie im Schlaf umzubringen. Doch jeder Protest wäre verlorene Liebesmüh gewesen, Ma hatte ihre Wahl getroffen. So hatten sie das beschädigte Tier mit nach Hause genommen – und mit ihm zog an jenem eisigen Januarnachmittag in der 59 Berryfield Road etwas ein, das ihre Mutter im Nachhinein als ihr verspätetes Weihnachtswunder bezeichnet hatte.
Anfangs ließ das Wunder jedoch auf sich warten. Kaum hatten sie die Box geöffnet, flüchtete Sir Francis wie ein geölter Blitz unter die Couch. Dort blieb er vier Tage, zitternd, fauchend, und schlug mit ausgefahrenen Krallen nach allem, was sich in seine Nähe traute. Weder Schmeicheleien noch Beschimpfungen konnten ihn hervorlocken, sogar den Thunfisch verschmähte er, den Ma ihm hingestellt hatte. In der fünften Nacht jedoch – mittlerweile waren sie überzeugt, dass das unterernährte Tier in seinem Versteck verhungern würde – wartete in Joshs Zimmer eine Überraschung auf Bonnie. Zu einer Fellkugel zusammengerollt lag der Kater im Gitterbettchen, eng an ihren schlafenden Jungen geschmiegt. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft gewesen.
Aus den Augenwinkeln verfolgte Bonnie, wie Josh ein paar Steine aus der Hosentasche nestelte und sie in einer schnurgeraden Reihe neben sich auf den Grabstein legte. Er wirkte bedrückt, und sie bekam ein schlechtes Gewissen. Sir Francis hatte Josh sozusagen mit aufgezogen, ihm seine vernarbte Straßenkaterseele geschenkt, ihn durch seine Liebe stark und selbstbewusst gemacht. Darüber hinaus hatte er ihn Geduld, Nachsicht und Pflichtbewusstsein gelehrt und ihn getröstet, viele, viele Male – und sie auch. Er war Ma’s Vermächtnis.
»Ich regele die Sache schon. Notfalls bleibt er eben in der Box.« Sie versprach vermutlich zu viel. Sir Francis verwandelte sich in einen teuflischen Mr Hyde, sobald man ihn einsperrte. Trotzdem musste sie es auf einen Versuch ankommen lassen.
»Ich mag Shepherd’s Pie, glaube ich.«
Seine Worte erwärmten ihr Herz. Ihr Sohn war kein großer Fan von Aufläufen, aber er wusste, dass er ihr einen Gefallen tat, wenn er das Gegenteil behauptete. Sie zog ihn an sich und genoss es, wie sein Körper weich in ihrem Arm wurde.
»Machen wir uns auf den Weg?«, flüsterte sie in sein Haar, das nach Mandelshampoo und süßem, sauberem Kinderschweiß roch. »Nehmen wir den Hundeschlitten, das U-Boot oder den fliegenden Teppich?«
»Den Teppich!«
»Das hab ich befürchtet.« Mit einem gekünstelten Seufzen stand sie auf. Sie wartete, bis Josh sich aufgerappelt hatte und wie ein Seiltänzer auf Ma’s Grabstein balancierte, den Blick erwartungsvoll auf ihr Gesicht gerichtet. Er ist wieder gewachsen, stellte sie wehmütig fest. Lange würden sie dieses Spiel nicht mehr spielen können. »Flieg, Aladin«, sagte sie leise und breitete die Arme aus.
***
Der Bus tauchte mit einer halben Stunde Verspätung an der Haltestelle auf und war so überfüllt, dass der Fahrer die Leute, die nach ihnen einsteigen wollten, mit einem gleichgültigen »Nächster Bus!« im Regen stehen ließ. Er fuhr an, noch während sie ihren Sohn durch das nach Feuchtigkeit, Aftershave und langem Arbeitstag riechende Meer aus Mänteln und Regenparkas schob und die missmutigen Gesichter zu ignorieren versuchte, die dem Busfahrer jede gestohlene Minute ihres Feierabends übelnahmen. Sie mussten sich bis ins Oberdeck vorarbeiten, bis sie endlich zwei freie Plätze erspähte.
»Sorry, Sir«, sprach sie einen älteren Herrn an und wies auf seinen Nachbarsitz, der von einem Packen Unterlagen belegt war. »Dürfte mein Sohn sich dorthin setzen?«
»Kann ihn wohl kaum davon abhalten«, brummte der Mann, ohne von seiner Zeitung aufzusehen. Sie bereute es sofort, ihn Sir genannt zu haben.
»Wären Sie dann so nett, Ihre Papiere vom Sitz zu räumen?«
Er bedachte sie mit einem abschätzigen Blick, der alles erfasste: die abgewetzte, zu groß gewordene Jeans, den Primark-Mantel und ihr aschblondes Haar, das seit Monaten keine Tönung mehr gesehen hatte. Gleich darauf zappelte sie bereits kopfüber in einer Schublade, an der das Etikett Brennpunktviertel klebte.
»Das Zeug gehört mir nicht«, erwiderte der Mann feindselig, als hätte sie ihn aufgefordert, ihr seine Brieftasche zu geben.
Sie unterdrückte ihren aufkeimenden Zorn und sah sich hilfesuchend um. Die junge Frau auf der anderen Seite wich ihrem Blick aus und drehte den Kopf zum Fenster. Ergeben dirigierte Bonnie ihren Sohn auf den zweiten freien Sitz, sammelte die Unterlagen ein und nahm selbst neben dem unfreundlichen Herrn Platz. Gewisse Menschen wollte sie lieber so weit weg wie möglich von Josh wissen. Leider kam es oft vor, dass diese Leute feine Anzüge und Kaschmirschals trugen, dabei hieß es doch, Geld und Status zählten für die Iren nicht viel. Aber die Wirklichkeit – ihre Wirklichkeit – sah anders aus. Sie lächelte den Mann herausfordernd an. Seine Zeitung raschelte empört, während er von ihr abrückte.
In ihrem Schoß lagen nun die aktuelle Ausgabe des Irish Independent, ein Faltplan von Dublin und ein abgegriffener blauer Hefter, prall gefüllt mit Papieren, die lauter Eselsohren hatten. Kurz spielte sie mit dem Gedanken, den lästigen Fund unauffällig unter die Bank zu schieben, doch dann begegnete sie Joshs fragenden Augen.
Sei nett, sei geduldig, kümmere dich. Mach die Welt ein bisschen freundlicher, besonders dann, wenn sie unfreundlich zu dir ist.
Im Nachhinein würde sie nicht mehr sagen können, ob sie den Hefter aus Trotz, Ratlosigkeit oder Neugier aufschlug – vielleicht war von allem etwas dabei. In den hauchdünnen, pergamentartigen Seiten erkannte sie instinktiv etwas, das jemand schmerzlich vermissen musste. Viel verstand sie nicht davon, aber es handelte sich um Musiknoten, eindeutig Originale, da die Blätter mit Radiergummi bearbeitet und mit Randbemerkungen versehen waren. Wie zum Teufel landete so etwas in einem Linienbus?
»Was ist das?« Josh beugte sich zu ihr herüber. »Hat da jemand etwas verloren?«
»Sieht ganz so aus.« Sie hielt ihm die Notenmappe hin, damit er hineinsehen konnte. »Das sind Lieder, die jemand geschrieben hat.«
»Cool.« Josh strich ehrfürchtig über die Seite, als ahnte er die Bedeutung all der Punkte und Striche, die auf den Bleistiftlinien hockten wie Spatzen auf einer Leitung. »Da wird derjenige aber bestimmt sehr traurig sein. So wie Ben, als er in der Kita das Bild vergessen hat, das er für seine Schwester gemalt hat. Als er weg war, hat Mrs McPhillips es zerknüllt und in den Mülleimer geworfen, aber das hab ich ihm am nächsten Tag nicht gesagt, weil er sonst geweint hätte.« Er kaute auf der Unterlippe und sah zu ihr auf. »War das falsch, Mam? Hätte ich es ihm sagen müssen?«
»Bei manchen Dingen weiß man nie hundertprozentig, was richtig ist.« Sie klemmte ihm eine Haarsträhne hinters Ohr. Sein Haar war zu lang, aber er weigerte sich standhaft, dass sie es ihm kürzer schnitt. »Wenn dir dein Bauchgefühl gesagt hat, dass du Ben lieber nichts erzählst, um ihm eine Enttäuschung zu ersparen, dann ist das okay, glaube ich.«
»Und was sagt dir dein Bauchgefühl, Mam?« Josh legte den Kopf an ihre Brust. Bonnie schlang die Arme um ihn und drückte ihn an sich, spürte die instinktive Anziehung, die es nur zwischen einer Mutter und ihrem Kind gab. Dann schob sie ihn sanft auf seinen Sitz zurück.
»Alle mal herhören!«, rief sie in den Gang und hielt den blauen Hefter in die Höhe. »Sieht aus, als wär hier was verloren gegangen. Vermisst jemand ein paar Unterlagen oder hat eine Ahnung, wem sie gehören?«
»Müssen Sie so rumbrüllen, Miss?«, zischte der Mann neben ihr. »Warum kümmern Sie sich nicht um Ihren eigenen Kram?«
»Richtig! Was schert Sie die Vergesslichkeit anderer Leute?«, fragte eine Frau in den Vierzigern über die Kopfstütze des Vordersitzes. »Lassen Sie den Müll liegen, das Zeug landet sowieso im Container.«
Enttäuscht betrachtete sie die unbeteiligten Gesichter ihrer Mitreisenden. Zwar hatten alle auf ihren Ruf reagiert, aber die meisten Fahrgäste sahen sie nur mit einer Mischung aus Argwohn und Mitleid an, ehe sie sich erneut ihren Handys widmeten oder ihre Gespräche wiederaufnahmen. Bloß ein Mädchen mit pinkfarbenen Haaren und Nasenring reagierte.
»Der lag schon hier, als ich am Liffey Valley Shopping Centre eingestiegen bin. Gut möglich, dass die Sachen schon den ganzen Tag im Bus hin- und herfahren«, sagte sie in einem Ton, der wohltuend mitfühlend klang. »Am besten geben Sie den Hefter bei der Fundstelle ab, wenn Sie unbedingt was für Ihr Karma tun wollen.«
»Was ist Karma, Mam?«
Ihr Nachbar schnaubte und murmelte Unverständliches in seinen Kaschmirschal. Über ihnen trommelte der Regen auf das Dach des Doppeldeckers, das Wasser schlug in den Radkästen, als der Bus durch Pfützen fuhr. Bonnie spürte ein Dröhnen im Bauch, ein aufsteigendes Gefühl, wie wenn ein Flugzeug vom Boden abhebt.
»Es bedeutet, dass du alles, was du tust, irgendwann einmal zurückbekommst«, antwortete sie lauter, als nötig gewesen wäre. »Deshalb werden wir mit den Liedern das machen, was man eben so macht, wenn man ein netter Mensch ist.«
Zugegeben, es überraschte sie, einen Anflug von Betroffenheit im Gesicht ihres Sitznachbarn zu entdecken, aber Jesus, es fühlte sich gut an. Das pinkhaarige Mädchen grinste verstohlen das Display seines Handys an.
»Bringen wir die Lieder zur Fundstelle?« Josh beugte sich tief über die Mappe. »Ff…üür Moo…lly«, buchstabierte er eifrig den Titel des ersten Stücks. »Für Molly.« Als er lobheischend zu ihr aufsah, rutschte ein Zeitungsausschnitt zwischen den Seiten heraus und segelte zu Boden.
Bonnie bückte sich, überflog die Schlagzeile und den Text, bis ihre Augen an einem Namen hängen blieben. Ihre Mundwinkel zogen sich nach oben. Sicher war dieses Lächeln ein bisschen selbstgefällig, doch sie war längst nicht fertig mit dem Kaschmirschal-Mann. Auf einmal fühlte sie sich fast euphorisch, als stünde sie im Begriff, ganz Dublin den Kampf anzusagen, dieser scheinheiligen Stadt, die sehr wohl zwischen Arm und Reich unterschied. Natürlich sollte sie ihre Energien auf ihre eigene Situation konzentrieren, doch die kam ihr im Augenblick wesentlich auswegloser vor. Das Problem mit diesen Noten zu lösen war hingegen ein Kinderspiel: Sie musste nur einen Namen in eine Internet-Suchmaschine eingeben, um eine vorbildliche Mutter zu sein.
»Nein, wir gehen mit der Mappe nicht zur Fundstelle. Wir machen etwas viel Besseres«, sagte sie und kramte ihr Smartphone aus der Manteltasche, während das Flugzeug in ihrem Bauch Loopings schlug. »Wir bringen sie ihrem Besitzer zurück.«
»Echt?« Josh rutschte aufgeregt auf dem Sitz herum. »Wir bringen sie zurück, einfach so? So, als würde ich Ben sein Bild zurückgeben?«
»Genau so.«
»Aber wie sollen wir das machen, wenn kein Name draufsteht?«
»Ich lass mir was einfallen.«
»Versprichst du’s?« Die Pupillen ihres Kindes glänzten wie ein schwarzer See, auf dem Sonnentupfer flimmerten. Plötzlich war alles andere unbedeutend. Die Leute im Bus, die bevorstehenden Nächte auf Sheilas Couch, das leere Bankkonto. In diesem Blick lag alles, was sie brauchte, um jeden Tag neu zu schreiben: Vertrauen, Zuversicht. Unendliche Liebe. Sie würde den Teufel tun und ihn enttäuschen.
»Ich verspreche es, Josh.«
3. Kapitel
__________________
__________________
CAMPBELL PARK SCHOOL. DUBLIN, OKTOBER 2001.
Robert.
Blauer Kapuzenpulli, Turnschuhe. Rote Trainingshose, die dem pubertären Wachstumsschub ihres Besitzers nichts entgegenzusetzen hatte. Jeden Dienstag in der fünften Stunde spielte sich in der letzten Reihe am Fensterplatz dasselbe Spiel ab: Auf einem Bleistift kauend kippelte Mark O’Reilly mit dem Stuhl und wartete mit gelangweilter Miene darauf, dass ihm jemand erklärte, was er in diesem Klassenzimmer sollte.
Schuluniform ist Pflicht, mit Stühlen kippeln ist verboten. Robert schwankte zwischen Belustigung und Resignation. Wozu sollte er dem Jungen Vorschriften machen, an die er sich an seiner Stelle ebenso wenig gehalten hätte?
»Der Quintenzirkel ist die systematische Anordnung aller zwölf Dur- und Molltonarten. Tonarten, die sich nur um ein Vorzeichen unterscheiden, liegen stets eine Quint auseinander. Wir bezeichnen sie deshalb als quintverwandte Töne.«
Er fing an, vor der Tafel auf und ab zu gehen, während er den drögen Stoff herunterbetete, den er damals selbst nur schwer hatte ertragen können. Inzwischen wusste er, dass die Musiktheorie unerlässlich war, wenn jemand das Handwerk des Musizierens erlernen wollte. Doch das traf offenbar auf keinen der zweiundzwanzig Schüler in diesem Raum zu.
Ein Papierflieger segelte knapp an seinem Ohr vorbei und legte an der Tafel eine Bruchlandung hin. Jemand rülpste ungeniert, zweite Bankreihe Mitte, den Namen hatte er vergessen. In der ersten Reihe stießen sich zwei Mädchen an und kicherten, der lang aufgeschossene Scott unterhielt sich über den Gang hinweg mit seinem Kumpel Rufus. Aus dem Augenwinkel beobachtete Robert, wie Mark abschweifte und aus dem Fenster schaute, wo die Mittagssonne gleißendes Licht auf die Kreidekästchen auf dem Schulhof warf. Die waren hier ebenfalls verboten, weshalb der Hausmeister jeden Nachmittag den Dampfstrahler bemühte.
Mit zwei Fingern schob Robert den Ärmel des Jacketts übers Handgelenk und linste auf seine Armbanduhr. Fünf Minuten bis zur Pausenklingel, auf dem Flur waren bereits Stimmen zu hören. Er sollte erleichtert über das nahende Ende seines Martyriums sein, war es aber nicht.
Gedankenverloren musterte er den mit Tonarten beschrifteten Kreis auf der Tafel, eher ein Oval oder ein angeschlagenes Osterei, je nachdem. Der Englischlehrer aus Der Club der toten Dichter hätte jetzt eine Textstelle aus einem literarischen Werk zitiert und seine Schüler aufgefordert, auf die Tische zu steigen, damit sie die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachteten. Aber er war nun mal keine Romanfigur. Er konnte nur versuchen, diese jungen Menschen mit einer Version von Robert Brenner zu erreichen, die er selbst gut leiden konnte.
»Okay, und was soll der ganze Scheiß jetzt?«
Die ungläubige Stille, die sich mit seinen Worten in den Raum legte, besaß etwas Befriedigendes. Leider währte sie nur so lange, bis am Fensterplatz in der letzten Reihe ein Bleistift auf die Tischplatte fiel und klackernd über die Holzfläche rollte.
»Das frage ich mich schon den ganzen Morgen, Professor Brenner«, sagte Mark im Tonfall eines Fünfzehnjährigen, der bereits alles von der Welt wusste. Zum ersten Mal in den vergangenen vierzig Minuten sah ihm der Bub ins Gesicht. Seine Augen waren dunkelbraun wie sein Haar und ebenso rebellisch; das hämische Gelächter seiner Mitschüler schien sein Selbstbewusstsein noch anzufeuern.
Jetzt bloß nicht einknicken. Entschlossen hielt Robert dem lauernden Blick des Halbwüchsigen stand, als habe er es mit einem bissigen Köter zu tun, den er aus undefinierbarem Grund mochte.
Wahrscheinlich war er der einzige Lehrer an dieser Schule, der in Mark O’Reilly mehr als den ewigen Störenfried sah. Laut Walter, dem Schuldirektor, war der Junge nur deswegen noch hier, weil seine Noten zu überragend und seine Vergehen zu nichtig für einen Rauswurf waren. Zumindest die, bei denen er sich hatte erwischen lassen. Aber Robert wusste, wozu dieser Junge imstande war, seit er vor drei Wochen mit der Musikklasse »Hello, Goodbye« von den Beatles einstudiert hatte – ein Schnellschuss zur Verabschiedung eines Kollegen, die Walter verbummelt hatte. Das Lied musste innerhalb weniger Tage stehen, doch die meisten Kinder kannten das Stück nicht, weshalb er es zu Demonstrationszwecken auf dem Piano vorgetragen hatte.
Mark hatte es mühelos auf seiner Geige nachgespielt. Fehlerfrei, vom ersten bis zum letzten Ton. Perfekte Tempi, exakt gesetzte Pausen, ohne einen Blick auf das Notenblatt zu verschwenden. Das absolute Gehör. Eine Gabe, die O’Reilly so egal war wie der sprichwörtliche Sack Reis am anderen Ende der Welt.
Drei Minuten bis zur Pause. Robert bückte sich und hob den Papierflieger auf. Fly home Prof! hatte jemand mit Bleistift auf einen Flügel gekritzelt und ein Hakenkreuz daruntergesetzt. Er seufzte und zeigte in die zweite Reihe, drittes Pult von links. Der blonde Junge nahm widerwillig die Kopfhörer seines Discman ab.
»Wie lautet dein Lieblingslied auf der CD, Nathaniel?«
Nathaniels Adamsapfel hüpfte. Verunsichert sah er sich um, aber seine Mitschüler wussten ebenso wenig, worauf der Lehrer hinauswollte. Gut so.
»›It’s Raining Men‹ von Geri Halliwell … Sir.« Die Antwort des Jungen provozierte allgemeines Gestöhne, Nathaniel zuckte die Achseln.
»Du hörst also gern Musik.« Eine Feststellung, keine Frage, die von dem Angesprochenen mit einem vorsichtigen Zahnspangen-Lächeln beantwortet wurde. Wann hatten sie eigentlich damit angefangen, Kindern das Gefühl zu geben, dass sie ständig vor den Erwachsenen auf der Hut sein müssten, um in der Welt klarzukommen?
»Um auf Mr O’Reillys Frage einzugehen …« Aus dem Augenwinkel sah er, dass Marks Stuhl endlich mit vier Beinen auf dem Boden stand. Im Gesicht des Teenagers lag skeptisches Interesse.
»Wir alle lieben Musik, ganz gleich welcher Art. Das tun wir aus gutem Grund.« Er zwinkerte Nathaniel zu, der seinen Discman mit knallrotem Kopf im Rucksack verstaute. »Neben der Malerei und der Literatur ist die Musik eines der wenigen Dinge, das uns Menschen seit Jahrtausenden verbindet. Sie funktioniert wie eine Art sozialer Klebstoff: Wenn wir zusammen musizieren, singen und tanzen, schenkt uns das ein Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Das macht die Musik so wichtig, für uns als Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen.« Er ließ seinen Schülern Zeit, das Gehörte zu verdauen. Sein Puls war erhöht, er fühlte sich fiebrig und kurzatmig. So war es jedes Mal, wenn er über seine große Leidenschaft sprach. »Doch wir wären keine Menschen, wenn wir uns nicht die Frage nach dem Genie stellen würden. Viele Menschen in Ihrem Alter träumen von einer Bühne. Doch was unterscheidet diejenigen im Scheinwerferlicht von all den anderen in den Zuschauerreihen? Natürlich können Sie eine Ballade von U2, einen Folksong der Dubliners oder eine Sinfonie von Mozart lieben. Sie können eine gewisse Begabung für ein Instrument haben. Aber steckt deshalb ein Musiker oder eine Musikerin in Ihnen? Sind Talent und die Liebe zur Musik die einzigen Zutaten im Rezept für Ruhm und Ehre?« Fragend sah er die Mädchen in der zweiten Reihe an. Die Dunkelhaarige wechselte einen Blick mit ihrer Banknachbarin und schüttelte zögernd den Kopf. »Korrekt, Miss Clarke!« Er schnalzte. »Die Antwort ist ein klares Nein. Im Alphabet kommt Anstrengung vor Erfolg, und wer in der Welt der Musik Fuß fassen möchte, muss die Melodien visualisieren können.« Er tippte auf das Tonarten-Schema an der Tafel und hob die Stimme. »Nur wer die Musik sieht, ist imstande, sie zu erschaffen. Vielleicht sogar für die Ewigkeit.«
Jemand klatschte. Laut und provozierend langsam, aber das Geräusch kam nicht vom Fensterplatz in der letzten Reihe.
»Excellent, Herr Kollege! Das nenne ich mal einen ambitionierten Quintenzirkel-Vortrag.«
Robert drehte sich um und begegnete dem spöttischen Grinsen von Alan O’Keefe, dem einzigen Kollegen, den er mit Freuden siezen würde, hätte ihm jemand bei Dienstantritt die Wahl gelassen.
Wie lange O’Keefe schon an der Tür lehnte, vermochte er nicht zu sagen. Ihm war nur klar, dass das Wort ambitioniert nicht als Kompliment gemeint war. Wut kochte in ihm hoch, aber zu Alans Glück durchbrach die Pausenklingel die eingetretene Stille. Er hätte sonst für nichts garantieren können. Auch nachdem die Schüler den Raum verlassen hatten – Mark O’Reilly war mit schleifenden Schnürsenkeln an ihm vorbeigeschlendert, als könnte er durch sein gemäßigtes Tempo Überlegenheit demonstrieren –, fand Robert, dass seine Faust hervorragend in die blutarme Visage seines Fachkollegen gepasst hätte.
»›Was soll der ganze Scheiß?‹ Das war nicht gerade pädagogisch wertvoll ausgedrückt, Robert.« Alan trug weiterhin sein gönnerhaftes Lächeln zur Schau, das so falsch war wie eine von einem Anfänger gespielte Sonate.
O’Keefe gönnte ihm nicht den Dreck unter den Fingernägeln, was Robert auf dessen eigene musikalische Mittelmäßigkeit zurückführte. Darüber hinaus war Alan bislang der einzige Musiklehrer an der Campbell Park School gewesen. Dass er für den Starpianisten Robert Brenner zur Seite rücken musste, war ein Drops, an dem er schwer schluckte, zumal sein Konkurrent keinerlei pädagogische Qualifikation vorzuweisen hatte. Insofern war Robert der Unmut des Kollegen sogar verständlich. Doch O’Keefe, zerfressen von Neid, Missgunst und Minderwertigkeitsgefühlen, hatte von Anfang an keine Gelegenheit ausgelassen, sich ihm gegenüber wie ein Arschloch zu verhalten.
An diesem Tag würde er sich jedoch nicht provozieren lassen. O’Keefes bohrenden Blick im Rücken packte er seine Tasche.
»Ist sonst noch was, Kollege?« Er konnte sie nicht vermeiden, diese winzige Pause, ehe er das Wort Kollege herauswürgte.
»Walter will uns sehen. Dringende Lagebesprechung für den Fachbereich.«
Robert nickte, in Gedanken war er längst zu der zurückliegenden Schulstunde zurückgekehrt. Etwas war im Klassenzimmer passiert. Ihm wollte nur nicht einfallen, was.
Die Erkenntnis überfiel ihn, als sie das Hauptgebäude erreicht hatten und O’Keefe vor ihm in den blassgrün getünchten Gang des Verwaltungstrakts einbog. Den betäubenden Geruch von Holzpolitur in der Nase blieb Robert wie vom Donner gerührt stehen, den Blick ans Mitteilungsbrett geheftet, wo die Aushänge zu unleserlichen Flecken verschwammen. Sein Herz klopfte, während er sich Mark O’Reillys Gesicht ins Gedächtnis rief, seine aufsässigen Augen und die winzigen Kreolen an seinen Ohrläppchen, die ihm etwas irritierend Mädchenhaftes verliehen. Vielleicht täuschte er sich, womöglich spielte sein Wunschdenken seiner Wahrnehmung einen Streich. Aber im Nachhinein war er sich fast sicher, dass ihm der Junge beim Verlassen des Klassenzimmers anerkennend zugelächelt hatte.
***
O’Keefe saß auf dem Besucherstuhl vor Walters Schreibtisch, als Robert das Schulleiterbüro betrat. Eine weitere Sitzgelegenheit gab es nicht, weshalb er sich neben dem Aktenschrank postierte und das Zigarettenpäckchen auf dem Tisch anstarrte. Sein Gaumen zog sich zusammen. Drei Monate war seine letzte Zigarette her, geraucht am Münchner Flughafen, ein symbolischer Abschied vom Nikotin und seinen Depressionen. Aber er hatte die Sucht unterschätzt. Das Verlangen kam stets wieder, und manchmal war es so stark, dass ihm Tränen in die Augen traten.
»Nimm dir eine«, sagte Walter, der seinen Blick bemerkt hatte. Er bemerkte immer alles, auch die Spannungen, die zwischen seinen Lehrkräften herrschten. Robert lehnte höflich ab, was O’Keefe die perfekte Gelegenheit bot, einen auf Kumpel mit dem Chef zu machen.
»Ich bin so frei, Walter«, sagte Alan und ließ sich von seinem Vorgesetzten Feuer geben.
Der Schulleiter zündete sich ebenfalls eine Zigarette an und lehnte sich im Schreibtischsessel zurück. Blauer Dunst stieg auf, dem das typische einträchtige Schweigen der gemeinsamen Raucherpause folgte. Robert atmete so flach wie möglich und überlegte, ob er vollends den Spießer mimte, wenn er das Fenster öffnete. Doch er sah, dass Walter Cunningham – dieser schwergewichtige Mann, der so viel besser auf den Rugbyplatz da draußen als in dieses sterile Büro gepasst hätte – nach Worten suchte, obwohl er sonst nie um Worte verlegen war. Also verharrte Robert geduldig an Ort und Stelle, während O’Keefe belangloses Zeug von defekten Tamburinen und verloren gegangenen Musikschrankschlüsseln plapperte und nicht mitbekam, dass keiner ihm zuhörte.
Die Warteschleife endete, als Walter den Stummel seiner Zigarette in dem Tonaschenbecher ausdrückte, ein verbeultes, schiefes Gefäß, das zweifellos im hiesigen Töpferkurs entstanden war. Robert fand, es sagte viel über seinen Chef aus, dass er das hässliche Ding auf seinem Schreibtisch duldete.