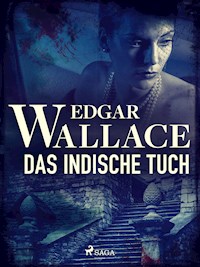
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Edgar Wallace Krimiklassiker "Das indische Tuch" wird der Chauffeur Studd eines Morgens erwürgt an einem Feldweg aufgefunden. Hat der mehrfach vorbestrafte Biggs etwas mit der Tat zu tun? Verdächtig scheint ebenfalls der ein oder andere Bedienstete von Marks Priory, bei dem der Ermordete angestellt war. Und auch die Herrschaften des alten Schlosses könnten etwas zu verbergen haben…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Edgar Wallace
Das indische Tuch
Übersezt von Hans Herdegen
Saga
Das indische Tuch
Übersezt von Hans Herdegen
Titel der Originalausgabe: The Frightened Lady
Originalsprache: Englisch
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1933, 2022 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728294239
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
Ein amerikanischer Diener ist an sich ein Widerspruch. Selbst Brooks gab das dem Butler Kelver gegenüber zu, obwohl er dadurch seine eigene Existenzberechtigung verneinte. Seine große, kräftige Gestalt kam in der schmucken Livree gut zur Geltung; sein Haar war grau und dünn. Aus seiner Westentasche schaute stets ein angebrochenes Paket Kaugummi hervor.
Auch sein Kollege Gilder paßte nicht zu dem Haushalt des Schlosses Marks Priory. Die beiden waren für ihren Beruf nicht besonders begabt und lernten anscheinend auch nichts dazu. Trotzdem waren sie nette Leute und benahmen sich den anderen Dienstboten gegenüber immer sehr höflich.
Man hatte sie im allgemeinen gern, wenn man Gilder auch ein wenig fürchtete. Seine hagere Erscheinung mit dem eingefallenen, durchfurchten Gesicht wirkte etwas düster, außerdem besaß er unheimliche Körperkräfte.
John Tilling, einer der Parkwächter, bekam das zu spüren. Auch er war groß und stattlich, aber rotblond und von jähzornigem Temperament. Wilde Eifersucht beherrschte ihn, denn seine hübsche junge Frau ging gern ihre eigenen Wege.
Mrs. Tilling hatte zum Beispiel einen Pferdeknecht aus dem Dorf kennengelernt, der ein rotes, grobes Gesicht hatte, nach Stall und Bier roch und sie auf seine plumpe Art liebte. Aber in ihrer Phantasie wurde er zu einem verwunschenen Prinzen und sie zu einer befreiten Prinzessin. Das war jedoch ein alter Skandal. Später entwickelte sie größeren Ehrgeiz und ließ sich mit höhergestellten Leuten ein; allerdings wußte ihr Mann nichts von alledem.
Eines Nachmittags hielt er Gilder an, der gerade von dem alten Klosterfeld herüberkam.
»Entschuldigen Sie!« sagte Tilling höflich, aber mit einem drohenden Unterton in seiner Stimme. »Sie sind in letzter Zeit einige Male in meinem Haus gewesen, während ich unterwegs in Horseham war.«
Er fragte nicht, er stellte eine Tatsache fest.
»Gewiß«, erwiderte der Amerikaner langsam. »Mylady gab mir den Auftrag, wegen der letzten Eiersendung nachzufragen, die ihr in Rechnung gestellt wurde. Sie waren damals nicht zu Hause, deshalb kam ich am nächsten Tag noch einmal.«
»Und da war ich wieder nicht da«, entgegnete Tilling, dessen Gesicht sich rötete.
Gilder sah ihn nur lächelnd an. Er ahnte nichts von den Liebesabenteuern der Mrs. Tilling, denn der Dorfklatsch interessierte ihn nicht.
»Das stimmt. Sie waren irgendwo im Wald.«
»Aber meine Frau haben Sie getroffen und mit ihr Tee getrunken!«
Gilder wurde ärgerlich. Er lächelte jetzt nicht mehr, und sein Blick wurde hart.
»Worauf wollen Sie hinaus?«
Plötzlich packte ihn der Parkwächter am Rock.
»Bleiben Sie von meinem Haus fort –«
Weiter kam Tilling nicht, denn der amerikanische Diener nahm ihn behutsam am Handgelenk, drehte seine Hand und machte sich frei.
Wäre Tilling ein schwaches Kind gewesen, so hätte er nicht weniger Widerstand leisten können.
»Tun Sie das nicht wieder. Ja, ich habe Ihre Frau gesehen und habe auch Tee mit ihr getrunken. Für Sie mag sie eine schöne Frau sein, aber für mich besteht sie nur aus zwei hübschen Augen und einer Nase. Merken Sie sich das!«
Er bog Tillings Unterarm mit einem Jiu-Jitsu-Griff leicht nach hinten.
Der Parkwächter taumelte zurück, und es machte ihm große Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Er war ein langsam denkender Mann, den unmöglich zwei Gemütsbewegungen zu gleicher Zeit beherrschen konnten. Deshalb zeigte er sich in diesem Augenblick nur erstaunt.
»Sie kennen Ihre Frau besser als ich«, erklärte Gilder, während er sich zu seiner vollen Größe aufrichtete. »Vielleicht beurteilen Sie ihren Charakter richtig, aber wenn Sie Verdacht auf mich haben, dann täuschen Sie sich gewaltig.«
Als er nach einer Besorgung beim Apotheker vom Dorf zurückkam, fand er Tilling beinahe an derselben Stelle, an der er ihn vorher verlassen hatte.
Der Parkwächter war nicht mehr aufsässig und machte Gilder keine weiteren Vorwürfe, in gewisser Weise versuchte er sogar, sich bei dem Amerikaner zu entschuldigen. Man sagte Gilder nach, daß er Einfluß auf die Schloßherrin hätte.
»Es wäre mir lieb, Mr. Gilder, wenn Sie die Geschichte vergessen wollten. Ich habe eine kleine Auseinandersetzung mit meiner Frau gehabt und bin sehr aufgeregt. Es kommen so viele Leute in mein Haus, aber ich glaube, daß Sie als verheirateter Mann –«
»Das stimmt schon wieder nicht. Ich bin nicht verheiratet, aber ich bin häuslich veranlagt. Und jetzt wollen wir nicht mehr über die Sache reden.«
Später erzählte er Brooks den Vorfall, und der korpulente Mann hörte ruhig zu, während er seinen Kaugummi bearbeitete.
»Haben Sie schon einmal von Messalina gehört, Gilder?« fragte er dann. »Sie war eine Italienerin, die Frau von Julius Cäsar oder so einem ähnlichen Kerl.«
Brooks las viel, und er hatte auch ein Gedächtnis für Namen.
2
Der Herrensitz Marks Priory war schon zur Zeit der Sachsen gegründet worden, und der Westturm hatte ein hohes Alter. Die anderen Teile des Gebäudes stammten aus den verschiedensten Zeiten. Lord Willie Lebanon, der Herr von Marks Priory, ärgerte sich über das Haus, obwohl ihn der Aufenthalt hier in gewisser Weise beruhigte. Dr. Amersham hielt es für ein Gefängnis, in dem er eine unangenehme Pflicht zu erfüllen hatte, und nur Lady Lebanon sah darin den Stammsitz ihres uralten Geschlechts.
Lady Lebanon war schlank und nicht allzu groß, aber ihre tadellose Figur wirkte weder klein noch unbedeutend. Das reiche, schwarze Haar, das dem feingeschnittenen Gesicht einen reizvollen Rahmen gab, trug sie in der Mitte gescheitelt. Von Zeit zu Zeit leuchteten ihre dunklen Augen auf und verrieten einen fanatischen Charakter, obwohl sie sonst in ihrem Wesen fest, kühl und klar war. Immer schien sie sich bewußt zu sein, daß sie als Aristokratin die Pflicht hatte, zu repräsentieren; der Geist der neuen Zeit hatte sie nicht berührt. Sie hatte einen Vetter geheiratet und war erfüllt von der Bedeutung des alten Geschlechts der Lebanon.
Ihr Sohn Willie fand wenig Freude an dem Leben, das er auf Marks Priory führen mußte, und langweilte sich. Obwohl er verhältnismäßig schwächlich war, hatte er mit Erfolg die Militärakademie in Sandhurst besucht. Darauf tat er als Leutnant zwei Jahre Dienst in Indien, was einen sehr guten Einfluß auf seinen Gesundheitszustand hatte. Schließlich bekam er jedoch einen schweren Fieberanfall und wurde dadurch etwas nervös und unruhig. Lady Lebanon erzählte das ihren Gästen, wenn sie sich überhaupt zu einer Erklärung herbeiließ. Unvoreingenommene Beobachter hätten vielleicht einen anderen Grund für die Nervosität des Lords finden können.
Langsam stieg er eben die große Wendeltreppe in dem runden Turm von Marks Priory hinunter, die in die große Halle führte. Er war fest entschlossen, endlich mit seiner Mutter ins reine zu kommen. Schon oft hatte er diesen Entschluß gefaßt, aber bisher niemals den Mut und die Energie aufgebracht, seine Absicht tatsächlich auszuführen.
Sie saß gerade an ihrem Schreibtisch und las ihre Briefe. Als er in die Halle trat, sah sie ihn lange und durchdringend an und brachte ihn allein dadurch schon in Verlegenheit.
»Guten Morgen, Willie.«
Ihre Stimme klang angenehm, aber es lag eine gewisse Härte darin, die auf den jungen Lord einen unangenehmen Eindruck machte.
»Kann ich einmal mit dir sprechen?« fragte er schließlich.
Er versuchte, sich zu vergegenwärtigen, was er ihr sagen wollte. Er war das Haupt der Familie... er war der Herr von Marks Priory in der Grafschaft Sussex... er hatte zu befehlen und anzuordnen!
»Ja, was wünschst du, Willie?«
Sie lehnte sich in ihren Sessel zurück und faltete die schöngeformten Hände.
»Ich habe Gilder entlassen«, erwiderte er unsicher. »Er benimmt sich geradezu unverschämt... es ist überhaupt lächerlich, daß man Amerikaner im Schloß duldet, die nicht wissen, wie sie sich zu betragen haben. Es gibt doch genug englische Dienstboten, die du engagieren könntest. Brooks ist mindestens ebenso schlimm...«
Hier ging ihm der Atem aus, aber sie wartete geduldig. Wenn sie doch nur etwas gesagt hätte oder ärgerlich geworden wäre! Er war doch tatsächlich Herr im Hause! Unglaublich, daß er nicht einmal einen Dienstboten entlassen konnte, wenn er wollte. Er hatte doch eine ganze Schwadron kommandiert, allerdings nur in Vertretung des Rittmeisters, der auf Urlaub war. Aber der Regimentskommandeur hatte lobend anerkannt, daß Willie trotz seiner Jugend seine Aufgabe ausgezeichnet durchgeführt hatte und mit den Leuten fertig geworden war.
Der junge Lord räusperte sich.
»Es macht mich doch vor den Leuten lächerlich«, fuhr er fort. »Ich meine, die Lage, in der ich mich hier befinde. Im Wirtshaus reden die Bauern darüber, und man hat mir gesagt, daß im Dorf alle darüber sprechen.«
»Wer hat dir das gesagt?«
Seine Mutter sprach sehr energisch, und bei dem metallischen Klang ihrer Stimme fuhr er erschrocken zusammen.
»Nun, die Leute erzählen, daß ich mich wie ein kleiner Junge benehme, der immer an der Schürze seiner Mutter hängt, und so weiter.«
»Wer hat das gesagt?« fragte sie wieder. »Etwa Studd?«
Er wurde rot, denn sie hatte das Richtige getroffen. Aber er mußte dem Chauffeur gegenüber sein Wort halten und durfte ihn nicht verraten.
»Studd? Um Himmels willen, nein! Ich würde doch dergleichen nicht mit einem Angestellten besprechen. Nein, ich habe es hintenherum gehört, und auf jeden Fall habe ich Gilder entlassen.«
»Es tut mir leid, daß ich ohne Gilder nicht auskommen kann. Außerdem ist es nicht angebracht, daß du einen Dienstboten entläßt, ohne dich vorher mit mir in Verbindung zu setzen.«
Er zog einen Sessel an die andere Seite des Schreibtisches und ließ sich ihr gegenüber nieder. Dann machte er einen energischen Versuch, ihr in die Augen zu schauen, aber er starrte doch nur den silbernen Leuchter an, der etwas seitwärts in gleicher Höhe mit ihrem Kopf stand.
»Allen Leuten ist es aufgefallen, wie sich diese beiden benehmen«, sagte er hartnäckig. »Sie denken gar nicht daran, mich mit Mylord anzureden. Daran liegt mir allerdings auch nicht viel, denn wir leben in einer demokratischen Zeit. Aber sie tun nichts im Hause, sie sind vollkommen unnütz und stehen nur herum. Ich habe doch recht, Mutter!«
Sie lehnte sich etwas vor.
»Du hast unrecht, Willie. Ich brauche die beiden hier, und du hast keine Ursache, voreingenommen gegen sie zu sein, nur weil sie Amerikaner sind.«
»Ich habe keine Vorurteile gegen sie –«
»Bitte, unterbrich mich nicht, wenn ich spreche, mein lieber Junge. Du mußt nicht auf die Geschichten hören, die Studd dir erzählt. Er ist ein netter, umgänglicher Mensch, aber ich weiß nicht, ob er der richtige Chauffeur für Marks Priory ist.«
»Du willst ihn doch nicht etwa entlassen?« protestierte er. »Verdammt noch mal, ich habe drei gute Kammerdiener gehabt, und jedesmal sagtest du, sie wären nicht die richtigen Leute für mich, obwohl ich sehr gut mit ihnen auskam!« Er nahm allen Mut zusammen. »Ich glaube, daß sie nur Amersham nicht paßten!«
Sie warf den Kopf leicht zurück.
»Ich richte mich nie nach Dr. Amershams Ansicht, ich frage ihn nicht um Rat und lasse mich auch nicht durch ihn leiten«, erwiderte sie scharf.
Er gab sich die größte Mühe, ihren Blick auszuhalten.
»Was macht der Doktor überhaupt im Schloß?« fragte er. »Er lebt hier in Marks Priory, obwohl er mir unausstehlich ist. Wenn ich dir erzählte, was ich alles von ihm gehört habe –«
Er brach plötzlich ab, denn die beiden abgezirkelten, roten Flecke auf ihren Wangen waren ein Sturmsignal, das er nur zu gut kannte.
Zu seiner größten Erleichterung kam Isla Crane in die Halle. Sie hielt einige Briefe in der Hand, als sie aber Mutter und Sohn im Gespräch sah, zögerte sie. Dann wollte sie sich schnell zurückziehen, aber Lady Lebanon rief sie herbei.
Isla war vierundzwanzig Jahre alt. Sie hatte dunkle Haare, dunkle Augen und eine schlanke, anmutige Gestalt.
Willie Lebanon grüßte sie mit einem Lächeln, denn Isla gefiel ihm. Einmal hatte er über sie mit seiner Mutter gesprochen, und zu seinem größten Erstaunen hatte sie ihm keine Vorhaltungen gemacht. Isla war eine entfernte Kusine von ihm und arbeitete als Sekretärin bei Lady Lebanon. Auch auf Dr. Amersham machte sie tiefen Eindruck. Aber davon wußte Lady Lebanon nichts.
Isla legte die Briefe auf den Tisch und war zufrieden, als Mylady sie nicht zurückhielt.
»Findest du nicht, daß sie sehr schön ist?« fragte Lady Lebanon, als die Sekretärin gegangen war.
Eine sonderbare Frage, denn seine Mutter lobte nur selten andere Menschen. Er glaubte daher, daß sie der Unterhaltung eine andere Wendung geben wollte, und das war ihm nur recht, da sein Mut und seine Energie erschöpft waren.
»Ja, sie ist fabelhaft«, entgegnete er nicht sehr begeistert, war aber gespannt, was sie nun sagen würde.
»Es ist mein Wunsch, daß du sie heiratest«, erklärte sie ganz ruhig.
Er starrte sie an.
»Warum soll ich denn Isla heiraten?« fragte er bestürzt.
»Sie ist doch ein Mitglied unserer Familie. Ihr Urgroßvater war der jüngere Bruder deines Urgroßvaters.«
»Aber ich will doch gar nicht heiraten –«
»Rede nicht so albern, Willie. Du mußt heiraten, und Isla ist in jeder Beziehung eine gute Partie. Geld hat sie zwar nicht, aber darauf kommt es auch nicht an. Sie ist aus guter Familie, das ist die Hauptsache.«
Er sah sie immer noch entsetzt an.
»Heiraten? Ich habe doch nie daran gedacht. Nein, der Gedanke ist mir schrecklich. Sie ist zwar sehr nett, aber –«
»Ich wünsche, daß du deinen eigenen Haushalt führst.«
Er dachte bei sich, daß er das schon längst tun würde, wenn sie ihn nur schalten und walten ließe.
»Wenn die Leute darüber reden, daß du dich an die Schürze deiner Mutter hängst, muß dir dieser Vorschlag doch willkommen sein. Ich möchte nicht deinetwegen mein ganzes Leben hier in Marks Priory verbringen.«
Das war allerdings eine verlockende Aussicht. Willie Lebanon atmete tief auf, dann erhob er sich.
»Natürlich muß ich einmal heiraten, aber es ist furchtbar schwer...« Er zögerte, bevor er weitersprach. Wie würde sie sein Geständnis aufnehmen? »Ich habe versucht, mich ein wenig mit ihr anzufreunden – ja, ich habe sie vor etwa vier Wochen sogar einmal geküßt, aber sie war entsetzlich widerspenstig!«
»Das war auch nicht recht von dir, sie einfach zu küssen!«
Gilder kam in Sicht, und Willie war froh, daß die Unterhaltung unterbrochen wurde.
Gilders Livree war von einem guten Londoner Schneider angefertigt worden, aber der Amerikaner hatte eine unglückliche Figur.
Lord Lebanon wartete auf die Vorwürfe seiner Mutter, die seiner Erfahrung nach nicht ausbleiben konnten, aber sie sagte nichts über das vernachlässigte Aussehen des Dieners, sie fragte nicht einmal, wie er dazu käme, sie ohne weiteres zu stören.
»Wünschen Sie etwas, Mylady?« erkundigte sich Gilder.
Als sie den Kopf schüttelte, verließ er langsam die Halle.
»Wenn du ihn nur gefragt hättest, was, zum Teufel, er eigentlich wollte –«
»Denke an das, was ich dir über Isla gesagt habe«, unterbrach sie ihn, ohne sich um seinen Protest zu kümmern. »Sie ist entzückend – und sie stammt aus unserer Familie. Ich werde ihr mitteilen, daß ich eine Heirat zwischen euch beiden wünsche!«
Er schaute sie verblüfft an.
»Weiß sie denn noch nichts davon?«
»Und was nun Studd angeht –«, sie runzelte die Stirn.
»Du wirst ihn doch nicht entlassen? Er ist wirklich ein sehr guter Kerl, und er hat mir auch gar nichts erzählt.«
Später traf Lord Lebanon den Chauffeur in der Garage.
»Ich fürchte, daß ich Ihnen keinen guten Dienst erwiesen habe«, erklärte er schuldbewußt. »Ich sagte heute zu meiner Mutter, daß die Leute über mich klatschen...«
Studd richtete sich grinsend auf.
»Ach, darauf kommt es mir nicht an, Mylord.«
Der etwa fünfunddreißigjährige Mann hatte ein frisches, gesundes Aussehen. Früher war er Soldat gewesen und hatte in Indien gedient.
»Ich gebe die Stellung hier nicht gern auf, aber ich glaube nicht, daß ich noch lange bleiben kann. Gegen Mylady habe ich nichts, sie ist immer sehr höflich und wohlwollend zu mir. Dagegen werden Sie wie ein Sklave von ihr behandelt. Ich gehe nur wegen dieses gemeinen Kerls.«
Lord Lebanon seufzte. Er brauchte nicht erst zu fragen, wer dieser gemeine Kerl wäre.
»Wenn Mylady ebensoviel von ihm wüßte wie ich«, sagte Studd geheimnisvoll, »dann würde sie ihm das Haus verbieten!«
»Was wissen Sie denn?« erwiderte Lebanon neugierig.
Er hatte diese Frage schon früher gestellt, aber nie eine genaue Antwort darauf erhalten.
»Wenn die Zeit kommt, werde ich auch ein paar Worte zu reden haben. Er war doch in Indien?«
»Selbstverständlich. Er fuhr hin, um mich nach Hause zu bringen, und in früheren Jahren war er drüben Regierungsarzt. Wissen Sie etwas über ihn – ich meine über seine Affären in Indien?«
»Im rechten Augenblick melde ich mich schon und sage, was ich über ihn denke«, erwiderte Studd düster.
Er zeigte auf einen Anbau an der Garage. Dort stand ein neuer Wagen, den Willie noch nie gesehen hatte.
»Die Karre gehört ihm. Wo kriegt er nur das Geld her, daß er sich so einen Wagen anschaffen kann? Der kostet doch ein paar tausend Pfund. Und als ich den Mann damals kannte, war er pleite. Ich möchte nur wissen, woher er das Geld nimmt.«
Willie Lebanon hatte seiner Mutter schon oft dieselbe Frage vorgelegt, ohne eine Antwort darauf zu erhalten.
Der junge Lord haßte Dr. Amersham; alle Leute mit Ausnahme seiner Mutter und der beiden amerikanischen Diener haßten den kleinen, energischen Herrn, der sich etwas zu auffällig kleidete und zuviel Parfüm gebrauchte. Überall versuchte Dr. Amersham sich Geltung zu verschaffen, und wenn man dem Dorfklatsch trauen konnte, war er auch ein Schürzenjäger. Aus unbekannten Gründen flossen ihm plötzlich reichliche Mittel zu; er besaß eine schöne Wohnung in der Devonshire Street in London, hatte drei Rennpferde und lebte auch sonst auf großem Fuß. Häufig war er in Marks Priory; er kam zu jeder Tageszeit mit seinem Auto von London und brachte dann ein bis zwei Stunden im Herrenhause zu. Und sobald er erschien, war es, als ob er nur zu befehlen hätte.
*
Der Arzt stieg die Treppe herunter, auf der er schon einige Zeit gestanden und gelauscht hatte. Eine Sekunde, nachdem Willie gegangen war, kam er näher und zog einen Stuhl an den Schreibtisch, an dem Lady Lebanon saß. Er nahm eine Zigarette aus seinem goldenen Etui und steckte sie an, ohne um Erlaubnis zu fragen.
Dr. Amersham blies einen Rauchring in die Luft und sah Lady Lebanon an.
»Was ist das für eine neue Idee, daß Willie Isla heiraten soll?«
»Sie haben wohl auf der Treppe gelauscht?«
»Ja. Da ich nichts erfahre, muß ich alles selbst herausfinden. Isla soll also den Jungen heiraten?«
»Warum nicht?« fragte sie scharf.
Seine Augen waren rot und entzündet, und seine Hand zitterte, als er die Zigarette aus dem Mund nahm. Er hatte eine Gesellschaft in seiner Wohnung gegeben und nur wenig geschlafen.
»Haben Sie mich deshalb gerufen? Beinahe wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ich hatte eine schlaflose Nacht, ein Patient –«
»Sie haben keinen Patienten gehabt«, erklärte sie ruhig. »Ich bezweifle, daß jemand in London so unvernünftig ist, Sie als Arzt zu nehmen!«
Er lächelte.
»Sie selbst haben mich doch engagiert – das genügt vollkommen. Einen so guten Patienten findet man so bald nicht wieder.«
Er lachte über diesen Scherz, aber Lady Lebanons Gesichtsausdruck blieb starr.
»Ihr Chauffeur ist wirklich nicht viel wert. Der Kerl ist ziemlich unverschämt; er hatte doch die Frechheit, mich zu fragen, warum ich mir nicht meinen eigenen Chauffeur mitbringe! Außerdem steht er auch auf etwas zu vertrautem Fuß mit Willie!«
»Wer hat Ihnen das gesagt?« fragte sie schnell.
»Das habe ich gehört. Es gibt genug Leute in der Nähe, die mir mitteilen, was hier passiert.« Er lächelte befriedigt, denn er hatte wirklich zwei sehr gute Freunde in Marks Priory; außerdem war da die hübsche Mrs. Tilling. Andererseits verehrte die Frau des Parkwächters auch den Chauffeur Studd, was Dr. Amersham zu seinem größten Mißvergnügen entdeckt hatte.
»Und was sagt Isla zu der Heirat?«
»Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen.«
»Keine schlechte Idee. Merkwürdigerweise ist mir der Gedanke noch nie gekommen. Isla... ja, eine außerordentlich gute Idee.«
Wenn sie über seine Worte erstaunt war, so zeigte sie es jedenfalls nicht.
»Außerdem ist sie eine Blutsverwandte der Lebanons. Ist es nicht schon einmal in der Geschichte der Familie vorgekommen, daß Vetter und Kusine einander unter ähnlichen Umständen geheiratet haben?« Er sah zu den dunklen Bildern auf, die an den hohen Wänden hingen. »Ich habe ein gutes Gedächtnis und kenne die Geschichte der Lebanons fast ebensogut wie Sie.« Umständlich zog er seine Uhr heraus. »Ich wollte bald wieder zurückfahren nach London –«
»Ich möchte aber, daß Sie bleiben«, erklärte sie kurz.
»Ich habe eine Konferenz heute nachmittag –«
»Trotzdem bleiben Sie. Ich habe ein Zimmer für Sie richten lassen. Studd muß natürlich entlassen werden; er hat Willie von dem Dorfklatsch erzählt.«
Er richtete sich plötzlich auf. Hatte am Ende Mrs. Tilling etwas gesagt?
»War es etwas über mich?« fragte er schnell.
»Was sollten die Leute im Dorf denn über Sie reden?«
Er lachte ein wenig verwirrt.
Sie wußte, daß seine Heiterkeit nur vorgetäuscht war, aber sie machte keine Bemerkung darüber.
Dr. Amersham fügte sich. Er murrte zwar noch etwas, fand aber keine weitere Ausrede.
Er hatte auch gar nicht die Absicht, zur Stadt zurückzukehren; er wollte die Nacht in einem kleinen Haus in der Nähe verbringen, das er sich von einem jungen Londoner Innenarchitekten hatte ausstatten lassen. Dort hatte er eine Verabredung. Aber von alledem ahnte Lady Lebanon natürlich nichts.
»Haben Sie übrigens Studd einmal in Indien getroffen?« fragte sie unvermittelt, als er sich zum Gehen wandte. »Er hat in Puna gedient.«
Er drehte sich rasch um; sein Gesichtsausdruck hatte sich vollständig verändert.
»In Puna?« fragte er scharf. »Wann war das?«
»Das weiß ich nicht. Aber er hat anderen Leuten erzählt, daß er Sie dort kannte. Das wäre eine weitere Veranlassung, ihm zu kündigen.«
Dr. Amersham wollte Studd noch aus einem anderen Grund von Marks Priory entfernen, aber darüber schwieg er selbstverständlich.
3
Mr. Kelver, der Butler von Marks Priory, verbrachte abends gern eine Stunde vor dem Nebeneingang und betrachtete von dort aus die Gegend. Wie schon oft überlegte er gerade wieder, ob es mit seiner Würde vereinbar wäre, jeden Abend schon um neun Uhr von seiner Herrschaft getrennt zu werden. Genau um diese Stunde schloß Lady nebenan nämlich die große Eichentür zu, die den Nordostflügel des Herrenhauses von den anderen Räumen abgrenzte.
Die Quartiere der Dienerschaft waren sehr geräumig und behaglich eingerichtet, und mit Erlaubnis Mr. Kelvers konnten die Angestellten ein- und ausgehen, wann und wie sie wollten. Sie benutzten dann den Fußweg, der am Wald entlang zum Dorf hinunterführte. Aber er empfand es doch als starke Zurücksetzung, fast als Beleidigung, daß er selbst, der in hochadligen Häusern gedient hatte, auch mit den anderen Dienstboten vom Herrenhaus ausgeschlossen wurde.
Die Tür, vor der er stand, lag im Nordostflügel und war in gewisser Weise ein Privateingang für ihn selbst. Die anderen Angestellten gingen wie die Kaufleute und Lieferanten durch die kleine Eingangshalle.
Studd gegenüber sprach er sich manchmal aus, wenn er auch diesem höflichen und erfahrenen Mann niemals sein volles Vertrauen schenkte.
Der Chauffeur war gerade auf dem Weg zur Garage, bog um einen der beiden großen Ecktürme des Schlosses und blieb bei Kelver stehen. Da er etwas erhitzt aussah, dachte Kelver zuerst, Studd hätte zuviel getrunken.
»Ich habe diesem Dr. Amersham endlich einmal die Meinung gesagt«, begann Studd und zeigte mit dem Daumen über die Schulter. »Das will nun ein großer Herr und ein Doktor sein! Wenn Mylady wüßte, was ich weiß, bliebe der Kerl keine fünf Minuten länger im Haus! Der war bei der indischen Armee! Na, ich könnte etwas erzählen, wenn man mich fragte!«
»Um was handelt es sich denn?« erkundigte sich Mr. Kelver höflich. Er tat immer so, als ob er Klatsch nicht hören wollte, obwohl er sehr begierig darauf war, das Neueste zu erfahren.
»Es ist merkwürdig. Ich habe im Dorf einen komischen Mann getroffen, der mir erzählte, daß er früher in Indien gewesen wäre. Darauf lud ich ihn zu einem Glas Bier ins Wirtshaus ein. Bei der Unterhaltung habe ich nicht viel gesagt, sondern nur zugehört, aber es ist ganz klar, daß er tatsächlich dort war.«
Kelver hob den ergrauten Kopf und sah den kleinen Chauffeur von oben herab an.
»Hat Dr. Amersham sich über etwas beklagt?« fragte er.
Studd wurde dadurch wieder an seinen Ärger erinnert.
»Es ist etwas an seiner Karre passiert, und ich sollte die Sache in fünf Minuten reparieren. Dazu braucht man aber mindestens zwei Tage. Er meint, er hätte hier alles zu sagen, aber wir wissen doch genau, daß er nicht der Herr im Schloß ist. Was meinen Sie?«
Der Butler lachte geheimnisvoll.
»Es gibt allerhand Leute auf der Welt«, entgegnete er.
»Ich weiß nicht, ob man mit einer so flauen Ansicht durchkommt«, erwiderte der Chauffeur etwas unsicher. »Dieser Herrensitz gehört Lord Lebanon – darüber sind wir uns doch wenigstens einig?« Er hob die Hand und zählte an den Fingern ab. »Nun hören Sie einmal zu, wer hier etwas zu sagen hat: Zuerst dieser blöde Dr. Amersham, der alles kontrollieren will. Zweitens Lady Lebanon. Drittens« – er zögerte – »nennen wir einmal Miss Crane. Aber gegen die habe ich nicht das mindeste. Und als letzter kommt Lord Lebanon!«
»Mylord ist noch jung«, erklärte Mr. Kelver höflich.
Er hatte dieselbe Meinung wie Studd, aber seine Stellung legte ihm Pflichten auf, an die er sich gebunden fühlte. Mr. Kelver hatte bei dem Herzog von Colbrooke gedient, und schon seit vielen Generationen hatten seine Vorfahren große Herren betreut. Daher wußte er genau, daß es ihm nicht zustand, seine Herrschaft zu kritisieren.
Plötzlich hörten die beiden schnelle Schritte auf dem Kiesweg, und gleich darauf erschien Dr. Amersham.
»Nun, Studd, haben Sie meinen Wagen fertiggemacht?«
Der Doktor hatte eine scharfe, unangenehme Stimme, und sein ganzes Auftreten reizte zum Widerspruch.
»Nein«, entgegnete der Chauffeur heftig. »Und ich mache ihn auch nicht fertig – ich gehe heute abend aus!«
Amersham wurde bleich vor Ärger.
»Wer hat Ihnen die Erlaubnis dazu gegeben?«
»Der einzige, der mir hier im Haus die Erlaubnis geben kann«, erwiderte Studd laut. »Lord Lebanon selbst.«
»Sie können sich eine andere Stelle suchen«, erklärte der Doktor wild.
»So, ich soll mir eine andere Stelle suchen?« fragte Studd wütend. »Meinen Sie vielleicht, ich würde anderer Leute Namen unter Schecks schreiben?« Dr. Amersham sah plötzlich verstört aus. »Wenn ich mir eine andere Stelle suche, wird es jedenfalls eine ehrliche Beschäftigung sein! Auf keinen Fall bestehle ich einen Kameraden – merken Sie sich das, Doktor! Und was ich auch unternehme, ich werde nicht abgefaßt und verhaftet, ich komme nicht vor Gericht, und mich stößt man auch nicht aus der Armee aus!«
Studd hatte drohend gesprochen, und der Arzt konnte den Blick des Mannes nicht ertragen. Er wollte ihm hart entgegnen, aber was er vorbrachte, war eigentlich keine Erwiderung auf die schweren Anklagen.
»Sie wissen zuviel!«
Amersham wandte sich rasch ab und entfernte sich.
Mr. Kelver hörte die Worte, konnte aber den Zusammenhang nicht verstehen. Er war bestürzt über das Benehmen Studds und fragte sich, ob er nicht hätte vermitteln sollen. Aber fast schien es ihm, als ob Dr. Amersham seine Anwesenheit gar nicht bemerkt hätte.
»So, dem habe ich es ordentlich gegeben«, erklärte Studd triumphierend. »Haben Sie gesehen, wie er sich verfärbte? Dabei behauptet der Kerl, er wird mich entlassen!«
»Ich hätte aber doch nicht in diesem Ton mit ihm geredet, Studd«, sagte der Butler mit leisem Vorwurf.
Aber der Chauffeur war jetzt in Fahrt und achtete nicht auf Kelvers Mahnung.
»Jetzt hat er wenigstens begriffen, daß ich ihn von früher her genau kenne. Ach, ich hätte ihm noch ganz andere Dinge an den Kopf werfen können!«
Am Abend fand im Dorf ein Maskenball zu irgendeinem wohltätigen Zweck statt, und als die Dämmerung hereingebrochen war, fuhr vom Herrenhaus ein Wagen mit einem Pierrot, einer Pierrette, einer Zigeunerin und einem Inder zu dem Fest hinunter. Das farbenprächtige indische Kostüm hatte Studd gewählt, dem Mr. Kelver vor der Abfahrt noch einen väterlichen Rat gab.
»An Ihrer Stelle würde ich morgen früh mit Dr. Amersham sprechen und mich entschuldigen. Wenn Sie im Recht sind, können Sie großzügig sein, und im anderen Fall ist es selbstverständlich, daß Sie sich entschuldigen.«
Dann ging Kelver in die Halle und machte noch einen letzten Rundgang, bevor er sich in den Teil des Hauses zurückzog, den die Angestellten bewohnten. Hier und dort rückte er ein Kissen zurecht; er nahm auch das leere Glas fort, das allem Anschein nach Dr. Amersham auf Myladys Schreibtisch hatte stehenlassen.
Später sah er ihn in einer der großen Fensternischen des Hauptganges bei den amerikanischen Dienern Brooks und Gilder. Sie sprachen leise miteinander und hatten die Köpfe gesenkt. Aber nicht nur Kelver sah sie, sondern auch Lord Lebanon, der in der offenen Tür seines Zimmers lehnte. Er sagte Kelver gute Nacht, als dieser vorbeiging, aber kurz darauf rief er ihn zurück.
»Steht da unten nicht der Doktor?« fragte er, da er ein wenig kurzsichtig war.
»Ja, Mylord. Er unterhält sich mit Gilder und Brooks.«
»Zum Teufel, worüber haben die soviel miteinander zu reden? Kelver, sind Sie nicht auch der Meinung, daß dies ein sonderbares Haus ist?«
Kelver war zu höflich und kannte seine Stellung zu gut, um diese Frage zu bejahen. In Wirklichkeit hielt er den ganzen Haushalt für sonderbar genug, vor allem die beiden amerikanischen Diener. Von Anfang an war ihm klargemacht worden, daß er ihnen nichts zu sagen hätte. Außerdem brauchten die beiden nach neun Uhr nicht die Wohnräume der Herrschaft zu verlassen, sondern konnten sich frei im ganzen Haus bewegen.
»Ich sage ja immer, daß es alle möglichen Leute auf der Welt gibt.«
Willie Lebanon lächelte.
»Das stimmt, Mr. Kelver«, erwiderte er liebenswürdig und klopfte dem alten Mann auf die Schulter.
Der Butler wurde ein wenig verlegen, denn so vertraulich hatte sich der Lord ihm gegenüber noch nie benommen.





























