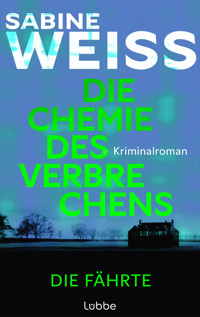Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau geht unerschrocken ihren Weg – und wird zur weltberühmten Madame Tussaud! »Das Kabinett der Wachsmalerin« von Sabine Weiß als eBook bei dotbooks. Während der Französischen Revolution ging sie durch die Hölle und entkam nur knapp der Guillotine. Nun hofft Marie in London auf den großen Durchbruch. Doch auch hier erwarten sie Intrigen, Macht- und Habgier. Allein in einer fremden Stadt, sieht sich Marie neuen Gefahren ausgesetzt und wieder muss sie kämpfen … Nur wenig ist über das Leben der Marie Grosholtz bekannt. Auf Basis ihrer jahrelangen Recherchen legt Sabine Weiß dennoch einen fundierten und lebendigen Roman vor, der die Londoner Jahre und den geschäftlichen Durchbruch von Madame Tussaud nachzeichnet. »Sabine Weiß entwickelt einen spannenden Plot mit ausgeprägter Sensibilität für die historischen Figuren und das Zeitgeschehen. Ein großer Roman.« REVUE Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das Kabinett der Wachsmalerin« der Erfolgsautorin historischer Romane, Sabine Weiß. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Während der Französischen Revolution ging sie durch die Hölle und entkam nur knapp der Guillotine. Nun hofft Marie in London auf den großen Durchbruch. Doch auch hier erwarten sie Intrigen, Macht- und Habgier. Allein in einer fremden Stadt, sieht sich Marie neuen Gefahren ausgesetzt und wieder muss sie kämpfen …
Nur wenig ist über das Leben der Marie Grosholtz bekannt. Auf Basis ihrer jahrelangen Recherchen legt Sabine Weiß dennoch einen fundierten und lebendigen Roman vor, der die Londoner Jahre und den geschäftlichen Durchbruch von Madame Tussaud nachzeichnet.
»Sabine Weiß entwickelt einen spannenden Plot mit ausgeprägter Sensibilität für die historischen Figuren und das Zeitgeschehen. Ein großer Roman.« REVUE
Über die Autorin:
Sabine Weiß, geboren 1968, studierte Germanistik und Geschichte, bevor sie sich dem Journalismus zuwandte. Für ihre Romane »Die Wachsmalerin« und »Das Kabinett der Wachsmalerin« reiste sie monatelang auf den Spuren der Wachskünstlerin Marie Tussaud durch Frankreich, England, Irland und Schottland.
Bei dotbooks veröffentlichte Sabine Weiß bereits »Die Wachsmalerin«
Die Autorin im Internet: www.sabineweiss.com
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/pages/Sabine-Weiss-Autorin/126749097370127
***
eBook-Neuausgabe Mai 2016
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Samuel Scott »The Thames and the Tower of London« und shutterstock/FlexDreams
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-490-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Kabinett der Wachsmalerin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sabine Weiß
Das Kabinett der Wachsmalerin
Das Leben der Madame Tussaud Zweiter Roman
Für Marianne und Wolfgang
Kapitel 1
Dover, 1802
Zollbeamte würde den Schock seines Lebens bekommen, und Marie konnte nichts tun, um es zu verhindern. Wiederholt hatte sie ihn angesprochen, aber er hatte nicht reagiert. Dabei war sie sicher gewesen, dass ein Zöllner, der mit dem Grenzverkehr zwischen Frankreich und England zu tun hatte, auch der französischen Sprache mächtig war. Das schien jedoch nicht der Fall zu sein. Und die wenigen Brocken Englisch, die Marie bislang sprach, hatten einfach nicht ausgereicht.
Das Stemmeisen fraß sich in die Holzkiste hinein, mit einem Krachen gab der Deckel nach. Rot leuchtete unter der Strohfüllung das Blut am Wachskopf der hingerichteten Marie Antoinette hervor. Dass er unter ihren vielen Kisten ausgerechnet diese öffnen musste! Der Mann fuhr zurück, fasste sich wieder und schrie einen Befehl. Soldaten stürmten in den Raum und umzingelten Marie, der vierjährige Joseph schlang erschrocken die Arme um ihre Hüfte. Marie war zierlich, aber umgeben von den Bewaffneten kam sie sich winzig vor. Soldaten, Waffen, Verhaftung, Kerker, Todesangst – mit einem Mal war die Erinnerung wieder lebendig an das Jahr 1794, in dem sie und ihre Mutter in Paris verhaftet und eingekerkert worden waren und ihnen der Gang auf die Guillotine gedroht hatte. Angst erfasste sie. Sollte ihre Tournee in England im Gefängnis enden, bevor sie richtig begonnen hatte? Entschlossen drängte Marie die Erinnerungen zurück.
»Es ist ein Missverständnis! Der Kopf ist nicht echt, er ist aus Wachs! Ist denn niemand hier, der meine Sprache beherrscht?«, fragte sie laut. Die Soldaten sahen sie ratlos an. Endlich fand sich ein Mann, der sie verstand. Er übersetzte ihre Worte, die feindliche Haltung der Soldaten ließ etwas nach. Ein Uniformierter wurde hinausgeschickt und kehrte mit einem Zollbeamten zurück, der weitere Wachsköpfe aus der Kiste holte. Schließlich hielt er einen Wachskopf hoch – es war der von Napoleon Bonaparte.
»Was für eine Erklärung haben Sie für diese gefährliche Fracht, Madame?«, fragte er in fast akzentfreiem Französisch.
»Ich bin Künstlerin und im Auftrag des gefeierten Wachsfigurensalons von Curtius unterwegs. Dieser Salon in Paris ist für die Lebensechtheit seiner Kunstwerke berühmt. Jetzt, nachdem endlich der Frieden zwischen unseren Ländern wieder eingekehrt ist, möchte ich in London seine Wachsfiguren ausstellen.« Auch wenn Marie seit dem Tod ihres Ziehonkels Curtius der Wachssalon gehörte und sie weitaus die meisten Figuren selbst hergestellt hatte, hielt sie diese Information jetzt zurück. Sie wollte den Beamten nicht noch mehr verwirren.
»Madame, Sie sollten wissen, dass der Friede brüchig ist. Boney«, zum ersten Mal hörte Marie den Spitznamen, den die Engländer Napoleon gegeben hatten, »stellt unsere Geduld auf eine schwere Probe. Dieser Wachskopf könnte für eine Kriegslist genutzt werden«, sagte der Beamte ernst.
Marie hatte nicht geahnt, dass sie so misstrauisch empfangen werden würde, denn nach beinahe zehn Jahren Krieg zwischen Frankreich und England war der Friedensvertrag, der in der französischen Kleinstadt Amiens geschlossen worden war, von beiden Völkern erleichtert gefeiert worden. Seitdem wimmelte Paris von englischen Touristen. Auch französische Adelige, Priester und Royalisten, die in England vor dem Revolutionsregime Zuflucht gefunden hatten, kehrten nun in großer Zahl in ihre Heimat zurück.
Marie machte sich von ihrem Sohn los, flüsterte ihm ein paar beruhigende Worte ins Ohr und ging auf den Zollbeamten zu. »Darf ich?« Sie nahm ihm den Wachskopf aus der Hand und drehte ihn herum. »Sehen Sie, er ist leer. Keine geheimen Botschaften oder Waffen sind hier versteckt. Und wenn es Sie beruhigt, ich habe diesen Kopf mit meinen eigenen Händen geschaffen. Kein Soldat Napoleons hatte damit zu tun. Nur eine einfache Frau.«
Der Mann sah sie verdutzt an. Die Soldaten kamen näher. Jetzt trieb die Neugier sie an, Marie kannte diesen Blick von den Besuchern des Kabinetts genau. Marie musste ihre Sensationslust befriedigen, sie übersprang die erste Begegnung mit Napoleon, bei der er den Wachssalon aufgesucht und die Figur Robespierres bewundert hatte, und kam gleich zur Schilderung ihrer eigentlichen Porträtsitzung.
»Ein Zufall hatte mich mit der Ehefrau des französischen Herrschers bekanntgemacht. Auch das Wachsabbild der schönen Joséphine finden Sie in diesen Kisten. Ihrer Fürsprache habe ich es zu verdanken, dass mir Napoleon eine Porträtsitzung gewährte.« Sie hielt den Wachskopf nun so, dass alle ihn gut sehen konnten. »Morgens um sechs Uhr sollte ich mich im Palast der Tuilerien einfinden. Der Erste Konsul erwartete mich bereits ungeduldig, also fing ich umgehend an. Ich sagte ihm, dass er nicht erschrecken solle, wenn ich sein Gesicht mit einer Gipsschicht bedecken würde, um die Maske anzufertigen, denn er würde durch die Strohhalme in seinen Nasenlöchern atmen können. Er wurde ärgerlich und rief: ›Erschrecken! Ich würde nicht einmal erschrecken, wenn Sie um meinen Kopf herum geladene Pistolen halten würden.‹« Einige Soldaten konnten sich ein Lachen nicht verkneifen. »Letztlich war er so zufrieden mit seinem wächsernen Abbild, dass er zwei seiner Generäle zu mir schickte, damit ich auch sie porträtieren konnte«, erklärte Marie. »In der Ausstellung gibt es Napoleon, seine Frau und seine Generäle in Lebensgröße und in originalgetreuer Kleidung zu sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich in einigen Wochen im Lyceum-Theater selbst davon überzeugten, wie lebensecht und menschlich zugleich die Figuren wirken.« Sie legte den Wachskopf in die Kiste zurück.
Der Beamte war beruhigt. Er bat um Verständnis dafür, dass sie auch die anderen Kisten öffnen müssten, um sich von der Harmlosigkeit des Inhalts zu überzeugen. Dieses Mal waren die Männer vorsichtiger. Anschließend entschuldigte er sich bei Marie. »Normalerweise haben immer Beamte Dienst, die in anderen Sprachen bewandert sind, oder es sind Übersetzer zur Hand. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in England und viel Erfolg mit Ihrer Ausstellung. Mich zumindest haben Sie neugierig gemacht.«
Das Novemberwetter war klar und kalt. Der Wind hatte alle Wolken vertrieben, schon in Dover hatten die weißen Klippen in der Wintersonne gestrahlt. Marie hatte für den Transport ihrer Kisten gesorgt und mit Nini, wie sie ihren Sohn Joseph nannte, die nächste Postkutsche nach London bestiegen. Es war ein beeindruckendes Gefährt, das von vier Pferden gezogen wurde, die Garde war bewaffnet und trug ein Horn bei sich, das in jeder Stadt und an jeder Station ertönte. Sie passierten Schlagbäume, wo der Wegzoll entrichtet werden musste. Alle paar Meilen wurden die Pferde mit einer Schnelligkeit gewechselt, dass man es kaum bemerkte. Nun hielt die Kutsche auf einer Anhöhe an, von der aus die Fahrgäste ihr Ziel betrachten konnten. Auch Marie und Nini stiegen aus. London war so groß, dass es sich am Flusslauf entlang erstreckte, so weit das Auge reichte. Steinkohledampf strömte aus tausenden Schornsteinen und hüllte die Stadt in einen grauen Schleier. Nini staunte über die vielen Schiffe, die die Themse bedeckten. Ein Wald aus Masten schien auf der Wasseroberfläche im Wind zu schwanken. Dahinter erhoben sich, wie ihnen ein Mitreisender erklärte, der Turm der St.-Pauls- Kathedrale, der Doppelturm der Westminsterabtei sowie die Türme über hundert weiterer Kirchen. Die Stadt wirkte riesig. Marie hatte noch nie eine so gewaltige Ansammlung von Häusern gesehen. Sie vertraten sich noch ein wenig die Füße, dann gab der Kutscher das Signal zum Aufbruch. Später fuhren sie über eine breite Straße nach London hinein. Marie glaubte ein paarmal, dass sie ihr Ziel, die Stadtmitte, erreicht hatten, weil das Gewimmel auf den Straßen so dicht geworden war, aber die Kutsche ruckelte immer weiter. Sie fühlte sich erschlagen von der schieren Größe der Stadt. Auch Nini konnte sich kaum vom Kutschfenster lösen. Schließlich hielt der Wagen, und sie stiegen erschöpft aus. Marie musste nun nur noch ein Fuhrwerk finden, das sie in ihre Unterkunft in der Surrey Street brachte. Der Lärm auf den Straßen kam ihr ohrenbetäubend vor. Ein Kutscher beschimpfte einen Passanten als »blinden Hund«, damit er aus dem Weg ging, Händler priesen lauthals ihre Waren an, jemand schrie »Haltet den Dieb«, weil ihm sein Taschentuch gestohlen worden war, umherziehende Musiker schlugen das Tamburin und spielten die Fidel dazu. Endlich fanden sie die richtige Kutsche.
Das Haus in der Surrey Street, einer kleinen Straße, die das Themseufer mit der Vergnügungsmeile mit dem Namen »the Strand« verband, machte einen einfachen, sauberen Eindruck. Ihre Wirtin, eine korpulente Dame, die gepflegt, aber für ihr Alter in zu leuchtende Farben gekleidet war, begrüßte sie freundlich und zeigte ihnen ihr Zimmer. Es war mit Tapeten und Teppichen ausgestattet und möbliert. Sie wies Marie einen Schrank zu, in dem sie Brot, Butter, Tee und Kaffee für die täglichen Mahlzeiten lagern konnte, und gab ihr den Schlüssel dafür. Als die Wirtin gegangen war, spürte Marie erst, wie anstrengend die Reise gewesen war. Ihr Blick blieb im Spiegel hängen, der auf der Kommode stand. Haarsträhnen hatten sich gelöst und fielen ihr dunkel über das Gesicht, unter ihren Augen wölbten sich halbmondförmige Schatten. Sie war beinahe einundvierzig Jahre alt, heute sah man es. Sie nahm ihr Brusttuch ab und hängte es über den Spiegel. Nini war schon auf das Bett gefallen, Marie setzte sich neben ihn. Sie überlegte einen Moment, ob sie gleich losgehen sollte, um ihren Geschäftspartner Monsieur de Philipsthal aufzusuchen, aber da war ihr Sohn schon eingeschlafen. Sie konnte sich ebenso gut einen Moment ausruhen. Marie schnürte ihre Schuhe auf und legte sich neben ihn. Auch ihr fielen die Augen zu.
Steif lag Marie auf dem Bett, sie konnte nur mühsam den Schlaf abschütteln. Sie war verspannt, die Reise steckte ihr in den Knochen, sie mochte sich jedoch nicht herumwälzen, aus Angst, Nini zu wecken. Am liebsten hätte Marie ihre beiden Söhne mit nach London genommen. Der Gedanke an ihr Nesthäkchen Françison schnürte ihr den Hals zu. Doch ihr Ehemann, nach dem der zweijährige François benannt worden war, hatte darauf bestanden, dass dieser Sohn bei ihm blieb. Marie spürte die Wärme ihres Kindes und fühlte, wie sich ihre Gesichtszüge in einem Lächeln entspannten. Wie groß Nini schon war mit seinen vier Jahren, und doch war er noch ein kleines Kind. Sie verlangte viel von ihm, manchmal mehr, als sie ihm zumuten konnte. Das Licht der aufgehenden Sonne ließ seinen Schopf schimmern. Er hatte die schönen schwarzen Haare seines Vaters. Ach, François, Geliebter. War sie in den letzten Wochen zu hart zu ihrem Mann gewesen? Aber sie konnte seine Trägheit und seine Leichtlebigkeit einfach nicht mehr ertragen. Der Wachssalon war für ihn eine lästige Pflicht, der er sich so schnell wie möglich entledigen wollte, damit mehr Zeit für seine Immobiliengeschäfte blieb. Dabei hatte der Salon sie in den letzten Jahren ernährt, während seine Geschäfte die Familie immer tiefer in die Schulden gestürzt hatten. »Warum lässt du mich nicht nach England fahren, ich war doch schon einmal dort?«, hatte François sie gefragt, als sie am letzten Abend aneinandergeschmiegt im Bett gelegen hatten. Die bevorstehende Trennung hatte die Alltagssorgen verdrängt, hatte sie wie Jungverliebte wieder zusammenfinden lassen. Marie war froh darüber, sie hatte sich nach seinem Körper, seinen Zärtlichkeiten gesehnt. Sie versuchte seine Frage möglichst zartfühlend zu beantworten, denn ihre Reisepläne hatten François' Laune arg gedämpft. Einige Monate nach ihrer Hochzeit im Oktober 1795 hatte sich schon einmal die Möglichkeit ergeben, die Figuren in England zu zeigen. Natürlich bestand François, der sich gerade in seine Rolle als Mitverantwortlicher für das Kabinett Curtius' hineinfand, auf dieser Chance. Er wollte ihr wohl auch beweisen, dass er dieser Aufgabe gewachsen war. Marie war die Trennung damals schwergefallen, zumal sie kurz vor seinem Aufbruch festgestellt hatte, dass sie schwanger war. Sie hatte ihm von ihrer Schwangerschaft erzählt, er war dennoch abgereist. Curtius’ großartiges Kabinett der Kuriositäten machte in Städten wie London, Norwich und Birmingham halt und wurde von den Zeitungen als das »Nonplusultra der Künste« gefeiert. Alles wäre gut gewesen, hätte nicht ihr Ehemann einen Teil des Gewinns in eine »geniale Geschäftsidee« in England investiert – und alles verloren. Seitdem hatte sie gewusst, dass sie ihm ihr Geld nicht anvertrauen konnte.
Dieses Mal durfte nichts schiefgehen. Wie Curtius würde sie die Ausstellung in England Wachsfigurenkabinett nennen, denn einen Wachssalon kannte man nur in Paris. Vielleicht würden sich ja auch einige Besucher an das Kabinett erinnern. Sie würde es besser machen als François und erst wieder zurückkehren, wenn ihre Geldbörse prall gefüllt war – und das je früher, desto besser, das nahm sie sich vor.
Als sie aus ihrem Zimmer traten, überschwemmte die Magd gerade den Vorplatz des Hauses und den gepflasterten Fußweg mit Wasser und scheuerte ihn. Während sie auf das Frühstück warteten, staunte Marie über die Akribie, mit der die Magd auch die Fußteppiche in den Wohnzimmern bürstete, die Tische und Stühle mit einem wollenen Tuch abrieb und selbst die Feuerzangen und Schaufeln, die im Kamin standen, blank hielt. Einige Zeit später erschien ihre Wirtin. Bei gebuttertem Brot und Tee fragte sie Marie nach ihrer Reise und ihren Plänen aus. Nini beobachtete Tom, den etwa zehnjährigen Sohn des Hauses, der ungerührt mit seinem Toast herummatschte.
»Ein Wachsfigurenkabinett?«, fragte die Wirtin gerade und wischte sich mit dem Tischtuch die buttrigen Lippen ab. »Was soll denn daran besonders sein? Wachsfigurenkabinette haben wir hier schon lange! Gerade kürzlich habe ich eines auf der Bartholomäusmesse besucht. In der Fleet Street gibt es die Wachsarbeiten von Mrs Salmon, die sind stadtbekannt. Catherine Andras darf sich ›Wachsmodelliererin von Königin Charlotte‹ nennen und stellt regelmäßig in der Königlichen Akademie aus. Und sogar in der Westminsterabtei stehen Wachsfiguren. Wenn das alles ist, was Sie anzubieten haben, hätten Sie sich die Reise sparen können.« Marie fühlte sich, als hätte ihr jemand ins Gesicht geschlagen. Sie legte ihren Toast auf den Teller und tastete in ihrer Tasche nach einem Taschentuch, denn sie mochte sich die Finger nicht am Tischtuch abwischen.
»Es sind nicht nur die Figuren. Wir haben Modelle der Bastille und der Original-Guillotine«, sagte sie ruhig. Lange hatte Marie mit sich gehadert, dieses Modell mitzunehmen, denn zu viele schreckliche Erinnerungen waren für sie mit der Guillotine verbunden. Manchmal schreckte sie nachts hoch, weil sie die Bilder der grauenvollen Hinrichtung von Madame Dubarry, der Mätresse des Königs, bis in den Schlaf verfolgt hatten. Die Wirtin blieb kühl.
»Kennen wir schon«, meinte sie ungerührt und schenkte sich Tee nach. »Bei Mrs Salmon kann man auch die schrecklichen Zellen der Bastille sehen.« Ihr schien es Freude zu machen, Marie zu entmutigen, die langsam in ihrem Sitz zusammensank. War denn alles umsonst gewesen? Hätte sie sich diese Reise sparen können? Wäre sie besser in Paris bei ihrer Familie geblieben und hätte den Wachssalon dort auf Vordermann gebracht? Sie machte einen letzten Versuch, die Wirtin von der Güte ihrer Ausstellung zu überzeugen.
»Wir präsentieren auch die Figuren der letzten königlichen Familie von Frankreich, von König Ludwig XVL, seiner Frau Marie Antoinette und ihren Kindern. Außerdem zeigen wir die Totenmasken der Revolutionäre. Ich habe sie eigenhändig nach der Hinrichtung abgenommen. Der Konvent hat mich dazu gezwungen …« Das würde es doch wohl in London nicht geben. Niemand außer ihr dürfte im Besitz dieser Originalmasken sein.
»Tatsächlich?« Die Wirtin beugte sich vor. Auch Tom hatte jetzt aufgehört, sein Frühstück zu malträtieren. »Das muss ja grauenvoll gewesen sein. Erzählen Sie doch mal, Mrs Tussaud!«
Marie begann, von ihren Erlebnissen während der Revolution zu berichten. Begeistert hörte ihr die Wirtin zu. Je grausiger die Ereignisse wurden, umso besser schien es ihrer Hausherrin zu gefallen. Marie indessen wurde unruhig, Arbeit lag vor ihr. Schließlich konnte sie sich losreißen. Sie konnte es kaum erwarten, mit Monsieur de Philipsthal zu sprechen.
Die Lage ihrer Unterkunft war gut gewählt. Marie und Nini mussten nur ein Stück zu Fuß gehen, bis die Surrey Street in »the Strand« mündete. Zu ihrer Rechten bestimmte eine Kirche das Straßenbild, sie schlugen die andere Richtung ein. Ihr Weg führte sie an einem palastartigen Gebäude vorbei. Marie fragte einen Passanten, um welches Bauwerk es sich handelte und erfuhr, dass es Somerset House sei, ein öffentliches Gebäude, in dem unter anderem die Königliche Malerakademie untergebracht war. Ein prächtiger Bau, aber kein Vergleich mit dem Louvre, fand Marie. Im weiteren Verlauf der Straße stand ein Kaufmannshaus an dem anderen, die meisten waren von oben bis unten mit Schildern behängt. Marie musste an den Ausspruch Napoleon Bonapartes denken, der England als »Nation von Krämern« bezeichnet hatte. In goldener Schrift pries ein Schuhflicker seine Arbeit an, ein Branntweinhändler warb für seine Liköre, und meistens fand sich noch eine Inschrift, die darauf hinwies, dass hier schon ein Mitglied der Königsfamilie gekauft hatte. Die Engländer schienen sehr stolz auf ihr Königshaus zu sein. Marie staunte über das saubere Straßenpflaster, an dessen Rand es auf beiden Seiten Steinplatten für Fußgänger gab, so dass ihr das Zu-Fuß-Gehen sicherer als in Paris erschien. Trotzdem erschrak Nini über die Kutschen, die aus der Mischung aus Steinkohledämpfen und Nieselregen plötzlich hervorbrachen und an ihnen vorbeipreschten. Marie wunderte sich über die Frauen, die mit ihren knöchellangen Mänteln, Stiefeln und Gamaschen Wind und Wetter trotzten, während die Männer sorgfältig in Flanell gehüllt erschienen und sich unter ihren Regenschirmen versteckten. Waren die Männer hier zimperlicher als die Frauen? Die Menschen waren auffallend gut gekleidet, sogar Bettler schienen unter ihrer zerlumpten Kleidung saubere Hemden zu tragen.
Das Lyceum-Theater befand sich am östlichen Ende der Straße. Es war ein schlichtes, vierstöckiges Gebäude, an dem einzig der säulengeschmückte Eingang auffiel. An der Wand sah sie ein Plakat, das auf Philipsthals Phantasmagoria hinwies. Darauf war eine Art Zauberer abgebildet, der in einem magischen Kreis stand und mit Hilfe eines Totenschädels einen Geist beschwor. In einer weniger aufgeklärten Zeit hätte man Monsieur de Philipsthal wegen seiner Illusionskünste genauso für einen Zauberer gehalten wie meinen Onkel oder mich, weil wir lebensecht wirkende Wachsfiguren erschaffen können, dachte Marie. Zufrieden stellte sie sich vor, wie bald auch ihr Plakat hier hängen würde.
Die Vorführung sollte gerade beginnen, kurzentschlossen schlich sich Marie mit Nini in den Theatersaal. Sie fanden noch einen Platz in einer der hintersten Reihen. Der Raum wurde nur durch eine einzelne Lampe, die von der Decke herabhing, erleuchtet. In diesem Halbdunkel wurde plötzlich der Vorhang hochgezogen und enthüllte eine Höhle, in der Skelette und andere gruselige Figuren zu sehen waren. Sie spürte, wie Nini sich auf ihrem Schoß versteifte. Das Licht begann zu flackern und verlosch ganz. Auf einmal fuhr ein grollendes Donnern in ihre Glieder, ein Blitz blendete sie. Ihr Sohn schreckte auf, versteckte sein Gesicht an ihrem Hals. Auch Maries Puls schlug schneller. Beruhigend streichelte sie ihm über die Wange. Ein grausiger Bilderreigen begann. Aus dem Nichts tauchte ein Skelett auf und huschte über eine Mauer. Der Kopf eines Mannes verwandelte sich vor ihren Augen in einen Totenschädel. Geister schwebten an ihr vorbei, ein scheinbar endloser Totentanz. Dann wurde es wieder dunkel. War es endlich vorbei? Durften sie in die Welt der Lebenden zurückkehren? Erst jetzt spürte Marie, dass ihr Hals feucht war, Nini weinte. Ruckartig stand sie auf. Sie musste hier raus. Sie presste ihren Sohn an sich und drängte sich durch die Sitzreihe. Die anderen Zuschauer brummten unwirsch. Endlich hatte sie das Ende der Reihe erreicht, da brach direkt vor ihr ein leuchtend rotes Gesicht aus der Tiefe des Raumes hervor. Ein schriller Schrei klingelte in ihren Ohren. Marie strauchelte, ihr Sohn schrie auf. Der Geist verfolgte sie, streckte die Finger nach ihr aus. Marie hörte Frauen kreischen. Der Geist wandte sich von ihr ab. Im Zuschauerraum breitete sich Panik aus. Männer riefen nach Licht. Endlich hatte sie den Ausgang gefunden. Marie taumelte hinaus, suchte verzweifelt nach einer Bank. Schließlich ließ sie sich in einer Ecke auf den Boden sinken. Es war keine gute Idee gewesen, sich Monsieur de Philipsthals Auftritt anzusehen. Marie wiegte ihren Sohn auf dem Schoß. Langsam beruhigte er sich und auch das Zittern ihrer Glieder ließ nach. Die Rufe, das erregte Sprechen und das Getrappel der Schuhe waren jetzt verebbt. Marie schob ihren Sohn von ihrem Schoß, erhob sich und nahm Ninis Gesicht in die Hände. Zart wischte sie ihm die Tränenspuren von den Wangen und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. Es half nichts, sie mussten mit Philipsthal sprechen.
»Wie sehen wir nur aus, wir zwei?«, flüsterte sie. Sie strich ihm die Haare glatt und rückte sein Hemd zurecht. Lächelnd sah sie an sich herab. »Und ich, was ist mit mir?«, fragte sie. Nini zupfte ihr einen Fussel vom Kleid.
»Jetzt siehst du wieder gut aus, Maman.« Er sah sie tapfer an und nahm ihre Hand. Als sie sich erneut dem Theatersaal näherten, wurde er immer langsamer, er hatte doch Angst.
»Willst du hier auf mich warten? Aber rühr dich nicht von der Stelle!«, wies Marie ihn an.
Aus dem Saal waren Geräusche zu hören. Marie trat näher. Jetzt, wo das Theater erleuchtet war, sah sie die gewölbte Decke und die Galerien, die teilweise mit schwarzen Tüchern verhängt waren. Hinter einem der Vorhänge hörte sie Stimmen. Sie schob das Tuch zur Seite und trat dahinter. Monsieur de Philipsthal, seine Frau und ein Gehilfe liefen zwischen optischen Geräten, Projektionsapparaten und Lampen hin und her, auf dem Boden stand ein mit schwarzem Stoff bezogenes Holzgestell, das von einer roten, durchscheinenden Maske gekrönt wurde. Bei Licht besehen sah der Geist der Roten Frau nur noch wie ein schlichtes Stück Kunsthandwerk aus.
»Bonsoir, Madame und Monsieur de Philipsthal«, sagte sie laut. Die beiden sahen erstaunt auf. Paul de Philipsthal kam auf sie zu, nahm wortlos ihren Arm und zog sie wieder in den Theatersaal. Seltsam, als ob er etwas zu verbergen hat, dachte Marie.
»Der Zutritt in diesen Raum ist für Unkundige verboten. Der Umgang mit der Laterna magica ist nicht ungefährlich. So manchem ist das Gerät schon explodiert«, sagte er und richtete seine tadellos gebundene Krawatte. Wie immer trug er einen edlen Anzug, dieses Mal aus schwarzem Stoff, die Haare waren sorgfältig frisiert. Dann nahm er ihre Hand und deutete einen Handkuss an. »Jetzt muss ich Sie erst einmal richtig begrüßen. Willkommen im Lyceum-Theater, Madame. Ich hatte heute noch gar nicht mit Ihnen gerechnet.«
»Die Reise war unkomplizierter als erwartet«, sagte Marie. »Wir hatten sogar Zeit, Ihren Auftritt anzuschauen. Ich hatte den Eindruck, dass nicht nur der Umgang mit der Laterna magica gefährlich sein kann, sondern dass auch einige Besucher sich bedroht fühlten.« Monsieur de Philipsthals Wangen röteten sich.
»Dabei wurde schon genug über den Auftritt der Roten Frau berichtet! Langsam müsste sich doch herumgesprochen haben, dass dabei nichts passieren kann.« Er schnalzte missbilligend mit der Zunge.
»Aber lassen Sie nur, diese Tumulte sind gut für uns. Je mehr das Publikum sich aufregt, umso besser ist es für das Geschäft. Sollen sie ruhig erzählen, was für ein Schrecken der von mir beschworene Geist ihnen eingejagt hat. Von der Vorliebe der Engländer für das Makabere können Sie und ich nur profitieren.«
»Das hoffe ich sehr«, sagte Marie. Sie dachte daran, wie sie Philipsthal im letzten Sommer wiederbegegnet war. Ihr Onkel hatte den Schausteller und Freund während der blutigen Phase der Revolution aus dem Gefängnis gerettet, indem er bei Robespierre ein gutes Wort für ihn einlegte. Danach hatte Marie sporadisch von Philipsthal gehört. Möglicherweise
fühlte er sich dem Hause Curtius verbunden, vielleicht hatte er aber auch das Gefühl, sich zu dessen Lebzeiten für Curtius' Hilfe nicht ausreichend revanchiert zu haben. Wie auch immer: Vor einigen Monaten war er in ihrem Wachssalon auf dem Boulevard du Temple aufgetaucht, hatte mit den enormen Summen geprahlt, die er in der letzten Saison mit seiner Phantasmagoria in London eingenommen hatte, und hatte ihr eine Partnerschaft angeboten. Da es mit dem Wachssalon nicht zum Besten stand, hatte sie sein Angebot angenommen. Ein Gastspiel in London würde hoffentlich genügend Geld in ihre Kasse bringen. Vielleicht könnte sie sogar den Kredit ablösen, der auf ihrem Haushalt lastete. Kurz nach dem Tod ihres Onkels hatte Marie erfahren, dass er Schulden gemacht hatte, für die sie als seine Erbin geradestehen musste. Die schlechten Geschäfte – die Pariser tobten sich eher in den Tanzsalons aus, als in den Wachssalon zu gehen – hatten ihr Übriges dazu getan, den Schuldenberg zu erhöhen. London sollte sie finanziell sanieren. Doch die Worte ihrer Wirtin hatten Marie verunsichert. Sie wollte mit Monsieur de Philipsthal darüber sprechen. Philipsthal riss sie aus ihren Gedanken.
»Ich muss Sie nun leider hinausbitten. Dies ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich habe heute Abend noch eine Privatvorführung. Sie verstehen, die hohen Herrschaften wollen nicht hierher ins Theater kommen.«
»Wann kann ich mein Wachsfigurenkabinett eröffnen?«, fragte Marie noch.
»Bald, bald«, sagte Philipsthal ungeduldig und schob sie aus dem Saal. »Alles Weitere besprechen wir am besten morgen.«
Am Eingang des Theaters lief Nini auf sie zu. »Meinen Sohn Nini, also Joseph, kennen Sie doch noch, Monsieur de Philipsthal?«
Paul de Philipsthal blickte Marie an. Das Gesicht mit der hohen Stirn und der gewölbten Nase verzog sich zu einem Lächeln, doch Marie sah, dass die tiefliegenden Augen ernst blieben.
»Vermutlich. Aber ich wusste nicht, dass Sie ihn mitbringen. Auch darüber müssen wir morgen sprechen.«
Am nächsten Tag kam Paul de Philipsthal ihnen am Eingang des Lyceum-Theaters entgegen.
»Ich habe schon auf Sie gewartet. Ich dachte, ich lade Sie zur Feier Ihrer Ankunft in ein Kaffeehaus ein. Außerdem habe ich das hier für Sie, es wird Ihnen von Nutzen sein, bis Sie Ihr Kabinett eröffnen können«, er drückte ihr ein kleines Buch in die Hand. Marie las den Titel: Leitfaden für Reisende nach London. Eine Sammlung aller notwendigen Kenntnisse für Fremde, die in dieser Hauptstadt ankommen. Der Autor war ein gewisser Abbé Tardy, der dieses Buch im Jahr 1800 zum Druck gebracht hatte. Marie bedankte sich. Wie aufmerksam von Philipsthal, ihr so ein Geschenk zu machen.
Marie war froh, dass sie sich heute Morgen dazu entschlossen hatte, ihr bestes Kleid anzuziehen. Es umschmeichelte ihre zarte, schlanke Figur und ließ ihren blassen Teint, ihre braunen Augen und ihr dunkles Haar sehr vorteilhaft zur Geltung kommen. Ihre Mutter Anna hatte es nach der neusten Pariser Mode geschneidert. Man trug schlichte Chemisenkleider im griechischen Stil mit hoher Taille, tiefem Ausschnitt und kleiner Schleppe. Marie hatte es genossen, auf Korsett, Reifrock und Polster zu verzichten. In England musste sie allerdings ihr Korsett wieder hervorholen, hier wurde die Taille der Frauen nach wie vor geschnürt. Die Mode stand ihr, sie wirkte damit auch in London überaus passend und modisch gekleidet, das bemerkte sie an den anerkennenden Blicken der Herren, als sie das Kaffeehaus betraten.
»Ein hübsches Kleid haben Sie an. Im Wachsfigurenkabinett sollten Sie allerdings strenger, seriöser auftreten, sonst nimmt man Sie nicht ernst. Es soll Ihnen doch nicht gehen wie der Salondame Madame Recamier, die erst neulich für einen Auflauf sorgte, weil sie sich in einem hauchdünnen Musselinkleid in den Kensington Gardens sehen ließ«, dämpfte Philipsthal ihre Zufriedenheit. Marie schwieg betreten. Als der Kellner auf sie zutrat, riet er ihr zu Tee. »Der Kaffee ist hier meist trübe und schwach. So wie die Engländer ihr Fleisch zu wenig kochen, kochen sie ihren Kaffee zu lange.« Er bestellte Schildkrötensuppe und die warmen Pastetchen, für die das Etablissement bekannt war. Während sie warteten, schwärmte Monsieur de Philipsthal von seinem Londoner Bekanntenkreis, zu dem auch Mitglieder der beau monde, der feinsten Gesellschaft, gehörten. Marie probierte die Suppe, verzog aber den Mund. »Cayenne-Pfeffer und Madeira-Wein«, sagte Philipsthal spöttisch. Marie hielt sich lieber an die wohlschmeckenden Pasteten und berichtete ihrem Geschäftspartner von dem beunruhigenden Gespräch mit ihrer Zimmerwirtin.
»Ja, das stimmt, Wachsarbeit hat eine lange Tradition in England. Sie werden es hier nicht so leicht haben wie in Paris. Deshalb war ich ja auch überrascht, dass Sie Ihren Jungen mitgebracht haben. Er könnte Sie ablenken von der Aufgabe, die es hier zu bewältigen gilt.« Er warf einen Blick auf Nini, der auf seinem Stuhl saß und still an einer Pastete knabberte. Nini hatte es vermieden, Philipsthal anzuschauen, die ganze Nacht über hatten ihn Alpträume geplagt, in denen ihn die Rote Frau jagte. »Sie verfügen jedoch über etwas Einzigartiges. Ihre Hände haben die Köpfe von Ludwig XVI. und Marie Antoinette berührt. Ihre Finger haben die verzerrten Gesichtszüge der hingerichteten Revolutionäre geglättet. Sie haben es an der Reaktion ihrer Wirtin gesehen. Das sind die Geschichten, die die Leute hören wollen. Diese Sensationslust kennen Sie doch aus Paris.«
»Aber ich spreche kein Englisch«, entgegnete Marie.
»Ich werde Ihnen für die erste Zeit meinen Sekretär, Mr Tenaveil, an die Seite stellen. Er kann Ihnen helfen.«
»Das ist zu gütig, Monsieur de Philipsthal«, sagte Marie erleichtert. Was für ein feiner Herr er doch war, und wie zuvorkommend. Philipsthal beugte sich vor. Er schien das Gefühl zu haben, dass Marie zu ihm aufsah, und genoss es sichtlich.
»Sie dürfen nie vergessen, dass viele Engländer Wachsfiguren nur vom Jahrmarkt kennen. Dieses billige Vergnügen kann unser Ziel nicht sein. Was hat meine Phantasmagoria noch mit den Guckkastenvorführungen der fliegenden Händler zu tun? Nichts!« Marie erinnerte sich an die fahrenden Schausteller, die, einen sperrigen Kasten auf dem Rücken, über den Boulevard du Temple gezogen waren. Oft warfen sie die Bilder grotesker Teufelsfratzen an die Wände, begleitet von der Musik eines Leierkastens. Anschließend sammelten sie bei den Zuschauern einige Sous ein. Philipsthal hingegen schien wahre Reichtümer angehäuft zu haben.
»Sehen Sie, wir beide haben Besseres verdient. Was wollen wir mit den armen Schluckern, die sich kaum den Eintritt leisten können? Wir müssen die Menschen ansprechen, die bereit sind, uns angemessen zu entlohnen, die wohlhabenden Geschäftsleute und den Adel. Nächste Woche wird endlich das untere Theater im Lyceum frei. Sie können schon mal Ihre Wachsfiguren auf Schäden untersuchen. Und dann kann es losgehen. Bis dahin schauen Sie sich die Stadt an – denn später werden Sie keine Zeit mehr dafür haben.«
Schon zwei Tage darauf hatte Marie die Schäden an den Wachsfiguren behoben. Sie und Nini nutzten die übrige Zeit, um London zu erkunden. Ihr erster Weg führte sie zum Palast von St. James, der sich ganz in der Nähe befand. Wie schäbig das Gebäude war, überraschte Marie. Es war alt und winklig und wirkte so gar nicht wie der Wohnsitz einer Königsfamilie. Sie gingen ein Stück weiter zum Haus der Königin Charlotte, Buckingham House genannt, einem etwas moderneren Ziegelsteinbau. Wenn sie hingegen an die Pracht von Versailles zurückdachte! Nini gefielen besonders die Kühe und Pferde, die im St.-James's-Park auf der Wiese herumliefen, und sie kaufte ihm für zwei Pence ein Glas Milch. Später liefen sie an Astleys Amphitheater an der Westminsterbrücke vorbei. Marie fragte sich, ob die berühmte Zirkusfamilie Astley noch immer die Kopien der Totenmasken der ersten Revolutionsopfer Launay und Flesselles besaß, die sie nach dem Bastillesturm für sie angefertigt hatte. In der Nähe der Londoner Brücke betrachteten sie eine turmhohe runde Säule. Sie war zum Andenken an die Feuersbrunst von 1666 errichtet worden, die große Teile von London verwüstet hatte. In der Inschrift, die Marie mühsam entzifferte, wurden die Katholiken als Mordbrenner beschuldigt. Marie wusste, dass Menschen katholischen Glaubens in England misstrauisch beäugt wurden, aber da sie keine fanatische Kirchgängerin war, würde sie unbehelligt bleiben, hoffte sie. Der Palast von Westminster, der Tower und die prächtigen Läden und Magazine in der Bond Street standen genauso auf ihrem Programm wie die anderen Wachsfigurenkabinette, denn es war immer gut, seine Konkurrenz zu kennen.
Nach ihren Besuchen wusste sie, dass sie nicht nachlassen durfte in ihren Bemühungen, ihre Wachsausstellung ansprechend und aktuell zu halten. Denn im Gegensatz zu Paris, würde sie hier um jeden Besucher kämpfen müssen. Über den Zustand der viel gerühmten Wachsfiguren in der Westminsterabtei war sie jedoch entsetzt. In der legendären Begräbniskirche englischer Könige und berühmter Briten wurden die Figuren der nationalen Größen ausgestellt, doch viele Monumente waren so mit Staub und Spinnweben bedeckt, dass man die Inschriften gar nicht lesen konnte. Das Gleiche galt für die Wachsfiguren, die in der Kapelle Heinrichs VII. aufgestellt waren. Viele der lebensgroßen Figuren früherer königlicher Familienmitglieder waren für Leichenprozessionen hergestellt worden. Schon seit Jahrhunderten pflegte man die Tradition, vor der Aufbahrung und der Beisetzung Bildnisse der Verstorbenen durch die Stadt zu tragen. Danach wurden diese Abbilder und später entstandene Gedenkstatuen in der Westminsterabtei ausgestellt. Sie waren zwar durch Schränke mit Glastüren vor den vielen Besuchern geschützt, dennoch wirkten sie zerzaust und staubgrau. Marie beobachtete, dass die Besucher besonders von den Kleidern der Figuren angetan waren, weil die Herrschaften sie angeblich schon zu Lebzeiten getragen hatten. »Als wenn sie noch lebten!«, rief ein älterer Herr mit Tränen in den Augen aus. Marie war ebenfalls gerührt, aber aus einem anderen Grund. Sie musste an die Königsgräber in der Kirche St. Denis in Paris denken, die während der Revolution vom Mob geschändet worden waren. Plötzlich überfiel sie Heimweh.
Da standen sie wieder in stiller Eintracht: König Ludwig XVI., Königin Marie Antoinette, die Philosophen Voltaire, Rousseau, die Revolutionäre Marat, Robespierre und die vielen anderen. Über dreißig Figuren hatte Marie aus Paris mitgebracht. In der Mitte des unteren Theatersaals hatte sie Napoleon und seine Ehefrau Joséphine platziert. Marie strich den Saum von Joséphines Kleid glatt. Nur durch ihre Hilfe war Marie die Sitzung bei Napoleon genehmigt worden. Die ganze Zeit hatte sie geplaudert, um den ungeduldigen Mann abzulenken. Marie war ihr für diese Hilfe dankbar. Egal, ob sie der Zeit, die sie gemeinsam im Kerker der Revolutionäre verbracht hatten, geschuldet oder ob es ein Zugeständnis an Curtius' bekannten Salon war. Bei Napoleon musste Marie schnell arbeiten, da die Gefahr bestand, dass er die Sitzung abbrach. Sie musste an David denken, den berühmten Maler Jacques-Louis David. Selbst ihm hatte Napoleon nur eine Porträtsitzung gewährt. David hatte sich im Ancien Régime von König Ludwig XVI. fördern lassen, hatte dann seine Kunst in den Dienst der Revolution gestellt, sich in die Regierung wählen lassen und später reihenweise Verhaftungsbriefe unterschrieben. Mit seiner unversöhnlichen Haltung hatte er viele verprellt oder gar in den Tod getrieben, auch seine Frau hatte sich von ihm scheiden lassen. Nach dem Ende der Terrorherrschaft war er im Gefängnis gelandet. Inzwischen war er wieder hochangesehen und könnte, wenn er so weitermachte, noch Hofmaler von Napoleon werden. Davids Talent, zu jeder Zeit und in jedem Regime erfolgreich zu sein, stieß Marie ab. Er war ihre erste Liebe gewesen, diesen Rang konnte ihm niemand streitig machen. Doch er hatte sie ungeheuer verletzt, als er sie für eine andere sitzenließ, das würde sie ihm nie verzeihen. Selbst wenn er es gewesen war, der sie vor der Guillotine und aus den Kerkern der Revolutionäre befreit hatte, verringerte es seine Schuld nicht. Marie dachte an ihre letzte Begegnung zurück. David hatte sie zur Präsentation seines Monumentalbildes »Die Sabinerinnen« im großen Saal der ehemaligen Académie d'Architecture im Louvre geladen. Sie war seiner Einladung gefolgt, weil sie wusste, dass sie nichts mehr für ihn empfand.
Sogar die Nachricht, dass er seine Frau nach der Scheidung erneut geheiratet hatte, machte ihr nichts mehr aus. Sie war selbst verheiratet, hatte eine eigene Familie, sie liebte und wurde geliebt. Und zu dieser Familie wollte sie so schnell wie möglich zurück. Marie drehte sich um. Sie sah Nini auf einer Decke sitzen und vergnügt Wachs kneten, um daraus kleine Türme zu bauen. Marie lächelte, ihre Brust weitete sich vor Stolz. So hatte auch sie einmal angefangen.
Mr Tenaveil brachte ihr die Plakate für die beiden Ausstellungen. Aufgeregt überflog sie den Bogen. Wo war der Hinweis auf ihr Wachsfigurenkabinett? »Wir stehen nicht drauf! Das Wachsfigurenkabinett wird nicht erwähnt! Dabei hatte ich Ihnen doch diktiert, was Sie setzen lassen sollen«, sagte sie. Sofort taten ihr die scharfen Worte leid, deshalb entschuldigte sie sich für ihren Ton. »Sie müssen mich verstehen. Wie sollen wir Besucher für das Wachsfigurenkabinett bekommen, wenn niemand von uns weiß?« Tenaveil schien Verständnis für ihre Erregung zu haben, trotzdem antwortete er ausweichend, dass sie Monsieur de Philipsthal danach fragen müsse.
Es dauerte bis zum Abend, bis sie Philipsthal zur Rede stellen konnte. Er war in Eile, weil er eine Vorführung vorbereiten wollte, und tat ihre Beschwerde schroff ab. »Was regen Sie sich so auf? Die Leute strömen wegen der Phantasmagoria ins Lyceum-Theater. Ihre Wachsausstellung ist eine Beigabe, genauso wie meine kleinen mechanischen Kunstwerke, meine Automaten.« Eine Beigabe? Das hatte Marie aber anders verstanden! »Außerdem, Madame, Sie wissen doch um unsere Verabredung. Für Ihre Kosten, und dazu gehören nun mal auch die Plakate, sind Sie selbst verantwortlich. Ich dachte, beim ersten Mal helfe ich Ihnen. Aber wenn Sie so undankbar sind, lassen Sie eben neue drucken – es ist doch Ihr Geld!«
Marie kochte vor Wut. Sie würde also selbst mit dem Drucker sprechen müssen. Nun würde es noch länger dauern, bis sie ihre Ausstellung bekanntmachen konnte und endlich Geld verdienen würde. Das Geld, das Philipsthal ihr für die Reise vorgestreckt hatte, wurde langsam knapp. Vielleicht sollte sie in der Zwischenzeit, bis die Plakate fertig waren und die Besucher in das Wachsfigurenkabinett strömen würden, einige Figuren von Einheimischen herstellen, die von sich reden machten. Sie könnte sie nach Gemälden oder Büsten porträtieren oder nach der Natur, falls sie eine Sitzung arrangieren konnte. Mr Tenaveil müsste ihr die Zeitung übersetzen, damit sie wusste, über wen in London gesprochen wurde. Seit sie denken konnte, hatte es zu ihrem Tagesablauf gehört, sich über die Neuigkeiten zu informieren. Und jetzt diese Abhängigkeit! Sie schämte sich dafür. Es wurde Zeit, dass sie herausfand, ob es ein Lesekabinett gab, in dem sie die französischen Zeitungen La Mercure Britannique oder Le Courier de Londres einsehen konnte, die in der Stadt veröffentlicht wurden. Zeitungen waren hier durch die Steuer sehr teuer, die meisten Familien leisteten sich keine eigene, sondern lasen sie in den Kaffeehäusern, Lesekabinetten oder an einer der viele Straßenbuden, wo man einen Penny Lesegeld für jedes Blatt zahlte. Aber letztlich blieb es dabei, Marie musste die Sprache lernen. Nini schien sich mit dem Englischen leichter zu tun. So wie sie als Kind schneller Französisch gelernt hatte als ihre Mutter, flog auch Nini die fremde Sprache förmlich zu. Bald würde er die Besucher sprachgewandt durch das Kabinett führen können. Darüber hinaus wollte sie noch einen Katalog zu ihrer Ausstellung haben, in dem auf Englisch das Wichtigste über jede Figur stand. Wenn ihr Geschäft mehr einbrachte, würde sie mit einem Drucker über einen derartigen Katalog verhandeln, nahm sie sich vor.
Schon eine Woche später führte ihre Zeitungsrecherche zu einem ersten Ergebnis: Sir Francis Burdett wurde im Zusammenhang mit der Verhaftung des mutmaßlichen Verräters Colonel Despard genannt. Burdett? Hatte dieser radikale englische Politiker nicht einmal ihren Onkel in Paris besucht? Sie würde ihm einen Brief schreiben, und um eine Porträtsitzung bitten. Einen Versuch war es wert.
Es war Sonntag, und Marie war unruhig. Die Wachsfiguren waren aufgestellt, die Artefakte, wie das Modell der Bastille, die ägyptische Mumie oder das Hemd Heinrichs IV., waren aufgebaut, die Plakate hingen und die Handzettel waren gedruckt. Morgen würde sie endlich ihr Wachsfigurenkabinett im Lyceum-Theater eröffnen können. Jetzt gab es nichts mehr zu tun. Sie durfte auch gar nichts tun, denn am Sonntag hatte in England jede Arbeit zu ruhen. In Paris würden sie nun wohl einen Pot-au-Feu machen, den Suppentopf auf den Herd stellen und gemeinsam etwas unternehmen, während der Eintopf köchelte, aber hier … Nini trat an sie heran.
»Liest du mir etwas vor?«, fragte er. Marie lächelte, nahm aus ihrer Tasche ein Buch und zog ihn auf ihren Schoß. Nini strahlte, »Der Robinson, wie schön«. Langsam begann sie aus Robinson Crusoe vorzulesen, immer wieder hielt sie inne, um mit ihrem Sohn über das Vorgelesene zu sprechen. Sie erinnerte sich daran, wie sie auf dem Schoß ihres Großvaters in Straßburg gesessen hatte, während er ihr mit seiner tiefen Stimme aus ebendiesem Buch vorlas. Er war damals schon ein alter Mann gewesen, jetzt war er sicher bereits viele Jahre tot, genauso wie ihre Großmutter. Ob ihr Vater wohl noch lebte? Sie hatte ihn zuletzt gesehen, als sie ein Kind gewesen war, und danach nichts mehr von ihm gehört. Ihr war nur ihre Mutter geblieben, Anna. Und die kümmerte sich jetzt um Maries Familie, das Haus im Pariser Vorort Ivry und den Wachssalon. Noch immer hatte sie keinen Brief von zu Hause erhalten. Sie hoffte inständig, dass alle gesund waren und das Geschäft gut lief.
Die Magd klopfte an die Tür und brachte frisches Wasser. Marie und Nini ließen sich nicht stören. »Missis, was lesen Sie denn da?«, fragte sie entsetzt. »Das ist doch nicht die Bibel! Wissen Sie denn nicht, dass man am Sonntag nur in der Bibel lesen darf?« Marie klappte das Buch zu.
»Nein, das wusste ich nicht. Nun, es ist ja schon vorbei.« Die Magd verließ entrüstet den Raum, wenig später trat Maries Wirtin ein.
»Ich dachte, Sie wüssten um unsere Sitten. In Ihrem Land kennt man dergleichen wohl nicht. Sie wissen es nicht besser, deshalb werde ich Sie unterweisen«, sagte sie streng. »Wir widmen den Sonntag der Andacht und dem Gebet. Weltliche Lektüre, Musik und Kartenspiel sind dann verpönt. Seien Sie froh, dass die Strafgesetze, die zur Zeit der Königin Elisabeth galten, aufgehoben sind. Damals musste man Strafe zahlen, wenn man nicht zum Gottesdienst erschien. Heute sind wir toleranter. Bitte halten Sie sich an unsere Gepflogenheiten, zumindest solange Sie in meinem Haus wohnen.«
Marie ärgerte sich, der Raum kam ihr zu eng vor, die stickige Ofenluft schien ihr den Atem zu nehmen. Sie schnappte nach Luft. »Maman, was ist los?«, fragte ihr Sohn nervös. Sie beruhigte ihn. »Nichts, es ist schon gut. Lass uns ein wenig spazieren gehen.«
Vom Fluss her kroch der Nebel über die Straßen. Sie gingen in Richtung »the Strand«, da hörten sie Geschrei. Als sie näher an die Menschenmenge heran traten, erkannte Marie in deren Mitte zwei Männer, die mit Fäusten aufeinander losgingen. Die anderen feuerten sie an und wetteten ungeheure Summen auf den Ausgang des Kampfes. Solche Vergnügungen schienen am heiligen Sonntag gestattet zu sein. Verärgert zog Marie ihren Sohn weiter. Sie würden noch einmal zum Lyceum-Theater gehen und sich an ihrem Plakat erfreuen.
Aus dem Theater kam ihnen ein Mann entgegen, den Marie kannte. Sie wusste jedoch nicht, wo sie ihn einsortieren sollte. Sein Blick war auf ihr Plakat geheftet, er blieb stehen und las es. Marie musterte ihn unauffällig. Die rötlich blonden Haare, das runde, freundliche Gesicht, die leicht himmelwärts gerichtete Nase. Sie kannte ihn aus Paris, es war lange her. Plötzlich war die Erinnerung da. Es war der Bauchredner, der früher für ihren Onkel im Palais Royal gearbeitet hatte. »Monsieur Charles, Henri-Louis Charles?«, sprach sie ihn an. Er drehte sich um. Seine Augen wanderten einen Moment lang über ihr Gesicht, dann strahlte er.
»Marie! Marie Grosholtz«, sagte er erfreut und fügte dann kühler hinzu, »entschuldigen Sie, ich meine natürlich Madame Tussaud.« Marie fiel jetzt wieder ein, unter welchen Umständen sie ihn zuletzt gesehen hatte. Es war kurz nach dem Fest zum Jahrestag des Bastille-Sturms gewesen. Sie hatten auf den Ruinen der Bastille geflirtet, getanzt, sich geküsst und einen wunderbaren Abend miteinander verbracht. Aber am nächsten Morgen war Marie sich ihrer Gefühle nicht sicher gewesen. Henri-Louis hatte sie nach Versailles begleitet, wo sie ihre Wachsfiguren der königlichen Familie aufstellen sollte. Dort hatte er sie gefragt, warum sie so abweisend zu ihm war. Sie hatte ihm ehrlich geantwortet. Er war verletzt gewesen und wenig später aus ihrem Leben verschwunden. Und nun traf sie ihn hier wieder, in London.
»Was für ein angenehmer Zufall, Ihnen zu begegnen«, sagte Marie. »Hatten Sie im Lyceum zu tun?«
»Ich bin hier aufgetreten, bevor Monsieur de Philipsthal aus Paris zurückkehrte. Zuletzt war ich im Saville House am Leicester Square. Nun ziehe ich weiter, nach Norden, bis Edinburgh. Ich musste hier noch etwas abholen. Und Sie? Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu sehen«, antwortete er freundlich.
»Monsieur de Philipsthal hatte mir von seinem Erfolg in England berichtet und mir eine Partnerschaft angeboten. Ich werde meine Figuren einige Monate lang hier zeigen. Morgen soll es endlich losgehen.«
»Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich fürchte, Sie können es gebrauchen«, sagte er und schickte sich an zu gehen. Marie wollte ihn aufhalten.
»Wie meinen Sie das?«, fragte sie. Er drehte sich um. Beinahe widerwillig gab er Antwort.
»Nun, man hört so einiges. Monsieur de Philipsthal hatte hier vor einigen Monaten Schwierigkeiten. Dabei ging es wohl auch um Geld. Aber vielleicht wäre es am besten, wenn Sie meine Bemerkung einfach wieder vergessen.«
»Das glaube ich auch. Ich habe bislang nur von dem großen Erfolg meines Partners gehört. Und zu mir hat er sich immer korrekt verhalten.«
»Dann ist ja alles in Ordnung«, antwortete Monsieur Charles brüsk. Unentschlossen stand er vor ihr. Nini drängte sich dichter an seine Mutter heran. Henri-Louis Charles schien ihn erst jetzt zu bemerken und beugte sich zu ihm. »Und wer bist du?«, fragte er. Marie stellte ihn vor, Nini verbeugte sich leicht. Als Monsieur Charles sie mit einem Bauchrednertrick überraschte, löste sich ihre Anspannung in Gelächter auf. Marie war erleichtert darüber, schließlich war sie so froh gewesen, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Auch Henri-Louis Charles wirkte nun weniger verkrampft. »Haben Sie hier in der Nähe eine Unterkunft genommen? Darf ich Sie einige Schritte begleiten?«
Marie nickte. Sie sprachen ein paar Minuten über das Wetter und die trübsinnige Stimmung. »Es wundert mich nicht, dass laufend Selbstmörder aus dem Fluss gezogen werden, allein in den letzten Tagen waren es wieder drei, erzählte unsere Wirtin«, sagte Marie.
»So gern wir Franzosen hier alles auf die Veränderlichkeit der Witterung schieben, sogar die Gallenkrankheiten, von denen die meisten Fremden zu Beginn ihres Aufenthalts befallen werden, so wenig Wahres ist an dieser Behauptung. Die Erklärung für die vielen Selbstmorde ist viel simpler: Hier ist es üblich, am Ende des Jahres alle Rechnungen zu begleichen. Wer nicht genug Geld hat, dem droht das Schuldgefängnis. Der einzige Ausweg, um Armut und Schande zu entgehen, scheint vielen der Selbstmord«, erklärte Henri-Louis Charles. »Dazu kommt die weitverbreitete Irreligiosität. Wenn man an nichts glaubt, hat man auch nichts, woran man sich festhalten kann, wenn es einem schlecht ergeht.«
»Das ist bei meiner Wirtin anders. Sie ist so fest in ihrem Glauben, dass ich am Sonntag nicht mal meinem Sohn aus Robinson Crusoe vorlesen durfte.«
»Tja, das ist das andere Extrem. Manche hängen sogar den Käfig ihres Kanarienvogels zu, damit sein Gesang nicht ihre Andacht stört. Deshalb ziehe ich es vor, in einem Viertel von London zu wohnen, in dem viele Franzosen leben. Dort ist man, sagen wir, toleranter.«
»Und wo ist das?«, horchte Marie auf.
»Je nach Geldbeutel kommen verschiedene Gegenden in Frage. Die Haute Monde des Exils zieht es in Viertel wie Marylebone, während auf der anderen Seite der Themse die wohnen, denen es nicht so gut geht. Dort kann man froh sein, wenn man die Härten des Exils überlebt oder nicht darüber verrückt wird. In Soho leben die meisten emigrierten Franzosen. Auch Jean- Paul Marat hatte in den Jahren vor der Revolution dort gelebt. Hier gibt es französische Geschäfte, Kaffeehäuser, Gasthäuser und sogar katholische Kirchen. In manchen Straßen kommt es einem vor, als sei man wieder in Paris«, schwärmte er. »Man muss es sich in der Fremde so angenehm wie möglich machen. England hat viele Vorzüge, aber diese Ausflüge in die Heimat genieße ich doch sehr«, sagte Henri-Louis Charles. Inzwischen waren sie vor ihrer Unterkunft stehen geblieben.
»Verzeihen Sie meine Bemerkung über Philipsthal von vorhin. Es würde mich aber wundern, wenn er mit seinen Geschäften zufrieden ist. Als er im letzten Jahr hier auftrat, war seine Phantasmagoria noch etwas Sensationelles, etwas Neues. Inzwischen gibt es überall Nachahmer. So ist es leider in unserem Geschäft. Einer hat eine Idee, viele andere äffen sie nach. Um in dieser Konkurrenz zu bestehen, braucht man immer neue Attraktionen. Und genau das sind Sie und Ihre Wachsfiguren für Philipsthal«, meinte Mr Charles und tippte zum Abschied an seinen Zylinder. »Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute.«
»Ich Ihnen auch. Ich bin sehr froh, dass sich unsere Wege wieder gekreuzt haben«, antwortete Marie. Bereits nach wenigen Schritten war Henri-Louis Charles im Nebel verschwunden. Marie und Nini kehrten in die Enge ihrer Unterkunft zurück.
Schon seit einiger Zeit beobachtete Marie die Dame, die vor dem Eingang ihres Wachsfigurenkabinetts hin- und herlief. In der einen Hand hielt sie ein fleckiges Papierpaket, aus dem ein Fischschwanz zu ragen schien, in der anderen einen Regenschirm. Ihre Kleidung sah elegant aus, war aber abgenutzt, an einigen Stellen konnte Marie sogar Flicken erkennen. Sie war etwa in Maries Alter, ihr Gesicht wirkte jedoch eingefallen und grau. Immer wieder las sie die Schrift auf dem Plakat, dann wieder versuchte sie, in die Räume zu spähen. Sie musste schon ganz durchgefroren sein. Marie trat zu ihr und sprach sie an.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Die Frau schien verlegen. »Die königliche Familie von Frankreich! Ich wünschte, ich könnte sie noch einmal sehen«, sagte sie leise auf Französisch. Marie freute sich, die Sprache ihrer Heimat zu hören.
»Das können Sie«, sagte sie. »Kommen Sie doch einfach hinein.«
Die Dame sah sie neugierig an. »Sie sind Französin?« Marie nickte.
»Ich auch. Ich bin mit meinen Eltern nach den Septembermassakern vor der Revolution geflohen. Wir haben uns jahrelang in England durchgeschlagen. Jetzt sind unsere letzten Ersparnisse erschöpft. Ich kann es mir nicht leisten, diese Ausstellung zu besuchen. So gern ich es auch möchte«, sagte die Frau traurig.
Marie tat die Emigrantin leid. Aus einem Impuls heraus sagte sie: »Ich bin für diese Ausstellung verantwortlich. Es wäre mir eine Freude, wenn Sie hereinkommen würden.«
Sicher, sie wollte Geld verdienen, aber diese eine Besucherin, die umsonst in das Wachsfigurenkabinett kam, würde sie schon verkraften. Es war ohnehin nicht viel los, gar nichts, um genau zu sein. Die Frau bedankte sich überschwenglich und stellte sich als Madame Latisse vor. Sie folgte Marie in den Salon und legte ihre Sachen am Eingang ab. Marie spürte förmlich, wie sehr sie der strahlend erleuchtete Raum mit den prächtig ausstaffierten Figuren beeindruckte. Als sie das Modell der Bastille erblickte und das Gewehr mit Gravur, das ihr Onkel Curtius von der Nationalversammlung für seinen Einsatz bei der Erstürmung der Festung erhalten hatte, versteifte sie sich. Madame Latisse drehte sich abrupt um und wollte das Wachsfigurenkabinett verlassen. Marie hielt sie auf und fragte sie nach dem Grund für diese plötzliche Abwehr.
»Curtius! Der Name kam mir gleich bekannt vor. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Revolutionär der ersten Stunde, der später eine Rolle dabei spielte, dass der ehrenwerte General Custine hingerichtet wurde. Mit so einem Menschen will ich nichts zu tun haben«, sagte sie erregt. Marie versuchte, sie zu beruhigen.
»Sie irren. Philippe Curtius hat zwar dazu beigetragen, die Bastille zu erstürmen und so unser Volk aus der Unterdrückung zu befreien. Den blutigen Terror der Revolution hat er jedoch verurteilt«, erzählte sie. Das stimmte zwar nicht ganz, sie selbst hatte sich oft genug mit ihrem Onkel über seine Unterstützung der Revolutionäre gestritten, aber wer sollte das heute noch nachprüfen. Madame Latisse zögerte, Marie setzte noch hinzu: »Und was General Custine angeht: Monsieur Curtius hatte ihn als Dolmetscher bei seiner Mission ins Rheinland begleitet. Später in Paris hat Curtius ihn ausdrücklich gelobt – und ist dafür selbst angefeindet worden.« Hätte Jean-Paul Marat sich damals nicht für ihren Onkel eingesetzt, wäre er vielleicht ins Gefängnis gekommen. Dass Curtius mit diesem radikalen Politiker befreundet gewesen war, sollte sie jedoch lieber nicht erwähnen. Marie spürte jetzt deutlich, dass sie sich auf einem schmalen Grat bewegte. Einerseits profitierte sie davon, dass sie hautnah in die Ereignisse der Revolution verwickelt gewesen war, andererseits durfte sie nicht in den Ruch kommen, selbst eine der blutgierigen Revolutionärinnen gewesen zu sein. Sie musste Curtius' Geschichte also etwas entgegensetzen:
»Wir wären selbst fast Opfer der Revolution geworden. Ich habe die Schwester des Königs in Versailles in der Wachskunst unterrichtet. Diese Verbindung zum Hof hat mich und meine Mutter in Lebensgefahr gebracht. Wir wurden verhaftet und eingekerkert.«
Madame Latisse wirkte jetzt kleinlaut und sah sich verlegen um. Marie bot an, sie durch das Kabinett zu führen. Doch die Frau ging bereits wie hypnotisiert auf die Abbilder der königlichen Familie zu. Marie blieb stehen, sie wollte sie nicht stören. Als sie die Figur des Dauphins erblickte, begannen Madame Latisses Schultern zu zucken. Diese Reaktion hatte Marie schon häufig erlebt, denn der Thronfolger war im Alter von nur zehn Jahren in einem Pariser Gefängnis gestorben. Nach einigen Minuten wandte die Besucherin sich den anderen Wachsbildnissen zu. Sie knickste vor der Figur von König Ludwig XVL, trat dann zur Figur der Königin Marie Antoinette, hob den Saum ihres Kleides und küsste ihn. »Wir konnten es nicht fassen, als wir von ihrem grausamen Tod hörten«, flüsterte sie mit tränenerstickter Stimme. Auch Marie dachte nur ungern an die Hinrichtungen des Königs und der Königin zurück. Sie war von Regierungsvertretern gezwungen worden, die Totenmasken zu nehmen. Es war schrecklich gewesen, die abgeschlagenen Köpfe der königlichen Herrschaften in der Hand zu halten. Nun waren diese Masken sicher in einer ihrer Kisten verstaut. Sie würde sie aus Respekt vor den Toten nicht öffentlich zeigen, aber es beruhigte Marie, sie in Sicherheit zu wissen. Madame Latisse hatte sich jetzt wieder gefangen.
»Ich habe die Königin häufig gesehen, weil ich einige Jahre im Geschäft der Modeschöpferin Bertin in Paris tätig war. Wussten Sie, dass auch Mademoiselle Bertin einige Zeit im Londoner Exil verbracht hat? Ich habe gleich erkannt, dass dies ihr Werk ist«, sagte sie zu Marie und strich bewundernd über das Kleid, das die Figur von Marie Antoinette trug. Neugierig fragte sie, ob Mademoiselle Bertin heutzutage auch bei Napoleons Frau Joséphine derart angesehen sei. Marie erzählte, dass die Bertin als passé,duvieux temps, nicht mehr in Mode, galt und fragte Madame Latisse, ob sie auch in London für die Modeschöpferin gearbeitet habe. Madame Latisse verneinte.
»Viele von uns haben ihr Geld damit verdient, Strohhüte zu flechten. Andere haben Französisch, Tanzen, Fechten oder Schach unterrichtet, einige haben sich als femmedechambre bei reichen Damen verdingt. Manche sind auch in der Kunstakademie und -galerie des Deutschen Rudolph Ackermann hier um die Ecke untergekommen«, sie machte eine vage Handbewegung. »Die meisten Emigrés sind aber auf das Geld der britischen Regierung angewiesen, auf die Wohltätigkeit der reichen Engländer oder gar auf Almosen. Einige, wie die Herzogin von York, haben Geld gesammelt, um unsere Not zu lindern. Trotzdem sind wir oft hungrig ins Bett gegangen. Trost fanden wir nur in der Kapelle in St. Marylebone. Alles was Rang und Namen hatte, kam dort zur Andacht. Ich selbst habe den Grafen von Artois gesehen, der von der Kirche zu Fuß in seine Wohnung in die Baker Street ging«, berichtete Madame Latisse.
Erregung erfasste Marie. Sie kannte den Bruder des früheren Königs noch aus Versailles und könnte ihn um ein Porträt und seine Unterstützung bitten. Das würde vielleicht ihr Geschäft in Schwung bringen. »Lebt Monsieur noch in London?«, fragte sie. Doch ihre Hoffnung wurde schon in der nächsten Sekunde zunichte gemacht.
»Nein, er ist wieder in den Palast von Holyrood nach Edinburgh zurückgekehrt, wo er nicht belangt werden kann. Er hat ungeheure Schulden angehäuft«, flüsterte Madame Latisse, als ob es sich dabei um ein Geheimnis handelte. Dabei hatten die Schulden des eitlen und vergnügungssüchtigen Bourbonensprosses schon vor der Revolution für Gerede gesorgt. Madame Latisse ging zum Ausgang und nahm dort wieder ihren Regenschirm und das fettige, nach Fisch riechende Papierpaket an sich. Nachdenklich sagte sie: »Seit dem Friedensschluss hat London sich verändert. Einige der Kirchen und Schulen für die Franzosen sind geschlossen worden, weil so viele von uns in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Auch meine gebrechlichen Eltern und ich wollen das nächste Schiff nehmen. Dabei wissen wir gar nicht, was uns dort erwartet.« Marie versuchte sie zu beruhigen.
»Frankreich hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Es gibt eine Amnestie, die Todesstrafe für Emigranten ist abgeschafft. Die Revolution ist offiziell längst vorbei. Sie können unbesorgt zurückkehren.« Marie fürchtete jedoch, dass sich auch diese Emigrantin in ihrer Heimat kaum zurechtfinden würde. Zu viel hatte sich in den vergangenen zehn Jahren verändert. Sie würde sich vermutlich in Paris ebenso fremd wie in England fühlen. Und dennoch würde Marie am liebsten mit ihr tauschen, so sehr vermisste sie ihre Familie. Madame Latisse verabschiedete sich mit einem müden Lächeln. »Ich kann Ihnen nichts geben, nicht einmal diesen Fisch hier. Haben Sie Dank für Ihre Großzügigkeit. Durch Sie konnte ich in die glorreiche Vergangenheit zurückblicken – wenn auch nur für einen kurzen Augenblick.« Marie war gerührt. Es gab nichts mehr zu sagen, deshalb winkte sie ihr hinterher: »Grüßen Sie mir Paris!«
Erschöpft, aber erwartungsfroh betrat Marie ihre Unterkunft. Sie warf ihrer Wirtin einen Blick zu, wurde allerdings enttäuscht, als die nur mit den Schultern zuckte. Marie strich Nini über das Haar und ging mit ihm in ihr Zimmer, um das Abendbrot zuzubereiten. Wieder nichts. Wieder kein Brief aus Frankreich. Warum schrieb ihr Ehemann François nicht? War er so beschäftigt mit dem Salon und dem Haus, dass er keine Zeit hatte, die Feder in die Hand zu nehmen? Wie sehr sie sich nach ein paar Zeilen von ihm sehnte und nach einer Nachricht von ihrem kleinen Liebling Françison! Die Magd klopfte und stellte einen Teller mit Käsetoast auf den Tisch. Ihre Wirtin hatte eine Vorliebe dafür, Brot über dem Feuer zu rösten und Chesterkäse darauf zu schmelzen. Marie würde heute keinen Bissen davon herunterbekommen, aber Nini griff hungrig danach. Es waren nicht nur Heimweh und Sehnsucht, die ihr auf den Magen schlugen. Bisher war in England nichts so gewesen, wie sie es erwartet hatte. Auch das Geschäft lief nicht so gut wie erhofft. Ich muss Geduld haben, schalt sie sich in Gedanken. Es war Ende November, erst jetzt kehrte die feine Gesellschaft ihren Landsitzen den Rücken und reiste zurück nach London. Erst vor kurzem war das Parlament eröffnet worden. Auch der Herzog von Orléans, der Anwärter auf den französischen Thron, war unter den Geladenen gewesen. Sein Vater Philippe-Égalité hatte einst für die Hinrichtung seines Vetters Ludwig XVI. gestimmt, und der Herzog ließ sich als Adelsspross feiern – was für eine Zeit! Man sprach davon, dass der Friede mit Frankreich brechen könnte. Sie wünschte, sie könnte sich mit jemandem über die Ironie der Geschichte austauschen, aber Philipsthal war immer zu beschäftigt, ihre Zimmerwirtin würde es kaum verstehen und ihr Sohn Nini war noch zu klein dafür. Sie würde François in ihrem nächsten Brief davon schreiben. Überhaupt, die Politik! Alle schienen zu glauben, dass Bonapartes Sturz kurz bevorstand. Würden die Gerüchte dafür sorgen, dass mehr Besucher als bisher in das Kabinett gelockt wurden? Es half nichts, die Konkurrenz war groß, sie brauchte neue Attraktionen, die ihre Kasse füllten. Sie müsste endlich anfangen, einige Mitglieder der Königsfamilie sowie der einflussreichen englischen Politiker zu porträtieren, um die Ausstellung noch attraktiver zu gestalten. Wie hätte Onkel Curtius gesagt: Ein richtiger Reißer würde ihr jetzt guttun …