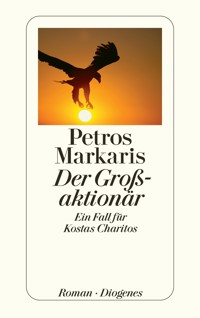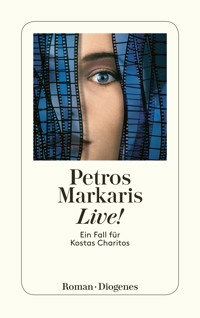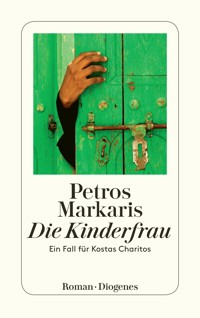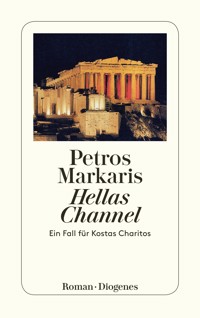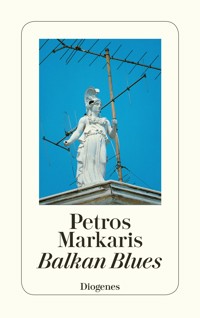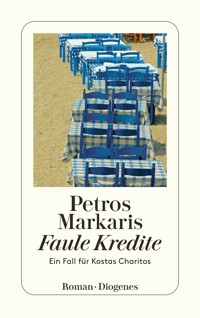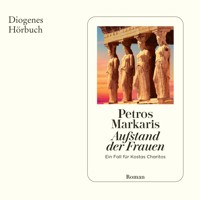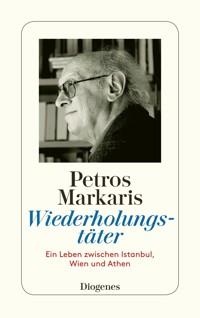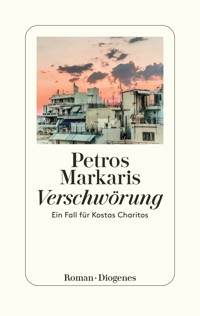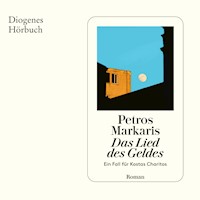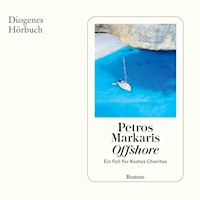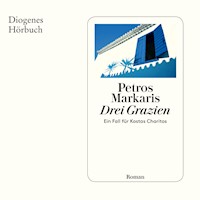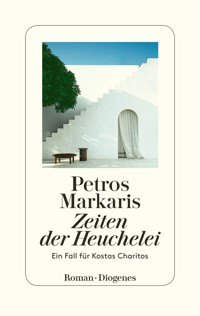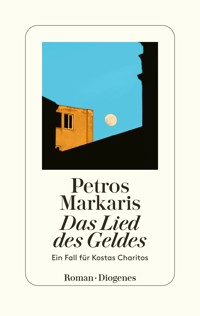
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kostas Charitos
- Sprache: Deutsch
Feierlich wird die Linke zu Grabe getragen, in einem Trauerzug durch die Straßen von Athen. Was wie ein Karnevalsumzug aussieht, ist der Beginn einer neuen Protestbewegung: Die Armen schließen sich zusammen, um sich Gehör zu verschaffen. Ist in ihren Reihen der Mörder zu suchen, der die ausländischen Investoren auf dem Gewissen hat? Kommissar Charitos ermittelt und horcht auf, als er überall in der Stadt das Lied des Geldes vernimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Petros Markaris
Das Lied des Geldes
Ein Fall für Kostas Charitos
Roman
Aus dem Neugriechischen von Michaela Prinzinger
Diogenes
Im Gedenken an meine beiden Verleger
Filippos Vlachos und
Samis Gavrielides
Selbst die Sintflut
Dauerte nicht ewig.
Einmal verrannen
Die schwarzen Gewässer.
Freilich, wie wenige
Dauerten länger!
Bertolt Brecht,
Beim Lesen des Horaz
1
Wir sind nicht sehr viele. Gerade mal hundert vielleicht. Als ich jung war, hätten wir vor der Partei für die misslungene Mobilisierung der Massen Rechenschaft ablegen müssen. Aber heute, da zehn Teilnehmer auf einer Straße oder einem Platz schon als Demonstration durchgehen, gelten wir als Menschenmeer.
Die meisten stammen aus unserem Obdachlosenheim. Bei einem Rundgang durch die übrigen Asyle konnte ich weitere Interessenten gewinnen. Dazu kommen einige direkt von der Straße.
Die Passanten bleiben neugierig stehen und beobachten uns. Sie fragen sich völlig zu Recht, was eine Gruppe Unbekannter, die einen Sarg mit sich führt, auf dem Attikis-Platz zu suchen hat. Genauso ergeht es den Bewohnern des Viertels, die das Schauspiel von den Fenstern und Balkonen verfolgen.
Zwei Männer, die ich nicht namentlich kenne, da sie aus einem anderen Obdachlosenasyl stammen, stellen den Sarg auf dem Boden ab.
»Hältst du eine Rede, Lambros?«, fragt mich Stelios.
»Ja, am besten warten wir noch ein bisschen. Vielleicht kommen ja noch mehr Leute.«
Doch anstelle zusätzlicher Teilnehmer trifft ein Streifenwagen ein. Die Erklärung liegt auf der Hand. Einer der Schaulustigen muss, erschrocken über den Anblick von Sarg und Trauerzug, die Polizei alarmiert haben.
»Was spielt sich hier ab?« Die Frage des Polizeibeamten, der aus dem Streifenwagen gestiegen ist, richtet sich an alle und keinen.
»Eine friedliche Kundgebung«, antwortet Anna.
»Und der Sarg? Liegt da jemand drin oder ist der leer?«
Bevor ich ihm antworten kann, ist die MAT-Sondereinheit, die »Eingreiftruppe zur Wiederherstellung der Ordnung«, im Laufschritt herbeigeeilt und hat uns eingekesselt. Meine Mitstreiter werfen mir besorgte Blicke zu.
»Im Sarg, da liegt die Linke«, erkläre ich dem Polizeibeamten. »Sie hat Selbstmord begangen, und wir wollen sie zu Grabe tragen. Die Linke ist in den Armenvierteln groß geworden. Daher haben wir beschlossen, sie hier am Ionias-Boulevard aufzubahren, wo sich Arme und Migranten immer die Türklinke in die Hand gegeben haben.«
»Den Sarg nehmen wir mit. Und ihr löst euch schön friedlich auf, denn Ausschreitungen nützen weder euch noch uns etwas«, meint der Truppführer der MAT-Sondereinheit zu mir, der meine Antwort aus nächster Nähe mitbekommen hat.
Sein Gesichtsausdruck bringt mich auf die Palme. Wenn man so alt ist wie ich, dann versetzen einen Zorngefühle zurück in die Vergangenheit.
»Können Sie mir eine Sache erklären?«, frage ich. »Wenn wir in meiner Jugend für die Linke auf die Straße gegangen sind, haben uns eure Vorgänger zuerst auf der Straße und danach in der Zentrale der Sicherheitspolizei grün und blau geschlagen. Und jetzt, da wir euch erklären, dass die Linke Selbstmord begangen hat, wollt ihr uns wieder verprügeln? Muss man für eine Unterstützung der Linken, sei sie nun tot oder lebendig, immer mit einer Prügelstrafe rechnen?«
»Herr Lambros, wieso rufen Sie nicht Kommissar Charitos an?«, sagt Stelios zu mir und reicht mir das Handy.
Der Truppführer stutzt. »Sie kennen Kommissar Charitos?«
Bevor ich ihm antworten kann, tritt der Polizeibeamte aus dem Streifenwagen auf ihn zu und flüstert ihm etwas ins Ohr.
»Ist der Enkel des Kommissars tatsächlich nach Ihnen benannt?«, will er wissen, nachdem ihn der Polizeibeamte aufgeklärt hat.
»Ja.«
Er gibt sofort klein bei. »In Ordnung, Sie können Ihre Veranstaltung durchführen. Wir bleiben am Rande und passen auf, dass nichts aus dem Ruder läuft.«
Wie war es zu der Aktion gekommen? Auf eine solche Frage würde ich spontan »Na einfach so« oder auch »Alte Sünder bekehrt man nicht« antworten. Doch das stimmt nicht. Der Einfall kam nicht aus dem Nichts.
Es waren die vielen Anfragen im Obdachlosenheim gewesen, die wir ablehnen mussten. Dabei ging es nicht um irgendwelche Anliegen unserer Bewohner, sondern um Menschen, die an unsere Tür klopften und bei uns aufgenommen werden wollten. Doch wir hatten kein Bett mehr frei und mussten sie wieder auf die Straße schicken. Wenn ich sah, wie sie stumm und mit hängenden Köpfen davonzogen, fragte ich mich, wie wir in den fünfziger oder sechziger Jahren darauf reagiert hätten.
Damals hätten wir für die Armen und Entrechteten demonstriert. Wir hätten Parolen skandiert, wären mit der Polizei aneinandergeraten und vermutlich unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. In neun von zehn Fällen wussten wir von vornherein, dass wir einsame Rufer in der Wüste waren. Aber der Satz »Verdammt, damit kommt ihr nicht durch!« hätte uns auf die Barrikaden getrieben.
Damals stand eine Partei und linke Bewegung hinter uns, die genau wusste, wie sie uns mit diesem »Verdammt …« mobilisieren konnte. Heute ist der Satz zum Seufzer »Verdammt, was können wir schon dagegen tun?« verkommen. Die Mutlosigkeit der Obdachlosen hat mir die Augen geöffnet, und ich merkte, dass auch ich inzwischen zur Fraktion der Resignierten gehörte. Auf einmal wurde mir klar, dass wir die Linke und alles, was wir durchgemacht hatten – die Bewegung, den Widerstand im Zweiten Weltkrieg, die Verfolgung, das Exil auf den Verbannungsinseln in der Bürgerkriegszeit – vergessen mussten. Nichts davon zählte noch, stattdessen waren die Tage der Linken gezählt.
Heute müssen sich die Armen aus eigener Kraft erheben, wenn sie je wieder gute Tage sehen wollen. Von politischen Gruppierungen haben sie nichts zu erwarten, sie müssen selbst zu einer Bewegung werden. Alles andere sind nostalgische, gefühlsduselige Geschichten aus der Vergangenheit. Auch ich selbst, Lambros Sissis, musste von der Ideologie des Marxismus-Leninismus auf die Ideologie der Armut umschwenken. In der Politik agieren nurmehr Leute, die ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben.
Plötzlich sehe ich, wie ein Grüppchen Migranten zu uns stößt. Ihr Anführer, ein dreißigjähriger Grieche, tritt auf mich zu. »Als ich gesehen habe, dass ihr die Linke zu Grabe tragt, habe ich meine Nachbarn zusammengerufen. Viele kommen aus ehemaligen Ostblockländern, hatten aber keine Gelegenheit, den Sozialismus zu beerdigen, da sie der politische Wandel völlig überrascht hat. Jetzt können sie das nachholen.«
Ich werfe einen Blick auf die übrigen Demonstranten. Ruhig warten sie das Kommende ab, genauso wie die MAT-Sondereinheit, die sich aus der Sache heraushält und am Rand des Platzes strammsteht. Jetzt ist der geeignete Moment, meine Rede zu beginnen.
»Wir sind heute hier, um eine Trauerfeier zu begehen. Eine Kundgebung also, in der kein Platz ist für Geschrei und Ausschreitungen, sondern für stille Einkehr. Ich selbst habe mich mein Leben lang für die Linke und den gesellschaftlichen Wandel eingesetzt. Heute sage ich euch: Das alles ist Schnee von gestern. Ihr könnt von niemandem Unterstützung und Rückendeckung erwarten.«
»Wem sagst du das!«, erhebt sich eine Männerstimme aus der Menge. »Wir sind hier, weil der Sozialismus in unserer Heimat tot ist.«
»Auch im Sozialismus haben wir, genauso wie hier, für einen Kanten Brot gearbeitet«, entgegnet ihm eine Frau.
»Bei uns in Pakistan kein Stück Brot. Hier kein Stück Brot. Wo Stück Brot?«, ruft einer aus der zweiten Reihe und ringt verzweifelt die Hände.
»Was ihr sagt, stimmt!«, rufe ich ihnen zu. »Daher könnt ihr von keinem System, von keiner Regierung und von keiner Bewegung Rückhalt und Hilfe erwarten. Der Sozialismus und die Linke, an die wir geglaubt haben, haben Selbstmord begangen, weil sie sich auf das Spiel der Macht eingelassen haben. Die Armen auf der ganzen Welt müssen begreifen, dass nur noch sie selbst die Bewegung sind.«
»Gut gesagt, aber was können wir schon ausrichten, verdammt noch mal?«, ertönt jetzt die Stimme einer Frau, die mir die Gedanken von vorhin wohl von der Stirn abgelesen hat.
»Wir müssen uns in jedem Viertel, in jeder Wohngegend zusammentun. Nicht, um über unser Schicksal zu klagen, sondern um über unsere Probleme zu reden. Wir müssen aussprechen, wer uns ausbeutet, wer uns bestiehlt, wer von unserem Unglück profitiert. In ein paar Tagen werden wir ein Komitee zusammenstellen. Dann könnt ihr zu uns kommen, um uns eure Probleme zu schildern, und danach entscheiden wir gemeinsam, wie wir darauf reagieren und welche Form von Protest wir organisieren.«
Ich warte ab, ob sich jemand zu Wort meldet. Doch alle schweigen. Sie überlassen mir die Initiative für den nächsten Schritt.
»Dann beerdigen wir jetzt die Linke«, sage ich.
Ich lasse die Stadtbahnstation hinter mir und biege in den Ionias-Boulevard ein. Die Prozession folgt mir, mit dem Sarg direkt hinter mir.
Ich habe die Gegend zuvor ausgekundschaftet und weiß, wo wir den Sarg abstellen können: auf dem kleinen Grundstück eines Einfamilienhauses, das noch aus der Zeit um 1922 stammt, als die Verfolgten des Griechisch-Türkischen Kriegs von Kleinasien nach Athen kamen. Das Grundstück ist kahl und leer, nur ein kleiner Garten mit Bäumen umgibt das Haus der einstigen Flüchtlinge. Auch ohne die für Friedhöfe üblichen Zypressen ist dieser Ort die geeignete Grabstelle für die Linke.
»Stellt den Sarg hier ab«, sage ich zu den beiden Trägern und deute auf einen Platz in der Mitte des Grundstücks.
»Ich schlage vor, dass wir eine Schweigeminute einlegen«, sage ich zu den Teilnehmern.
»Wollen wir denn keine richtige Trauerfeier machen?«, fragt eine Frau.
»Eine Schweigeminute ist die für die Linke passende Trauerfeier«, antworte ich ihr.
»Wollen wir sie nicht bestatten?«, will ein Mann wissen.
»Nein, sie soll hier öffentlich und für die Passanten sichtbar aufgebahrt bleiben.«
Einer der Bewohner unseres Obdachlosenheims hat mit weißer Farbe »Hier ruht die Linke« als Geleitwort auf den Sarg geschrieben.
Nach der Schweigeminute löst sich die Kundgebung nach und nach auf.
»Wir bleiben in Kontakt!«, rufe ich den Teilnehmern hinterher. »Wir melden uns bald bei euch. In der Zwischenzeit solltet ihr euch in euren Vierteln organisieren und das Unrecht und die Probleme auflisten, die euch zu schaffen machen.«
Einige machen sich einzeln auf den Weg, andere in Gruppen. Die Migranten bilden die größte Gruppe. Wir hingegen kehren zum Bahnhof zurück, um die Stadtbahn zum Viktoria-Platz zu nehmen.
Die MAT-Sondereinheit macht sich zum Abmarsch bereit. Als mich der Truppführer erblickt, kommt er auf mich zu.
»Eine gute Rede, Herr Lambros, aber uns bringen Sie damit in Schwierigkeiten«, meint er.
»Wieso?«, wundere ich mich.
»Die Politiker machen den Armen ein leeres Versprechen nach dem anderen, um sie ruhigzustellen. Aber wenn Sie sie jetzt in Aufruhr versetzen, müssen wir die Kastanien aus dem Feuer holen.« Damit dreht er sich um und geht zum Streifenwagen.
In der Stadtbahn herrscht unter den Obdachlosen aus unserem Asyl immer noch eine euphorische Stimmung. Mir aber ist klar, dass man anfangs immer Beifall bekommt. Verflucht wird man erst hinterher.
2
Ich brauche Adriani nicht auf ihrem Handy anzurufen, um herauszufinden, wo sie ist. Zu dieser Tageszeit, sobald es kühler wird, geht sie mit unserem Enkel Lambros in den Volkspark von Pangrati. Bequemerweise liegt er ganz in der Nähe von Katerinas Wohnung.
In der Nikosthenous-Straße finde ich einen Parkplatz. Adriani sitzt wie immer auf derselben Bank, die eine Hand am Kinderwagen. Ihre ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf unseren Enkel.
»Hab ich’s doch gewusst, dass ich dich hier finde«, sage ich beim Näherkommen.
»Nachmittags ist weniger los«, erläutert sie. »Morgens kommen die Mütter mit ihren Kindern, die laut schreien und spielen. Das ist immer ein großes Halligalli! Lambros wird dann unruhig und nörgelig. Deshalb gehe ich lieber morgens mit ihm spazieren und nachmittags in den Park, wenn nicht Melpo ihn übernimmt.«
Zunächst einmal beuge ich mich über den Kinderwagen unseres Enkels, der mittlerweile sieben Monate alt ist. Er schwenkt seine Ärmchen, dreht den Kopf hin und her und lacht beim geringsten, zumeist nicht nachvollziehbaren Anlass. So auch jetzt: Er blickt mich an, fuchtelt mit den Ärmchen und schenkt mir ein Lächeln.
Ich nehme neben Adriani Platz. Nun, da sich vier Augen auf Lambros heften, wendet er den Kopf ab und gähnt.
»So ein braves Kind ist mir noch nicht untergekommen«, meint Adriani. »Ein stilles Wasser. Nur wenn er Hunger hat, weint er mal.«
»Ganz anders als unsere Tochter.«
»Das kannst du laut sagen! Katerina hat ja schon losgeheult, wenn sie das Fläschchen nur gesehen hat.«
Lambros schlägt die Augen auf, mustert das Verdeck des Kinderwagens, das Adriani zum Schutz vor der Sonne hochgestellt hat, und lächelt erneut.
»Siehst du das? Dieses freundliche Gesicht zu allem, was er tut?«, sagt Adriani und schlägt das Kreuzzeichen. »Heilige Muttergottes, hoffentlich bleibt das so, bis er groß ist!«
»Bei den Erwachsenen hängt das Lächeln von den Umständen ab«, sage ich.
Sie blickt mich an. »Ist das der Grund, dass du in der letzten Zeit freundlicher dreinblickst?«
»Ich?«
»Ja, wegen der Beförderung.«
Damit hat sie recht, zugegeben. Die Beförderung hat mich moralisch aufgebaut. Auf der Dienststelle ist es ruhig, ich stehe nicht unter Druck, und mit dem Vizepolizeipräsidenten bin ich nach wie vor ein Herz und eine Seele. So ist es nur natürlich, dass ich ein Dauerlächeln im Gesicht trage.
»Komm, gehen wir«, sagt sie und steht auf. »Katerina wird schon zu Hause sein, und Lambros muss gefüttert werden.«
Wir machen uns auf den Weg zur Ajias-Athanassias-Straße. Adriani lenkt den Kinderwagen, Lambros mimt geräuschloses Händeklatschen, und ich paradiere an seiner Seite wie zum Begleitschutz einer hochgestellten Persönlichkeit.
Als Katerina uns an der Wohnungstür hört, kommt sie uns im Flur entgegen. »Hallo, mein Junge!«, ruft sie und nimmt Lambros auf den Arm. Dann küsst sie ihre Mutter und mich.
»Ich setze Lambros kurz in sein Bett und wärme ihm sein Fläschchen«, meint sie.
»Wo ist Fanis?«, frage ich.
»Er kommt später, er hat heute Notdienst.«
Während Katerina Lambros ins Kinderzimmer bringt, sagt Adriani: »Ich schau mal nach, was zum Essen da ist«, und steuert die Küche an.
Allein im Wohnzimmer zurückgeblieben, habe ich keine Lust, den Fernseher anzumachen. Lieber sehe ich meinem Enkel beim Abendessen zu. Als ich ins Kinderzimmer komme, hält ihn seine Mutter auf dem Arm, und er nuckelt an seinem Fläschchen, gierig wie ein Erwachsener, der seinen Durst direkt aus der Flasche löscht.
»Glück gehabt, er ist ein guter Esser«, sage ich zu meiner Tochter.
»Ein guter Esser nennst du das? Er ist unersättlich!«
»Freut dich das nicht?«
»Nein! Wenn er so weitermacht, wird er noch ein richtiges Dickerchen. Du willst doch auch nicht, dass er wie diese übergewichtigen Kinder wird, auf deren Hintern ein ganzes Tischtuch passt?«
Da hat sie schon recht. Trotzdem fasziniert mich Lambros’ hingebungsvolle Gier.
Adriani kommt nun auch ins Kinderzimmer und unterbricht das Schauspiel. »Unglaublich, Melpo hat Artischocken à la Polita gekocht. Sie hat einfach goldene Hände!« Nur selten drückt sie, die sonst alle anderen Hausfrauen als Konkurrenz wahrnimmt, ihre Bewunderung so unverhohlen aus.
»Wie schafft sie das bloß?«, frage ich arglos.
»Sie setzt Lambros in den Kinderwagen und nimmt ihn mit in die Küche. So hat sie ein Auge auf ihn, während sie gleichzeitig Essen zubereitet«, erläutert mir Katerina.
In diesem Augenblick klingelt es, Adriani geht zur Tür und kommt in Begleitung von Katerinas Freundin Mania zurück.
»Ganz allein heute?«, frage ich Mania, da sie sonst immer mit Uli erscheint.
»Ja, Uli ist in Deutschland.«
»Wieso denn? Hoffentlich nichts Schlimmes!«, meint Adriani.
»Sein Vater hatte einen Herzinfarkt, und er ist nach München geflogen, um seiner Mutter beizustehen.«
»Was meinen die Ärzte?«, frage ich.
»Fanis hat mit ihnen gesprochen«, antwortet Katerina an Manias Stelle. »Sie meinten, es sehe gut aus. Nach allem, was er gehört hat, ist Fanis zuversichtlich.«
Nachdem Lambros seine Mahlzeit beendet hat, legt Katerina ihn in sein Bettchen zurück. Wir setzen uns ins Wohnzimmer, damit er in Ruhe einschlafen kann.
»Ich improvisiere schnell etwas.« Adriani erhebt sich.
»Mama, wir haben doch die Artischocken. Was willst du denn noch vorbereiten?«
»Es sind drei Personen mehr zum Essen hier, und die Artischocken werden nicht reichen. Mein Auge trügt mich nicht.«
»Du brauchst dich nicht in der Küche zu plagen, wir können doch ein paar Souflaki bestellen«, schlage ich vor. Ich verpacke den Vorschlag absichtlich so edel und rücksichtsvoll, da ich hoffe, sie damit herumzukriegen, aber eigentlich habe ich natürlich einfach wahnsinnig Lust auf Souflaki. Doch da habe ich mich geschnitten.
»Artischocken à la Polita und Gyros mit Tzatziki im Pittabrot! Also wirklich! Von Menükombinationen hast du ja keine Ahnung. Schade um die Mühe, die ich mir immer beim Kochen mache!«, meint sie herablassend, während sie das Wohnzimmer verlässt.
»Papa, hast du wirklich geglaubt, du könntest sie überreden, Souflaki oder Gyros-Pitta zu bestellen?«, fragt mich Katerina, als wäre ich nicht ganz bei Trost.
»Nein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt«, lautet meine Antwort, die allgemeine Heiterkeit auslöst.
Wir plaudern wir über Gott und die Welt, wobei das Thema Lambros allgegenwärtig ist. Dann kommt Adriani aus der Küche.
»Ich habe Pilze im Kühlschrank gefunden, damit mache ich Makkaroni an Pilzsoße«, verkündet sie. Sie setzt die Miene einer Volksschullehrerin auf, während sie doziert: »Pilze passen prima zu Artischocken.«
Ich erhasche den spöttischen Blick meiner Tochter, halte mich jedoch zurück. Zum Glück geht Adriani ins Kinderzimmer, um den schlafenden Lambros zu bewundern, und die Diskussion findet damit ein Ende.
Eine halbe Stunde später kommt Fanis nach Hause. Er sieht müde aus.
»Alle Notfälle sind in meiner Schicht eingeliefert worden«, erklärt er uns.
Er eilt zu seinem Sohn hinüber, doch kurz danach kehrt er, zusammen mit Adriani, mit enttäuschter Miene zurück.
»Die vielen Notfälle würde ich ja noch wegstecken, aber dass mein Sohn, wenn ich so spät nach Hause komme, nicht mehr wach ist und ich ihm keinen Gutenachtkuss geben kann, ärgert mich doch sehr«, meint er.
»Du kannst ihn ja auch am Morgen noch herzen. Früh wach ist er allemal«, tröstet ihn Katerina.
»Das reicht mir aber nicht«, erwidert er, während er sein Handy hervorholt und eine Nummer wählt. Als er etwas überdeutlich zu sprechen beginnt, wird uns klar, dass er Uli angerufen hat. Wir unterbrechen unser Gespräch, damit er sich in Ruhe auf das Telefonat konzentrieren kann.
»Sein Zustand ist stabil«, sagt er zu Mania, sobald er aufgelegt hat. »So, wie Uli mir den Verlauf und die Behandlung geschildert hat, wird es kaum Komplikationen geben.«
»Ein Glück, dann kommt er ja bald zurück. Er hat ein Projekt mittendrin abbrechen müssen und befürchtet, dass man ihm den Auftrag entzieht«, erläutert Mania.
»Ich decke den Tisch«, sagt Katerina.
Mania steht auf. »Warte, ich helfe dir.«
»So ein hübscher Kerl, dein Sohn«, sage ich zu Fanis.
»Hoffen wir, dass er so brav und unkompliziert bleibt. Seine einzige Schwäche ist das Essen. Am liebsten würde er den ganzen Tag ein Fläschchen in der Hand haben.«
»Melpo findet es toll, dass er mit so viel Appetit isst«, fügt Katerina hinzu. »Und unser Sohnemann freut sich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn er sie sieht.«
Adriani bringt das Essen, und wir nehmen am Tisch Platz. Als ich die Artischockenpfanne mit einem Stückchen Feta probiere, dringt ein wohliges Brummen aus meinem Mund. »Melpo ist einfach eine hervorragende Köchin«, sage ich.
»Und nach einer solchen Köstlichkeit wolltest du Souflaki hinterherschieben?«, wirft mir Adriani an den Kopf.
Ich merke, wie Ärger in mir hochkriecht. »Du gehst doch öfter als ich in die Kirche. Kannst du mir sagen, wann die Frühmesse zu Ende ist?«, frage ich ganz ruhig.
Sie blickt mich baff an. »Warum?«
»Damit ich morgen zum Pfarrer gehen und ihm die Sünde beichten kann, dass ich Souflaki essen wollte. Er erlässt sie mir ja vielleicht.«
Alle brechen in Gelächter aus, nur Adriani nicht. Stattdessen wirft sie mir einen giftigen Blick zu.
Doch da ihre Makkaroni genauso lecker wie Melpos Artischocken schmecken, finden wir alle unsere gute Laune wieder.
3
»Ich hielt es für sinnvoll, Sie zu informieren, Herr Vizekriminaldirektor.« Der Truppführer der MAT-Sondereinheit steht vor meinem Schreibtisch und blickt mich verlegen an.
»Richtig gedacht! Nur, woher sind Sie so sicher, dass es sich um Lambros Sissis handelt?«, frage ich.
»Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ein Mann aus der Menge hat den Redner mit ›Lambros‹ angesprochen und ihm geraten, Sie anzurufen. Daraufhin hat mir einer der Beamten zugesteckt, dass Ihr Enkel auch Lambros heißt, nach einem Freund der Familie.«
Ich verzichte auf weitere Erläuterungen. »Sie haben von einer Kundgebung gesprochen. Was war das für eine Veranstaltung?«
Der Truppführer zögert kurz. »Nichts Großes, anfangs waren es um die hundert Teilnehmer. Danach kamen noch ein paar dazu, insgesamt waren es vielleicht hundertfünfzig.« Er hält inne und sucht nach Worten. »Normalerweise wäre alles ohne weitere Folgen geblieben, aber jemand ist über den Sarg erschrocken und hat die Polizei verständigt.«
Ich springe auf. »Sarg?«
»Ja, ein richtiger Sarg. Als ich Ihren Freund gefragt habe, ob ein Toter im Sarg liegt, hat er mir geantwortet, nein, da liege die Linke drin. Sie habe Selbstmord begangen, und sie würden sie in der Nähe des Ionias-Boulevards beisetzen.«
Er verstummt und wartet auf meine Reaktion. Zum einen überrascht mich Sissis’ Handeln nicht. Seit einiger Zeit schon bringt er seine Enttäuschung über die Linke zum Ausdruck, indem er sarkastische Bemerkungen macht oder aufzählt, wo sie überall versagt hat. Zum anderen erstaunt es mich doch, dass er so weit geht, sie im Rahmen einer öffentlichen Trauerfeier zu Grabe zu tragen.
»Hat er etwa auch eine Grabrede gehalten?«, frage ich mit leisem Spott.
»Ja, seine Worte waren ernst und besorgniserregend«, antwortet der Truppführer.
»Was hat er gesagt?«
»Dass die Armen nach dem Selbstmord der Linken selbst eine Bewegung gründen und für ihre Rechte einstehen müssen.«
»Und was ist daran besorgniserregend?«
»Wissen Sie, was uns erwartet, wenn die Armen durch Kundgebungen und Protestmärsche zu einer eigenen Bewegung werden?«, meint er mit der Miene eines Dozenten, der einem Polizeischüler Unterricht erteilt. »Da kriegen wir es nicht mit hundert oder zweihundert Leuten zu tun, die das Athener Zentrum mit ihren Protesten lahmlegen, sondern mit einer ganzen Heerschar von Leuten, der wir nur schwer beikommen können.«
»Stimmt, aber wir haben keine andere Möglichkeit, als abzuwarten.«
Nachdem ich ihn entlassen habe, verfalle ich ins Grübeln. Ich weiß nicht, was in Sissis’ Kopf vorgeht und welche Pläne er hat. Er ist bestimmt kein Mensch, der auf Gewalt setzt, und das beruhigt mich. Gleichzeitig weiß ich, dass die spontane Mobilisierung von Menschen anfällig für Ausschreitungen ist. Wenn bei einer solchen Kundgebung irgendwelche Radaumacher die Initiative an sich reißen, wird ihnen Sissis mit seinen Unterstützern kaum Einhalt gebieten können. Dann müssen wir – mit allen Folgen, die das nach sich zieht – eingreifen.
Die einzige Lösung ist, mit Sissis zu sprechen, um aus erster Hand zu erfahren, was er plant. Wenn ich ihn nicht überzeugen kann, auf Kundgebungen zu verzichten, sollten wir zumindest gemeinsam nach einer Lösung suchen, um das Schlimmste zu verhindern. Wie ich allerdings den Altkommunisten Sissis überzeugen soll, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, ist eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß.
Ich gebe Stella Bescheid, dass ich in einer Stunde wieder zurück bin, und fahre in die Tiefgarage des Präsidiums hinunter. Wie unangenehm, gerade zum Zeitpunkt meiner Beförderung in einen Gewissenskonflikt zwischen Pflicht und Freundschaft zu geraten!
Der Verkehr auf dem Alexandras-Boulevard fließt normal dahin, so dass ich rasch zur Unterführung an der Evelpidon-Straße gelange. Erst in der Kefallinias blockieren hier und da kleinere Baustellen die Spur, oder man muss umzäunten Schlaglöchern ausweichen. Könnte es sein, dass mir die anstehenden Gemeinderatswahlen entgangen sind? Normalerweise zeigen die Athener Stadtbezirke nur vor den Wahlen einen Anfall plötzlicher Betriebsamkeit.
Nach diesem elenden Stop-and-Go gelange ich endlich zur Tenedos-Straße, doch hier steht ein Lkw quer. Ich versuche, nicht auszurasten, da ich mit Sissis ein delikates Thema ansprechen werde und nicht schon genervt erscheinen will. Als ich eine Parklücke sehe, fackle ich nicht lange und laufe schließlich Sissis in die Arme, als er gerade aus dem Obdachlosenheim tritt. »So früh unterwegs?«, fragt er, überrascht von meinem Besuch.
»Ich wollte mich mit dir unterhalten, aber wie ich sehe, hast du zu tun.«
»Nichts Dringendes, das hat auch später noch Zeit«, erwidert er.
Als er Anstalten macht, ins Obdachlosenheim zurückzukehren, halte ich ihn zurück. »Mir wäre lieber, wenn wir uns beide allein und woanders unterhalten.«
Erst reagiert er überrascht, dann aber willigt er ein. Wir gehen zum kleinen Kafenion an der Ecke Ajias-Sonis- und Tenedou-Straße.
»Ich weiß, worum es geht«, meint er, sobald die Mokkas eintreffen. »Der verantwortliche MAT-Polizist hat dich informiert.«
»Warum hast du vorher nichts gesagt? Ich hätte die Kollegen anweisen können, sich im Hintergrund zu halten.«
»Erstens, weil ich dich nicht hineinziehen wollte. Es macht keinen guten Eindruck, wenn der stellvertretende Kriminaldirektor mit einer Person befreundet ist, die zu öffentlichen Protestaktionen aufruft. Und zweitens, weil Kundgebungen, für die man Polizeischutz beantragt, wie Bohnensuppe mit Rhizinusöl sind.« Damit bestätigt er meine Befürchtung, dass eine Zusammenarbeit mit ihm turbulent werden könnte.
»Jedenfalls habe ich zum ersten Mal begriffen, was es heißt, gute Beziehungen zu haben«, fügt er hinzu.
»Wieso?«
»Sobald dein Name fiel und klar wurde, was uns verbindet, waren deine Kollegen äußerst entgegenkommend.«
Ich suche nach Worten, um ihm meine Bedenken darzulegen. »Ich will kein Besserwisser sein. Du bist erfahren genug und weißt, dass spontane öffentliche Proteste eine offene Einladung an alle möglichen Typen sind. Da kann sich weiß nicht wer alles einschleichen.«
»Ich verstehe, worauf du hinauswillst«, sagt er mit einem zustimmenden Nicken. »Richtig, für solche Aktionen braucht man einen Ordnungsdienst. Kundgebungen oder Demos haben wir nie ohne Bewachung durchgeführt.« Er blickt mich mit einem Auflachen an. »Zu meiner Zeit hatten die Bauarbeiter diese Aufgabe übernommen. Vor denen zitterten alle, sogar eure Leute.«
Bei seinen Worten atme ich auf, da wir uns doch leichter verständigen als gedacht. »Und was hast du vor?«, frage ich ihn.
»Solange wir nur so wenige Teilnehmer wie gestern sind, also weniger als zweihundert, wird es keine Misstöne geben«, erläutert er. »Wenn Leute zur Kundgebung kommen, die auf Radau aus sind, können wir sie sofort herausfischen. Schwierig wird es, wenn die Veranstaltungen größer werden. Dann brauchen wir einen Ordnungsdienst. Niemand soll Parolen schwingen dürfen, die nichts mit unserer Bewegung zu tun haben oder Unfrieden säen. Bei Ausschreitungen müssen wir schnell genug reagieren können und die Chaoten aus dem Verkehr ziehen.«
Sein Blick sagt mir, wie sehr ihn das Problem beschäftigt.
Plötzlich kommt mir eine Idee. »Wie wäre es, wenn einer von meinen Mitarbeitern bei den Kundgebungen dabei wäre?«
Er holt Luft, um mich zu unterbrechen, aber ich komme ihm zuvor. »Lass mich ausreden. Ein junger Mann zum Beispiel, der sich in keiner Weise von den anderen Teilnehmern unterscheidet. Nur du und ich wissen Bescheid, wer es ist.«
»Gleich kommst du mit dem Vorschlag, dass Polizisten in Zivil den Ordnungsdienst übernehmen«, meint er spöttisch.
»Das würde ich nie tun«, erwidere ich. »Nicht nur, weil es untersagt ist, sondern weil man Polizisten hundert Meter gegen den Wind riecht. Sobald sie eingreifen, wissen alle, dass es Bullen sind. Und dann raufen wir uns die Haare. Ich rede von einem gutausgebildeten jungen Mann, der sich von den Leuten seiner Generation in nichts unterscheidet. Er wird an euren Aktionen teilnehmen und dabei die Augen offen halten. Wenn er Unruhestifter sieht, verständigt er sich mit dir. Ich garantiere dir, dass er nichts ohne dein Einverständnis unternehmen wird.«
Er blickt mich skeptisch an, erhebt jedoch keinen Widerspruch.
Ich bezahle die Mokkas, und wir brechen auf.
»Denk darüber nach«, sage ich, bevor wir auseinandergehen. »Es eilt ja nicht. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Vielleicht ist meine Angst übertrieben und sein Einsatz gar nicht nötig. Behalt den Vorschlag einfach im Hinterkopf.«
»In Ordnung, ich denke darüber nach.«
Während der Fahrt ins Präsidium versuche ich herauszufinden, wem ich diese Aufgabe im Notfall am besten übertragen könnte. Zwei Mitarbeiter, die mir aus der Mordkommission vertraut sind, kommen in die engere Auswahl: Thanos Askalidis und Fotis Dervisoglou. Vom Alter her kommen am ehesten sie in Frage. Askalidis fällt es leichter, mit Leuten und speziell auch mit jungen Leuten Kontakt aufzunehmen. Dervisoglou war bei der Antiterroreinheit, bringt also mehr Erfahrung mit. Darüber hinaus vertraue ich seinem Instinkt.
Meine Wahl fällt schließlich auf Dervisoglou, aber noch brauche ich nichts zu überstürzen. In erster Linie muss ich mit den Kollegen der Sondereinheit sprechen und sie um fortlaufende Berichterstattung ersuchen, damit ich rechtzeitig intervenieren kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als persönlich involviert zu sein. Und dagegen muss ich mich absichern.
Sobald ich in mein Büro komme, ersuche ich Stella, den Leiter der MAT-Sondereinheit zu mir zu rufen. Jorgos Alamanos ist ein bulliger Fünfzigjähriger. Seine Miene sagt mir, dass er weiß, warum ich ihn rufen ließ.
»Der Truppführer hat mich informiert«, sage ich einleitend.
»Ich weiß, ich habe ihn zu Ihnen geschickt.«
»Erst einmal möchte ich klarstellen, dass Sie und Ihre Einheiten Ihre Arbeit machen sollen.«
»Kann sein, dass nichts weiter passiert, als dass ein oder zwei Kundgebungen stattfinden und die neue Bewegung auf eine Handvoll Leute beschränkt bleibt, die schließlich alle brav wieder nach Hause gehen.« Er pausiert und blickt mich an. »Aber wenn die Initiative ein großes Publikum anspricht und mobilisiert, wird es schwierig, das Ganze unter Kontrolle zu behalten. Das ist, was mir Angst macht.«
»Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich möchte, dass Sie mich auf dem Laufenden halten. Mein Freund neigt jedenfalls sicher nicht zu Gewalt. Er ist ein Altkommunist, der glaubt, dass die linke Bewegung tot ist. Darum will er, dass die Armen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.«
Alamanos blickt mich an. Ihm liegt etwas auf der Zunge, aber er zögert. »Kann ich ehrlich zu Ihnen sein, Herr Vizekriminaldirektor?«, sagt er schließlich.
»Sicher.«
»Dass man heutzutage die Armen zu gemeinsamen Protesten aufruft, kann ich als Privatperson verstehen. Als Polizist aber betrachte ich das mit Sorge.«
Das sehe ich genau gleich. Ich versichere Alamanos, ihn auf dem Laufenden zu halten, woraufhin er mein Büro verlässt.
Kurz geht mir durch den Kopf, dass ich den Vizepolizeipräsidenten über mein Verhältnis zu Sissis informieren sollte. Aber ich komme zu dem Schluss, dass es verfrüht wäre. Besser warte ich ab, wie sich Sissis’ Vorhaben weiterentwickelt. Durchaus denkbar, dass schon bald die Luft raus ist.
Wie gut, sage ich mir, dass der kleine Lambros noch in seinem Bettchen liegt und begierig an seinem Fläschchen saugt. Wäre er älter, würde er vielleicht an der Seite seines Namensvetters stehen und für seinen Opa, den Bullen, nichts als Verachtung übrighaben.
4
Als ich ins Obdachlosenheim zurückkomme, sitzen Stelios und Anna mit dem Typen, der die Migranten aus den ehemaligen Ostblockländern mobilisiert hat, zusammen in der Cafeteria.
»Da geht die Post ab!«, sagt Anna zu mir.
Bevor ich fragen kann, wo die Post abgeht, springt der junge Mann von seinem Stuhl hoch und kommt auf mich zu.
»Guten Tag, Herr Sissis. Ich habe die Migranten zur Kundgebung mitgebracht, mein Name ist Nikitas Kourtidis.«
»Ja, ich erinnere mich.«
»Ich habe ein paar Fotos von gestern auf Facebook gepostet und wollte Ihnen die Reaktionen darauf zeigen. Kommen Sie«, sagt er und führt mich zu einem Laptop.
Er lässt mich Platz nehmen und deutet auf dem Bildschirm mit einem Pfeilchen an eine Stelle. »Lesen Sie das.«
Bravo, Leute! Endlich gehen wir Armen auf die Straße und stehen für unsere Rechte ein! Darunter steht die Unterschrift: Pinaleon. Ein Geschäftsmann, der seinen Laden schließen musste.
Der Pfeil zeigt jetzt auf einen anderen Kommentar: Endlich hört man die Stimmen, die mit gutem Recht laut werden, und nicht diejenigen, die bloß ihren Besitz verteidigen. Ich wünsche euch viel Erfolg!
Der dritte Kommentar beschimpft uns: Spinnt ihr? Wer behauptet, dass die Linke tot ist, ist ein Faschist.
»Das hier fand ich am interessantesten«, sagt Nikitas und lenkt den Pfeil an eine andere Stelle.
Hoffentlich erreicht ihr, was ihr wollt, aber macht euch nicht allzu viele Hoffnungen. In den sechziger Jahren gab es einen Politiker, der sagte: »Die Zahlen versprechen Wohlstand, aber die Menschen darben.« Die heutigen Politiker haben die Lösung gefunden. Sie setzen Menschen und Zahlen gleich und sagen: »Die Zahlen versprechen Wohlstand, also läuft alles prima.« Ich bin auf eurer Seite, aber ich fürchte sehr, dass am Ende nur die Erinnerung an einen gutgemeinten Kampf bleibt.
Nikitas hat recht. Die letzte Wortmeldung ist die interessanteste, da sie meine Resignation in Worte fasst.
»Der bringt es auf den Punkt«, bestätigt Stelios, der neben mir mitliest.
»Was machst du beruflich?«, frage ich Nikitas.
»Ich studiere in London und schreibe gerade an meiner Masterarbeit zum Thema Unternehmertum in Griechenland während der Krise. Wenn ich hier bin, wohne ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Sosopoleos-Straße, die meinen Eltern gehört. Ich kenne die Zuwanderer in der Gegend, ein paar habe ich für meine Arbeit interviewt. Ihre Kundgebung hielt ich für eine gute Gelegenheit, sie mit einzubeziehen.«
Er scheint mir klug und gebildet. Ich will nicht gleich in Begeisterung verfallen, aber ich denke, dass er uns nützlich sein kann. »Kann ich dich was fragen?«, sage ich.
»Bitte schön.«
»Glaubst du, dass wir die Migranten, die du zur Kundgebung mitgenommen hast, für den Kampf der Armen mobilisieren können?«
Er überlegt kurz, bevor er mir antwortet. »Sie sind sofort mitgekommen, als ich ihnen sagte, dass wir die Linke zu Grabe tragen«, meint er. »Für sie ist die Linke gleichbedeutend mit dem verhassten sozialistischen System.« Er denkt erneut nach. »Den meisten Migranten geht es hier besser als in ihrem Herkunftsland, Herr Sissis. Wenn man ihnen von Armut erzählt, denken sie automatisch an die Jahre, die sie in ihrer Heimat verbracht haben. Sie setzen Armut gleich mit Sozialismus. Damals haben sie keinen Aufstand gemacht. Warum sollten sie das heute tun? Ich werde mit ihnen reden, aber viel verspreche ich mir davon nicht.«
Mit seinen Worten wischt er mein ganzes Leben und alles, wofür ich gekämpft habe, vom Tisch. Die besten Jahre meines Lebens habe ich für den kommunistischen Gedanken geopfert und es mit Folter, Verfolgung und Exil bezahlt. Und nun wirft Kourtidis mit ein paar wenigen Sätzen all das auf den Müllhaufen der Geschichte. Mensch, Lenin, sage ich mir, mit dem Sturm auf den Winterpalast hast du geglaubt, du könntest die Armut abschaffen, aber du hast dich vertan, genau wie wir, deine Erben.
Trotzdem hat mir der junge Mann die Augen geöffnet. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass es »die Armut« an sich nicht gibt, sondern viele unterschiedliche Arten von Armut. Ich kenne nur die griechische, und jetzt muss ich mich mit den anderen vertraut machen.
»Und noch eine Frage: Hast du Beziehungen zu Leuten aus Asien und Afrika, die wir mobilisieren könnten?«
»Hier nicht«, antwortet er. »Ich kann Ihnen aber meine Erfahrung aus Großbritannien schildern. Diese Menschen leben mit ihren Landsleuten in geschlossenen Gemeinschaften. Außerhalb ihres Arbeitsplatzes betrachten sie die Einheimischen mit Misstrauen und wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Wenn Sie aber das Vertrauen Einzelner gewinnen, können Sie hoffen, über sie auch die anderen zu erreichen. Andernfalls befürchte ich, dass sie zu Hause bleiben und nur aus der Ferne applaudieren, um keine Schwierigkeiten zu bekommen.« Er lächelt. »Vielleicht sagen sie aber auch: ›Ihr habt ja keine Ahnung, was Armut heißt.‹«
Seine Worte schaffen mit einem Schlag Klarheit in meinem Kopf. Jetzt weiß ich, wer am besten mit Flüchtlingen und Migranten reden kann.
»Ich danke dir für deine klaren Antworten«, sage ich zu Kourtidis. »Ich hoffe, dass du bei den Kundgebungen dabei sein wirst.«
Kourtidis holt ein Notizbuch aus seinem Rucksack. Er schreibt etwas auf und überreicht mir den Zettel. »Hier ist meine Handynummer. Rufen Sie mich an, wenn Sie eine Demo machen oder wenn Sie denken, dass ich helfen könnte.«
Nachdem er sich von allen verabschiedet und die Cafeteria verlassen hat, greife ich nach dem Telefon. Katerina wird mir helfen können. Sie hat viel mit Migranten zu tun, da sie ihre Fälle übernimmt und sie vor Gericht vertritt.
Ich rufe sie in ihrer Kanzlei an und hoffe inständig, dass sie abnimmt und nicht bei einem Gerichtstermin ist. Bei ihr zu Hause will ich sie nicht darauf ansprechen, weil ich fürchte, dass Fanis und vor allem auch Adriani, die abends immer dort ist, es in die falsche Kehle bekommen. Wegen Kostas mache ich mir weniger Gedanken, weil er mich versteht. Er ist vielleicht der einzige Polizeibeamte von ganz Athen, der weiß, worum es mir geht.
»Was für eine Überraschung, Onkel Lambros!«, höre ich Katerinas Stimme, als mich die Sekretärin durchstellt.
»Könnte ich vorbeikommen und etwas mit dir besprechen?«
»Ist etwas passiert?«, fragt sie beunruhigt.
»Nein, ich will nur deine Meinung einholen.«
»Komm, wann immer du willst. Ich habe Zeit.«
Ich gebe Stelios, der zu meinem inoffiziellen Stellvertreter geworden ist, Bescheid und nehme am Amerikis-Platz den Trolleybus. Der Himmel sieht nach Regen aus. Ich hoffe, rechtzeitig zurück zu sein, ohne nass zu werden.
Zum Glück beginnt es erst zu nieseln, als ich das Wohnhaus betrete, in dem Katerinas Kanzlei liegt. Als sie mich mit der Sekretärin sprechen hört, tritt sie aus ihrem Büro und begrüßt mich.
»Wie geht es Lambros dem Jüngeren?«, frage ich, nachdem wir uns umarmt und geküsst haben.
»Er hat zwei ständige Begleiterinnen, die ihn auf Händen tragen: seine Oma und Melpo. Das einzige Problem ist seine Fressgier.«
»Der Appetit kommt beim Essen«, erwidere ich amüsiert.
Wir gehen in ihr Büro. Sobald wir Platz genommen haben, blickt sie mich besorgt an. »Ist etwas passiert?«, fragt sie noch mal.
»Keineswegs, mach dir keine Gedanken«, beruhige ich sie. »Ich hätte nur gern deine Meinung zu einem Vorhaben.«
Ich beginne, ihr meinen Plan in allen Einzelheiten zu erläutern. »Über alles, was ich dir erzählt habe, weiß auch dein Vater Bescheid«, füge ich hinzu, damit sie nicht denkt, dass ich hinter seinem Rücken vorgehe.
»Und was hat er dazu gesagt?«