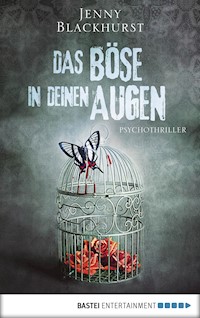9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
SEINE FREUNDE SOLLTE MAN SICH GUT AUSSUCHEN - SEINE FEINDE NOCH BESSER ...
Als Karen Brown ihre neue Patientin zum ersten Mal sieht, hält sie Jessica für einen psychologischen Routinefall: eine gelangweilte Frau, die ihren tristen Alltag mit einer heimlichen Affäre aufpeppt. Doch schon nach ihrem ersten Gespräch hat Karen das Gefühl, dass Jessica geradezu besessen ist von der Ehefrau ihres Liebhabers. Als wenig später die Leiche jener Frau gefunden wird, steht die Polizei vor Karens Tür. Sie gilt als dringend mordverdächtig. Karen ahnt, dass Jessica sie nicht zufällig ausgewählt hat - und dass es ein großer Fehler war, Jessica zu unterschätzen ...
DER NEUE ROMAN DER SPIEGEL-BESTSELLERAUTORIN - FESSELND, ABGRÜNDIG UND ABSOLUT UNVORHERSEHBAR
»In ihrem Debütroman Die stille Kammer entfesselt die 29 Jahre alte Britin Jenny Blackhurst ein Gefühlschaos, beklemmend und mitreißend.« Kölner Stadt-Anzeiger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
TEIL I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
TEIL II
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
TEIL III
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Abschließendes Gutachten – Karen Browning
Danksagung
Über die Autorin
Jenny Blackhurst interessiert sich seit frühster Jugend für Spannungsliteratur. Die Idee für einen eigenen Roman entwickelte sie nach der Geburt ihres ersten Kindes. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in Shropshire, England.
Jenny Blackhurst
DAS MÄDCHENIM DUNKELN
Psychothriller
Aus dem Englischen vonMichael Benthack und Anke Angela Grube
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Jenny BlackhurstTitel der englischen Originalausgabe: »Before I Let You In«Originalverlag: Headline Publishing Group, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, BonnTitelillustration: © Trevillion Images/Sandra Cunningham;© shutterstock/Reinhold LeitnerUmschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2997-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Ken – wir alle vermissen dich mehr,
TEIL I
Kapitel 1
Womit möchten Sie beginnen?
Hmm.
Habe ich etwas Komisches gesagt?
Nein, aber diese Frage habe ich meinen Patienten immer gestellt. Das gibt ihnen das Gefühl, sie hätten die Kontrolle über die Sitzung. Nur wissen wir beide ja, dass nicht ich hier das Sagen habe, oder?
Ist es Ihnen wichtig, das zu glauben?
Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen mir die Befangenheit nehmen, damit ich mich öffne und meine dunkelsten Ängste beichte. Dann können Sie denen sagen, dass ich irre bin. Ich habe tatsächlich das Gefühl, irre zu sein. Sie dürfen sich das ruhig notieren.
Warum fangen Sie nicht am Anfang an, Karen? Bei Ihrer ersten Begegnung mit Jessica Hamilton?
Das ist nicht der Anfang. Sondern wahrscheinlich nur der Punkt, an dem dies alles hier begonnen hat, aber der Anfang ist es im Grunde nicht. Das Ganze hat lange davor angefangen, lange bevor ich Bea, Eleanor und Michael begegnet bin. Angefangen hat es mit dem, was passiert ist, als ich vier war.
Möchten Sie darüber sprechen? Darüber, was Ihnen als Kind zugestoßen ist?
Nein. Und darüber wollen die auch nichts wissen. Die wollen wissen, wie sie gestorben ist.
Sprechen Sie weiter.
Sie können mich nicht wieder hinkriegen.
Wie bitte?
Das war einer der ersten Sätze, die Jessica Hamilton mir gegenüber geäußert hat – und der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, da irrt sie sich: Ich habe ständig Menschen »wieder hingekriegt«, das war mein Beruf. Nur bin ich damals nicht auf die Idee gekommen, dass Jessica gar nicht in Ordnung gebracht werden wollte. Das war nie ihre Absicht. Ich habe es anfangs zwar noch nicht gewusst, aber sie war gekommen, um mich zur Ordnung zu rufen.
Kapitel 2
KAREN
Eine Therapiesitzung am Cecil-Baxter-Institut dauerte gewöhnlich fünfzig Minuten. Manche Patienten verbrachten die ganze Zeit schweigend, was einige der jüngeren Psychiater oftmals verwirrte – warum 150 Pfund ausgeben, um fünfzig Minuten lang stumm dazusitzen? Dr. Karen Browning gehörte allerdings nicht dazu, sie verstand es. So wie sie auch professionell Verständnis für Männer hatte, die Prostituierte aufsuchten: Es machte ihnen nichts aus, dafür zu bezahlen, auch wenn sie vielleicht nur dasaßen, es ging ihnen um Kontrolle.
Das leise Klicken von Stöckelschuhen auf dem Holzboden machte Karen auf ihre Sekretärin Molly aufmerksam. Sie stand unmittelbar vor der Tür zu ihrem Sprechzimmer. Unsere Sekretärin, rief sich Karen in Erinnerung – Molly arbeitete für alle vier jüngeren Psychiater im zweiten Stock. Nur die Direktoren in der obersten Etage hatten persönliche Assistentinnen. Es klopfte leise an der Tür. Karen trug ein wenig Lipgloss auf, legte den Stift in die oberste Schublade ihres Schreibtischs zurück und wartete, dass Molly die Tür aufschob. Alle Sprechzimmer boten ideale Therapiebedingungen, und Karen war besonders stolz auf ihres, dieses Symbol all dessen, was sie beruflich erreicht hatte.
Aber heißt es denn nicht: Hochmut kommt vor dem Fall?
Am Morgen hatte sich Karen eine Stunde lang ihre Fallnotizen zu diesem Therapiegespräch noch einmal durchgelesen, damit sie so viel wie irgend möglich über Jessica Hamilton wusste, bevor diese zur Tür hereinkam. Miss Hamilton war ihre einzige neue Klientin in dieser Woche – alle anderen Patienten waren seit geraumer Zeit bei ihr in Behandlung –, aber sie besaß kaum Informationen über die junge Frau, worüber sie sich ungeheuer ärgerte. Wer immer sie aufgenommen hatte, hatte bei weitem nicht so gründlich gearbeitet, wie sie es getan hätte. Die hingekritzelte Unterschrift unter dem Aufnahmebericht konnte von jedem ihrer Kollegen stammen, und sie nahm sich vor, das Thema in der nächsten Teamsitzung so sachlich wie möglich anzusprechen.
Alter: 23Anamnese: Keine diagnostizierte Depression oder Angststörung. Familiärer Hintergrund unbekannt. Zurzeit keine Medikation. Keine Überweisung durch Hausarzt.
Grund für die Konsultation: Spannungskopfschmerzen und irrationale kognitive Aktivität.
Wie immer nach der Lektüre des Aufnahmeberichts konnte Karen nicht anders, als sich ein Bild von der Frau zu machen, die gleich ihr Sprechzimmer betreten würde. Vermutlich war sie wohlhabend, der Summe nach zu urteilen, die sie für eine fünfzigminütige Therapiesitzung bezahlte. Ab und zu arbeitete Karen unentgeltlich, aber Jessica Hamilton war Selbstzahlerin und auf eigenen Wunsch gekommen. Karen stellte sich vor, dass sie im Freundeskreis Jess und in der Familie Jessica gerufen wurde.
Es klopfte ein zweites Mal – was Molly nur selten tat. Wenn Karens Schild »Therapiesitzung« nicht an der Tür hing, kam sie normalerweise einfach herein. Karen stand auf, strich ihre Kostümjacke glatt und öffnete die Tür. Doch vor ihr stand nicht ihre lächelnde Assistentin, sondern eine schlanke, ängstlich wirkende junge Frau mit blasser Gesichtshaut und roten Flecken auf den Wangen.
Karen hoffte, dass ihre Miene nicht verriet, wie überrascht sie war, aber das war nicht sehr wahrscheinlich. In den acht Jahren als Psychiaterin hatte sie gelernt, ihre Reaktionen unter der Oberfläche zu verbergen, unerkennbar für den Betrachter. Das ultimative Pokerface.
Das Bild eines jungen, attraktiven reichen Mädchens, das der Name Jessica heraufbeschworen hatte, war meilenweit von der Wirklichkeit entfernt. Karen schüttelte ihr die Hand und nahm kurz die abgenagten Fingernägel ihrer Patientin wahr. Ihr Handschlag war so schwach wie ihr Lächeln matt.
»Jessica?« Karen warf einen kurzen Blick in den Empfangsbereich, konnte Molly aber nirgends sehen. »Entschuldigen Sie bitte, aber normalerweise ist unsere Assistentin da und nimmt unsere Patienten in Empfang. Kommen Sie herein.« Innerlich verfluchte sie Molly und ihre mangelnde Professionalität – das sah ihr gar nicht ähnlich.
»Bitte, nehmen Sie Platz.«
Entweder hatte Jessica Hamilton sie nicht gehört, oder sie nahm einfach keine Notiz von ihrer höflichen Aufforderung. Sie ging langsam um das Sofa herum, hinüber zu den Bücherregalen an der gegenüberliegenden Wand des Sprechzimmers. Offenbar wollte sie sich jedes Detail auf den Mahagoniregalen einprägen: die ledergebundenen Wälzer, die Karen eher aus Gründen der Ästhetik als wegen des Inhalts ausgewählt hatte. Zum ersten Mal seit langem hatte Karen das Gefühl, dass ihr Zimmer beurteilt und als mangelhaft bewertet wurde.
»Möchten Sie sich nicht setzen, damit wir anfangen können?«
Eine Sekunde lang glaubte Karen, Jessica würde sie wieder ignorieren, aber dann nahm sie schweigend ihr gegenüber Platz und wartete, dass Karen mit der Sitzung begann.
Jessica war nicht unattraktiv. Wenn ihr Gesicht wegen der kalten Witterung – vielleicht auch aufgrund von Nervosität – nicht so gerötet gewesen wäre, hätte sie durchaus als hübsch gelten können. Das naturgewellte Haar reichte ihr bis auf die Schultern und war von einem solchen Dunkelblond, dass es fast farblos wirkte – ein Wuschelkopf, der keine Aufmerksamkeit erregen wollte. Der ganze Look schien darauf abzuzielen, so unscheinbar wie möglich zu erscheinen.
»Mein Name ist Dr. Karen Browning. Ich weiß nicht, ob Sie bereits andere Therapeuten konsultiert haben, aber wir hier möchten, dass sich unsere Klientinnen wohlfühlen. Bitte nennen Sie mich Karen. Falls Sie das nicht wollen, ist das okay. Und ich möchte Sie Jessica nennen, aber wenn Ihnen Miss oder Mrs. Hamilton lieber ist, habe ich auch nichts dagegen.«
Sie strahlte Jessica an, in der Hoffnung, ihr damit ein wenig die Befangenheit zu nehmen. Karen fühlte mit allen ihren Patienten mit. Es musste eine Furcht erregende Erfahrung für sie sein, die eigenen Ängste und an sich selbst wahrgenommenen Schwächen einem Menschen mitzuteilen, der sich nur deshalb dafür interessierte, weil er Geld dafür bekam. Darum bemühte sie sich, so zugänglich wie möglich zu wirken. Keine Designer-Kostüme wie manche ihrer Kolleginnen, keine strenge Frisur und kein Brillantschmuck – wobei Letzteres ohnehin nicht ihrem Stil entsprach.
Jessica nickte zu Karens Standardfloskeln, als hätte sie etwas Tiefgründiges vernommen, ließ jedoch nicht erkennen, wie sie genannt werden wollte.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
Jessica schüttelte fast unmerklich den Kopf. Karen stand auf, schenkte sich ein Glas Wasser aus dem Spender in der Ecke ein und nahm auf dem Stuhl direkt gegenüber Jessica Platz. Die Sitzfläche war mit Absicht etwas niedriger als die des Sofas gewählt, auf dem Jessica saß. Es sollte den Patienten das Gefühl von Kontrolle geben, das vielen Menschen in der Welt da draußen fehlte.
»Gut. Wie ich sehe, kommen Sie wegen Ihrer Spannungskopfschmerzen. Möchten Sie mir etwas darüber erzählen?«
Jessica sah sie direkt an – was Karen nicht gewohnt war, jedenfalls nicht in der ersten Sitzung. Sie hatte ihr Sprechzimmer sparsam eingerichtet, damit ihre Gegenüber nichts hatten, worauf sie sich konzentrieren konnten oder wodurch sie sich ablenken lassen würden – das Sofa, ihr Schreibtisch und zwei kleine Bücherregale, das eine Foto, kein Nippes und ein großes Gemälde mit einem Bootssteg über beruhigendem, türkisfarbenem Wasser. Dennoch fanden die Patienten immer etwas, was sie statt ihrer Therapeutin anschauen konnten. Nicht so Jessica Hamilton.
»Sie können mich nicht wieder hinkriegen.«
Jessicas Stimme hatte einen bösartigen, herausfordernden Unterton, der ihrem Auftreten so sehr widersprach, dass er Karen tiefer berührte als ihre Worte. Aber sie war in ihrem Beruf schon tausende Male schockiert worden und inzwischen verdammt gut darin, ihre Reaktionen zu verbergen. Auch jetzt verzog sie keine Miene.
»Glauben Sie, dass das hier passieren wird, Jessica? Dass ich versuchen will, Sie wieder hinzukriegen?«
»Ist das denn nicht Ihr Beruf, Dr. Browning? Die armen kleinen Irren wieder hinzukriegen, damit ihr Leben so perfekt läuft wie das Ihre?«
Jessica hielt den Augenkontakt aufrecht. Sie hatte blaue Augen, die aber zu dunkel waren, um aufzufallen, wobei die kleinen braunen Einsprengsel den Effekt noch mehr dämpften. Unscheinbar – so wie der Rest von ihr.
»Nein, Jessica, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich bin nur dazu da, Ihnen zuzuhören und dabei zu helfen, mit dem zurechtzukommen, was Ihnen Probleme bereitet.«
»Zuhören und helfen, das klingt für mich nicht besonders proaktiv. Wieso zahlen die Leute Ihnen eigentlich so viel Geld, wenn Sie nur die Kummertante spielen? Was ist denn so besonders an Ihnen?«
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Patient zornig wird oder sich konfrontativ verhält, dachte Karen und versuchte, den Ärger, den die junge Frau ausstrahlte, nicht persönlich zu nehmen. Manchmal waren Menschen, wenn sie zu ihrer Sitzung kamen, auf das Leben selbst wütend, und dann gifteten sie den Therapeuten oder die Therapeutin an. Jessica Hamilton war da nicht anders. Und doch empfand sie sich so: als anders.
»Oft fällt es uns leichter, unsere Probleme einem Außenstehenden mitzuteilen. Man fühlt sich dann nicht so stark beurteilt und befindet sich an einem sicheren Ort, an dem man seine Themen zur Sprache bringen kann. Ich bin weder dazu da, über Sie zu urteilen, Jessica, noch will ich Sie verbessern. Wir betrachten Menschen nicht als kaputt, und es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu reparieren. Wenn Sie mit mir reden möchten, würde ich gerne versuchen zu verstehen, was in Ihrem Leben vor sich geht. Gibt es einen Punkt, an dem Sie beginnen möchten?«
Sie sah, dass Jessica über diese Sätze nachdachte, und spürte ihre Enttäuschung darüber, dass Karen sich nicht provozieren ließ. Was glaubte die junge Frau wohl, was sich durch eine Therapie erreichen ließ, und warum war sie überhaupt hierhergekommen, wenn sie eine solch schlechte Meinung von dem Beruf des Psychiaters hatte?
»Ich habe Sex mit einem verheirateten Mann.«
Waren die ersten Sätze der Patientin als Herausforderung gemeint gewesen, so wollte sie jetzt schockieren. Karen machte sich im Kopf bereits Notizen. Patientin versucht zu schockieren, um negatives Urteil hervorzulocken. Möglicherweise, um Schuldgefühle zu verringern. Da würde sie ihr Ziel aber sehr viel weiter stecken müssen als bisher. Karen hatte in diesen vier Wänden schon viel schlimmere Geständnisse gehört.
»Geht es nur darum, um Sex? Andere Leute hätten vielleicht gesagt ›ich schlafe mit‹ oder ›ich habe eine Affäre mit‹.«
Jessicas Miene blieb ausdruckslos, undurchschaubar. »Ich bin nicht verliebt in ihn. Es hat keinen Sinn. Ich bin nicht irgendein dummes Mädchen, das glaubt, dass er seine Frau verlassen wird, um mit mir zu leben.«
Patientin verwendet Leugnung als Abwehrmechanismus, um sich ihre Gefühle nicht eingestehen zu müssen. Symptom für ein Problem in anderem Bereich?
»Möchten Sie ganz von vorn anfangen und darüber sprechen, wie Sie beide sich kennengelernt haben?«
Psychiaterin, das war kein leichter Beruf, aber Karen hatte nie einen anderen in Erwägung gezogen und in all den Jahren, seit sie ihn praktizierte, ihre Berufswahl noch nie bereut. Sie hatte eine Begabung, Patienten so zu behandeln, als wären sie verletzte Vögel, ganz sanft, ohne jähe Bewegungen, und wahrte dabei stets einen neutralen Tonfall. Sie hörte zu, dirigierte, ohne zu diktieren. Bei manchen Menschen hatte sie das Gefühl, dass sie, wenn sie auch nur ein falsches Wort sagte, am liebsten geflohen wären, dass sie sie mehr als Feind und weniger als Retter betrachteten. Deshalb kam es vor, dass ein Patient sie anfangs ablehnte – vor allem, wenn er die Therapie nicht freiwillig machte.
Jessica ignorierte die Frage, legte die Ellbogen auf die Oberschenkel und beugte sich vor, um die Distanz zu ihr zu verringern.
»Was macht einen Menschen gut oder böse – was glauben Sie?« Diese Frage stellte sie so leise, dass Karen auf ihrem Stuhl etwas nach vorn rutschen musste, um sie zu hören. »Sind es seine Gedanken? Oder geht es nur darum, ob man die Dinge, die man sich vorstellt, auch tut? Geht es um einen Mangel an Moral? Fehlendes Einfühlungsvermögen?«
»Machen Sie sich Sorgen wegen bestimmter Gedanken, die Sie haben?«
Jessica grinste, was ihre unscheinbaren Gesichtszüge unattraktiv erscheinen ließ. »Nicht direkt. Aber Sie haben mir nicht geantwortet.«
»Das ist eine komplizierte Frage, Jessica, und ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Antwort darauf habe. Aber wenn Sie sich wegen Ihrer Gedanken sorgen, dann würde ich sagen, dass die Tatsache, dass Sie hier sind und versuchen, wegen dieser Gedanken Hilfe zu erhalten, beweist, dass sich Ihr Denken eher aus Ihrer Lebenssituation ergibt als aus einer immanenten kognitiven Störung.«
»Hören Sie sich eigentlich immer wie ein Lehrbuch an?«
»Entschuldigen Sie –«
»Und entschuldigen Sie sich immer so viel?«
»Ich –«
»Okay, was sagt denn Freud darüber, wenn man einen Menschen aus Versehen verletzt?«
Eine winzige innere Anspannung verdrehte sich zu einem Knoten in Karens Brust. Es geschah nicht oft, dass sie die Kontrolle über ein Therapiegespräch verlor, aber diese Sitzung entwickelte sich definitiv in die falsche Richtung. »Haben Sie jemanden aus Versehen verletzt?«
»Wer sagt denn, dass ich von mir spreche?«
Ein Gefühl Grauens in ihr führte dazu, dass Karens Hand fast unmerklich zitterte. Ob Jessica wohl gemerkt hatte, wie unbehaglich ihr zumute war? Jessica hatte die Reaktion auf ihre Frage nicht voraussehen können. Trotzdem umspielte ein leises Lächeln ihre Lippen, und sie setzte wieder ihre teilnahmslose Miene auf.
»Ein Versehen ist dadurch definiert, dass wir nichts dafür können, Jessica: Wir tun oft etwas aus Versehen, um auf diese Weise die Auswirkungen unserer Handlungen zu bewältigen, die unseren Charakter prägen.«
»Mein Vater hatte so eine komische Art, Zufälle und Versehen zu betrachten. Nicht so was wie Stolpern, sondern die richtig schlimmen Dinge, die wir im Leben zulassen, weil wir den Ball nicht im Auge behalten haben. Er hat gesagt, dass in diesem Leben nichts zufällig ist, dass nichts einfach aus Zufall passiert. Seiner Meinung nach erlaubt uns unser Unterbewusstsein auf diesem Weg, unsere wahren Gefühle auszuleben, unter dem Vorwand, wir hätten es nicht absichtlich getan. Finden Sie, dass das einen Sinn ergibt, Dr. Browning?«
Die Anspannung band die beiden Frauen aneinander wie ein Seil, die harmlose Frage war voller unausgesprochener Bedeutung. Karen schwieg.
»Ich glaube, Sie würden meinen Vater mögen.«
Karen versuchte, ihre Gedanken in zusammenhängende Sätze zu fassen. Schlagwörter aus ihrer Ausbildung – Vater, Unterbewusstsein – zogen automatisch Fragen nach sich, und doch hatte sie große Mühe, sie auszusprechen. Bevor sie etwas sagen konnte, redete Jessica weiter.
»Es war auf einer Wohltätigkeitsgala.« Ihre Augen fixierten ein Stückchen loser Haut am Rand ihres Daumennagels, die Hauteinrisse konnten auf eine Angststörung hindeuten. Die Fingernägel selbst waren kurz und ungleichmäßig – abgekaut, nicht gefeilt – und nicht lackiert.
Es dauerte einen Moment, bis Karen klar wurde, dass Jessica damit ihre ursprüngliche Frage beantwortet hatte. Dabei zeigte sie dieselbe undurchdringliche Maske, die ihre Patientin schon zu Beginn der Sitzung aufgesetzt hatte. Karen ließ sich etwas Zeit, um in die Therapeutenrolle zurückzufinden, und setzte das Gespräch fort, als hätte es die letzten fünf Minuten nie gegeben.
»Haben Sie beruflich mit Wohltätigkeitsveranstaltungen zu tun?«
»Nicht direkt, ein Bekannter hatte eine Eintrittskarte übrig. Er saß an der Bar und langweilte sich genauso wie ich. Er machte irgendeinen Witz von wegen er würde mir Geld geben, wenn ich mit ihm dabliebe, und ich hab ihm geantwortet, ich wäre keine Prostituierte. Da ist er ganz verlegen geworden und hat gesagt, dass er das nicht so gemeint hätte, dass er mich nicht beleidigen wollte. Da ist mir aufgefallen, wie gut er aussieht.«
Sie blickte von ihren Händen auf und lächelte. Es war kein Grinsen wie noch vor einer Minute, sondern ein echtes Lächeln der Erinnerung. Allerdings verwandelte es ihr Gesicht nicht, so wie bei anderen Menschen. Wenn überhaupt, dann brachte es Jessicas Unscheinbarkeit nur noch stärker zum Ausdruck, die Tatsache, dass selbst ein Lächeln sie nicht heiter wirken ließ. Die äußere Erscheinung beeinflusst, wie andere Menschen einen behandeln, und Karen konnte sich gut vorstellen, dass ein gut aussehender Mann diese junge Frau im Sturm eroberte. »Aber er war süß, überhaupt nicht eingebildet und übertrieben selbstbewusst wie manche attraktiven Männer.«
»Entspricht das Ihren Erfahrungen mit Männern?«
Jessica redete einfach weiter, als hätte Karen überhaupt nichts gesagt. Sehr detailliert schilderte sie den Abend, an dem sie ihren verheirateten Geliebten kennengelernt hatte, die Witze, die er erzählt hatte, die Art, wie seine Hand so nahe an ihrem Knie gelegen hatte, dass diese, jedes Mal, wenn sie lachte, ihr Seidenkleid berührte. Doch im Laufe der Erzählung änderte sich ihre Körpersprache noch einmal. Sie nahm wieder eine Abwehrhaltung ein und wappnete sich für den Teil, der die negativen Gefühle auslöste.
Klassische Anzeichen für kognitive Dissonanz.
»Was ist also nach dem Ende der Gala passiert?«
Jessica verschränkte die Arme vor der Brust. Der Patientin widerstrebt es, sich zu erinnern. »Wir sind in sein Hotelzimmer gegangen und haben gevögelt.«
»Und wie haben Sie sich dabei gefühlt?« Die Frage war natürlich ein Klischee, und ein ziemlich schreckliches dazu. Karen war es jedes Mal furchtbar peinlich, wenn sie sie stellen musste. Ihre Freundinnen hatten einen Dauerwitz daraus gemacht. Als Karen ihr mitgeteilt hatte, dass sie Psychiaterin werden wollte, hatte ihre beste Freundin Bea sie ein Jahr lang mindestens bei jedem zweiten Treffen gefragt: Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Aber manchmal – okay, oft – musste genau diese Frage gestellt werden. Weil es Karens Aufgabe war, die Gefühle, die sich bei den Patienten während des Erzählens einstellten, an der Wurzel zu packen. Häufig waren die Patienten so in ihre eigene Geschichte versunken, dass ihnen gar nicht auffiel, wie sentimental sie klang.
»Ich bin nicht gekommen, wenn Sie das meinen. Es war nett, ein bisschen schnell vorbei und kaum eine romantische Liebe auf den ersten Fick, aber es war okay.«
Die Patientin verwendet Humor und schockierende Ausdrücke, um von der Frage nach ihren Gefühlen abzulenken. Karen konnte ordinäre Ausdrücke nicht ausstehen, sie bewirkten, dass sie sich unbehaglich und unsicher fühlte. Was vermutlich auf ihre Schulzeit zurückging. Es erinnerte sie daran, wie brav sie gewesen war und wie viel Angst sie gehabt hatte, vulgäre Begriffe zu verwenden, wie sie die coolen Kids immer wieder in ihre Sätze einstreuten. Möglicherweise ging diese Abneigung aber auch weiter zurück. Viel weiter.
»Beim zweiten Mal war’s besser. Und bald ist es zu einem dritten und vierten Mal gekommen. Inzwischen treffen wir uns regelmäßig unter der Woche. Da er nicht im Büro arbeiten muss, wohnt er praktisch bei mir.«
»Haben Sie keine Angst, dass seine Frau dahinterkommen könnte?«
Jessicas Miene verdüsterte sich. »Eine Zeit lang hab ich das geglaubt. Ich habe auf einen Anruf gewartet oder dass sie aufkreuzen und sagen würde: Ich weiß, was du tust. Ich weiß, was du getan hast. Aber sie ist so sehr mit den Kindern beschäftigt, dass sie nicht einmal merken würde, was läuft, wenn wir in ihrem Auto bumsten, während sie am Steuer sitzt. Es interessiert sie nicht die Bohne, was er macht.«
»Sagt er das?«
»Das muss er gar nicht, es kommt in anderen Dingen zum Ausdruck, die er äußert. Sie hat keine Zeit für ihn.«
»Aber Sie.«
Jessica schaute sie wütend an. »Was macht das denn für einen Unterschied? Ich hab Ihnen doch gesagt, ich will gar nicht, dass er sie verlässt. Ich begreife bloß nicht, dass sie nicht merkt, was mit ihrem Mann los ist.« Wieder blickte sie auf ihre Fingernägel. »Ich denke viel darüber nach«, sagte sie leise.
Das war es also. Es hatte nicht so lange gedauert, wie Karen erwartet hatte, um auf die nächste Schicht des Problems zu stoßen. Dies war der Grund, weshalb Jessica hier war. Aber wenn sie sie jetzt zu sehr drängte, würde das die verbliebenen vierzig Minuten der Sitzung ruinieren. Karen versuchte, sich einzureden, dass Jessica lediglich eine junge Frau war, die sich in eine Lage gebracht hatte, die einen inneren Widerstreit in ihr auslöste. Dieser Trotz bereits am Beginn der Sitzung, das Gefühl, dass die Patientin gekommen war, um sie herauszufordern – dabei ging es allein um die Komplexe der Patientin, die sich in ihren harmlosen Fragen über das Leben manifestierten. Karen war fast überzeugt davon.
»Was seine Frau angeht …?«, fragte sie leise und beugte sich ein wenig vor.
Jessica nickte. Sie sah sie zwar immer noch nicht an, schaute aber nicht mehr so finster.
»Wie konnte sich diese Frau denn so behandeln lassen? Ich meine, weiß sie davon, und interessiert es sie nicht? Oder ist sie einfach so blöd, dass sie nicht merkt, was er treibt? Er hat sich ein zweites Handy gekauft. Damit er mich kontaktieren kann, ohne dass sie davon erfährt. Sie regelt alle finanziellen Dinge, aber er hat ein Konto, von dem sie nichts weiß. Welcher Ehemann glaubt denn, so was tun zu müssen? Aber seine Frau ist so ein kontrollierendes Miststück, dass er nur auf diese Weise an sein Geld rankommt.«
Das er ausgibt, um mit anderen Frauen zu schlafen.
»Ich hab ein paar Dinge getan, nur Kleinigkeiten. Ich habe ein bisschen mit ihr gespielt, Sachen in ihrem Kalender verändert, dafür gesorgt, dass sie ein paar Termine verpasst. Hat sich gut angefühlt, die Kontrolle zu haben.«
»Sie waren bei dieser Frau zu Hause?«
»Ja.«
Karens Unbehagen, das in der vergangenen halben Stunde immer stärker geworden war, drohte sie vollends zu überwältigen.
»Jessica, ich muss Sie das leider fragen. Mein Beruf verpflichtet mich dazu, und ich würde meine Arbeit nicht richtig machen, wenn ich Ihnen die Frage nicht stellte. Verstehen Sie, was ich meine?«
Jessica nickte.
»Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Verhalten eskalieren könnte? Dass das, was Sie über diese Frau denken, zu Handlungen führen könnte, die sich Ihrer Kontrolle entziehen?«
»Nein.« Sie schüttelte langsam den Kopf. »Nichts davon. Sie ekelt mich an, und ich hasse sie, aber ich bin nicht gefährlich.«
Kapitel 3
BEA
»Hallo zusammen! Ich heiße Eleanor, und mein Scheißdrauf an diesem Freitag ist …« Eleanor machte eine Pause, um maximale dramatische Wirkung zu erzielen – etwas, was sie seit ihrer gemeinsamen Kindheit sehr gut beherrschte. »… dass ich mindestens sechzehn Windeln wechseln musste, wovon eine mir auf die Füße gefallen ist. Was buchstäblich Scheiße war.«
Bea und Karen konnten ihren Lachanfall, der durch das kleine Café hallte, nicht stoppen. Bea sah, dass einige Gäste sie über ihre Zeitungen hinweg ansahen, als wären sie drei lärmende Teenager in einer Bibliothek, und widerstand dem Drang, ihnen die Zunge herauszustrecken. Karen erinnerte Bea jede Woche aufs Neue daran, dass sie mittlerweile erwachsen wären – aber wenn sie beisammen saßen, schienen die vergangenen fünfzehn Jahre wie weggeblasen, und sie lagen wieder zu dritt auf Eleanors Schubladenbett und ließen eine Flasche Mad Dog 20/20 kreisen, einen hochprozentigen Billigwein.
Eleanor verzog ihr Gesicht und nahm einen Schluck von ihrem Getränk.
»Ja, lacht nur, ihr blöden Ziegen. Ihr müsst ja auch nicht die Kacke von euren neuen flachen, ach so vernünftigen Schuhen kratzen. So! Karen ist dran.«
Karen griff nach ihrer Tasse und hielt sie hoch, aber Bea sah, dass sie zögerte. Nur für den Bruchteil einer Sekunde, was den meisten Leuten gar nicht aufgefallen wäre, aber die kannten ihre Freundinnen ja nicht auch schon seit Urzeiten. »Freut mich, mit euch an diesem wunderschönen Freitagnachmittag zusammenzusitzen. Mein Scheißdrauf ist, dass ich vergangene Woche bei der Arbeit so viel zu tun hatte, dass ich einen Zahnarzttermin vergessen und eine Podiumsdiskussion mit einem renommierten Psychiater verpasst habe, auf die ich mich seit Monaten gefreut hatte. Ich hatte schlicht vergessen, den Termin in meinen Kalender einzutragen.«
Bea und Eleanor stöhnten theatralisch. Eleanor legte den Kopf auf den Arm, der auf dem Tisch lag. »Um Gottes Willen, Karen Browning, du könntest dir wenigstens irgendwas ausdenken, wenn dein Leben so verdammt an Unsere kleine Farm erinnert«, sagte sie leise in ihren Ärmel. Sie schaute hoch. »Ich hab in letzter Zeit so viele Treffen mit der Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt verpasst, dass sie die Aufsichtsbehörde garantiert auf Schnellwahl gestellt hat. Bea – du bist dran. Und komm uns bitte nicht mit Aa auf den Schuhen. Ich bezweifle, dass ich damit klarkäme, dieses Spiel in drei aufeinanderfolgenden Wochen zu gewinnen.«
Bea schenkte sich Saft aus dem Krug nach, der auf dem geschmacklosen rot-weißen Tischtuch stand, und setzte sich gerade hin.
»Hallo zusammen! Ich heiße Bea.«
»Hallo Bea«, sagten die beiden anderen Frauen im Chor. Bea hob ihr Glas und nickte in Richtung Eleanor, die schon ganz neugierig wartete.
»Ich möchte Eleanor für meine Nominierung danken. Mein Scheißdrauf an diesem Freitag ist, dass ich vergessen habe …«, sie hielt inne, als ihr einfiel, dass das, was sie vergessen hatte, vor Karen nicht erwähnt werden durfte. Rasch rief sie sich ihren Nachmittag im Büro in Erinnerung. »Ich hab vergessen, einen unserer größten Kunden für unser Seminar für Führungskräfte anzumelden, weshalb mein Arsch von einem Chef mich vor versammelter Mannschaft als unfähig abgekanzelt hat.«
»Dieser Wichser«, sagte Eleanor leise und rieb Bea die Schulter, während sie mit der anderen Hand die SMS öffnete, die sie gerade eben bekommen hatte. »Um Himmels willen, Noah schläft noch. Der kriegt heute Nacht kein Auge zu, wenn Mum ihm erlaubt, tagsüber ein langes Schläfchen zu halten.«
Ganz kurz war Bea verärgert, aber im letzten Moment rehabilitierte sich Eleanor und steckte ihr Handy in ihre viel zu voll gestopfte Handtasche zurück.
»Es lohnt nicht, auch einen Gedanken an den Kerl zu verschwenden.«
Eleanor griff nach Beas obstsaftfreier Hand – und sah auf ihrem Handrücken feine Kugelschreiberabdrücke, vermutlich eine Gedächtnisstütze oder eine Telefonnummer, die ein anderthalb Minuten langes Duschbad nicht ganz gelöscht hatte. Wieder summte Beas Handy unter dem Tisch, aber sie beachtete es kaum – was ihr hoch anzurechnen war.
»Das hat Fran auch gesagt.« Bea grinste. »Allerdings mit etwas deutlicheren Worten.«
Karen zog die Augenbrauen hoch. »Bist du nicht ein bisschen zu alt dafür, dass deine große Schwester dir zur Hilfe eilt?«
»Ach, lass sie doch, Karen.« Bea grinste gutmütig. »Fran hat mir immer geholfen. Du hast sie einfach nie an dich herangelassen. Ich finde es schön, endlich eine Schwester zu haben, mit der ich reden kann. Keine Beziehung ist so wie die zwischen Schwestern, weißt du.« Als ihr einfiel, was Karens Schwester vor langer Zeit zugestoßen war, schlug sie die Hand vor den Mund. »O Mist, tut mir leid.«
Karen lächelte, aber ihr Mund verzog sich zu einem dünnen Strich, sodass es eher aussah, als zöge sie eine Grimasse. »Schon gut, du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du deine Schwester liebst. Ich freue mich, dass du dich wieder besser mit Fran verstehst, ehrlich.«
Diesmal lächelte sie aufrichtig und hob ihren Becher. »Okay, heute hat Eleanor gewonnen. Auf dein beschissenes Leben!«
Bea stieß mit Karen an. Eleanor hob ebenfalls ihren Becher.
»Auf mein beschissenes Leben.« Sie seufzte. »Also … sagt die Fitness-Mami zur berufstätigen Mami: ›O nein, ich wundere mich nur, dass gerade du die Zeit hattest …‹« Sie hielt inne und schaute von Bea zu Karen und wieder zu Bea. »O Gott, ich bin langweilig, stimmt’s?« Sie stützte den Kopf in beide Hände. »Geht einfach, wenn ihr wollt, ich schau weg, dann könnt ihr euch unbemerkt rausschleichen.«
Bea lachte. »Nein, im Ernst, ich wollte wirklich wissen, was die Fitness-Mami zu der anderen sagt … der Veganer-Mami?«
Eleanor stöhnte. »Na gut. Aber ihr sollt wissen, dass diese sechzehn Minuten Kommunikation zwischen Erwachsenen bei der Abholung der Kinder von der Schule alles ist, womit ich mich an den meisten Tagen begnügen muss. Ich sitze nicht in einem Büro herum und tratsche darüber, wer wessen Truthahn-Sandwich geklaut hat, oder bringe anderer Leute Kopf wieder in Ordnung. Ich verkehre bloß mit streitenden Müttern.«
»Hast du mal darüber nachgedacht, wann du wieder arbeiten gehen willst?« Als Bea die niedergeschlagene Miene ihrer Freundin sah, bereute sie sofort, die Frage gestellt zu haben.
»Adam findet, ich sollte mir eine Auszeit nehmen. Nur solange, bis Noah zur Schule geht. Er meint, bei den hohen Kosten für die Kinderbetreuung könnte ich genauso gut Zeit mit den Jungs verbringen, solange sie klein sind. Außerdem könnten wir es uns ja auch leisten, von seinem Gehalt zu leben.«
»Und was findest du?«, fragte Karen vorsichtig nach.
Eleanor seufzte.
»Ich denke, ich will keine blöde Mittelschicht-Tussi sein, die sich darüber beklagt, die Chance zu haben, ihre Kinder selbst großzuziehen, wenn es unzählige Frauen gibt, denen nichts anderes übrig bleibt, als wieder arbeiten zu gehen, und die alles dafür tun würden, um in meiner Lage zu sein.«
»Okaaaay«, erwiderte Bea und steckte die Gabel in das Stückchen Karottenkuchen, das auf Karens Teller übrig geblieben war. »Aber was denkst du, wenn deine Freundinnen nichts dabei finden, wenn du eine Mittelschicht-Tussi bist?«
»Ich denke, ich dreh noch durch, wenn ich nicht bald etwas tue, das dazu führt, dass ich mich wieder wie ich selbst fühle. Ich bin zu egoistisch, um von morgens bis abends jemandes Mami oder jemandes Ehefrau zu sein.«
»Du könntest eine Firma gründen«, schlug Karen vor. »Dann wärest du Mami und gleichzeitig Super-Geschäftsfrau. Noah könnte ein paar Tage in der Woche morgens in eine Kita gehen – er würde vom Zusammensein mit anderen Kleinkindern profitieren, und du könntest netzwerken. Ich hab da ein paar Kontakte, deren Telefonnummern ich dir geben kann. Ich kenne viele Mütter, die das Gleiche gemacht haben.«
Eleanor machte ein Gesicht, als wüsste sie nicht, was sie von der Idee halten sollte.
»Ich weiß nicht«, sagte sie, aber zwischen den Zeilen las Bea, dass durchaus Interesse bestand – ein Interesse, das sie bei Eleanor, die in einer Werbeagentur gearbeitet hatte, nicht mehr wahrgenommen hatte, seit diese im Mutterschaftsurlaub gegangen war. »Ich meine, bei Fresh hatte ich einen ziemlich festen Kundenstamm. Wenn ich eine Firma gründen würde, hieße das, dass ich wieder ganz von vorne anfangen müsste. Das wäre viel Arbeit … Ich werd’ mal darüber nachdenken. Wäre bestimmt besser, als in meinen alten Job zurückzukehren und mir die Brust auf der Behindertentoilette abzupumpen.«
»Ich dachte, du stillst nicht mehr?«
»Ja, schon, aber die Mistdinger – entschuldige, Karen – hören einfach nicht auf, Milch zu geben. Jeden Morgen wache in einer Pfütze Milch auf.«
Bea verzog das Gesicht. »Igitt.«
»Ach, Bea, eines Tages … wenn du erst mal Kinder hast …«
Bea tat so, als würde sie schaudern. »Verdammt, ich kann gar keine Kinder bekommen. Zunächst einmal habe ich ein cremefarbenes Sofa.«
Eleanor lachte. »Du wirst schon noch Kinder haben. Und das weißt du auch. Ich kannte mal eine Frau, die …«
»Im Ernst, Eleanor«, schaltete sich Bea ein. »Wenn du noch ein Wort über diese Moira aus dem Büro verlierst, die ihr erstes Kind mit 42 bekommen hat, übergebe ich mich.«
Eleanor zog ein gekränktes Gesicht, dann sagte sie grinsend: »Aber sie hat eins bekommen! Es ist also nie zu spät.«
»Ganz genau. Mehr noch: Ich fange sofort damit an. Dem nächsten Mann, mit dem ich schlafen will, händige ich vorher einen Fragebogen aus. Ihr wisst schon, die, die man in Arztpraxen bekommt. ›Entschuldigen Sie, aber könnten Sie mir, bevor Sie Ihre Boxershorts ausziehen, bitte sagen, ob jemand in ihrer Familie an einer Herzerkrankung leidet? Nein? Fantastisch. Also, wenn Sie soweit sind, dürfen Sie Ihren Pimmel bitte in dieses Reagenzglas stecken.‹« Sie tat so, als würde sie ein Reagenzglas schwenken.
»Du bist vulgär, Bea.« Karen schüttelte den Kopf. »Apropos, wie sieht’s denn bei dir an der Liebesfront aus?«
»Die Rechnung!«, rief Bea und wandte sich in gespielter Verzweiflung zu der Kellnerin um. »Könnten wir die Rechnung bekommen, bitte?«
Bea lebte als Einzige der drei Frauen allein. Deshalb musste sie die anderen mit anschaulichen Schilderungen ihres Liebeslebens versorgen, in denen die Freundinnen schwelgten, die auf diese Weise die Zeit ihrer Partnersuche noch einmal durchlebten. Was sie jedoch nicht wussten und auch niemals erfahren würden, war, dass all die Angeberei, die Lügen und das Getue allein ihrem Vergnügen und auch dazu dienten, dass sie sich keine Sorgen um sie machten. Bea hatte schon seit Jahren keinen festen Partner mehr, und mit ihren wenigen Alibi-Dates hatte sie sich Karens Nachfragen vom Halse schaffen wollen. Die Männer hatten nie eine echte Chance gehabt.
Während sie darauf warteten, dass die verdatterte Kellnerin die Rechnung brachte, wandte sich Karen zu Bea um.
»Hör mal, ich kenne da einen Mann an unserem Institut. Er ist Single …«
Bea stöhnte theatralisch. »Ich flehe dich an, Karen, keine Blind Dates mehr! Ich liebe dich, aber die Kerle, die du in der Vergangenheit für mich aufgetan hast, waren – na, sagen wir mal, es ist mir nicht gelungen, meinen Märchenprinzen unter ihnen zu finden.«
Karen lächelte. »Ich weiß, Chris war ein bisschen eine Spaßbremse, und Sean …«
»… war eine absolute Schwanzbremse«, beendete Bea den Satz.
»Im Ernst, Karen, wie es diese Männer zum Psychiater gebracht haben, wenn sie selbst so viele beknackte psychische Probleme haben, ist mir schleierhaft.«
»David ist anders. Er ist nicht mal Psychiater. Er arbeitet in der IT-…«
»Oh, um Gottes willen. Also wirklich, ich bitte dich … als wäre das besser!«
Eleanor lachte. »Stell dich nicht so an, Bea, du könntest dir wenigstens dein 21 Jahre altes Notebook von ihm upgraden lassen, wenn er sich als Niete im Bett erweist.«
»Bitch.« Bea grinste Karen zu. »Gut, gib mir seine Nummer. Hoffentlich ist er kein zweiter Sean.«
»Bestimmt nicht. Aber es ist kein Wunder, dass du bei deiner Ausdrucksweise keinen anständigen Mann findest. Du könntest wenigstens versuchen, dich wie eine Dame zu benehmen.«
»Das wäre Werbebetrug …«, Bea zeigte auf Eleanor.
»Ist so was nicht verboten, Els?«
Die Kellnerin kam mit der Rechnung. Wie immer zückte Karen ihre Kreditkarte. Bea blickte frustriert zu Eleanor, die kurz den Kopf schüttelte. Beide hatten schon unzählige Male versucht, zu zahlen, aber am Ende war es einfach unkomplizierter, Karen die Rechnung begleichen zu lassen. »Ich muss zurück ins Institut – ich hab heute Nachmittag noch eine Patientin und will gleich nach der Sitzung nach Hause. Michael fährt über das Wochenende weg, und ich will ihn noch verabschieden.«
»Irgendwohin, wo es nett ist?«
Karen zog ein Gesicht. »Nach Doncaster, glaube ich. Hab euch lieb.« Sie nahm ihre Kreditkarte von der Kellnerin entgegen, die anderen beiden Frauen umarmten sie und verabschiedeten sie.
»Ich muss jetzt auch los.« Eleanor tat so, als würde sie auf die Uhr sehen, aber Bea ahnte, dass sie unbedingt wieder bei ihren Söhnen sein wollte. »Viel Glück bei der Arbeit. Ruf mich an, wenn du etwas zu bereden hast.«
Bea schnitt eine Grimasse. »Danke, Liebes, wird gemacht. Grüß Tweedledum und Tweedledee von mir.«
Eleanor grinste. »Ich werde Toby und Noah liebe Grüße von ihrer alten Tante Bea ausrichten. Allerdings dürften sie keine Ahnung haben, wer Tweedledum und Tweedledee sind. Was wird den Kindern heute eigentlich noch in der Schule beigebracht? Zwinkerzwinker.«
»Weißt du, eines Tages lernst auch du, richtig zu zwinkern. Und witzig zu sein.«
»Hab schon verstanden, blöde Kuh. Darf ich trotzdem nach dem Fitnesstraining die Reisepassformulare bei dir vorbeibringen?«
»Aber nicht zur Bettgehzeit, Bea! Du tauchst dauernd zur Bettgehzeit auf, und Tobes gerät dann immer außer Rand und Band.«
»Nicht zur Bettgehzeit, ich verspreche es.«
Kapitel 4
KAREN
Die Anspannung am Tisch war mit Händen zu greifen, aber nicht, weil die Anwesenden umtrieb, was man ihnen gleich mitteilen würde – es war nicht der Stil der Institutsleitung, schlechte Nachrichten vor dem Team zu verkünden. Diese wurden hinter geschlossenen Türen übermittelt, so leise wie möglich, kein Aufhebens, keine Aufregung. Nein, die jüngeren Psychiater, sechs insgesamt, Karen eingeschlossen, machten aus demselben Grund besorgte Gesichter, der Karen ungeduldig mit dem Fuß wippen und ständig zur Tür blicken ließ, seit sie sich in dem großen Besprechungszimmer versammelt hatten.
Es war Freitag, und alle hatten gehofft, früh ins Wochenende starten zu können. Michael fuhr heute Abend ab, und Karen wollte ihn unbedingt noch sehen, bevor er aufbrach. An solchen Wochenenden führte sie sich auf, als würde er nie mehr wiederkommen. Wenn sie sich von einem geliebten Menschen verabschiedete, dann immer so, als wäre es das letzte Mal. Wenn sie nicht mit Michael zusammen war, musste sie ständig daran denken, er könnte in einen Autounfall verwickelt sein, und sorgte sich, ihre letzten Worte an ihn könnten gelautet haben: »Ach, übrigens, könntest du die Mülltonnen noch vor neun rausstellen?«
Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich die Tür zum Konferenzraum, und zwei der leitenden Ärzte, Robert und Jonathan, betraten den Raum. Beiden entging völlig, dass das Wochenende bevorstand, und ihre Mitarbeiter wie verdrießliche Teenager beim Nachsitzen wirkten.
»Danke, dass Sie alle gekommen sind.« Jonathan sah in die Runde, wobei sein Blick auf Karen verharrte, die im Mantel dasaß. »Halten wir Sie auf, Karen?«
Karens Wangen wurden warm. Es war ihr peinlich, so angesprochen zu werden, aber sie würde sich nicht beschämen lassen. Sie hatte schon lange den Eindruck, dass Jonathan sie nicht besonders mochte, er war ein frauenverachtender Mistkerl, und seine herablassenden Bemerkungen zielten stets auf sie oder die einzige andere angestellte Psychiaterin.
»Nein, das kann warten, bis wir hier fertig sind«, antwortete sie und erwiderte Jonathans Blick. Wahrscheinlich hoffte er im Stillen, dass sie schwanger werden und den Schalter im Kopf umlegen würde, von Karrierefrau auf Mutter. Jedenfalls engagierte sie sich hundertmal mehr als ihre Kollegen, was keiner von ihnen bestreiten konnte. Außerdem hatten die auch nicht ihren Elan. Nur wusste der arme Jonathan nicht, dass sie niemals Kinder haben würde. Hin und wieder verspürte sie die große Versuchung, es ihm zu sagen, seinen Traum zu zerstören, dass sie eines Tages in einen Großraumwagen einsteigen und sich eine Schürze umbinden würde. Was aber bedeutet hätte, ihm den Grund zu nennen, und das brachte sie einfach nicht über sich.
Robert spürte die Anspannung zwischen ihnen und räusperte sich. »Also gut, wir werden Sie nicht lange aufhalten. Wie Sie wissen, haben wir Sie hier zusammengerufen, weil Ken Williams in diesem Sommer in den Ruhestand gehen wird.«
»Wie Sie wissen« war eine Untertreibung. Seit Ken zwei Monate zuvor angekündigt hatte, dass er sich zurückziehen werde, hatte dieses Wissen in jedem einzelnen ihrer Sprechzimmer gelauert. Es hatte sie während ihrer Therapiesitzungen beobachtet und ihnen etwas zugeflüstert, wenn sie ihren Papierkram erledigten. Die Aufnahmeberichte waren umfänglicher geworden, die Überweisungen flossen in Strömen wie der Champagner in der Playboy-Villa. Kens Ausscheiden riss eine Lücke in der Chefetage, die jeder von ihnen nur allzu gern gefüllt hätte.
Karen ahnte bereits, wer der Glückliche sein würde. Und seiner Miene nach zu urteilen, schien er das Ergebnis auch schon zu kennen. Travis Yapp war der Inbegriff aller Kraftausdrücke, die Bea jemals benutzt hatte. Aber wie sollte man auch jemanden nennen, der sich für einen Mann seines Alters zu viel Gel ins Haar schmierte und seine Frau als »meine Gattin« vorstellte? Karen nahm sich vor, Bea später danach zu fragen.
Karen wusste, dass Robert Travis nicht ausstehen konnte, aber auch, dass Travis die richtigen Leute beeindruckt und alles gesagt und getan hatte, was von ihm erwartet wurde. Karen missfiel die Schlussfolgerung, dass sie das nicht getan hatte. Sicher, sie hatte sich nicht immer besonders diplomatisch verhalten. Sie war keine Jasagerin, aber sie hatte immer gehofft, dass Robert sich für sie einsetzen würde. Sie sei nicht die Richtige, hatte er ihr erklärt und hinzugefügt, als wollte er ihr Schicksal als angestellte Psychiaterin für den Rest ihres Lebens besiegeln: »Du wärst im zweiten Stock sowieso nicht glücklich geworden, zu viele Verwaltungsaufgaben, nicht genug therapeutische Arbeit. Du würdest dort ersticken.« Travis hingegen sei genau die Art von verschlagenem Trottel, den man in der Chefetage haben wolle. Und was bist du dann?, hätte sie Robert gerne gefragt, aber er war immer noch ihr Chef, und überhaupt: Er sollte nicht wissen, wie sehr es sie kränkte, dass sie den Job nicht kriegen würde.
Jetzt redete Jonathan. Es war eine lange, langweilige Ansprache über die jahrelange Erfahrung, die Ken mitnehmen würde und darüber, wie viel dieser von seinen Kolleginnen und Kollegen gelernt habe. In Erwartung von Travis Krönung musste Karen wohl ein finsteres Gesicht gemacht haben, denn Robert sah sie an und formte mit dem Mund die lautlose Frage: »Alles okay?«
Karen senkte den Blick und ignorierte Roberts Anteilnahme. Sicher, es war kindisch, aber der Affenzirkus hier machte sie ängstlich und wütend. Vielleicht musste sie Yapp gratulieren, lächeln und sagen, er sei der Beste für den Job, aber sie musste Robert ja nicht auch noch sein schlechtes Gewissen nehmen, wo er sich als ein solcher Feigling erwiesen hatte. Damals auf der Uni hatte die Theorie von der »gläsernen Decke« sie nie so recht überzeugt, aber die Zweifel, die sie so nachdrücklich geäußert hatte, legten sich allmählich.
»Und darum freuen wir uns, Karen als Mitglied des Leitungsteams begrüßen zu dürfen. Was sagst du dazu, Karen?«
Karen schüttelte den Kopf. Sie hatte sich bestimmt verhört. »Entschuldige, was hast du gerade gesagt?«
Robert lachte – und ersparte ihr damit die Verlegenheit, während die übrigen aus dem Team abzuschätzen versuchten, wie die anderen reagierten. Offensichtlich hatten auch sie damit gerechnet, dass Travis befördert werden würde.
»Nun, Schock und Zweifel sind genauso gut eine Reaktion wie jede andere.« Er grinste. »Sie werden sich mir sicherlich anschließen und Karen gratulieren – vorausgesetzt natürlich, sie nimmt das Angebot an.«
Karen fasste sich, lächelte und nickte liebenswürdig. »Natürlich bin ich begeistert und fühle mich geehrt. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie mir diese Chance geben. Ich hoffe, ich kann Ihre Erwartungen erfüllen.«
Karens Kollegen erholten sich alle ebenso rasch wie sie. Das traf insbesondere auf Travis zu, der ein strahlendes weißes Dreamboy-Grinsen aufsetzte und ein unsichtbares Glas zum Anstoßen hob. »Herzlichen Glückwunsch, Karen – es muss großartig sein, zu erkennen, dass sich die viele harte Arbeit ausgezahlt hat.«
»Herzlichen Glückwunsch, Karen – es muss großartig sein, zu erkennen, dass sich die viele harte Arbeit ausgezahlt hat.« Karen ahmte den Satz in einem kindischen, gekünstelten Tonfall nach. »Was für ein …«, sie suchte nach einem passenden Kraftausdruck und erinnerte sich, wie Bea erst einige Stunden zuvor die Möglichkeiten der englischen Sprache kreativ genutzt hatte. »Was für eine Schwanzbremse.«
Robert lachte so spontan und aufrichtig, dass Karen trotz ihrer Verärgerung lächeln musste.
»Wieso lachst du?«, tadelte sie ihn, auch wenn ihre Wut verflogen war. »Ist dir nicht aufgefallen, dass er damit andeuten wollte, dass ich mit dir geschlafen habe, um befördert zu werden?«
»Das ist ganz normale Frauenfeindlichkeit – wenn ein Mann befördert wird, dann, weil er hart dafür gearbeitet hat, bei einer Frau ist der Grund, dass sie mit einem Mann geschlafen hat. Das wird einem am ersten Tag auf der Bist-du-nicht-glücklich-einen-Penis-zu-haben-Schule beigebracht.«
»Hm, dann bist du wohl ein Frauenversteher, was?« Karen sah auf die Uhr. »Aber ich muss jetzt wirklich nach Hause. Ich wollte dir nur für die Chance danken. Ich werde dich nicht enttäuschen.«
»Das weiß ich.« Robert lächelte. »Herzlich willkommen in der Karriere Ihrer Träume, Dr. Browning.«
Als Karen die Stufen des Cecil-Baxter-Instituts hinunterschritt, schwirrte ihr der Kopf. Mitglied des Leitungsteams. Alles, wofür sie gearbeitet hatte, alles, was sie wollte, war jetzt zum Greifen nahe. Sie würde vielleicht keine Familie haben, so wie sie es sich als Kind erhofft hatte, aber dafür machte sie jetzt Karriere – endlich fühlte sie sich in ihren Entscheidungen bestätigt.
Auf dem Weg zu ihrem Auto blickte Karen die Straße hinauf und hinunter und wollte sie gerade überqueren, als sie jäh am Straßenrand innehielt. Rechts von ihr, knapp dreihundert Meter entfernt, parkte ein silbermetallicfarbener Fiat. Am Steuer saß ihre neue Patientin. Jessica Hamilton, die wartete und beobachtete, wie Karen das Gebäude verließ, obwohl ihre gemeinsame Therapiestunde erst wenige Stunden zurücklag.
Kapitel 5
KAREN
»Ja!« In den letzten fünf Minuten hatte sie ihre Schlüssel gesucht, und als sie sie schließlich gefunden hatte und aus ihrer Handtasche zog, kam auch ein zerknülltes kleines Blatt Papier zum Vorschein, das auf die Türschwelle fiel. Sie hob es auf, öffnete die Tür und legte ihre Tasche auf die Kommode im Flur.
»Hallo? Michael?« Am liebsten hätte sie gerufen: »Liebling, ich bin zu Hause!« Aber das wäre ungehört verklungen – Michael war nicht da. Das Haus gehörte ihr – nun ja, der Bank –, aber Michael hatte einen Schlüssel, und es war sein Zuhause, wenn er unter der Woche da war. Sie waren nicht wie die anderen Paare, die Karen kannte, die ständig Kontakt hielten, und obwohl sie das manchmal schwierig fand, funktionierte es. Meistens. Sie hasste es, den Charakter ihrer Beziehung geheimzuhalten, aber den Leuten in ihrem Umfeld zu erklären, wohin Michael an seinen »Arbeits«-Wochenenden tatsächlich fuhr, war einfach nicht drin.
Sie schlenderte weiter ins Wohnzimmer. Im Gehen glättete sie das Stück Papier, das sie in ihrer Handtasche gefunden hatte. Oben auf dem Blatt befand sich ein lustiges gelbes Schul-Logo: das Logo ihrer alten Schule und der, die Toby jetzt besuchte. Darunter stand in Großbuchstaben der Satz »Wir halten den Kontakt«. Es war eine Art Infoschreiben, das die bisherigen Leistungen der Kinder im Schuljahr im Einzelnen aufführte. Ohne den Rest zu lesen, steckte Karen den Brief in die Schublade im TV-Schrank.
Karen war die besondere Stille gewohnt, die einen umgab, wenn man zu lange allein zu Hause war, doch heute fand sie sie beunruhigend. Sie schaltete den Fernseher ein, um die Leere zu füllen, die, hätte sie Kinder gehabt, nun vermutlich von einer regen Nachmittagsroutine ausgefüllt worden wäre. Der Bildschirm erwachte flimmernd zum Leben. Karen ließ ihn auf dem Kanal, der gerade ausgewählt war, ignorierte das vorhersehbare Unterhaltungsprogramm für die Rentner und Arbeitslosen, das gerade lief, und ging nach oben, um ihr Make-up aufzufrischen. Michael sollte ein schönes Bild von ihr in Erinnerung behalten an den Tagen, an denen er nicht da war. In den zwei Jahren, in denen sie nun zusammenwaren, hatten sie sich nie gehen lassen, sie waren nie bequem geworden, so wie sie es hätten werden können, wenn die Dinge anders gelegen hätten. Die Zeit, die sie gemeinsam verbrachten, empfanden sie immer als kostbar, weil ihnen bewusst war, dass Michael von einer Minute zur nächsten aufbrechen müsste, sollte es in seiner Familie einen Notfall geben.
Während Karen sich die Lippen nachzog, die Wimperntusche auffrischte und etwas mehr Rouge auf die Wangen auftrug, dachte sie an die bedauernswerte, erschöpfte Eleanor und daran, dass sie kaum noch Zeit für sich hatte. Und an Bea, die nur eines hatte: Zeit. Und an Beas Job, in dem es im Moment nicht gerade super lief. Sie sollte den beiden anbieten, mehr für sie zu tun, Eleanor einen Tag lang die Jungs abnehmen, damit sie ihre wohlverdiente Ruhe fand, ein bisschen mehr Zeit mit Bea verbringen und versuchen, jemanden zu finden, der sie glücklich machte. Nicht, dass das besonders gut gelaufen war beim letzten Versuch – woran Bea sie nur allzu gerne erinnerte. Rückblickend war es vermutlich eine alberne Idee gewesen, ihre Freundin mit einem Kollegen verkuppeln zu wollen. Dabei hatte Karen nur helfen wollen. Trotzdem: Bea hätte etwas mehr Dankbarkeit zeigen und zumindest so lange warten können, bis Sean gegangen war, bevor sie ihn im Flüsterton als absoluten Flachwichser bezeichnete.
Tatsache war, dass Karen immer nur das Beste für ihre Freundinnen wollte.
Als sich ihr Gesicht allmählich schwer anfühlte von dem Make-up, das sie in ein paar Stunden entfernen würde, wischte sie über das Display ihres Handys – und hatte Angst eine Nachricht von Michael zu finden, dass er schon hatte losfahren müssen, als sie noch im Institut war. Aber nichts dergleichen, da waren nur ein paar E-Mails, die bis später warten konnten, und eine SMS von Bea.
E hat ganz schön fertig ausgesehen. Sehen alle Mütter so aus? Gott sei Dank, dass wir kinderlos glücklich sind!!! Xx
Karen lächelte über Beas Art, ihr mitzuteilen, dass sie sich wegen Eleanor Sorgen machte, ohne es wie eine Einmischung aussehen zu lassen. Sie schickte zwei SMS ab, mit der einen antwortete sie Bea: Ihr geht’s bestimmt gut. Vielleicht sollten wir ihr anbieten, am Wochenende die Jungs zu uns zu nehmen. Die andere ging an Eleanor: Ich fand unser Mittagessen super. Du fehlst mir, wie immer. Kann ich dir irgendwie mit den Kleinen helfen? Xx
Bea antwortete fast sofort:
Klingt gut. Sag mir Bescheid, wann. Xx
Karen wollte gerade eine weitere SMS tippen, ihr Daumen schwebte über dem Display, als sie hörte, wie Michael die Haustür aufschloss.
Kapitel 6
ELEANOR
Als Eleanor das Café verließ, spürte sie, wie die Ruhe und Freiheit förmlich aus ihrem Körper heraussickerten. Als Erstes musste sie Noah bei ihrer Mutter abholen, anschließend Toby von der Schule, dann Essen kochen und Noah baden, bevor Adam nach Hause kam, der meistens zu erschöpft war, um die Jungs zu Bett zu bringen, sodass sie am Ende auch das noch übernahm. Es würde halb neun werden, bevor sie sich hinsetzen konnte, danach würde sie den ganzen Abend aufs Babyfon lauschen und schließlich ins Bett kriechen, um drei Stunden zu schlafen, bevor Noah wieder aufwachte.
Während der Autofahrt dachte sie an Bea und Karen und daran, wie sie wohl den Abend verbringen würden. Jetzt, da Michael nicht da war, würde Karen vermutlich arbeiten, Notizen tippen, Berichte und Rechnungen schreiben, alles vom gemütlichen Sofa aus, mit einem Glas Wein in der Hand, und sich nebenbei einen kitschigen Film im Fernsehen ansehen. Bea würde den Abend im Fitnesscenter verbringen, lange genug bei ihr vorbeischauen, um die Abendroutine der Kinder zu stören – egal, was sie versprochen hatte –, nach Hause fahren, sich umziehen und mit den Mädels aus dem Büro losziehen. Sie würde bis spät in die Nacht feiern und anschließend ins Bett fallen, – wohl wissend, dass sie am morgigen Samstag ausschlafen konnte. Am Mittag dann würde sie mit Karen oder einer ihrer anderen Freundinnen auswärts essen gehen.
Eleanors Abend sah ein wenig anders aus. Falls Noah problemlos einschlief, musste sie sich den Text der Einladungskarten für die Überraschungsparty ausdenken, die Bea und sie für Karens Geburtstag in sechs Wochen geben würden. Außerdem wollte sie eine Liste mit den Dekorationen anfertigen, die sie für den reservierten Raum in dem Restaurant benötigten – sie hatte sich immer noch nicht entschieden, ob die Feier ein Thema haben sollte. Bea und sie hatten einen ganzen Nachmittag lang Ideen zusammengetragen, als sie vor Monaten mit den Planungen begonnen hatten aber dabei war nur eine Entscheidung herausgekommen: kein Rosa. Am Vormittag um zehn musste Toby zum Fußball, und Noah und sie würden mit ihm da hinfahren, während Adam arbeitete. Sobald sie am Nachmittag wieder nach Hause zurückgekehrt wären, würden sie alle gemeinsam essen, anschließend fand eine Geburtstagsparty mit den anderen Müttern von der Schule statt, am Abend würden sie einen Film schauen und dabei irgendetwas von einem Lieferservice essen. Was für ein glamouröses Leben …
Eleanor versuchte oft, sich in Erinnerung zu rufen, dass sie sich genau dieses Leben gewünscht hatte, dass diese Phase im Leben der Jungs nicht ewig dauern und ihr das alles fehlen würde, wenn sie Teenager wären, und sie machen könnte, was sie wollte. Allerdings war sie sich ziemlich sicher, dass sie dann von den letzten zehn Jahren zu ausgelaugt sein würde, um schicke Klamotten anzuziehen und in einen Nightclub zu gehen. Ließen Nightclubs einem mit über 40 überhaupt rein? Vielleicht gab es da ja einen speziellen Raum für Frauen, die die Zeit zwischen 30 und 39 vollgekleckert mit Babykotze verbracht hatten. Und wenn Noah aus dem Gröbstem raus wäre, würde Toby achtzehn sein, und bei dem Gedanken, dass er seiner Mutter in der Disko in die Arme laufen könnte, brach ihr der kalte Schweiß aus.
Ihr Telefon klingelte, Adams Name erschien auf der Anruferkennung. »Hallo, Schatz.«
Sie stellte das Telefon auf Freisprechen und rief in den Hörer: »Hey, wie geht’s dir?«
»Gut, danke, was gibt’s Neues?« Es war nicht so, dass Adam sie tagsüber nie mehr anrief, nur gab es immer einen Grund, und der bedeutete meistens, dass sie noch etwas erledigen musste. Könntest du mich mal zu kurz abholen …? Kannst du das hier mal kurz zur Post bringen …? »Mal kurz«, das waren in ihrem Zuhause mittlerweile heikle Wörter.
»Nichts Besonderes«, sagte sie.
»Okay. Ich hab wahnsinnig viel zu tun, ich wollte dir nur sagen, dass ich etwas später komme. Es ist ziemlich stressig hier, und ich muss noch jemanden anrufen, bevor ich für heute Schluss machen kann.«
Eleanor wurde ein bisschen traurig. Sie beneidete Adam darum, dass er sich einfach seiner Arbeit widmen konnte, geschützt durch das Wissen, dass sie da sein und sich um alles kümmern würde. Um das Essen, das Haus, die Kinder. Hatte sie sich ihr Leben so vorgestellt, als sie ihn kennenlernte? Sollte häusliche Plackerei der einzige Lohn dafür sein, dass sie Adam und seinen anderthalb Jahre alten Sohn bei sich aufgenommen hatte?
So dachte sie natürlich nicht wirklich darüber. Toby war genauso ihr Sohn. Sieben Jahre lang hatte sie ihn großgezogen, und er sagte Mama zu ihr, auch wenn er nicht wusste, dass das nicht stimmte. Sicher, die Mädels fanden, dass Adam und sie Toby über seine leibliche Mutter aufklären sollten, aber in Wahrheit war ihr der Gedanke zuwider, dass ihre perfekte Familie dann nicht mehr ganz so perfekt wäre. Dass Toby während eines Streits rufen würde: »Du bist nicht meine richtige Mum«, oder nach der Eispenderin suchte, die es wagte, sich als seine leibliche Mutter zu bezeichnen. Es hatte nichts Mütterliches, sich für Alkohol und Drogen zu entscheiden statt für sein Kind. Diese Frau hatte nicht das Recht, wie ein bedrohlicher Schatten über ihrem Leben und dem ihrer Familie zu hängen. Und doch war das so, denn tief im Inneren hielt sich Eleanor für einen furchtbaren Menschen, weil sie Toby seine Herkunft verschwieg. Sie fand es egoistisch und niederträchtig und rechtfertigte sich, indem sie sich – und jedem, der es hören wollte – sagte, dass es zu Tobys Bestem sei. Welches Kind wollte denn wissen, dass seine Mutter es verlassen hatte, bevor es ihr überhaupt sagen konnte, wie sehr es sie liebte und auf sie angewiesen war? Toby brauchte das nicht zu wissen, sie konnten es nicht gebrauchen, eine Problemfamilie zu sein.
»Okay, Schatz, ich kümmere mich um alles.« Eleanor unterdrückte ein Seufzen, was ihr aber nicht ganz gelang. Adam schwieg, auch wenn er es vielleicht bemerkt hatte.