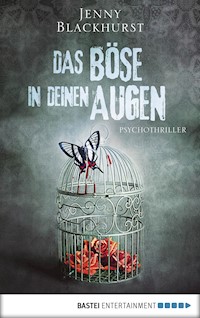9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Susan Webster hat keinerlei Erinnerung an den schrecklichsten Abend ihres Lebens: Sie soll ihren eigenen Sohn erstickt haben. Jahre später entdeckt sie Fotos, die die Hoffnung schüren, dass ihr geliebter Sohn noch lebt.
Auf eigene Faust versucht Susan, den rätselhaften Bildern und ihrer eigenen Erinnerung auf den Grund zu gehen - und kommt dabei einem anderen grauenvollen Verbrechen auf die Spur, das sich vor zwanzig Jahren an einem Elite-College im Norden Englands ereignete ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Brief
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Epilog
Danksagung
Leseprobe
Über die Autorin
Jenny Blackhurst interessiert sich seit frühster Jugend für Spannungsliteratur. Die Idee für einen eigenen Roman entwickelte sie nach der Geburt ihres ersten Kindes. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in Shropshire, England.
Jenny Blackhurst
DIE STILLEKAMMER
Psychothriller
Aus dem Englischen vonAnke Angela Grube
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Jenny Blackhurst
Titel der englischen Originalausgabe: »How I Lost You«
Originalverlag: Headline Publishing Group, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Britta Schiller, Eitorf
Titelillustration: © shutterstock/Valentin Agapov;
© Thinkstock/boule13; © shutterstock/Hanka Steidle
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
ISBN 978-3-7325-0622-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Ash und für Connor,der niemals aufgibt und immer einen Weg findet.
Brief
Brief von Susan Webster – Insassin #397609 – an dieBewährungskommission
23. Januar 2013
An die ehrenwerten Mitglieder der Kommission
Mein Name ist Susan Webster. Vor fast vier Jahren, am 23. Juli 2009, habe ich mein drei Monate altes Kind getötet. So lange hat es gedauert, bis ich in der Lage war, diese Worte auszusprechen und zu akzeptieren, dass sie wahr sind, auch wenn es mir immer noch unvorstellbaren Schmerz und Kummer bereitet, sie niederzuschreiben.
Während der Untersuchungshaft und der folgenden zwei Jahre und acht Monate in Oakdale habe ich mich umfassend über Puerperalpsychose informiert, jene Form postnataler Depression, unter der ich nach Dylans Geburt litt. Meine Recherchen haben mir geholfen, es zu verstehen und zu begreifen, dass ich an jenem furchtbaren Tag nicht wusste, was ich tat. Ich weiß jetzt auch, dass meine Erinnerungen an die zwölf wunderbaren Wochen mit Dylan romantisiert sind, weil ich die furchtbare Wut verdrängen wollte, die ich ihm gegenüber empfand. Ich weiß das, weil es das ist, was die Ärzte sagen. Dass meine geheiligten Erinnerungen – die alles sind, was mir von meinem wunderschönen Kind geblieben ist – lediglich das Produkt meines gestörten Gehirns sind, ist für mich schwerer zu akzeptieren als das Wissen, dass ich meinen kleinen Sohn getötet habe. In dunkleren Momenten ertappe ich mich bei dem Wunsch, mich daran erinnern zu können, an den Hass, an meine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben, das ich geboren hatte. Vielleicht würde ich dann für einen Moment Frieden finden, und der Schmerz und die Gewissensbisse, die jeden wachen Moment überschatten, würden für eine Weile nachlassen. Ich hasse mich selbst dafür, dass ich so empfinde; meine Erinnerungen, seien sie echt oder eingebildet, sind das Einzige, was es mir ermöglicht, an der Person festzuhalten, die ich einmal war. Eine Ehefrau und Mutter, ein wenig unorganisiert vielleicht, bestimmt eine furchtbare Köchin, aber niemals, nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen, eine Mörderin.
Auch wenn ich meine Tat akzeptiert habe, erwarte ich keine Vergebung. Ich weiß, dass ich mir selbst nie vergeben werde. Ich bitte nur darum, dass meine Reue bei der Anhörung in Betracht gezogen wird, damit ich versuchen kann, mir ein neues Leben aufzubauen, etwas Gutes in der Welt zu bewirken und anzufangen, das Böse wiedergutzumachen, das ich getan habe.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Susan Webster
Kapitel 1
24. April 2013
Er ist immer noch da.
Egal, wie oft ich den Raum verlasse und versuche, mit meinem normalen Leben weiterzumachen, jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe, ist er da.
Er kam heute Morgen, versteckt unter bunten Werbebriefen und ominös aussehenden Rechnungen. Ich habe sowieso schon einen Horror vor der Post. Sonntag ist mein liebster Wochentag.
Sonntags kommt keine Post. Nur dass heute nicht Sonntag ist. Und heute kam Post.
Ich kann nur vermuten, dass mein Hass auf alles, was in einem Briefumschlag steckt, auf die schiere Menge an Rechnungen zurückzuführen ist, die ich jeden Tag erhalte. Ich bin erst seit einem Monat hier, und offenbar versucht jeder Versorgungsbetrieb im Land, mir irgendetwas in Rechnung zu stellen. Jedes einzelne »An den Bewohner« gerichtete Schreiben, das ich erhalte, gemahnt mich an eine weitere Einzugsermächtigung, die ich noch nicht erteilt habe, und ruft mir auf deprimierende Weise in Erinnerung, wie schusslig ich bin und wie weit meine knapp bemessenen Mittel noch reichen müssen.
Was heute per Post kam, ist allerdings keine Rechnung. Das sehe ich daran, dass der Brief per Hand adressiert wurde. Er stammt nicht von einer Bekannten oder Brieffreundin. Der Umschlag ist postkartengroß und braun. Die Schrift ist klein und flüssig; es sieht aus, als gehöre sie einer Frau, aber sicher kann ich mir da nicht sein. Nichts von alldem ist der Grund dafür, dass der Brief noch immer ungeöffnet auf der Arbeitsplatte meiner Küche liegt.
Ich könnte ihn einfach in den Müll werfen. Oder warten, bis Cassie vorbeikommt und sie den Brief öffnen lassen, wie eine Schülerin, die erst ihre Mutter einen Blick auf das Abschlusszeugnis werfen lässt. Als ich wieder an die Arbeitsplatte trete, sehe ich die Worte auf dem Umschlag, und mein Herz beginnt zu rasen.
Susan Webster, Oak Cottages 3, Ludlow, Shropshire.
Aber Susan Webster ist tot. Ich sollte es wissen; ich habe sie vor vier Wochen umgebracht.
Eigentlich sollte niemand auf der Welt wissen, wo ich bin und wer ich bin. Das war der Grund dafür, dass ich ganz offiziell meinen Namen geändert habe. Selbst meine Bewährungshelferin nennt mich Emma. Manchmal vergesse ich immer noch, darauf zu reagieren. Mein Name, mein neuer Name, lautet Emma Cartwright. Das wird Ihnen nichts sagen. Vor drei Jahren war ich noch Susan Webster. Vielleicht ziehen Sie jetzt leicht die Nase kraus, weil der Name Ihnen irgendwie bekannt vorkommt, Sie ihn aber nicht einordnen können? Kann sein, dass Ihr Blick nach oben und links schnellt, während Sie versuchen, sich zu erinnern. Wenn Sie im Südosten Englands leben, murmeln Sie vielleicht so etwas wie: »Ach ja, war das nicht die, die ihr Baby umgebracht hat? Eine Schande!« Wenn Sie irgendwo anders leben, werden Sie sich vermutlich nicht erinnern. Als es in den Nachrichten kam, war gerade ein A-Promi beim Drogendealen erwischt worden. Mein Sohn und ich schafften es nicht in die Schlagzeilen der überregionalen Presse.
Ich werde es tun. Mit zitternden Händen reiße ich den Umschlag auf und achte dabei darauf, den Inhalt nicht zu beschädigen. Als die kleine Karte herausfällt, überlege ich kurz, ob ich nicht besser Handschuhe anziehen sollte, für den Fall, dass es ein Drohbrief ist und die Polizei ihn als Beweismittel braucht. Einem normalen Menschen mag das seltsam erscheinen, diese Sorge, dass Todesdrohungen in der Post sein könnten. Glauben Sie mir, ich hätte mir auch nie vorstellen können, mich einmal in einer solchen Situation wiederzufinden.
Jetzt ist es zu spät, sich Gedanken über Spurensicherung zu machen. Es ist auch kein Brief, es ist ein Foto. Ein kleiner Junge lächelt breit in die Kamera, ein warmes, echtes, schönes Lächeln. Meine Furcht verwandelt sich in Verwirrung. Wer ist der Junge? Ich kenne keine Kinder dieses Alters; er muss etwa zwei oder drei sein. Ich habe eine Nichte, aber keine Neffen, und die wenigen Mütter und Babys, die ich in Krabbelgruppen getroffen habe, bevor … also, vorher eben … sind weggeblieben. Wahrscheinlich haben sie verdrängt, was geschehen ist, als hätten Dylan und ich nie existiert.
Warum hat man mir das geschickt? Ich überlege, welche Kinder ich kenne, und werfe das Foto auf die Arbeitsplatte. Dabei dreht es sich und landet verkehrt herum, und in diesem Augenblick verengt sich meine Welt auf die Größe des 10 × 14 cm großen Fotos vor mir. Auf der Rückseite stehen drei Worte, in derselben sauberen Handschrift: Dylan – Januar 2013.
Kapitel 2
»Das ist irgendein Streich«, verkündet Cassie und wirft das Foto zurück auf meine Küchenarbeitsplatte. Das war’s? Zwanzig Minuten Warten, während sie schweigend das Foto anstarrte, und dann kommt nichts als ein Streich? Ich hole tief Luft.
»Das ist mir klar, Cass, aber wer kann es gewesen sein? Wer außer dir weiß, dass ich hier bin? Wer würde mich glauben machen wollen, dass Dylan noch am Leben ist?«
Sie wendet den Blick ab, und ich weiß, wen sie im Verdacht hat.
»Mark«, verkünde ich. »Du glaubst, dass es Mark war.«
Als sein Name fällt, beißt Cassie die Zähne zusammen und bemüht sich, nichts zu sagen. Es fällt ihr nicht leicht. Sie schiebt das spitze Kinn vor, und ich glaube, sie beißt sich buchstäblich auf die Zunge. Meine beste Freundin hasst meinen Exmann. Sie mag die meisten Männer nicht, aber Mark steht wohl ganz oben auf der Liste. Ich weiß mit Sicherheit, dass sie ihm ebenso wenig gefallen würde, obwohl sie sich nie begegnet sind.
Vermutlich sollte ich das mit Cassie erklären. Sie ist die beste Freundin, die ich je hatte, die Art Freundin, die ich mir immer gewünscht habe; aber wir kennen einander nicht schon unser ganzes Leben lang. Wir haben uns weder als schüchterne Erstklässlerinnen bei der Einschulung kennengelernt, noch haben wir während des Studiums zusammengewohnt. Als ich Cassie kennenlernte, geschah dies vor einem Hintergrund aus Heulen, Kreischen und Stahltüren, die hinter mir ins Schloss fielen. Sie saß auf dem oberen Bett, das gebleichte blonde Haar locker zu einem Knoten geschlungen, die schmalen schwarzen Augenbrauen zusammengezogen. Sie sprang vom Bett und landete wie eine Katze neben mir – später fand ich heraus, dass sie sich den Knöchel gebrochen hatte, als sie das zum ersten Mal probierte. Die weiten efeugrünen Gefängnishosen hingen locker um ihre vorstehenden Hüftknochen, und ihre Weste, die hochgezogen war, um die milchweiße Taille zu zeigen, hätte aus der Kinderabteilung stammen können. Sie sah aus, als könnte ein starker Windstoß sie umpusten, und doch hatte sie eine enorme körperliche Präsenz, die stärkste, die ich je erlebt habe.
»Das obere Bett gehört mir, aber ich bin keine Bettnässerin wie andere hier, also keine Sorge. Fass meine Sachen nicht an.«
Ich lernte Cassie am einsamsten Tag meines Lebens kennen. Damals wusste ich es noch nicht, ich würde es erst viel später merken, aber sie hat diesen Tag gerettet, sie hat mich gerettet.
Wir sind uns begegnet, weil sie eine Kriminelle ist. Eine Mörderin, wie ich. Aber im Gegensatz zu mir erinnert Cassie sich an jede Sekunde ihres Verbrechens. Sie schwelgt in den Details, sie erzählt die Geschichte, wie Pfadfinderinnen sich Gruselgeschichten am Lagerfeuer erzählen. Sie wird sauer, wenn ich ihr sage, dass ihre Gleichgültigkeit ein »Verteidigungsmechanismus« ist, der sie vor der Erinnerung an ihr Verbrechen schützt. Als ich das zum ersten Mal sagte, nannte sie mich eine Woche lang Freud und weigerte sich, meinen richtigen Namen zu benutzen, bis ich ihr versprach, sie nicht noch einmal zu analysieren. Sie war nie näher daran zuzugeben, dass ich recht haben könnte.
»Gut …« Ich bin gewillt, sie ein Weilchen gewähren zu lassen. »Nehmen wir mal an, es war Mark. Woher sollte er wissen, wo ich wohne? Und warum sollte er mich glauben machen wollen, dass unser Sohn noch lebt?«
Cassie verdreht die blauen Augen himmelwärts. »Er arbeitet im IT-Bereich … oder?«
»Richtig.« Ich nicke bestätigend. »Er ist kein Hacker.«
Sie zuckt lediglich die Achseln, während ich aufstehe, um uns noch einen Tee zu machen. Wenn meine Hände nicht mit irgendwas beschäftigt sind, zittern sie.
»Und warum? Warum sollte mein Exmann, der zum Hacker geworden ist, mir das Foto eines kleinen Jungen schicken, der, wie wir alle wissen, unmöglich mein toter Sohn sein kann?«
»Vielleicht weil er ein Arschloch ist? Oder um die emotionale Last, die du bereits trägst, um eine zusätzliche Ladung Schuldgefühle zu bereichern? Oder weil er will, dass du an deinem Verstand zweifelst? Vielleicht soll ›Januar 2013‹ ja nicht bedeuten, dass es sich bei dem Jungen um Dylan handelt, sondern dass er jetzt so aussehen könnte, wenn du ihn nicht … also, wenn er nicht, du weißt schon …«
»Ich weiß.«
»Hast du deine Bilder von Dylan noch? Die in dem Fotoalbum, das dein Vater dir gegeben hat?«
»Ja, irgendwo«, entgegne ich abwesend. Die werde ich nicht hervorkramen. »Ich glaube nicht, dass Mark es gewesen sein kann.«
Nach dem Tod unseres Sohnes war er am Boden zerstört – wie es jeder Mann gewesen wäre –, aber er bemühte sich, zu mir zu stehen. Zweimal hat er mich sogar in Oakdale besucht. Beide Male zitterte er wie ein scheißender Hund und konnte es kaum ertragen, mich anzusehen, aber es war gut zu wissen, dass er versuchte, mir zu vergeben. Dann hörten die Besuche auf, einfach so. Ein paar Wochen später erhielt ich ein Schreiben, mit dem ich darüber unterrichtet wurde, dass er die Scheidung eingereicht hatte, zusammen mit einer kurzen handschriftlichen Notiz von Mark: »Es tut mir leid.« Daraufhin bastelte Cassie ein Dartboard aus meinen Fotos von ihm und ging dazu über, sie mit nassen Papierhandtüchern zu bewerfen, um mich aufzuheitern. Dartpfeile waren in Oakdale nicht erlaubt. Wir durften nicht einmal gespitzte Bleistifte haben.
»Es ist also nur ein Streich.« Ich versuche, mich selbst davon zu überzeugen. »Keine Drohung. Nur dass das Wort ›Streich‹ einen an etwas Lustiges denken lässt, was das hier jedenfalls nicht ist.«
»Dann eben ein übler Streich, oder wie sagt man beim Betrugsdezernat? Ein Schwindel.« So ist Cassie, wenn sie beschließt, dass sie recht hat. Ihre langen, blau lackierten Fingernägel trommeln einen Rhythmus auf dem Tisch – sie braucht eindeutig eine Zigarette. Diese Nägel sind für mich ein Symbol für die komplette Veränderung, die Cassie nach dem Verlassen von Oakdale durchgemacht hat. Als ich sie kennenlernte, waren die Nägel, mit denen sie ungeduldig auf dem Tisch trommelte, abgekaut und bedeckt mit altem, abblätterndem Nagellack. Diese Nägel sind längst verschwunden, zusammen mit den kurzen Jeansröcken und bauchfreien Tank Tops. Heute bedeckt Cassies Kleidung ihre Haut, und ihre Nägel sind immer gepflegt.
»Ein übler Scherz, ja, natürlich«, entgegne ich abwesend. »Es muss ein Scherz sein. Eindeutig keine Drohung.«
*
Ich werde Cassie los, indem ich vorgebe, noch Besorgungen machen zu müssen. Sie weiß, dass das gelogen ist, akzeptiert den Wink aber fraglos und küsst mich zum Abschied, wobei sie einen rosa Lippenabdruck auf meiner Wange und ein Stück unscheinbares nasses Küchenpapier in der Spüle hinterlässt.
Zum hundertsten Mal drehe und wende ich den Umschlag in den Händen, als mir etwas auffällt, das mir einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Auf dem Umschlag ist keine abgestempelte Briefmarke. Der Brief muss schon auf meiner Fußmatte gelegen haben, bevor die Post kam. Wer immer es war, er war bei meinem Haus, stand vor meiner Tür und hat das Foto leise durch den Briefschlitz geworfen, während ich in der Küche war. Bei dem Gedanken wird mir übel, und ich presse die Hand auf den Mund. Es ist keine Drohung. Als Drohung macht es keinen Sinn. Wenn es eine Drohung sein soll, taugt sie nicht viel. Es wird ja mit nichts gedroht. Es ist nur eine subtile Warnung: Jemand kennt meinen Namen. Jemand weiß, wer ich bin. Was ich getan habe. Und dieser Jemand stand vor meiner Haustür.
Ich kann nicht länger stark sein. Mein Kampfgeist hat mich verlassen, und ich sinke auf den kalten Küchenfußboden und fange an zu weinen.
Kapitel 3
Jack: 23 September 1987
Ein Tritt ging ins Gesicht des Jungen, ein Schuhabsatz wurde ihm in die Rippen gerammt. Der Junge rollte sich zu einem Ball zusammen und stieß ein Grunzen aus, aber – wie Jack mit widerstrebendem Respekt beobachtete – es kamen keine Tränen. Als sie das Blut sahen, trat Riley einen Schritt vor, doch Jack packte ihn am Arm – es war noch zu früh. In einer Minute oder so, nach ein paar Blutergüssen mehr, vielleicht einer gebrochenen Rippe. Von seinem Standpunkt aus, etwa zwanzig Fuß entfernt, an eine der kackbraunen transportablen Hütten gelehnt, wirkte das Schlagen und Treten fast wie choreographiert, hypnotisierend. Als Jack das Knacken hörte – es klang, als würde ein Zweig brechen –, und das Grunzen verstummte, stellte er sich aufrecht hin, strich über den Ärmel seines Pullovers und bedeutete Riley, ihm dorthin zu folgen, wo der Spaß vor sich ging.
»Lasst ihn sofort los!«
Alle drei Jungen hörten auf, obwohl einer seinen Fuß auf dem gebrochenen Handgelenk des Fünfzehnjährigen stehen ließ – als könnte er sonst verschwinden.
»Scheiße, was geht euch zwei das an?« Junge Nummer 1 – Jack hatte keine Ahnung, wer sie waren – machte eine Geste, als würde er einer imaginären Ziege vor sich einen Kopfstoß verpassen. Verfickter Idiot.
»Was hat er gemacht?«
»Harris verpfiffen.« Junge 2, der, dessen Fuß auf dem Handgelenk seines Opfers stand, trat noch einmal fester zu. »Stimmt doch, Shakespeare, oder?«
»Ich war’s nicht«, murmelte das blutige Kleiderbündel auf dem Boden.
»Wer war’s dann?«, wollte Junge 3 wissen – Harris, so wie es aussah. Er war der Größte der drei, aber nach dem, was Jack beobachtet hatte, hatte er am wenigsten Schaden angerichtet. Vielleicht machte er sich ungern die Kleidung schmutzig. Ergab Sinn.
»Null Ahnung. Ich nicht.«
»Verlogene kleine Schlange.« Junge 2 wollte wieder zutreten. Binnen Sekunden war Jack neben ihm, packte ihn an seinem bordeauxroten Blazer und stieß ihn weg.
»Hände weg, hab ich gesagt. Er hat dich nicht verpfiffen. Er sagt die Wahrheit. Er war’s nicht.«
»Ach ja – und woher willst du das wissen?«
»Ich weiß alles, du Idiot. Wenn du wissen willst, wer dich verpfiffen hat, frag Mike Peterson.«
Harris kniff die Augen zusammen, ebenso wie Riley, der neben Jack stand. »Sicher?«
»Ich bin mir sicher. Und noch eins.« Er wies auf den Jungen auf dem Fußboden. »Der gehört ab jetzt zu mir. Wenn du Probleme mit ihm hast, komm zu mir. Wenn ich dich je wieder dabei erwische, dass du ihn anrührst, lasse ich dir die Beine brechen – euch allen. Kannst ja mal sehen, was dann aus deiner Rugbykarriere wird, Harris, du Rindvieh.«
Er hielt den Atem an und achtete darauf, dass sein Kiefer sich nicht bewegte. Harris wandte sich wieder seinen Schlägern zu und bedeutete ihnen mit einer Kopfbewegung, sie sollten verschwinden. Die drei schlenderten davon, als hätten sie nicht mehr getan, als ein Fußballspiel zu beenden.
»Alles okay?« Riley zog den Jungen in die Hocke hoch und achtete dabei darauf, dass sein Kopf unten blieb. Das schulterlange braune Haar des Jungen war mit einer glänzenden Mischung aus Fett, Schweiß und Blut bedeckt. Er versuchte, zu Jack aufzusehen, der vor ihm stand, doch dann krümmte er sich vor Schmerzen und schaute wieder auf den Fußboden.
»Warum hast du ihnen das gesagt?« Die Worte waren kaum verständlich, seine Lippen begannen bereits anzuschwellen. »Peterson … war es nicht. Ich war’s.«
»Ich hab sie davon abgehalten, dir die Scheiße aus dem Leib zu prügeln, oder nicht? Soll ich sie zurückrufen? Ihnen sagen, dass ich mich geirrt habe?« Er schaute in die Richtung, in der die drei verschwunden waren, wohl wissend, dass sie längst weg waren. »Harris! He, Harris!«
»Nein, tut mir leid, ich hab’s nicht so gemeint.« Der Junge verzog vor Schmerz das Gesicht.
»Lieber Himmel, du bist ja in einem schönen Zustand. Komm, ich bring dich zu mir nach Hause – meine Eltern sind nie da, und Lucy kann dich verarzten. Sie war früher Krankenschwester.«
»Wer ist Lucy?«
»Die Haushälterin. Ich hab Terz gemacht, als es hieß, dass sie mit uns im Haus wohnen würde, weil ich wusste, dass sie ein Auge auf mich haben sollte, aber sie ist eigentlich ganz in Ordnung – sie ist erst achtzehn und hat Riesentitten, und sie macht saugute Snacks. Ich bin Jack, und das ist Matt. Warum haben die dich Shakespeare genannt? Ist das dein Spitzname?«
Der Junge versuchte, trotz des Blutes in seinem Gesicht finster dreinzuschauen. »Nein. Ich hasse ihn. Ich hatte in der Englischarbeit eine 1, und Miss Bramall hat gesagt, ich sei ja ein kleiner Shakespeare. Jetzt nennen mich alle so. Ich bin –«
»Mir gefällt’s«, unterbrach Jack ihn. »Es klingt, als hättest du etwas auf dem Kasten, und ich mag Leute, die etwas auf dem Kasten haben. Ich kann dich ja Billy nennen, wenn du magst, Abkürzung für William, ein kleiner Witz unter uns. Wir sind doch jetzt Kumpel, oder?«
»Warum willst du mein Freund sein? Ich bin nicht wie du und deine Clique.«
»Ach ja? Wie ist meine Clique denn so?«
»Reich. Und, na ja … gut aussehend und so.«
Jack schaute Matt an, und beide begannen zu lachen. »Bist du schwul, Shakespeare? Scharf auf meine Freunde, oder was?«
»Nein! So habe ich es nicht gemeint. Ich wollte nur –«
Jack schnaubte. Du liebe Güte, war der Typ wirklich dermaßen treudoof? Aber er würde schon für irgendwas von Nutzen sein.
»Na komm, gehen wir und säubern dich.«
Kapitel 4
Wie an den meisten Samstagen ist die Stadt gedrängt voll. Jugendliche, Paare und Mütter, die ihre mürrischen, quengelnden Kleinkinder hinter sich herzerren, besuchen die wenigen Geschäfte, die wir noch haben. »Die Rezession hat die Stadt hart getroffen«, erklärt Rosie Fairclough mir, während sie mir ein Riesenstück klebrigen, warmen Schokoladenkuchen serviert. »Wir brauchen mehr junges Blut wie Sie, das wieder Geld in die Stadt bringt.«
Fast hätte ich laut gelacht. Die neugierige Rosie wäre sicher ganz anderer Meinung, wenn sie eine Ahnung hätte, wer da in ihre verschlafene Kleinstadt gezogen ist. Da hätte der Landfrauenverband doch wirklich mal was zu klatschen.
Ich mache mich über den Schokoladenkuchen her, ein wenig zu gierig, und riskiere dabei einen verstohlenen Blick zum Fenster hinaus. Nichts als Straßen mit Kopfsteinpflaster und Leute, die ihre Wochenendeinkäufe erledigen. Ich schüttle den Kopf, komme mir albern vor und versuche, mir in Erinnerung zu rufen, dass ich nicht in einem Low-Budget-Spionagefilm lebe. Niemand beobachtet mich. Ich muss versuchen, alles zu vergessen, was heute Morgen geschehen ist, den dummen Streich, daher wende ich meine Aufmerksamkeit den anderen Gästen zu.
Eine Frau sitzt in der Nähe des Tresens und spielt gedankenverloren mit einem Stück Möhrentorte herum, ohne dabei zuzulangen, wie ich es gerade getan habe. Sie ist ungefähr so alt, wie meine Mutter jetzt wäre, allerdings wirkt sie nicht so, als müsste sie sich Gedanken um ihre Figur machen, und ihre Miene lässt vermuten, dass sie Sorgen hat. Ihr langes blondes Haar fällt ihr ins Gesicht, als sie auf die Zeitung vor sich starrt, und sie macht sich nicht die Mühe, es zurückzustreichen. Ich ertappe mich bei der Überlegung, was für eine Geschichte wohl bei ihr dahintersteckt. Streit mit dem Liebhaber? Ein Ehemann auf Abwegen? Oder etwas viel Schlimmeres?
Fast so, als hätte ich sie gerufen, blickt sie unvermittelt auf und ertappt mich dabei, wie ich sie anstarre. Peinlich berührt lasse ich meinen Blick zur Tür gleiten; es ist mir unangenehm, dass ich beim Gaffen erwischt wurde. »Nicht die Leute anstarren, Schätzchen«, pflegte meine Mutter zu sagen. »Das ist unhöflich.«
»Na, das hat ja nicht lange vorgehalten.« Rosie sieht, dass ich meinen Schokoladenkuchen schon verdrückt habe, und lächelt. »Möchten Sie noch ein Stück?«
O Gott, ja.
»O Gott, nein.« Ich lache ein wenig zu laut. Ich musste schon immer gegen mein inneres dickes Mädchen ankämpfen; Essen ist mein Trost. Wenn ich je das Essen verweigerte, pflegte meine Mutter meinen Vater anzusehen und zu flöten: »Oh-oh, Len, ich glaube, wir haben da ein Problem.« Sie zog mich damit auf, obwohl es ihre Schuld war, dass wir eine Familie von Genießern waren. Ihre selbst zubereiteten Mahlzeiten, besonders die Desserts, brachten meine Freundinnen dazu, für eine Essenseinladung Schlange zu stehen, und meine Pausenbrotdose war der Neid meiner Klassenkameraden. Biskuitrollen, Zitronenkuchen mit Guss, Himbeer-Baiser-Torte – ich war wie die Grundschulversion eines Crackdealers. Sehr zum Leidwesen meines Mannes konnte ich nie an die kulinarischen Fähigkeiten meiner Mutter heranreichen, und er musste sich mit einem verflixt guten Sonntagsessen einmal in der Woche zufriedengeben. »Meine Hüften würden mir das nie verzeihen«, sage ich. »Rosie, könnte ich Sie mal etwas fragen?«
Die Augen der älteren Frau leuchten auf, als hätte ich sie gefragt, ob es ihr etwas ausmachen würde, wenn ich ihr ein Gewinnlos im Mittwochslotto überließe. Rosie ist praktisch der Informationsdienst hier in der Stadt.
»Ich habe mich nur gefragt, wie die Leute hier in der Gegend so sind. Gibt es viel Ärger?«
Rosie schüttelt den Kopf. »Oh nein, Liebchen, also, samstags gelegentlich eine Prügelei unter Jugendlichen, aber sonst nicht viel. Warum, haben Sie Probleme mit irgendjemandem?«
Sofort bereue ich meine Frage. Mir war klar, dass Rosie eine Klatschbase ist, aber jetzt frage ich mich, ob sie das Zeug dazu hat, das nächste Puzzleteil aktiv ausfindig zu machen. Wird sie ins Internet gehen, sobald ich weg bin, um Nachforschungen über Emma Cartwrights geheime Vergangenheit anzustellen? Ach, Paranoia, meine alte Freundin, wie habe ich dich in der letzten Stunde vermisst.
»Ach, es ist eigentlich nichts«, lüge ich mühelos. »Heute Morgen lag ein Ei vor meiner Haustür, und da habe ich mich gefragt, ob die Einheimischen es vielleicht nicht so gern sehen, wenn Fremde zuziehen.«
Rosie wirkt enttäuscht. »Ach, das werden irgendwelche Kinder gewesen sein«, versichert sie. »Es ist hier nicht so wie in manchen Kleinstädten, wissen Sie, wo jeder alles über alle weiß. Wir kümmern uns eher um uns selbst. Ich würde mir deswegen keine Gedanken machen.«
»Nein, natürlich«, erwidere ich, erleichtert darüber, dass meine kleine Notlüge keine weiteren Nachfragen ausgelöst hat. »Genau das habe ich mir auch gedacht: nur ein dummer Streich.«
*
Das große Stück Schokoladenkuchen liegt mir schwer im Magen, als ich das Café verlasse, und Rosies Worte schwirren mir im Kopf herum: Hier ist es nicht wie in manchen Kleinstädten, wissen Sie, wo jeder alles über alle weiß. Bevor ich Oakdale verließ, wurde ich darauf vorbereitet, dass die Leute feindselig reagieren könnten, sollten sie herausfinden, wer ich bin. Auf Fackeln und Mistgabeln war ich vorbereitet; Stalking und psychologische Spielchen habe ich jedoch nicht erwartet. Denn blöder Witz hin oder her – Tatsache bleibt, jemand kennt meinen alten Namen. Was bedeutet, jemand weiß, was ich getan habe.
Die Glocke über der Tür des Feinkostgeschäfts am Markt bimmelt, als ich eintrete. Die Gourmetstadt Ludlow kann sich rühmen, mit die besten frischen, regionalen Delikatessen in ganz Shropshire zu haben, und jedes Jahr im September findet hier ein Feinschmecker-Festival statt. Das dicke Mädchen in mir liebt Ludlow einfach.
»Emma, wie schön, Sie zu sehen.« Carole strahlt, als sie mich in der Tür stehen sieht. »Wie geht’s?«
»Besser, wenn ich erst eine Schachtel von Ihrem Camembert und etwas von dem Krustenbrot habe.«
Carole verschwindet kurz und kehrt mit einer braunen Papiertüte zurück. Als sie die Tüte über den Ladentisch reicht, fühlt sie sich noch warm an, und der Duft von frischgebackenem Brot steigt mir in die Nase.
»Ich nehme noch eine Flasche Wein dazu.« Carole hebt die Augenbrauen. »Gibt’s was zu feiern?«
Ich lächle gezwungen. »Eher eine Art Frustessen. Vielleicht erzähle ich Ihnen irgendwann davon.«
Sie ist höflich genug, nicht weiter in mich zu dringen. Wir nennen uns beim Vornamen, seit ich ihr Feinkostgeschäft entdeckt habe, aber wir sind weit davon entfernt, Freundinnen zu sein. Ich glaube, ich werde mich nie mit jemandem anfreunden können, der meine Vergangenheit nicht kennt. Es ist einfach zu riskant.
»Lassen Sie es sich schmecken.« Sie nimmt mein Geld entgegen, und ich wage mich wieder auf die Straße hinaus. Mein Kopf rät mir, nach Hause zu gehen und das Foto zu vernichten, zu vergessen, dass es dieses Foto je gegeben hat, doch als ich mich auf den Nachhauseweg machen will, entdecke ich etwas Unmögliches. Vor mir geht eine Frau, sie ist schlank und hat lange, dunkle Haare. Sie beugt sich hinab, um den kleinen Jungen neben sich an die Hand zu nehmen. Den kleinen Jungen, der mich vorhin aus dem Foto heraus angestrahlt hat. Meinen Sohn.
*
Ich bemühe mich verzweifelt zu rufen, doch es schnürt mir den Atem ab. Stattdessen mache ich ein paar ruckartige Schritte vorwärts, und dann fange ich an zu laufen.
»Dylan!«, schreie ich. Er kann es nicht sein, das ist völlig unmöglich, und doch ist er hier, nach all diesen Jahren. Bei seinem Anblick möchte ich am liebsten auf die Knie fallen. Wie kann es sein, dass mein Sohn mir so nahe ist, nachdem er so lange so weit entfernt von mir war?
Ein paar Leute drehen sich nach mir um, aber mein Sohn und seine Entführerin schauen nicht zurück. Es könnte Einbildung sein, aber mir scheint, dass sie ihre Schritte beschleunigt. Jedoch nicht schnell genug; es dauert nur Sekunden, bis ich sie eingeholt habe.
»Dylan.« Ich bücke mich, um den kleinen Jungen am Arm zu packen, und erwische seine marineblaue Jacke. Adrenalin schießt durch meine Brust, als die Frau zu mir herumfährt.
»Was zum Teufel machen Sie da? Lassen Sie meinen Sohn los!«
Sie hebt ihn hastig hoch, und ich muss seine Jacke loslassen, als die Frau vor mir zurückweicht. Ihr Gesicht ist verzerrt vor Angst und Zorn.
»Das ist mein Sohn, Dylan, er ist mein …« Ich verstumme, als mich die Erkenntnis trifft wie ein Schlag. Das ist nicht mein Sohn. Mein Sohn ist tot, fort, und dieser kleine Junge klammert sich am Hals seiner Mutter fest, steif vor Angst wegen der verrückten Frau, die sie anschreit. Plötzlich sieht er überhaupt nicht mehr aus wie der Junge auf dem Foto; er ähnelt weder mir noch Mark noch sonst jemandem aus unserer Familie. Dieser kleine Junge gehört genau dahin, wo er ist: in die Arme seiner Mutter. Ich zögere und trete einen Schritt zurück. Am liebsten würde ich weglaufen, doch meine Beine gehorchen mir nicht. Als die Frau erkennt, dass ich nicht länger eine Bedrohung für sie oder ihr Kind darstelle, geht sie auf mich los.
»Sind Sie verrückt? Wie können Sie es wagen, meinen Sohn anzufassen? Ich sollte die Polizei rufen, Sie verdammte Irre!«
»Es tut mir leid, ich …« Ich finde keine Worte. Ich würde es gern erklären, aber wie? Wie beschreibt man Arme, die sich immer leer anfühlen? Ein Herz, das wegen des Verlustes schmerzt? Augen, die an jeder Straßenecke tote Kinder sehen? Wie soll man irgendjemandem, geschweige denn einer Fremden auf der Straße, begreiflich machen, wie es ist, das Kind zu verlieren, das man in seinem Leib getragen hat?
»Das will ich auch hoffen! Sie sind ja verrückt.« Erst als sie meinen Arm wegschlägt, merke ich, dass ich immer noch die Hand ausgestreckt hatte.
»Sie hat gesagt, dass es ihr leidtut.« Die Worte kommen von hinten, die Stimme klingt kräftig und vertraut. »Sie hat einen Fehler gemacht. Vielleicht sollten Sie ihre Entschuldigung annehmen und Ihrer Wege gehen.«
Erleichterung durchflutet mich, als es mir endlich gelingt, mich umzudrehen, und ich meine Retterin sehe. Carole. Ich höre die Frau hinter mir noch einmal grummeln, dass ich ja verrückt sei, aber dann höre ich Schritte, und sie ist fort.
»Danke.« Ich schaue die Leute an, die stehen geblieben sind, um das Spektakel zu verfolgen. »O Gott.«
»Vergessen Sie die.« Carole ergreift sanft meinen Arm. Sie erhebt die Stimme und richtet ihre nächsten Worte an die Umstehenden. »Die haben nichts Besseres zu tun.«
Einige wirken beschämt, eine Frau zuckt die Achseln, und eine Gruppe von Jugendlichen kichert höhnisch, aber alle entfernen sich.
»Geht’s wieder?«, fragte Carole mich sanft. Tut es nicht, und ihre Freundlichkeit lässt mir Tränen in die Augen steigen. Ich schniefe und nicke.
»Es wird gleich wieder, es war nur ein albernes Missverständnis. Warum sind Sie mir nach draußen gefolgt?«
Carole hält mir ein Stück Papier hin. »Das ist Ihnen aus der Tasche gefallen, als Sie Ihr Portemonnaie herausgeholt haben.«
Ich habe es noch nie gesehen, strecke aber automatisch die Hand danach aus. Es ist ein Zeitungsausschnitt, und als ich näher hinsehe, erkenne ich es. Mein Baby starrt mich von einem Schwarz-Weiß-Foto an, einem Foto, das ein paar Tage nach der Geburt aufgenommen wurde. Die Überschrift fehlt, aber ich erinnere mich noch, wie sie gelautet hat. KINDSMÖRDERIN BEKOMMT SECHS JAHRE.
»Das kann unmöglich …« Ich will abstreiten, dass dieses Foto in meiner Handtasche gewesen sein könnte, doch Caroles besorgter Blick lässt mich verstummen. Wo sollte der Ausschnitt sonst herkommen? »Ich meine, ja, das gehört mir. Danke. Nochmals vielen Dank.«
»Sind Sie sicher, dass Sie okay sind?«
Ich nicke wieder, diesmal entschiedener. »Ja. Danke, Carole, aber jetzt muss ich los. Entschuldigen Sie mich.«
Carole sieht aus, als wollte sie noch etwas sagen, überlegt es sich dann aber anders. Gott sei Dank.
»Sie wissen ja, dass ich nur ein paar Häuser entfernt wohne, falls Sie mich brauchen sollten, Emma.«
Ich nicke wieder, und dann wird mir klar, was sie da gerade gesagt hat. »Entschuldigung, Sie tun was?«
Sie wirkt verlegen. »Tut mir leid, ich dachte, Sie wüssten, dass wir in derselben Straße wohnen.«
Nein, das wusste ich nicht. Wie konnte mir das entgehen? Wandere ich seit vier Wochen herum, ohne irgendetwas oder irgendjemanden um mich herum wahrzunehmen? Nun, Carole hat mich jedenfalls gesehen … Wer hat mich sonst noch beobachtet?
»Emma? Sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist? Sie sehen ein wenig krank aus.«
Nie habe ich dringender jemanden gebraucht als gerade jetzt, doch dies ist weder die Zeit noch der Ort, eine Fremde in mein Leben einzuladen. Nicht mal dann, wenn diese einen Käse- und Weinladen führt. Was sollte ich auch zu meiner neuen Freundin sagen? »Ach, heute Morgen hat jemand entdeckt, dass ich eine Mörderin bin, und jetzt habe ich Halluzinationen, sehe meinen toten Sohn und trage Fotos von ihm mit mir herum, ohne es zu wissen. Also, ich könnte wirklich eine Tasse Tee gebrauchen. Bei mir oder bei dir?«
»Nein, mir geht’s gut«, versichere ich stattdessen. »Vielen Dank noch mal.«
Kapitel 5
Die Stadtbibliothek ist gähnend leer, sogar für einen Samstag. Ich war ziellos durch die Stadt gestreift, den Zeitungsausschnitt so fest umklammert, dass die Druckerschwärze auf meine Finger abfärbte, bis ich irgendwann in eine Seitenstraße einbog und auf dieses große Steingebäude stieß.
Als ich an die Information trete, blickt die streng aussehende Frau, die dahinter sitzt, nicht einmal hoch. Auf ihrem Namensschild steht »Evelyn«.
»Ja?«, fragt sie, den Kopf in dem gewaltigen Bibliothekskatalog vergraben, der vor ihr liegt, sodass ich auf ihre graue Mähne starre.
»Ähm, ich hätte gern einen Ausweis.« Als die Frau meine Stimme hört, blickt sie überrascht auf.
»Oh, entschuldigen Sie, meine Liebe«, lächelt sie, und ihre grimmige Miene verwandelt sich und wird freundlich. Sie senkt die Stimme. »Ich dachte, es wäre wieder der Typ da drüben.« Sie weist mit dem Kopf auf einen ziemlich seltsam wirkenden Mann mit weichem Filzhut und grüner Wachsjacke, der in der Ecke sitzt und entschlossen auf einen der Computerbildschirme starrt. »Er beschwert sich ständig über unsere Internet-Filter. Ich habe direkt Angst, zu ihm rüberzugehen, um zu sehen, was er aufrufen möchte. Das hier ist eine Bibliothek, Herrgott noch mal, kein bescheuerter Porno-Kongress.«
Unwillkürlich entschlüpft mir ein kurzes Lachen, so absurd ist es, dass diese ältere, reserviert wirkende Dame in einer Bücherei das Wort »Porno« laut ausspricht. Sie lächelt wieder.
»Entschuldigen Sie, meine Liebe, was wollten Sie noch mal – einen Leseausweis?«
Zehn Minuten später sitze ich vor einem Computer – so weit entfernt von dem Mann mit dem weichen Filzhut wie irgend möglich – und stelle fest, dass meine Finger die Worte »Dylan Webster« eingeben.
Ich war immer auf Recherchen angewiesen. Der kleine Raum, der in Oakdale als Bibliothek bezeichnet wurde, war nichts verglichen mit dem hier. Ein paar Monate lang wusste ich gar nichts von seiner Existenz. Ich hatte Wochen damit zugebracht, die Wände meines Zimmers anzustarren, während Cassie tat, was sie konnte, um das teilnahmslose Etwas, das zu ihr ins Zimmer gesteckt worden war, in ein Gespräch zu verwickeln. Eines Nachmittags kam sie nach ihrer Schicht in der Kantine zu mir und packte mich am Handgelenk. Das war’s, dachte ich. Sie hat die Geduld mit mir verloren; jetzt wird sie mich endlich angreifen. Vielleicht überlebe ich es ja nicht. Dann werde ich endlich bei Dylan sein.
»Hier«, sagte sie und bog meine Finger auseinander. »Nimm die und komm mit.«
Ich sah nach, was sie mir in die Hand gedrückt hatte. Drei glänzende Silbermünzen; in der wirklichen Welt zu nichts nutze, höchstens als Spielgeld für Kinder, doch in Oakdale wertvoller als Goldbarren. Unsere Version von Geld, verdient durch harte Arbeit und gutes Betragen. Die Silbermünzen verschafften einem drinnen bestimmte Annehmlichkeiten – Zigaretten, neue Unterwäsche, Zeitschriften – sowie Zugang zu den Luxusbereichen wie dem Fitnessraum. Oder der Bibliothek. Cassie zog mich auf die Füße, und ich ließ mich aus unserem Zimmer führen, die Flure mit Stahlfußboden entlang zum Gemeinschaftsflügel. An einer Tür links vom Gemeinschaftsraum, die mir nie zuvor aufgefallen war, hing das Schild mit der Aufschrift »Bibliothek«. Über einem rechteckigen Schlitz neben der Tür stand »drei Münzen, Zugang für einen halben Tag«, und es gab einen Schlitz für die Zugangskarten. Cassie holte meine Karte aus ihrer Tasche – Gott weiß, wann sie die geklaut hatte, anfangs hatte ich meinen Besitz noch eifersüchtig bewacht –, führte sie ein und fütterte den Schlitz mit drei Münzen.
»Na los. Ein halber Tag.« Sie schob die Tür auf und versetzte mir einen leichten Schubs. »Geh und informier dich über dieses Purpur-Dings, über das Dr. Shaky in der Therapie ständig schwafelt.«
»Puerperal«, murmelte ich, unfähig, das auszusprechen, was ich wirklich sagen wollte. »Puerperalpsychose.«
»Ja, hab ich doch gesagt. Wenn du wieder rauskommst, kannst du mir vielleicht schon alles darüber erzählen.«
In dieser dunklen, stillen Höhle mit insgesamt dreiunddreißig Bücherregalen und zwei Computern mit Internetanschluss, die jedoch mit einem so restriktiven Filter ausgestattet waren, dass man von Glück sagen konnte, wenn man mehr fand als Bilder von flauschigen Häschen, lernte ich alles, was ich über die Krankheit wissen musste, unter der ich gelitten hatte. Je mehr ich mit Cassie über das sprach, was ich erfuhr, desto mehr Sinn ergab alles: die Auswirkung der In-vitro-Fertilisation auf meinen Geisteszustand, der Kaiserschnitt, der traumatisch genug sein konnte, um eine Frau in die Tiefen postnataler Depression zu treiben, meine Erschöpfung und Vergesslichkeit, die Gereiztheit, die ich auf Schlafmangel zurückgeführt hatte.
Bilder, die ich so angestrengt bemüht habe, vor mir selbst zu verbergen, sickern wie Wasser durch Felsen. Das Aufwachen in einem Krankenhausbett, nicht allmählich, sondern abrupt, meine weit aufgerissenen Augen.
»Das Baby, Hilfe! Mein Baby!« Das Zimmer ist leer, ich bin allein, und als ich versuche, mich aufzusetzen, erhebt mein Bauch hitzigen Protest. Was ist mit mir passiert? Was ist mit meinem Baby geschehen?
»He, he, nicht bewegen.« Binnen Sekunden ist Mark an meiner Seite, und sein Daumen drückt auf den Rufknopf neben meinem Bett. »Es ist alles gut, Schatz, nicht aufsetzen.«
»Das Baby, Mark, geht es dem Baby gut?« Ich presse die Hände auf die harte Wölbung meines Bauchs, und ein kleines Flattern darin versichert mir, dass alles in Ordnung ist. Es ist warm und tröstlich, und ich stoße den Atem aus, den ich angehalten habe.
Es riecht nach antibakteriellem Handwaschgel, ein Geruch, der mich immer noch an Krankheit und Krebs erinnert, an den langsamen Verfall meiner Mutter. Mark lächelt, doch bevor er etwas sagen kann, steht eine dritte Person im Zimmer, eine Frau. Ihr dunkelblondes Haar ist nachlässig hochgebunden, den Rest ihres Gesichts nehme ich nicht wahr.
»Ihm geht’s gut, dem Baby geht es gut«, flüstert Mark. Sein Lächeln wird breiter, als gäbe es etwas, was ich wissen müsste, was ich verstehen sollte, aber ich verstehe nicht.
»Er erholt sich gut, alles in allem. Sie können ihn sehen, nachdem der Arzt bei Ihnen war.«
»Wovon reden Sie?« Wieder drücke ich die Hand auf meinen Bauch. »Hatte ich noch eine Ultraschalluntersuchung? Hat die ergeben, dass es ein Junge ist?« Was stimmt hier nicht?
Marks Worte sind sanft und tröstend. »Die Wehen haben eingesetzt, erinnerst du dich, mein Schatz? Es gab ein Problem mit dem Baby, sie mussten dich unter Narkose setzen. Erinnerst du dich nicht? Du hast gesagt, dass es okay ist, du hast dein Einverständnis gegeben.«
Du hast dein Einverständnis gegeben. Warum redet mein Mann wie ein Rechtsanwalt aus einer Fernsehserie? Was redet er da? Warum schaut diese Frau mich so voller Mitgefühl an?
»Es stand auf Messers Schneide, meine Liebe. Das Baby hat nicht gut reagiert. Wir mussten es so schnell wie möglich holen. Aber es geht ihm gut, er erholt sich. Ich hole jetzt besser mal den Arzt.«
»Der Junge ist wunderschön, Susan. Ich bin so stolz auf dich. Willst du mal sehen?« Mark zückt sein Handy und zeigt mir ein Foto des winzigsten Babys, das ich je gesehen habe. Warum zeigt er mir das? Sicher will er doch nicht behaupten …
»Mark.« Mein Ton ist härter geworden. Er muss aufhören, Unfug zu reden, mir blöde Fotos zu zeigen und zu grinsen wie ein Idiot. »Was geht hier vor? Wessen Baby ist das?«
Ich sehe, wie sein Gesicht ernst wird und die Fältchen in den Augenwinkeln – seine glücklichen Fältchen, wie ich sie nenne – verschwinden. »Susan, das ist unser Baby. Du hattest einen Kaiserschnitt, und unser Sohn wurde geboren. Hier ist er.«
Wieder hält er mir das Handy hin, und ich spüre, wie die Welle von Wut und Verwirrung an die Oberfläche schwappt. Ich schlage es ihm aus der Hand. Es kommt unerwartet, er hält es nur locker, und so fliegt es ihm aus der Hand und kracht gegen die Wand.
»Hör auf, mir das zu zeigen! Das ist nicht mein Baby! Mein Baby ist hier drin, ich kann es fühlen!«
»Herr im Himmel, Susan.« Mark springt auf, um sein kostbares iPhone zu holen, und dreht sich dann zu mir um, das Gesicht gerötet, die Augen zusammengekniffen. »Was sollte das denn? Du müsstest dich mal reden hören. Das ist unser Baby, dein Baby.«
Er lügt. Ich würde es wissen, ich würde es wissen, wenn ich ein Kind geboren hätte! Er hätte meine Hand gehalten, während ich presste und laut schrie, ich hätte mein Baby schreien hören, ich hätte es auf meiner Brust liegen fühlen. Ich würde es wissen.
»Du irrst dich. Das ist nicht mein Baby. Das ist nicht mein Baby!«
Es erforderte drei Krankenschwestern, einen Arzt und eine hohe Dosis Sedativa, um mich zu beruhigen, und erst vier Stunden nach meinem Aufwachen bekam ich das Baby zu sehen, das angeblich mein Baby war. Als ich in den kleinen Plastikkasten starrte, den sie mir ins Zimmer schoben, verspürte ich keine Verbindung zwischen dem kleinen Jungen vor mir und dem Leben, das ich die letzten acht Monate so sorgsam in mir hatte wachsen lassen. Ich fühlte mich beraubt, als hätten diese Leute mir die kostbaren ersten Augenblicke mit meinem Sohn gestohlen. Ich durfte ihn halten, die Schwestern machten Fotos und gaben ermutigende Laute von sich, und ich begann sie zu fühlen, die Liebe, die ich empfunden hatte, seit wir wussten, dass wir ein Baby bekommen würden; und doch, das Gefühl, dass es unfair war, blieb. Ich war beraubt worden, erst einer natürlichen Empfängnis und jetzt einer natürlichen Geburt. Ich erinnere mich, dass ich dachte, vielleicht sollte ich gar keine Mutter sein, vielleicht war es mir nicht bestimmt.
Ich hatte angenommen, dass alle frischgebackenen Mütter so empfanden wie ich; meine Recherchen und die Macht von Google halfen mir, es besser zu verstehen. Danach leerte ich Mülltonnen und reinigte die Toiletten, verzweifelt bestrebt, mir genug zu verdienen, um so viel Zeit wie möglich in der Bibliothek zu verbringen – und Cassie ihre drei Silbermünzen zurückzuzahlen –, bis eines Nachmittags eine Aufseherin zu mir ins Zimmer kam und mir einen Rettungsanker zuwarf: einen Job in der Bibliothek, nur ein paar Stunden die Woche. Im Gegenzug erhielt ich unbegrenzten Zugang.
Eins habe ich bis jetzt jedoch nie getan: den Namen meines Sohnes in die Suchmaske eingegeben. Ich hatte keine Ahnung, wie schwer es mir fallen würde, auf »Enter« zu drücken und die qualvollen Sekunden zu warten, die es dauert, bis die Suchergebnisse auf dem Bildschirm erscheinen.
Mein Cursor schwebt über dem kleinen Kreuz in der Ecke des Bildschirms, bereit, die Seite zu schließen, sollte es mir allzu nahegehen. Und dann kommt es. Eine ganze Seite mit Websites, in denen auf Dylans Tod Bezug genommen wird, und immer wird sein Name, der Suchbegriff, in Fettschrift hervorgehoben. Die ersten Suchergebnisse sind Prozessberichte, Zeitungsartikel, die ich damals gelesen habe, auch wenn es mir selbst heute noch schwerfällt, mich der Tatsache zu stellen, dass es um mich geht. Auszüge aus Schlagzeilen wie MUTTER MIT POSTNATALER DEPRESSION BEKOMMT SECHS JAHRE und KINDSMÖRDERIN – ICH ERINNERE MICH NICHT stechen unter den Facebook- und LinkedIn-Profilen anderer Dylan Websters hervor. Jeder Artikel zeigt dasselbe Foto – das Foto, das ich in der Hand halte. Mein Herz hämmert schmerzhaft gegen meinen Brustkorb, als ich die Suchergebnisse überfliege, und jede Überschrift ist eine Erinnerung an jene Zeit, die ich mit großer Mühe in einen dunklen Winkel in der hintersten Ecke meines Kopfes verbannt habe.
Einige Artikel haben anscheinend gar nichts mit Dylan zu tun, aber irgendwo muss sein Name auftauchen. Ich drucke alles aus und verspreche mir, dass ich sie zu Hause lesen werde, wo ich in Ruhe aus der Fassung geraten kann. Die ganze Zeit lässt mir der Zeitungsausschnitt keine Ruhe, der mir laut Carole aus der Handtasche gefallen ist. Wer hat ihn da hineingesteckt? Warum? War ich es selbst? Bin ich verrückt? Ich verdränge diesen beunruhigenden Gedanken.
Aus einer Laune heraus gebe ich den Namen meines Ex-Mannes ein, Mark Webster. Alles, was kommt, ist ein Design-Büro – nicht mein Mark – und ein professioneller Dart-Spieler – eindeutig nicht mein Mark. Dann stoße ich auf einen Artikel, den ich kenne. Marks Foto starrt stolz vom Bildschirm, und im Text erklärt die Universität von Durham der Welt, wie erfolgreich ihre Absolventen geworden sind. Ich erinnere mich noch, wie selbstzufrieden er war, als der Artikel im Guardian erschien. Eine »Was machen sie jetzt«-Story, die dem ganzen Land verkündete, dass Mark Webster Partner in einer der führenden IT-Firmen war, der Mr. Big der IT-Szene. Ich hatte über seine Aufgeblasenheit gelächelt; ich habe es immer wunderbar gefunden, wie ehrgeizig er war und wie stolz auf alles, was er erreicht hatte. Der Artikel im Guardian war wie eine Absegnung, ein Zeichen, dass er es geschafft hatte.
Beinahe ohne es zu bemerken, bin ich zwei Stunden in der Bibliothek gewesen. Die Wärme des Tages hat nachgelassen, es wird langsam kalt. Als ich das Gebäude verlasse, zittere ich, ziehe meine grobmaschige Strickjacke fester über der Brust zusammen und beschleunige meine Schritte, bestrebt, möglichst schnell dorthin zurückzukehren, wo ich meinen Wagen geparkt habe. Ich merke erst, wie wenig Aufmerksamkeit ich meiner Umgebung geschenkt habe, als ich mit einer Frau zusammenstoße, die aus der Seitentür der Bibliothek getreten ist.
»Ach Gott, entschuldigen Sie.« Ich blicke auf und sehe die blonde Frau, die mich vorhin im Café dabei ertappt hat, wie ich sie angestarrt habe.
»Es war meine Schuld.« Unsere überraschende Begegnung scheint sie zu verunsichern, und sie lächelt befangen. Am liebsten würde ich etwas Witziges sagen, um die Stimmung aufzulockern – sie wirkt sehr angespannt –, aber mir ist bewusst, dass ich dann wirken könnte wie eine verrückte Stalkerin, also halte ich den Mund.
»Kein Problem«, entgegne ich stattdessen. Kurz wirkt es, als wollte sie etwas sagen, doch nach einem kurzen verlegenen Schweigen schiebt sie sich nur eine Strähne ihres widerspenstigen Haars hinters Ohr und geht weiter.
Ich bin ausgesprochen froh, als ich wieder zu Hause bin und es mir mit einem Becher heißen Kakaos vor dem Kamin gemütlich machen kann, die Ausdrucke fächerförmig vor mir ausgebreitet. Die Artikel über den Prozess sind immer noch schwer erträglich für mich, also blättere ich die letzten durch, in denen der Name Dylan Webster nur irgendwo im Text auftaucht, und hoffe, dass es dabei nicht um irgendeinen Schwimmweltmeister geht, der genauso heißt wie mein Sohn.
Tut es nicht. Die erste Überschrift ist nutzlos, irgendein Bericht über das Treffen ehemaliger Absolventen einer Universität. Doch als ich die zweite Schlagzeile sehe, setze ich mich aufrecht hin und lese aufmerksam weiter.
FAMILIE DES VERSCHWUNDENEN GERICHTSMEDIZINERS BESORGT UM WUNDERBAREN VATER
20. November 2010. Von Nick Whitely
Drei Tage, nachdem Dr. Matthew Riley als vermisst gemeldet wurde, zeigt seine Familie sich besorgt um einen »wunderbar verlässlichen Ehemann und Vater.«
In Dr. Rileys Haus in Bradford sagte sein Cousin Jeff Aldwater, 34: »Matthews Familie macht eine unsagbar schwierige Zeit durch. Matty ist ein unglaublich zuverlässiger Mann, ein wunderbarer Ehemann und liebender Vater. Nie würde er seine Frau oder seine beiden entzückenden Töchter freiwillig im Stich lassen, daher sind wir selbstverständlich äußerst besorgt. Wir sind alle in heller Panik.«
Kristy Riley, Matthews Ehefrau, wird sich heute noch auf einer Pressekonferenz zu Wort melden.
Dr. Riley, 36, stand kürzlich im Rampenlicht wegen seiner Mitwirkung an der Verurteilung von Susan Webster, der jungen Mutter, die vor drei Wochen für schuldig befunden wurde, ihren Sohn Dylan erstickt zu haben. Der Gerichtsmediziner wurde zuletzt am 17. November beim Verlassen des Supermarkts Waitrose in Bradford gesehen, in der Hand eine Plastiktüte, die vermutlich Wein und Pralinen für die Feier seines achten Hochzeitstags enthielt. Jeder, der Angaben über seinen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei West Yorkshire über die Hotline-Nummer auf deren Website in Verbindung zu setzen.
Matthew Riley. Erinnere ich mich an ihn? Ich durchsuche meine verschwommenen Erinnerungsbilder an ein Gerichtsverfahren, bei dem ich nur körperlich anwesend war, und dann sehe ich ihn vor mir. Ein Arzt, der zu jung aussah, um ein Experte für irgendetwas zu sein, jedoch laut dem Zeitungsartikel älter war als ich. Ich erinnere mich, wie ich mich um Konzentration bemühte, als er in den Zeugenstand trat, weil ich wusste, wie wichtig seine Aussage sein würde. Ich weiß nicht, ob es am Stress lag, am Schlaf-und Nahrungsmangel oder an den Antidepressiva, die die Ärzte im Krankenhaus mir verschrieben hatten, aber nachdem Dylan nicht mehr da war, fiel es mir schwer, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Trauer, sagte mein Vater; ihm sei es nach dem Tod meiner Mutter ebenso ergangen. Ich hatte den Verlust meiner Mutter auch betrauert, natürlich, aber dies war etwas anderes, ein alles verzehrendes schwarzes Loch knapp außerhalb meiner Sichtweite, und doch wusste ich, es war da und wartete darauf, dass ich ihm zu nahekam und hineinstürzte. Es erforderte all meine Energie, nicht einfach freiwillig hineinzutreten.
Der Sachverständige wurde vereidigt, und der Staatsanwalt trat zum Zeugenstand. Er war ein grässlicher kleiner Mann, der mich so stark an den großen und mächtigen Zauberer von Oz erinnerte, dass ich ein Kichern unterdrücken musste, um nicht zu beweisen, was sowieso alle dachten – dass ich verrückt war. Ich versuchte, mich darauf zu konzentrieren, was der Arzt – Matthew Riley, wie ich jetzt weiß – gerade sagte.
»… zeigte keine Reflexe. Ich habe fehlenden Puls und Atemstillstand festgestellt, auch das Herz schlug nicht mehr. Um 16.06 Uhr habe ich ihn für tot erklärt, aber die Obduktion ergab, dass der Tod etwa zwei Stunden früher eingetreten ist.«
»Und Susan Webster war …?«
Während des ganzen ersten Teils seiner Aussage hatte er die Geschworenen angesehen, doch bei dieser Frage warf er mir einen Blick zu und räusperte sich, als würde er sich nicht wohl in seiner Haut fühlen.
»Das Notfall-Team hatte Mrs. Webster in den OP gebracht. Bei unserem Zusammentreffen auf dem Parkplatz hatte ich sie für tot gehalten, doch es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass sie nur bewusstlos war.«
Der Staatsanwalt schwieg kurz, damit diese Information ins Bewusstsein dringen konnte, obwohl sie, wie ich dachte, den Geschworenen wohl kaum neu sein durfte.
»Woran ist Dylan Webster Ihren ersten Eindrücken nach gestorben?«
Dr. Riley richtete den Blick auf die Geschworenen und war wieder ganz der medizinische Sachverständige.
»Scheinbar war Dylan ein Opfer von SIDS geworden.« Er warf einen Blick auf den Staatsanwalt, der ihn mit einem Nicken zum Weiterreden ermutigte. »Auch plötzlicher Kindstod oder Krippentod genannt.«
Mir wurde schwarz vor Augen. Ich hasste diesen Mann, entschied ich. Ich hasste es, dass er über mich und meinen Sohn sprach und dabei das Wort »Tod« in den Mund nahm.
»Können Sie uns sagen, warum Sie annahmen, dass dies der Fall war?«
»Nun, unglücklicherweise gehört der plötzliche Kindstod immer noch zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern unter einem Jahr, daher ist es nur natürlich, ihn als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, wenn ein Baby in seinem Bettchen stirbt, ohne dass es Anzeichen für Misshandlungen oder eine andere Todesursache gibt.«
»Und was hat die Obduktion ergeben?«
»Bei der Obduktion fand ich Fasern von Mr. und Mrs. Websters Sofakissen im Mund des Kindes. Es lagen ein akutes Emphysem und ein Lungenödem vor.«
Man musste kein medizinischer Sachverständiger sein, um zu wissen, worauf Dr. Rileys Aussage hinauslaufen würde.
»Und als Sie all diese Erkenntnisse zusammenfügten, was haben Sie als Todesursache festgestellt?«, fragte der Staatsanwalt mit einer Miene, die, da war ich mir sicher, perverse Schadenfreude ausdrückte. Dr. Riley sah mich nicht einmal an, als er seine belastende Aussage machte.
»Es war meine Meinung als Mediziner, dass Dylan Webster an einer gewaltsamen Suffokation starb.«
»Und in einfacher Sprache?«
»Dylan Webster wurde mit einem Kissen erstickt.«
*
Wurde Dr. Riley je gefunden? Ist sein Verschwinden überhaupt relevant? Seufzend reibe ich mir das Gesicht und hocke mich hin. Und da höre ich das Geräusch.
Ich kann mir nicht einreden, dass es nur Einbildung war. Hinten im Garten höre ich ein lautes Krachen, als würde jemand gegen die Mülltonnen stoßen. Ich springe auf und halte nach etwas Ausschau, mit dem ich mich verteidigen kann. Der Feuerhaken. Ein Klischee, ich weiß, aber vermutlich mit gutem Grund, und in jedem Fall besser als eine zusammengerollte Zeitung.
Ich warte ein paar Minuten hinter der Wohnzimmertür und fange schon an, mir ein bisschen albern vorzukommen, als ich ein neues Geräusch höre. Ein Rütteln, mit ziemlicher Sicherheit an der Hintertür, und ein Kratzen, als versuche jemand, das Schloss aufzubrechen. Verdammt. Da habe ich nun die letzten drei Jahre damit zugebracht, in der Forensischen Psychiatrie keine Schwierigkeiten zu bekommen, und jetzt werde ich in einer idyllischen Kleinstadt in Shropshire ein böses Ende nehmen. Wenn ich nicht solche Angst hätte, könnte ich vermutlich die komische Seite daran würdigen.
Die Küche ist dunkel, und da die Jalousien heruntergelassen sind, habe ich keine Chance, zu sehen, wer vor der Hintertür steht. Mist. Meine einzige Hoffnung ruht auf dem Überraschungseffekt. Wer auch immer hier einzubrechen versucht, ist eindeutig kein Fachmann – er veranstaltet seit gut zehn Minuten ziemlichen Radau, und die Tür ist noch immer fest verschlossen. Ich überlege, ob ich die Tür aufreißen und dem, der dahinter steht, eins mit dem Feuerhaken überbraten soll, ganz im »Fluch der Karibik«-Stil, aber wenn ich mir’s recht überlege, ist das Letzte, was ich will, noch eine Mordanklage, weil ich irgendeinen verwirrten Besoffenen abgemurkst habe, der beim falschen Haus gelandet ist und seinen Schlüssel nicht ins Schloss bekommt.
Das Rütteln hat aufgehört. Vielleicht hat er aufgegeben und ist weggegangen. Den Feuerhaken in der Hand, schleiche ich zum Küchenfenster und spähe durch die Jalousien. Draußen ist es stockfinster, und ich kann nichts erkennen außer meinem eigenen Spiegelbild. Als plötzlich etwas gegen die Scheibe donnert, schreie ich vor Schreck auf, und es dauert eine volle Minute, bis ich erkenne, was das Donnern verursacht hat. Mein Schrei verwandelt sich in ein nervöses Lachen der Erleichterung. Ein riesiger schwarzer Kater sitzt auf dem Fensterbrett und kratzt an der Scheibe, um hereingelassen zu werden – niemand anders als mein hauseigener Stalker, der Streuner aus der Nachbarschaft: Joss. Ich hole tief Luft und öffne das Fenster. Würdevoll kommt er hereinstolziert.
»Du verdammtes, blödes Vieh«, schelte ich ihn liebevoll. Er schnurrt und reibt sein Gesicht an meinem, ohne eine Ahnung zu haben, was für einen Aufruhr er gerade ausgelöst hat. Ich stelle ihm einen Napf mit Weetabix hin – seine Lieblingsnahrung –, und nachdem ich überprüft habe, ob die Hintertür auch wirklich abgeschlossen ist, kehre ich in die Geborgenheit meines Wohnzimmers zurück. Joss folgt mir getreulich, rollt sich vor dem Kamin zusammen und schläft auf der Stelle ein.
Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich so töricht reagiert habe. Das Einzige, was sich mitten in der Nacht in meinem Garten herumtreibt, ist ein streunender Kater, der nichts will außer seinem Weetabix und einem warmen Ort zum Schlafen. Was für eine verdammte Idiotin ich doch bin. Trotzdem überprüfe ich noch einmal alle Fenster und Türen: Sicher ist sicher.
Kapitel 6
Jack: 24. September 1987
»He, Shakespeare, fang.« Jack pfefferte die Schokolade durch die Luft und lachte, als sie den anderen Jungen voll gegen die Brust traf. »Zu langsam!«
»Danke.« Billy runzelte die Stirn. »Wann kommen die anderen?« Er hatte schon drei Mal auf die Uhr gesehen, seit er vor einer Viertelstunde gekommen war. Beim dritten Mal hatte Jack sich das Lachen verkneifen müssen.
»Bald. Warum, bist du nervös?«
»Nein.« Die Antwort kam schnell, aber Jack konnte sehen, dass Billy log. Er hatte sich in etwas geworfen, was bestimmt seine coolsten Klamotten waren, doch die Asics-Turnschuhe und die marineblaue Jogginghose, kein Markenartikel, würden beim Rest der Gruppe kaum gut ankommen. Das waren Jungs, die schon mit zwölf Nike und Fred Perry trugen – Billy hielt das vermutlich für den Namen des Kioskbetreibers.
»Entspann dich. Die beißen nicht. Es sei denn, ich sage es ihnen.« Jack runzelte die Stirn, als sein Straßenkämpfer wieder mal das Leben verlor. Verärgert warf er den Controller auf die Spielkonsole und fluchte. »Verfickt langweilig, dieses Spiel. Wir brauchen unbedingt ein paar neue Sachen.«
»Du hast viel mehr Zeug als ich.« Billy schaute sich in Jacks Zimmer um und sog jedes Detail in sich auf. Überbleibsel früherer Hobbys lagen überall herum: die Gitarre (er hatte seinen Eltern wochenlang deswegen in den Ohren gelegen, nur um nach sechs Gitarrenstunden wieder hinzuschmeißen); die Laufschuhe, letztes Jahr ein absolutes Must-have, waren verdreckt und lagen auf einer Jacke, die wahrscheinlich mehr gekostet hatte als alle Klamotten des anderen Jungen zusammengenommen. Es war ziemlich amüsant zu beobachten.
»Ein Haufen Müll. Wenn Adam kommt, wird er rausgehen und Tracker spielen wollen. Deine schönen neuen Turnschuhe könnten dreckig werden.«
Jack grinste, als der andere sein Bestes tat, sich unbeteiligt zu geben. Wahrscheinlich würde er Stunden damit zubringen, sie sauber zu schrubben, bevor er nach Hause ging. Es musste die Hölle sein, Eltern zu haben, die immer da waren und ständig wissen wollten, wohin man ging und mit wem man sich traf. Zumal es in einem Haus von Briefmarkengröße vermutlich schwer war, sich aus dem Weg zu gehen. Er kannte Billys Haus – von außen natürlich nur, er war sicher, dass er niemals hineingebeten würde.
Als es an der Tür klingelte, fuhr Billy zusammen. Jack lachte und sprang auf.
»Ich gehe«, schrie er, obwohl er nicht wusste, ob überhaupt jemand da war. Lucy hatte er noch nicht gesehen, seit er um elf aufgewacht war. Wahrscheinlich erledigte sie die Wocheneinkäufe. Falls er nicht hier war, wenn sie zurückkam, würde es ihr egal sein. Seine Eltern gehörten zu den Leuten, die glaubten, dass Jugendliche zum Aufwachsen Freiheit brauchten – und die hofften, dass es ihm nicht auffallen würde, wenn Lucy seinen Ranzen durchsuchte, um festzustellen, was für Hausaufgaben er aufhatte.
Billy hielt sich im Hintergrund, als die anderen die Treppe hochgetrampelt kamen. Der Erste, der Jacks Zimmer betrat, war Riley. Jack sah, wie Billys Schultern vor Erleichterung herabsackten. Er nickte Matt zu. »Alles gut?«
Matt grinste. »Alles gut.«
Der zweite Junge, der durch die Tür trat, rümpfte die Nase. »Wer bist du denn?«
Jack schubste ihn. »Sei kein Arsch. Das ist Shakespeare. Er hängt mit uns ab.«
»Shakespeare? Was soll das denn für ein Name sein?« Der zweite Junge grinste. »War deine Mutti besoffen, als sie dich so genannt hat?«
»Das ist ein Spitzname, du Idiot. Weil er so gut in Englisch ist. Shakes, das ist Adam Harvey.«
Die beiden Jungen nickten einander zu, doch keiner der beiden wirkte sonderlich erfreut über die Begegnung.
»Du siehst scheiße aus, was ist passiert?«