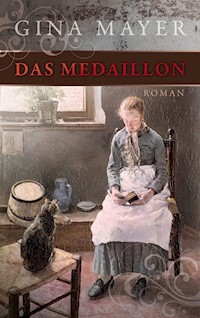
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition oberkassel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein weiteres überarbeitete Meisterwerk nach "Die Protestantin" aus der Feder der in Düsseldorf lebenden Schriftstellerin Gina Mayer. Mitte des 19. Jahrhunderts werden im Neandertal bei Erkrath prähistorische Knochen entdeckt. Dies sorgt in der pietistischen Kleinstadt Elberfeld für großes Aufsehen. Die beiden Freundinnen Rosalie und Dorothea träumen in dieser Zeit von einem Leben jenseits der strengen Tabus ihrer Erziehung. Rosalie beginnt als Apothekersgehilfin zu arbeiten, Dorothea hilft heimlich in der Leihbücherei aus. Aber nicht alle Menschen in Elberfeld sind damit einverstanden, dass die Frauen ihre eigenen Wege gehen. Hundertfünfzig Jahre später finden Archäologen erneut Knochen bei Erkrath. Nora, eine Teilnehmerin des Forschungsteams, entdeckt bei dem Skelett ein Medaillon. Je mehr sie über das Schmuckstück herausfindet, desto enger scheint ihr Schicksal mit dem der Toten verknüpft. Faszinierend und spannend sind die Lebenswege dreier mutiger Frauen geschildert, detailgetreue Millieuschilderungen der Gegend und Lebensumstände von Wuppertal bis Erkrath zeichnen den Roman der Schriftstellerin aus. "Mit einer ungeheuren Lust am Erzählen entwirft Gina Mayer ein fesselndes Sittengemälde, das bis in unsere Zeit reicht." (Welt am Sonntag (zur früheren Ausgabe)) "Aus dem Kontrast zwischen Gegenwart und Vergangenheit resultiert eine mitreißende Spannung, die das Buch zusammen mit der natürlichen Erzählweise der Autorin fesselnd macht." (Rheinische Post (zur früheren Ausgabe)) "Der ideale Schmöker für lange Winterabende." (NRZ (zur früheren Ausgabe))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Medaillon
Gina Mayer
edition oberkassel2014
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Dank an die LeserInnen
Gina Mayer
Impressum
Wer bin ich? Asche, Staub und Koht
O grosser HErr! Das weistu woll;
Wer bin ich? Von Natur im Tod,
Ich bin das nicht, was ich seyn soll;
Und dennoch kommst du zu mir gehen
Mir als Erlöser beyzustehen?
Joachim Neander
(1650 – 1680)
Dezember 1907, Cleveland, Ohio
Alle anderen Gäste saßen in Gruppen zusammen, nur die alte Frau hatte einen Tisch für sich allein an einem der hohen Fenster, die auf den Eriesee hinausgingen. Die warme Wintersonne ließ ihr weißes Haar hellblond erscheinen und überstrahlte ihre Gesichtshaut, so dass diese ganz glatt erschien. Sie las.
So hat Großmutter ausgesehen, als sie eine junge Frau war, dachte June. Sie blieb am Eingang stehen, um sie in Ruhe betrachten zu können, aber im selben Moment hob die alte Frau den Kopf, als ob sie ihren Blick gespürt hätte. »Da bist du ja endlich.« Sie faltete ihre Zeitung zusammen und wies auf den freien Stuhl neben ihrem. »Was darf ich dir bestellen?«
»Eine Limonade.« June zog ihre Jacke aus und hängte sie über die Lehne des Stuhls, bevor sie sich niederließ. »Hast du lange gewartet?« Sie war in der Stadt gewesen und hatte Besorgungen erledigt, darüber hatte sie die Verabredung mit ihrer Großmutter am See fast vergessen.
Die alte Frau zuckte mit den Schultern, während sie ein Stuck Zucker in ihren Tee rührte.
»Was liest du?«, fragte June.
»Die Nachrichten.«
»Gibt es etwas Neues?«
»Die Welt wird immer feindseliger. Russland verstärkt nun die Franzosen an der Seite Englands. Ganz Europa schließt sich gegen Deutschland zusammen.« Sie seufzte, strich mit der flachen Hand über ihre Augen und sah plötzlich nicht mehr jung aus, sondern sehr alt.
»Hast du Angst um dein Heimatland?«, fragte June.
Ihre Großmutter lachte. »Mein Heimatland. Das ist so ein großes Wort. Deutschland hat sich so verändert, seit ich es damals verlassen habe.«
»Aber du sorgst dich dennoch. Dass es Krieg gibt«, beharrte June.
Die alte Frau blinzelte mit schmalen Augen über die funkelnde Oberfläche des Sees. »Sicher«, sagte sie, aber sie wirkte plötzlich geistesabwesend, als ob ihre Gedanken schon ein Stück weitergegangen wären. Dann drehte sie die Zeitung um und tippte mit dem Zeigefinger auf eine der Meldungen auf der letzten Seite. »Hier, siehst du das?«
»Urmensch in Deutschland entdeckt«, begann June zu lesen. »Die ältesten menschlichen Überreste der Welt sind im Oktober 1907 in einer Kiesgrube nahe der deutschen Stadt Heidelberg gefunden worden. Ein Sandgräber entdeckte einen sehr kräftig gebildeten menschlichen Unterkiefer mit vollständiger Bezahnung. Dieses Fragment des sogenannten Homo heidelbergensis wird von der Wissenschaft als das bisher älteste Fundstück einer primitiven Übergangsform zwischen Mensch und Affen bewertet.«
Achselzuckend schob sie die Zeitung wieder zu ihrer Großmutter zurück. »Für archäologische Ausgrabungen konnte ich mich noch nie erwärmen.«
Aber die alte Frau hatte ihr gar nicht zugehört, sie strich gedankenverloren über die Zeitungsseite, während sie hinaus auf den See blickte, als gäbe es dort draußen etwas zu sehen, das von ungeheurer Bedeutung für sie war, etwas, das June nicht sehen konnte.
»Was ist denn, Großmutter?«, fragte June
»Einmal«, sagte die alte Frau langsam. »Einmal haben wir uns über diese Frage fast entzweit. Ob es einen fossilen Menschen gibt. Und nun schreiben sie so nebenbei von Übergangsformen zwischen Menschen und Affen, als ob es nichts Besonderes wäre. Aber damals war es ein Eklat. Und es ist gar nicht lange her.«
»Wer hat sich fast entzweit?«, fragte June. »Sprichst du von dir und Großvater?«
Die alte Frau sah hinaus auf den See und antwortete nicht.
1. Kapitel
»Die horizontal übereinander liegenden Lager, die verschieden gefärbten und aus verschiedenartigen Stoffen gebildeten Schichten zeigen uns in grandiosen Schriftzügen die Geschichte der Vergangenheit. Die großen Erdkrisen scheinen daselbst von Gottes Hand verzeichnet zu sein. Hier fangen die Beweise an. Sie sind unwiderleglich, wenn es sich ergibt, dass das Werk des Menschen, das wir suchen, dieses Kunstprodukt, von dem ich behaupte, dass es dort liegt, sich eben daselbst schon seit der Ablagerung der Schichten befindet.«
(aus einem Vortrag von Boucher de Perthes vor der Pariser Akademie, 1839)
»Rosalie!« Dr. Kuhns dünne, ein wenig klagende Stimme folgte ihr die enge Gasse hinunter bis an die Ecke zur Hauptstraße. Sie blieb stehen und schaute zurück zum Haus, aber ihr Vater war nirgends zu sehen. Das Fenster zu den Praxisräumen stand offen. Sie zögerte einen Moment lang, dann kehrte sie um.
Er beugte sich aus dem Erdgeschossfenster auf die Straße herunter, in seiner ausgestreckten Hand wedelte ein Zettel hin und her. »Sei so gut und schau nach dem Markt noch in der Apotheke vorbei, besorg mir die Tinkturen, ich brauche sie hernach dringend.« Die blauen Augen hinter den konvexen Brillengläsern waren riesig und verschwommen wie seltsame Meeresfische. Sie nickte kurz und steckte das Rezept in eine Schürzentasche. »Ich bin aber nicht vor einer Stunde zurück.«
Sie hörte ihn noch etwas murmeln, während er ihr schon den Rücken zukehrte, das Gesicht dem nächsten Patienten zugewandt.
Der ganze Sommer 1856 war verregnet gewesen, auch jetzt im August war der Himmel bedeckt, es war viel zu kühl für die Jahreszeit. Sie fröstelte in ihrem dünnen Sommerkleid, als sie die Tür zur Apotheke aufstieß. Die Glocke oben am Türrahmen klingelte schrill und erschrocken. Der Laden war leer, wahrscheinlich war der alte Rinstermann oben in den Räumen, die er allein bewohnte. Es würde eine Weile dauern, bis er die Stufen heruntergehumpelt war, und noch länger, bis er mit seinen zittrigen, arthritischen Händen die Tinkturen zusammengemischt hätte. Rosalie fragte sich manchmal, ob er überhaupt noch in der Lage war, die einzelnen Einheiten genau zu bemessen.
Wie immer, wenn sie in der Apotheke war, begann ihr Herz schneller zu schlagen, während ihre Augen an den vertrauten Holzregalen entlangglitten, auf denen Seite an Seite weiße Porzellangefäße standen, darunter honigfarbene Glastöpfe mit weißen Etiketten, sorgfältig beschriftet mit lateinischen Namen in hellblauer Schrift. Ein Schrank mit quadratischen Schubfächern, hinter jedem halbrunden Messinggriff lag ein Geheimnis, das Heilung versprach oder den Tod brachte, je nach Art der Anwendung.
Die Küche der Medizin nannte ihr Vater die Apotheke. Rosalie, die die Apotheke mit allen ihren Rätseln liebte, empfand das als verächtliche Herabsetzung.
Auch heute, obwohl sie so in Eile war, atmete sie den halb bitteren, halb minzigen Geruch ein, der aus dem Nachbarraum drang, wo die Arzneien und Salben gemischt wurden, und schloss die Augen und stellte sich vor, dass es ihr Reich wäre, diese Apotheke, dass sie es wäre, die ihrem Vater die Tinkturen zusammenrührte und Pflaster strich.
»Ist Ihnen nicht recht gut?« Das war nicht die Stimme des alten Rinstermann. Rosalie riss die Augen auf. Hinter der Ladentheke stand ein junger Mann. Weißer Mantel, dunkle, halblange Haare, Bart. Er war ein Stück größer als sie, das gefiel ihr.
»Wo ist Herr Rinstermann?«, fragte sie.
Er lächelte. »Er hat sich zur Ruhe gesetzt, die Apotheke verkauft und ist nach Düsseldorf gezogen zu seiner Nichte.«
So plötzlich, dachte sie. In der vergangenen Woche hatte er ihr noch eine Salbe verkauft und keinen Ton davon gesagt, dass er sein Geschäft aufgeben wollte. Aber er war immer schweigsam gewesen, der alte Apotheker.
»Und Sie sind sein Nachfolger«, fragte sie und hörte, wie ihre Stimme mit jedem Wort an Höhe verlor. Irgendwo, ganz tief in ihrem Inneren, stellte sie fest, hatte sich absurderweise ein Rest Hoffnung verborgen, dass sie selbst nach Rinstermanns Abgang die Apotheke übernehmen könnte. Ganz ohne Lehrjahre, ohne Universitätsstudium, ohne Wissen und Kenntnisse. Es war ein dummer, ein unsinniger Gedanke gewesen und sie schämte sich plötzlich dafür, obwohl niemand davon gewusst hatte, nicht einmal sie selbst.
»Minter«, sagte der Mann und sie sah ihn überrascht an, dann wurde ihr bewusst, dass er sich vorgestellt hatte.
»Und Sie?«, fragte er.
»Rosalie«, sagte sie. »Rosalie Kuhn.«
Der Name war ein Fluch. Ihre Mutter hatte ihn ausgesucht, vielleicht weil er sie an irgendjemanden, an irgendetwas erinnert hatte. Was immer es war, sie hatte es Rosalie nicht mehr mitteilen können. Sie war gestorben und hatte nicht miterlebt, wie ihre einzige Tochter heranwuchs und sich in ihrer Entwicklung immer weiter von ihrem Namen entfernte. Nun war sie neunzehn Jahre alt, muskulös gebaut und dunkelhaarig. Im Winter, wenn ihre Haut hell und durchscheinend war, zeichnete sich auf ihrer Oberlippe ein schwarzer Schatten ab wie die Vorahnung eines Bartes. Die Jungen in der Volksschule hatten sich schon damals darüber lustig gemacht, aber nur heimlich und hinter ihrem Rücken, denn Rosalie war stark, niemand legte sich gerne mit ihr an.
Nachdem sie ihren mädchenhaften Namen ausgesprochen hatte, musterte sie den neuen Apotheker voller Misstrauen, aber er schien den Widerspruch zwischen ihrer Erscheinung und ihrem Namen nicht zu bemerken.
»Was kann ich für Sie tun?«
Sie reichte ihm den Zettel mit den Verschreibungen, er las und nickte und verschwand dann im Nebenraum. »Dr. Kuhn, ist das Ihr Mann?«, fragte er, als er ihr die drei Fläschchen mit den Tinkturen über die Ladentheke reichte.
»Mein Vater«, entgegnete sie und lächelte. Im gleichen Moment begann einer im Stockwerk über der Apotheke zu hämmern, es klang laut und wütend, als ob jemand mit einem harten Gegenstand auf den Boden schlüge. Sie sah den Apotheker fragend an, aber er hatte den Blick zur Decke gerichtet und wirkte mit einem Mal voller Sorge, vielleicht hatte er Angst, dass sie einstürzte.
»Nun denn, wir werden uns künftig noch des Öfteren begegnen.«
Er richtete die Augen wieder auf sie, lächelte verwirrt und kam hinter der Theke hervor und trat vor ihr zur Tür, um sie für sie zu öffnen.
»Der alte Rinstermann hat also verkauft«, sagte ihr Vater und nickte langsam, während er einen Löffel gestampfte Kartoffeln im Mund versenkte. »Ja richtig, er hat davon gesprochen, es war wohl auch an der Zeit, lange wäre es sicher nicht mehr gut gegangen mit ihm. Und der Neue, sein Nachfolger, wie ist er?«
»Er wirkt recht angenehm.« Rosalie versuchte sich an den Namen des jungen Apothekers zu erinnern. Minster. Mindner. Oder so ähnlich.
»Nun, er wird mir sicherlich seine Aufwartung machen in den nächsten Tagen.« Ihr Vater schenkte sich ein Glas Bier ein, nahm einen kräftigen Schluck und wischte sich dann mit dem Handrücken den Schaum von der Oberlippe, der sich wie ein weißer Flaum auf seinen dunklen Bart gelegt hatte.
»Heute Abend erwarte ich übrigens Fuhlrott. Er war vorhin in der Praxis und hat seinen Besuch angekündigt.«
Dr. Fuhlrott wohnte nur ein paar Häuser weiter auf der Laurentiusstraße und unterrichtete Naturkunde an der Höheren Bürger- und Realschule in Elberfeld. Auch ihm war vor drei Jahren die Frau gestorben, aber ihn hatte es noch schlimmer getroffen als Kuhn, statt nur mit einer war er mit sechs Töchtern zurückgeblieben, von denen die jüngste heute gerade einmal acht Jahre alt war. Vielleicht lag es an dieser Unmenge an eigenen Töchtern, dass er Rosalie, die im gleichen Alter war wie seine Zweitälteste, immer nur mit höflichem Desinteresse behandelte. Als wäre sie Luft.
Die beiden Doktoren – wie sie die Nachbarn nannten – waren schon viele Jahre befreundet, sie teilten das Interesse an den Naturwissenschaften, an der Zoologie, der Geologie und der Botanik, das Interesse an allem, was erforschbar war und logisch. Sie trafen sich ein oder zwei Mal die Woche und Rosalie, die stets dabeisaß, wenn sie zusammenkamen und miteinander redeten, sog die Dinge, über die sie diskutierten, in sich auf. Fuhlrott, der mit den Steinbruchbesitzern der ganzen Umgebung bekannt war, wurde von ihnen mit Knochen versorgt, die beim Abbau zu Tage kamen, viele davon waren nur wenige Jahre alt und wertlos, andere wiederum bezeichnete der Doktor als ‚fossil‘ und ihr Zustand und ihre Beschaffenheit ermöglichten Rückschlüsse auf das Aussehen, das Wesen der Arten in vorsintflutlichen Zeiten. Rosalie malte sich immer aus, wie die Erde vor der Sintflut ausgesehen haben mochte, mit Eis bedeckt und von fremdartigen Lebewesen bevölkert. Es fiel ihr schwer, diese Vorstellung mit Noahs Arche in Verbindung zu bringen, denn wie hätten all die eigentümlichen Tiere, die Nashörner und Hyänen und Auerochsen, auf ein einziges Schiff passen sollen – und sei es auch noch so groß. »Meiner Ansicht nach hat die Sintflut in ihrem alttestamentarisch beschriebenen Ablauf nie stattgefunden«, sagte ihr Vater, als sie ihn danach fragte. »Es ist ein Sinnbild, eine Parabel, keine wissenschaftliche Beschreibung.« So etwas sagte er jedoch nur zu ihr und selbst dann senkte er die Stimme, so dass sie genau hinhören musste. Mit seinem Freund Fuhlrott sprach er niemals über solche theologischen Dinge, sie hielten sich an naturwissenschaftliche Fakten.
Um sieben läutete es an der Haustür. Rosalie öffnete und erwartete Fuhlrott, es war aber nicht der Lehrer, sondern der neue Apotheker. An seinen Namen konnte sich Rosalie nicht mehr erinnern, aber er schien sie ebenfalls vergessen zu haben, jedenfalls stellte er sich erneut vor.
»Minter«, sagte er mit einem Diener. »Ich hoffe, ich störe nicht.«
»Keineswegs«, sagte Rosalie.
»Ich wollte mich Ihrem Herrn Vater gerne einmal vorstellen, so er zu Hause wäre.« Der Apotheker blinzelte nervös über ihre Schulter ins Dunkel des Hausflurs.
»Nein, nein. Kommen Sie ruhig herein, mein Vater hat Sie ja schon erwartet.«
Sie führte ihn durch den Flur und die Treppe hinauf bis ins Kaminzimmer, das groß und düster neben der Küche lag. Ihr Vater saß in seinem Lehnstuhl und kehrte ihnen den Rücken zu. »Fuhlrott, alter Knabe!«, rief er, ohne von seinem Buch aufzusehen. »Gibt es Neuigkeiten aus der Urzeit?«
»Es ist Herr Minter«, sagte Rosalie schnell. »Von der Apotheke.«
Ihr Vater blickte auf, das Lächeln, das Fuhlrott gegolten hatte, verschwand aus seinem Gesicht, aber als er die verlegene Miene des Besuchers sah, erhob er sich und kam ihm entgegen. Dann klingelte es wieder und Rosalie ging, um die Tür zu öffnen, und dieses Mal war es wirklich Fuhlrott.
Er kümmerte sich gar nicht um den fremden Gast, sondern nahm gleich in seinem gewohnten Sessel am Fenster Platz, griff nach dem Bierkrug, den Rosalie schon für ihn hingestellt hatte, und nahm einen großen, durstigen Schluck. Dann stellte ihm Dr. Kuhn den Apotheker vor, der die Gelegenheit nutzen wollte, um sich zu verabschieden.
»Nicht doch, nicht doch«, sagte Fuhlrott und lächelte sein schmales Lächeln, bei dem er seinen rechten Mundwinkel immer ein wenig tiefer zog als den linken. »Gehen Sie nicht. Jedenfalls nicht meinetwegen.«
»Setzen Sie sich und trinken Sie ein Glas Bier mit uns«, meinte auch Dr. Kuhn und warf Rosalie einen schnellen Blick zu, der sie ärgerte. Sie ging dennoch in die Küche, holte noch einen Krug und stellte ihn dem Apotheker hin, der sich inzwischen aufs Sofa gesetzt hatte, ein wenig abseits von den beiden anderen Herren, auf den Platz, auf dem sie selbst für gewöhnlich saß. Er nickte kurz, als sie ihm Bier einschenkte.
»Ich habe heute ein Schreiben erhalten von Pieper aus Mettmann«, sagte Fuhlrott.
»Der Steinbruch-Pieper?«, fragte Kuhn. »Was hat er denn diesmal?«
»Wieder Knochen. Er schreibt von den Resten des Bären, auf die er gestoßen sein will.«
»Das wäre in der Tat phänomenal, wenn er dir zu dem Zahn jetzt das Gerippe nachlieferte.«
»Phänomenal, aber nicht sehr wahrscheinlich. Der Bärenzahn wurde bereits vor Monaten gefunden, inzwischen wird an einer ganz anderen Stelle abgebaut. Sollte es sich also wirklich um denselben Bären handeln, so müssten dem Tier zuerst die Zähne aus dem Maul gefallen sein, bevor es sich dazu entschließen konnte, sich zum Sterben niederzulassen.«
Kuhn lachte und prostete dann Minter zu, der seinen Krug hob und zaghaft zurückprostete.
»Dr. Fuhlrott betreibt Untersuchungen an altertümlichen Gebeinen und Gestein«, erklärte Rosalie, die sich neben den Apotheker gesetzt hatte, nachdem sie den Korb mit der zerschlissenen Wäsche hinter dem Sofa hervorgeholt hatte.
»Interessieren Sie sich für die Erdgeschichte?«, fragte Fuhlrott. Seine Stimme klang mit einem Mal streng. Schulmeisterlich, dachte Rosalie und bemerkte, dass sich Minter neben ihr unwillkürlich ein Stück aufrichtete.
»Sicher«, sagte er und fuhr dann schnell mit der Unterlippe über die Oberlippe, als wollte er einen unsichtbaren Bierrest weglecken. »Ich habe mich ein wenig damit beschäftigt, gleichwohl sind meine Kenntnisse mangelhaft ...«
»Da geht es Ihnen nicht viel anders als uns«, unterbrach ihn Fuhlrott, »und dem Rest der Wissenschaft. Alles, was weiter als die 1 850 Jahre zurückliegt, die unsere lächerliche Zeitrechnung umfasst, verschwimmt in einem Nebel des Unwissens, und je weiter man sich zurückbewegt, umso dichter wird er. Hier und da stoßen wir auf ein paar Knochenreste, den Abdruck von Weichtieren und Pflanzen im Gestein und ziehen daraus unsere Schlüsse auf Gottes Schöpfung.«
»Gerade deshalb ist es beachtlich, welche umfassende Erkenntnis die Forscher aus dem Wenigen gewinnen«, sagte Minter. »Ich habe in Nürnberg die Rekonstruktion eines Mammutschädels aus der Vorzeit gesehen, er wirkte so ganz und gar lebendig, erschreckend wirklich.«
»Ja, es waren furchterregende Geschöpfe, die damals die hiesigen Wälder bewohnten, ob Mammut oder Höhlenbär oder Auerochse, riesig in ihren Ausmaßen und unvorstellbar in ihrer Kraft«, pflichtete Kuhn ihm bei.
»Und dennoch haben sie ihren Platz auf der Erde geräumt für Nachfolger, die weit kleiner, weit schwächer sind«, meinte Fuhlrott. »Der Braunbär ist ein Zwerg im Vergleich zu seinem Vorfahr, der Elefant in seiner Größe ein Winzling neben dem Mammut ...«
»... ganz zu schweigen von den braven Ochsen, die uns heutzutage die Pflüge über die Felder ziehen«, fiel Kuhn ihm ins Wort.
Rosalie schob ihre Stopfnadel durch die Fäden, die sie quer über das Loch im Strumpf gespannt hatte, einmal darüber, einmal darunter.
»Wie kommt das?«, fragte Minter neben ihr und sprach damit aus, was sie soeben gedacht hatte. »Warum werden die Wesen kleiner und schwächer?«
»Man vermutet, dass die urzeitlichen Arten durch immer wiederkehrende Naturkatastrophen ausgerottet worden sind, durch Erdbeben, Vulkanausbrüche, Fluten, wie in der Bibel beschrieben«, sagte Fuhlrott.
»Und dann haben sich neue Arten gebildet? Sozusagen aus dem Nichts?«, fragte Minter. Rosalie warf ihm einen Blick zu. Er wirkte jetzt nicht mehr verunsichert, sein Oberkörper war leicht nach vorn gebeugt und seine Augen schmal vor Neugierde.
»Das ist meine Meinung«, nickte Fuhlrott. »Alte Arten wurden vernichtet, neue Arten von Gott geschaffen.«
Minter ließ seinen Oberkörper wieder gegen die Sofalehne sinken und stieß dabei Luft durch die Nase.
»Sind Sie anderer Ansicht?«, fragte ihn Fuhlrott sofort.
Der Apotheker zuckte mit den Schultern. »Ich finde jene Theorie überzeugender, die besagt, dass sich alle Lebewesen, die Tiere, aber auch die Pflanzen, mit den Jahrtausenden stetig verändert haben. Sie sind gewachsen, geschrumpft, wie es die Umstände, die Lebensverhältnisse erfordert haben.«
»Aber was sollte sie dazu gebracht haben, sich zu verändern?«, mischte Kuhn sich nun wieder ein.
Minter lächelte. »Nehmen wir einmal an, Sie schließen morgen Ihre Praxis zu und gehen in den Wald und werden Holzfäller.«
»Das wäre ein mühseliges Brot«, erwiderte der Arzt.
»Richtig. Weshalb?«
»Ich bin die körperliche Anstrengung nicht gewohnt.«
»Was also würde geschehen?«
Kuhn zuckte mit den Achseln. »Worauf wollen Sie hinaus? Ich würde schnell ermüden und früher oder später elendig verhungern ...«
«... oder aber Sie gewöhnen sich an die Arbeit, Sie werden mit einem jeden Tag stärker und kräftiger und bilden Muskeln aus. Sie verändern sich.«
»Aber Auerochse, Mammut und Bär sind nicht größer geworden, sondern kleiner.«
»Vielleicht wurde die Nahrung knapper und sie sind nach und nach zusammengemagert. Was immer es war, die veränderten Lebensumstände haben sie dazu gebracht, sich zu entwickeln.«
»Und diese Veränderung wird weitergegeben von einer Generation zur anderen?«, fragte Kuhn skeptisch. »Zeugt ein Holzfäller automatisch auch einen kraftstrotzenden Sohn?«
Fuhlrott zog seine Pfeife und einen Tabakbeutel heraus und begann sie langsam zu stopfen, der Apotheker holte eine flache Blechdose aus der Tasche, klappte sie auf und nahm eine Zigarette heraus. Rosalie vernähte ihren Faden und biss ihn ab.
»Chevalier de Lamarck sagt, dass Fähigkeiten und Kenntnisse von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden, so beide Elternteile darüber verfügen«, sagte Minter, während er sich die Zigarette zwischen die Lippen klemmte.
Kuhn zuckte mit den Schultern, er schien nicht überzeugt.
»Aber wann ist dieser Prozess der Veränderung Ihrer Meinung nach abgeschlossen?«, fragte Fuhlrott, wobei er mit einem Mundwinkel lächelte, während der andere nach unten wies. »Wann haben die Arten und Rassen, die Pflanzen und Tiere und auch wir Menschen ihre vollkommene Form erreicht?«
»Nie«, sagte Minter. Er zog an seiner Zigarette und stieß dann weißen Rauch aus, durch den Mund und durch die Nasenlöcher. »Dieser Prozess ist niemals abgeschlossen. Alles geht immer weiter.«
Jeden Morgen um neun sah Rosalie ihre Freundin Dorothea Leder. Sie trafen sich an der Pumpe am Königsplatz, der genau in der Mitte zwischen ihren Häusern lag. Dann hatten sie zehn Minuten Zeit zum Reden, manchmal auch eine Viertelstunde, nicht viel, aber besser als gar nichts. Heute wartete Dorothea schon, als Rosalie von der Laurentiusstraße in die Gasse einbog, die große Kanne und den Zinkeimer unter dem Arm. Dorothea war wie Rosalie neunzehn Jahre alt, aber mit ihrem runden Kindergesicht, den roten Wangen und dem langen Haar, das sie immer zu einem Zopf geflochten trug, wirkte sie viel jünger.
»Kommst du endlich«, rief sie, als Rosalie sie erreicht hatte und klang dabei etwas atemlos, obwohl sie gewartet hatte. »Ich muss gleich los, Hermann hat das Fieber und ich kann ihn nicht lange allein lassen, aber etwas muss ich dir doch erzählen!«
»Was gibt es denn?« Rosalie stellte ihre Gefäße neben die vollen Eimer der Freundin. Dorothea sah sie an, dann senkte sie plötzlich den Blick, als schämte sie sich.
»Was ist es?«, fragte Rosalie, deren Herz auf einmal schneller schlug.
»Herr Kirschbaum hat mich gestern gefragt«, begann Dorothea und Rosalies Herz beruhigte sich wieder. Herr Kirschbaum. Wenn es um Herrn Kirschbaum ging, handelte es sich bestimmt um nichts Aufregendes.
Aber Dorothea schaute sich nervös um. Ein paar Schritte entfernt, an der Pumpe, standen zwei Frauen, die sie aber nicht beachteten. »Er hat mich gefragt, ob ich für ihn arbeiten will«, beendete sie dann den Satz mit gedämpfter Stimme.
»In der Bücherei?« Herrn Kirschbaum gehörte die Leihbibliothek auf der Alten Freiheit, hinter der Reformierten Kirche, und Dorothea war seine beste Kundin. Beinahe täglich ging sie hin und lieh sich Bücher aus, die neuesten Romane, wissenschaftliche Werke und Gedichtbände, Dramen, Sagen und Klassisches. Sie las, wann immer sie ein wenig Zeit dafür fand, während die Kartoffeln auf dem Herd kochten, während das Plätteisen aufheizte, während ihr jüngster Bruder auf dem Topf saß, sie las nachts, beim Schein der Öllampe.
»Was sollst du denn für ihn tun?«
»Ich soll ihm zur Hand gehen, bei allem, was anfällt. Ich würde ein paar Groschen verdienen und die Ausleihgebühr würde er mir ebenfalls erlassen ...«
«... allein dadurch würdest du ein Vermögen sparen! Aber meinst du, dass deine Leute ...?«
»Bist du von Sinnen?« Das Leuchten verschwand aus Dorotheas Gesicht. »Vater würde mich eher aus dem Haus jagen, als das zu erlauben.«
Die Leders waren Pietisten, sie gehörten der Niederländisch-reformierten Gemeinde an, die sich vor neun Jahren unter der Leitung von Pastor Kohlbrügge von der offiziellen reformierten Kirche abgespalten hatte. Oben in der Deweerthstraße hatten sie ihre eigene Kirche und ein Pastorat gebaut, dorthin pilgerte die Familie nun jeden Sonntag, jeden Feiertag und oft auch unter der Woche.
Für die Leders waren Gott und seine Gebote die Mauern, die ihrem Leben Halt gaben und ihrem Denken eine Grenze setzten. Rosalie, die daran gewöhnt war, dass man immer alles anzweifelte und überprüfte – Fragen sind dazu da, sie zu stellen, sagte ihr Vater immer – fand Dorotheas Familie in ihrer bedingungslosen Religiosität befremdlich und faszinierend zugleich.
Gott war der Maßstab, nach dem sich in der siebenköpfigen Familie alles richtete, und Gott, darin waren sich Dorotheas Eltern mit dem Rest der Gemeinde einig, hielt nichts vom Bücherlesen, sofern es sich nicht um die Heilige Schrift handelte. Natürlich kannten sie die Leidenschaft ihrer Tochter, ihre schändliche Schwäche, wie sie es nannten, und versuchten sie auszumerzen, einzudämmen, abzuwehren, wo immer es ging. Ihr Vater drohte und ihre Mutter beschwor sie und Dorothea versprach Besserung, aber nachts, wenn alle schliefen, setzte sie sich auf die Stufen vor dem Haus und las im Schein der Gaslaterne weiter.
Rosalie zuckte mit den Schultern. »Dabei passt eins wunderbar ins andere. Mit dem Geld, das du verdienst, könntet ihr ein Dienstmädchen bezahlen, damit wäre allen geholfen.«
Dorothea starrte auf ihre ausgetretenen Schuhe, die unter dem verblichenen Rock zum Vorschein kamen. »Es ist ganz und gar hoffnungslos«, sagte sie düster. »Und dann ausgerechnet bei Herrn Kirschbaum.«
Rosalie wusste, was sie damit meinte, jeder in Elberfeld hätte sie verstanden. Herr Kirschbaum war ein kleiner Mann, rundlich und um die vierzig, ein Jude, aber das war nicht einmal das Schlimmste. Er war einfach seltsam, ohne Frau und Kinder hauste er in ein paar Kammern hinter der Leihbibliothek. Man sah ihn selten auf der Straße, und wenn er seinen Laden einmal verließ, dann ging er schnell und mit gesenktem Kopf, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Er murmelte vor sich hin, ganz egal ob Leute im Laden waren oder nicht. »Kirschbaum«, murmelte er. Er redete sich selbst mit seinem Nachnamen an, auch das war seltsam. »Kirschbaum, die neue Lieferung muss noch aufgeschnitten werden, dass du es nicht wieder vergisst.«
Dorothea hatte Recht, es war undenkbar, dass ihre Eltern sie für diesen Mann arbeiten ließen, auch wenn er mit Kartoffeln oder Eiern gehandelt hätte anstelle von Romanen, hätten sie niemals eingewilligt.
Rosalie sah ihre Freundin an, sah ihr rundes, trauriges Gesicht und hätte sie so gerne getröstet, aber ihr fiel beim besten Willen nichts Aufmunterndes ein und nichts, was sie ihr hätte raten können. Plötzlich kam ihr die Apotheke wieder in den Sinn, die braungelben Gläser in Reih und Glied, die immer so ausgesehen hatten, als warteten sie auf sie. Aber jetzt gab es einen neuen Apotheker und außerdem war es ohnehin ein dummer, aussichtsloser Traum gewesen. Bei Dorothea ist es die Bibliothek und bei mir die Apotheke, dachte sie, und eines ist so sinnlos wie das andere.
»Ich muss los«, sagte Dorothea. Sie hob ihre beiden randvollen Eimer an und stellte sie in ihren Leiterwagen. Dabei schwappte ein Teil des Wassers über den Rand und färbte die Pflastersteine dunkel. »Wir sehen uns morgen.«
Am Mittwochabend kam Fuhlrott zu Besuch, obwohl er gewöhnlich nur donnerstags oder montags kam. Er trug einen zerschlissenen braunen Lederkoffer an Rosalie vorbei durch die Diele und legte ihn so behutsam auf den Esstisch, als wäre er zerbrechlich.
Rosalie und ihr Vater sahen ihm dabei zu, wie er den Deckel aufklappte. Der Koffer war mit einem Leintuch ausgelegt, auf dem vergilbten Stoff lagen bräunliche Gebeine. Lange kräftige Knochen mit dicken Wülsten an den Enden, ein größeres, scharfkantiges Fragment, der obere Teil eines Schädels, ein paar kleinere Knochenstücke.
»Keine Bärenknochen«, stellte Kuhn sofort fest, während er sich über die Skelettteile beugte und Rosalie dabei ein Stück zur Seite drängte, ohne es zu bemerken. Er nahm vorsichtig den größten Knochen aus dem Koffer und führte ihn so dicht an sein Gesicht heran, als wollte er an ihm riechen. »Ein Oberschenkelknochen, ganz ohne Zweifel«, murmelte er. »Menschlich. Aber gleichwohl eigentümlich. Was für eine Knochenstärke. Und diese Krümmung.«
Er sah Fuhlrott an und dieser nickte und zuckte gleich darauf mit der linken Schulter. Kuhn wandte sich dem Schädelteil zu. »Auch die Schädelform ist äußerst ungewöhnlich. Zu flach für einen menschlichen Kopf und diese Knochenwülste über den Augen scheinen fremd ...« Er drehte die Kalotte, so dass die auffallenden Augenbrauenwülste Rosalie bedrohlich anstarrten.
»Also doch ein Tierschädel?«, fragte Fuhlrott.
»Von welcher Tierart sollte er stammen?«, fragte Kuhn zurück. »Für eine Hyäne oder einen Wolf sind die Gebeine zu massiv. Nein, diese Skelettteile sind die eines Menschen, daran ist kein Zweifel. Sind das die Knochen, die Ihnen Pieper hat zukommen lassen?«
Fuhlrott nickte wieder. »Ich war gestern im Neandertal. Kalkarbeiter, die eine neue Höhle, die so genannte Feldhofer Grotte, für den Abbau vorbereiten sollen, haben die Skelettteile in der Lehmschicht gefunden. Die Knochen waren schon im Abraum vor der Höhle gelandet, glücklicherweise wurden sie im letzten Moment noch sichergestellt.«
Er setzte den Koffer mit den Skelettresten auf den Boden, dann begann er die Teile in anatomisch korrekter Anordnung auf den Tisch zu legen. Er fing unten an, mit den mächtigen Oberschenkelknochen, die ein Stück weit über den Tisch hinausragten, darüber legte er einen Teil des Beckenknochens. Dann links und rechts die Arme – der rechte Oberarmknochen mit Speiche und Elle, der linke Oberarmknochen nur mit der Elle, dazwischen schwammen fünf linke Rippen. Das rechte Schlüsselbein schloss den seltsamen Torso nach oben hin ab, darüber schwebte die Schädelkalotte, und weil sie flach auf den Tisch gelegt war, sah es aus, als ob das Skelett den Kopf gesenkt hielt, beschämt über seine eigene Unvollständigkeit.
Eine Weile starrten sie alle schweigend darauf, als erwarteten sie, dass sich die einzelnen Teile wie durch Zauberhand zusammenfügten und zum Leben erwachten.
Was sind das für Knochen, dachte Rosalie und Fuhlrott antwortete ihr, obwohl sie die Frage gar nicht laut ausgesprochen hatte.
»Ich glaube, diese Gebeine sind sehr alt«, sagte Fuhlrott. Seine Stimme, die sonst eher spöttisch klang, hatte mit einem Mal etwas sehr Ernstes und Ehrfurchtsvolles. »Ich habe den ganzen Tag darauf verwandt, sie zu untersuchen, und ich bin überzeugt davon, dass sie ...«, er atmete tief ein und dann wieder aus und plötzlich schien er unsicher. Seine Augen wanderten von den Skelettteilen zu Kuhn und wieder zurück. »Sie sind sehr alt«, wiederholte er.
»Wie alt«, fragte Kuhn leise. »Was meinen Sie?«
Jetzt blickten sie beide Fuhlrott an und Rosalie sah, dass kleine Schweißperlen auf seiner Stirn standen.
»Fossil«, sagte er.
»Das wäre in der Tat ...«, begann Kuhn und dann verstummte auch er wieder.
»Der Lehm, in dem die Gebeine gelegen haben, ist alles entscheidend für die Altersbestimmung«, sagte Fuhlrott schließlich und deutete auf die bräunlichen, trockenen Erdreste, die in den Vertiefungen der Knochen und an den Kanten der Gelenke hingen. »Man muss diese Lehmreste mit den Resten an dem Bärenzahn vergleichen, den ich vor einigen Monaten erhalten habe. Wenn die Sedimente miteinander übereinstimmen, wenn eine Probe zur anderen passt, dann können wir davon ausgehen, dass beide Individuen, Mensch und Höhlenbär, zur gleichen Zeit existiert haben.«
»Das bedeutet, dass es menschliche Individuen in der Diluvialperiode gegeben hat. Aber Cuvier behauptet das Gegenteil«, meinte Kuhn.
Die Diluvialperiode, das wusste Rosalie, war die Zeit der Sintflut, und die Wissenschaftler gingen davon aus, dass es vor und während dieser Zeit noch kein menschliches Leben gegeben hatte – wobei sie sich immer fragte, was es dann mit Adam und Eva, Kain und Abel und all den anderen Personen auf sich hatte, von denen die Bibel berichtete und die doch eindeutig vor der Sintflut gelebt hatten. Vielleicht war die Anzahl der Menschen so gering gewesen, dass sie im fossilen Sinne nicht zählten. Oder vielleicht waren die Wissenschaftler der Ansicht, ohne dass sie es offen aussprachen, dass auch die biblischen Berichte von der Erschaffung der Welt und von der Vertreibung aus dem Paradies Sinnbilder waren, so wie ihr Vater die Sintflut als Parabel betrachtete.
»Man muss die Gebeine zuerst einmal genau untersuchen und vermessen, bevor irgendwelche Schlüsse gezogen werden können«, sagte Fuhlrott ausweichend.
Kuhn betrachtete die Knochenteile auf dem Tisch, ohne etwas zu entgegnen, mit schief gelegtem Kopf.
»Die Arme«, meinte er nach einer Weile zusammenhanglos. »Ganz erstaunlich. Der rechte Oberarmknochen ist erheblich stärker als der linke.«
»Das ist wahr«, stimmte ihm Fuhlrott zu. »Also handelt es sich am Ende nicht nur um ein Individuum, sondern um zwei verschiedene? Vielleicht Mann und Weib?«
»Vielleicht.« Kuhn nahm den linken Knochen auf, dann verfiel er erneut in ein ausgedehntes Schweigen, während seine Finger wieder und wieder über das untere Ende des Knochens tasteten. »Unter Umständen aber auch nicht.«
»Wie bitte?«, fragte Fuhlrott.
»Meiner Meinung nach könnte es sich um eine Verletzung handeln«, erklärte Kuhn. »Das Gelenk ist beschädigt. Sehen Sie.« Er nahm auch die dazugehörige Elle auf und steckte das obere Ende in das Ellenbogengelenk des Oberarmknochens, dann hebelte er den Unterarm mehrmals auf und ab, die Bewegung war zackig und unregelmäßig. Es sah aus, als winkte der Skelettarm ihnen zu. »Sehen Sie?«, sagte er noch einmal und Fuhlrott nickte. »Wenn das Individuum seinen Arm nicht richtig einsetzen konnte, ist möglicherweise der Muskel verkümmert. Das wiederum würde die geringere Knochenmasse erklären.«
»Ich habe die Beschädigung am Gelenk wohl bemerkt«, meinte Fuhlrott. »Aber vielleicht ist sie ja auch der groben Behandlung durch die Steinbrucharbeiter zuzuschreiben. Die Männer haben die Gebeine mit Spitzhacken aus dem Lehm geschlagen. Wir sollten das Relikt genauer untersuchen. Ein Brennglas wäre äußerst nützlich.«
Nun sahen beide Männer Rosalie an, die einen Moment lang verständnislos zurückstarrte, bis sie begriff, was man von ihr erwartete. »In der Praxis.« Ihr Vater lächelte ihr aufmunternd zu.
Sie ging die Stufen hinunter, zuerst schnell, aber dann wurde sie mit jedem Schritt langsamer und gleichzeitig wütender. Es ist immer dasselbe, dachte sie, sie beachten mich nicht, es ist, als ob ich gar nicht da wäre. Aber wenn es etwas zu besorgen gibt, wenn ein Bierkrug geholt werden soll, ein Buch oder ein Vergrößerungsglas, dann erinnern sie sich an mich, dann bin ich gerade recht.
Sie legte die Lupe mit großem Nachdruck auf den Tisch, das Geräusch war so laut, dass die beiden Männer ihr Gespräch unterbrachen und sie irritiert ansahen.
»Das Brennglas. Hier ist es.«
»Danke, mein Liebes«, sagte ihr Vater, während er die Lupe aufnahm und an Fuhlrott weiterreichte, dann beugten sie sich über die braunen Knochen, Seite an Seite, Kopf an Kopf, und hatten sie schon wieder vergessen.
»Gute Nacht«, sagte Rosalie.
Die alte Friedel zog die kleine Holzkiste unten aus der Kaffeemühle, schüttete das Pulver in die Kanne und goss kochendes Wasser darüber. Augenblicklich erfüllte Kaffeeduft die Küche, aromatisch und gleichzeitig ein wenig bitter. Rosalie schnupperte lächelnd, aber dann fiel ihr Blick auf die Fliesen über dem Herd, deren ehemals weiße Oberfläche gelblich geworden war, verziert von Ornamenten aus Fett und Fliegendreck, und sie verzog das Gesicht. Friedels Augen waren nicht die besten und beim Putzen war sie nicht die Gründlichste. Rosalie tat sich schwer damit, die alte Dienstmagd zurechtzuweisen. Gut, dass ihre Mutter nicht mehr erleben musste, was für eine erbärmliche Hausfrau sie geworden war. Aber vielleicht war sie ja selbst nicht ordentlicher gewesen, Rosalie hatte sie ja nie kennengelernt.
Sie hörte ihren Vater aus seinem Zimmer kommen, seine schlurfenden Schritte im Flur. Dann stand er im Türrahmen und sie überlegte, ob sie ihn einfach ignorieren sollte, wie Fuhlrott sie immer ignorierte, aber stattdessen siegte ihre Neugier. »Was habt ihr herausgefunden gestern Nacht?«, erkundigte sie sich, als er am Tisch Platz genommen hatte, die Augen hinter den Brillengläsern rot und geschwollen vom Schlafmangel. »Ist es nun ein Urmensch oder nicht?«
Sofort verschwand die Müdigkeit aus seinem Gesicht, er wog den Kopf hin und her und lächelte dabei. »Es ist noch zu früh, ein abschließendes Urteil abzugeben, und man wird andere Experten, andere Wissenschaftler hinzuziehen müssen, das ist ganz außer Frage, aber nach unseren Untersuchungen deutet alles darauf hin, dass es sich um ein menschliches Individuum aus dem Ante-Diluvium handelt.« Er fuhr sich mit den Zeigefingern hinter den Brillengläsern über die Augen. »Fuhlrott will die Entdeckung im Verein vorstellen, ehe er sich damit an die Öffentlichkeit wagt.« Der Verein, das war der Naturwissenschaftliche Verein für Elberfeld und Barmen, den Fuhlrott vor ein paar Jahren gegründet hatte. Jeden Dienstag traf man sich, um Fragen der Botanik, Geologie und Archäologie zu diskutieren.
»Aber wenn das stimmt, das wäre ... unglaublich«, sagte Rosalie.
»Es wäre weltbewegend – wie die Erkenntnisse eines Galilei.«
Er rührte in dem Kaffee, den Friedel ihm hingestellt hatte, und sah mit leuchtenden Augen an Rosalie vorbei. Rosalie dachte daran, dass Galileo Galilei auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden wäre, wenn er seiner Überzeugung nicht abgeschworen hätte, und fröstelte plötzlich, obwohl es ein warmer Sommermorgen war.
Sie erzählte Dorothea von den Knochenfunden, als sie am Nachmittag zusammen Brombeeren pflückten.
»Ein Urmensch«, sagte Dorothea ungläubig.
»Ja, und nach der Beschaffenheit des Schädels zu urteilen, muss er recht wunderlich ausgesehen haben«, sagte Rosalie. »Der Kopf war viel flacher als der unsrige und über den Augenbrauen hatte er vorstehende Knochenwülste wie die Affen und auch die Glieder waren plumper und schwerfälliger. Es war eine primitive Vorstufe zu unserer heutigen Art.«
»Aber Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen am sechsten Tag«, meinte Dorothea. »In der Bibel steht nichts davon, dass er ihn nach der Erschaffung noch weiter verbessert hat.«
Rosalie schwieg betreten. Natürlich, trotz der unzähligen Bücher, die Dorothea verschlang, war sie doch ganz im bibeltreuen Glauben ihrer Eltern verhaftet und eine wissenschaftliche Denkweise war ihr fremd. Es war dumm gewesen, ihr von den Gebeinen zu erzählen. Ihrem Vater und Fuhlrott jedenfalls würde es nicht gefallen, wenn die Nachricht von spektakulären Funden aus der Urzeit die Runde machte, noch bevor sie die Knochen richtig untersucht hatten. Ihr Ruf war ohnehin nicht der beste. Kuhn galt als verschroben und freidenkerisch und Fuhlrott war Katholik und gehörte einer Freimaurerloge an, weshalb man ihn auch nicht zum Direktor seiner Schule gemacht hatte, sondern nur zum Stellvertreter. Und Rosalie war sich ganz sicher, dass Pastor Sommer damals Fuhlrott gemeint hatte, als er in einer Predigt gegen jene Ketzer gewettert hatte, die die heilige Ordnung der Schrift leugneten und die Wissenschaft höher als den einzig wahren Glauben stellten.
Sie blickte etwas unbehaglich zu Dorothea hinüber, aber diese begegnete ihrem Blick nicht, sie hielt die Augen auf ihren Korb gesenkt, dessen Boden mit Beeren bedeckt war. »Vielleicht war es ja gar kein Urmensch, sondern etwas ganz anderes. Ein großes Tier oder ein Riese ...«, meinte Rosalie zögernd.
Dorothea antwortete nicht und blickte auch nicht auf.
Schweigend pflückten sie weiter und Rosalie streckte ihre Finger nach ein paar prallen Beeren, aber sie erreichte sie nicht. Als sie den Arm zurückzog, riss sie ihn an einer Dornenranke auf, vom Handgelenk bis zum Ellenbogen erschien ein langer Kratzer auf der Haut, zuerst weiß, dann füllte er sich mit Blut.
»Was ist eigentlich aus der Sache mit Kirschbaum geworden?«, fragte sie, um das Gespräch auf ein unverfängliches Thema zu bringen. »War er gekränkt über deine Absage?«
Dorothea ließ ein paar Beeren von der rechten Hand in die linke gleiten, die sie wie eine Schale hielt, und betrachtete nachdenklich die Früchte, als habe sie vergessen, was sie damit anfangen wollte. »Ich habe nicht abgelehnt«, sagte sie schließlich leise.
»Ich verstehe nicht.« Rosalie suchte wieder Dorotheas Blick und dieses Mal hob Dorothea den Kopf und sah sie an. Im grellen Sommerlicht hatten ihre Augen einen schwarzen, harten Glanz, wie die Beeren in ihrer Hand. »Ich habe ihm zugesagt«, sagte sie. »Ab Montag werde ich für ihn arbeiten.«
2. Kapitel
»Nach Untersuchung dieses Gerippes, namentlich des Schädels, gehörte das menschliche Wesen zu dem Geschlecht der Flachköpfe, deren noch heute im amerikanischen Westen wohnen, von denen man in den letzten Jahren noch mehrere Schädel an der obern Donau bei Sigmaringen gefunden hat. Vielleicht trägt dieser Fund zur Erörterung der Frage bei: ob diese Gerippe einem mitteleuropäischen Urvolke oder bloß einer (mit Attila?) streifenden Horde angehört haben.«
(aus einem Artikel im »Barmer Bürgerblatt« vom 9. September 1856)
Dorothea pflückte ein paar Brombeeren vom Strauch und hielt sie in der Hand. Plötzlich verspürte sie das fast unwiderstehliche Bedürfnis, ihre Finger zusammenzupressen und die glänzenden Beeren zu zerquetschen. Aber dann ließ sie die Früchte zu den anderen Beeren in den Korb fallen.
Sie dachte darüber nach, was Rosalie soeben zu ihr gesagt hatte. Dass dieser Fuhlrott auf die Knochen eines Urmenschen gestoßen sei.
Die Knochen eines Urmenschen. Das war ja noch schlimmer als damals die Sache mit den Steinen, die Fuhlrott in der Eifel gefunden hatte und die angeblich mehrere hunderttausend Jahre alt waren. Rosalie hatte Dorothea davon berichtet und Dorothea hatte wiederum ihrer Familie beim Abendbrot davon erzählt. Ihr Vater war außer sich geraten. »Dieser Ketzer, dieser römische Ketzer!«, hatte er getobt, obwohl sie den Namen Fuhlrott gar nicht erwähnt hatte. Dorothea hatte die Augen auf ihren Teller gesenkt und geschwiegen und sich selbst verwünscht, dass sie den Mund nicht hatte halten können.
Abends war ihr Vater dann zu ihr in die Kammer getreten, mit der Bibel in der Hand, sie hatte gerade noch Zeit gehabt, ihr Buch unter dem Kopfkissen verschwinden zu lassen. Sie setzte sich aufs Bett und er setzte sich ihr gegenüber auf den Stuhl, dann schlug er die Schrift auf, das Buch Genesis, und las ihr das Geschlechtsregister von Adam bis Noah und von Sem bis Abraham vor und dann das Geschlechtsregister Esaus und die Könige und Stammesfürsten der Edomiter und schließlich noch einige andere Abschnitte und als ihr schon der Kopf schwirrte von den vielen Namen und Altersangaben und sie sich fragte, ob ihr Vater auf diese Weise das ganze Alte Testament durchgehen wollte, ließ er das Buch sinken und sah sie an.
»Verstehst du?«, fragte er. Sie verstand überhaupt nichts, aber das wollte sie ihm nicht sagen, weil sie befürchtete, dass er dann aufs Neue mit seinem Vortrag beginnen würde. Also nickte sie nur und senkte den Blick.
»Wer Ohren hat zu hören, der höre«, sagte ihr Vater. »Und wer rechnen kann, der rechne. Nach der Heiligen Schrift ist unsere Erde etliche tausend Jahre alt, aber nicht älter, und jeder, der etwas anderes behauptet, stellt sein Wort gegen das des Herrn.« Dann hatte er mit ihr gebetet, und seitdem hatten sie nicht mehr über den Vorfall gesprochen.
So hatte ihr Vater reagiert, als sie nur von altertümlichen Steinen erzählt hatte, und jetzt fing Rosalie sogar von den Skelettresten eines grobschlächtigen Urzeitmenschen an, die dieser verrückte Lehrer gefunden haben wollte. Doch damit wollte Dorothea nichts zu tun haben.
»Aber Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen am sechsten Tag«, sagte sie laut und bestimmt. »In der Bibel steht nichts davon, dass er ihn nach der Erschaffung noch weiter verbessert hat.«
Rosalie pflückte schweigend weiter und Dorothea fragte sich, ob sie die Freundin gekränkt hatte. Rosalie wuchs in einer so ungezwungenen Umgebung auf, ihr Vater ließ sie tun und machen, was sie wollte, so lange sie ihm nur einigermaßen den Haushalt in Ordnung hielt. Schon in der Volksschule hatte ihr ihre freie Art eine Menge Probleme bereitet, dieses Nachfragen und Nachhaken um jeden Preis. Dieses Verlangen, Zusammenhänge zu verstehen, die nicht zu verstehen waren.
Jetzt hätte Dorothea gerne etwas Versöhnliches gesagt, irgendetwas Belangloses, Freundliches, aber ihr fiel nichts ein. Und dann fing Rosalie auch noch von Kirschbaum an. Warum hatte sie ihr nur davon erzählt? Dass sie ihre Eltern hinterging, war schlimm genug. Aber sie hätte die Angelegenheit wenigstens für sich behalten müssen, statt mit Rosalie zu reden, die die Bedeutung dieser Sache ohnehin nie verstehen würde.
Am Montag begann sie ihre Arbeit für Isaak Kirschbaum. Sie betrat den kleinen Laden auf der Alten Freiheit, wie sie ihn unzählige Male zuvor schon betreten hatte: Sie schaute hastig über ihre Schulter, ob sie vielleicht jemand beobachtete, den sie kannte, dann zog sie das Kopftuch tiefer ins Gesicht und ging mit schnellen, kleinen Schritten über die Straße auf die Ladentür zu. Als sie die Tür öffnete, spürte sie die hohen, runden Fenster der Reformierten Kirche hinter sich, wie Augen bohrten sie sich in ihren Rücken. Es war nicht ihre Gemeinde, aber es wäre ihr dennoch lieber gewesen, wenn da ein anderes Gebäude gestanden hätte, nicht ausgerechnet eine Kirche.
Drinnen atmete sie aus und dann tief ein. Wie sie ihn liebte, diesen staubigen, muffigen Geruch nach Papier und die hohen, schmalen Regale, die sich deckenhoch und dicht an dicht drängten. Voller Bücher.
»Wünsche einen guten Morgen«, hörte sie eine vertraute Stimme irgendwo hinter den Regalen, auch das war wie immer.
»Guten Morgen«, gab sie zurück und zog dabei ihr Kopftuch vom Haar und den Mantel aus und das war neu.
Herr Kirschbaum kam zwischen zwei Regalreihen hervor und gab ihr die Hand. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, war sie überrascht darüber, wie klein er war, nur ein wenig größer als sie selbst. »Ich freue mich sehr«, sagte er förmlich. »Hätte nicht gedacht ...«, dann brach er ab, drehte sich um und ging vor ihr her zu dem Schreibtisch, der auf einer kleinen Empore inmitten der Regale stand.
»Hier, das wäre ... das ist Ihr Platz«, begann er. Ihr Blick wanderte zum Fenster, vom Schreibtisch aus konnte man auf die Straße sehen und von der Straße auf den Schreibtisch. Jeder, der vorbeiging, würde sie sehen können, wie sie an diesem Schreibtisch saß und arbeitete.
»Oder, wenn Sie wünschen, dort, im Hinterzimmer«, sagte Kirschbaum, der ihrem Blick gefolgt war.
Den ganzen Vormittag saß sie dort, umgeben von hohen Bücherstapeln, Büchern, die von den Lesern wieder zurückgebracht worden waren und deren Titel sie nun in der Ausleihkartei suchte. Wenn sie die betreffende Karte gefunden hatte, dann strich sie den untersten Namen auf der Liste durch und sortierte die Karte in alphabetischer Ordnung zurück in die Kartei. Und am Ende nahm sie die Bücher und stellte jeden Band zurück an seine Stelle im Regal.
Neben dem Tisch lag ein hoher Stapel mit neuen Büchern, druckfrisch von Verlagen, die sie für den Verleih vorzubereiten hatte, und während sie die Seiten aufschnitt, las sie hier einen Absatz und dort ein Wort, und immer wieder begann ihr Herz schnell und aufgeregt zu schlagen, so sehr freute sie sich, dass sie hier war. Und so sehr schämte sie sich.
Ihre Eltern dachten, dass sie sich um Tante Lioba kümmerte, die oben in der Nordstadt in einem kleinen Häuschen ganz alleine wohnte, aber die man nicht mehr allein lassen konnte, seit sie geworden war wie ein kleines Kind. Aber statt Dorothea ging die alte Walpurga zur Tante und Dorothea gab ihr dafür fast das ganze Geld, das sie bei Kirschbaum verdiente. Einen kleinen Teil gab sie ihr dafür, dass sie auf die Tante aufpasste und für sie kochte und ihr das Haus in Ordnung hielt, und einen größeren Teil gab sie ihr, damit sie den Mund hielt und niemandem davon erzählte.
Um zwölf Uhr ging Kirschbaum in seine kleine Wohnung hinter der Bibliothek und kurze Zeit später zog ein wunderbarer Geruch durch die halb offene Tür in den Raum, in dem Dorothea saß und arbeitete, und sie merkte, dass sie hungrig war. Sie fragte sich, ob es nun an der Zeit war, die Brote herauszuholen, die sie von zu Hause mitgebracht hatte, aber während sie noch darüber nachdachte, hörte sie ein Geräusch. Als sie aufblickte, sah sie Kirschbaum auf der Türschwelle stehen, klein und rundlich und ernst. Seine dunklen Augen unter den dichten Brauen wirkten irgendwie überrascht, als wunderte er sich, sie hier zu sehen.
»Also«, sagte er nach ein paar Sekunden leise. »Das Essen ist fertig.«
Dann drehte er sich um und ging. Sie folgte ihm in eine kleine, dunkle Küche, deren schmales Fenster unter der Decke lag, so dass man nicht hinaussehen konnte. Auf einem winzigen Tisch standen zwei Teller mit Suppe und davor warteten zwei Stühle, er hatte tatsächlich für sie gekocht. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, er sagte auch nichts und setzte sich schweigend hin, also nahm sie auf dem anderen Stuhl Platz. »Einen guten Appetit wünsche ich.« Er nahm den Löffel und begann zu essen.
»Danke«, sagte sie und dann senkte sie die Augen und faltete die Hände unter dem Tisch und sprach lautlos den Segen, weil sie es so gewohnt war. Als sie die Augen wieder aufschlug und ihn ansah, nickte er ihr zu und lächelte, und sie lächelte zurück.
Nach einigen Tagen hörte sie auf, sich morgens heimlich Brote zu machen, denn Kirschbaum kochte jeden Mittag für sie. Dabei hatte er eine Dienstmagd, die ihm den Haushalt machte, die für ihn putzte und wusch, aber das Kochen überließ er ihr nicht. Vielleicht beherrschte sie die komplizierten Regeln nicht, nach denen die Juden ihre Speisen zubereiteten, dachte Dorothea.
»Warum sprechen Sie Ihr Gebet nicht laut?«, fragte er am dritten Tag, nachdem sie vor dem Essen wieder still gebetet hatte. »Es stört mich nicht, im Gegenteil sogar.«
»Nein«, wehrte sie rasch ab. »Es ist nur meine Gewohnheit zu beten.«
»Ich weiß.« Er lächelte. »Nun, ich habe diese Gewohnheit leider verloren, deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie es für mich tun.«
»Aber ich bete doch zu einem anderen Gott«, sagte sie zögernd.
»Ich dachte immer, es gibt nur einen einzigen.«
»Natürlich«, meinte sie schnell und warf ihm von der Seite einen unsicheren Blick zu, um herauszufinden, ob er sich über sie lustig machte. Seine runden Augen waren ruhig und ernst. Ein bisschen traurig wie immer.
Abends nach der Arbeit ging sie immer in die Nordstadt, um bei Tante Lioba nach dem Rechten zu sehen. Der Weg dauerte eine Viertelstunde, sie ging so schnell sie konnte, mit gesenktem Kopf und mit niedergeschlagenen Augen, und hoffte, dass sie keiner sah und ansprach. Aber heute war die Hoffnung vergeblich.
»Wohin rennst du denn?«, fragte eine laute Stimme. Rosalie stand vor der Apotheke am Heckweiher, an einen Laternenpfahl gelehnt, als habe sie auf Dorothea gewartet.
»Ich muss zu Tantchen«, sagte Dorothea.
»Kommst du mit mir in die Apotheke?«, fragte Rosalie. »Ich muss meinem Vater ein paar Dinge besorgen. Hinterher begleite ich dich in die Nordstadt.«
Sie betraten zusammen den dunklen Ladenraum, Rosalie ging mit schwungvollen Schritten auf den jungen Mann hinter der Theke zu und streckte ihm einem Zettel entgegen. »Das ist Fräulein Leder«, stellte sie Dorothea vor.
Der Apotheker reichte Dorothea seine Hand über die Ladentheke. »Minter mein Name. Angenehm.«
Er war groß, sehr groß, Dorothea musste ihren Kopf in den Nacken legen, um ihm ins Gesicht zu blicken. Ein schöner Mann, aber irgendetwas an ihm flößte ihr ein Unbehagen ein. Sie hatte auch das Gefühl, dass sie ihn von irgendwoher kannte, dass sie ihn schon gesehen hatte, nicht nur einmal, sondern oft, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie etwas entgegnen musste. »Angenehm«, stotterte sie.
Die dunklen Augen musterten sie amüsiert. Dann wandte Minter sich Rosalie zu. »Ich habe die Tropfen schon vorbereitet, es dauert nur einen kleinen Moment.« Er ging in den Nebenraum und Dorothea und Rosalie warteten. Während sie auf die Regale starrten, hörten sie plötzlich über sich ein lautes Poltern und dann ein Dröhnen, wie von einem Erdbeben. Dorothea sah Rosalie fragend an, aber diese zuckte nur mit den Schultern. Schließlich kam Minter aus dem Nebenzimmer zurück und reichte Rosalie eine bräunliche Glasflasche.
»Vater sagt, ich soll Sie für den morgigen Abend einladen«, sagte Rosalie. »Dr. Fuhlrott wird auch zugegen sein.«
»Gibt es neue Erkenntnisse bezüglich der Gebeine?«, fragte der Apotheker.
Dorothea senkte den Blick zu Boden, als hätte er etwas Unzüchtiges gesagt. Diese elenden Knochen.
Rosalie zuckte mit den Schultern. »Fragen Sie ihn selbst.«
»Werden Sie auch da sein?«, fragte Minter.
Rosalie zögerte einen Augenblick, sie drehte die Flasche in ihrer Hand hin und her, dann verzog sie verächtlich ihren großen Mund. »Sicher bin ich dabei, wo sollte ich auch sonst hin.«
Zum Abendbrot gab es Kartoffeln mit saurer Milch und die ganze Familie saß an dem langen Tisch in der Küche, die Eltern und Dorothea und ihre jüngeren Brüder Traugott, Tobias, Matthis und der kleine Hermann. Hermann zerdrückte seine Kartoffel zu einem klumpigen Brei und zog dann mit der Gabel Furchen, so dass die dicke Milch durch die Rinnen floss. Dorothea beugte sich so weit es ging über ihren Teller, damit der Vater vom Tischende aus nicht sehen konnte, dass Hermann spielte anstatt zu essen.
»Die Männer werden morgen Abend gleich nach der Arbeit hier eintreffen und hungrig sein«, sagte Frau Leder. »Es ist vielleicht nicht genug, wenn wir ihnen nur Brot und Griebenschmalz anbieten. Ich werde in der Frühe noch eine Kohlsuppe kochen, das ist sicherlich besser.« Der Satz war keine Frage, dennoch hob sie die Stimme am Ende und sah ihren Mann an, der seine Fingernägel betrachtete.
»Die Gemeinde kommt aber nicht zum Essen, sondern zum Gebet«, meinte er, ohne ihren Blick zu erwidern. »Hungrig soll gewiss keiner gehen, aber Brot und Schmalz stillen den Hunger genauso gut wie Wasser den Durst.« Jetzt blickte er auf und sah so missbilligend aus, als habe sie vorgeschlagen, Bier oder Wein zu reichen.
Frau Leder nickte, dabei legte sie Hermann noch eine Kartoffel auf den Teller und zerstörte so seinen kunstvoll errichteten Dammsee. Dorothea blickte auf das Bild über dem Esstisch, das Jesus zeigte, wie er auf dem See Genezareth über das Wasser wandelte. Sein dunkles Haar fiel in sanften Wellen auf sein weißes Gewand, die warmen, braunen Augen blickten versonnen in die Ferne und plötzlich wusste Dorothea, an wen dieser Apotheker, dieser Minter, sie vorhin erinnert hatte. Mit seinen langen Haaren sah er aus wie Jesus.
Rosalie war so schroff und abweisend zu ihm gewesen, als er sie auf das Treffen in ihrem Haus angesprochen hatte. Ob sie ihn nicht mochte?
Morgen würden sie hier ihre Andacht halten und zur gleichen Zeit würden die beiden Doktoren, dieser Apotheker und Rosalie sich genauso andächtig über diese Knochen beugen und darüber spekulieren, welchem altertümlichen Wesen sie gehört hatten. Und waren sich nicht einmal bewusst, dass sie Gottes heiliges Wort in Frage stellten, dachte Dorothea und fragte sich, ob das die Sache besser machte oder schlimmer.
»Dorothea?« Die Stimme ihres Vaters riss sie aus den Gedanken.
»Ja?«
»Hast du nicht zugehört? Ich sprach von Tante Lioba.«
»Von Tante Lioba?« Ihr Herz setzte einen Schlag aus und begann dann zu rasen.
»Ob du sie morgen mitbringen kannst, zur Andacht.«
»Ich weiß nicht«, meinte Dorothea. »Sie ist ja so verwirrt. Ich weiß wirklich nicht.« Sie schwieg, während sie verzweifelt versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Warum wollte ihr Vater Tante Lioba dabeihaben? Auch früher, als sie noch bei Verstand gewesen war, war sie niemals zu ihren Andachten gekommen. Sie war auch kein Glied der Niederländisch-reformierten Gemeinde. Ahnte er etwas? Wollte er Dorothea am Ende gar auf die Probe stellen? Wie sollte sie sich verhalten?
Er betrachtete wieder seine Hände. »Gut.« Er nickte langsam. »Es werden so viele Leute kommen, auch die Ältesten, und wenn sie unruhig wird und laut, dann kann sich keiner sammeln.«
Dorothea nickte ebenfalls. Ihr Herz schlug jetzt wieder langsamer, weil die Gefahr vorüber war, aber sie fühlte sich schuldig, obwohl sie nichts anderes gesagt hatte als die Wahrheit. Tante Lioba würde ganz ohne Zweifel alles durcheinanderbringen. Aber das war nicht der Grund, warum sie sie nicht dabeihaben wollte. Sie hatte Angst, dass sie sie verraten würde. Und dass dann alle erfuhren, dass Dorothea das vierte Gebot brach und auch das achte, Tag für Tag aufs Neue.
Sie musste damit aufhören, sie musste dieses Doppelleben aufgeben. Aber dann dachte sie wieder an das Halbdunkel in der Bibliothek, an den Geruch von altem Papier und die Stapel neuer Bücher, die auf ihrem Schreibtisch im Hinterzimmer auf sie warteten, und sie spürte ein warmes, fast wollüstiges Gefühl in ihrem Leib und wusste, dass es immer so weitergehen würde, bis es nicht mehr weiterging.
Als sie an den Regalen von A bis Kr vorbei war und ihr kleines Büro fast erreicht hatte, hörte sie die Stimmen. Herrn Kirschbaums Stimme und eine Frauenstimme, die dünn und jämmerlich klang. Sie kamen aus den hinteren Räumen, in denen Kirschbaum lebte, und weil er noch niemals Besuch gehabt hatte, seit sie für ihn arbeitete, hielt sie inne und lauschte. »Ich bitte darum, nur dieses einzige Mal, es ist doch gewiss nicht zu viel verlangt ...«, klagte die Frauenstimme.
Dorothea schüttelte den Kopf über ihre Neugierde und wollte die Tür hinter sich schließen, aber jetzt kam die Frau aus Kirschbaums Wohnung. Sie war viel älter als Dorothea, eine kräftige Person mit hoch aufgetürmtem schwarzen Haar, die ein Taschentuch vor den Mund presste. Ihre runden Schultern hoben und senkten sich in raschem Wechsel. Sie weinte und als sie fast an der Tür vorbei war, wandte sie plötzlich den Kopf und starrte Dorothea an. Ihre schwarzen Augen lagen tief in runzeligen, rot verweinten Höhlen, aber aus diesen Tiefen heraus brannten sie so verächtlich, so hasserfüllt, dass Dorothea die Tür abrupt ins Schloss zog und mit zitternden Beinen an ihrem Tisch Platz nahm.
Was war das für eine Frau? Weshalb war sie so außer sich? Was für ein Geheimnis verbarg Kirschbaum, dieser ruhige, unscheinbare Mann?
Eine Affäre. Die Frau liebte ihn, und er hatte sie abgewiesen. Dorothea runzelte die Stirn. Was für ein Unsinn.
Die Frau war eine Leserin, die ein Buch ausgeliehen und verloren hatte und nun nicht dafür aufkommen wollte. Nein, dachte sie, die Frau hatte nicht verlegen ausgesehen oder ungehalten, sondern richtiggehend verzweifelt.
Sie schob die Gedanken von sich und zog stattdessen eines der Bücher von dem Stapel, der sich links auf ihrem Tisch auftürmte, der Stapel mit den Rückgaben. Sie musste die dazugehörige Karte aus dem Karteikasten holen und das Buch zurückschreiben und dann an seinen Platz ins Regal bringen, in diesem Fall war es das Regal von S bis Sh, denn es handelte sich um William Shakespeares dramatische Werke, übersetzt von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck.
Sie suchte die Karteikarte im Kasten und setzte einen winzigen Haken hinter den Namen des letzten Lesers, der das Werk entliehen hatte, legte die Karte vorne zwischen den Einband und die Titelseite und dann ließ sie das Buch fallen. Sie ließ es nicht absichtlich fallen, es glitt ihr einfach aus den Händen und blieb aufgeschlagen auf dem Boden liegen, mit dem Rücken nach oben wie ein toter Vogel.
Sie hob es schnell wieder auf, pustete den Staub vom Einband und wollte es eben weglegen, als ihr Blick auf die Stelle fiel, an der sich das Buch geöffnet hatte. Es war eine Stelle aus dem Kaufmann von Venedig, und ohne darüber nachzudenken, warum sie es tat, las sie den Satz, den der Daumen ihrer linken Hand unterstrich.
»Shylock:« las sie. »Gewinn ist Segen, wenn man ihn nicht stiehlt.« Und im selben Moment verstand sie und erschrak.
Sie hatte das Stück vor Jahren gelesen und erinnerte sich nicht an alles, aber sie wusste, dass es um zwei Freunde ging, von denen der eine Geld brauchte und der andere borgte es für ihn bei dem reichen Juden Shylock. Und dieser Shylock machte es zur Bedingung, dass er sich ein Pfund Fleisch aus dem Leib des Christenmenschen herausschneiden dürfe, so die Schuld nicht rechtzeitig zurückgezahlt werden würde. Ein Pfund Fleisch nahe beim Herzen. Das war kein Zufall. Das war ein Zeichen. Dieses Buch. Dieses Stück. Und ausgerechnet dieser Spruch. Gewinn ist Segen, wenn man ihn nicht stiehlt. Und dann die weinende Frau mit den schwarzen Haaren. Und Kirschbaum, der Jude war. Natürlich ging es um Geld, sagte das Zeichen, und ihr gesunder Menschenverstand sagte es auch, wenn sie eins und eins zusammenzählte. Kirschbaums Leihbibliothek warf guten Gewinn ab und nach Judenart verlieh er ihn gegen Zins an andere. Und die Frau konnte ihre Schuld nicht zurückzahlen, deshalb war sie so verzweifelt gewesen.
Dorothea schob das Buch mit spitzen Fingern weg, als wäre es klebrig oder heiß, dann hob sie den Kopf und sah, dass die Tür offen war, die sie vorhin geschlossen hatte, und dass Kirschbaum auf der Schwelle stand und sein stilles, in sich gekehrtes Lächeln lächelte. Sie spürte, wie ihr Gesicht zu glühen begann, als habe er sie bei etwas Verbotenem ertappt. Das Buch lag da, mitten auf dem Schreibtisch, William Shakespeares dramatische Werke, und sie hatte das Gefühl, dass es alles verriet, was sie über ihn wusste, aber das war natürlich Unsinn, es waren doch nur alte Theaterstücke.
Dennoch verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht von einem Moment zum anderen. »Ich bitte um Vergebung, ich war mir nicht bewusst, dass Sie schon da sind, weil die Tür geschlossen war ...«, sagte er förmlich. »Ich habe sie nur zugemacht, weil Sie Besuch hatten«, entgegnete sie ruhig. Sein Gesicht wurde noch ernster. Jetzt wusste er, dass sie wusste, worin sein eigentliches Geschäft bestand, womit er sein Geld verdiente.
Er nickte rasch mehrmals hintereinander, dann wandte er sich wieder zum Gehen. »Soll ich sie nun auflassen oder möchten Sie lieber ungestört ...?«
»Lassen Sie sie ruhig offen «, sagte sie, dann zog sie die Shakespeare-Ausgabe wieder zu sich und begann zu arbeiten.



![Der magische Blumenladen. Ein Geheimnis kommt selten allein [Band 1] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/bfd0d7f67be7d774666bcee00a7100be/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Fabelhafte Ferien [Band 8] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/eeddb4174d5824872fad5fb3d853c98b/w200_u90.jpg)
![Pferdeflüsterer-Academy. Flammendes Herz [Band 7] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1ce39ff55effea97b6067a010141e305/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Eine himmelblaue Überraschung [Band 6] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/401babdfc514b7b9b743c21e2d9e0987/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Die Reise zu den Wunderbeeren [Band 4] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/083234a7b3de6e42798c9d6c28bbb720/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Ein Brief voller Geheimnisse [Band 10] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/66f27df72721a7322e9589623110ef5b/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Der gefährliche Schulzauber [Band 9] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8c4a43bc44e8a8a3c4371ca0b6f88906/w200_u90.jpg)
![Internat der bösen Tiere. Der Verrat [Band 4 (Ungekürzt)] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/195ad640b295cdc3615ee699de2aaa2b/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Zaubern ist nichts für Feiglinge [Band 3] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/bc48cc06b29b36f523377c0425e26a0c/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Die verzauberte Hochzeit [Band 5] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/95076212a4ad10ee0ab1eb57651ebb4e/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Eine unheimliche Klassenfahrt [Band 12] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0a4dc14d80efb0d40a6d38173ec544ad/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Das verhexte Turnier [Band 7] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/86b7fc67e33dfe52ea2f600f419a3f77/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Ein total verhexter Glücksplan [Band 2] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/63cb300c30676a32483bd1a9ebe7adbf/w200_u90.jpg)
![Der magische Blumenladen. Hilfe per Eulenpost [Band 11] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a1fd8ed4a514a710ea758a7c1b741b6f/w200_u90.jpg)
![Die Stadtgärtnerin. Lieber Gurken auf dem Dach als Tomaten auf den Augen! [Band 1 (ungekürzt)] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b081c7f60f341f65485a897dc90b868/w200_u90.jpg)
![Internat der bösen Tiere. Die Prüfung [Band 1 (Ungekürzt)] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e179a66daff02383a6f3ca090717ae8f/w200_u90.jpg)
![Die Schule für Tag- und Nachtmagie. Mathe, Deutsch und Wolkenkunde [Band 2] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/284e287fa7e88177ba35795577b7bb41/w200_u90.jpg)









