
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine 50 Texte umfassende Märchensammlung aus dem 17. Jahrhundert: Der ursprünglich als "Märchen der Märchen" betitelte Band ist in fünf Tage aufgegliedert. Zehn Frauen erzählen an jedem dieser fünf Tage jeweils ein Märchen. Somit ist eine beachtliche Sammlung entstanden, die u.a. bei den Gebrüdern Grimm und Clemens Brentano Beachtung fanden und von ihnen zusammengefasst oder modernisiert wurden.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Basile Giambattista
Das Pentameron
Übersetzt Adolf Potthoff
Saga
Das Pentameron ÜbersetztAdolf Potthoff OriginalIl Pentamerone ossia la Fabia delle FiabeCopyright © 1634/36, 2020 Basile Giambattista und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726701401
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Wer sucht, was er nicht soll, findet, was er nicht will — so heißt es in einem Sprichwort aus der guten alten Zeit. Und hätte der Affe sich nicht die Stiefel angezogen, dann wäre er den Jägern nicht in die Falle gegangen. So geschah es auch einer lumpigen Mohrensklavin. Denn der Schleifstein glättet jede Rauheit, und einmal kommt der Tag, da jede Rechnung bezahlt wird. Daher stolperte endlich auch die über ihre eigenen Füße, die sich auf krummen Wegen verschafft hatte, was anderen zukam; und je höher sie gestiegen war, desto tiefer stürzte sie hinab. Und das wird in diesem Buche erzählt.
Es war einmal ein König von Vallepelosa. Der hatte eine Tochter namens Zoza, die man, gleich als wäre sie ein anderer Zoroaster oder ein zweiter Heraklit, niemals hatte lachen sehen. Der unglückliche Vater, der nichts anderes im Sinne hatte als diese einzige Tochter, ließ kein Mittel unversucht, um den Schatten der Melancholie von ihr zu vertreiben. Um sie zum Lachen zu reizen, ließ er bald Seiltänzer kommen, bald Reifenspringer, bald Schembartläufer; heute Gaukler, morgen Ringkämpfer, stark wie Herkules; einmal einen tanzenden Hund, ein andermal einen Esel, der aus einem Becher trank; nun Moriskentänzer, dann dies, dann das. Aber alles war vergebliche Liebesmühe, denn weder das Rezept eines Wunderdoktors noch das sardinische Kraut oder ein Stich ins Zwerchfell hatte ihren Mund auch nur zu dem leisesten Lächeln gekräuselt. Da nahm der arme Vater, der nicht mehr aus noch ein wußte, seine Zuflucht zu einem letzten Mittel.
Er gab Befehl, vor dem Portal seines Schlosses einen Ölbrunnen springen zu lassen, wobei er dachte, die Menschen, die auf der Straße wie die Ameisen hin und her liefen, würden vor dem spritzenden Brunnen — aus Angst, sich die Kleider zu beschmutzen — einherhüpfen wie die Grillen, springen wie die Böcklein, Haken schlagen wie die Hasen, so daß die Tochter beim Anblick all des Gleitens und Rutschens in ein helles Gelächter ausbrechen müßte.
Der Brunnen begann zu sprudeln, aber Zoza stand am Fenster und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Da führte der Zufall ein altes Weiblein des Weges, das sog das Öl mit einem Schwamme auf und drückte den in ein Krüglein aus. Während die Alte so alle Hände voll zu tun hatte und ganz in ihre Arbeit vertieft war, schleuderte so ein Satansbraten von Hofpage ein Steinlein so geschickt gegen das Krüglein, daß es in tausend Scherben zersplitterte. Die Alte, die Haare auf den Zähnen hatte und nicht gewohnt war, sich zum Narren halten zu lassen, fuhr herum und schrie den Pagen an: „Ha, du Schlingel, du Scheißkerl, du Bettpisser, du Taugenichts, du Schlappschwanz, du Galgenstrick, du Eselsbastard, auf dem sogar die Flöhe den Husten haben! Daß du doch den Tatterich kriegtest! Deiner Mutter gönnte ich die böse Nachricht. Wärst du doch vor die Hunde gegangen, ehe die Bäume wieder ausschlagen! Eine katalanische Lanze müßte dir zwischen die Rippen fahren! Das Seil sollte dir den Hals zuziehen, daß auch nicht ein einziges Tröpfchen Blut herauskäme. Eimerweise müßte das Unglück auf dich niederregnen! Keine Spur sollte von dir zurückbleiben, du Lump, du Tunichtgut, du Gauner, du Hurensohn!“
Nun hatte der Knabe zwar erst wenig Flaum auf den Wangen und noch weniger Bescheidenheit im Herzen, da er aber diesen Hagel unbeherrschter Schimpfworte auf sich niederprasseln fühlte, zahlte er es ihr mit derselben Münze heim und schrie: „Willst du wohl deine Kloake zumachen, du Satansbraten, du blutsaugerische Hexe, du Kindsmörderin, du Schlangengezücht, du Furzgesicht!“ Als die Alte diese Kosenamen hörte, stieg ihr die Wut in den Kopf, so daß sie den Kompaß ihrer Gelassenheit verlor, aus dem Stalle der Geduld ausbrach und den Vorhang ihrer Hinterbühne aufhob, so daß man den ganzen umbuschten Schauplatz erblickte und Silvio wohl hätte sagen können: „Geht hin und weckt die Schläfer mit der Trompete.“ Bei diesem Anblick bekam Zoza einen solchen Lachkrampf, daß sie beinahe ohnmächtig geworden wäre.
Durch den Lärm dieses Gelächters erneut in Wut versetzt, schnitt die Alte schreckliche Grimassen und rief: „Warte nur, du sollst auch nicht den Schatten eines Ehegatten finden, es sei denn, du bekämst den Fürsten von Camporotondo!“ Kaum hatte die Prinzessin diese Worte gehört, da ließ sie die Alte holen und wollte um jeden Preis wissen, ob sie sie habe beleidigen oder verwünschen wollen. Die Alte antwortete: „Der Fürst, den ich genannt habe, müßt Ihr wissen, ist ein Bild von einem Manne; er hat aber auf die Verwünschung einer Fee hin den letzten Pinselstrich an dem Gemälde seines Lebens getan und wurde außerhalb der Stadtmauern ins Grab gelegt. Auf seiner Gruft befindet sich eine Inschrift, die besagt, daß die Frau, die innerhalb von drei Tagen einen Krug, der dort an einem Haken hängt, mit ihren Tränen füllt, ihn vom Tode auferwecken und zum Gatten nehmen wird. Nun ist es aber unmöglich, daß zwei Menschenaugen so viele Tränen vergießen können, damit einen Krug zu füllen, der einen halben Scheffel faßt, es sei denn jene Nymphe Egeria, die, wie ich habe erzählen hören, in Rom in eine Tränenquelle verwandelt wurde; drum habe ich, als ich mich von Euch verlacht und verspottet sah, Euch diesen Fluch zugeschleudert, und ich bitte den Himmel, er möge ihn erfüllen zur Bestrafung des Unrechts, das mir zugefügt worden.“ Mit diesen Worten flitzte sie eilends die Treppe hinab, als säße ihr die Angst vor einer Tracht Prügel im Nacken.
Von Stund an begann Zoza über die Worte der Alten nachzusinnen und sie hin und her zu überlegen; der Versucher trat bei ihr ein, und nachdem sie das Rad der Gedanken und die Mühle der Zweifel immer wieder um diese Tatsache gedreht hatte, ließ sie sich endlich auf dem Wagen jener Leidenschaft, die den Verstand des Menschen verblendet und seine Urteilskraft lähmt, dahin bringen, daß sie einen ordentlichen Haufen Taler aus der Schatzkammer des Vaters nahm und aus dem Palaste des Königs entwich. Sie wanderte, bis sie an das Schloß einer Fee gelangte, und nachdem sie der ihr Herz ausgeschüttet, wurde die Fee von Mitleid gerührt mit dem jungen Mädchen, das zwei Sporen dem Abgrunde entgegenhetzten: ihre große Jugend und ihre übermächtige Liebe zu einem Unbekannten. Daher gab sie ihr einen Empfehlungsbrief an eine ihrer Schwestern, die auch zauberkundig war. Diese nahm sie mit vielen Aufmerksamkeiten auf, und als am anderen Tage die Morgenröte anbrach und die Nacht eine Botschaft an die Vögel erließ und demjenigen ein gutes Trinkgeld versprach, der ihr Kunde brächte über einen verlorenen Haufen Schatten, reichte sie ihr eine schöne Walnuß und sprach: „Nimm, mein Töchterchen, bewahre sie gut und öffne sie nur im Augenblicke höchster Not.“ Dann empfahl sie Zoza mit einem anderen Briefe an eine dritte Schwester. Nach langer Wanderung dort angekommen und genau so liebreich aufgenommen, erhielt sie von ihr einen Brief an eine vierte Schwester und eine Kastanie mit derselben Weisung, wie sie ihr mit der Walnuß gegeben worden war. Darauf machte sie sich wieder auf den Weg und gelangte an das Schloß der letzten Fee, die sie tausendmal liebkoste und ihr am nächsten Morgen beim Abschied eine Haselnuß verehrte mit derselben Mahnung, sie nicht zu öffnen, es sei denn, daß die äußerste Not sie dazu zwinge.
Im Besitz dieser Gaben nahm Zoza den Weg unter die Füße und wanderte durch so viele Länder und durchquerte so viele Wälder und Flüsse, daß sie nach sieben Jahren — es war gerade in dem Augenblick, da die Sonne, von den Trompeten der Hähne geweckt, ihr Pferd gesattelt hatte, um die gewohnten Posten abzureiten — fast lahm in Camporotondo ankam. Noch hatte sie das Stadttor nicht erreicht, da erblickte sie das Marmorgrab am Fuße einer Quelle, die, in ein Porphyrbecken eingeschlossen, kristallene Tränen weinte. Sie nahm den Krug von der Wand, setzte ihn zwischen die Knie und begann die Komödie der beiden Zwillinge zu spielen, sie unten und die Quelle oben, und nicht eher hob sie den Kopf von der Öffnung des Kruges, als bis in weniger als zwei Tagen die Tränenflut bis hoch an den Rand gestiegen war und an der ganzen Füllung nur noch zwei Fingerbreit fehlten. Ehe Zoza aber diesen Stand erreicht hatte, war sie vom vielen Weinen so müde geworden, daß sie, ohne widerstreben zu können, vom Schlafe überwältigt wurde und gezwungen war, sich für ein paar Stunden unter das Zelt ihrer Augenlider zurückzuziehen.
In dieser Zeit legte sich eine krummbeinige Mohrensklavin — sie begab sich oft mit einem Fäßchen zum Wasserschöpfen an die Quelle und kannte deren allerorten beredete Inschrift recht gut —, die gesehen hatte, wie Zoza dasaß und in zwei Bächlein ihre Tränen verströmte, auf die Lauer, um ihr den Krug, wenn er ungefähr voll wäre, aus den Händen zu nehmen und sie mit einer Handvoll Fliegen sitzen zu lassen. Als sie bemerkte, daß Zoza eingeschlafen war, zog sie ihr geschickt den Krug vom Schoße, hielt ihre Augen darüber und füllte ihn im Handumdrehen bis oben an den Rand. Kaum war er voll, da erhob sich der Fürst wie einer, der aus langem Schlaf erwacht, aus seinem Marmorsarg und streckte die Hände nach dem schwarzen Fleischkloß aus, den er auf der Stelle in seinen Palast führte und unter Festen und wunderbarem Feuerwerk zu seiner Gemahlin machte.
Inzwischen erwachte Zoza. Als sie den Krug auf dem Boden und damit ihre Hoffnungen im Staube und das Grab der Verzweiflung geöffnet sah, da krampfte sich ihr Herz zusammen, und es fehlte nicht viel, so hätte sie das Gepäck ihrer Seele an dem Zollhause des Todes abgelegt. Da es aber nun einmal kein Mittel gegen ihr Leid gab und sie sich über nichts anderes zu beklagen hatte als über ihre Augen, welche die Schäfchen ihrer Hoffnungen nicht sorgfältig genug bewacht hatten, wandte sie sich langsamen Schrittes dem Stadtinnern zu. Dort hörte sie von dem Feste des Fürsten und von der hochedlen Gemahlin, die er heimgeführt, und nun konnte sie sich ohne weiteres vorstellen, wie alles zugegangen war. Da sprach sie unter Seufzern, zwei dunkle Wesen hätten sie auf die nackte Erde gesetzt, der Schlaf und die Mohrin. Um nun aber nichtsdestoweniger gegen den Tod, dem sich jedes Wesen nach Kräften widersetzt, kein Mittel unversucht zu lassen, nahm sie in einem schönen Hause gegenüber dem Palaste des Fürsten Quartier. Von hier aus konnte sie, wenn es ihr schon versagt sein sollte, den Abgott ihres Herzens zu erblicken, wenigstens die Mauern des Tempels betrachten, die ihn umschlossen. Fürst Taddeo, der bisher wie eine Fledermaus die schwarze Nacht der Sklavin umflattert hatte, erblickte nun eines Tages Zoza, und auf der Stelle wurde er zum Adler und ließ diesen Ausbund aller Köstlichkeiten der Natur, dieses Trumpf-As der Schönheiten, keinen Augenblick mehr aus den Augen. Kaum hatte die Mohrin das bemerkt, schlug sie einen Höllenlärm, und da sie gesegneten Leibes war, drohte sie dem Gatten: „Wenn du nicht Fenster verlassen, ich mich schlagen in Bauch und klein Georglein totdrücken.“ Um seinen Sprößling besorgt, zitterte Taddeo wie Espenlaub und riß sich aus Furcht vor ihrem Mißfallen von Zozas Anblick los wie die Seele vom Leibe.
Als Zozas schwachen Hoffnungen auch noch diese gebrechliche Stütze entzogen wurde, wußte sie im ersten Augenblick nicht, woran sie sich halten sollte. In dieser äußersten Not erinnerte sie sich an die Geschenke der Feen. Sie öffnete also die Walnuß, und heraus sprang ein Zwerglein wie ein Püppchen so groß, die zierlichste Gestalt, die man auf Erden je gesehen, und das setzte sich ans Fenster und begann mit so viel Trillern, Figuren und Läufen zu singen, daß es die berühmtesten Volkssänger und die Königin der gefiederten Sänger weit hinter sich ließ. Zufällig erblickte und hörte die Mohrensklavin den kleinen Sänger. Da überkam sie ein so großes Verlangen nach ihm, daß sie Taddeo rief und sprach: „Wenn ich nicht haben das Sängerlein, ich mich schlagen in Bauch und klein Georglein totdrücken.“ Der Fürst, der völlig nach der Flöte seiner schwarzen Gemahlin tanzte, schickte sofort zu Zoza und ließ fragen, ob sie ihm den Kleinen verkaufen wolle. Zoza erwiderte, sie sei keine Händlerin; wenn er das Zwerglein aber als Geschenk betrachten wolle, so möge er es nur nehmen, denn sie wolle es ihm gern verehren. Immer nur darauf bedacht, seine Frau bei guter Laune zu halten, damit sie ihr Kind glücklich zur Welt bringe, stimmte Taddeo zu.
Vier Tage darauf öffnete Zoza die Kastanie, und heraus trat eine Glucke mit zwölf goldenen Küchlein. Sie setzte sich an dasselbe Fenster, und als die Mohrin sie erblickte, packte sie ein unbändiges Verlangen danach. Daher rief sie Taddeo, zeigte ihm das wunderschöne Spielzeug und sprach: „Wenn du die Glucke nicht holen, ich mich schlagen in Bauch und klein Georglein totdrücken.“ Taddeo, der sich von der türkischen Hündin einschüchtern und vollständig beherrschen ließ, schickte von neuem zu Zoza und bot ihr für die Glucke jeden Preis, den sie verlange. Zum andern Male erhielt er dieselbe Antwort, daß er sie nur als Geschenk bekommen solle; wenn er aber dächte, sie kaufen zu können, so seien seine Worte in den Wind gesprochen. Da ihm nichts anderes übrig blieb, beugte sich seine Klugheit vor der Notwendigkeit, und er heimste den schönen Fang ein und wunderte sich über die Freigebigkeit dieses Weibes, wo doch die Weiber sonst von Natur so habgierig sind, daß ihnen nicht sämtliche Goldminen Indiens Genüge tun.
Wieder vergingen einige Tage, da öffnete Zoza die Haselnuß, aus der eine Puppe hervorging, die goldene Fäden spann, eine wahrhaft wunderbare Erscheinung. Kaum hatte Zoza sich an dasselbe Fenster gesetzt, und kaum war der Blick der Mohrin daraufgefallen, da rief sie auch schon nach Taddeo und wiederholte dieselbe Melodie: „Wenn du nicht Puppe kaufen, ich mich schlagen in Bauch und klein Georglein totdrücken!“ Taddeo, der sich wie ein Kreisel aufdrehen und von seiner Frau an der Nase herumführen ließ, wollte persönlich zu ihr gehen, denn ihm kamen die Sprichwörter in den Sinn: ,Besser ist’s, selbst zuzufassen, als auf Fremde sich verlassen.‘ — ,Selbst geh, hast du was im Sinn, und wenn nicht, schick andre hin.‘ — ,Wer Fische will zum Essen fangen, muß selber nach der Angel langen.‘ Und er bat sie umständlich um Entschuldigung wegen der unbeherrschten Gelüste der Schwangeren. Zoza aber, die vor Wonne fast zerfloß, da nun endlich der Quell all ihrer Leiden vor ihr stand, beherrschte sich um so mehr und ließ sich bitten und beschwören, um ihr Schifflein in Fahrt zu halten und möglichst lange den Anblick des Geliebten zu genießen, der ihr von einer häßlichen Mohrin entrissen worden war. Schließlich gewährte sie ihm die Puppe, wie sie es mit den anderen Dingen auch getan hatte. Ehe sie sie ihm jedoch überreichte, flüsterte sie dem Figürchen ein, es solle in der Brust der Mohrin das Gelüste wecken, sich Geschichten erzählen zu lassen. Da stand nun Taddeo und hielt die Puppe in der Hand, für die er nicht einen roten Heller gegeben hatte, und fand keine Worte für so viel Freundlichkeit. Endlich bot er ihr als Gegengabe für ihre Huld Reich und Leben an, kehrte in den Palast zurück und brachte der Mohrin das Spielzeug.
Die setzte sich das Püppchen auf den Schoß, um sich an ihm zu ergötzen, und siehe da: wie Amor in Gestalt des Ascanius auf Didos Schoße saß und das Feuer ihres Herzens entzündete, so weckte die Puppe in der Mohrin denWunsch nach Märchen, so daß sie nicht widerstehen konnte und Angst hatte, sich den Mund zu berühren und Kinder zur Welt zu bringen, die zudringlicher werden würden als eine ganze Schiffsladung voll Bettelvolk. Daher rief sie wie gewöhnlich nach ihrem Gemahl und wiederholte den gewohnten Spruch: „Wenn nicht kommen Leute Märchen erzählen, ich mich schlagen in Bauch und klein Georglein totdrücken.“
Um ungesäumt diesen Wunsch zu erfüllen, ließ Taddeo ausrufen, alle Frauen des Landes sollten sich an einem bestimmten Tage beim Aufgange des Sternes Diana, der Aurora weckt, damit sie die Straße für die Durchfahrt der Sonne schmücke, an einem bezeichneten Orte einfinden. Da es ihm aber zuwider war, daß das gesamte Weibervolk die Hände in den Schoß legen sollte nur wegen eines seltsamen Gelüstens seiner Frau, und da er außerdem zu ersticken fürchtete in dem Gedränge einer solchen Menge, wählte er zehn von ihnen aus, und zwar die Besten der Stadt, die ihm die gescheitesten und zungenfertigsten zu sein schienen. Und das waren: die lahme Zeza, die krumme Cecca, die kropfhalsige Menica, die großmäulige Tolla, die bucklige Popa, die geifernde Antonella, die breitmäulige Ciulla, die triefäugige Paola, die grindige Ciommetella und die schlampige Jacova. Nachdem ihre Namen aufgeschrieben und die anderen entlassen worden waren, erhoben Taddeo und die Mohrin sich von den Thronsesseln und begaben sich gemessenen Schrittes zu einem Garten des Schlosses, wo die laubigen Zweige so ineinander gewachsen waren, daß die Sonne mit dem Kamme ihrer Strahlen sie nicht zu entwirren vermochte. Sie ließen sich in einer von Reben überwachsenen Laube nieder, in deren Mitte ein großer Brunnen sprudelte — der Lehrmeister der Hofschranzen, die er jeden Tag in der Kunst der Geschwätzigkeit unterrichtete —, und Taddeo nahm wie folgt das Wort:
„Es gibt nichts Verlockenderes auf der Welt, meine verehrten Damen, als von den Taten anderer Menschen zu hören, und nicht ohne Grund erblickte jener große Philosoph das höchste Glück der Menschenkinder in dem Anhören gefälliger Geschichten: wenn man nämlich angenehmen Dingen sein Ohr leiht, verflüchtigt sich der Kummer, vergehen die trüben Gedanken und verlängert sich das Leben. Denn seht, aus Gelüste nach Neuigkeiten verlassen die Handwerker ihre Werkstätten, die Kaufleute ihre Kontore, die Advokaten ihre Gerichtshöfe, die Krämer ihre Läden und gehen in die Barbierstuben und wo sie sonst noch Schwätzer finden, um mit offenen Mäulern falschen Nachrichten, aus der Luft gegriffenen Zeitungen und erfundenen Berichten zu lauschen. So werdet ihr auch meine Gemahlin entschuldigen, daß sie sich das Gelüste in den Kopf gesetzt hat, Mären zu hören. Wenn es euch gefällt, dem Verlangen meiner Fürstin zu entsprechen und damit in den Mittelpunkt meiner eigenen Wünsche zu treffen, so seid es zufrieden, während der vier oder fünf Tage, bis ihr Leib sich seiner Bürde entledigt, jeden Tag, und zwar jede von euch, eine Geschichte zu erzählen,wie es die alten Weiblein mit den Kindern machen, um ihnen die Zeit zu vertreiben. Findet euch also immer an demselben Orte ein, wo man zuerst essen und dann mit dem Erzählen beginnen wird. Der Tag soll dann beschlossen werden mit einem von unseren eigenen Dienern aufgeführten Hirtenspiel, und so wollen wir unser Leben in Freuden fristen, hat doch mit dem Tode alle Fröhlichkeit ein Ende!“
Diesen Worten nickten alle beifällig zu. Inzwischen waren die Tische aufgestellt, die Schüsseln hereingetragen worden, und sie begannen zu speisen. Nachdem sie sich tüchtig gütlich getan, gab der Fürst der lahmen Zeza ein Zeichen, auf daß sie Feuer an die Kohlen lege. Zeza verbeugte sich tief vor dem Fürsten und seiner Gemahlin und begann also zu erzählen:
Erster Tag
I Der Zauberer
Antuono von Marigliano, von seiner Mutter als der Obertölpel aller Tölpel aus dem Hause gejagt, tritt in die Dienste eines Zauberers. Er wird von diesem, da er Sehnsucht nach der Heimat hat, mehrere Male beschenkt, läßt sich jedoch immer wieder von einem Wirte prellen. Zuletzt aber, als er einen Knüppel zum Geschenk erhält, der seine Unerfahrenheit züchtigt, läßt er den Wirt die Strafe bezahlen für die Betrügereien, die er an ihm verübt hat, und sein Haus wird reich durch ihn.
Der Mann, der gesagt hat, das Schicksal sei blind, war offenbar noch weiser als Meister Lanza; denn es schlägt blindlings drein, hebt Leute auf den Gipfel, die man, abgerissen wie die Vogelscheuchen, nicht einmal aus einem Bohnenfeld verjagen würde, und schmettert andere in den Staub, welche die Blüte der Menschheit sind, wofür ich euch sogleich ein Beispiel geben will:
Es war einmal, so wird erzählt, im Lande Marigliano eine tüchtige Frau namens Masella. Die hatte außer sechs heiratsfähigen Töchtern, so schlank wie die Bohnenstangen, einen Sohn, und der war ein solcher Tropf, ein derartiges Rindvieh, daß er nicht einmal zum Schneeballmachen taugte. Er glotzte drein wie eine gestochene Sau, und es verging kein Tag, daß sie nicht zu ihm sagte: „Was hast du eigentlich in unserm Hause verloren, du verfluchtes Stück? Verdufte, du Schurke, verschwinde, du Makkabäer, heb dich von dannen, du Unglückswurm, geh mir aus dem Wege, du Vielfraß! Du bist mir in der Wiege vertauscht worden. Statt eines Püppchens, eines Herzblättchens und wunderlieben Engelchens hat man mir einen widerlichen Wechselbalg hineingelegt!“ Kurzum, Masella redete, und er pfiff dazu.
Als sie sah, daß alle Hoffnungen, aus Antuono — so hieß der Junge — werde jemals etwas Gescheites werden, vergeblich waren, wusch sie ihm eines Tages den Kürbis ohne Seife, nahm einen Prügel in die Hand und machte sich daran, ihm das Wams auszumessen.
Da Antuono,als er es am wenigsten erwartet hatte, sich so durchgewalkt, gestriegelt und gekrempelt sah, entschlüpfte er ihren Händen, gab Fersengeld und lief und lief, bis er zu der Stunde, da an den Himmelsfenstern die Lichter aufzuflammen begannen, am Fuße eines Berges ankam, der so hoch war, daß er an die Wolken stieß.
Da erblickte er auf der Wurzel einer Pappel in der Nähe einer Bimssteinhöhle einen Zauberer. O Schreck, wie war der häßlich! Von Gestalt winzig wie ein Zwerg, hatte er einen Kopf dicker als ein indischer Kürbis, eine Stirn voller Blatternarben; die Augenbrauen waren ihm zusammengewachsen, die Augen standen schief, die platte Nase zeigte zwei Nasenlöcher, schmutzig wie die Kloaken, ein Maul hatte er wie ein Scheunentor, und daraus sprangen zwei Stoßzähne hervor, die ihm bis an die Knöchel reichten. Zottig war seine Brust, Arme hatte er wie eine Haspel, Beine so krumm wie ein Torbogen und Füße so breit wie Entenfüße. Kurzum, er sah aus wie ein scheußlicher Teufel, ein widerlicher Bettler, ein wahres Höllenscheusal, das einen Roland mit Schrecken und einen Skanderbeg mit Angst erfüllt hätte, und bei dessen Anblick der kühnste Haudegen in Ohnmacht gefallen wäre.
Antuono aber, der sich nicht wie eine Wetterfahne drehte, nickte mit dem Kopf und sagte: „Grüß Gott, Herr! Wie geht’s? Wie steht’s? Nichts gefällig? Wie weit ist es noch bis zu dem Ort, wohin ich gehen muß?“ Als der Zauberer dieses ungereimte Zeug hörte, schlug er eine Lache auf, und da ihm das Wesen dieses Schafskopfes gefiel, sagte er zu ihm: „Willst du in meine Dienste treten?“ Antuono erwiderte: „Was verlangt Ihr denn im Monat?“ Der Zauberer: „Warte ab und diene mir redlich, dann werden wir schon einig werden, und du sollst ein gutes Leben haben!“
Als sie handelseinig geworden waren, blieb Antuono als Diener bei dem Zauberer, in dessen Hause ihm die gebratenen Tauben nur so ins Maul flogen, und wo er, was die Arbeit anging, faulenzen konnte nach Herzenslust, so daß er schon nach vier Tagen fett war wie ein Türke, feist wie ein Ochse, keck wie ein Hahn, rot wie ein Krebs, grün wie Knoblauch und dick wie ein Walfisch, dabei vierschrötig und von so praller Haut, daß er kaum aus den Augen schauen konnte.
Es waren noch keine zwei Jahre vergangen, da wurde ihm das fette Leben so zuwider, und der Wunsch und das Verlangen, eine Reise nach Marigliano zu machen, so unbändig, daß er nur noch an sein Elternhaus dachte, sich vor Heimweh verzehrte und bald wieder so aussah wie früher. Der Zauberer, der ihm bis auf den Grund des Herzens sah und erkannte, daß es ihn juckte wie einer jungen Frau, die nicht auf ihre Kosten gekommen ist, rief ihn beiseite und sprach: „Lieber Antuono, ich weiß, du hast große Sehnsucht nach deinem Fleisch und Blut; und da ich dich liebe wie meinen Augapfel, will ich es zufrieden sein, wenn du eine Reise machst und dein Heimweh stillst. Nimm daher diesen Esel, der wird dir die Mühe des Weges verkürzen; sei aber vorsichtig und hüte dich zu sagen: ,Arri, cacauro!‘ Denn das würde dir leid tun, bei der Seele meines Großvaters!“
Antuono nahm das Grautier zwischen die Schenkel und trabte von dannen, ohne ,Guten Abend‘ zu sagen. Aber er hatte noch keine hundert Schritte getan, da sprang er schon von dem Esel und fing an zu rufen: „Arri, cacauro!“ Kaum hatte er den Mund geöffnet, da hob das Langohr den Schwanz und schüttete Perlen, Rubine, Smaragde, Saphire und Diamanten aus, jedes so dick wie eine Walnuß. Antuono riß das Maul auf wie ein Scheunentor, als er sah, was für schöne Dinge da dem Esel aus dem Leibe purzelten, und staunte über die prächtige Entladung und den kostbaren Durchfall des Eselchens. Jubelnd steckte er sich den Reisesack mit den Juwelen voll, stieg wieder auf, stieß dem Reittier die Fersen in die Flanken und langte an einer Herberge an.
Hier stieg er ab, und das erste, was er zu dem Wirte sagte, war: „Binde diesen Esel an die Krippe; gib ihm zu fressen die Fülle; aber hüte dich zu sagen: ,Arri, cacauro!‘ Denn das würdest du zu bereuen haben. Und bewahre mir diese Sächelchen an sicherem Orte auf.“ Der Wirt war ein ausgekochter Junge und mit allen Wassern gewaschen. Kaum hatte er die unverhoffte Weisung vernommen und die Juwelen gesehen, deren Wert in die Tausende ging, da kitzelte ihn die Neugier, zu erfahren, welche Wirkung diese Worte haben würden. Er setzte daher dem Antuono ein gutes Nachtmahl vor, gab ihm zu trinken, mehr als er vertragen konnte, und steckte ihn dann zwischen Strohsack und Bettdecke. Kaum sah er ihn in Schlaf fallen, und kaum hörte er ihn laut schnarchen, da lief er auch schon in den Stall und sagte zu dem Esel: „Arri, cacauro!“ Und der Esel führte mit der Medizin dieser Worte die gewohnte Operation aus, stieß den Zapfen aus seiner Hintertonne, und es gab einen goldenen Durchfall und eine Flut von Edelsteinen.
Beim Anblick dieser kostbaren Entleerung faßte der Wirt den Plan, den Esel zu vertauschen und dem Vielfraß von Antuono eins auszuwischen, denn es dünkte ihn gar leicht, ein solch dummes Schwein und Rindvieh, einen solchen Narren, Tropf und Tölpel, wie ihm da einer in die Hände gefallen war, anzuführen, auf den Arm zu nehmen, zu betuppen, zu beschummeln, hinters Licht zu führen und ihm ein X für ein U vorzumachen. Antuono erwachte, als Aurora gerade hervorkam, um den Nachttopf ihres Alten voller roter Pisse durch das Fenster des Ostens zu gießen. Er rieb sich die Augen mit den Händen, reckte eine halbe Stunde lang die Arme, führte Dutzende von Malen hin und her ein Zwiegespräch zwischen Gähnen und Fürzen, rief den Wirt und sprach zu ihm: „Komm her, Kamerad, dicke Rechnungen, lange Freundschaft, Friede zwischen uns, Krieg zwischen den Geldbeuteln, schreib mir die Rechnung und mach dich bezahlt.“ Und so zog er aus seinem Beutel so viel für Brot, so viel für Wein, dies für die Suppe, das für das Fleisch, fünf Groschen für den Stall, zehn für das Bett, fünfzehn als Trinkgeld: Und damit nahm er den vertauschten Esel und ein Säckchen mit Bimssteinen statt Edelsteinen und ritt in flottem Trabe der Heimat zu.
In Marigliano begann er — noch ehe er einen Fuß in sein Elternhaus gesetzt hatte — zu schreien, als ob er in die Brennesseln gefallen wäre: „Lauf her, Mama, lauf! Jetzt sind wir reiche Leute! Breite Handtücher auf den Boden, falte Bettücher auseinander und lege Decken daneben, du sollst ein kleines Wunder erleben!“ Mit großer Freude öffnete die Mutter eine Truhe, darin sie die Aussteuer ihrer Töchter bewahrte, nahm Bettücher heraus, die unter dem leisesten Hauch von dannen flogen, Handtücher, die frisch nach der Wäsche dufteten, mit Farben geziert, die einem in die Augen stachen, und breitete alles zierlich auf dem Boden aus. Und Antuono führte seinen Esel hinauf und rief: „Arri, cacauro!“ Aber sooft er auch „Arri, cacauro!“ sagen mochte, der Esel machte sich soviel daraus wie aus dem Klang der Leier. Als er ihn aber drei-, viermal aufgefordert hatte und alles in den Wind gesprochen war, nahm er einen dicken Knüppel und fing an, auf das unglückliche Tier einzuschlagen; und er prügelte und prügelte, daß der arme Graue fast aus den Fugen ging und einen schönen gelben Brei auf die weißen Tücher schüttete.
Als die unglückliche Mama diesen Erfolg und an Stelle des Fundaments ihres Reichtums einen so gänzlich anderen Grund gelegt sah, der ihr zudem das ganze Haus zu verpesten drohte, da schnappte sie nach dem Prügel, und ehe Antuono noch Zeit fand, ihr die Bimssteine zu zeigen, verabreichte sie ihm eine so kräftige Prügelsuppe, daß der Junge die Beine auf den Rücken nahm und zu dem Zauberer zurückeilte.
Der Meister sah, daß er mehr im Trabe als im Schritt herankam, und da er dank seiner Zauberkraft schon wußte, was geschehen war, empfing er ihn mit Vorwürfen darüber, daß er sich von einem Wirt hatte anführen lassen, und schimpfte ihn einen Tölpel, einen Dummkopf, einen Hornochsen, einen Schafskopf, einen Dummrian und lächerlichen Narren, der sich für einen mit Schätzen gefüllten Esel ein Tier hatte in die Hand spielen lassen, das ganz gewöhnlichen Dreck im Leibe hatte. Antuono schluckte die Pille und schwor, nie, niemals wieder würde er sich von einem Menschen zum besten halten lassen.
Ein Jahr darauf aber bekam er wieder dieselben Kopfschmerzen und verging vor Sehnsucht nach den Seinigen. Der Zauberer, der zwar häßlich von Gesicht war, aber eine schöne Seele hatte, gewährte ihm auch diesmal Urlaub, machte ihm ein schönes Mundtuch zum Geschenk und sprach: „Bring dies deiner Mutter, aber sieh dich vor und führe dich nicht wieder so tölpelhaft auf wie mit dem Esel. Und ehe du nicht zu Hause angekommen bist, sage ja nicht ,Tüchlein, öffne dich!‘ noch ,Tüchlein, schließe dich!‘ Denn wenn dir wieder ein Unglück zustößt, hast du den Schaden davon. Nun mach dich fort, viel Glück auf den Weg, und komm schnell zurück!“
Antuono brach auf, aber er war noch nicht weit von der Hütte entfernt, da legte er das Mundtuch auf den Boden und sagte: „Tüchlein, öffne dich!“ und es tat sich auf, und plötzlich sah er darauf eine Menge Juwelen, Kleinodien, Kostbarkeiten, die schönsten und erstaunlichsten Dinge. Dann sprach Antuono die Worte: „Tüchlein, schließe dich!“ und es schloß sich um all diese Schätze. Darauf machte er sich auf den Weg zu demselben Wirtshaus. Dort angekommen, sagte er zu dem Wirt: „Nimm und bewahre mir das Mundtuch auf, doch hüte dich vor den Worten: ,Tüchlein, tu dich auf!‘ und ,Tüchlein, schließe dich!‘“ Der Wirt war ein ganz geriebener Gauner und antwortete: „Laß mich nur machen.“ Und er gab ihm zu essen in Hülle und Fülle, besorgte ihm dazu einen tüchtigen Affen und schickte ihn dann ins Bett. Darauf nahm er das Mundtuch, sprach die Worte und erblickte vor sich so viele köstliche Dinge, daß er aus dem Staunen gar nicht herauskam. Darum suchte er ein anderes Mundtuch heraus und steckte es dem Pinsel zu.
Antuono wachte auf und ritt in lustigem Trabe, bis er an das Haus seiner Mutter kam, und rief: „Jetzt wollen wir der Armut aber mal einen Tritt in den Hintern geben! Jetzt haben wir ein Mittel gegen die Lumpen und Fetzen und all den elenden Plunder!“ Und er legte das Mundtuch auf die Erde und sprach: „Tüchlein, öffne dich!“ Aber er hätte es von heute bis morgen sagen können, es war verlorene Liebesmühe, denn das Tüchlein machte nicht die geringsten Anstalten, sich zu öffnen. Als er sah, daß der Handel wieder schiefging, sagte er zu der Mutter: „Der Himmel sei gelobt! Der Wirt hat mir wieder einen Streich gespielt. Aber warte nur, er und ich sind zwei. Es wäre besser, er wäre niemals geboren worden. Besser für ihn, er wäre unter die Räder eines Wagens geraten! Ich will das beste Stück aus meinem Hause verlieren, wenn ich ihm bei meiner Rückkehr in der Wirtschaft nicht zur Strafe für die Juwelen und den gestohlenen Esel alle Gläser, Schüsseln und Teller in Scherben schlage!“ Als die Mutter aber diese neue Eselei hörte, spuckte sie Feuer und Schwefel und schrie ihn an: „Daß du dir doch den Hals brächest, du verdammter Junge! Die Schultern sollst du dir auseinanderfallen! Heb dich von dannen, denn wenn du auch die Frucht meines Leibes bist, so kann ich dich doch nicht riechen; mir schwillt die Leber und der Kopf wird mir dick, wenn du mir vor die Füße kommst. Mach, daß du verschwindest, dieses Haus soll dich brennen wie Feuer. Ich schüttele dich aus meinen Röcken, und einer soll mir noch sagen, ich hätte dich zur Welt gebracht.“
Der unglückliche Antuono sah den Blitz und wollte den Donner nicht abwarten, und wie einer, der Wäsche gestohlen hat, zog er den Kopf ein, hob die Füße und eilte zu dem Zauberer zurück. Als der sah, wie er so ganz sachte und kleinlaut herankam, spielte er ihm eine neue Melodie vor und sprach: „Ich weiß nicht, was mich hindert, dir ein Auge einzudrücken, du Schwätzer, du Schandmaul, du faules Stück Fleisch, du Hühnerarsch, du Stadttrompeter — der du jedes Geheimnis ausposaunen mußt. Du speist ja alles aus, was du im Leib hast, und kannst nicht einmal die Erbsen bei dir behalten. Hättest du deinen Mund gehalten in der Kneipe, dann wäre dir nicht geschehen, was dir zugestoßen ist; aber deine Zunge klappert wie ein Mühlenrad, und so hast du dir damit das Glück zermahlen, das dir in den Schoß gefallen war.“
Der unglückliche Antuono zog den Schwanz ein und schluckte die Musik. Drei Jahre lang verhielt er sich ruhig im Dienste des Zauberers und dachte ebensowenig an sein Vaterhaus wie daran, Graf zu werden. Aber nach dieser Zeit bekam er einen neuen Fieberanfall, und wieder erhob sich in ihm der Wunsch, eine Reise in die Heimat zu machen, und wieder bat er den Zauberer um Urlaub. Von seinem Drängen bewogen, stimmte der Meister der Reise zu und gab ihm einen schön gearbeiteten Prügel mit der Weisung: „Nimm diesen Prügel mit zu meinem Andenken, aber hüte dich zu sagen: ,Prügel, reck dich!‘ oder ,Prügel, streck dich!‘ dann möchte ich nicht an deiner Stelle sein.“ Antuono nahm ihn in Empfang und antwortete: „Geh, diesmal habe ich meinen Verstand geschärft und weiß, wieviel Paar drei Ochsen sind; ich bin kein dummer Junge mehr, und wer Antuono hereinlegen will, der will sich seine Ellbogen küssen.“ Antwortete ihm der Zauberer: „Das Werk lobt den Meister; Worte sind Weiber, Taten sind Männer. Abwarten und Tee trinken! Du hast mich besser verstanden als ein Tauber; ein Mann gut beraten, schon halb frei von Schaden.“
Der Zauberer wollte noch weiterreden, doch Antuono eilte schon von dannen. Aber noch war er keine halbe Meile entfernt, da sagte er schon: „Prügel, reck dich!“ Das war kein Wort, das war ein Zauberspruch: als wenn ein Kobold in seinem Marke säße, begann der Prügel plötzlich auf die Schultern des armen Antuono loszuschlagen; die Hiebe regneten nur so vom blauen Himmel herab, und der eine wartete nicht auf den anderen. Der arme Mensch, der gewalkt und gegerbt wurde wie Corduanleder, schrie: „Prügel, streck dich!“ und sofort hielt der Prügel ein, auf das Linienblatt seines Rückens den Kontrapunkt zu schreiben. So durch eigenen Schaden klug geworden, sagte er: „Ein Feigling, der flieht! Diesmal laß ich mir die Gelegenheit nicht entgehen, es ist noch nicht zu Bett gegangen, der einen bösen Abend erleben soll!“
Mit solchen Gedanken kam er an die gewohnte Kneipe und wurde von dem Wirt auf das liebenswürdigste empfangen, denn der wußte, welche Riemen man aus der Haut dieses Gastes schneiden konnte. Antuono sagte zu ihm: „Verwahre mir diesen Stock; hüte dich aber zu sagen: ,prügel, reck dich!‘ Denn das könnte gefährlich werden. Hör gut zu und beklage dich nicht bei Antuono, denn ich habe dich gewarnt und mache mein Bett im voraus.“
Der Wirt freute sich schon unbändig auf das dritte Abenteuer, füllte ihn gut mit Suppe und ließ ihn auf den Boden des Weinkruges sehen. Und als er ihn todmüde in ein Bettchen gepackt hatte, lief er, nahm den Stock in die Hand, rief auch sein Weib herbei, damit sie an dem prächtigen Feste teilnehme, und sagte: „Prügel, reck dich!“ Da verteilte der die Ladung nach allen Regeln der Kunst auf den Kielraum des Wirtes und der Wirtin und klitsch! hier und klatsch! da, ritt er hin und her, daß es nur so eine Art hatte.
Als sie sich so schmählich hereingefallen sahen, liefen Mann und Weib davon, der Prügel immer hinterher, und sie weckten Antuono und flehten um Erbarmen.
Antuono sah, daß alles nach Wunsch gegangen und daß die Makkaroni in den Käse und der Kohl in den Speck gefallen war, und er rief: „Da ist nichts zu machen! Ihr werdet zu Tode geprügelt, wenn ihr mir nicht meine Sachen zurückgebt.“ Und der Wirt, der schon ganz zerdroschen war, schrie: „Nimm alles, was ich habe, nur schaff mir den verfluchten Folterknecht von den Schultern!“ Und um Antuono Sicherheit zu geben, holte er alles hervor, was er ihm entwendet hatte. Als dieser alles in den Händen hatte, sagte er: „Prügel, streck dich!“ und der Prügel sprang herab und hockte sich in die Ecke.
So nahm Antuono seinen Esel und die anderen Dinge und ging nach Hause zu seiner Mutter, und nachdem er eine wahrhaft königliche Probe mit dem Hintern des Esels abgelegt und einen sicheren Beweis für die Tüchtigkeit des Mundtuchs erbracht, hatte er Geld in Hülle und Fülle, verheiratete seine Schwestern, überhäufte seine Mutter mit Reichtum und bestätigte die Wahrheit des Satzes:
Kindern und narren
hilft gott in gefahren.
II Der Myrtenzweig
Eine Bäuerin aus Miano bringt einen Myrtenzweig zur Welt. Ein Prinz verliebt sich in ihn, und er entpuppt sich als eine wunderschöne Fee. Als der Prinz sich für einige Zeit entfernen muß, läßt er sie in dem Myrtenzweig zurück, an dem er ein Glöckchen befestigt. In das Gemach des Prinzen schleichen sich gewisse üble Frauenzimmer, die auf die Fee eifersüchtig sind; sie berühren den Myrtenzweig, die Fee kommt heraus, und sie reißen sie in Stücke. Der Prinz kehrt zurück, findet das Gemetzel vor und will vor Schmerz sterben; als ihm aber die Fee auf wunderbare Weise zurückgegeben wird, nimmt er sie zur Gemahlin und läßt die Weiber hinrichten.
Alle hielten den Atem an, als Zeza ihre Erzählung vortrug. Als sie aber damit zu Ende war, erhob sich ein großes Gerede, und sie bekamen den Mund nicht mehr zu vor Staunen über die wunderbare Leibesfracht des Esels und den verzauberten Prügel; und eine meinte, wenn man einen Wald von solchen Prügeln besäße, würden bald nur noch wenig Gauner lange Finger machen und die meisten Verstand annehmen, so daß man nicht mehr wie heutzutage mehr Esel als Traglasten fände. Doch als sie eine Zeitlang ihre Meinungen ausgetauscht hatten, gab der Herr Cecca den Befehl, den Faden der Erzählung weiterzuspinnen, und Cecca erzählte wie folgt:
Wenn der Mensch bedächte, wieviel Schaden und Unheil und welches Verderben durch schamlose Weiber in der Welt angerichtet werden, würde er die Fährte eines liederlichen Weibsbildes sorgsamer fliehen als den Anblick einer Schlange; und er würde seine Ehre nicht aufs Spiel setzen für solch einen Bordellwisch, nicht sein Leben für ein Spital von Krankheiten und nicht all sein Einkommen für eine Metze, die noch keine drei Heller wert ist, die dir nichts eingibt als Abführpillen für Ekel und Ärger: was ihr vernehmen sollt aus der Geschichte eines Prinzen, der sich solch schlimmem Pack in die Hände gegeben hatte.
Es lebten einmal unten in der Vorstadt von Miano ein Mann und eine Frau, die sich, da ihnen auch nicht der Keim eines Kindes beschert war, nichts sehnlicher wünschten als einen Erben. „O Gott, wenn ich doch nur irgend etwas zur Welt brächte, und wäre es auch nur ein Myrtenzweiglein!“ so seufzte die Frau ohne Unterlaß. Und so oft sang sie diese Melodie und lag dem Himmel so lange damit in den Ohren, bis ihr der Leib schwoll und sich rundete und sie nach Ablauf von neun Monaten, anstatt ein Knäblein oder Mägdelein der Wehmutter in den Arm zu legen, aus den elysäischen Gefilden des Leibes einen schönen Myrtenzweig hervortrieb.
Hocherfreut pflanzte sie ihn in einen Blumentopf, der mit viel schönen Masken geschmückt war, stellte ihn auf das Fensterbrett und pflegte ihn des Morgens und des Abends mit größerer Sorgfalt als der Bauer sein Kohlfeld, aus dem er die Pacht seines Gartens zu erzielen hofft. Als aber der Königssohn, der auf die Jagd gehen wollte, an dem Hause vorbeikam, verliebte er sich über alle Maßen in den schönen Myrtenzweig, und er ließ die Bäuerin bitten, ihn ihm zu verkaufen, und hätte ihr gern ein Auge dafür gezahlt. Nach vielem Nein und vielem Widerspruch wurde sie schließlich von Begehrlichkeit nach dem Angebot ergriffen, von Versprechungen geschmiert, durch Drohungen verschüchtert und durch Bitten überwunden, so daß sie ihm den Topf mit dem Myrtenzweig gab mit der Bitte, ihn zu hegen und zu pflegen, denn sie liebe ihn mehr als einen Sohn und hinge in Zärtlichkeit an ihm, wie wenn er aus ihrem Leibe hervorgegangen wäre.
Niemand jubelte lauter als der Prinz. Er ließ den Myrtenzweig in seine eigenen Gemächer tragen, setzte ihn auf eine Terrasse, lockerte das Erdreich und begoß den Zweig mit eigenen Händen.
Nun geschah es, daß der Prinz, als er eines Abends zu Bett gegangen war und die Kerzen schon gelöscht hatte, die Stille sich ringsum dehnte und die Menschen im ersten Schlummer lagen, das Schlurfen von Schuhen im Hause vernahm und jemand vorsichtig auf sein Bett zuschleichen spürte. Es schoß ihm durch den Kopf, es könne sein Kammerdiener sein, der ihm die Börse erleichtern, oder ein Kobold, der ihm die Decke vom Leibe ziehen wollte. Kurzum, als Mann von Mut, dem auch die finsterste Hölle keine Furcht einjagen konnte, stellte er sich mausetot und harrte des Ausgangs des Abenteuers. Als er jedoch jemand an seiner Seite fühlte und im Tasten auf etwas Weiches stieß, wo er auf die Borsten eines Stachelschweins zu treffen vermeinte, da fand er etwas, das war viel feiner und molliger als armenische Wolle, sanfter und schmiegsamer als ein Marderschwanz, flaumig und zart wie das Gefieder des Stieglitzes. Da schloß er sie in seine Arme in dem Glauben, sie sei eine Fee, was sie ja auch wirklich war, und umschlang sie wie ein Polyp und spielte mit ihr all die verliebten Spiele wie „die stumme Spätzin“ oder „Steinchen im Schoß“. Doch ehe die Sonne ihre ärztliche Visite bei den Blumen machte, die in der Nacht krank und matt geworden waren, erhob sich die Freundin und schlüpfte davon. Der Prinz aber blieb zurück voll süßer Erschöpfung, geladen mit Neugier und glühend vor Entzücken.
Sieben Tage hindurch währte das Spiel, und der Prinz verzehrte sich und verschmachtete vor Begierde, zu erfahren, welches Glück ihm da von den Sternen herabgeregnet war, und welches Schiff, so reich beladen mit den kostbarsten Schätzen der Liebe, da in seinem Bette Anker geworfen hatte. Als daher eines Nachts das schöne Kind eingeschlummert war, band er sich eine ihrer Flechten an den Arm, damit sie nicht davonschlüpfen könnte, rief seinen Kammerdiener und hieß ihn die Kerzen anzünden und erblickte die Blüte der Schönheit, das Wunder der Frauen, den Spiegel und das Nesthäkchen der Venus, sah ein Püppchen, ein anmutiges Täubchen, eine Fata Morgana, ein leuchtendes Banner, ein Zweiglein von Gold, schaute eine Herzensbrecherin, ein Falkenauge, einen Mond in seiner Fülle, einen Königsbissen, ein Juwel, nahm mit einem Wort ein Schauspiel wahr, wie er es noch nie gesehen.
Wieder und wieder betrachtete er sie und rief: „Jetzt krieche hinter den Ofen, du zyprische Göttin! Häng dich auf, o Helena! Pack dich, schöne Kleopatra! Eure Reize sind ein Pappenstiel neben dieser Schönheit mit doppelten Sohlen, dieser vollkommenen, ungeteilten, vollendeten, unbestreitbaren, fest gegründeten und tief verwurzelten Schönheit, neben dieser wunderbaren Holdseligkeit, neben dieser sevillanischen, unübertrefflichen, bezaubernden, prächtigen Anmut, an der kein Makel ist und die nirgendwo einer Erhöhung bedarf. O Schlaf, du süßer Schlaf, tröpfle weiter Mohn auf die Augen dieses Edelsteins! Zerstöre mir nicht den Genuß, so lange, wie es mich verlangt, diesen Triumph der Schönheit zu betrachten. O schöne Flechte, die mich bindet! O schöne Augen, die mich wärmen! O schöne Lippen, die mich erquicken! O schöne Brust, die mich tröstet! O schöne Hand, die mich durchbohrt. Wo, wo, in welcher Wunderwerkstatt der Natur ist diese lebende Statue geschaffen worden? Welches Indien lieferte das Gold, dieses Haar daraus zu spinnen? Welches Äthiopien das Elfenbein, um diese Stirn zu bilden? Welche Maremme die Karfunkel, diese Augen zu formen? Welches Tyrus den Purpur, dieses Antlitz zu färben? Welcher Orient die Perlen, um diese Zähne zu modeln? Und von welchem Gebirge nahm man den Schnee, ihn auf diese Brust zu streuen? Diesen Schnee, der gegen alle Natur die Blumen am Leben erhält und die Herzen wärmt?“
Bei diesen Worten schlang er seine Arme wie Rebenranken um die Fee, um den Trost seines Lebens festzuhalten. Doch als er ihren Hals umfaßte, erwachte sie aus ihrem Schlummer und antwortete mit einem anmutigen Gähnen auf die Seufzer des verliebten Prinzen. Da er sah, daß sie erwacht war, sprach er zu ihr: „O mein Schatz, wenn ich schon fast gestorben wäre, als ich diesen Liebestempel ohne Kerze bewachte, was soll nun erst aus meinem Leben werden, da du zwei Sterne entzündet hast? O schöne Augen, die ihr mit dem Triumph eures Lichtes die Bank der Gestirne gesprengt, ihr allein habt dieses Herz durchbohrt, ihr allein könnt wie mit frischen Eiern die Wunde wieder zum Versiegen bringen. Und du, meine schöne Ärztin, laß dich von Mitleid rühren mit einem Liebeskranken, der beim jähen Wechsel aus der Luft der dunklen Nacht in das Licht dieser Schönheit sich ein Fieber zugezogen hat! Leg mir die Hand aufs Herz, fühl mir den Puls, verschreib mir ein Rezept! Aber welches Rezept suche ich, meine Fee? Setze mir mit deinem schönen Munde fünf Schröpfköpfe auf die Lippen; ich brauche keine andere Einreibung als ein Streicheln dieses Händchens, denn ich bin sicher, daß du mich mit dem herzstärkenden Wasser dieser zierlichen Anmut und der Heilwurzel deiner Zunge stark und gesund machen wirst.“
Bei diesen Worten errötete die schöne Fee wie eine flammende Lohe, und sie antwortete: „Lobet mich nicht so sehr, gnädiger Herr Prinz, ich bin nur eine Dienerin, und diesem königlichen Antlitz aufzuwarten, würde ich nicht davor zurückschrecken, das Gefäß der Nacht für Euch zu leeren; erachte ich es doch für ein hohes Glück, aus einem Myrtenzweig in einer tönernen Scherbe zum Lorbeerzweig geworden zu sein und an der Herberge eines lebendigen Herzens aufgesteckt zu werden, in der so viel Güte und so viel Tugend wohnt.“
Der Prinz schmolz dahin wie ein Talglicht, und wieder begann er sie zu umarmen und den Brief mit einem Kusse zu besiegeln; und er reichte ihr die Hand und sprach: „Hier hast du mein Wort, du sollst meine Gemahlin werden, du sollst die Herrin des Zepters sein, du sollst den Schlüssel zu diesem Herzen haben, wie du ja schon das Steuer dieses Lebens führst.“ Und nach diesen und anderen Liebenswürdigkeiten und Reden erhoben sie sich vom Lager und versicherten sich, daß ihr innerer Mensch noch in Ordnung war, und auf diese Weise genossen sie noch eine Reihe von Tagen.
Das Schicksal aber, dieser Spielverderber und Ehestörer, steht den Plänen der Liebe immer im Wege, es ist immer der schwarze Köter, der die Freuden der Liebenden verbellt, und so geschah es denn auch, daß der Prinz aufgefordert wurde, Jagd zu machen auf einen großen wilden Eber, der das Land verwüstete. Das zwang ihn, die Fee zu verlassen und damit zwei Drittel seines Herzens; und da er sie mehr liebte als sein Leben und in ihr den Ausbund alles Schönen sah, sproß aus dieser Liebe und dieser Schönheit jene dritte Art, die ein Sturm auf dem Meere der Liebesfreude ist, ein Regen auf die Wäsche der Liebestruhe, ein Ruß, der in den fetten Topf der Vergnügen der Verliebten fällt; jene Art sage ich, die eine stechende Schlange, ein nagender Wurm, eine giftige Galle, ein klirrender Frost ist, jene Art, die das Leben immer in Spannung hält, das Gemüt immer schwanken macht, das Herz immer mit Argwohn füllt. Er rief also die Fee und sprach zu ihr: „Ich bin gezwungen, liebes Herz, zwei oder drei Tage von Hause fortzugehen. Gott weiß, mit welchen Schmerzen ich mich von dir trenne, die du meine Seele bist; es weiß der Himmel, ob nicht, ehe ich den ersten Schritt von dir weg tue, meine letzte Stunde gekommen ist! Doch da ich nicht anders kann, als meinem Vater zu Willen zu sein, muß ich dich verlassen. Aber ich bitte dich, bei aller Liebe, die du zu mir hegst, begib dich wieder in den Myrtenzweig und komme nicht eher heraus, als ich zurückgekehrt bin, und das wird so bald wie möglich sein.“ — „Das werde ich tun“, versetzte die Fee, „denn ich mag, kann und will dem nicht entgegen sein, was dir gefällt. Geh also, und alles Glück auf den Weg, ich werde dir aufs beste dienen. Aber tu mir einen Gefallen, binde oben an den Myrtenzweig einen seidenen Faden mit einem Glöckchen, und wenn du zurückkehrst, ziehe an dem Faden und klingele, dann komme ich sofort heraus und rufe: ,Hier bin ich!‘“
Der Prinz tat so und schärfte einem seiner Diener ein: „Komm her, komm her, du, sperr die Ohren auf, mach dieses Bett jeden Abend, als ob ich darin schlafen wollte, begieße täglich diesen Topf und paß wohl auf, denn ich habe die Blätter gezählt, und finde ich eines weniger, so kannst du deine Rechnung mit dem Himmel machen.“ Mit diesen Worten bestieg er sein Roß und ritt davon wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, um hinter einem Eber herzujagen.
Inzwischen hatten die sieben lockeren Weiber, die der Prinz zu seinem Vergnügen gehalten hatte, gemerkt, daß er in der Liebe nachgelassen, erkaltet war und aufgehört hatte, ihre Gärtlein zu bestellen, und sie schöpften Verdacht, er könne über irgendeine neue Bindung die alte Freundschaft vergessen haben. Begierig, Land zu entdecken, riefen sie einen Maurer, und mit dem Klang des Geldes brachten sie ihn dazu, einen unterirdischen Gang zu graben, der von ihren Häusern zu dem Palaste des Prinzen führte. Dort eingedrungen, öffneten die schmutzigen Weiber das Gemach, um zu sehen, ob eine listenreiche Nebenbuhlerin ihnen die Stellung weggenommen und den guten Kunden bezaubert hätte, aber sie fanden niemand. Als sie den wunderschönen Myrtenzweig erblickten, pflückte eine jede ein Blatt ab, die Jüngste aber nahm die ganze Spitze, an welcher das Glöckchen befestigt war; und dieses, kaum berührt, ertönte, und die Fee, des Glaubens, es sei der Prinz, kam sofort hervor. Als die häßlichen Hexen jedoch die zierliche Gestalt gewahrten, schlugen sie ihr die Nägel ins Gesicht und kreischten: „Bist du es, die das Wasser unserer Hoffnungen auf ihre Mühle leitet? Bist du es, die uns den hübschen Bissen der prinzlichen Gunst aus den Händen gerissen hat? Bist du die saubere Dame, die sich in den Besitz des Bratens gesetzt hat, der uns gehörte? Sei uns willkommen: du hast deinen letzten Schritt getan! Es wäre besser, deine Mutter hätte dich nie geboren! Das wird dir übel bekommen! Du hast gefunden, was du nicht suchtest! Du kommst uns wie gerufen! Ich will kein Neunmonatskind sein, wenn du uns entgehst!“ Mit diesen Worten schlugen sie die Fee mit einer Keule auf den Kopf und zerschnitten sie sofort in hundert Stücke, und jede nahm sich ihren Teil. Nur die Jüngste wollte sich an der Bluttat nicht beteiligen, und als sie von den Schwestern aufgefordert wurde, zu tun wie sie, nahm sie nur ein Büschel von dem goldenen Haar. Da sie fertig waren, verschwanden sie durch denselben unterirdischen Gang.
Mittlerweile kam der Kammerdiener, um das Bett zu machen und den Topf zu begießen, wie sein Herr ihm befohlen hatte. Als er die Zerstörung sah, wäre er beinahe vor Schrecken davongelaufen. Er biß sich die Hände, dann sammelte er die Überreste des Fleisches und der Knochen, wusch das Blut vom Boden ab, häufte alles in demselben Topfe zusammen, begoß es, legte das Bett offen, schloß ab, und nachdem er den Schlüssel unter die Schwelle gelegt hatte, floh er eilends aus dem Lande.
Als er von der Jagd zurückkehrte, zog der Prinz an der Seidenschnur und läutete das Glöcklein. Aber läute nur, daß du Wachteln fängst, läute nur, denn der Bischof zieht vorbei! Er hätte mit dem Hammer läuten können, die Fee stellte sich taub. Wütend eilt er in das Gemach, und da er nicht die Ruhe hat, den Kammerdiener zu rufen und den Schlingel zu suchen, stemmt er sich gegen das Schloß, sprengt die Tür auf, stürzt hinein, reißt das Fenster auf, und als er den Myrtenzweig entblättert dastehen sieht, erhebt er ein großes Klagegeschrei und ruft mit schriller Stimme: „O ich Elender, o ich Trübseliger, o ich Unglücklicher! Wer hat mir diesen Wergbart umgehängt? Wer hat mir diese Unglückskarte vorgespielt? O du vernichteter, zerschmetterter, in den Staub gestürzter Prinz! O meine entblätterte Myrte, o meine verlorene Fee, o mein kummervolles Leben, o ihr meine in Rauch aufgegangenen Freuden, o mein zu Essig gewordener Wein! Was sollst du tun, elender Cola Marchionne! Was beginnen, du Unglücklicher? Nun spring über den Graben, zieh dich aus dieser Klemme! Du bist aus allen Himmeln gestürzt und schneidest dir nicht die Kehle durch? All deiner Schätze hat man dich beraubt, und du brichst nicht ohnmächtig zusammen? Das Leben hat man dir genommen, und du verlierst nicht den Verstand? Wo bist du, wo bist du, meine Myrte? Welches Herz, härter denn Pfefferstein, hat mir diesen schönen Topf zerschlagen? O verfluchte Jagd, du hast mich aus all meinem Behagen gejagt. Weh mir, um mich ist es geschehen, ich bin vernichtet, ich bin tot, meine Tage sind zu Ende! Ich kann nicht mehr leben, wie soll ich dieses Dasein fristen ohne mein Leben? Ich muß mich auf die Bahre strecken, denn ohne meinen Schatz wird der Schlaf mir zur Qual, das Essen zu Gift, das Vergnügen zur Folter, das Leben zur Bitternis!“
Solche und andere Worte, die einen Stein auf der Straße hätten erweichen können, stieß der Prinz hervor, und nach einer langen Totenklage und schmerzlichem Jammern, voller Angst und Weh, konnte er weder ein Auge schließen, um zu schlafen, noch den Mund öffnen, einen Bissen zu genießen, so durchwühlte ihn der Schmerz. Sein Gesicht, das vorher geleuchtet hatte wie orientalische Mennige, wurde gelb wie Schwefel und der rosige Schinken seiner Lippen ranzig wie Schweineschmalz. Die Fee, die aus den in dem Topfe gesammelten Resten wieder anfing zu wachsen, sah, wie der arme Verliebte sich zerschlug und die Haare raufte und klein und häßlich wurde und aussah wie ein kranker Spanier, wie eine wurmige Eidechse, wie Kohlsuppe, wie Gelbsucht, wie eine Quitte, wie der Steiß eines Feigenfressers und der Furz eines Wolfes; und sie wurde von Mitleid bewegt. Und mit einem Satze aus dem Topf springend, wie ein Lichtstrahl aus einer Blendlaterne huschend, stand sie vor den Augen von Cola Marchionne, schlug ihm die Arme um den Hals und sagte: „Ruhig, ruhig, mein Prinz! Es ist genug, hör auf zu klagen, trockne deine Tränen, glätte deine Stirne! Sieh da, ich bin gesund und munter, jenen schlechten Weibern zum Trotz, die mir den Schädel spalteten und mit meinem Fleische verfuhren wie Typhon mit seinem armen Bruder.“
Bei diesem jähen Wechsel der Dinge, der gerade eintrat, als er es am wenigsten vermutete, erwachte der Prinz vom Tode zum Leben. Die Farbe kehrte in seine Wangen zurück, die Wärme ins Blut, der Geist in die Brust, und tausendmal herzte und küßte er die Fee und wollte haarklein wissen, wie alles gekommen war. Und als er erfuhr, daß den Kammerdiener nicht die geringste Schuld traf, ließ er ihn zurückrufen, hieß ein großes Gastmahl anrichten und vermählte sich mit Zustimmung seines Vaters mit der Fee. Er wünschte, daß außer allen Großen des Reiches vor allem die sieben Schandweiber zugegen wären, die aus diesem Milchschäfchen Hackfleisch gemacht hatten.
Als die Tische abgeräumt wurden, fragte der Prinz jeden einzelnen seiner Gäste: „Was hätte die Person verdient, die diesem schönen Kinde ein Leids angetan?“ Und dabei zeigte er mit dem Finger auf die Fee, die so schön war, daß sie die Seelen wie ein Blitz durchpfeilte, die Herzen wie eine Winde herauszog und die Wünsche karrenweise erregte. Und alle, die am Tisch saßen, beim König angefangen, gaben Antwort. Der eine sagte, sie verdiene den Galgen, ein anderer, es stehe ihr zu, aufs Rad geflochten zu werden, der dritte empfahl glühende Zangen, der vierte wollte sie vom Felsen herabgestürzt sehen, der eine empfahl diese, der andere jene Strafe. Zuletzt kam die Frage an die sieben Scheusale. Diese ahnten wohl, daß es ihnen an den Kragen gehen würde und ihnen eine schlimme Nacht bevorstand, dennoch antworteten sie, da nun einmal im Wein Wahrheit ist, wer die Verwegenheit besitze, jene köstlichste aller Liebesfreuden anzurühren, der verdiene, lebendig in einer Kloake begraben zu werden.
Auf diesen Urteilsspruch, den sie mit eigenem Munde gefällt hatten, sagte der Prinz: „Ihr habt euch selbst den Prozeß gemacht, ihr selbst habt den Urteilsspruch verkündet. Mir bleibt nur übrig, euren Befehl auszuführen, denn ihr seid diejenigen, die mit dem Herzen eines Nero, mit der Grausamkeit einer Medea einen Eierkuchen aus diesem schönen Köpfchen gemacht und diese köstlichen Glieder zerschnitten habt wie Wurstfleisch. Drum vorwärts, schnell, daß keine Zeit verlorengeht! Auf der Stelle sollen sie in die Hauptkloake gestürzt werden und dort jämmerlich ihr Leben beschließen!“
Der Befehl wurde sofort ausgeführt. Der Prinz verheiratete die jüngste dieser Dirnen mit dem Kammerdiener und gab ihr eine gute Mitgift. Und nachdem er dem Vater und der Mutter des Myrtenzweiges ein bequemes Dasein gesichert hatte, lebte er in Fröhlichkeit mit seiner Fee. Jene Töchter der Hölle aber, die ihr Leben in so bitterer Not beschlossen, bestätigten die Wahrheit des Sprichwortes unserer Väter:
Die lahme ziege käm’ ans ziel,
wenn sie nicht stolperte und fiel.
III Peruonto
Peruonto, ein großer Tölpel, geht in den Wald, um ein Bündel Reisig zu schlagen. Er erweist sich liebenswürdig gegenüber drei Jünglingen, die in der Sonne schlafen. Sie verleihen ihm Zauberkraft, und als er von der Königstochter verhöhnt wird, flucht er ihr und wünscht, sie möchte von ihm schwanger werden, was in der Tat geschieht. Als man entdeckt, daß er der Vater der Kinder ist, die sie zur Welt bringt, läßt der König ihn samt der Frau und den Kindern in eine Tonne stecken und ins Meer werfen. Kraft seiner Zaubergabe aber übersteht er die Gefahr, verwandelt sich in einen schönen Jüngling und wird König.
Alle bewiesen ihre große Freude über die Tröstung, die dem armen Prinzen zuteil geworden, und über die Strafe, die den schlimmen Weibern auferlegt worden war. Da aber Menica in der Erzählung fortfahren sollte, verstummte das Geschwätz, und sie begann die folgende Geschichte zu erzählen:
Eine gute Tat geht nie verloren. Wer Freundlichkeiten sät, erntet Wohltaten, und wer Liebenswürdigkeiten pflanzt, heimst Liebe ein. Die Freude, die man einem edlen Herzen macht, ist noch niemals unfruchtbar gewesen, sie erzeugt vielmehr Dankbarkeit und gebiert Belohnung. Das hat man im menschlichen Leben immer wieder erfahren, und ihr werdet es auch bestätigt finden in dem Beispiel, das ich euch nun erzählen will.
Ceccarella, eine wackere Frau aus Casoria, hatte einen Sohn namens Peruonto, und der war der nichtsnutzigste Tagedieb, der größte Tölpel, die prächtigste Schafsnase, die die Natur je hervorgebracht hat. Der unglücklichen Mutter war das Herz darob schwärzer geworden als ein Küchenwischlappen, und sie verfluchte alle Tage die Knie, die jenem Uhu den Weg ins Leben erschlossen hatten, dessen Federn man sich wahrhaftig nicht an den Hut stecken konnte. Aber sie hatte gut reden, rufen und schreien, das arme Weib. Der Faulpelz tat, als hörte er sie nicht, und bequemte sich nicht, ihr auch nur den geringsten Dienst zu erweisen. Nachdem sie ihm tausend Strafpredigten gehalten, ihm tausendmal den Kopf gewaschen und tausendmal erklärte hatte: „Das sage ich dir, und das laß dir gesagt sein“, nach Geschimpfe am Morgen und Gezeter am Abend, schickte sie ihn endlich in den Wald, ein Bündel Holz zu schlagen, indem sie zu ihm sagte: „Lauf schnell und hole das Holz, versäume dich nicht auf dem Wege und komm geschwind wieder, denn wir wollen Carfioli in Öl kochen, vier Stück, um dieses elende Leben weiter fristen zu können.“



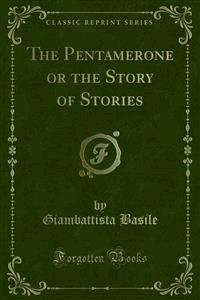













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











