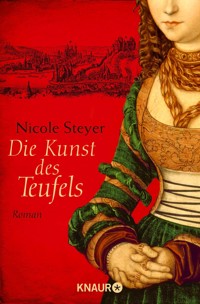9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie hat die Pest überlebt – doch der Tod schleicht weiter um die Häuser.
Rosenheim 1648: Die junge Marianne lebt und arbeitet in der Brauerei, die von der Witwe Hedwig Thaler geführt wird. Die alte Frau hat Marianne bei sich aufgenommen und aufgezogen – doch das Mädchen hat von ihr nur böse Worte und Ungerechtigkeiten empfangen. Einzig der Pfarrer des Ortes begegnet Marianne freundlich und nimmt sie vor den Anfeindungen der Leute in Schutz: Diese sehen in ihr so etwas wie eine Hexe, da sie einst die Pest überlebt hat. Doch dann liegt eines Tages Hedwig Thaler erschlagen auf dem Hof – und nur Marianne ahnt, wer der Mörder ist ...
Nicole Steyers bewegender Roman über eine mutige Frau zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Marianne hat als Einzige ihrer Familie die Pest überlebt. Die Braumeisterin Hedwig Thaler nimmt sie bei sich auf. Doch ein neues Zuhause bietet sie ihr nicht, dafür ist der Alltag zu entbehrungsreich, Hedwig zu lieblos. Als die Braumeisterin eines gewaltsamen Todes stirbt, überschlagen sich die Ereignisse. Marianne ahnt, wer der Mörder ist, doch wird es ihr, gelingen einen zu Unrecht Verdächtigten vor der Verhaftung zu retten?
Über Nicole Steyer
Nicole Steyer ist in Rosenheim aufgewachsen und begann schon früh, sich die ersten Geschichten auszudenken und aufzuschreiben. Im Jahr 2001 zog sie der Liebe wegen in das Taunusstädtchen Idstein, beschäftigte sich mit der Geschichte ihrer neuen Heimat und verfasste mit »Die Hexe von Nassau«, ihren ersten Roman.
Im Aufbau Taschenbuch und bei Rütten & Loening sind unter ihrem Pseudonym Linda Winterberg zahlreiche historische Romane und Sagas erschienen.
Alle lieferbaren Titel der Autorin unter aufbau-verlage.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Nicole Steyer
Das Pestkind
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog
Teil I — Rosenheim 1648
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Teil II — Ein schwedischer Tross
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Teil III — Die Rückkehr
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Nachwort
Historische Personen im Buch:
Danksagung
Impressum
Für meine Eltern
Prolog
Pfarrer Angerer hatte seinen Blick auf die Berge gerichtet, als er den schmalen Feldweg entlangging. Wieder einmal redete er sich ein, die mächtigen Gipfel würden ihm Sicherheit geben. Denn sie waren immer da, in ihrer Schönheit unvergänglich, und sie würden auch noch auf die Welt blicken, wenn es die Menschen nicht mehr gab.
Rechts und links des Weges standen Leichenkarren, auf denen in Leinentücher gewickelte, namenlose Tote auf eine Beerdigung in einem Massengrab warteten. Auf einem der Karren saß eine weinende Frau, eine Kinderleiche im Arm. Der Pfarrer blieb stehen und musterte sie mitleidig. Anneliese Hoflechner zählte noch keine achtzehn Jahre. Erst vor zwei Jahren hatte er sie in seiner Kirche getraut. Glücklich war sie damals gewesen, die Wangen rund und gerötet, die blauen Augen strahlend. Jetzt wirkte sie wie ein anderer Mensch, das Gesicht blass und eingefallen, die verweinten Augen in tiefen Höhlen. Ihr Kleid war schmutzig und voller Löcher, ihr Haar strähnig und wirr.
»Ach, Anneliese, es tut mir so leid für dich. Du solltest aber trotzdem vom Wagen herunterkommen. Der kleinen Luise kannst du nicht mehr helfen, denn sie ist schon längst bei Gott. Ich verspreche dir, sie in meine Gebete einzuschließen.« Er streckte ihr seine Hand hin und nickte aufmunternd. »Du wirst doch krank.«
Die junge Frau sah den alten Pfarrer verstockt an.
»Nein, ich gehe nirgendwohin. Sie braucht mich. Ich kann sie nicht einfach hier liegen lassen. Sie wollte doch nie allein sein. Sie schreit bestimmt, wenn ich fortgehe.«
Traurig nickte der Geistliche.
»Na, dann bleib noch ein wenig, damit das Kind nicht schreit.«
Seufzend setzte er seinen Weg fort. Ihm fehlten die Kraft und die Worte, um Anneliese zu erklären, dass ihr Kind nie wieder schreien würde. Wahrscheinlich war auch sie bereits krank, und nur Gott konnte ihr – konnte ihnen allen – jetzt noch helfen. Am Totenfeld angekommen, empfing ihn Ludwig, der Totengräber. Sein braungebranntes Gesicht war mit Erde verschmiert, seine Wangen waren leicht gerötet. Er begrüßte den Pfarrer mit einem Lächeln.
»Guten Morgen, Hochwürden.«
Ludwig, der den blonden Schopf und das mitfühlende Herz seiner Mutter geerbt hatte, wirkte gesund und kräftig. Keine Anzeichen von Erschöpfung oder gar Fieber waren zu erkennen. In Pfarrer Angerers Augen war dieser Mann ein Phänomen. Seit Wochen vergrub er Leichen, berührte jeden Tag den Schwarzen Tod und atmete verseuchte Luft ein, doch krank wurde er nicht. Viele andere, die hier draußen gearbeitet hatten, waren bereits dahingerafft worden. Aber er war jeden Tag hier, arbeitete bis zur Erschöpfung, spendete so manch Trauerndem Trost und betete für die Toten.
»Und, wie sieht es heute aus?« Der Pfarrer blickte in die neu ausgehobene Leichengrube, in der bereits mehr als zwanzig Tote nebeneinanderlagen.
»Wie immer.« Der Totengräber deutete hinter sich. »Heute ist auch vom Gutshof der Leitners ein Wagen gekommen. Alle sind tot. Nur …« Ludwig stockte.
»Was nur?« Pfarrer Angerer sah ihn erstaunt an.
»Es fehlt jemand.«
»Wie, es fehlt jemand?«
»Ich habe doch oft auf dem Hof ausgeholfen. Im Stall und auf dem Feld. Nachdem Maria, Gott hab sie selig, letztes Jahr im Kindbett gestorben ist, wurden dort immer wieder helfende Hände gebraucht.«
Pfarrer Angerer sah den Totengräber ungeduldig an.
»Ja und, weiter.«
Ludwig deutete auf einen Leiterwagen am Wegrand.
»Alle sind auf dem Karren. Sogar Alma, die Küchenmagd, hat es erwischt. Nur die kleine Marianne fehlt. Es war keine Kinderleiche darunter. Ich habe genau nachgesehen.«
Verdutzt sah der Pfarrer den Totengräber an.
»Vielleicht sollte noch mal jemand auf dem Hof nach dem Rechten sehen?« Ludwig kratzte sich am Kopf. »Am Ende lebt die Kleine noch.«
Pfarrer Angerer seufzte. Viel Hoffnung, ein lebendes Kind zu finden, hatte er nicht. Doch das tote Mädchen dort seinem Schicksal überlassen, das wollte er auch nicht. Das Kind hatte es verdient, in geweihter Erde begraben zu werden.
»Mit jemand bin dann wohl ich gemeint.«
Ludwig grinste, griff erneut nach seiner Schaufel und begann, das Massengrab zuzuschaufeln.
»Ich würde ja hingehen. Aber Ihr seht ja, was hier los ist.«
Der Gutshof der Leitners sah von weitem wie immer aus. Doch als der Pfarrer auf den Innenhof des weitläufigen Anwesens trat, war die Veränderung spürbar. Es war totenstill. Keine Hühner kamen ihm neugierig entgegengelaufen, keine Pferde oder Kühe standen auf den Weiden rund ums Haus, Staub tanzte, vom heißen Wind aufgewirbelt, über den Boden, und unter einem Holzkarren saßen zwei Katzen, die ihn misstrauisch musterten. Die Stille zeigte auf grausame Art und Weise den Tod.
Pfarrer Angerer straffte die Schultern, ging auf das Haupthaus zu, öffnete die Tür und betrat den dämmrigen Flur. Die Luft war abgestanden, und es stank nach Erbrochenem, Exkrementen und verfaultem Essen. In der Stube befand sich niemand. Teller mit schimmligen, vertrockneten Essensresten waren noch auf dem Tisch, unter dem ein Schuh lag. In einer Ecke neben der Ofenbank standen ein Spinnrad und ein Korb mit Wolle und Strickzeug. Der Pfarrer ging weiter.
Die Küche war ebenfalls leer. Im Spülstein stapelten sich Tonteller und Becher, und der Ofen war erkaltet, ein Topf mit Eingebranntem darauf.
Das Fenster war verschlossen, die Hintertür sogar verriegelt. Er wandte sich ab und stieg die Treppe nach oben, doch weder in den Schlafräumen des Gutsherrn noch in den Gesindekammern fand er das Mädchen.
Er trat wieder auf den Hof, schloss die Tür hinter sich und ging in den leeren Stall. Herumliegender Dung und Mist erinnerten daran, dass hier einst Ziegen, Kühe und Schweine gestanden hatten.
Kopfschüttelnd wandte sich der Pfarrer ab und wollte den Stall gerade wieder verlassen, da drang plötzlich ein seltsames Geräusch an sein Ohr, und er hielt inne.
Ein Summen. Ganz leise nur, aber es war da.
Er ging in die Mitte des Stalles und blickte sich um. Das Summen hörte nicht auf. Suchend schritt er durch den Stall und schaute in jeden Verschlag. Sein Blick blieb an einer schmalen Bretterwand hinter dem Schweinekoben hängen. Einige der Bretter waren schief. Neugierig trat er darauf zu und schob sie zur Seite. Sofort schlug ihm fürchterlicher Gestank entgegen. Eine Mischung aus Kot, Urin und süßlichem Früchteduft raubte ihm den Atem. Im Dämmerlicht entdeckte er Marianne, die ihn mit großen Augen ansah. Ihre Wangen waren, soweit er es bei dem schwachen Licht erkennen konnte, verschmiert, und ihre schwarzen Löckchen ringelten sich wirr um ihr Gesicht. Sie hielt ein halb gefülltes Einmachglas in der Hand und hatte ihren Daumen im Mund. Pfarrer Angerer lächelte erleichtert. Krank sah die Kleine auf den ersten Blick nicht aus.
»Marianne, Kind, da bist du ja«, sagte er freundlich und streckte die Hand nach ihr aus.
Sie wich zurück.
»Nicht rausholen!« Ihr Blick war trotzig. »Die Alma hat gesagt, ich soll hier drinbleiben. Bald wird sie kommen und mich holen. Hier bin ich sicher. Sind wir alle immer sicher, wenn sie kommen.«
Pfarrer Angerer atmete tief durch. Anscheinend saß die Kleine nicht zum ersten Mal in diesem Verschlag. Wie oft sie sich hier vor Marodeuren versteckt hatten, konnte er nur erahnen. Bei näherem Hinsehen bemerkte er jetzt auch einige Decken, einen Tonkrug und Becher.
Warum die alte Magd das Mädchen hierhergebracht hatte, konnte er nur vermuten.
Langsam sank er in die Hocke, sah Marianne fest in die Augen und entschuldigte sich innerlich beim Herrgott für seine Lüge.
»Sie hat mich geschickt, damit ich mich um dich kümmere. Sie selbst kann das im Moment nicht.«
Misstrauisch sah ihn die Kleine an, kam dann aber doch näher. Erleichtert zog der Pfarrer das Kind aus dem Verschlag, nahm es auf den Arm und verließ sofort den Stall.
»Wo sind die Hühner?«, fragte Marianne verwundert.
»Vielleicht fortgelaufen.« Der Geistliche betrachtete Marianne näher. Sie war schmutzig und stank erbärmlich. Ihr Haar war zerzaust und verklebt, und ihre Finger waren voller Marmelade und Brotkrümel, aber sie schien gesund zu sein. Es war ein Wunder. Alle hier waren gestorben, nur dieses kleine Mädchen lebte und war putzmunter.
»Ich habe Durst.« Marianne begann, auf seinem Arm zu zappeln. »Wo ist Alma?«
Der Priester ließ die Kleine nicht los.
Im Innenhof stand ein Brunnen, doch der Sauberkeit des Wassers traute er nicht. Das Grauen dieses Ortes ergriff Besitz von ihm, und er wollte nur noch weg von hier.
»Du bekommst gleich etwas zu trinken.« Beruhigend strich er dem Mädchen über die Schulter, während er eiligen Schrittes den Hof verließ. »Ich verspreche es dir. Ich bringe dich jetzt ins Pfarrhaus. Gewiss bist du hungrig. Lydia, meine Magd, wird sich um dich kümmern. Sie kann sehr gut kochen.«
Marianne begann zu weinen und wild um sich zu schlagen. Seine Worte interessierten sie nicht. »Lass mich runter! Nicht weggehen! Ich will zu Alma! Sie hat gesagt, sie kommt mich holen. Fest hat sie es versprochen!«
Pfarrer Angerer antwortete nicht. Er hielt sie umklammert und kämpfte mit den Tränen, während er den Feldweg entlangging und erneut den Blick auf die Berge richtete.
Marianne wand sich, schlug auf ihn ein und schrie. Doch es half alles nichts. Der Gutshof wurde immer kleiner und verschwand bald ganz aus ihrem Blickfeld.
Teil I
Rosenheim 1648
1
Das rote Licht des anbrechenden Sommermorgens drang in den Raum. Die Vögel waren erwacht, zwitscherten aber nur vereinzelt. Marianne drehte sich zur Seite und blickte durch das kleine Fenster über die Dächer der Stadt. Über die Mauern, Giebel und Hinterhöfe, die dicht an dicht nebeneinanderlagen und kaum Raum ließen für Blattwerk und Grün. Doch nicht weit davon, hinter den letzten Gassen unten am Fluss, erstreckte sich ein Wald, den sie von hier oben erkennen konnte. Sie beobachtete stumm den roten Streifen am Horizont, der sich ins Orangerote und Gelbe verfärbte, um dann dem grellen Licht der Sonne Platz zu machen. Heute wäre ein guter Tag für einen Ausflug ins Kloster, dachte sie. Schon länger hatte sie die Mönche und ihren Mentor, den Abt Pater Franz, nicht mehr besucht. Besonders ihr geliebter Rosengarten, in dem sie so gern saß, fehlte ihr.
Sie richtete sich auf und schaute auf ihren Stiefbruder, der zusammengekauert neben ihr im Bett lag und im Schlaf leicht schmatzende Geräusche machte. Sein fettiges, braunes Haar stand wirr von seinem Kopf ab, und seine Wangen, die ein sanfter Flaum zierte, waren gerötet. Anderl war in der Nacht zu ihr gekommen. Was er immer tat, wenn ein Gewitter über dem Haus tobte oder andere Dinge ihn erschreckten. Allmählich wurde er allerdings zu groß, um in ihr Bett zu schlüpfen. Immerhin waren sie keine Kinder mehr – jedenfalls war sie keines mehr. Im Herbst würde sie achtzehn Jahre alt werden, viele Mädchen in ihrem Alter dachten bereits ans Heiraten oder waren verlobt. Anderl, der drei Jahre jünger war als sie, war zwar auch älter und größer geworden, hatte einen flaumigen Bartwuchs und eine tiefe Stimme bekommen, aber es war die Stimme eines Mannes, der dachte wie ein Kind, der so vieles nicht verstand und den alle nur den Dummen nannten. Als einfältiges Balg der Thalerin wurde er beschimpft, und die Kinder verspotteten ihn und riefen ihm all das hinterher, was sie von den Erwachsenen aufgeschnappt hatten. Anderl machte sich nicht viel daraus. Er schien in seiner eigenen Welt zu leben, hielt nichts von Regeln, verschwand, wann er wollte, nahm sich die Zeit, die er brauchte.
Es war nicht richtig, wie sie ihn behandelten, dachte Marianne und strich ihm sanft über die Wange.
Vorsichtig kletterte sie über ihn hinweg und schlich zu ihrem winzigen Waschtisch. Die enge Dachkammer war karg möbliert. Ein einfacher Stuhl und ein schmaler Tisch standen unter dem zweiten Fenster. In einer schäbigen, braunen Truhe verwahrte sie ihre wenigen Habseligkeiten – ihre Erinnerungen an ein anderes Leben, das es nur noch verschwommen in ihrem Kopf gab. Ihr Blick wanderte über die matt schimmernden Beschläge und das abgewetzte Leder. Jetzt war keine Zeit für Wehmut, auch wenn das ihrer Stimmung entsprach. Ihr Tagwerk rief. Irmgard war bestimmt bereits in der Küche und wartete auf sie. Die gute alte Irmgard, der einzige Mensch in diesem Haus, außer Anderl, der sie nicht ständig ausschimpfte oder gängelte.
Ihr Hemd klebte an ihrem Leib, den jetzt, da sie der Wärme des Bettes entflohen war, trotz der schwülen Hitze im Raum eine leichte Gänsehaut überzog. Hastig zog Marianne das Hemd aus und nahm von einer kleinen Wäscheleine, die in der Ecke neben dem Tisch hing und den Kleiderschrank ersetzte, ein frisches. Es wies bereits einige kleine Löcher auf, war aber trocken und sauber. Daneben hingen ihre wenigen Kleider. Ihr einziges Sommerkleid hatte sie gestern notdürftig vom Schmutz der Straßen befreit. Seufzend nahm sie es von der Leine und fuhr über den Saum, der noch feucht und nicht ganz sauber war. In einigen Stunden würde er sowieso wieder aussehen wie vorher, dachte sie, zog das Kleid über den Kopf und schnürte ihre Brüste ein. Sie hielt nicht viel davon, ihre weiblichen Reize zu zeigen. Prüfend blickte sie in den trüben Spiegel, der über ihrem winzigen, klapprigen Waschtisch an der Wand hing. Doch ihre tiefen Augenringe konnte selbst der alte Spiegel nicht verdecken. Sie spritzte sich Wasser ins Gesicht und rubbelte es mit einem Leinentuch trocken. Anschließend musterte sie sich erneut. Die Wangen hatten jetzt ein wenig Farbe bekommen und waren leicht gerötet. Ihr langes schwarzes Haar hatte sie zu einem dicken Zopf geflochten, aus dem sich während der Nacht einige Haare gelöst hatten, die ihr nun wirr ins Gesicht hingen. Sie öffnete den Zopf und bürstete den Staub des letzten Tages heraus.
»Es sieht hübsch aus.«
Erschrocken zuckte Marianne zusammen und blickte sich um. Anderl saß aufrecht im Bett und lächelte sie an.
»So hübsch sind deine Haare.«
Sie legte den Kopf schräg und spürte, wie ihr die Schamesröte ins Gesicht stieg.
»Du bist wach?«, sagte sie ausweichend. »Es ist recht früh, Anderl, schlaf noch ein wenig.«
Der Junge sah sie prüfend an. Marianne begann, ihren Zopf zu flechten, und wartete geduldig ab, bis er die richtigen Worte gefunden hatte.
»Ich bin nicht müde«, antwortete er, ließ seinen Kopf aber zurück aufs Kissen sinken.
»Doch, das bist du.« Marianne band sich ein blaues Kopftuch um, ging zu ihm und sank vor dem Bett in die Hocke. Zärtlich sah sie ihn an und fuhr ihm durch sein wirres Haar.
»Es war eine laute Nacht, und du bist so spät zu mir gekommen. Schlaf noch ein wenig.«
Dankbar sah er sie an und kuschelte sich gähnend unter die Decke.
»Du bist auch müde.«
Seufzend erhob sich Marianne und schlüpfte in ihre abgetragenen, aber bequemen Schuhe.
»Ja, das bin ich. Aber wenn ich jetzt nicht gleich in die Küche gehe, dann reißt mir Irmgard den Kopf ab.«
Prüfend zog sie ihr Kopftuch vor dem Spiegel zurecht und drehte sich dann erneut zu ihm um.
Doch Anderl hatte die Augen bereits wieder geschlossen. Marianne schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich hatte er ihre Antwort gar nicht mehr gehört. Sie öffnete die Tür und trat in den düsteren Flur.
Die allgegenwärtige Geruchsmischung aus Malz, gebratenem Fleisch und Schweiß hüllte sie ein. Leise schlich Marianne über den knarzenden Dielenboden, vorbei an Hedwigs Kammer, zur Treppe. Ihre Ziehmutter hielt nichts davon, früh aufzustehen. Zumeist erschien sie erst kurz vor dem Mittagsgeschäft in der Gaststube, worauf Marianne und die anderen durchaus verzichten konnten.
Hedwig stellte das dar, was man sich gemeinhin unter einer Brauereibesitzerin und Wirtin vorstellte. Sie war korpulent, hatte ausladende Hüften und große Brüste. Ihre Haut war weiß wie Schnee und von roten Flecken übersät. Ihr Kinn war fleischig, ihre Oberarme fest und muskulös. Laut und burschikos klang ihr Lachen, und ihr Gang hatte nichts Weibliches an sich. Margit, die abends immer beim Bedienen aushalf und eigentlich nur wegen der Männer kam, verglich sie gern mit dem großen, massiven Geschirrschrank, der hinter der Theke in der Gaststube stand.
Marianne konnte nicht über Margits Scherze lachen, denn sie hatte Angst vor Hedwig und war stets auf der Hut, wenn sie in ihre Nähe kam. Nicht eine angenehme Eigenschaft verband sie mit dieser Frau, die eigentlich ihre Mutter sein sollte und sie großgezogen hatte. Sie würde niemals auf den Gedanken kommen, sich als ihre Tochter zu fühlen. Sie war die Tochter der Frau mit den hellen blauen Augen und der sanften, singenden Stimme, die es nur noch in ihrer Erinnerung gab.
Marianne blieb verwundert auf dem letzten Treppenabsatz stehen. Normalerweise hörte man Irmgard mit den Töpfen klappern und nahm die unverwechselbaren Gerüche von Holzrauch und Haferbrei wahr, die durch den unteren Flur zogen. Aber heute war es still. Unheimlich still. Die Küchentür war nur angelehnt, und ein schmaler Lichtstreifen fiel auf den Dielenboden. Marianne trat näher heran. Ihr Herz klopfte ihr bis zum Hals. Sie schob die Küchentür vorsichtig auf. Keiner schlug sie wieder zu, nichts fiel zu Boden, niemand rannte fort oder erschreckte sie. Sie wurde etwas mutiger und blickte in den Raum. Die geräumige Küche war leer. Wie Marianne bereits auf der Treppe vermutet hatte, brannte kein Feuer in dem großen gusseisernen Ofen. Auf dem Boden entdeckte sie Irmgards Korb, gut gefüllt mit Gemüse, das in dem kleinen Garten hinter den Brauereigebäuden wuchs. Also musste sie hier gewesen sein, überlegte Marianne. Die Tür zum Hof stand offen, quietschte ein wenig in den Angeln, und die Sonne schien in den Raum. In ihrem Licht tanzten kleine Staubkörnchen, irgendwo summte eine Biene, das Gackern der Hühner drang an ihr Ohr. Marianne rieb sich fröstelnd über die Arme, obwohl es nicht kalt war.
Langsam ging sie durch die Küche, trat auf den Hof und hob ihre Hand zum Schutz vor der Sonne über die Augen. Als sie sich an das grelle Licht gewöhnt hatte, sah sie Irmgard. Sie lag auf dem Boden. Die Hühner tippelten eifrig um sie herum und pickten nach dem Futter, das aus dem Eimer gefallen war, der neben der alten Magd lag. Irmgards Blick ging ins Leere, ihre Gesichtszüge wirkten erschlafft. Vorsichtig trat Marianne näher. Der Tod hatte für sie nichts Erschreckendes. Sie sank neben die alte Frau und betrachtete ihr Gesicht. Das Antlitz, das sie jeden Tag gesehen hatte, die Augen, die jetzt ausdruckslos waren, hatten immer über sie gewacht und oft Milde und Nachsicht gezeigt. Selbst jetzt, im Angesicht ihres Schöpfers, lächelte Irmgard ein wenig. Marianne lächelte ihr zu und vergaß für einen Moment den Hof und alles um sich herum.
In ihrer Erinnerung sah sie plötzlich ihre alte Küchenmagd Alma vor sich. Die gute alte Alma, die nicht wiedergekommen war.
Sie sah ihren kleinen Bruder, wie er im Bettchen gelegen hatte, die Augen geschlossen, die Lippen rot. Er hatte ausgesehen, als würde er schlafen, so friedlich und ruhig. Der Tod hatte ihm nicht seinen Liebreiz genommen. Alma hatte immer gesagt, der liebe Gott würde aus Kindern Engel machen und sie deshalb im Schlaf holen. Warum er sie selbst damals nicht geholt hatte, hatte sie nie verstanden. Sie wäre so gern ein Engel geworden, an der Seite ihres Bruders.
Ein sanfter Windstoß brachte Marianne in die Realität zurück. Seufzend erhob sie sich, hielt dann aber noch für einen kurzen Moment inne. Der Wind schien für einen Augenblick stärker zu werden. Staub wirbelte in die Höhe, und sogar die gackernden Hühner wurden still. Es war, als würde die Seele sich verabschieden und endgültig gehen.
»Auf Wiedersehen«, flüsterte Marianne und wandte sich wieder zur Tür, durchschritt schweren Herzens die Küche und ging die Treppe nach oben. Jetzt musste Hedwig geweckt werden.
Das rostige Friedhofstor quietschte laut, als Marianne es öffnete. Missmutig blickte sie sich um. Es war Mittag, und die Sonne schien unerbittlich auf die schmiedeeisernen Kreuze und Grabsteine. Langsam schritt sie durch die Reihen der Gräber. Einige wurden liebevoll gepflegt, andere waren verwildert, und Brombeerranken und Efeu überwucherten die Grabsteine und ‑kreuze. Der Friedhof war im hinteren Bereich erweitert worden. Ein großes Loch klaffte in der Mauer, und ein angedeuteter Weg führte auf ein neues Gräberfeld. Dicht an dicht lagen hier die frischen Grabstätten, meist nur mit einfachen Holzkreuzen verziert.
Marianne ging nicht gern auf den Friedhof, was nichts mit den Toten oder so manchem Geist zu tun hatte. Sie fürchtete sich eher vor den Lebenden. Langsam schritt sie durch das hohe Gras. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, in diesem neuen Teil des Friedhofes einen Weg anzulegen. Zu viele Tote hatte es in der letzten Zeit zu beklagen gegeben. Zwar waren die Zeiten nicht so schlecht wie während der großen Pestwellen, und Massengräber gab es keine, aber Leopold Wiesner, der Friedhofsgräber, den alle nur Poldi nannten, konnte sich über fehlende Arbeit nicht beklagen.
Marianne blieb vor einem teilweise ausgehobenen Grab stehen. Poldi hielt beim Schaufeln inne und blickte auf. Mürrisch verzog er das Gesicht, womit Marianne gerechnet hatte, denn Poldi konnte sie nicht leiden und machte daraus, wie fast alle in Rosenheim, keinen Hehl. In seiner Gegenwart verspürte sie stets Angst, was gewiss auch mit seinem abstoßenden Äußeren zusammenhing. Poldi war als Kind von einem Hund gebissen worden. Das Tier hatte ihm einen Teil der rechten Wange und ein Auge herausgerissen. Diese Entstellung ließ ihn wie ein Ungeheuer aussehen. Sein verbliebenes Auge wirkte stechend und unnatürlich. Er drehte es oft seltsam hin und her, was die abschreckende Wirkung noch verstärkte. Wegen des Lochs in seiner Wange konnte er nicht richtig lachen und verzog oft nur den Mundwinkel, was sein Gesicht noch hässlicher aussehen ließ.
Er wischte sich seine schmutzigen Hände an der Hose ab.
»Was willst du, Mädchen? Habe ich nicht gesagt, du sollst dich auf dem Friedhof nicht blicken lassen, verdammtes Pestkind.« Marianne wich ein Stück zurück. Am liebsten wäre sie fortgelaufen. Sollte Hedwig doch zusehen, wie sie ihre Magd unter die Erde bekam. Eigentlich war es ihre Aufgabe, sich um Irmgards Beerdigung zu kümmern. Allerdings hätte Hedwig wahrscheinlich vergessen, zum Friedhof und zum Pfarrer zu gehen, bei dem Marianne bereits gewesen war, denn sonst würde Irmgard bei diesem Wetter im Schuppen zu stinken anfangen. Die alte Magd hatte es verdient, eine anständige Beerdigung zu bekommen. Auch wenn diese eher einfach und ohne Pfarrer am Grab ausfallen würde. Hedwig dachte nicht daran, den Geistlichen zu bezahlen oder wenigstens eine kleine Spende für die Kirche zu geben. Deshalb würde Irmgard nur kurz im Stall gesegnet werden, bevor Poldi sie hoffentlich abholen würde.
Marianne atmete tief durch, ignorierte seinen rüden Ton und antwortete:
»Hedwig Thaler schickt mich. Unsere Irmgard, die Küchenmagd, ist tot. Einfach umgefallen. Könnt Ihr sie morgen Vormittag holen?«
Poldi zog die Augenbrauen hoch und machte eine weit ausholende Geste.
»Vier Gräber müssen bis morgen fertig werden. Denkst du, ich hab für alles Zeit, du vermaledeites Etwas? Sieh zu, dass du fortkommst, und richte Hedwig aus, ich hätte zum Abholen keine Zeit und sie soll die Leiche herbringen.«
Mit dieser Antwort hatte Marianne gerechnet.
Doch es gehörte zu Poldis Aufgaben, die Leichen abzuholen. Sie durften innerhalb der Stadtmauern nicht einfach auf irgendeinem Wagen transportiert werden. Der Friedhofsgräber musste sie mit dem dafür vorgesehenen Karren abholen, ob es ihm gefiel oder nicht. Margit hatte sie schon vorgewarnt, dass er gewiss versuchen würde, sie abzuwimmeln.
»Ihr kennt die Regeln, Poldi. Sie muss mit dem Leichenkarren abgeholt werden.«
Poldi warf ihr einen bösen Blick zu. Auch wenn er sie nicht leiden konnte und am liebsten in die Hölle schicken würde, aus der sie anscheinend hervorgekrochen war, musste er in diesem Fall nachgeben. Es war seine Pflicht, die Toten einzusammeln. Wenn er es nicht tat, konnte er Ärger mit dem Büttel bekommen, was er auf gar keinen Fall wollte.
Er griff wieder nach seiner Schaufel und arbeitete weiter. Marianne blieb abwartend vor dem Grab stehen. Sein Verhalten war unmöglich, doch sie versuchte trotzdem, geduldig zu bleiben, denn mit lauten Worten würde sie nicht weiterkommen. Poldi musste nachgeben. Es war nur eine Frage der Zeit.
Der Friedhofsgräber schaufelte eine Weile schweigend weiter, doch irgendwann konnte er ihren Anblick nicht mehr ertragen. »Also gut«, lenkte er ein. »Ich komme sie morgen früh holen. Einen Sarg wird es nicht geben, oder?«
Marianne atmete erleichtert aus.
»Nein, einen Sarg gibt es nicht. Auf Wiedersehen.«
Sie drehte sich um und schritt hocherhobenen Hauptes davon.
Auf dem Rückweg vom Friedhof kam Marianne am Anwesen der Hofers vorbei, das am Anfang der engen Hafnergasse lag, die zum Salzstadl führte. Es war ein prachtvolles Eckhaus mit einem großen Tor, durch das man in einen Innenhof gelangte, in dem eine große Linde neben einem plätschernden Brunnen stand.
Die Hofers waren reiche Leute. Maximilian Hofer war ein angesehener Tuchhändler. Fast alle Lieferungen, die über den Inn verschifft wurden, kamen zu ihm oder wurden von hier verschickt. Im hinteren Teil des Hofes gab es große Lagerhäuser, in denen viele Tuchballen auf ihre Abnehmer warteten.
Marianne hatte als Kind gern mit Angelika, der Tochter des Hauses, gespielt. Angelika war zwei Jahre älter als sie und hatte nie viel darauf gegeben, ob ihrem Vater gefiel, was sie tat. Ungehorsam hatte er sie genannt und Marianne stets vom Hof verscheucht, wenn er ihrer ansichtig geworden war. Sogar eingesperrt hatte er Angelika und geschlagen. Doch die beiden Mädchen trafen sich trotzdem.
Der Tuchhändler war Witwer und oft auf Reisen. Angelika war von Kinderfrauen großgezogen worden, die sich meistens nicht darum scherten, was das Kind tat.
Marianne und Angelika waren eine Zeitlang wie Pech und Schwefel gewesen. Marianne hatte die Freundin häufig zu den Mönchen ins Kloster mitgenommen, wo sie durch den weitläufigen Obstgarten toben durften und oft bei der Ernte halfen.
Wehmütig blickte Marianne in den vertrauten Innenhof und betrachtete den staubigen Boden, die Karren vor den Lagerhäusern und die Hühner, die gackernd herumliefen und nach etwas Essbarem suchten. Überall auf dem Boden lagen wie ein hellgrüner Teppich die Blüten der Linde.
Gern wäre sie hineingegangen und hätte grüß Gott gesagt, aber sie traute sich nicht. Angelika hatte vor drei Jahren geheiratet.
Ludwig Thalhammer stammte aus einer einflussreichen Kaufmannsfamilie. Von fern hatte Marianne Angelika in ihrem hübschen seidenen Hochzeitskleid bewundert. Ihre blonden Haare waren geflochten und aufgesteckt worden, und sie hatte einen Blumenkranz aus Margeriten getragen. Ab diesem Tag war alles anders zwischen ihnen geworden. Ludwig hatte Angelika den Umgang mit Marianne verboten. Sie sah jetzt weg, wenn ihr die Freundin auf der Straße begegnete, und grüßte sie nicht mehr. Marianne hatte anfangs gehofft, dass diese Ablehnung sich geben würde, aber als Ludwig sie an einem windigen Herbsttag wie einen räudigen Hund vom Hof gejagt hatte, hatte sie verstanden. Seitdem war sie nie wieder hierhergekommen. Doch jetzt zögerte sie weiterzugehen. Nur zu gern hätte sie Angelika, die im letzten Jahr Mutter geworden war, wiedergesehen. Die Freundin konnte doch nicht auf ewig so abweisend zu ihr sein. Auch wenn alle sie verachteten und ihr mit Misstrauen und Argwohn begegneten, wusste Angelika es besser.
Aber dann überlegte sie es sich anders und ging weiter. Angelika hatte jetzt ein eigenes Leben, in dem es für sie keinen Platz mehr gab.
Einige Meter weiter ließ ein lautes Quietschen Marianne innehalten, und sie wandte sich um.
Ein kleines Mädchen kam aus dem Hof des Tuchhändlers gewackelt, ruderte mit den Armen, lief auf die Gasse und hob einen Kieselstein auf, den es bewundernd musterte. Marianne blickte zum Hoftor, doch niemand folgte dem Kind. In diesem Moment bog ein mächtiges Fuhrwerk, von vier Pferden gezogen, um die Ecke und fuhr genau auf die Kleine zu. Marianne rannte los, riss das Kind an sich und sprang zur Seite. Das Fuhrwerk ratterte an ihnen vorbei. Das Mädchen riss erschrocken die Augen auf, verzog sein Gesicht und begann zu weinen.
In dem Moment trat Angelika auf die Straße. Sofort rannte sie zu Marianne und riss ihr das Kind aus den Armen.
Ihr Blick war eiskalt. Marianne wich zurück, versuchte dann aber, sich zu verteidigen.
»Sie ist vor eines der Fuhrwerke gelaufen.« Angelika sah ihre Tochter mahnend an.
»Frieda, meine Frieda. Du sollst doch nicht auf die Gasse laufen.«
Sie wandte sich ab. Marianne schaute ihr fassungslos hinterher. Das konnte doch nicht sein. Sie hatte die Kleine vor dem sicheren Tod bewahrt, denn die Pferde hätten das Kind niedergetrampelt, und das war der Dank dafür. Enttäuscht wollte sie weitergehen. »Warte!«, rief Angelika aber doch noch. Marianne blieb stehen und drehte sich um.
»Danke, dass du Frieda gerettet hast.« Angelika lächelte schüchtern.
»Gern geschehen«, antwortete Marianne erleichtert.
Angelika nickte, hob die Hand zum Gruß, ging auf den Hof zurück und schloss das Tor hinter sich.
Marianne blieb noch eine Weile stehen und blickte nachdenklich auf die rot gestrichenen Bretter, auf denen in weißen geschwungenen Buchstaben der Name des Tuchhändlers stand. Der Verlust ihrer Freundschaft schmerzte sie sehr.
Doch dann straffte sie die Schultern, schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter und ging. Sie würde nichts daran ändern können, sosehr sie es sich auch wünschte, denn sie spielte in Angelikas Leben keine Rolle mehr.
Der Innenhof der Brauerei war wie leer gefegt, als Marianne ihn kurz darauf betrat. Dicke dunkle Quellwolken türmten sich am Himmel bedrohlich auf und verdeckten die Sonne. Doch die schwüle Hitze lag wie eine Glocke über allem. Ihr Kleid klebte an ihrem Körper, und Schweiß rann ihre Beine hinunter. Selbst die Hühner hatten sich in den Schatten des Hauses zurückgezogen. Sanftes Wiehern drang aus der geöffneten Stalltür nach draußen.
Marianne verdrehte die Augen. Bert und Sepp, die beiden behäbigen Brauereipferde, sollten eigentlich schon längst auf der kleinen Weide stehen, die auf der anderen Seite des Gebäudes direkt an den Gemüsegarten grenzte, um den sich bisher Irmgard gekümmert hatte. Marianne ahnte bereits, dass ihr diese Aufgabe jetzt zufallen würde, wie alles, was Irmgard erledigt hatte. Hedwig Thaler würde ihre Angewohnheit, möglichst wenig zu arbeiten, gewiss nicht ändern.
Sie betrat den Stall, in dem ihr drückende, nach Pferdemist stinkende Luft entgegenschlug. Sofort scharrten die beiden Tiere unruhig mit den Hufen. Marianne öffnete die Boxen und führte die beiden über den Hof auf die kleine Weide, die nicht mehr als ein Stück Wiese zwischen Hauswänden war. Die Sonne verschwand hinter den Wolken, grummelnd kündigte sich ein Gewitter an. Schwer atmend und von Schwindel geplagt, blieb Marianne unter einem Apfelbaum stehen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie bisher weder etwas gegessen noch getrunken hatte.
Zurück im Hof, ging sie trotz des nagenden Hungers noch einmal in den Stall, um nach der toten Irmgard zu sehen. Die Leiche lag noch genau dort, wo sie sie abgelegt hatte, ordentlich zugedeckt mit einem grauen Leinentuch. Beruhigt wandte sie sich zum Gehen. Doch dann ließ ein Geräusch sie aufhorchen. Zielsicher eilte sie durch den Stall, blieb in der hintersten Ecke stehen und entfernte ein Holzbrett in der Wand, welches als Tür diente. Dahinter befand sich eine enge Nische, gerade groß genug für zwei Menschen. Anderl saß darin und sah Marianne mit weit aufgerissenen Augen an.
Sie kroch schweigend neben ihn und schob das Brett mit geübtem Griff wieder vor den Eingang.
»Was ist passiert?« Sie streichelte sanft seinen Arm.
Anderl schluchzte leise und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Hat sie dich wieder geschlagen?« Er nickte.
Liebevoll zog sie ihn an sich. Hedwig würde nie mit ihm umgehen können. Immer wenn es dem Jungen zu viel wurde, verkroch er sich in der Nische im Stall. Als Kinder hatten sie häufig viele Stunden hier ausgeharrt, wenn Hedwig mal wieder wütend gewesen war.
»Warum war sie denn böse?«
Anderl reagierte nicht auf ihre Frage.
Marianne wiederholte sie. Doch anstatt ihr zu antworten, wechselte er das Thema.
»Wir müssen für Irmgards Grab Blumen pflücken.« Marianne verstand: Er wollte nicht darüber reden.
»Ja, das machen wir. Wir werden ihr einen großen bunten Strauß pflücken. Vor dem Münchener Tor wachsen Margeriten und Glockenblumen. Gleich morgen gehen wir dorthin.« Anderl lehnte seinen Kopf an ihre Schulter.
»Glaubst du, Irmgard ist jetzt im Himmel?«
»Bestimmt. Unsere Irmgard war so ein guter Mensch. Gewiss ist sie jetzt bei Gott und guckt auf uns herab.«
»Mutter wollte nicht, dass ich Blumen pflücke«, sagte Anderl leise.
Marianne schloss die Augen.
»Das kann ich mir vorstellen.« Anderl hob den Kopf.
»Sie hat Irmgard nicht gerngehabt, oder?« Marianne stützte ihr Kinn auf seinen Kopf.
»Manchmal frag ich mich, ob sie überhaupt irgendwen gernhat.«
In der darauffolgenden Nacht konnte Marianne nicht schlafen. Durch das winzige Dachfenster schien der Mond auf den Dielenboden, und das Zirpen der Grillen war zu hören. Sie lag, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, im Bett und starrte an die Decke. In solchen Momenten dachte sie oft an den Hof in Kieling und versuchte sich auszumalen, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn ihre Eltern nicht gestorben wären. Sie schloss die Augen und sah sich selbst in dem Innenhof, an den sie sich noch gut erinnern konnte. Eine Schar Gänse lief schnatternd um sie herum, und Knechte und Mägde gingen ihrem Tagwerk nach. Am geöffneten Küchenfenster stand Alma und winkte ihr fröhlich zu. Marianne öffnete wieder die Augen. Alma, die gute alte Küchenmagd, die für sie wie eine Mutter gewesen war. Sie hatte sie gesucht in jener Nacht, als sie es wagte, ihr Versteck zu verlassen. Sie war vom Lärm geweckt worden und hatte gedacht, Alma wäre zurückgekommen. Doch es war nicht die Magd gewesen, die sie auf dem Hof gesehen hatte. Seltsam verhüllte Gestalten mit Fackeln in den Händen hatten ihr Angst gemacht. Sie schüttelte den Kopf, um die schrecklichen Erinnerungen loszuwerden, und drehte sich zur Seite. Ihr Blick fiel auf die Truhe unter dem Tisch. Wie lange hatte sie nicht mehr hineingesehen? Sie wusste es nicht. Sie stand auf, zog die Truhe unter dem Tisch hervor und öffnete sie.
Ganz oben lag ihre alte Puppe Elly und sah sie mit ihren schwarzen Knopfaugen vorwurfsvoll an. Elly bestand aus ein paar alten Strümpfen und Stroh, ihre Haare waren aus brauner Wolle. Sie trug noch immer das blaue Kleid, das Alma ihr genäht hatte. Marianne konnte sich noch genau daran erinnern, wie sie es ihr gemeinsam angezogen hatten. Lächelnd hob sie die Puppe hoch, drückte sie kurz an sich und legte sie dann neben sich auf den Boden. Unter Elly kam ein Bild ihres Vaters zum Vorschein. Sie hielt es ins Mondlicht, um es besser sehen zu können. Sein Blick war ernst, und er trug eine Uniform, denn er hatte gedient und war für die Kaiserlichen gegen die Schweden gezogen. Wegen einer schweren Verletzung am Bein war er heimgekommen und geblieben. Marianne hatte ihren Vater nur humpelnd gesehen. Aber immerhin war er zurückgekommen und nicht fortgeblieben wie so viele andere. Sie legte das Bild zur Seite und kramte den nächsten ihrer Schätze heraus.
Es war eine feine Goldkette, an der ein winziger Anhänger in Form eines Engels hing. Die Kette hatte einmal ihrer Mutter gehört. Alma hatte sie ihr um den Hals gehängt, als sie sie in den Verschlag gebracht hatte. Aufpassen sollte der Engel auf sie und beschützen vor allem Bösen, ihr Glück bringen.
Marianne ließ den Anhänger durch ihre Finger gleiten und hielt ihn ins Mondlicht, in dem er sanft schimmerte. So ein kleiner Engel, dachte sie. Wie sollte er sie beschützen können? Vielleicht war damals doch der Teufel mit im Spiel gewesen. Aber was hatte sie getan, um ihm zu erliegen? Sie war ein Kind gewesen, klein und hilflos. Sie schloss ihre Finger um den winzigen Engel, stand auf und legte sich wieder in ihr Bett. Vielleicht war es dieser kleine Anhänger gewesen, der sie gerettet und das Böse und die Pest vertrieben hatte, was ihr jedoch niemand glauben würde, das wusste sie, denn die Pest, schwarz und dunkel, würde sie niemals verlassen.
Am nächsten Tag glich Rosenheim einem dampfenden Gluthaufen. Die Hitze flimmerte über den Pflastersteinen des Äußeren Marktes, auf dem nur wenige Laubengänge Schutz vor dem gleißenden Licht boten. Staub tanzte in der schwülen Luft übers Pflaster, und kaum ein Mensch war zu sehen. Die meisten flohen um diese Zeit in ihre kühlen Häuser und schlossen die Fenster. Erst am späten Nachmittag, wenn die Sonne langsam hinter den Mauern verschwand, würde sich der Markt wieder mit Menschen füllen. Nur wenige, meist mit Salz oder Getreide beladene Fuhrwerke waren unterwegs.
Marianne war nass geschwitzt, und ihr Kopf dröhnte. Sie war auf der Suche nach Anderl. Der Junge hatte nur wenige Talente, doch wie man sich klammheimlich davonstehlen und vor der Arbeit drücken konnte, verstand er hervorragend.
Sie verließ die Stadt durchs Inntor und wandte sich zum Fluss, wo sie Anderl vermutete, der gern den Schifffahrern bei der Arbeit zusah.
Hier draußen, in der Nähe des Wassers, war die Luft etwas erträglicher. Ein leichter Wind wehte über die Weidenbäume und die von gelbem Löwenzahn übersäten Wiesen. Marianne atmete tief durch und blickte auf das glitzernde Wasser der Mangfall, die wenige Meter weiter in den Inn mündete, um mit ihm gemeinsam die weite Reise zur fernen Donau anzutreten.
Über den Bergen türmten sich die ersten Quellwolken auf, einige davon verfärbten sich bereits bedrohlich dunkel. Sie entdeckte Anderl schon von weitem. Er stand dort, wo sie ihn vermutet hatte, direkt neben dem Fähranleger, unweit von der abgerissenen Innbrücke. Einige Überreste der ansehnlichen Brücke lagen noch am Ufer. Den Rest hatten die grünen Wasser des Inns verschlungen. Die kaiserlichen Truppen hatten die Brücke, trotz aller Proteste der Bürgerschaft, vor einigen Jahren zerstört. Die Kriegslist war aufgegangen, und General Wrangel war bisher nicht über den Inn gekommen. Allerdings hatten die Truppen der Stadt damit großen Schaden zugefügt, die ihr Brunnenwasser über eine an der Brücke entlangführende Leitung vom höher gelegenen Schlossberg bezogen hatte. Seitdem waren Durchfallerkrankungen, die von verunreinigtem Wasser herrührten, weit verbreitet. Vor allem Kleinkinder und Säuglinge fanden den Tod.
Wann die Brücke wieder aufgebaut wurde, wusste niemand. Marianne blieb hinter Anderl stehen und folgte seinem Blick. Auf der anderen Seite des Flusses war eine Gruppe Innschifffahrer mit vielen aneinanderhängenden, teilweise vollbeladenen Booten unterwegs. Alois Greilinger, der Stangenreiter und Schiffsmeister, den jeder in Rosenheim kannte und sogar ein wenig fürchtete, ritt voraus und prüfte das Ufer mit seiner langen Stange nach etwaigen Untiefen, die für die Männer und Pferde, die hinter ihm die Boote an Seilen und Ketten zogen, den sicheren Tod bedeuten konnten. Es ging nur langsam und mühsam gegen den mächtigen Strom voran.
Die Innschifffahrer waren ein ganz eigenes Volk. Einerseits angesehen, in Bruderschaften verbunden, andererseits galten sie als ruchlos und ohne Manieren. Sie waren frei, ein wenig wie Landsknechte, die durch die Lande zogen und tun und lassen konnten, was sie wollten. Jeder Vater in Rosenheim sperrte seine Töchter ein, wenn die Männer in der Stadt waren. Obwohl ein Schifffahrer durchaus auch eine gute Partie darstellte, auch wenn die Innschifffahrt viele Gefahren barg und so manches Mädchen schneller Witwe wurde, als ihr lieb war.
»Ich weiß, du würdest gern mitfahren«, sagte Marianne, ohne ihren Stiefbruder zu begrüßen.
»Schon«, antwortete er, ohne sich umzudrehen. »Aber sie werden mich nicht haben wollen.«
Marianne trat neben Anderl.
»Warum bist du dir da so sicher?«
Anderl sah seine Stiefschwester verwirrt an.
Sie seufzte. Wieder einmal hatte er sie nicht verstanden.
»Ich kann mich ja mal erkundigen«, sagte sie. »Vielleicht brauchen sie noch einen Schiffsjungen. Du bist kräftig geworden und groß.«
Schweigend blickte der Junge ans andere Ufer, die Boote verschwanden nach und nach hinter einer Biegung.
Ein Schatten legte sich auf den Fluss. Marianne blickte auf. Die ersten Wolken schoben sich vor die Sonne. Hedwig würde bestimmt schon ungeduldig auf sie warten.
»Wir sollten gehen«, schlug Marianne vor. »Mutter ist bestimmt schon wütend. Du kennst sie doch.«
Anderl sah seine Schwester nachdenklich an und blickte danach wieder aufs Wasser hinaus.
»Mutter ist immer wütend. Also ist es gleichgültig.«
Langsam drehte er sich um und trat auf die Straße. Marianne folgte ihm.
Wie recht er doch hat, dachte sie. Sie wird niemals zufrieden mit ihm sein – oder mit mir.
Später am Abend hing die Schwüle des Tages noch immer über der Stadt, und auf dem Marktplatz drehte der Nachtwächter bereits seine Runden. Doch die Gaststube der Brauerei war noch gut gefüllt.
Marianne, die beim Bedienen aushalf, war auf dem Weg zur Küche. Durch die geöffnete Hintertür drang ein leichter Luftzug in den düsteren Flur, kühlte ihre schweißnasse Haut und ließ sie kurz erschauern. Seufzend strich sie eine Haarsträhne, die sich aus ihrem geflochtenen Zopf gelöst hatte, nach hinten und atmete tief durch, genoss für einen Moment den kühlen Hauch des Abends und schloss die Augen. Müde lehnte sie sich an die Wand. Der Tag war anstrengend gewesen und war längst noch nicht vorbei.
Hedwig hatte keinen Finger gerührt, um den Betrieb am Laufen zu halten. Marianne hatte das Gemüse geerntet, sich um die Pferde und Hühner gekümmert und den Stall ausgemistet. Sie hatte den Boden in der Gaststube gescheuert, Brot gebacken und beim Metzger das bestellte Fleisch abgeholt. Hedwig dagegen hatte wie immer nur Befehle erteilt und Marianne sogar geohrfeigt, als ihr etwas nicht schnell genug gegangen war.
Hedwig hatte Irmgard nie so gegängelt, vor ihr hatte sogar sie so etwas wie Respekt gehabt.
Doch Irmgard lag jetzt unter der Erde, am Rande des Friedhofs, abseits der kunstvoll geschmiedeten Kreuze, dort, wo die Armen verscharrt wurden.
Anderl hatte als Einziger um Irmgard geweint. Er hatte die Magd sehr gemocht. Traurig hatte er eine Weile vor dem Grab gestanden und seine selbst gepflückten Blumen hineingeworfen.
Marianne selbst konnte nicht weinen. Sie wusste nicht einmal, warum, denn Irmgard hätte ihre Tränen verdient. Die alte Magd hatte sie zwar auch gegängelt und zur Arbeit angetrieben, aber sie hatte sie so angenommen, wie sie war.
Marianne schloss die Augen, drehte ihren Kopf zur geöffneten Tür und sog die nach Regen riechende Luft ein. Wie schön wäre es jetzt, einfach fortzugehen. Einen Tag nur das zu tun, was einem gerade einfiel. Vielleicht auf einer Sommerwiese liegen, irgendwo unter einem schattigen Baum, die nackten Füße im weichen Gras. Dort, wo einem der sanfte, nach Blumen duftende Wind um die Nase wehte und nur die zwitschernden Vögel und summenden Bienen zu hören waren.
»Marianne!« Sie öffnete erschrocken die Augen. Hedwig stand mit einem Tablett, auf dem sich gebratene Hühnerbeine türmten, vor ihr und sah sie vorwurfsvoll an.
»Was faulenzt du hier schon wieder herum, dafür füttere ich dich gewiss nicht durch. Beeil dich und bring das Tablett zu Mooshammers Tisch.«
»Ja, Mutter, sofort. Es tut mir leid. Es ist nur« – Marianne stockte –, »es ist so schrecklich schwül heute.«
Die Wirtin drückte Marianne das Tablett in die Hand.
»Habe ich das Wetter gemacht? Das ist keine Entschuldigung für deine Faulenzereien. Ganz im Gegenteil. Ich habe deine ewigen Ausreden satt. Wärst du eine normale Dienstmagd, schon längst hätte ich dich vor die Tür gesetzt. Aber diese Flausen werde ich dir austreiben, du wirst schon sehen.«
Drohend hob die korpulente Frau die Hand. Marianne zog den Kopf ein und presste die Augen zusammen. Doch nichts geschah. Verächtlich schnaubend wandte sich Hedwig von ihrer Stieftochter ab und ging zurück in die Küche.
Vor Wut kochend, schob sich Marianne durch die gut gefüllte Gaststube und schlug nach der einen oder anderen Hand, die ihr das herzhaft duftende Fleisch stibitzen wollte. Die Gerüche von Bier, Wein und Schweiß schwängerten die Luft und raubten ihr den Atem.
Wäre sie eine einfache Magd, dann wäre sie schon längst fort, dachte Marianne, während sie bemüht lächelnd die Fleischplatte auf dem Tisch abstellte und eine weitere Hand daran hinderte, ihr Hinterteil zu begrapschen. Gäbe es auch nur eine einzige Möglichkeit, zu gehen, hätte sie sie genutzt. Doch es gab keine. Ihr ganzes Leben würde sie bei diesen Trunkenbolden verbringen. Abend für Abend, Nacht für Nacht würde sie in dieser verrauchten und stickigen Gaststube stehen, und niemals würde sich daran etwas ändern. Wahrscheinlich endete sie irgendwann wie Irmgard, verscharrt und vergessen auf dem Armenfriedhof.
Hinter der Theke spülte Margit, die zweite Küchenmagd der Brauerei, Gläser. Marianne gesellte sich zu ihr. Margit und sie waren in etwa gleich alt. Sie war ein wenig kleiner als Marianne und hatte lockiges kupferrotes Haar, das sich nur schwer bändigen ließ. Ihre Haut war kreideweiß und von Sommersprossen übersät. Margit wollte ebenfalls fort aus der Brauerei, allerdings aus anderen Gründen, die ausschließlich etwas mit dem männlichen Geschlecht zu tun hatten. Deshalb hatte sie sich auch heute wieder ausgesprochen aufreizend zurechtgemacht. Ihr dunkelblaues Leinenkleid war eng geschnürt, und ihre Brüste hatte sie ein gutes Stück nach oben geschoben. Ein Korsett, wie es sich die reicheren Frauen Rosenheims leisten konnten, besaßen sie beide nicht. Deshalb wickelte Margit einfach ein Stück Stoff unter ihre Brüste, was in etwa dieselbe Wirkung hatte.
»Der Büttel und sein Kumpan möchten noch zwei Gläser Wein. Ich hab sie schon eingeschenkt. Kannst du die Bestellung an den Tisch bringen? Du siehst doch, was hier los ist.«
Margit wies in den Gastraum und schenkte dabei dem Wildbacher Gerhard, der sabbernd in ihren Ausschnitt starrte, ein verführerisches Lächeln. Marianne verdrehte die Augen, griff nach den Gläsern und schob sich an einer Gruppe singender Männer vorbei zum Tisch des Büttels.
August Stanzinger, wie der Büttel hieß, war ein kleiner, drahtiger Mann mit schmalen blauen Augen in seinem kantigen Gesicht. Seine Wangen wirkten eingefallen, und selbst wenn er lächelte, hatte er nichts Freundliches an sich. In seiner Gegenwart fühlte sich Marianne immer seltsam unbehaglich und verletzbar. Eilig stellte sie die Gläser auf den Tisch und wich dem kühlen Blick aus, den er ihr zuwarf. Sein Gegenüber war ihr unbekannt. Den großen blonden Mann, der ihr sogar ein Lächeln schenkte, hatte sie hier noch nie gesehen. Eigentlich kannte in Rosenheim jeder jeden. Nur in den letzten Jahren, seitdem immer wieder Soldaten und Landsknechte durchzogen und untergebracht werden mussten, gab es auch Fremde hier.
Doch der Mann sah weder wie ein Soldat noch wie ein Landsknecht aus. Neugierig musterte Marianne, nachdem sie wieder hinter der Theke war, die beiden sich angeregt unterhaltenden Männer. »Sag mal, Margit, kennst du den Mann, mit dem der Büttel heute hier ist?«
Margit, die gerade eine Runde Schnaps für einen der größeren Tische vorbereitete, blickte zu den beiden hinüber und schüttelte den Kopf.
»Den habe ich hier noch nie gesehen. Warum interessiert dich das? Findest du ihn hübsch?« Marianne seufzte.
»Nein, finde ich nicht. Ich wollte einfach nur wissen, ob du etwas über ihn weißt. Der Büttel scheint ihn ganz gut zu kennen, so wie er mit ihm redet.«
Margit zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung. Der wird schon wissen, wer er ist. Mir gefällt der Kerl nicht. Und mit Männern, die man nicht kennt, sollte man sowieso nicht liebäugeln. Das hat meine Mutter schon immer gesagt. Schuster, bleib bei deinem Leisten, hat sie gesagt. Am Ende ist er ein armer Schlucker oder ein Verbrecher.«
»Ein Verbrecher, der sich mit dem Büttel unterhält?«, fragte Marianne und verdrehte kopfschüttelnd die Augen. Wenn es um Männer ging, dachte Margit nur an das eine und hatte eine blühende Phantasie. Warum die Küchenmagd noch nicht unter der Haube war, war Marianne schleierhaft. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Margit es mit ihrer Tugend nicht so genau nahm. Mehr als ein Mal hatte sie sie dabei beobachtet, wie sie mit einem Burschen hinterm Hühnerstall verschwunden war. Wenn sie so weitermachte, würde sie nicht als treue Ehefrau, sondern als Hure enden.
Den Rest des Abends verbrachte Marianne hinter der Theke. Ab einer gewissen Uhrzeit ließ sie Margit den Vortritt beim Bedienen. Immer wieder wanderte ihr Blick in die Ecke, in der die Männer heftig miteinander diskutierten und manchmal sogar hinter vorgehaltener Hand flüsterten.
Einige Zeit später, als der letzte Gast endlich gegangen war, arbeitete Marianne noch immer in der Küche. Es zählte zu ihren Aufgaben, den Ofen zu reinigen, die Töpfe zu scheuern und den Abfall rauszubringen. Jeder Knochen im Leib tat ihr weh, aber heute genoss sie es, allein zu sein und diese Zeit für sich zu haben. Sie hatte die Hintertür zum Hof und die Tür zur Gaststube geöffnet. Ein leichter Luftzug wehte durch den Raum und ließ sie freier atmen.
Hedwig wusste ganz genau, wie sie ihrem Stiefkind das Leben schwermachen und ihr immer wieder zeigen konnte, was sie von ihr hielt. Dass es der Alten nur um den Unterhalt ging, den ihr Pater Franz jeden Monat bezahlte, war Marianne schon lange klargeworden. Nächstenliebe war für die Thalerin, wie ihre Ziehmutter überall in der Stadt genannt wurde, ein Fremdwort.
Wie oft hatte sich Marianne von hier fortgewünscht, war weinend ins Kloster gelaufen und hatte darum gebettelt, nicht mehr hierher zurückzumüssen. Aber es hatte alles nichts geholfen. Niemand außer der Thalerin wollte sie haben. Sie war die Geächtete, die es mit dem Teufel hatte. Mit der Zeit hatte sich Marianne an das Geschwätz der Leute gewöhnt. Sie war dem Tod entkommen. Gott hatte ihr das Leben geschenkt, sagte Pater Franz immer. Er war für sie ein wenig wie der Vater, den sie nie gehabt hatte. Sie konnte immer zu ihm ins Kloster kommen, wenn sie Kummer hatte. Er hörte ihr zu, nahm sie in den Arm und trocknete ihre Tränen.
Ein starker Windstoß, der die Tür zur Gaststube laut knallend zuschlug, ließ Marianne, die gerade dabei war, eine gusseiserne Bratpfanne im Spülstein zu scheuern, aufblicken. Donnergrollen folgte dem Windstoß, und ein weiterer Luftzug ließ die Kerze in der Laterne flackern.
Erleichtert über die kühle Brise, welche die stickige Schwüle des Tages vertrieb, ließ Marianne ihre Arbeit liegen und trat in den dunklen Hof hinaus. Sie genoss es, wie ihr der Wind unter die Röcke fuhr und sie an den Beinen kitzelte. Ein heller Blitz zuckte über den Nachthimmel und erleuchtete die dunklen Fenster. Der Duft von Blumen und Erde vermischte sich mit dem sanften Malzgeruch, der hier allgegenwärtig war. Wieder zuckte ein Blitz über den Himmel und ließ den Hof geheimnisvoll und unheimlich aussehen. Gleich würde es zu regnen beginnen. Seufzend drehte sie sich um, ging zurück in die Küche und begann, die Küchenabfälle, die Hedwig stets achtlos in die Ecke neben den Herd warf, in einen großen Holzeimer zu schaufeln, lief erneut hinaus und schüttete sie auf den Kompost. Es war seltsam still geworden. Nichts regte sich. Das Unwetter rang noch einmal nach Atem, um dann endgültig zuzuschlagen. Plötzlich durchbrachen Stimmen die bedrohliche Stille. Das Hoftor war nur angelehnt. Direkt davor standen anscheinend zwei Männer, die sich heftig stritten. Den einen der Männer erkannte sie sofort an seiner überheblich klingenden Stimme. Der Büttel und sein Kumpan. Leise schlich Marianne zum Pferdestall hinüber und drückte sich in den Schatten der Hauswand. Vor Aufregung schlug ihr das Herz bis zum Hals. Lauschen war eine Sünde, das wusste sie. Aber sie konnte nicht anders. Sie wollte unbedingt wissen, was die beiden Männer so Wichtiges zu besprechen hatten.
»Die Brauerei gehört mir. Meine Cousine ist Witwe, eine Frau kann so einen Betrieb doch gar nicht richtig bewirtschaften. Und ihr einfältiger Sohn wird die Geschäfte niemals übernehmen können.«
»Ich weiß nicht«, erwiderte August Stanzinger. »Immerhin bin ich hier der Stadtbüttel. Ich kann doch nicht das Recht mit Füßen treten.«
»Es soll Euer Schade nicht sein. Unter meiner Führung wirft die Brauerei gewiss gute Gewinne ab, und eine Beteiligung Eurerseits käme dann durchaus in Frage. Oder soll ich mein Wissen doch noch kundtun?«
»Nein, natürlich nicht!« Der Büttel wurde lauter. »Ich werde Euch schon irgendwie helfen. Das Stockhammer Bräu hat einen guten Ruf, der, seitdem die Frau es allein bewirtschaftet, sehr gelitten hat. Natürlich auch deshalb, weil sie den blöden Jungen hat und sich auch noch dieses Pestkind aufhalste, das hier niemand haben will.«
Marianne sog scharf die Luft ein.
»Also helft Ihr mir jetzt, meine hübsche Base loszuwerden? Wie gesagt, es soll Euer Schade nicht sein.« Die Stimme des Mannes klang zynisch.
Der Büttel seufzte hörbar.
»Meinetwegen. Aber wir müssen genau darüber nachdenken, wie wir es am besten machen. Am Ende stellt der Bengel doch noch Ansprüche.«
»Aber der Bengel ist doch einfältig und dumm.«
»Ja schon«, erwiderte der Büttel. »Aber Ihr wisst ja, wenn es ums Geld geht, da begreift selbst der Dümmste Dinge, die er vorher nicht verstanden hat.«
Die Stimmen entfernten sich.
Langsam frischte der Wind auf. Erneut erhellten Blitze die Dunkelheit, und die ersten dicken Tropfen fielen vom Himmel. Marianne stand, wie zur Salzsäule erstarrt, an der Hauswand. Der Wind, die Regentropfen, alles prallte an ihr ab. Das eben Gehörte konnte sie kaum glauben. Wenn sie die Männer wirklich richtig verstanden hatte, dann planten die beiden einen Mord.
2
Die Frau auf dem Boden hatte ihren Kopf abgewandt und die Augen fest geschlossen. Rhythmisch bewegte sich ihr Körper. Sie spürte den Atem des jungen Soldaten an ihrem Hals, hörte sein Stöhnen. Ihr nackter Po scheuerte über den Dielenboden, und wie durch eine Wand drangen die Rufe der Männer an ihr Ohr.
»Ja, komm schon, Claude, zeig ihr, wer hier der Sieger ist«, feuerten die Männer, die um die beiden herumstanden, den jungen Burschen an, der sich mit aller Macht an ihr verging.
Nur einer der Männer hielt sich zurück und beobachtete die Szene teilnahmslos. Albert Wrangel konnte Vergewaltigungen nichts abgewinnen. Eine Frau gegen ihren Willen zum Beischlaf zu zwingen, das hatte in seinen Augen etwas Barbarisches. Er stand in der Nähe des Eingangs, direkt neben der Leiche des Mannes, der eben noch versucht hatte, sein Haus und seine Familie zu verteidigen. Jetzt lag er mit starrem Blick und aufgeschlitztem Bauch in einer Blutlache auf dem Boden. Normalerweise hätte er sich geekelt, aber die letzten Jahre hatten ihn gelehrt, mit so einem Anblick fertigzuwerden.
Die anderen Männer seiner Gruppe waren länger dabei als er und kämpften bereits seit Jahren an der Seite seines Bruders, General Wrangel, obwohl man die Plünderungen, die sie zur Zeit durchführten, nicht als Kampf bezeichnen konnte. Seit dem Sieg in der Schlacht bei Zusmarshausen zogen sie durch Städte und Dörfer und brachten den leidenden und armen Menschen, die ihr eigener Kaiser fast verhungern ließ, Tod und Verderben. Sein älterer Bruder, Carl Gustav Wrangel, war ihm völlig fremd geworden, denn sein Name war der Inbegriff für Grausamkeit. Doch hatte er den Heerführer jemals wirklich gekannt?
Leises Schluchzen drang plötzlich an sein Ohr. Er bückte sich und blickte unter den klobigen Esstisch. Unter der Ofenbank saßen zwei Kinder. Ein Bursche, nicht älter als zehn Jahre, hielt einem kleinen Mädchen, das höchstens vier oder fünf Jahre zählte, verzweifelt den Mund zu. Tränen rannen über die Wangen der Kleinen, die ihn mit weit aufgerissenen Augen, in denen die blanke Panik stand, anstarrte. Der Junge dagegen erwiderte Alberts Blick ohne Furcht und legte seinen Finger auf die Lippen. Das Mädchen schluchzte erneut, und er presste seine Hand noch fester auf ihren Mund. Er war überraschend ruhig für einen Zehnjährigen, der gerade gesehen hatte, wie sein Vater ermordet worden war. Tapfer verteidigte er seine Schwester. Dieser Mut imponierte Albert. Er lächelte, legte ebenfalls den Finger auf die Lippen und zeigte zu seinen Kumpanen hinüber. Erleichtert sank der Junge in sich zusammen.
Claude war inzwischen fertig, schob sein Wams zurecht und stellte sich grinsend neben Albert, während sich der nächste der Kameraden über die Frau hermachte.
»Nach Markus bist du an der Reihe. Sie ist schön feucht, warm und willig, hat dicke, feste Brüste. Du wirst es lieben.«
Albert machte eine abfällige Handbewegung.
»Ich mache mir nichts aus dicken Bauersfrauen.« Claude sah ihn irritiert an.
»Aber sie ist genau das Richtige für einen Kerl wie dich.«
»Nein, ich möchte nicht«, wiegelte Albert erneut ab. »Wir sollten auch langsam von hier verschwinden, immerhin müssen wir heute noch zum Berichterstatten ins Hauptlager reiten.« Claude blickte nach draußen, wo das laute Kreischen der Weiber und das Geschrei der Kinder nachgelassen hatten. Ab und an rannten Soldaten an der geöffneten Tür vorbei, und auf der Straße lagen erschlagene Menschen, deren Blut sich mit dem Regen vermischte.
»Du bist ein Spielverderber, Albert. Dein Bruder hätte die Alte gewiss genommen. Er lässt ungern etwas anbrennen, musst du wissen.«
Albert atmete tief durch. Er hasste es, mit einem Mann verglichen zu werden, den er kaum als Bruder wahrnahm.
»Ich bin aber nicht Carl.« In seiner Stimme lag ein drohender Unterton.
»Ist ja schon gut.« Claude, der eigentlich zu Turennes Truppen gehörte, sich aber lieber den Schweden angeschlossen hatte, hob beruhigend die Hände.
Albert sah den Franzosen, der es mit seinen großen leuchtend blauen Augen, seinem bräunlichen Teint und den zerzausten schwarzen Haaren bei den Frauen leicht hatte, lächelnd an.
»Hast du Geschwister, Claude?«
»Aber sicher doch«, antwortete der Franzose entrüstet, »derer sogar acht.«
»Und bist du allen ähnlich, denkt ihr alle gleich?« Claude klopfte Albert lachend auf die Schulter.
»Guter Gott, nein. Jetzt verstehe ich, was du meinst, mein Freund.«
Erneut drang leises Schluchzen an Alberts Ohr. Nervös wanderte sein Blick zu den Geschehnissen auf dem Fußboden, doch niemand schien etwas bemerkt zu haben. Sie mussten hier weg. Wer weiß, wie lange der Junge das Mädchen noch stillhalten konnte. Eigentlich ging er nicht davon aus, dass seine Mitstreiter die Kinder töten würden. Aber im Krieg geschah manches, was man später bereute. Auf den Straßen lagen nicht nur tote Männer, auch Frauen und Kinder waren reihenweise ermordet worden.
»Wir brechen auf«, befahl Albert. Claude sah ihn überrascht an.
Albert hatte den höchsten Rang unter den Männern, war der Bruder des Generals, ließ sich das aber nur selten anmerken. Claude hatte den schlanken, drahtigen blonden Mann mit den verträumt blickenden grünen Augen vom ersten Augenblick an ins Herz geschlossen. Er war kein Schaumschläger, hatte seinen Mann auf den Schlachtfeldern gestanden, trauerte allerdings um die Toten, die seit Jahren ihre Wege pflasterten, und zeigte oft Mitleid mit den Armen. Er würde nie ein Anführer wie Carl Wrangel werden, aber er würde seine Menschlichkeit nicht verlieren.
»Ihr habt gehört, was Albert gesagt hat.« Claude klatschte in die Hände. »Es ist Zeit, zu gehen. Lasst die Frau jetzt in Ruhe.« Die Männer sahen den Franzosen verdutzt an. Der Nächste hatte eben die Hose geöffnet. Die Frau am Boden wirkte wie erstarrt. Zwischen ihren Beinen war der Boden feucht, und auf ihrem nackten weißen Körper glänzte der Schweiß.
Friedrich ließ widerwillig von ihr ab und trat ihr achtlos in die Seite.
»Sie wäre es sowieso nicht wert gewesen. Die Huren im Tross sind besser.«
Hastig kroch die Frau, die durch den Tritt aus ihrer Erstarrung gerissen worden war, hinter den Ofen und versuchte, ihre Blöße zu bedecken.
»Wir gehen«, wiederholte Albert seinen Befehl. »In diesem Haus wird heute kein Blut mehr vergossen.«
Schwarzer Rauch zog durch die Straßen, als die Männer nach draußen traten. Um sie herum herrschte das blanke Chaos. Frauen, mit zerrissenen Kleidern und rußverschmierten Gesichtern, liefen, Kinder hinter sich herziehend, an ihnen vorüber. Tote lagen herum, Feuer loderte aus vielen Häusern. Soldaten rannten, Brot, Schmuck und Federvieh in den Händen, an ihnen vorbei, selbst Schuhwerk und Kleidung trugen sie fort.