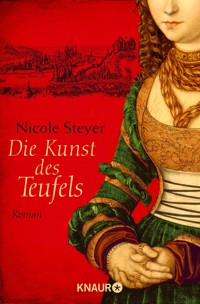6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein praller historischer Roman über eine Frau, die sich im Hessen des 18. Jahrhunderts ihren Platz in der Gesellschaft erkämpfen muss, von der Erfolgsautorin Nicole Steyer und ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Diskriminierung. Einst trug die Zigeunerin Suni einen anderen Namen. Einst wohnte sie in einem Schloss und nicht in Zelten. Aber das war in einem anderen Leben, vor jener Nacht, in der der dunkelhäutige Mathis, den man den "Schokoladen-Jungen" nennt, dem kleinen Mädchen das Leben rettete und die Freunde getrennt wurden. Als Suni Jahre später nach Darmstadt zurückkehrt, weckt die vertraute Umgebung verdrängte Erinnerungen. Damit wird Suni erneut zur Gefahr für die Frau, die ihr schon einmal nach dem Leben trachtete … Wird ihr Lebensretter von einst ihr noch einmal helfen können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Nicole Steyer
Der Gaukler und die Tänzerin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Einst trug die Zigeunerin Suni einen anderen Namen. Einst wohnte sie in einem Schloss und nicht in Zelten. Aber das war in einem anderen Leben, vor jener Nacht, in der der dunkelhäutige Mathis, den man den »Schokoladen-Jungen« nennt, dem kleinen Mädchen das Leben rettete und die Freunde getrennt wurden. Als Suni Jahre später nach Darmstadt zurückkehrt, weckt die vertraute Umgebung verdrängte Erinnerungen. Damit wird Suni erneut zur Gefahr für die Frau, die ihr schon einmal nach dem Leben trachtete … Wird ihr Lebensretter von einst ihr noch einmal helfen können?
Ein praller historischer Roman über eine Frau, die sich im Hessen des 18. Jahrhunderts ihren Platz in der Gesellschaft erkämpfen muss, von der Erfolgsautorin Nicole Steyer und ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Diskriminierung.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Nachwort
Historische Persönlichkeiten und Hintergründe im Buch
Dank
1727
Magdalene stand am Fenster, versteckt hinter den schweren Brokatvorhängen, und blickte sehnsüchtig nach draußen, wo Schneeflocken ihren sanften Reigen tanzten. Sie deckten die Straßen von Darmstadt zu, legten sich auf Dächer, Fenstersimse, Leiterwagen und Wollmützen, doch leider verwandelte sich der weiße Teppich auf der Gasse schnell in eine graue Matschbrühe. Menschen eilten an ihrem Fenster vorüber, mit tief ins Gesicht gezogenen Hüten und Mützen und umhüllt von Umhängen und dicken Mänteln waren sie kaum zu erkennen. Der eisige Winterwind, den Väterchen Frost über das Land schickte, trieb die Menschen in die Häuser und ließ die Welt erstarren. In den Zimmern des Hauses eingesperrt, war Magdalene in den letzten Wochen immer rastloser geworden und hatte ihre Kinderfrau, die gute Dorothea, nicht nur ein Mal verärgert. Am liebsten würde sie auch jetzt nach draußen laufen, um durch den Flockenwirbel zu tanzen oder mit anderen Kindern zu spielen und an deren Schneeballschlachten teilzunehmen. Doch das durfte sie nicht, denn sie war kein Gassenkind, sondern ein feines Mädchen. Die Tochter des Landgrafen Ernst-Ludwig von Hessen-Darmstadt trieb sich nicht mit schmutzigen Bälgern herum. Dorotheas Worte hatten endgültig geklungen. Magdalene wollte es trotzdem nicht einsehen. Sie versuchte ständig, auszubüxen, was meistens misslang. Einmal jedoch wäre es ihr beinahe gelungen, wenn da nur nicht die dummen Schnürsenkel an ihren feinen Schühchen gewesen wären, die so schwer zu binden waren. Die Schlaufe wollte nicht halten, immer wieder waren ihr die schwarzen Bänder durch die Finger gerutscht. Da half es auch nichts, dass sie den Mantel aus dem Zimmer geholt hatte, genauso wie das hübsche wollene Tüchlein, das ihren Hals vor dem Wind schützen sollte. Sogar hinter einen der Vorhänge war sie geschlüpft, als Thomas, der Hausdiener, die Eingangshalle betreten hatte. Doch sie war nicht schnell genug gewesen. Ertappt hatte er sie, auf Strümpfen, die Schühchen in den Händen, in den Mantel gehüllt, das Tüchlein um den Hals. Thomas war ein lieber Hausdiener. Er hatte ihr zugezwinkert und verständnisvoll gelächelt. Trotzdem hatte er sie – mit einer Ausrede – zu Dorothea zurückgebracht. Nein, ein Verräter war er nicht, der Thomas. Stets gelassen, ruhig, verschwiegen. Er hatte den Mantel an den Haken im Garderobenzimmer gehängt, die Schühchen in den feinen Schrank gestellt und hatte sie liebevoll auf den Arm genommen. Sie liebte es, von dem stattlichen Mann mit dem silbergrauen Haar getragen zu werden und die vertrauten Gerüche von Pfeifentabak und Vanille einzuatmen. Seit sie denken konnte, hob er sie auf seine Arme, obwohl sie inzwischen eigentlich zu groß dafür war. Jedenfalls behauptete das Dorothea. Ein sechsjähriges Mädchen konnte selbst laufen, es schickte sich nicht, vom Personal durch die Gegend getragen zu werden. Doch Thomas scherte sich nicht um das Gerede des Kindermädchens. Für ihn war Magdalene seine kleine Zuckermaus, der er schleunigst das Binden der Schuhe beigebracht hatte, was sie inzwischen perfekt beherrschte.
Vor dem Eingangsportal des Hauses hielt eine Kutsche. Magdalene beobachtete, wie der Kutscher vom Bock herabsprang, einen Regenschirm öffnete und die Kutschentür öffnete. Luise von Spiegel eilte hastig zum Eingangsportal des Stadtpalais, wo sie von Thomas in Empfang genommen wurde. In der letzten Zeit kam die blonde Frau mit den hohen Wangenknochen und der winzigen spitzen Nase immer öfter zu ihnen, was Magdalene missfiel, denn sie raubte ihr die knapp bemessene Zeit mit dem geliebten Vater. Er war viel unterwegs, reiste nach Gießen, Frankfurt, manchmal sogar in das ferne Berlin. Oder er hatte Verpflichtungen, wie Dorothea oftmals erklärte. Dann hielt er sich im Schloss Wolfsgarten oder Kranichstein auf, wo zur Jagd gerufen wurde. Im letzten Sommer hatte sie das Schauspiel beobachten dürfen. An der Hand ihrer Mutter hatte sie auf der Terrasse von Schloss Wolfsgarten gestanden und dem lauten Klang der Jagdhörner und dem Gebell der Hunde gelauscht. Die Lautstärke hatte sie genauso erschreckt wie die vielen Menschen, Pferde und der entschlossene Blick des Vaters. Hier im Stadtpalais, dem Landgraf-Johann-Haus, das dem Landgrafen aufgrund der stockenden Bauarbeiten am Schloss als Wohnsitz diente, war er anders. Sein Blick war milde, seine Stimme ruhiger. Oftmals hielt er sich stundenlang in seinem Musikzimmer auf und entsann neue Musikstücke, manchmal auch mit seinem Kapellmeister Christoph Graupner, den sie sehr mochte, denn er hatte stets Pfefferminzbonbons in seiner Tasche, die er bereitwillig mit ihr teilte. Die Musik war es wohl, die Magdalene am meisten mit ihrem Vater verband. Er bemühte sich, seiner Tochter das Spiel auf dem Spinett beizubringen, und liebte es, wenn sie zu seinen selbst komponierten Stücken durch den Raum tanzte. In diesen Momenten schien es, als wären sie eine Einheit. Weit fort von allen höfischen Zwängen, Zeremonien und Regeln, stahlen sie sich wenige Stunden der Zweisamkeit, die für Magdalene jedes Mal die größten Augenblicke des Glücks darstellten.
»Magdalene, Kind, was stehst du nur die ganze Zeit am zugigen Fenster.« Dorotheas Stimme riss Magdalene aus ihren Gedanken.
»Luise von Spiegel ist eingetroffen«, sagte Magdalene, ohne auf die Ermahnung des Kindermädchens einzugehen. Sie schlüpfte hinter dem Brokatvorhang hervor und nahm erfreut Dorotheas säuerliche Miene zur Kenntnis. Niemand im Haus konnte die hochnäsige Ziege, wie Luise von Spiegel hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, leiden.
»Auch das noch«, seufzte Dorothea und ließ ihre Stickarbeit sinken. »Als ob der Herr heute nicht schon genug Sorgen hätte.«
Magdalene zuckte zusammen. Die Sorgen, von denen Dorothea sprach, betrafen ihre Mutter, die bereits seit drei Tagen oben in der Kammer lag. Einige Male war Magdalene die Treppe hinauf- und den langen Gang entlanggeschlichen und vor der geschlossenen Tür stehen geblieben. Die Sehnsucht nach einer Umarmung der geliebten Mama hatte sie immer wieder dorthin getrieben. Doch jedes Mal wurde sie durch das laute Stöhnen, einmal sogar durch durchdringende Schreie, wieder vertrieben. Weinend war sie in ihr Zimmer geflohen, wo Dorothea sie getröstet hatte. Ihr Geschwisterchen würde auf die Welt kommen. Das Schreien und Stöhnen wäre normal, es ginge vorüber. Bald schon würde sich die Tür zum Zimmer der Mutter öffnen, und sie dürfte den neuen Erdenbürger bewundern, vielleicht ein Brüderchen, das wäre doch fein. Doch bis heute war die Tür geschlossen geblieben, und die Mienen der Erwachsenen waren immer ernster geworden. Nach dem Arzt war gerufen worden, und eine ältere Frau, eine Hebamme, wie Dorothea erklärt hatte, lief immer mal wieder schweigend durchs Treppenhaus.
»Sorgen?«, fragte Magdalene vorsichtig. »Ist es wegen der Mama? Die Zimmertür, sie öffnet sich einfach nicht.«
Dorothea atmete tief durch und nickte. »Ich habe gehört, dass es nicht gut um deine Mutter steht. Sie ist wohl sehr schwach und müde.«
Schwach und müde wiederholte Magdalene in Gedanken Dorotheas Worte. Das war die geliebte Mutter bereits seit Wochen. Bleich lag sie in ihrem Bett oder auf einer Chaiselongue am Feuer, oftmals ein Buch in der Hand. Einmal war sie beim gemeinsamen Kartenspiel eingeschlafen. Noch im Frühjahr hatten sie alle gemeinsam im Herrengarten gepicknickt und Fangen gespielt. Sogar der Vater war anwesend gewesen. So hübsch hatte ihre Mutter damals in dem gelben Seidenkleid und mit ihrem hochgesteckten kastanienbraunen Haar ausgesehen. Wie es Mode war, hatte sie sich das Gesicht weiß gepudert, doch die frische Luft hatte ihre Wangen gerötet, und einige wenige Sommersprossen hatten sich auf ihre Nase gestohlen. Doch am meisten liebte Magdalene das Strahlen ihrer grünen Augen und ihr fröhliches Lachen. Du bist wie ich, hatte die Mutter oft zu ihr gesagt, ein kleines Charlotte-Abbild.
»Wir müssen für sie beten«, sprach Dorothea weiter.
»Als ob das was helfen würde«, erwiderte Magdalene und biss sich auf die Lippe.
»Wie redest du denn, Kind«, gab Dorothea entrüstet zurück.
»Na, beim letzten Mal hat es doch auch nichts geholfen«, verteidigte sich Magdalene und verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. »Mein Fohlen ist, trotzdem ich gebetet habe, gestorben. Und ich hab dem lieben Gott erklärt, wie sehr ich das Fohlen gernhab und dass ich gut darauf aufpassen würde.«
»Manchmal ist er eben zu beschäftigt, um zuzuhören«, erwiderte Dorothea, die es nicht fertigbrachte, gegen Magdalenes kindlich naive Worte mit Ermahnungen vorzugehen.
»Vielleicht sollten wir ihm erklären, dass wir gar kein Brüderchen haben wollen«, schlug Magdalene vor. »Dann ist doch alles wieder gut, oder?«
»Wenn das so einfach wäre«, erwiderte Dorothea seufzend.
»Oder ich gehe hinauf, umarme sie und gebe ihr genau hierhin« – sie deutete auf ihre rechte Wange – »einen dicken Kuss. Dann geht es ihr bestimmt bald besser.«
»Ach, Kind«, antwortete Dorothea traurig, »ich denke nicht, dass das gut ist. Und du weißt doch, mein Fuß. Erst gestern bin ich auf der Treppe gestolpert.« Sie deutete auf eine Gehhilfe an der Wand.
»Dann geh ich eben allein.« Magdalene lief, ohne eine weitere Antwort von Dorothea abzuwarten, zur Tür, öffnete sie, eilte den Flur hinunter und bog schwungvoll um die nächste Ecke. Mit einem Aufschrei rannte sie in Mathis, den kleinen Mohrenjungen, hinein, der ein Tablett mit einer hübschen Porzellantasse trug, die auf den Boden fiel, dank des weichen Teppichs aber nicht zerbrach.
»So pass doch auf«, rief Mathis erschrocken. Magdalene hastete, eine Entschuldigung nuschelnd, an ihm vorüber und die Treppe hinauf. Auf dem obersten Absatz blieb sie außer Atem stehen und blickte zurück. Dorothea war ihr, wie vorauszusehen war, nicht gefolgt. Nur Mathis stand wenige Stufen von ihr entfernt und schaute sie mit seinen schwarzen Augen schweigend an. Er wusste, was sie nach oben trieb, so, wie er immer alles wusste. Mathis war drei Jahre älter als sie und gehörte zum Hauspersonal. Seine Hauptaufgabe bestand darin, den feinen Damen heiße Schokolade zu servieren, aber auch andere Tätigkeiten fielen ihm zu. Er polierte das Silbergeschirr und kümmerte sich gemeinsam mit dem Kammerdiener Josef um das Ausbessern und Instandhalten der Garderobe des Hausherrn und der anderen männlichen Bediensteten. Bald schon würde er für die Arbeit als Schokoladenjunge zu groß werden. Dann sollte er wie sein Vorgänger, Justus, in der Verwaltung des Residenzschlosses als Schreiber untergebracht werden, weswegen er gemeinsam mit Magdalene Unterricht erhielt. Die Tradition, die Schokoladenjungen zu unterrichten, war aus der Zeit der ehemaligen Landgräfin erhalten geblieben. Der ersten Gemahlin Ernst-Ludwigs war sehr daran gelegen gewesen, die »lieben schwarzen Mohren« zu fördern, wie sie sich ausgedrückt hatte. Sie sollten einen guten Platz am Darmstädter Hof erhalten und ein Auskommen haben.
Zu Beginn hatte Magdalene Mathis natürlich ausgefragt. Warum er eine so schwarze Haut hätte? Von wo er käme? Vielleicht aus dem Schwarzwald, was naheliegend schien. Doch es war das ferne Afrika gewesen, von dem er erzählte. Mit einem Schiff übers Meer war er gekommen, ganz allein und ohne seine Familie. Das stellte sich Magdalene schrecklich vor. Sofort hatte sie beschlossen, Mathis’ Freundin zu werden, vielleicht auch ein bisschen Familie, obwohl das natürlich schwierig war, denn er war schwarz, und sie war weiß. Aber was galt schon das bisschen Hautfarbe, wenn man sich gut verstand und einander gernhatte. Und sie hatte Mathis gern, sogar so gern, dass er nachts in ihr Zimmer schleichen durfte, um gemeinsam mit ihr im Bett zu kuscheln. Dann erzählten sie sich Geschichten, kicherten oder schwiegen miteinander.
Sie erwiderte für einen kurzen Moment seinen Blick. Dann ging sie langsam weiter. Bedächtig setzte sie einen Schritt vor den anderen. Der Flur war lang. Bilder hingen an den mit Stuck verzierten Wänden. Gemälde ihrer Vorfahren, die sie anzustarren, sie mit ihren Augen zu verfolgen schienen. Meistens nahm sie ihre Blicke kaum wahr. Sie waren leblose Zeugen der Vergangenheit, festgehalten in Öl, in immer gleichen Posen. Doch heute erschienen sie ihr lebendig zu sein, und ihre ernsten Mienen verunsicherten Magdalene und ließen sie immer langsamer werden, je näher sie dem Zimmer der Mutter kam. Als sie es erreichte, stellte sie zu ihrem Erstaunen fest, dass die Tür nur angelehnt war. Sie blieb stehen und lauschte. Es drang kein Stöhnen nach draußen, niemand schrie. Vielleicht war das ein gutes Zeichen. Am Ende war ihr Brüderchen jetzt da, und alles wurde wieder gut. Zaghaft trat sie näher an die Tür heran und linste in den Raum. Ihre Mutter lag im Bett, so viel konnte sie erkennen. Daneben stand eine Frau, die sagte:
»Nicht lebensfähig ist es gewesen, dein winziges Balg. Das Kind einer wertlosen, austauschbaren Mätresse.«
Magdalenes Hände begannen zu zittern. Luise von Spiegels schrille Stimme hätte sie unter Hunderttausenden erkannt. Doch was wollte diese Frau von ihrer Mutter, und was meinte sie mit winziges Balg? Sollte ihr Brüderchen doch schon zur Welt gekommen sein? Aber warum hatte niemand etwas gesagt, keiner nach ihr gerufen? Sie ahnte Schreckliches.
»Schon seit langer Zeit hat er sich von dir abgewandt. Wieso sollte er auch nicht? Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst, eine von Krankheit und Siechtum gezeichnete Frau. Niemals wird er dich heiraten, wie du hoffst.«
Magdalene schob die Tür ein Stück weiter auf. Sie hielt den Atem an. Wieso antwortete die Mutter nicht auf die Frechheiten dieser Frau? Sie musste sich doch verteidigen. Sehr wohl liebte der Vater ihre Mutter. Wie oft hatte er sie besucht, hatte sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt, ihr kleine Geschenke zukommen lassen.
Luise von Spiegel begann, im Raum auf und ab zu gehen.
»Trotzdem finde ich, wir sollten langsam unser Spiel um seine Gunst beenden. Du wirst jetzt endlich begreifen, dass ich gewonnen habe. Sieh mich an: Ich bin so viel jünger und hübscher als du. Ich werde ihm viele Kinder schenken und an seiner Seite die perfekte Landgräfin sein. Eine Landgräfin, die du niemals gewesen bist.« Erneut blieb Luise von Spiegel vor dem Bett stehen. »Wer weiß überhaupt, ob du jemals in die Geschichte eingehen wirst.« Sie zuckte mit den Schultern. »Mätressen versinken in der Vergessenheit. Nur Ehefrauen werden namentlich genannt. Und ich werde alles dafür tun, eine solche zu werden.«
Sie griff nach einem Kissen und beugte sich über das Bett. Magdalene konnte nicht so recht sehen, was jetzt vor sich ging, denn durch den Türspalt konnte sie nur Luises Rücken erkennen. Sie öffnete die Tür ein Stück weiter.
»Mach es gut, meine Liebe. Ich erlöse dich hier und jetzt von deinem Leiden. Es ist besser für uns alle, wenn du stirbst.«
Fest drückte Luise das Kissen auf den Kopf der Mutter. Magdalene stand mit weit aufgerissenen Augen in der Tür, unfähig, sich zu bewegen. Immer fester drückte Luise zu. Da begann Magdalene, laut zu kreischen. Erschrocken richtete Luise sich auf und starrte das Mädchen an, doch ihre Überraschung legte sich schnell.
»Magdalene, Kind, wie kommst du denn hierher?« Ihre Stimme klang plötzlich schmeichelnd, nichts von der eben gehörten Gehässigkeit war geblieben.
»Du hast sie getötet«, stammelte Magdalene. Sie deutete auf Luise, der alle Farbe aus dem Gesicht wich. Luise machte einen Schritt auf Magdalene zu und streckte die Hand nach ihr aus. »Was redest du da für einen Unsinn, Kind. Ich wollte nur nach ihr sehen, mehr nicht.«
Magdalene wich zurück. Sie wiederholte ihre Worte. »Du hast sie getötet.« Der Schock saß tief. Ihre geliebte Mutter lag blass und reglos in den Kissen. Magdalene schüttelte den Kopf und begann, Schritt für Schritt rückwärts zu gehen. Luise folgte ihr auf den Flur hinaus, wollte nach ihr greifen, doch Magdalene entzog sich ihr. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie die Frau an. Erneut griff Luise, die allmählich die Geduld verlor, nach ihr.
»Jetzt komm schon her, du dummes Ding. Ich erkläre es dir. Ich wollte nur ihr Bestes. Das wirst du doch verstehen?« Ihre Stimme klang gepresst. Magdalene machte einen weiteren Schritt nach hinten. Luise folgte ihr. Magdalene spürte ihren schneller werdenden Herzschlag, ihre Hände zitterten. Sie musste hier weg, zurück zu Dorothea, zum Vater, zu Thomas auf den Arm. In ihr Bett, zu Mathis, der sie wärmen würde. Sie drehte sich um und rannte den Flur entlang und die vielen Treppen hinunter, dann klapperten ihre Pantinen auf dem Marmorboden der Eingangshalle.
Luise folgte ihr. »Magdalene, Kind, so bleib doch stehen. Es ist nichts. Ich will es dir erklären. So hör doch zu.« Suchend blickte sich Magdalene nach Thomas um. Normalerweise hielt sich der Hausdiener hier irgendwo auf. Doch jetzt war er nicht zu sehen, aber Luise stand unweit von ihr entfernt am Treppenaufgang und atmete schwer.
»Gute Güte, Kind. Was scheuchst du mich durch die langen Gänge. So lass mich doch endlich erklären.«
Genau in diesem Moment trat Mathis aus einem Nebenraum. Verwundert schaute er von Luise zu Magdalene.
Die adlige Dame warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Verschwinde, du elender Mohr.« Ihre Stimme klang giftig.
»Sie hat Mama umgebracht«, rief Magdalene und deutete auf Luise. Mathis riss die Augen auf. Im oberen Geschoss wurde es plötzlich unruhig. Laute Stimmen waren zu hören. Eine Frau begann zu kreischen. Die Tote schien entdeckt worden zu sein.
Luise wurde nervös. »Was für ein Unsinn. Ich habe nur mit ihr geredet, nicht mehr. Deine arme Mutter, Gott hab sie selig. Das hat sie nicht verdient.« Sie bekreuzigte sich.
»Lügnerin«, schrie Magdalene. »Das Kissen hast du auf ihren Kopf gelegt, damit sie keine Luft mehr bekommt. Ganz genau hab ich es gesehen. Du willst ihr meinen Vater wegnehmen, willst ihn mir wegnehmen. Aber das werde ich niemals zulassen. Mein Vater gehört mir!«
Magdalene verschränkte die Arme vor der Brust.
Luise verlor endgültig die Geduld.
»Und wenn es so ist? Was geht es dich, Balg einer Mätresse, an. Er gehört dir, dass ich nicht lache. Einem kleinen wertlosen Mädchen.«
Mathis keuchte auf. Luise machte einen Schritt auf Magdalene zu. Mathis stellte sich schützend vor sie und sagte: »Ihr rührt sie nicht an, oder ich werde …«
»Was wirst du, kleiner wertloser Mohr, der du bist«, erwiderte Luise und schubste ihn grob zur Seite. Mathis stürzte und schlug hart mit den Knien auf dem Marmorboden auf. Magdalene wich bis zur Eingangstür zurück.
Mathis rappelte sich wieder auf und rief: »Lauf, Magdalene. Verschwinde!«
Magdalene reagierte blitzschnell. Sie drückte die Klinke nach unten und öffnete die Tür. Als sie nach draußen eilte, glaubte sie, Thomas’ Stimme zu hören. Doch nichts hielt sie jetzt noch zurück. Sie rannte durch das Schneetreiben, vorbei an Kutschen und Karren über den weitläufigen Marktplatz, auf dem nur noch wenige Menschen unterwegs waren. Sie wusste nicht, wohin, kannte sich nicht aus. Sie rannte an der Stadtkirche vorbei und in eine der schmalen Gassen, zu einem der Stadttore. Kurz bevor sie das Bessunger Tor erreichte, blieb sie unsicher stehen und blickte zurück. Sollte sie überhaupt aus der Stadt hinauslaufen? Der schneidend kalte Wind ließ sie erzittern. Sie schlug die Arme um den Körper. Da tauchte eine Gestalt auf, die heftig winkte. Luise von Spiegel. Sie verfolgte sie noch immer. Magdalene hastete weiter auf das Stadttor zu, Tränen der Verzweiflung in den Augen. Wäre sie doch nur bei Dorothea in der Kammer geblieben. Einmal nur hätte sie auf die Kinderfrau hören sollen, dann wäre jetzt alles gut. Aber wäre es das wirklich? Am Tod ihrer Mutter und dem Triumph dieser bösen Frau hätte auch ihre Folgsamkeit nichts geändert. Weinend eilte sie am Torwächter vorüber, der ihr verdutzt nachblickte. Noch immer glaubte sie, Luises Stimme zu hören. Schneller musste sie laufen, nur fort von dieser schrecklichen Person. Das eben Gesehene vergessen, niemals wieder daran denken müssen. Sie rannte querfeldein. Ihre feinen Stoffschuhe waren bereits durchnässt, und ihre Füße fühlten sich wie Eisklumpen an. Ein Stück weiter blieb sie, nach Atem ringend, stehen und blickte sich panisch um. In einem nahen Kiefernwäldchen standen einige Zelte, eine Rauchwolke stieg in den Himmel, und Stimmen waren zu hören. Ihr Blick wanderte zur Straße zurück, wo sie im Schneetreiben eine Gestalt wahrzunehmen glaubte. War ihr diese Frau bis hierher gefolgt, oder war es jemand anders? Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und das Blut rauschte ihr in den Ohren. Der Wind trieb ihr Schneeflocken in die Augen, riss an ihrer Haube, zerzauste ihr Haar. Die Gestalt am Wegesrand schien näher zu kommen. Hastig eilte Magdalene zu dem kleinen Kiefernwäldchen und duckte sich in den Windschatten eines der Zelte. Mit fest geschlossenen Augen, zitternd und frierend, saß sie dort und begann, gegen Angst und Kälte eines der Lieder zu singen, die sie oft mit dem Vater gespielt hatte. Die Schneeflocken wirbelten auf sie herab und deckten sie zu, hüllten sie in ihr weiches, kaltes Kleid und ließen sie mehr und mehr erstarren. Ganz langsam wurde ihr Stimmchen immer leiser.
Kurz bevor Magdalene endgültig verstummte, tauchte eine beleibte Gestalt vor ihr auf, leuchtete ihr mit einer Laterne ins Gesicht und sagte: »Du hast recht, Majpejlomas. Hier draußen ist tatsächlich jemand. Ein kleines Mädchen, stell dir vor.«
1
Suni saß unter einem Apfelbaum und pflückte Margeriten, die sich die hinter einem Gutshof gelegene Streuobstwiese mit Glockenblumen, Löwenzahn und rotem Klee teilten. Die Bäume um sie herum schienen alle einen eigenen Charakter zu haben. Einer war windschief, ein anderer knorrig, und wieder einer sah so aus, als hätte er ein Gesicht inmitten seiner Zweige und würde sie angrinsen, doch Augen, Mund und Nase waren nur dicke Knorpel auf seinem Stamm. Die Apfelbäume trugen in diesem Jahr schwer an ihrer Last. Der Bauer würde eine reiche Ernte haben. Im Moment jedoch war mit den Äpfeln nicht viel anzufangen, denn sie waren noch nicht reif und ziemlich sauer, wie Cikni vorhin festgestellt hatte, als sie einen von ihnen vom Baum geholt und hineingebissen hatte. Das Gesicht hatte sie verzogen und das Stück Apfel sofort wieder ausgespuckt. Suni pflückte eine Glockenblume, legte sie zu den anderen Blumen in ihren Korb und blickte sich nach Cikni um. Das Mädchen hockte vor dem Eingangstor zum Gutshof und war von drei kleinen Katzen umringt, eines der winzigen Fellknäuel hatte es auf dem Arm. Lächelnd erhob sich Suni, ging zu ihr hinüber und hob ein besonders vorwitzig maunzendes Kätzchen hoch.
»Die sind aber niedlich«, sagte sie und sank neben Cikni in die Hocke.
»Ich denke, sie sind nicht viel älter als drei oder vier Wochen«, mutmaßte Cikni.
Sunis Kätzchen, ein grau-weiß geflecktes Häufchen Fell, begann mit ihr zu spielen und schlug mit seinen winzigen Pfoten nach ihren Fingern. »Hast schon richtig ordentliche Krallen«, sagte Suni belustigt, als ihr der Kleine einen winzigen Kratzer am Handgelenk verpasste.
»Am liebsten würde ich eine von ihnen mitnehmen«, sagte Cikni. Auf ihrem Arm saß ein nicht ganz so forsches Kätzchen. Geduldig ließ sich das grau getigerte Tier streicheln und schnurrte sogar ein wenig, während eines seiner Geschwister sich anschickte, in Sunis Blumenkorb zu klettern.
Suni hielt die kleine Katze zurück. »Nein, mein Kleines, das ist nichts für dich. Die hübschen Blumen werden noch gebraucht.«
»Was, zum Teufel, ist denn hier los?«, ertönte plötzlich eine ruppig klingende Stimme. Suni und Cikni zuckten erschrocken zusammen und blickten auf. Eine korpulente Frau stand vor ihnen und funkelte sie wütend an. »Elende Zigeuner und Diebesgesindel. Ihr wollt wohl unsere Äpfel stehlen. Hannes!«, rief sie laut. »Hannes, so komm doch. Diebe, Zigeuner!«
Ruckartig erhoben sich Suni und Cikni. Die Katzen rutschten zu Boden.
»Wir wollten nicht …«, versuchte Cikni die Frau, anscheinend die Bäuerin, zu beruhigen. Doch diese wollte ihr nicht zuhören. Erneut rief sie nach Hannes, vermutlich einem Knecht. »Hannes, so komm endlich. Zu Hilfe, Zigeuner!«
Cikni warf Suni einen kurzen Blick zu. Es hatte keinen Sinn. Suni griff nach ihrem Korb. Die Stimme der Frau überschlug sich. Eilig rannten Suni und Cikni über die Streuobstwiese davon. Erst als der Gutshof außer Sichtweite war, blieben sie auf einem kleinen Feldweg, nach Atem ringend, stehen. »Lieber Herrgott, was hat sich dieses Weib aufgeführt. Wir haben doch nur mit den Kätzchen gespielt«, sagte Cikni.
»Du weißt doch, wie die meisten Leute über uns Roma denken«, erwiderte Suni. »Die gute Frau hat wahrscheinlich gedacht, wir würden ihr mitsamt den Äpfeln sämtliche Hühner stehlen.«
»Pah, Hühner« – Cikni winkte ab –, »aber eines der Kätzchen hätte mir schon gefallen.«
»Mir auch«, erwiderte Suni und blickte über ein weites Kornfeld hinweg Richtung Gutshof. Azurblau war heute das Blau des Himmels, keine Wolke war zu sehen. Am Wegesrand plätscherte ein kleiner Bach. Vogelgezwitscher erfüllte die Luft. Was ist das heute für ein schöner Sommertag, dachte Suni versonnen. Gerade richtig für Ciknis Hochzeit, die in wenigen Stunden stattfinden sollte, was auch der Grund dafür war, dass sie losgezogen waren, um Blumen zu pflücken. Nur die schönsten Blüten sollten es für Ciknis Brautkranz werden, den sie heute Abend bei der Hochzeitszeremonie tragen würde. Bei einer Zeremonie, vor der sich Cikni fürchtete, obwohl sie Kalo ganz gern mochte, wie sie Suni gestern Abend gestanden hatte. Cikni ging in die Hocke, pflückte eine Kornblume am Wegesrand ab und legte sie zu der bunten Blütensammlung in Sunis Korb. Margeriten, Hahnenfuß, Korn- und Mohnblumen sammelten sich dort neben Kamillenblüten und rotem Klee. Suni musterte Cikni nachdenklich von der Seite. Wie eine glückliche Braut kam ihr das zierliche Mädchen nicht vor. Cikni war ein Spitzname und bedeutete die Kleine. Ciknis anderen Roma-Namen kannte Suni nicht. Seit sie denken konnte, wurde das Mädchen mit dem Spitznamen angesprochen. Cikni war sehr klein und wirkte noch sehr kindlich. Nur ein winziger Brustansatz unter ihrer Bluse ließ erkennen, dass sie langsam zur Frau heranreifte. Auch ihr Verhalten, Denken und Handeln war noch sehr kindlich. Verspielt war sie und anhänglich wie ein Kätzchen. Cikni hatte früh ihre Mutter verloren und war von Sunis Ziehmutter Rosina aufgenommen worden. Mit der Zeit waren sie wie Schwestern geworden. Sie teilten sich ein Lager, ihre Sorgen und Ängste, weinten, lachten und spielten miteinander. Die bevorstehende Hochzeit würde dies alles für immer verändern. Nach dem Fest würde Cikni in Kalos Zelt und auf sein Lager umziehen, wovor sie sich zu fürchten schien. Kalo war einer der wenigen Roma im heiratsfähigen Alter, die ihrer Gruppe angehörten. Er war etwa im selben Alter wie Suni, und Cikni war ihm bereits bei ihrer Geburt versprochen worden. Heute Nachmittag würden aus Freunden, die einander wie Geschwister liebten, Eheleute werden.
Suni ging neben Cikni in die Hocke und strich ihr liebevoll eine Haarsträhne hinters Ohr.
»Das wird schon werden. Kalo ist ein guter Junge. Niemals würde er etwas Ungehöriges tun.«
»Das denkst du«, gab Cikni zurück und stand abrupt auf. Suni glaubte, eine Träne in ihrem Augenwinkel zu erkennen.
Sie erhob sich ebenfalls und fragte: »Was meinst du damit? Hat er …« Sie wagte nicht, es auszusprechen.
Cikni nickte zaghaft.
»Das darf doch nicht wahr sein.« Wütend ballte Suni die Fäuste. »Ich erschlag ihn, diesen elenden Lump. Wie kann er es wagen, dich vor der Hochzeit überhaupt nur anzufassen. Na, dem werde ich helfen.« Sie wollte loslaufen, zurück ins nicht weit entfernte Lager, doch Cikni hielt sie am Arm zurück.
»Es ist nicht, was du denkst.«
Suni hielt in der Bewegung inne. »Nicht?«
»Ich meine, ich wollte es ja auch. Neulich Abend habe ich ihn am Bach getroffen, und es war so anders. Früher, da konnten wir einfach miteinander reden, herumtoben oder schwimmen gehen. Jetzt ist alles verändert. Wir haben uns lange gegenübergestanden, und keiner hat so recht gewusst, was er sagen soll. Irgendwann hat er zu lachen angefangen, und ich habe mitgelacht. Es war, als wollten wir all die Verlegenheit und das Unbekannte mit unserer Fröhlichkeit betäuben. Nach einer Weile hat er meine Hände ergriffen und mich näher an sich herangezogen, und ich habe in seine schwarzen Augen geblickt. In meinem Bauch hat es wie verrückt zu kribbeln begonnen. So etwas habe ich nie zuvor im Leben gespürt. Ganz langsam hat er sich zu mir vorgebeugt, und wir haben uns geküsst, so richtig, wie es die Großen tun. Da dachte ich, ich müsste innerlich zerspringen. Ganz fest haben mich seine Arme umschlungen, und plötzlich war er nicht mehr Kalo, sondern ein Fremder. Ich werde heute Nachmittag einen Fremden heiraten, den ich zu kennen glaubte. Ist es das, was wir unter Erwachsenwerden verstehen? Kennen wir einander überhaupt noch, wenn wir unsere Kindheit aufgeben und verlieren?«
»Ach, Cikni.« Suni entspannte sich wieder. Sie wollte etwas antworten, doch jemand anders kam ihr zuvor.
»Deine Kindheit wirst du nie verlieren. Sie wird für immer in deinem Herzen bleiben.«
Rosina war unbemerkt näher getreten. Die alte Romni lächelte milde und strich Cikni über den Kopf. »Ich kann deine Ängste verstehen. Jedem Mädchen geht es an seinem Hochzeitstag so oder so ähnlich. Es ist ein Neubeginn, die Veränderung der bisherigen Welt. Es wäre schlimm, wenn du dich nicht ein wenig davor fürchten würdest. Aber du freust dich doch auch auf die Zukunft, oder?« Sie fing Ciknis Blick auf.
»Schon«, gestand das Mädchen.
Rosina legte lächelnd den Arm um ihren Schützling und drückte sie fest an sich. »Und das Kribbeln wird mit jedem Kuss und jeder Berührung schöner. Das verspreche ich dir.« Sie zwinkerte Suni zu. »Obwohl Kalo eine Tracht Prügel verdient hätte, dieser Schwerenöter. Vor dem heutigen Tag hat er dich nicht anzurühren. Das weiß er genau.« Ihr Blick fiel auf den Blumenkorb. »Wie viele wunderbare Blüten ihr gesammelt habt. Wir werden den schönsten Brautkranz daraus flechten, den die Welt je gesehen hat, das verspreche ich dir.« Sie strich über Ciknis Haar und musterte ihr Gesicht. »Bezaubernd wirst du aussehen, die schönste Braut weit und breit.«
»Und ich werde später für dich tanzen«, fügte Suni lächelnd hinzu. »Den großartigsten Tanz, den du jemals gesehen hast.«
»Das wollen wir doch hoffen, mein kleiner Pusomori«, erwiderte Rosina und hob den Blumenkorb hoch. »Ohne Musik und Tanz wäre es ja kein richtiges Hochzeitsfest.« Sie zwinkerte Suni lächelnd zu, die eine Grimasse zog. Rosina wusste ganz genau, dass Suni ihren Spitznamen Pusomori nicht leiden konnte. Sie war kein kleiner Floh, auch wenn diese Bezeichnung darauf abzielte, ihre Geschmeidigkeit und ihren wunderbaren Tanz hervorzuheben, wie ihr Rosina schon mehrfach versichert hatte. Doch Sunis Meinung nach hatten Flöhe nichts mit Geschmeidigkeit oder Tanz zu tun. Sie waren nur lästige, juckende Gesellen und hatten weiß Gott nichts in einem Kosewort zu suchen, auch wenn es noch so lieb gemeint war.
Sie schlugen den Rückweg ein. Die Zigeuner hatten ihr Lager in einem von Ginsterbüschen und anderem Gestrüpp geschützten Kiefernwäldchen aufgebaut, was bei dieser Hitze ratsam war. Schon seit Tagen brannte die Sonne unerbittlich vom Himmel, und die Luft heizte sich immer weiter auf. Die Zigeunergruppe war eher klein. Sie zählte insgesamt etwa fünfzehn Frauen und Männer und einige Kinder unterschiedlichen Alters. Dazu kamen Rosina und der Älteste, den alle nur mit Baro Rom ansprachen. Er allein traf sämtliche Entscheidungen, wie er jedenfalls glaubte, denn hinter seinem Rücken hatte längst Rosina das Sagen.
Der alte Mann stand bei ihrer Rückkehr ins Lager mit dem Gehstock wedelnd auf dem freien Platz in der Mitte der Zelte, wo in wenigen Stunden die Trauung stattfinden sollte, und schimpfte lautstark. »Himmel. Hab ich nicht gesagt, dass der Altar dort drüben aufgebaut werden soll! Ihr seid wirklich zu gar nichts zu gebrauchen, ihr schändlichen Bälger.«
Rosina ließ die Mädchen stehen und ging kopfschüttelnd zu Baro Rom hinüber, der nur mit einer weinroten Pluderhose bekleidet und barfuß war.
»Jetzt lass die jungen Leute doch in Ruhe alles vorbereiten, mein lieber Freund. Es ist ja nicht die erste Hochzeit, die wir abhalten.«
Der alte Mann ließ den Spazierstock sinken. Missbilligend schaute er Rosina an. In seinem Aufzug ähnelte er ein wenig einer der Vogelscheuchen, die so mancher Bauer auf seine Felder stellte. Klapperdürr war er, jede seiner Rippen war zu sehen, und sein Kinn war spitz. Auf dem Kopf trug er einen aus braunem Filz gefertigten Schlapphut, und sein weißes Haar fiel bis auf seine Schultern herab.
»Aber es wird eine der ersten Hochzeiten seit langem sein, zu der wir Besuch bekommen werden. Gerade ist ein Bote eingetroffen.« Er wies zu einem der Zelte hinüber, vor dem ein junger Bursche, einen Becher in der Hand, saß. »Mein lieber Freund Berko hat sich angekündigt. Ich habe ihm schon vor längerer Zeit von der bevorstehenden Hochzeit berichtet. Du wirst dich gewiss daran erinnern, meine Liebe. Es war im letzten Januar gewesen, als wir uns in der Nähe von Cöln über den Weg gelaufen sind.«
»Im Januar, in Cöln. Da haben wir doch noch gar nicht gewusst, dass wir um diese Zeit in dieser gottverdammten Gegend sein werden, aus der wir, wenn du mich fragst, so schnell wie möglich verschwinden sollten. Der Landgraf, du weißt …« Rosina senkte ihre Stimme. Ihr Blick wanderte zu Suni.
»Der schon seit Monaten in Gießen weilt, was die Gegend sicherer macht«, antwortete Baro Rom in dem Versuch, Rosina zu beruhigen. »Und wegen Suni würde ich mir keine Gedanken machen. Ihre Heimat ist unser Lager. Sie ist durch und durch eine Romni geworden, und wenn du mich fragst, solltest du endlich deine Vorurteile ablegen und sie verheiraten. Merki scheint sich inzwischen von Samiras Tod erholt zu haben, und sein Sohn braucht eine Mutter.«
»Mit Merki!«, rief Rosina. »Die beiden konnten sich noch nie leiden, und das weißt du auch.«
»Dann werden sie sich aneinander gewöhnen. Wie du weißt, ist die Auswahl in unserer kleinen Gruppe begrenzt, und eine Hochzeit außerhalb der Gruppe wirst du, wie ich dich kenne, noch weniger befürworten.«
»Alles, nur nicht Merki. Ich kenne Suni. Niemals wird sie ihn heiraten.«
»Was Suni will, ist Nebensache. Sie ist im Sommer sechzehn geworden, ein altes Mädchen. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird keiner sie mehr haben wollen, und ich werde sie nicht die ganze Zeit durchfüttern.«
»Das musst du auch nicht«, gab Rosina schnippisch zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
Er lachte laut auf, trat näher an seine alte Freundin heran und tätschelte ihr die Wange.
»Und wer füttert dich seit Jusos Tod durch?«
»Das ist ja wohl etwas anderes«, verteidigte sich Rosina. »Juso war dein Vorgänger. Und wie du weißt, hat er sich wie ein Held geopfert. Hätte er damals die Reitergruppe nicht aufgehalten, weiß der Himmel, ob wir heute noch am Leben wären.«
»Was nichts daran ändert, dass ich dich jetzt versorge«, konterte Baro mit einem süffisanten Lächeln.
»Grins nicht so dumm«, schimpfte Rosina, der die Argumente ausgingen. Die leidige Heiratsdiskussion führten sie nicht zum ersten Mal, und sie wusste, dass er recht hatte. Doch sie wollte Suni nicht ziehen lassen. Es würde ihr das Herz brechen, das Mädchen zu verlieren. Das Schicksal hatte ihr keine Kinder geschenkt, was sie in jahrelange Verzweiflung stürzte und zu dem ein oder anderen Scharlatan trieb. Nach Jusos Tod hatte sie sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen und niemanden mehr an sich herangelassen. Bis zu dem Tag, als Suni kam, ihr kleiner Pusomori, der so wunderbar tanzen konnte. Niemals im Leben würde sie den kalten Wintertag vergessen, an dem sie das Mädchen hinter ihrem Zelt gefunden hatte. Ein kleines, von Angst erfülltes Kind, halb erfroren und bitterlich weinend. Sie hatte es liebevoll in den Arm genommen und die ganze Nacht festgehalten, bis es aufgehört hatte zu zittern. Es dauerte eine Weile, ehe die Kleine Zutrauen gefasst hatte, doch inzwischen waren sie zu einer Einheit verwachsen wie Mutter und Tochter, könnte man meinen, wäre nicht der äußerliche Unterschied. Rosina war eine typische Romni: schwarzes Haar, dunkle Haut und Augen. Sunis Haar war kastanienbraun und wellig. Es fiel bis auf ihre Taille herab und schimmerte im Sonnenlicht. Ihre Augen waren grün, unergründlich und wunderschön. Auch ihre Haut war gebräunt, doch niemals würde sie die Farbe der Roma annehmen. Sie war eine Gadži, eine von den anderen, die bei ihnen nichts zu suchen hatte und doch dazugehörte. Manchmal, wenn Rosina Suni tanzen sah, glaubte sie, der Herrgott hätte sie einfach der falschen Familie zugeteilt. In Sunis Herz schlug eine Roma-Seele, davon war sie felsenfest überzeugt. Ihr Leben bei dem Volk der Roma war ihr Schicksal, und vor dem konnte niemand fortlaufen, daran glaubte Rosina fest.
Baro Rom schaute zu einem der Zelte hinüber. »Wenn ich mir den Blick des jungen Boten so anschaue, dann sehe ich keine Probleme, sie nicht verheiratet zu bekommen.«
Rosina drehte sich um.
Suni stand vor einem der Zelte und unterhielt sich lachend mit dem jungen Boten des anderen Stammes. Regelrecht vertraut wirkten die beiden, obwohl sie sich erst seit wenigen Minuten kannten.
»Dann lieber Merki, oder was meinst du«, raunte Baro Rom Rosina ins Ohr, während er an ihr vorüberging. »So bliebe sie wenigstens in deiner Nähe.«
Rosina wusste nicht, was sie erwidern sollte. Wie zur Salzsäule erstarrt stand sie vor dem inzwischen fertig aufgebauten Holzaltar und beobachtete Suni und den fremden Burschen dabei, wie sie miteinander lachten und tändelten. Wie hatte sie auch nur einen Augenblick daran denken können, dass sie den Lauf der Zeit aufhalten könnte. Suni war inzwischen voll entwickelt, eine hübsche und begehrenswerte Frau und fürs Heiraten schon beinahe zu alt. In diesem Punkt musste sie Baro Rom recht geben.
»Wohin bist du nur verschwunden, mein kleiner Pusomori«, murmelte sie gedankenverloren und wischte sich eine Träne aus den Augen. »Es war doch erst gestern gewesen, als du zum ersten Mal zu der Melodie von Mandolinos Geige um mich herumgetanzt bist.«
»Was ist denn jetzt?« Ciknis Stimme riss Rosina aus ihren Gedanken. Erschrocken blickte Rosina das schmale Mädchen an, das ihr, wie sie sich mal wieder eingestehen musste, bei weitem nicht so sehr am Herzen lag wie Suni. Cikni war wehleidig und oftmals zickig. Auch war sie nicht so hübsch wie Suni. Aber ließen sich die beiden grundverschiedenen Mädchen überhaupt miteinander vergleichen? Womöglich tat sie Cikni unrecht. Cikni hatte früh ihre Eltern verloren, worunter sie noch heute litt. Sie sollte nachsichtiger mit dem oftmals verstockten Mädchen sein, das nicht so recht wachsen wollte. Immerhin war sie, Rosina, die einzige Mutter, die ihr geblieben war.
»Natürlich«, stammelte sie, »ich komme. Es wird ja auch langsam Zeit.« Sie legte den Arm um Cikni und lief mit ihr zu ihrem Lagerplatz, den sie neben einem großen Ginsterbusch im Schatten einer hohen Kiefer aufgeschlagen hatten. »Und stell dir vor«, verriet sie die eben erfahrenen Neuigkeiten, »es wird ein großes Fest werden, denn in den nächsten Stunden wird Berko mit seinem Stamm unweit von uns sein Lager aufschlagen.«
»Ach, das weiß ich doch längst.« Cikni deutete auf den jungen Boten. Suni hatte sich inzwischen neben den Burschen ins Gras gesetzt, was Rosina missbilligend registrierte.
»Er heißt Sorlo und ist sehr nett. Ich glaube, sie mögen einander«, sagte Cikni.
»Und wenn schon«, erwiderte die Rosina. »Er ist keiner von uns. Sie kann und wird ihn nicht heiraten.«
»Warum nicht«, widersprach Cikni mutig. »Ich habe euer Gespräch vorhin mit angehört. Baro Rom hat recht, und das weißt du.«
»Lauschen auch noch.« Entrüstet stemmte Rosina die Hände in die Hüften. »Was Baro Rom und ich besprechen, geht dich nichts an. Hörst du! Und jetzt sieh zu, dass du hinüberläufst und Suni herholst. Sie wollte den Blumenkranz flechten, also soll sie gefälligst damit beginnen, sonst werden wir nicht mehr rechtzeitig fertig.« Sie wedelte mit den Armen.
Eilig raffte Cikni die Röcke und lief über die Wiese. Nachdenklich schaute Rosina ihr nach. Vielleicht war das die letzte Anweisung gewesen, die sie dem Mädchen gegeben hatte. Nach der Trauung würde ein anderer für sie verantwortlich sein. Sie hätte wehmütig, vielleicht sogar traurig sein müssen. Doch sie war es nicht. Stattdessen war es Erleichterung, die sie fühlte. Ein Stück Verantwortung wurde ihr abgenommen, was guttat. Auch freute sie sich insgeheim darauf, nur mit Suni in ihrem Zelt zu schlafen. Vielleicht würde dann die alte Vertrautheit zurückkehren, die sie in den ersten Jahren verbunden hatte. Das war es wohl gewesen, was sie an Ciknis Auftauchen am meisten gestört hatte. Das Mädchen hatte ihre kleine, liebgewonnene Ordnung zerstört. Eine Ordnung, die sich gut und richtig angefühlt hatte. Oder durfte eine Mutter, auch wenn sie nur eine Ziehmutter war, überhaupt so denken? Durfte sie ein Kind mehr lieben als das andere? Die beiden Mädchen kamen zurück, Arm in Arm und verschwörerisch kichernd. Ihr Anblick brachte Rosina zum Lächeln. Wie Schwestern gingen die beiden miteinander um. Vielleicht sollte sie nicht so viel grübeln und mit sich selbst nachsichtiger sein. Es konnte nicht immer alles gelingen, doch vieles war gut geworden. Den Mädchen ging es gut, Cikni würde heute heiraten, und Suni – wer wusste das schon. Irgendwann würde sie Abschied nehmen müssen, auch wenn es schwer war. Ihr Blick fiel auf einen winzigen Spiegel, der an ihrer Zeltwand hing. Sie schaute in müde, von tiefen Falten umgebene Augen. Immer mehr graue Strähnen durchzogen ihr Haar, und ihr Rücken war krumm geworden. Die schöne und stolze Zigeunerin von einst sah ihr schon längst nicht mehr aus dem Spiegel entgegen. Nach und nach hatte sie sich am Ende ihres Lebens in eine alte Frau verwandelt. Eines Lebens, das nicht immer leicht gewesen war, in dem sie viele Rückschläge hinnehmen musste. Wie viel Hass, Missgunst und Gewalt konnte ein Mensch ertragen? Von immerwährender Angst getrieben zogen sie durch die Lande, nirgendwo willkommen und trotzdem auf ihre Art glücklich. Plötzlich kam ihr die alte Roma-Sage mit der roten Feder in den Sinn, und ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Wie oft hatte sie die Geschichte den Mädchen erzählt, und vielleicht sollte sie es jetzt noch einmal tun.
Cikni und Suni waren im Inneren des Zeltes verschwunden. Rosina folgte den beiden und gesellte sich zu ihnen auf das aus bunten Kissen und Decken bestehende Lager, und während die Mädchen die Blüten sortierten, begann sie zu erzählen:
»Könnt ihr euch noch an die alte Sage erinnern, die ich euch früher zum Einschlafen erzählt habe? Ich dachte, ich meine …« Sie kam kurz ins Stocken und spürte, wie ihr Herzschlag schneller wurde. »Also ich dachte«, wiederholte sie, »heute wäre ein guter Tag, um sie noch einmal zu erzählen. Ein letztes Mal für Cikni, die sie vielleicht bald ihren eigenen Kindern erzählen wird.« Sie griff nach der Hand des Mädchens und drückte sie fest. Cikni nickte lächelnd.
»Diese alte Sage berichtet davon, dass wir früher Vögel gewesen sind. Eines Tages flogen wir über einen goldenen Palast und landeten, um ihn zu betrachten. Die Bewohner des Palastes waren Truthähne, Enten und Hühner, die von unserer Schönheit sofort geblendet waren. Sie begannen, uns mit Süßigkeiten, Gold und Edelsteinen zu überschütten, und baten uns inständig, zu bleiben. Bald trugen wir unendlich viele Goldketten um den Hals. Nur einer von uns widerstand und wollte uns zum Weiterflug bewegen. Leider hörten wir nicht auf ihn. Da erhob sich der Unglückliche in die Lüfte und stürzte sich in seiner Not auf die Steine herab. Wir erwachten aus unserem Wahn, doch wir vermochten die Erde nicht mehr zu verlassen, war der Goldschmuck doch zu schwer. Die Enten und Hühner besangen ihren Sieg. Aber dann flog eine kleine rote Feder in den Palast, und der gesamte Schmuck fiel von uns ab, unsere Flügel wollten uns jedoch nicht mehr gehorchen. Der Wind trieb die Feder aus dem Palast hinaus, und sie irrte fortan über die staubigen Straßen. Wir folgten ihr, verloren nach und nach unser Federkleid und wurden zu Menschen. Aber tief in unserer Seele sind wir Vögel geblieben, die das Fliegen verlernt haben. In der Hoffnung, es eines Tages wieder zu erlernen, folgen wir noch immer der kleinen roten Feder über den ganzen Erdball und singen unsere Lieder.«
»Und tanzen dazu«, ergänzte Suni ergriffen.
»Und keine kann das so wunderschön wie du, geliebte Schwester«, sagte Cikni, griff nach Sunis Hand und drückte sie fest.
Rosina legte, Tränen in den Augen, ihre Hand darauf. »Das Schicksal hat uns drei auf seltsamen Wegen zusammengeführt. Es mag nicht immer alles gut gewesen sein, doch wir waren eine Einheit, und ihr seid meine Mädchen, für immer, gleichgültig, wohin euch eure Wege führen werden. Das dürft ihr niemals vergessen.«
Das Schicksal, wiederholte Suni in Gedanken, während sie nickte. Ein Schicksal, an das sie sich nur noch bruchstückhaft erinnern konnte. Einst hatte sie in einem feinen Stadthaus gelebt. War da nicht ein hübsch eingerichtetes Zimmer gewesen, helles Kerzenlicht und der Klang eines Jagdhorns? Sie durfte über ihr altes Leben nicht sprechen. Rosina hatte nichts davon hören wollen. Doch Erinnerungen ließen sich nicht wegsperren, ließen sich nicht verbieten. Sie verweilten tief in ihrem Herzen, auch wenn sie nach und nach verblassten. Eine Melodie war geblieben, wunderbar und zärtlich. Immer wieder summte Suni diese vor sich hin, in unbeobachteten Momenten tanzte sie sogar dazu, ganz für sich allein. Dann war sie wieder in dem hübschen Zimmer mit den bläulich schimmernden Wänden, dem Stuck an der Decke und dem warmen Kerzenlicht. Auf poliertem Parkett drehte sie sich im Kreis, wirbelte durch den Raum, streckte ihre Hände über den Kopf. Genau so wie die auf dem Kaminsims stehende weiße Tänzerin aus Porzellan hatte sie sein wollen. Anmutig, grazil und bezaubernd. Rosinas Geschichte war hübsch, doch sie galt nicht für sie. Sie war keine Zigeunerin, kein Mensch gewordener Vogel, der das Fliegen lernen wollte. Doch was war sie wirklich? Eine Verlorene, eine Getriebene, eine Heimatlose. Die weiße Tänzerin aus Porzellan und das Kerzenlicht waren geblieben, doch was damals geschehen war, schien unwiederbringlich verloren zu sein. Wer war ihr Vater, wo ihre wahre Mutter. An manchen Tagen, wenn sie weiterzogen, fühlte sie sich unendlich müde und erschöpft. Es gab kein Ankommen, kein Ziel ihrer Reise. Es ging durch Wälder und über Wiesen, vorbei an Dörfern und Städten, in denen sie nicht willkommen waren. Sie waren Zigeuner, das verhasste fahrende Volk, die böse Rotte, zu der sie aber nicht gehörte. Oder doch? Vielleicht war dieses Leben ihr Schicksal, wie Rosina oft sagte. Nichts geschah grundlos. Aber bestimmte man nicht selbst sein Schicksal? Konnte man das überhaupt? Manchmal wünschte Suni sich nichts mehr, als endlich anzukommen, um für den Rest ihres Lebens an einem Ort zu verweilen.
Sie wusste, dass sie nicht so denken durfte, doch immer öfter kamen ihr diese Gedanken in den Sinn.
»Da sitzen sie faul in ihrem Zelt herum, derweil gibt es noch so viel zu tun.« Eine herrische Stimme riss Suni aus ihren Grübeleien. Wie ertappt sprangen die drei Frauen auf. Der halbfertige Blumenkranz fiel zu Boden.
Am Eingang stand Kaschkeraka, die Hände in die breiten Hüften gestemmt. Ihr Blick blieb an Rosina hängen.
»Das Mädchen soll in wenigen Stunden heiraten, und nichts ist vorbereitet. Und das ausgerechnet heute, wo wir Besuch bekommen werden. Wo sollen wir so viel Brot, Früchte und Fleisch hernehmen, um alle zu bewirten? Auch der Wein könnte knapp werden. Mano und Janjo haben sich schon aufgemacht, um etwas aufzutreiben. Niemand richtet Tische und Bänke her oder schmückt das Lager mit bunten Bändern. Aber ich kann es schon irgendwie verstehen, bei dieser Hitze. Unerträglich ist es heute mal wieder. Doch Hochzeit bleibt Hochzeit, und es soll doch ein schönes Fest werden, eines, für das wir uns nicht schämen müssen.«
»Es ist gut, Kaschkeraka.« Rosina nutzte eine kurze Atempause der Frau und hob die Hand. Nicht umsonst bedeutete der Name Kaschkeraka so viel wie schwatzhafte Elster. »Wir kommen ja schon. Suni hat bereits damit begonnen, den Blumenkranz für Ciknis Haar zu flechten. Ihr Kleid ist ebenfalls vorbereitet, genauso wie der Brautschmuck. Ganz tatenlos sind wir nicht gewesen.«
Kaschkeraka, die nicht nur schwatzhaft, sondern auch sehr ordentlich war, ließ ihren Blick durchs Zelt schweifen und zog missbilligend die Augenbrauen in die Höhe.
»Ordnung war noch nie eine deiner Stärken, Rosina.« Der Vorwurf verfehlte seine Wirkung nicht. Rosinas Miene verfinsterte sich. Die beiden Frauen konnten einander noch nie leiden. Kaschkeraka hatte in den Stamm eingeheiratet, nachdem allgemein darüber abgestimmt worden war. Niglo hatte sich unsterblich in die hübsche Romni verliebt, als die beiden Stämme an einem warmen Frühlingstag in der Nähe von Hamburg aufeinandergetroffen waren. Er hatte die Ehe durchgesetzt, indem er Kaschkeraka ihre Ehre raubte, woraufhin sie von ihrer Familie verstoßen worden war. Der perfide Plan der beiden war aufgegangen. Baro Rom hatte es nicht fertiggebracht, das Mädchen seinem Schicksal zu überlassen, und so waren Kaschkeraka und Niglo im Eilverfahren getraut worden. Kaschkeraka wusste, dass Rosina anders gehandelt hätte, denn sie hatte eines Nachts eine Unterredung zwischen Rosina und Baro Rom belauscht. Besonders das Wort Berechnung hatte sie gekränkt. Wie konnte diese verhärmte Frau es wagen, sie derart zu beleidigen. Sie liebte Niglo. Er war für sie bestimmt. Das hatte sie vom ersten Augenblick an gespürt. Jeden Tag dankte sie dem Herrgott dafür, dass die meisten Mitglieder ihrer neuen Familie ihrer Aufnahme zugestimmt hatten, genauso wie Baro Rom. Kurz nach der Eheschließung kündigte sich bereits das erste Kind an. Inzwischen hatte sie fünf Kinder geboren, von denen noch zwei am Leben waren. Eines hatte nur wenige Stunden gelebt, das zweite war im Winter gestorben und das dritte in einen Teich gefallen und ertrunken.
»Heute ist eben ein aufregender Tag«, erwiderte Rosina mit spitzer Zunge. »Da kann es schon mal etwas unordentlicher sein.«
»Und eigentlich trage ich die Schuld daran«, sagte Suni und kam ihr damit zu Hilfe. »Und ich auch«, meldete sich jetzt Cikni ebenfalls zu Wort. »Wir mussten noch das Kleid fertigstellen und haben alle Stoffe auf dem Boden ausgebreitet.«
»Leider sind wir noch nicht zum Aufräumen gekommen.« Sunis Stimme klang schmeichelnd. Kaschkeraka warf ihr einen finsteren Blick zu. Eigentlich mochte sie Suni, denn sie war wie sie selbst kein festes Mitglied der Gruppe, was ihr gefiel. Mochte Rosina noch so sehr an dem Mädchen hängen und glauben, sie könnte eine Romni aus ihr machen, so wusste sie es besser. Einmal eine Gadži, immer eine. Sunis Welt war nicht die der Roma, auch wenn Rosina sich mit aller Macht an das Mädchen klammerte und die ersten Anzeichen der Veränderung nicht wahrhaben wollte.
»Wir könnten die restlichen Blumen auf den Tischen verteilen. Das würde festlich aussehen.«
»Und dazwischen Glasperlen streuen«, schlug Rosina vor und zwang sich zu einem Lächeln. »Und ich kenne einen Pflaumenbaum, dessen Zweige bis zum Boden hängen, so schwer hat er an seiner Last zu tragen«, sagte Cikni. »Ich könnte mit Papin und Kaza losziehen und Pflaumen holen.«
»Mit Papin, dem kleinen Dummkopf«, schimpfte Kaschkeraka mal wieder über ihren eigenen Sohn. »Äpfel ernten und den Kübel tragen wird er schon können«, verteidigte Cikni den stämmigen Burschen, der geistig etwas zurückgeblieben war und deshalb mit dem Spitznamen Papin, was so viel wie Dummkopf bedeutete, leben musste.
Rosina überwand sich, ging auf Kaschkeraka zu und legte den Arm um sie.
»Das ist doch eine gute Idee. Dann gehen wir beide jetzt nach draußen und schauen nach dem Rechten.« Sie reckte die Nase in die Luft. »Riechst du das? Ich glaube, die Männer haben das Wildschwein über das Feuer gehängt.«
Kaschkeraka ließ sich von Rosina mit nach draußen ziehen. »Dann fehlen also nur noch der Eintopf und das Brot«, hörte Suni sie sagen. Kopfschüttelnd wandte sie sich an Cikni. »Da konnten wir den Streit ja gerade noch abwenden.«
»Dem Herrgott im Himmel sei Dank«, stimmte das zierliche Mädchen zu. »An meinem Hochzeitstag soll es bitte friedlich bleiben.«
»Dann lass uns schnell den Kranz fertigflechten, und danach holen wir die Pflaumen. Ich weiß genau, welchen Baum du meinst. Er ist sehr gut geeignet, denn er steht auf einem freien Feld. Ich denke, er gehört niemandem. Wenn wir zurückkommen, helfe ich dir beim Einkleiden und stecke dir die Haare hoch.« Sie griff in Ciknis dichtes schwarzes Haar und schob es nach oben. »Du wirst sehen, es wird ein ganz wunderbarer Abend werden, und deine Schönheit wird allen den Atem rauben.«
2
Suni hob den Arm und bewegte ein letztes Mal ihre Hand im Takt der Musik. Ihr Atem ging schwer, ihre Brust hob und senkte sich. Sie zeigte jedoch ihre Glücksgefühle nicht. Stolz hielt sie den Kopf hoch, ihre Miene war ernst. Eine besondere Aura sollte sie umgeben, eine Ausstrahlung, die sie geheimnisvoll machte und andere auf Abstand hielt. Kühl wollte sie wirken, elegant und erhaben. Respekt war es, was sie den anderen abverlangte. Ihr Tanz war etwas Besonderes, ein Geschenk für ihre Zuschauer, aber auch für sie selbst. Sie schloss die Augen und lauschte den Klängen von Mandolinos Geige, die zu Beginn des Tanzes sehnsuchtsvoll und verzaubernd und nur wenige Sekunden später temperamentvoll und mitreißend waren. In den letzten Augenblicken des Tanzes schien die Leidenschaft der Melodie in unendlicher Traurigkeit zu versinken, die sie alle für einen Moment verstummen ließ und daran erinnerte, wie groß an so manchem Tag der Kummer ihres freiheitsliebenden Volkes war. Sie waren Getriebene, Reisende, die niemals zur Ruhe kamen. Manchmal dachte Suni, dass es die rote Feder wirklich geben musste, die sie alle immer weiter vorwärtstrieb, auf der Suche nach … ja, wonach eigentlich? Nach Geborgenheit? Nach Heimat? Wie sollte ein Volk verstehen, was Heimat bedeutete, wenn es gar nicht wusste, was das war. Woher kamen sie wirklich? Aus dem fernen Indien oder Ägypten. Wieso wurden sie überall verurteilt, vertrieben und gehasst? War es das Unbekannte, das Fremde, das die Menschen fürchteten?
Suni ließ ganz langsam ihren Arm sinken, tauchte mit dem letzten Ton der Geige aus der sanften Umarmung der Musik auf und blickte den Umstehenden in die Augen. Sie waren bewegt, berührt und hielten einen Moment ergriffen inne, um wenige Sekunden später überschwenglichen Applaus zu spenden. Cikni kam auf sie zugelaufen und umarmte sie. Suni drückte das kleine Mädchen fest an sich und hob es hoch. Cikni war die Braut, wunderhübsch anzusehen mit ihrem Blumenkranz im hochgesteckten Haar und den wenigen Locken, die auf ihre Schultern fielen. All die Zweifel, die sie heute Nachmittag umgetrieben hatten, schienen verschwunden zu sein. Ihr Lächeln wirkte befreit, und ihre Augen leuchteten. Gemeinsam begannen sie, erneut zu tanzen. Sie hielten sich an den Händen und hüpften zu der fröhlichen Melodie, die Mandolino angestimmt hatte, über den Platz. Andere Paare taten es ihnen gleich, und bald wirbelte beinahe die komplette Festgesellschaft um das große Lagerfeuer, das Funken in den sternenklaren Nachthimmel schickte. Außer Atem überließ Suni irgendwann Kalo seine Braut, holte sich einen Becher Wein und setzte sich neben den alten Majpejlomas, der mal wieder eine seiner Geschichten zum Besten gab.
»Vor vielen Jahren, ich kann nicht sagen, wie lange es her ist, kam eine Gruppe unserer Leute in die Gegend von Allerheiligen, auch eine wunderschöne Romni war dabei. Sie blieben eine Weile und erwiesen der dortigen Klosterschule gute Dienste. In dieser Klosterschule weilte zu jener Zeit ein schöner Herr, ein feiner Ritter, von einer nicht weit entfernten Burg. Es wunderte die Roma sehr, dass er sie alsbald jeden Tag im Lager besuchte. Keiner ahnte, dass er sich vom ersten Moment an, da er sie gesehen hatte, in die hübsche Romni verliebt hatte. Und welch ein Unglück – sie erwiderte seine Liebe. Ihr kennt unsere Gesetze. Unsere Mädchen dürfen nur einen der unsrigen heiraten und lassen sich nicht auf ehrlose Dinge mit fremden Leuten ein. Ich betone das noch einmal, sonst wäre sie ihr ganzes Leben lang baletschido, keine ehrbare Romni mehr, nicht wahr.« Er blickte kurz in die Runde, erntete zustimmendes Nicken und erzählte weiter: »Die junge Romni war brav und gehorsam. Sie schenkte ihm ihr Herz, doch ihren unberührten Leib wollte sie ihm erst nach der Hochzeit geben. Der junge Ritter war ein ehrbarer Mann. Er versprach ihr die Ehe und überreichte ihr als Zeichen seiner Treue einen kostbaren Ring, den sie bis zum Tag ihrer Eheschließung auf ihrem Herzen tragen sollte. Einer der frommen Brüder des Klosters sollte das Paar heimlich trauen, denn der Ritter befürchtete, dass seine Eltern gegen die Verbindung mit einer Zigeunerin sein würden. Erst nach der Hochzeit würde er sich ihnen erklären. Das Mädchen war überglücklich und erzählte ihrer geliebten Großmutter, die sie aufgezogen hatte, von dem Eheversprechen. Lange blickte die alte Frau auf den Ring und sagte dann: ›Trage das Zeichen eurer Liebe immer an deinem Herzen, niemals vor eurer Hochzeit am Finger, denn sonst erlischt das Licht deines Lebens für immer.‹ Die Worte der Großmutter jagten dem Mädchen Angst ein, also trug sie den Ring Tag und Nacht an einer Kette um den Hals und hütete ihn wie ihren Augapfel. Am Morgen ihrer Trauung vergaß das Mädchen vor lauter Glück die Warnung ihrer Großmutter. Sie nahm den Ring, steckte ihn an den Finger, zog ihn wieder ab und betrachtete ihn von allen Seiten. Sie war so in ihrem Glück versunken, dass sie nicht die Raben wahrnahm, die oberhalb des Platzes im Felsen ihr Nest gebaut hatten. Schwarze Raben, deren Geschrei den Roma stets Unglück gebracht hatte. Einer der Raben flog plötzlich ganz nahe an ihr vorüber, und vor Schreck ließ das Mädchen den Ring fallen. Der Rabe schnappte sich das Schmuckstück und trug es den steilen Felsen hinauf in sein Nest. Das Mädchen fing bitterlich zu weinen an. Genau in diesem Moment kam ihr Geliebter zu ihr. Da fielen ihr die Worte ihrer Großmutter wieder ein, und sie weinte herzzerreißend um den verlorenen Ring. Er versprach ihr, den Ring wiederzuholen, und kletterte den Felsen hinauf. Doch kurz bevor er sein Ziel erreichte, verließen ihn seine Kräfte. Er rutschte auf einem Felsvorsprung ab, ein Ast, an dem er sich festklammern wollte, brach, und er stürzte in die Tiefe. Die Mönche trugen ihren toten Schüler in das Kloster zurück. Weinend sank die schöne Romni neben ihn zu Boden, und aus ihrem hübschen Hochzeitskleid wurde ein Leichenkleid. Sie ist an gebrochenem Herzen gestorben.«
Um Majpejlomas war es still geworden. Seine sanfte Stimme berührte tief im Innersten all das, was Suni liebte, auch wenn die meisten seiner Geschichten kein gutes Ende nahmen. Umständlich stand der alte Mann auf, verbeugte sich und sagte: »Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Freunde. Ob es das Mädchen wirklich gegeben hat, werden wir niemals erfahren. Doch sollte sie tatsächlich gelebt haben und die Überlieferung der Wahrheit entsprechen, dann ist sie nicht vergessen, und das ist doch schon sehr viel. Oder was meint ihr?« Er nahm seinen Becher, trank ihn in einem Zug leer, geriet leicht ins Schwanken und rief laut den Satz, der ihm seinen Rufnamen eingebracht hatte und so viel wie »Ich wäre beinahe umgefallen« bedeutete. »Ach du je, jetzt wäre ich beinahe Majpejlomas!« Seine Zuhörer lachten laut auf, und auch Suni musste schmunzeln.
»Was für eine traurige Geschichte«, sagte plötzlich jemand neben Suni. Sie wandte sich um und blickte in Sorlos schwarze Augen. »Allerdings kannte ich sie bereits«, fügte er hinzu.
»Ich auch«, erwiderte Suni. »Aber sie ist immer wieder schön anzuhören, besonders, wenn Majpejlomas sie erzählt.«
»Da stimme ich dir zu. Er ist ein guter Geschichtenerzähler.«
»Gut!« Suni klang entrüstet. »Er ist der beste.«
Sorlo zog eine Augenbraue in die Höhe.
»Jedenfalls der beste, den ich kenne«, gestand Suni kleinlaut.
»Geht mir auch so.« Er zwinkerte ihr lächelnd zu. »In eurem Lager scheint es viele Leute zu geben, die in dem, was sie tun, die Besten sind. Mir ist da vorhin eine junge Tänzerin aufgefallen, die unglaublich gut getanzt hat. Grazil, bezaubernd, einzigartig. Vielleicht kannst du mir ihren Namen nennen. Ich würde sie gern näher kennenlernen, wenn das erlaubt ist.«
Suni errötete, und in ihrem Magen begann es zu kribbeln. Ihr gefielen seine Art, sein Lächeln und das gewitzte Spielchen, das er mit ihr spielte. »Dann sollte ich sie vielleicht fragen, ob sie dich kennenlernen möchte«, antwortete sie. »Wen darf ich vorstellen?«
»Wen möchtest du denn vorstellen?«, fragte er.
»Vielleicht einen netten jungen Burschen mit Namen Sorlo, der der Tänzerin ein Kompliment machen möchte.«
»Du findest mich also nett«, konterte er. »Nett finde ich viele Dinge. Mehr bin ich in deinen Augen nicht wert?«
»Doch, ich meine, vielleicht«, erwiderte Suni unsicher.
Er lächelte. »Ein wenig oder vielleicht. So viel mehr, dass sie es wagen würde, mit mir ein Stück spazieren zu gehen?«