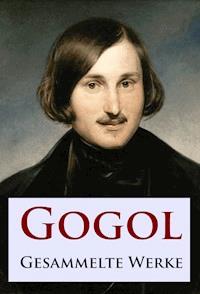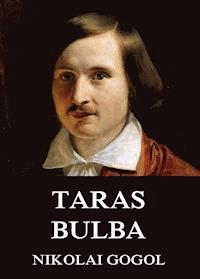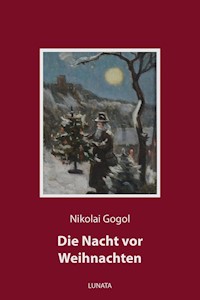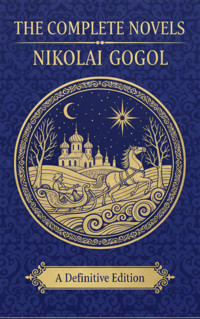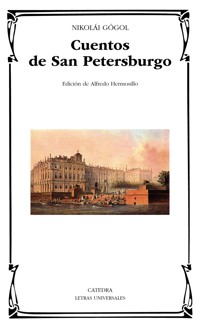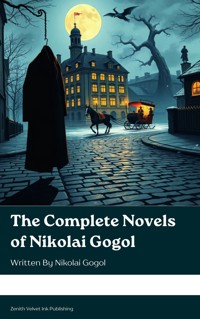Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Das Porträt erweist sich das Bildnis eines Wucherers, das der arme, begabte Maler Tschartkow im Trödelladen erwirbt, als verhängnisvoll. So wie der Wucherer alle, denen er Geld lieh, mit seinem bösen Geist erfüllte, werden auch die Besitzer seines Porträts ihres Lebens nicht mehr froh. Gogol ist in dieser Erzählung noch der hoffmannesken Schauerromantik ergeben. – In den beiden anderen Novellen des Bandes – Die Nase und Der Mantel – geht es grotesker und noch unheimlicher zu. Am Morgen des 25. März findet der Barbier Jakowlewitsch die Nase seines Kunden Kowaljow in seinem Frühstücksbrot. Im Glauben, sie Kowaljow im Rausch abgeschnitten zu haben, eilt der Barbier aus dem Haus und wirft sie in die Neva. Er wird dabei von einem Polizisten beobachtet, der ihn festnimmt und einem Verhör unterzieht. Kowaljow unterdessen stellt bei der Morgentoilette erschrocken fest, dass dort, wo seine Nase sitzen müsste, sich eine glatte Stelle befindet … Der Ministerialbeamte Akakijewitsch spart auf einen dringend benötigten neuen Wintermantel, den er sich einiges kosten lässt. An dem triumphalen Tag, da er das ersehnte Stück vom Schneider erhält, wird er vom Bürovorsteher sogar zu einem Festessen eingeladen. In der Nacht auf dem Rückweg überfallen ihn Diebe und entreißen ihm den Mantel. Der Verlust richtet ihn nach und nach seelisch und physisch zugrunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nikolai Gogol
Das Porträt
Drei Petersburger Novellen
Aus dem Russischen übersetzt von Alexander Eliasberg
Steidl Nocturnes
Herausgegeben von Andreas Nohl
Die Übersetzung wurde für diese Ausgabe überarbeitet.
Inhalt
Die Nase
I
II
III
Das Porträt
I
II
Der Mantel
Nachwort
Anmerkungen
Die Nase
I
Am 25. März geschah in Petersburg etwas überaus Seltsames. Der Barbier Iwan Jakowlewitsch, der auf dem Wosnessenskij-Prospekt wohnte (sein Familienname ist in Vergessenheit geraten und selbst auf seinem Ladenschild, das einen Herrn mit einer eingeseiften Wange und der Inschrift: »Wir lassen auch zur Ader« darstellt, nicht erwähnt), der Barbier Iwan Jakowlewitsch erwachte ziemlich früh am Morgen und roch den Duft von warmem Brot. Er setzte sich im Bett auf und sah, wie seine Gattin, eine durchaus ehrenwerte Dame, die sehr gerne Kaffee trank, frischgebackene Brote aus dem Ofen nahm.
»Heute möchte ich keinen Kaffee, Praskowja Ossipowna«, sagte Iwan Jakowlewitsch, »stattdessen möchte ich warmes Brot mit Zwiebeln.« (Das heißt, Iwan Jakowlewitsch wollte wohl das eine und das andere, er wusste aber, dass es unmöglich war, beides auf einmal zu verlangen, denn Praskowja Ossipowna mochte solche Launen nicht.) – Soll nur der Dummkopf Brot essen, umso besser für mich – sagte sich die Gattin – so bleibt mehr Kaffee für mich übrig. Und sie warf ein Brot auf den Tisch.
Iwan Jakowlewitsch zog des Anstands halber einen Frack über sein Hemd, setzte sich an den Tisch, nahm etwas Salz, schnitt zwei Zwiebeln zurecht, ergriff das Messer, machte eine wichtige Miene und begann das Brot zu zerteilen. Als er es in zwei Hälften geschnitten hatte, blickte er hinein und sah darin zu seinem Erstaunen etwas Weißliches. Iwan Jakowlewitsch kratzte vorsichtig mit dem Messer und tastete mit dem Finger. – Es ist etwas Festes, – sagte er sich, – was kann es sein?
Er bohrte mit den Fingern nach und zog – eine Nase heraus! … Iwan Jakowlewitsch ließ die Hände sinken; er fing an, sich die Augen zu reiben und das Ding zu betasten: eine Nase, tatsächlich eine Nase! Sie kam ihm sogar bekannt vor. Iwan Jakowlewitschs Gesicht zeigte Entsetzen. Dieses Entsetzen war aber nichts im Vergleich zu der Empörung, die sich seiner Gattin bemächtigte.
»Wo hast du diese Nase abgeschnitten, du Unmensch?«, schrie sie ihn wütend an. »Verbrecher! Trunkenbold! Ich selbst werde dich bei der Polizei anzeigen. Du Räuber! Drei Herren haben mir schon gesagt, dass du beim Rasieren so heftig an den Nasen ziehst, dass sie fast abreißen.«
Iwan Jakowlewitsch war aber mehr tot als lebendig: er erkannte, dass die Nase dem Kollegien-Assessor gehörte, den er jeden Mittwoch und Sonntag zu rasieren pflegte.
»Halt, Praskowja Ossipowa! Ich will sie in einen Lappen einwickeln und in die Ecke legen: dort wird sie eine Zeitlang liegen, und dann bringe ich sie weg.«
»Ich will davon nichts wissen! Niemals werde ich dulden, dass in meiner Wohnung eine abgeschnittene Nase herumliegt! … Du angebrannter Zwieback, du! Du kannst nur mit dem Messer auf dem Streichriemen herumfahren, wirst aber bald deine Pflichten nicht mehr erfüllen können, du Taugenichts, du Strauchdieb! Soll ich mich vielleicht deinetwegen vor der Polizei verantworten? … Du Schmierfink, du Dummkopf! Hinaus mir ihr, hinaus! Bring sie, wohin du willst. Dass ich von ihr nichts mehr höre!«
Iwan Jakowlewitsch stand wie zerschmettert da. Er überlegte und überlegte und wusste nicht, was er sich denken sollte. »Weiß der Teufel, wie das nur möglich ist«, sagte er endlich und kratzte sich hinter dem Ohr: »Ob ich gestern betrunken heimgekommen bin oder nicht, weiß ich nicht mehr. Es scheint doch eine außergewöhnliche Sache zu sein, denn das Brot ist etwas Gebackenes, die Nase aber etwas ganz anderes. Ich verstehe das Ganze nicht!« Iwan Jakowlewitsch verstummte. Der Gedanke, dass die Polizei bei ihm die Nase entdecken und ihn zur Verantwortung ziehen könnte, bedrückte ihn über alle Maßen. Ihm schwebte schon ein roter, schön mit Silber gestickter Kragen und ein Degen vor … und er zitterte am ganzen Leib. Endlich griff er nach seinen Unterkleidern und seinen Stiefeln, zog sich an, wickelte die Nase, unter strengsten Ermahnungen Praskowja Ossipownas, in einen Lappen und ging hinaus auf die Straße.
Er wollte sie entweder irgendwo liegen lassen, vielleicht irgendwo in der Gosse unter einem Hoftor, oder sie wie aus Versehen verlieren und dann in einer Seitengasse verschwinden. Aber unglücklicherweise begegnete er immerzu Bekannten, die ihn wie üblich aushorchten: »Wohin gehst du?«, oder: »Wen willst du so früh rasieren?« – und so fand Iwan Jakowlewitsch keine geeignete Gelegenheit. Einmal war er die Nase schon losgeworden, aber ein Gendarm winkte ihm von weitem mit der Hellebarde und rief: »Heb das auf, was du da weggeworfen hast!« Iwan Jakowlewitsch musste die Nase aufheben und in die Tasche stecken. Er wurde immer verzweifelter, zumal das Publikum auf der Straße beständig zunahm, je mehr Geschäfte und Läden öffneten.
Er beschloss, zur Isaak-Brücke zu gehen: vielleicht gelang es ihm, die Nase in die Newa zu werfen? … Aber ich fühle mich etwas schuldig, weil ich noch gar nichts über Iwan Jakowlewitsch, diesen in vielen Beziehungen ehrenwerten Mann, gesagt habe.
Iwan Jakowlewitsch war wie jeder ordentliche russische Handwerker ein entsetzlicher Trunkenbold und, obwohl er jeden Tag die Bärte fremder Männer rasierte, selbst stets unrasiert. Der Frack Iwan Jakowlewitschs (Iwan Jakowlewitsch trug niemals einen gewöhnlichen Rock) war scheckig, das heißt schwarz, doch voller gelblichbrauner und grauer Flecken; der Kragen glänzte, und statt drei Knöpfen waren nur Fädchen zu sehen. Iwan Jakowlewitsch war ein großer Zyniker, und wenn der Kollegienassessor Kowaljow ihm beim Rasieren sagte: »Deine Hände stinken immer, Iwan Jakowlewitsch!«, so antwortete Iwan Jakowlewitsch mit der Frage: »Warum sollten sie denn stinken?« – »Ich weiß es nicht, mein Bester, aber sie stinken«, entgegnete der Kollegienassessor, worauf Iwan Jakowlewitsch eine Prise nahm und ihm die Wangen und die Stellen unter der Nase, hinter den Ohren und unter dem Kinn einseifte – kurzum alles, was ihm gerade einfiel.
Dieser ehrenwerte Bürger stand schon auf der Isaak-Brücke. Er blickte sich um, beugte sich über das Geländer, als ob er sehen wollte, ob viele Fische dort unten schwammen, und warf das Läppchen mit der Nase verstohlen ins Wasser. Es war, als fiele eine riesige Last von seiner Seele. Iwan Jakowlewitsch musste lächeln. Statt sich nun auf den Weg zu machen, um seine Beamten zu rasieren, wollte er zunächst in einem Wirtshaus einkehren, dessen Schild »Speisen und Tee« versprach, und sich ein Glas Punsch bestellen. Aber da sah er plötzlich am Ende der Brücke den Revierinspektor, einen Mann von vornehmem Aussehen, mit breitem Backenbart, Dreispitz und Degen. Iwan Jakowlewitsch erstarrte, aber der Revierinspektor winkte ihm mit dem Finger und sagte: »Komm mal her, mein Freund.«
Iwan Jakowlewitsch wusste, was sich gehört, nahm seine Mütze ab, ging eilfertig zu ihm und sagte: »Guten Tag, Euer Wohlgeboren!«
»Nein, nein, Brüderchen, nichts von Wohlgeboren, sag mir lieber, was du da auf der Brücke gemacht hast.«
»Bei Gott, Herr, ich war unterwegs, zum Kundenrasieren, und hab nur geguckt, wie schnell die Newa fließt.«
»Du lügst, das ist eine Lüge – so kommst du mir nicht davon. Antworte wahr!«
»Ich will Euer Gnaden zweimal, ja sogar dreimal umsonst in der Woche rasieren«, erwiderte Iwan Jakowlewitsch.
»Nein, Freundchen, das sind Dummheiten! Ich werde schon von drei Barbieren rasiert, die es sich zur Ehre anrechnen. Sag mir lieber, was du da eben getan hast.«
Iwan Jakowlewitsch erbleichte … Hier hüllen sich die Geschehnisse in einen Nebel, und es ist schlechterdings unbekannt, was weiter geschah.
II
Der Kollegienassessor Kowaljow erwachte ziemlich früh und machte mit seinen Lippen »Brrr …«, wie er es stets tat, ohne den Grund dafür angeben zu können. Kowaljow streckte sich und ließ sich den kleinen Spiegel geben, der auf dem Tisch stand. Er wollte sich den Pickel ansehen, der am Abend vorher auf seiner Nase erblüht war; zu seinem größten Erstaunen sah er aber an der Stelle der Nase eine vollkommen glatte Fläche! Kowaljow erschrak, ließ sich Wasser geben und rieb sich die Augen mit dem Handtuch: die Nase war wirklich weg! Er fing an, die Stelle mit der Hand zu befühlen, kniff sich auch ins Fleisch, um festzustellen, ob er nicht schliefe: aber nein, er schlief nicht. Der Kollegienassessor Kowaljow sprang aus dem Bett und schüttelte sich – die Nase war noch immer weg! Er ließ sich sofort seine Kleider bringen und machte sich schnurstracks auf den Weg zum Polizeiobermeister.
Indessen müssen wir aber einiges über Kowaljow sagen, damit der Leser erfährt, welche Art Kollegienassessor er war. Die Kollegienassessoren, die diesen Grad Dank ihren Bildungszeugnissen erlangen, lassen sich keinesfalls mit den Kollegienassessoren vergleichen, die es im Kaukasus geworden sind. Es sind zwei völlig verschiedene Arten. Die gebildeten Kollegienassessoren … Russland ist aber ein so merkwürdiges Land, dass, wenn man etwas über einen Kollegienassessor sagt, sämtliche Kollegienassessoren von Riga bis Kamtschatka es unfehlbar auf sich beziehen. Ebenso ist es auch mit allen anderen Titeln und Rängen. Kowaljow war ein kaukasischer Kollegienassessor. Er bekleidete diesen Rang erst seit zwei Jahren und konnte ihn daher keinen Augenblick vergessen; um sich noch mehr Ansehen und Gewicht zu verleihen, nannte er sich niemals schlicht Kollegienassessor, sondern stets Major. »Hör mal, mein Täubchen«, sagte er etwa, wenn er ein Weib sah, das auf der Straße Vorhemden feilbot, »komm zu mir nach Hause; ich wohne in der Sadowaja-Straße, du brauchst nur nach Major Kowaljow zu fragen – jeder wird dir zeigen, wo es ist.« Begegnete er aber einer jungen Schönen, so gab er ihr außerdem einen geheimen Auftrag und fügte hinzu: »Frag nur nach der Wohnung von Major Kowaljow, mein Kind!« Aus diesem Grund wollen auch wir den Kollegienassessor Major nennen.
Der Major Kowaljow pflegte jeden Tag auf dem Newski-Prospekt spazieren zu gehen. Sein Hemdkragen war immer außerordentlich sauber und sorgfältig gestärkt. Sein Backenbart war von jener Art, wie ihn auch die Gouvernements- und Kreislandvermesser, die Architekten und Regimentsärzte, auch die Beamten für Sonderaufgaben tragen, überhaupt alle Männer, die volle und rote Wangen haben und sehr gut Boston spielen: dieser Backenbart reicht bis zur Mitte der Wange und geht von dort bis zur Nase. Der Major Kowaljow trug an seiner Uhrkette eine Reihe Karneol-Petschaften, in die teils Wappen und teils Inschriften geschnitten waren wie »Mittwoch«, »Donnerstag«, »Montag« und so weiter. Major Kowaljow war wegen Geschäften nach Petersburg gekommen, vor allem um sich eine seinem Rang gemäße Stellung zu suchen: im besten Fall die eines Vizegouverneurs, sonst aber die eines Exekutors in irgendeinem angesehenen Departement. Der Major Kowaljow war auch keineswegs abgeneigt zu heiraten, doch nur, wenn die Braut zweihunderttausend Rubel in die Ehe einbrachte. Nun kann der Leser beurteilen, wie es dem Major zumute war, als er statt seiner recht hübschen und mäßig großen Nase eine überaus alberne, glatte Fläche entdeckte.
Zu allem Unglück ließ sich keine einzige Droschke auf der Straße blicken, und so musste er zu Fuß gehen, in seinen Mantel gehüllt, das Gesicht mit dem Taschentuch verdeckt, als ob er Nasenbluten hätte. – Vielleicht ist es mir nur so vorgekommen: es kann ja nicht sein, dass eine Nase einfach so dumm verschwindet, dachte er und betrat eine Konditorei, um einen Blick in den Spiegel zu werfen. Gottlob war gerade niemand in der Konditorei; die Kellner fegten die Gaststuben und rückten die Stühle an ihren Platz; andere, mit verschlafenen Augen, trugen heiße Piroggen herein; auf den Tischen und Stühlen lagen die kaffeefleckigen Zeitungen von gestern. »Gott sei Dank, es ist keiner da«, sagte er, »jetzt kann ich in den Spiegel schauen.« Er ging ängstlich zum Spiegel und blickte hinein. »Teufel, so ein gemeiner Unfug!«, sagte er und spie aus. »Wenn doch an Stelle der Nase wenigstens etwas anderes wäre, aber so rein nichts, so gar nichts!«
Er biss verdrießlich die Zähne zusammen und trat aus der Konditorei, fest entschlossen, entgegen seiner Gewohnheit niemanden anzusehen und auch niemandem zuzulächeln. Plötzlich blieb er wie angewurzelt vor der Einfahrt eines Hauses stehen; vor seinen Augen geschah etwas Unfassbares: vor der Einfahrt hielt eine Equipage, der Schlag wurde geöffnet, ein Herr in Uniform sprang in gebückter Haltung aus dem Wagen und eilte die Treppe hinauf. Wie groß war das Entsetzen und zugleich das Erstaunen Kowaljows, als er in ihm seine eigene Nase erkannte! Bei diesem ungewöhnlichen Anblick drehte sich ihm alles vor den Augen; er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten; aber er wollte, koste es was es wolle, warten, bis sie wieder in die Equipage stieg; dabei zitterte er am ganzen Körper wie im Fieber. Nach zwei Minuten trat die Nase wieder aus dem Haus. Sie trug eine goldbestickte Uniform mit hohem Stehkragen, Beinkleider aus Wildleder und einen Degen an der Seite. An dem Hut mit dem Federbusch konnte man ersehen, dass sie im Rang eines Staatsrats stand. Alles wies darauf hin, dass sie Besuche machte. Sie sah nach rechts und links, rief zum Kutscher »Fahr vor!«, stieg ein und fuhr davon.
Der arme Kowaljow war wie von Sinnen. Er wusste nicht, was er von einem so seltsamen Geschehen denken sollte. Wie war es denn möglich, dass die Nase, die sich noch gestern in seinem Gesicht befunden hatte und die weder fahren noch gehen konnte, plötzlich eine Uniform trug! Er eilte der Equipage nach, die glücklicherweise nicht weit fuhr und vor der Kasaner Kathedrale hielt.
Er stürzte in die Kathedrale und drängte sich durch eine Reihe alter Bettelweiber mit verbundenen Gesichtern und zwei Löchern für die Augen, über die er sich früher so oft lustig gemacht hatte. In der Kirche waren nur wenige Beter. Kowaljow war so aufgeregt, dass er keine Kraft zum Beten fand und nur nach der einen Person Ausschau hielt; endlich sah er sie abseits stehen. Die Nase hielt ihr Gesicht in dem hohen Stehkragen verborgen und betete offensichtlich mit tiefer Andacht.
Wie soll ich mich ihr nähern?, dachte Kowaljow. An allem, an der Uniform und dem Hut ist zu erkennen, dass sie im Rang eines Staatsrats steht. Weiß der Teufel, wie ich es machen soll!
Er begann zu hüsteln, aber die Nase verharrte in ihrer andächtigen Stellung und verbeugte sich ständig.
»Mein Herr«, sagte Kowaljow, sich innerlich Mut zusprechend, »mein Herr …«
»Was wünschen Sie?«, fragte die Nase, indem sie sich umdrehte.
»Es erscheint mir so merkwürdig, mein Herr … ich denke … Sie sollten doch wissen, wo Sie hingehören … Plötzlich finde ich Sie, und wo? – in der Kirche. Sie werden doch zugeben …«
»Verzeihen Sie, ich habe nicht den geringsten Schimmer, wovon Sie sprechen … Erklären Sie sich bitte deutlicher.«
Wie soll ich mich erklären?, dachte Kowaljow. Dann fasste er sich ein Herz und begann: »Natürlich, ich … übrigens bin ich Major. Sie werden doch zugeben, dass es sich für mich nicht schickt, ohne Nase zu sein. Eine Händlerin, die auf der Woskressenski-Brücke geschälte Orangen verkauft, kann sich noch ohne Nase behelfen; aber ich, der ich Aussicht auf eine höhere Anstellung habe … und außerdem in Häusern verkehre und mit Damen bekannt bin: mit der Frau Staatsrat Tschechtarjowa und anderen … Urteilen Sie selbst … Ich weiß nicht, mein Herr (bei diesen Worten zuckte der Major Kowaljow die Achseln) … verzeihen Sie … wenn man es vom Standpunkt des Pflichtbewusstseins oder des Ehrgefühls ansieht … Sie werden selbst verstehen …«
»Ich verstehe gar nichts«, antwortete die Nase. »Erklären Sie sich deutlicher.«
»Mein Herr«, sagte Kowaljow mit würdevoller Bestimmtheit, »ich weiß nicht, wie ich Ihre Worte auffassen soll … Die ganze Angelegenheit liegt doch auf der Hand … oder wollen Sie nicht … Sie sind doch meine eigene Nase.«
Die Nase sah den Major an und zog die Brauen zusammen.
»Sie täuschen sich, mein Herr: ich lebe ganz unabhängig. Außerdem kann es zwischen uns keine engere Verbindung geben. Nach den Knöpfen Ihrer Uniform zu schließen, gehören Sie einem völlig anderen Ressort an.« Mit diesen Worten wandte sich die Nase von ihm ab.
Kowaljow war vollkommen verwirrt und wusste nicht, was er tun, ja nicht einmal, was er denken sollte. In diesem Augenblick hörte er das angenehme Rascheln eines Damenkleids: eine ältere Dame mit verschwenderischer Spitze an ihrer Garderobe stand nahebei, begleitet von einem Mädchen, dessen weißes Kleid sich wunderschön um ihre schlanke Gestalt schmiegte; darüber trug es einen strohgelben Hut, so leicht wie Schaumgebäck. Dahinter stand ein baumlanger Heiduck mit mächtigem Backenbart und einem ganzen Dutzend Mantelkrägen und öffnete seine Tabaksdose.
Kowaljow näherte sich ihnen, richtete den Batistkragen seines Vorhemds, ordnete die Petschaften an seiner goldenen Uhrkette und wandte sich aufmerksam der jungen Dame zu, die, graziös vorgebeugt wie eine Frühlingsblume, sich mit ihrem weißen Händchen und den durchscheinenden Fingern an die Stirn griff. Kowaljow lächelte noch wohlwollender, als er unter ihrem Hütchen ein rundliches, schneeweißes Kinn und einen Teil der Wange in der Farbe der ersten Frühlingsrosen erblühen sah. Aber plötzlich prallte er zurück, als hätte er sich verbrannt. Er erinnerte sich, dass er an der Stelle der Nase absolut nichts mehr hatte, und Tränen liefen ihm aus den Augen. Er drehte sich um und wollte dem Herrn in der Uniform sagen, dass er sich bloß als Staatsrat verstelle, dass er ein Spitzbube und Schuft sei und nichts weiter als seine eigene Nase … Die Nase war aber schon verschwunden: sie hatte sich verflüchtigt, wahrscheinlich um noch den einen oder anderen Besuch abzustatten.
Dies brachte Kowaljow zur Verzweiflung. Er ging zurück und blieb eine Minute lang in der Säulenhalle stehen, um ringsum nach der Nase Ausschau zu halten. Er erinnerte sich sehr gut, dass sie einen mit Federn geschmückten Hut und eine goldbestickte Uniform trug; doch hatte er sich weder ihren Mantel, noch die Farbe der Equipage und der Pferde gemerkt, und auch nicht, ob hinten ein Lakai (und in welcher Livree) gestanden hatte. Außerdem fuhren hier so viele Equipagen und so schnell vorbei, dass es schwer war, sich eine zu merken; und selbst wenn er sie erkannt hätte, wäre es ihm unmöglich gewesen, sie anzuhalten. Der Tag war schön und sonnig. Auf dem Newski-Prospekt wimmelte es von Menschen; eine ganze Blumenkaskade von Damen wogte über das Trottoir von der Polizeibrücke bis zur Anitschkinbrücke. Da sieht er einen ihm bekannten Hofrat, den er, besonders in Gegenwart von Fremden, Oberstleutnant zu titulieren pflegt. Da ist Jaryschkin, Abteilungsleiter im Senat, ein guter Freund, der im Bostonspiel immer verliert, wenn er 8 spielt. Und da ist ein anderer Major, der seinen Assessor im Kaukasus gemacht hat und der ihn mit der Hand zu sich winkt …
»Hol ihn der Teufel!«, sagte Kowaljow. »He, Kutscher, fahr mich direkt zum Polizeiobermeister!«
Kowaljow stieg in die Droschke und rief dem Kutscher zu: »Fahr so schnell du kannst!«
Kaum im Vestibül rief er: »Ist der Polizeiobermeister da?«
»Zu Befehl, nein«, antwortete der Portier. »Nein, der Herr Polizeiobermeister sind eben ausgefahren.«
»Was?«
»Jawohl«, fügte der Portier hinzu, »Es ist zwar noch nicht lange her, aber er ist ausgefahren; wären Sie etwas früher gekommen, hätten Sie ihn vielleicht noch angetroffen.«
Kowaljow setzte sich, ohne das Taschentuch vom Gesicht zu nehmen, wieder in die Droschke und rief dem Kutscher verzweifelt zu: »Los, fahr schon!«
»Wohin?«, fragte der Kutscher.
»Geradeaus!«
»Wie, geradeaus? Hier geht’s nur nach rechts oder links!«
Diese Auskunft brachte Kowaljow zur Besinnung und zwang ihn, erneut nachzudenken. Er hätte sich eigentlich an die Polizeidirektion wenden müssen, nicht etwa weil seine Situation irgendetwas mit der Polizei zu tun gehabt hätte, sondern weil dort sehr viel schneller Anordnungen getroffen werden konnten als in anderen Behörden. Genugtuung von den Vorgesetzten jener Behörde zu verlangen, bei der die Nase zu dienen behauptete, wäre unklug gewesen, weil bereits die eigenen Worte der Nase offenbarten, dass ihr nichts heilig war und sie auch in diesem Fall lügen würde, so wie sie schon gelogen hatte, als sie behauptete, Kowaljow noch nie gesehen zu haben. Kowaljow wollte dem Kutscher schon den Befehl geben, zur Polizeidirektion zu fahren, als ihm wieder der Gedanke kam, dass dieser Gauner und Spitzbube, der sich schon bei der ersten Begegnung so gewissenlos benommen hatte, den günstigen Augenblick nutzen und die Stadt verlassen könnte – und dann wäre alles Suchen vergebens, oder es könnte auch, Gott behüte, einen ganzen Monat lang dauern. Endlich schenkte wohl der Himmel selbst ihm einen Geistesblitz. Er beschloss, sich an die Annoncen-Expedition zu wenden und rechtzeitig eine Anzeige aufzugeben mit genauer Personenbeschreibung der Nase, damit jeder, der ihr begegnete, sie ihm wiederbringen oder wenigstens ihren Aufenthaltsort angeben könnte. Als er diesen Entschluss gefasst hatte, befahl er dem Kutscher, zur Zeitungsexpedition zu fahren. Und während der ganzen Fahrt bearbeitete er den Rücken des Kutschers mit der Faust und schrie: »Schneller, du Spitzbube! Schneller, du Schuft!«
»Ach, Herr!«, sagte der Kutscher, schüttelte den Kopf und peitschte mit den Zügeln auf den Rücken seines Pferdes ein, das langhaarig wie ein Bologneser Hündchen war.
Endlich hielt die Droschke, und Kowaljow stürzte atemlos in einen engen Empfangsraum, in dem ein kleiner grauhaariger Beamter in einem alten Frack und mit Brille an einem Tisch saß und, einen Gänsekiel zwischen den Zähnen, die eingenommenen Kupfermünzen zählte.
»Wo gibt man hier Anzeigen auf?«, rief Kowaljow. »Ach, guten Tag!«
»Meine Verehrung!« Der grauhaarige Beamte hob kurz den Blick und wendete sich dann wieder den Münz-stapeln zu.
»Ich habe eine Anzeige …«
»Entschuldigen Sie, aber haben Sie doch bitte noch etwas Geduld …«, sagte der Beamte, notierte mit der rechten Hand eine Zahl auf einen Zettel und verschob mit der Linken zwei Kugeln auf dem Rechenbrett.
Ein betresster Lakai, dessen gepflegtes Äußeres auf eine Anstellung in einem aristokratischen Haushalt schließen ließ, stand mit einem Blatt Papier in der Hand neben dem Tisch und fand es angemessen, seine Weltläufigkeit zu zeigen: »Glauben Sie mir, mein Herr, der Hund ist keine acht Kopeken wert, ich würde keine vier Kopeken für ihn geben, aber die Gräfin liebt ihn nun mal! Deshalb verspricht sie dem Finder hundert Rubel! Höflich und unter uns gesagt: die Geschmäcker der Menschen sind unberechenbar. Wenn man schon Hundeliebhaber ist, dann halte man sich einen Jagdhund oder Pudel. Gib fünfhundert oder von mir aus sogar tausend Rubel aus, aber dafür hat man einen wirklich guten Hund!«
Der ehrenwerte Beamte hörte ihm mit ernster Miene zu und zählte zugleich die Buchstaben auf dem Papier, das der Lakai mitgebracht hatte. Rechts und links standen noch reihenweise alte Frauen, Handlungsgehilfen und Hausknechte mit ihren Eingaben. Auf einem dieser Zettel hieß es, dass ein nüchterner Kutscher von seinem Besitzer in fremde Dienste gegeben werde; in einem anderen wurde eine wenig benutzte, im Jahre 1814 aus Paris mitgebrachte Equipage feilgeboten; hier wurde ein leibeigenes Mädchen von neunzehn Jahren, das waschen konnte und auch für andere Arbeiten taugte, ausgeschrieben; dort eine solide Droschke, an der eine der beiden Federn fehlte; ein junger, feuriger Apfelschimmel von siebzehn Jahren; neue, aus London bezogene Rüben- und Radieschensamen; ein Landgut mit allem Zubehör: mit einem Stall für zwei Pferde und einem Platz, auf dem man einen prachtvollen Birken- oder Tannenhain anlegen konnte; eine Anzeige über den Verkauf alter Stiefelsohlen nebst Aufforderung, sich zwischen acht und fünfzehn Uhr bei der Versteigerung derselben einzufinden. Der Raum, in dem sich diese ganze Gesellschaft befand, war klein und die Luft darin außerordentlich stickig; aber der Kollegienassessor Kowaljow konnte es nicht spüren, da er sich das Taschentuch vors Gesicht hielt und auch, weil seine Nase sich Gott weiß wo befand.
»Mein Herr, darf ich Sie bitten … Ich bin in Eile …«, sagte er schließlich voller Ungeduld.
»Gleich, gleich! … Zwei Rubel dreiundvierzig Kopeken … Einen Augenblick! … Ein Rubel vierundsechzig Kopeken«, sagte der grauhaarige Herr, während er den alten Weibern und den Hausknechten ihre Zettel ins Gesicht warf. »Was wünschen Sie?«, wandte er sich endlich an Kowaljow.
»Ich bitte …«, sagte Kowaljow, »es liegt ein Schwindel oder Betrug vor – ich weiß es noch nicht. Ich bitte Sie nur zu annoncieren, dass derjenige, der mir diesen Spitz-buben herbeischafft, eine großzügige Belohnung erhalten wird.«
»Darf ich fragen, wie Ihr Familienname lautet?«
»Nein, was brauchen Sie meinen Familiennamen? Ich kann ihn nicht bekanntgeben. Ich habe viele Beziehungen in die Gesellschaft: die Frau Staatsrat Tschechtarjowna, die Frau Stabsoffizier Pelageja Grigorjewna Podtotschina … Wenn sie es, Gott behüte, erfahren! Sie können einfach schreiben: ein Kollegienassessor, oder noch besser: ein Herr im Majorsrang.«
»Ist Ihnen ein Leibeigener entlaufen?«
»Ach was, Leibeigener. Das wäre keine so große Schande! Mir ist die … Nase ausgerückt …«
»Hm! Ein sonderbarer Familienname! Hat Sie dieser Herr Nase um eine große Summe betrogen?«
»Das heißt: die Nase … Sie haben mich nicht richtig verstanden! Die Nase, meine eigene Nase, ist mit unbekann tem Ziel irgendwohin entschwunden. Der Teufel hat mir einen Streich gespielt!«
»Ja, auf welche Weise ist sie denn verschwunden? Ich verstehe nicht recht.«
»Selbst ich kann Ihnen nicht sagen, auf welche Weise. Das Wichtigste ist aber, dass sie jetzt in der Stadt umherfährt und sich Staatsrat nennt. Darum bitte ich Sie, zu annoncieren, dass derjenige, der sie einfangen sollte, sie mir unverzüglich zurückbringen möchte. Bedenken Sie doch: wie soll ich ohne diesen so wichtigen Körperteil leben? Das ist doch kein kleiner Zeh, der im Stiefel steckt und dessen Fehlen kein Mensch bemerkt. Ich bin jeden Donnerstag bei der Frau Staatsrat Tschechtarjowna. Die Frau Stabsoffizier Pelageja Grigorjewna Podtotschina – sie hat ein hübsches Töchterchen – ist auch eine gute Bekannte von mir; urteilen Sie selbst, was soll jetzt tun … Ich kann mich doch bei diesen Damen unmöglich sehen lassen.«
Der Beamte überlegte sich den Fall: seine fest zusammengekniffenen Lippen wiesen darauf hin.
»Nein, ich kann eine solche Annonce nicht einrücken«, sagte er schließlich nach langem Schweigen.
»Wie? Warum?«
»Also, die Zeitung könnte ihren guten Ruf verlieren. Wenn jeder schreiben wollte, dass ihm seine Nase davongelaufen ist, so … Es ist ohnehin schon genug davon die Rede, dass viel zu viele sinnlose und falsche Gerüchte gedruckt werden.«
»Warum sollte denn diese Sache sinnlos sein? Das sehe ich wahrhaftig nicht ein …«