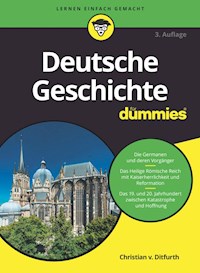Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vergessen Sie, was Sie über die deutsche Geschichte zu wissen glauben: "Das Rosa-Luxemburg-Komplott" von Christian v. Ditfurth als eBook bei dotbooks. Berlin, März 1919: Rosa Luxemburg führt die Revolution zum Sieg. Doch bald muss sie gegen russische Gewaltapostel und deutsche Freikorpssöldner kämpfen, um die Macht – und um ihr Leben. In diese explosive Situation gerät Sebastian Zacharias, der gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Er soll Lenin über Rosa Luxemburgs Pläne unterrichten. Als sie nur knapp einem Anschlag entgeht, sucht Zacharias die Mörder. Wem ist noch zu trauen? Seine Ermittlungen führen ihn auf die Spur einer skrupellosen Verschwörung. Bleibt Rosa Luxemburg nur ein letzter verzweifelter Ausweg? Spannend wie ein Thriller – in "Das Rosa-Luxemburg-Komplott" spielt Christian v. Ditfurth wieder mit der Geschichte: Was wäre geschehen, wenn die deutsche Revolution 1918/19 gelungen wäre? "Ein faszinierendes Konstrukt aus Fakten und Phantasie." Der Spiegel "Ein glänzend geschriebenes Buch, voller Dramatik und viel historischem Gespür." Saarbrücker Zeitung "Christian v. Ditfurth ist ein Meister historischer Thriller." Lausitzer Rundschau Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das Rosa-Luxemburg-Komplott" von Christian v. Ditfurth. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Berlin, März 1919: Rosa Luxemburg führt die Revolution zum Sieg. Doch bald muss sie gegen russische Gewaltapostel und deutsche Freikorpssöldner kämpfen, um die Macht – und um ihr Leben. In diese explosive Situation gerät Sebastian Zacharias, der gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Er soll Lenin über Rosa Luxemburgs Pläne unterrichten. Als sie nur knapp einem Anschlag entgeht, sucht Zacharias die Mörder. Wem ist noch zu trauen? Seine Ermittlungen führen ihn auf die Spur einer skrupellosen Verschwörung. Bleibt Rosa Luxemburg nur ein letzter verzweifelter Ausweg?
Spannend wie ein Thriller – in »Das Rosa-Luxemburg-Komplott« spielt Christian v. Ditfurth wieder mit der Geschichte: Was wäre geschehen, wenn die deutsche Revolution 1918/19 gelungen wäre?
»Ein faszinierendes Konstrukt aus Fakten und Phantasie.« Der Spiegel
»Ein glänzend geschriebenes Buch, voller Dramatik und viel historischem Gespür.« Saarbrücker Zeitung
»Christian v. Ditfurth ist ein Meister historischer Thriller.« Lausitzer Rundschau
Über den Autor:
Christian v. Ditfurth, Jahrgang 1953, ist Historiker, Lektor, Journalist und Autor. Seine Romane handeln von der deutschen Geschichte – teilweise mit einem alternativen Verlauf.
Bei dotbooks erschienen bereits seine Romane »Der 21. Juli« und »Der Consul«.
Die Website des Autors: www.cditfurth.de
***
eBook-Neuausgabe April 2016
Dieses Buch erschien bereits 2005 unter dem Titel »Das Luxemburg-Komplott« bei Droemer, München.
Copyright © der Originalausgabe 2005 Droemer Verlag. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co.KG, München.
Copyright © der eBook-Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von shutterstock/chitarra.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-500-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Rosa-Luxemburg-Komplott« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christian v. Ditfurth
Das Rosa-Luxemburg-Komplott
Roman
dotbooks.
Die sich anschicken, der barbarischen Vorgeschichte der Menschheit ein Ende zu bereiten, sind selbst Menschen dieser Vorgeschichte. Sie gehen in den Kampf gegen Götzen mit der Seele von Götzendienern.
Manès Sperber
Kapitel 1
Mit tausend Schritten macht's die Frau;
Doch wie sie sich auch eilen kann – Mit einem Sprunge macht's der Mann.
Sie lachte innerlich. Aber der Schrecken kehrte gleich zurück. Sie saß in der Ecke und las im Faust. Ihre Augen folgten dem Text, aber sie verstand ihn nur, weil sie ihn längst kannte. Ein Offizier saß an einem Tisch, nicht weit entfernt. Sie fühlte, wie er sie beobachtete. Er trug einen Schnurrbart in einem zum Feisten neigenden Gesicht mit eng beieinander stehenden Augen.
Leute einer Bürgerwehr hatten sie in ihrem Versteck in Wilmersdorf gefunden und ins Hotel Eden gebracht. Mordlust war in den Augen dieser Männer gewesen. Sie hatte geglaubt, sie würde schon unterwegs totgeschlagen. Aber sie beschimpften sie nur als rote Hure. Nachdem die Bürgerwehrleute sie durch die Drehtür in die Empfangshalle gebracht hatten, sah sie den Hass in den Augen der Soldaten, die an Tischen saßen und tranken. Aber keiner griff sie an. Mehr staunte sie, dass sie keine Furcht spürte. Vielleicht ist es deine Bestimmung, in einem Kampf ermordet zu werden, den du nicht wolltest. Der Aufstand war niedergeschlagen worden, wie sie es gewusst hatte von Anfang an. Sie waren zu wenige gewesen. Die meisten Arbeiter hörten noch immer auf Ebert und Scheidemann oder auf die Unabhängigen Sozialdemokraten, die nicht wussten, was sie tun sollten.
In der Niederlage zu sterben, das ist kein schlechter Tod für eine Revolutionärin. Der Tod befreit einen auch von den Fragen, auf die man keine Antwort findet. Sie erinnerte sich der Zeiten, in denen sie sich tot gewünscht hatte. In diesen Augenblicken der Verzweiflung. Als sie eingesperrt war und allein. Als ihre Welt zusammenbrach am 4. August 1914, an dem die sozialdemokratische Reichstagsfraktion den Krediten zustimmte, mit denen der Kaiser seinen Krieg bezahlte. Gerade vierzehn Abgeordnete hatten in der Fraktion dagegen gestimmt, sich aber dann im Reichstag der Mehrheit unterworfen. Als sie merkte, dass die Arbeiter immer noch denen glaubten, die sie tausendmal belogen hatten.
Vor ein paar Wochen erst war sie aus Breslau zurückgekehrt in einem überfüllten Zug, die meisten Fahrgäste trugen Uniform. Niemand interessierte sich für die kleine Frau, die auf ihrem Koffer saß und las. Für die meisten war die Revolution zu Ende, weil Frieden war.
Die Tür wurde aufgestoßen. Ein Offizier stürzte herein. »Herr Pabst, Herr Pabst! Es ist schrecklich!«, stammelte er.
Der Hauptmann stand auf und brüllte: »Machen Sie anständig Meldung!«
Der Soldat warf einen Blick zu der Frau, die immer noch so tat, als würde sie lesen. Dann straffte er den Körper und legte die Hand an die Mütze: »Herr Hauptmann, wir haben Liebknecht hinuntergebracht zum Abtransport, wie befohlen. Der Trupp ist mit ihm losgefahren, da kamen plötzlich Leute, viele Leute. Bewaffnete. Sie haben Liebknecht mitgenommen. Und die Wachmannschaft erschossen.«
Die Frau begann zu begreifen. Sie hatten Karl auf der Flucht erschießen wollen, aber Arbeiter hatten ihn gerettet.
»Sie haben sich den Gefangenen wegnehmen lassen?« Fassungslosigkeit lag in Pabsts Stimme. Er stellte sich direkt vor den anderen Offizier. »Ist das wahr?«, brüllte er.
»Jawohl«, sagte der Soldat. »Wir haben aber überall gesucht.«
Die Frau musste sich beherrschen, nicht laut loszulachen.
»Das heißt, Sie haben sich den Gefangenen wegnehmen lassen und ihn dann überall gesucht?«
»Jawohl, Herr Hauptmann.«
»Aber Sie haben ihn nicht gefunden?«
»Jawohl, Herr Hauptmann.«
»Wissen Sie, was Sie gemacht haben? Sie haben Deutschlands gefährlichsten Verbrecher laufen lassen.«
Die Frau in der Ecke spürte Hoffnung. Wenn Karl fliehen konnte, dann würde es ihnen schwerer fallen, sie zu töten. Karl wusste, wo sie war. Und Pieck wusste es auch. Wo war Pieck?
»Und wo ist dieser Meyer?«, fragte der Hauptmann. Es hörte sich so an wie: Den habt ihr wohl auch noch laufen lassen.
»Der ist noch hier.«
»Dann können Sie den ja auch noch gehen lassen«, schnauzte der Hauptmann. »Und diese Dame hier, die nicht zugeben will, die Luxemburg zu sein, die können Sie gleich mitschicken.«
Die Frau reimte es sich zusammen. Sie hatten noch nicht einmal herausgefunden, dass Meyer nur ein Deckname war. Sie hatten neben Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg mit Wilhelm Pieck ein drittes Mitglied der KPD-Zentrale gefangen, ohne es zu wissen. Stahlhelme machen nicht klüger, dachte die Frau.
Der Hauptmann brüllte Pflugk-Harttung aus dem Zimmer. Er hatte wohl schon die Lobeshymnen gehört auf den Mann, der Liebknecht und Luxemburg zur Strecke gebracht habe, den Bolschewistenzögling und das jüdische Flintenweib aus Polen, die alle anständigen Deutschen ermorden wollten. Sogar der sozialdemokratische Vorwärts hatte gefordert, die beiden zu töten, zusammen mit Radek, dem Bürgerkriegshetzer aus Russland.
Die Frau las immer noch. Sie zeigte keine Angst und keine Befriedigung.
Der Hauptmann nahm einen Füller in die Hand und spielte mit ihm. Der Füller fiel auf den Boden und zerbrach. Tinte trat aus, ein schwarzer Fleck weitete sich auf dem Teppich. Pabst fluchte leise. Er warf einen Blick zu der Frau und glaubte, er habe sie lächeln gesehen. Obwohl sie las, fühlte er sich beobachtet. Eine seltsame Frau. Sie war grauhaarig, nicht schön, klein und nicht mehr schlank. Ihn erstaunten immer noch die Ruhe und die Überlegenheit, mit der sie ihm gegenübertrat, als sie vorgeführt worden war.
»Sind Sie Frau Rosa Luxemburg?«
»Entscheiden Sie bitte selber«, hatte sie geantwortet.
»Dem Bild nach müssten Sie es sein.«
»Wenn Sie es sagen.«
Auch wenn er sich gegen den Eindruck wehrte, sie hatte eine Aura, selbst hier in diesem Zimmer, in dem sie nur in der Ecke saß und las. Davor hatte sie Nähzeug aus ihrem kleinen Koffer genommen und sich einen Saum angenäht, der bei der Verhaftung gerissen war. Er hatte viel über sie gehört. Liebknecht sei ein Hetzer, Luxemburg aber die Seele der deutschen Bolschewisten. Wie gefährlich sie war, hatte er begriffen, als ein Offizierskamerad zu ihm gekommen war und vorschlug, die Luxemburg vor der Truppe reden zu lassen. Die kleine Frau hatte sogar einem kaiserlichen Offizier den Kopf verdreht. Er würde wieder ein Kommando zusammenstellen und die Frau wegbringen lassen.
Der Anruf, den er vor zwei Stunden erhalten hatte, ging ihm durch den Kopf. Es war verrückt, völlig verrückt. Und ausgerechnet ihn hatten die sich ausgesucht für dieses Unternehmen. Ausgerechnet ihn. Diesen Tag, den 15. Januar 1919, würde er nie vergessen.
Kapitel 2
Er kratzte sich an der Backe und schaute ihn streng an. »Wie war die Zugfahrt?«
»Gut.« Hätte er ihm erzählen sollen, dass er neun Tage gebraucht hatte von Engels im deutschen Wolgagebiet nach Moskau, weil sie unterwegs immer wieder halten mussten, damit Bahnpersonal und Fahrgäste im Frost und unter Schneewehen Brennholz suchten, da es Kohle schon lange nicht mehr gab? Das wusste Feliks Dserschinski doch selbst, der Vorsitzende des Präsidiums der Außerordentlichen Kommission zur Bekämpfung der Konterrevolution, die alle nur Tscheka nannten.
»Wie mir Ihre Leiter berichten, haben Sie gut gearbeitet. Auch der Genosse Reuter ist zufrieden mit Ihnen.«
Zacharias erwiderte nichts. Sie hatten getan, was die Einheiten der Tscheka überall taten. Und der Genosse Ernst Reuter, der Volkskommissar des Wolgagebiets, hatte sie die Drecksarbeit machen lassen. Sie suchten Konterrevolutionäre, und wenn sie welche fanden, erschossen sie die meistens, ohne lang zu fragen. Wenn die Weißen Genossen fingen, töteten sie die auch. Entweder wir oder sie. Lenin hatte den Terror befohlen, die Tscheka und die Rote Armee übten ihn aus. Darüber musste Zacharias mit Dserschinski nicht reden.
»Die Wolgarepublik liefert Getreide und Fleisch nach Moskau, mehr als alle anderen Gebiete. Ohne sie wären wir längst verhungert. Das verdanken wir auch unserer Tscheka.« Dserschinski blätterte in einer Akte. »Sie waren 1909 auf der SPD-Parteischule in Berlin. Ihre Lehrerin in Politischer Ökonomie war Rosa Luxemburg.«
Es waren keine Fragen, was Dserschinski eher nuschelte. Trotzdem antwortete Zacharias: »Ja, Genosse Dserschinski.« Sie war nicht nur Lehrerin in Ökonomie gewesen. Sie hatte ihm und den anderen Genossen die Gewissheit gegeben, dass der Sozialismus kommen würde, weil die Geschichte es verlangte. Der Untergang des Kapitalismus war vorbestimmt, und ihre Aufgabe als Sozialisten war es, bereit zu sein, die Macht im Staat zu übernehmen. Sie würden es erleben. Die Arbeiter seien die letzte herrschende Klasse, deren Aufgabe darin bestehe, den Kommunismus herbeizuführen, in dem jeder nach seinen Bedürfnissen leben könne und in dem es keine Klassenherrschaft mehr gebe. Das Paradies auf Erden, sie hatte es in ihre Köpfe geredet, und sie hatten an ihren Lippen gehangen. Es war wie ein Erweckungserlebnis gewesen, Zacharias hatte es jedenfalls so empfunden. Seitdem nannte er die Genossin Dr. Luxemburg insgeheim Rosa, weil sie ihm nahe gekommen war, indem sie seine Gedanken bewegt hatte wie kein Mensch zuvor. Sie, die mit den Großen der Arbeiterbewegung auf gleicher Augenhöhe verkehrte, sie, die Eduard Bernstein, den Freund von Marx und Engels, in die Schranken wies, sie, die den großen Kautsky belehrte, sie, die Parteitage zum Jubeln brachte oder zum Protestieren, sie hatte klein vor ihnen gestanden, um ihnen geduldig das Einmaleins des Sozialismus beizubringen. Damals wollten wir alles wissen, besser noch, wir glaubten, alles lernen zu können, die Gesetze der Ökonomie, der Gesellschaft, der Geschichte. Und wem es an Gewissheit gefehlt hatte, der erfuhr sie in der Parteischule. In keiner anderen Schule wurde mehr gelernt und disziplinierter, es war eine Auszeichnung, dort hingeschickt zu werden. Er hatte sie sich erworben in seiner Jugendgruppe. Auch wenn er in den Augen der älteren Genossen vorwitzig war und die angestammten Autoritäten nicht im gewünschten Ausmaß verehrte, so empfahl der sozialdemokratische Wahlkreisvorstand doch, er solle auf die Schule gehen. »Damit sie ihm die große Klappe abgewöhnen«, witzelte einer. Das wurde ihm hintertragen, und er glaubte es.
***
Der Leiter der Tscheka musterte Zacharias, dann schaute er an die Decke. Rauch stand im Zimmer. Es war kalt, der Ofen in der Ecke wärmte kaum. Sie saßen in Mänteln an Dserschinskis Schreibtisch.
»Wir schicken Sie nach Deutschland«, sagte Dserschinski. »Die deutschen Genossen brauchen Hilfe. Und wir brauchen jemanden, der uns berichtet. Sie sollen genau hinschauen, und was Sie sehen, berichten Sie uns. Der Genosse Radek wird Sie einführen in den Spartakusbund, der sich seit Kurzem Kommunistische Partei nennt. Und Sie bekommen einen zweiten Auftrag: Wachen Sie über die Genossin Luxemburg.«
Zacharias schaute ihn mit großen Augen an. Und dann dachte er an Margarete. Er stellte sie sich vor mit ihrem Pferdeschwanz, der wippte, wenn sie lief. Ob sie auf ihn gewartet hatte? Aber sie hatte schon lang nichts mehr gehört von ihm. Nun würde er zurückkommen. In seiner Erinnerung schien die Sonne, ein paar weiße Fetzen schwebten am Himmel. »Kaiserwetter«, nannten das die anderen. Er sah Margarete und sich im Tiergarten, Hand in Hand, auch wenn manche Passanten durch Blicke kundtaten, dass sie es unschicklich fanden. Sie war meist fröhlich, und wenn er sie umarmen durfte, spürte er ihren weichen Körper, der seine Selbstbeherrschung prüfte. Er verspottete sich wegen seiner rosaroten Erinnerung, die alle Sorgen wegwischte, die auf ihnen gelastet hatten. Aber so ähnlich wird es gewesen sein. Ihr Lachen, wenn er sie abholte zum Spaziergang oder sie besuchte bei ihren Eltern, die ihn schon als künftigen Schwiegersohn sahen. Sie sagten es natürlich nicht, aber wenn er sonntags kam, stellte sie ungefragt eine Tasse mehr auf den Tisch.
***
»Wie wir gerade erfuhren, ist die Genossin Luxemburg nur knapp einem Mordanschlag entgangen. Sie war in den Händen konterrevolutionärer Freikorps, Liebknecht auch. Aber Liebknecht wurde befreit durch bewaffnete Arbeiter, er rief die Revolutionären Obleute auf, die Genossin Luxemburg ebenfalls zu befreien, und durchkreuzte die Pläne der Konterrevolution.«
»Die Revolutionären Obleute?«
»Sie wissen nicht, wer das ist? Sie sollten die Prawda nicht nur zum Heizen benutzen, Genosse Zacharias. Das sind Gewerkschafter, die sich im Krieg gegen die Burgfriedenpolitik von SPD und Gewerkschaftsführung aufgelehnt haben. Der Munitionsarbeiterstreik Anfang 1918 stand unter ihrer Führung, bis Ebert ihn abwürgte. Die revolutionären Arbeiter Berlins stehen hinter den Obleuten, noch nicht hinter den Kommunisten. Ich hoffe, Sie kennen wenigstens Ebert.«
Zacharias nickte. Ebert war SPD-Vorsitzender und Reichskanzler in Berlin, ein Verräter.
Dserschinski lächelte. Er zog Papiere aus einem Stapel auf seinem Schreibtisch, bis er endlich fand, was er gesucht hatte. »Hier ist ein telegrafischer Bericht eines zuverlässigen Informanten aus Berlin, in dem genau geschildert wird, wie die Genossin Luxemburg und der Genosse Liebknecht entkamen. Lesen Sie ihn durch und geben Sie in mir wieder.«
»Wem gebe ich meine Berichte aus Berlin?«
»Das erfahren Sie dort. Ein Genosse wird sich an Sie wenden, oder Sie suchen ihn auf, wenn er sich nicht meldet. Er heißt Karl Retzlaw, die Adresse gebe ich Ihnen später. Retzlaw wird Sie zum Genossen Radek bringen. Halten Sie sich zunächst an den Genossen Radek. Aber lassen Sie sich nicht einspannen von ihm.« Jetzt hörte er Dserschinskis polnischen Akzent. »Sie haben den Auftrag, eine Funktion in der Kommunistischen Partei zu übernehmen, die es Ihnen ermöglicht, die Genossin Luxemburg möglichst oft zu sehen. Welche Funktion, das ist Ihre Sache. Ihr darf nichts geschehen, und wir müssen wissen, was sie vorhat. Wir haben keinen wichtigeren Auftrag zu vergeben, Genosse Zacharias. Und ich verrate Ihnen, dass dieser Auftrag nicht von mir stammt.«
»Ich bin Kriegsgefangener.« Warum sage ich das?
»Das sind Sie seit März 1918 nicht mehr, seit dem Brester Vertrag. Sie haben unter der Leitung des Genossen Reuter gute Arbeit im Kriegsgefangenenkomitee geleistet, aber doch schon nicht mehr als Gefangener, sondern als Revolutionär. Sie sind ein Anhänger unserer Revolution, und Sie haben eine gute Biografie, jedenfalls für diesen Auftrag.« Er blätterte in der Akte und murmelte: »Geboren am 16. Januar 1888 in Berlin-Wedding in einer Arbeiterfamilie. Vater Metallarbeiter und seit 1875 Mitglied der SPD, unter dem Sozialistengesetz ein Jahr in Haft wegen Verbreitung sozialdemokratischer Propaganda. Da waren die Sozialdemokraten noch Revolutionäre, nicht wahr, Genosse Zacharias?«
Der nickte. Ob die Eltern noch lebten? Er hatte ewig nichts mehr erfahren von ihnen. Und seine Schwester Renate? Sie war nun zweiundzwanzig, nein dreiundzwanzig, Geburtstag am 5. Januar. Ob sie zu Hause glaubten, er sei tot? Wie sahen sie aus, seine Eltern und seine Schwester? Er erinnerte sich an Schemen, dabei war es wenige Jahre her, dass er sie das letzte Mal gesehen hatte. Das knochige Gesicht des Vaters mit breiter Nase, die nicht hineinpassen wollte in das Gesicht. Die früh grau gewordenen Haare. Die derben, starken Hände. Wie er die Schmerzen ertrug, die ihm die Gicht verschaffte. Er war spröde, wortkarg und verehrte Bebel. Die Mutter mit ihrem rundlichen Gesicht, eine kleine Warze am Kinn, die fest zurückgebundenen schwarzen Haare. Sie redete viel, als müsste sie das Schweigen des Vaters ausgleichen. Aber sie war immer freundlich und warmherzig, es sei denn, er trieb es zu arg als Kind, und ihre Geduld endete. Aber der Zorn war bald verraucht, als wäre nie etwas gewesen. Du malst dir eine Idylle aus. So war es nicht. Sie waren streng, der Vater hat dich geschlagen, wenn du in der Schule einen Tadel einfingst, und du fandst es ungerecht, in der Schule Schläge zu bekommen und zu Hause auch. Und du hast immer geglaubt, sie zögen Renate vor, das Nesthäkchen, das immer mehr von den wenigen Süßigkeiten bekam. Das sogar der Vater anlächelte.
***
»1914 wurden Sie eingezogen. Zuerst kurz an der Westfront, Belgien, dann Russland. Sie waren in Tannenberg dabei.« Dserschinski schaute Zacharias an.
Zacharias nickte. Es war ein Gemetzel gewesen.
»Januar 1917 Gefangenschaft, verwundet.«
Zacharias nickte. Sie hatten ihm ins Bein geschossen aus einem Hinterhalt heraus und seine Kompanie fast völlig aufgerieben. Nur wenige hatten überlebt. Er war gut bedient gewesen mit einem Durchschuss in der Wade. Schlimmer als die Schussverletzung war der Wundbrand, der ihn fast das Bein oder das Leben gekostet hätte. Aber er hatte gute Pfleger gehabt und vor allem Glück. Immer wenn die Narbe juckte, dachte er an sein Glück.
»Dann waren Sie im Kriegsgefangenenlager Pereslawl-Salesski, zusammen mit dem Genossen Reuter.«
Zusammen mit ein paar Tausend Mann, dachte Zacharias. Schmutziges Wasser, wenig zu essen, und wenn, dann einen Fraß sondergleichen. Reuter war ihm zunächst nicht aufgefallen. Erst später, als der zum Leiter des Kriegsgefangenenkomitees gemacht wurde. Aber er verschwand bald, und Zacharias traf ihn erst im Wolgagebiet wieder, da war Reuter schon Volkskommissar. Und da hatte die Tscheka Zacharias schon angeworben.
»Sie sind seit Juli 1918 bei uns.« Dserschinski sagte es fast lautlos und schaute nicht auf von der Akte.
Zacharias arbeitete damals in der Kriegsgefangenenverwaltung. Die versuchte aus Kriegsgefangenen Revolutionäre zu machen, die im Bürgerkrieg halfen und später in ihren Ländern als Kommunisten arbeiteten für die Weltrevolution. Solange der Frieden von Brest-Litowsk mit den Deutschen galt, war es verboten, mit Kriegsgefangenen politisch zu arbeiten. Aber als Lenin den Vertrag nach der deutschen Niederlage im Westen zerriss, setzte die Kriegsgefangenenverwaltung offen fort, was sie insgeheim längst getan hatte. Eines heißen Julitags kam ein Genosse von der Außerordentlichen Kommission und fragte Zacharias, ob er gegen die Konterrevolution kämpfen wolle. Das sei jetzt das Wichtigste für das Überleben der Sowjetmacht. Er gebe zu, sie machten nicht viel Federlesen. Lieber zehn zu viel erschossen, als dass einer entkomme. Zacharias fühlte sich geehrt. Nur die Treuesten der Treuen würden gefragt, sagte der Genosse, der sich nun unter dem Namen Michail Michailowitsch Woronin vorstellte.
Zacharias war jung, leichtfertig und schnell zu begeistern. Und er war geschmeichelt. Tscheka – das hatte einen Klang! Da durfte nicht jeder mitmachen, nur wenige wurden gefragt. Einen größeren Vertrauensbeweis gab es nicht. Also machte er mit. Er wurde zunächst einer Einheit zugeteilt, die in Moskau und Umgebung nach Konterrevolutionären und Spionen der Weißen suchte. Es wurde wenig gefragt und viel geschossen. Dann schickten sie ihn in das Wolgagebiet, weil er Deutscher war.
»Sie haben erklärt, dass Sie nach Deutschland zurückkehren wollen«, sagte Dserschinski. Er zog ein Papier aus der Akte.
Zacharias nickte. Die wahre Begründung war, dass er es leid war, andere Leute zu jagen, die als Feinde galten, weil sie Popen, Ladenbesitzer, Kulaken oder ehemalige Offiziere des Zaren waren. Er schlief nachts schlecht, sah die Angst in den Augen seiner Opfer und hörte noch, wie sie ihre Unschuld beschworen und um ihr Leben bettelten. Er wusste, diese Bilder würde er bis zum Ende seines Lebens in sich tragen. Eine Zeit lang hatte er sich eingeredet, er müsse weitertöten, um zu rechtfertigen, dass er getötet hatte. Erwies es sich als falsch, war er ein Verbrecher. Aber dann hatte er es nicht mehr ausgehalten. Er verbarg vor seinen Genossen und Vorgesetzten, dass er nachts zitternd und schwitzend aufwachte. Seine Begeisterung war erloschen, und doch konnte er nicht falsch finden, was die Tscheka tat. Tat sie es nicht, würde die Revolution in Bauernaufständen ersticken, und die Weißen würden die Sowjetmacht beseitigen und alle umbringen, die ihr geholfen hatten.
»Sie fühlen sich berufen, der deutschen Revolution zu helfen.«
»Berufen ist ein großes Wort, und ich bin nur ein kleiner Bolschewik. Aber manchmal sind die Kleinen nicht unnütz.«
Dserschinski lächelte. »Ihre Mundfertigkeit ist auch in der Akte vermerkt. Sie haben sich verdient gemacht im Kampf gegen die Feinde. Ich weiß, der ist nicht leicht. Wir sind keine Mörder, denen das Töten Freude bereitet. Wir sind Humanisten. Die Diktatur des Proletariats ist tausendmal humaner als die Diktatur der Bourgeoisie.«
Zacharias schien es zunächst fast, Dserschinski sagte es, um sich selbst zu überzeugen. Aber dann verwarf er den Gedanken. Ein Mann wie Feliks Dserschinski zweifelte nicht. Wer jeden Tag Menschen zu Hunderten in den Tod schickte, musste restlos überzeugt sein, dass es richtig war. Zacharias stellte sich Rosa an Dserschinskis Stelle vor, während der in der Akte blätterte und wieder in seinen Gedanken versank. Würde sie befehlen, Menschen zu töten, weil sie im Verdacht standen, gegen die Revolution zu arbeiten oder weil sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft als Feinde galten, als ›Burschuis‹? Dserschinski hatte lange Jahre mit Rosa zusammengearbeitet in der kleinen Partei mit dem langen Namen Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauens. Er hatte in den parteiinternen Streitereien als ihr Anhänger gegolten. Würde sie genauso handeln wie Dserschinski? War das nur eine Frage der Lage und des Zeitpunkts? Gibt es in einer Situation immer nur eine Möglichkeit, sich richtig zu entscheiden? Zacharias rief sie sich als Dozentin in Erinnerung. Es waren zuerst ihre Augen, die einen anstrahlten und gefangen nahmen.
»Wird sich die Genossin Luxemburg an Sie erinnern?«
Ob Dserschinski seine Gedanken lesen konnte? »Ich glaube schon.« Augen, die einen so anstrahlen, vergessen einen nicht. »Es wird mir sonst aber bestimmt gelingen, mich in Erinnerung zu bringen.«
Dserschinski lächelte. Gleich wurde er wieder ernst. »Die Genossin Luxemburg war eine gute Lehrerin.« Es war keine Frage. »Aber sie hat eine Sache nicht verstanden und sich dadurch in einen Widerspruch zum Genossen Lenin gebracht. Sie unterschätzt die Rolle der Partei. Ihre Partei führt nicht, sie lehrt. So ist die Genossin Luxemburg immer eine Lehrerin geblieben. O ja, auch ich habe viel von ihr gelernt. Sie hat eine Art, einem die Dinge um die Ohren zu hauen, ich muss schon sagen ...« Er brach ab, kurz erschien wieder ein Lächeln in seinem Gesicht. Einen Augenblick sah es so aus, als hätte dieser harte Mann Sehnsucht. »Wir haben nachher noch eine wichtige Besprechung. Nehmen Sie den Bericht aus Berlin und warten Sie draußen, bis Sie gerufen werden.«
Zacharias setzte sich im Vorraum in einen weichen Sessel und begann den Bericht zu lesen. Zuerst schaute er nach, wer ihn geschrieben hatte, aber da stand kein Name. Der Unbekannte schilderte, wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verhaftet und befreit worden waren.
***
Am Mittwoch, dem 15. Januar 1919 drangen Mitglieder einer sogenannten Wilmersdorfer Bürgerwehr in die Wohnung eines Herrn Marcusson in der Mannheimer Straße 43 ein. Dort stießen sie auf den Genossen Liebknecht, den sie verhafteten. Zwei Bürgerwehrleute brachten den Genossen Liebknecht zunächst in das Hauptquartier der Bürgerwehr in der Cecilienschule, um ihn dort zweifelsfrei zu identifizieren, weil der Genosse Liebknecht erklärte, er heiße Marcusson. Drei Mann blieben in der Wohnung des Marcusson zurück, um Genossen zu verhaften, die dort auftauchten. Später wurde der Genosse Liebknecht ins Hotel Eden gefahren, dem Hauptquartier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, und dort dem Stabschef der Division, einem Hauptmann Pabst, übergeben.
Kurz nachdem der Genosse Liebknecht aus der Wohnung gebracht worden war, erschien dort die Genossin Luxemburg und wurde ebenfalls verhaftet. Auch sie wurde schließlich zum Hotel Eden gebracht und dem besagten Hauptmann Pabst übergeben. Außerdem wurde noch der Genosse Pieck verhaftet, der sich als bürgerlicher Journalist ausgab und nicht identifiziert werden konnte.
***
Zacharias lehnte sich zurück und schloss die Augen. Er kannte auch Pieck aus der Vorkriegszeit, jedenfalls hatte er den Namen schon einmal gehört. Aber sie konnten ihn nicht identifizieren. Er las weiter und malte sich aus, welches Geschehen sich verbarg hinter den trockenen Sätzen.
Dieser Hauptmann Pabst wollte die Spartakusführer umbringen, das liegt auf der Hand. Gegen 23 Uhr erschienen Offiziere der Division in Mannschaftsuniformen im Hotel. Hauptmann Pabst übergab ihnen Liebknecht, und sie führten ihn aus dem Eden. An der Drehtür stand ein einfacher Soldat Wache, der Jäger Runge. Als er durch die Scheibe Liebknecht erkannte und sah, dass der durch einen Seitenausgang aus dem Hotel gebracht werden sollte, rannte Runge dorthin und kam gerade noch rechtzeitig, um dem Spartakusführer den Gewehrkolben auf den Kopf zu schlagen. Dann zerrten die Bewacher den blutenden Liebknecht ins Auto und fuhren los.
Und nun geschah etwas Unglaubliches. Kaum waren sie eine kurze Strecke gefahren in Richtung Tiergarten, standen plötzlich Bewaffnete auf der Straße, hielten das Auto an und umringten es. Sie waren in der Überzahl und erklärten, sie gehörten zu Spartakus und den Revolutionären Obleuten. Sie holten Liebknecht aus dem Auto und erschossen seine Bewacher. Zwei seiner Befreier brachten Liebknecht in dem Auto in Sicherheit, die anderen schafften die toten Offiziere von der Straße, sodass auf den ersten Blick keine Spuren der Befreiung zu entdecken waren. Dann versteckten sie sich in der Nähe der Drehtür, behielten auch den Seiteneingang im Auge, und warteten ab. Liebknecht sorgte offenbar dafür, dass die Revolutionären Obleute Verstärkung schickten, um notfalls das Hotel in einem Überraschungsangriff zu stürmen. Aber bald sahen die Revolutionäre, dass Rosa Luxemburg durch den Hauptausgang zu einem Auto gebracht wurde. Runge schlug auch sie mit dem Gewehrkolben. Als sie bewusstlos zu Boden stürzte, versetzte Runge ihr noch einen Schlag. Die Bewacher schleppten sie dann zum Auto und fuhren los. Die Revolutionäre hielten auch diesen Wagen an, befreiten die bewusstlose Rosa Luxemburg, töteten ihre Bewacher und brachten die Verletzte unter falschem Namen in ein Krankenhaus. Dann verschwanden die Befreier. Der Berichterstatter schloss mit der Bemerkung, dass ihm die bewaffneten Arbeiter unbekannt gewesen seien.
Liebknecht und Luxemburg waren schon so gut wie tot. Aber dann tauchte das Schicksal auf in Gestalt bewaffneter Arbeiter. Die erschienen, befreiten die Arbeiterführer und verschwanden. So etwas gibt es nur im Krieg oder in einer Revolution.
Die Tür öffnete sich, Dserschinski kam und sagte: »Kommen Sie, der Genosse Lenin will Sie sehen.«
Zacharias bekam weiche Knie.
Im Hof wartete schon die Limousine mit dem Fahrer. Der Wagen verließ das Gebäude und fuhr langsam durch die schneebedeckten Straßen das kurze Stück zum Kreml. Es waren nur wenige Menschen unterwegs, die meisten abgerissen, dieser oder jener in Kleidung, die zeigte, dass er schon bessere Tage erlebt hatte. Immer wieder Bettler oder Frauen, die ein Glas saures Gemüse anboten oder einen halb faulen Apfel oder sich selbst. Bald würde die frühe Nacht alles verdunkeln, nur Arme, Bewaffnete oder Gruppen trauten sich dann noch auf die Straße. Ein alter Mann starrte ins Auto, sie ließen ihn langsam zurück mit seinem Hass in den Augen.
Als sie die Kremlpforte erreichten, verlangten Milizsoldaten die Ausweise, obwohl sie Dserschinski gewiss sofort erkannt hatten. Drinnen fuhren sie zu einem größeren Haus, dort empfing sie ein Mann im Frack. Er sah nicht nur aus wie ein Diener des Zaren. »Der hat schon dem Zaren gedient«, sagte Dserschinski, nachdem sie der Befrackte in einen Raum geführt hatte, wo sie warten sollten, bis sie zu Lenin gebracht wurden. Ein mächtiger weißer Kachelofen spendete Wärme. Dserschinski hatte die Verwunderung in Zacharias' Augen gesehen. Sie liefen im Zimmer umher, Zacharias tat es, weil er nervös war. Er betrachtete die Wände, Flecken zeigten, wo früher Bilder gehangen hatten. Das Mobiliar war verziert, aber offenbar nicht mehr vollständig. Dserschinski war in sich gekehrt. Woran mag er denken?, fragte Zacharias sich. Plant er schon die nächsten Schläge gegen die Feinde?
Eine zweite Tür öffnete sich, sie war eingelassen in die Wand. Eine kleine, hagere Frau winkte sie wortlos hinein. Zacharias folgte Dserschinski in Lenins Arbeitszimmer. An der Wand ein Porträt von Marx. Das Mobiliar war schlicht, ein Schreibtisch mit Stuhl, daran vorne anschließend ein Tisch mit zwei schweren Ledersesseln, neben einem Regal ein Ledersofa. Zacharias entdeckte auf dem Tisch eine Statuette, ein auf einem Darwin-Buch sitzender Schimpanse, in der Hand einen Menschenschädel, den er fragend betrachtete, die Finger am Mund. In einer Ecke dampfte ein Samowar.
Lenin war kleiner, als Zacharias ihn in Erinnerung hatte. Er hatte ihn Monate zuvor als Redner auf einer Versammlung im Petrograder Smolny gesehen. Lenin sah alt aus. Aber seine Augen strahlten, da ähnelten sie Rosas. Zacharias hatte gelesen über das Attentat auf Lenin ein paar Monate zuvor, und manche munkelten, mit seiner Gesundheit stehe es nicht gut.
Lenin erhob sich hinter dem Schreibtisch und kam ihnen einige Schritte entgegen. Er gab Dserschinski die Hand, dann Zacharias. Er hielt Zacharias' Hand einen Augenblick, Lenins war erstaunlich weich. Dann zeigte er auf die Sessel und bat sie, Platz zu nehmen. Zacharias hatte viel gehört von Lenins Rastlosigkeit und Willenskraft. Aber der Lenin, den er nun sah, zeigte die Spuren des Alters und der Erschöpfung, Ringe um müde Augen, eine wachsbleiche Haut, und seine Hände zitterten ein wenig. Zacharias mühte sich, nicht hinzuschauen.
»Nun, Genosse Dserschinski, hier haben wir also den Genossen Zacharias«, sagte Lenin. Er sprach, ohne seine Stimme zu heben. »Möchten Sie Tee?«
Zacharias schaute Dserschinski an, der nickte. »Gerne, Genosse Lenin.«
»Nehmen Sie sich.« Lenin zeigte auf Becher, eine Teedose und den Samowar.
Sie nahmen sich Becher, die neben dem Samowar standen.
»Möchten Sie Zucker?«, fragte Lenin.
»Gerne«, sagte Zacharias, um etwas zu sagen. Seine Befangenheit war ihm peinlich. Dserschinski warf ihm einen bösen Blick zu. Lenin stand auf, hob den Deckel von einer Dose und sagte: »Nicht einmal Zucker für meine Gäste haben wir. Warten Sie.« Er verließ den Raum mit der Zuckerdose in der Hand. Dserschinski starrte auf den Fußboden vor sich.
»Ich wusste nicht ...«
Dserschinski winkte ab, ohne ihn anzuschauen. Er musste Ähnliches schon einmal erlebt haben. Nach einer Weile öffnete sich die Tür, und Lenin kehrte zurück mit der Zuckerdose. »Der Genosse Swerdlow ist unersetzbar, wie wir alle wissen. Jetzt noch mehr als früher.« Lenin stellte die gefüllte Zuckerdose auf den Tisch und schaute Zacharias an. Der nahm sich reichlich Zucker, Dserschinski tat es ihm nach.
»Sie wissen, ich schätze die Genossin Luxemburg. Wir hatten früher Streit, waren ja gewissermaßen in einer Partei. Aber im Gegensatz zu anderen ist die Genossin Luxemburg unserer revolutionären Sache treu geblieben. Und doch gibt es weiterhin Widersprüche. Aber wenn wir die neue, revolutionäre Internationale aufbauen wollen, brauchen wir die deutschen Genossen, vor allem Liebknecht und Luxemburg. Niemand hat einen größeren Namen beim internationalen Proletariat.«
Dserschinski wollte etwas sagen. Es genügte ein freundlicher Blick Lenins, und Dserschinski schloss seinen Mund wieder.
»Genosse Zacharias«, sagte Lenin bedächtig. »Wenn die Deutschen keine Revolution machen, wird der Rest der Welt über uns herfallen. Sie werden uns vernichten, die Sowjetmacht beseitigen und diesen Zwerg Kerenski zurückholen oder vielleicht sogar ein Mitglied der Zarenfamilie, das wir übersehen haben. Ich sage Ihnen offen, das Schicksal unserer Revolution liegt in der Hand von Luxemburg und Liebknecht. Und ein klein wenig auch in Ihrer.«
Zacharias versuchte zu begreifen, was Lenin meinte. Es gelang ihm nicht, er fühlte sich klein und spürte den Druck der Verantwortung, die Lenin ihm auflud.
Als wüsste Lenin, was Zacharias fürchtete, sagte er: »Wir tun alle mehr, als wir können. Niemand hat uns gezeigt, wie man die Sowjetmacht aufbaut, die Tscheka oder die Rote Armee. Die Genossen Dserschinski und Trotzki haben aus dem Nichts großartige Organe unseres Staats geschaffen. Seien Sie sicher, dass die Genossen viele Nächte nicht geschlafen haben, weil sie fürchteten, ihrer Aufgabe nicht gewachsen zu sein.« Er schaute Zacharias freundlich an und musterte ihn gleichzeitig. In seinem Blick schien die Fortsetzung zu liegen: Auch ich schlafe nicht, weil ich nicht weiß, ob es richtig ist, was ich tue. Ob wir es überstehen werden. »Denken Sie an diese Komitees der Dorfarmut. Die sollten den Mittel- und den Großbauern Druck machen, damit diese Nahrungsmittel abliefern, statt sie zu horten. Wenn wir ehrlich sind, dann war die Gründung dieser Komitees ein Fehler. Wir haben das Gegenteil von dem erreicht, was wir bezweckten. Ob die Sowjetmacht überlebt, hängt nicht davon ab, dass sie keine Fehler macht, sondern davon, dass sie aus jedem Fehler sofort die richtige Lehre zieht. Wir haben keine Zeit.« Den letzten Satz sagte er leise. Er trank einen Schluck Tee und wiederholte: »Wir haben keine Zeit.«
Er stand auf, hängte seinen Daumen ins Knopfloch seines knittrigen schwarzen Jacketts und ging ein paar Schritte. Er drehte ihnen den Rücken zu und schaute aus dem Fenster. Es war längst dunkel geworden. »Der Genosse Dserschinski hat Sie empfohlen für diesen Auftrag. Sie kennen Rosa Luxemburg, Sie sind Deutscher, Sie sind Bolschewik geworden hier bei uns, Sie sind intelligent. Was Ihnen fehlt, ist Erfahrung. Die kann man Ihnen nicht beibringen. Wir sind Ihnen nicht gram« – dieses Wort sagte er auf Deutsch –, »wenn Sie Fehler machen. Wir sind es nur, wenn Sie nicht daraus lernen. Wenden Sie sich in Berlin an den Genossen Radek, er wird Sie unterrichten. Aber denken Sie daran, Sie sind kein Untergebener des Genossen Radek. Sie sind nur an Weisungen des Genossen Dserschinski gebunden und an das, was Ihnen Ihr Verstand rät. Ihr Auftrag besteht aus drei Teilen: Erstens, finden Sie heraus, was Rosa Luxemburg vorhat; zweitens, schützen Sie die Genossin vor Anschlägen der Konterrevolution; drittens, schlagen Sie uns vor, wie wir die deutsche Revolution unterstützen können: Propaganda, Waffen, Geld. Wie würden die deutschen Arbeiter reagieren, stünde unsere Rote Armee an der deutschen Grenze? Diese Frage mag Ihnen utopisch erscheinen. Aber bedenken Sie, es gibt nichts Utopischeres als unsere Revolution. Jedenfalls, wenn man sich zwei Jahre zurückversetzt. Wenn die Revolution bald auch in Polen siegt, dann haben wir eine gemeinsame Grenze mit Deutschland. Die Dinge in der Ukraine werden wir bald bereinigen.«
Dserschinski sagte nichts, obwohl Lenin den Auftrag für Zacharias weiter fasste, als der Tschekaleiter es getan hatte. Er war in sich versunken. Er hatte das alles schon oft gehört. Aber Zacharias beeindruckte es, wie Lenin seine Gedanken entwickelte, sachlich, ruhig und im Vertrauen darauf, dass er recht hatte. Er hatte an die Oktoberrevolution geglaubt, im Gegensatz zu einigen Mitgliedern des bolschewistischen Zentralkomitees, und er hatte recht behalten. Revolutionen geschehen nicht, die revolutionäre Partei macht sie. Die Revolution lässt sich datieren und planen wie die Offensive einer Armee an der Front. Es gibt revolutionäre Situationen, die kann man nutzen oder verstreichen lassen. Lenin hatte dazu einiges geschrieben.
»Sie fürchten, die deutschen Genossen könnten eine revolutionäre Situation nicht ausnutzen?«, fragte Zacharias.
Lenin nickte und schaute ihn freundlich an. »Ich sehe, Sie verstehen, was ich meine. Genau das fürchte ich. Unter uns: Die Kommunisten in Deutschland sind ein kleiner Haufen ohne klare Linie. Die Unabhängigen Sozialdemokraten dreschen revolutionäre Phrasen und tun nichts, außer dass sie Millionen von Arbeitern an sich binden und zum Nichtstun verdammen. Die Mehrheitssozialdemokratie drischt auch revolutionäre Phrasen – die Sozialisierung marschiert! –, aber sie ist die Speerspitze der Konterrevolution. Ebert wollte sogar die Monarchie retten! Trotzdem ist die SPD aus den Wahlen zur Nationalversammlung als stärkste Partei hervorgegangen. Aber wir wissen, wie schnell die Stimmung der Arbeiter umschlagen kann, wenn es uns gelingt, Ebert und Scheidemann zu entlarven.« Seine Stimme wurde scharf, und Zacharias hörte seinen Hass. »Diese sogenannten Sozialdemokraten setzen Freikorpstruppen gegen revolutionäre Arbeiter ein. Im Baltikum bekämpfen sie die Sowjetmacht. Und trotzdem folgen ihnen die Arbeiter immer noch.« Ungläubigkeit lag in seiner Stimme. Er setzte sich wieder hin und goss sich Tee nach. Dserschinski blinzelte. Es schien, als hätte er geschlafen. Aber Zacharias wusste, dass Dserschinski nicht schlief, sondern genau zuhörte. Lenin beugte sich ein Stück vor. »Sie berichten dem Genossen Dserschinski. Und der Genosse Feliks Edmundowitsch berichtet mir alles, was ihm wichtig erscheint.«
Dserschinski nickte. »Natürlich, Genosse Lenin«, sagte er. Er war hellwach.
Zacharias begriff, Lenin wollte möglichst viele verschiedene Berichte aus Deutschland haben, um nicht allein auf Radek angewiesen zu sein. Deutschland war für ihn das wichtigste Land der Welt.
»Gut, Genossen, ich danke Ihnen.« Lenin erhob sich. Er gab erst Dserschinski die Hand, dann Zacharias. Dessen Hand hielt er wieder etwas länger fest. Er zog ihn ein Stück zu sich und schaute ihm streng in die Augen. »Berichten Sie nur die Wahrheit, nur die Wahrheit«, sagte er eindringlich. »Es gibt so viele Lügen, und es gibt so viele Genossen, die wollen mir einen Gefallen tun, indem sie die Dinge in schönen Farben schildern. Die sollte man alle erschießen.« Er lächelte.
Dserschinski setzte Zacharias vor dem Hotel National ab. Am Eingang standen zwei Soldaten mit geschulterten Gewehren. Sie rauchten und schwatzten. Der eine schaute lange auf Zacharias' Dienstausweis, wahrscheinlich konnte er nicht lesen. Er hatte ein Bauerngesicht, das ständig grinste. Dann gab er Zacharias den Ausweis endlich zurück und sagte: »Gut, Genosse.« Als er den Mund öffnete, sah Zacharias Zahnlücken und braune Zahnstummel.
Im Hoteleingang stank eine Tranlampe. Niemand war am Empfang, aber Zacharias hatte den Zimmerschlüssel in der Manteltasche. Als er sein Zimmer betrat, hörte er es röcheln. Er erschrak, dann fasste er an seine Pistolentasche und starrte in die Dunkelheit. Langsam sah er Umrisse. Auf seinem Bett lag einer, er schnarchte. Das Hotel war voll belegt mit Funktionären, die in Moskau zu verhandeln hatten mit dem Exekutivkomitee des Sowjets, mit Regierungs- oder Parteistellen. Es geschah oft, dass die Hotelleitung Zimmer mehrfach belegte, weil sie nichts mehr frei hatte. Die Genossen sollten sehen, wie sie damit klarkamen. Zacharias fand unterm Bett eine Decke, breitete seinen Mantel auf dem Boden aus und legte seinen Kopf auf die Aktentasche. Führende Genossen hatten es besser, sie lebten hier in Suiten und mit Frauen, die einem offiziell abgeschafften Gewerbe nachgingen.
Der Mann in seinem Bett begann wieder zu röcheln und zu prusten. Aber nicht die Geräusche hinderten Zacharias zu schlafen, sondern der Nachklang seiner Begegnung mit Lenin. An dem kleinen Mann mit Glatze und der kranken Gesichtsfarbe hing der Sowjetstaat. Ohne Lenin keine Revolution, und stürbe er jetzt, dann würde die Diktatur hinweggefegt binnen weniger Wochen. Es war ein Wunder, dass sie bis heute standgehalten hatte. Gedanken lösten sich ab, ohne Sinn und Zusammenhang. So meldete sich die Erschöpfung. Doch dann kam die Erinnerung an Margarete. Wo mochte sie sein? Wie lebte sie? Hatte sie einen anderen geheiratet? Als er in den Krieg gezogen war, hatte sie versprochen, auf ihn zu warten. So, wie es alle Frauen allen Soldaten versprechen. Das Leben hält sich nicht an Versprechen.
***
Irgendwann wälzte er sich endlich in den Schlaf. Als er am Morgen aufwachte, war der Mann im Bett verschwunden, und die Knochen schmerzten. Er streckte sich und machte ein paar Kniebeugen. Dann wusch er sich und ging in den Essraum. Es gab hartes Brot, das nach Sägemehl schmeckte, und einen ranzigen Aufstrich, der ihn bitter aufstoßen ließ. Der Tee schien aus Rinde gebraut worden zu sein. Aber er wusste, für die meisten Menschen in Russland wäre dies ein Festmahl gewesen. Der Hunger war Feind Nummer eins der Revolution. Unter ihm litten nur die wichtigsten Funktionäre nicht. Die Führung durfte nicht hungern. Diese Funktionäre erhielten Versorgungspakete und sie durften in eigens für sie eingerichteten Restaurants speisen.
An den anderen Tischen palaverten Funktionäre, die warteten, wie das Warten überhaupt zur Hauptbeschäftigung der Funktionäre geworden war, die aus der Provinz in die Hauptstadt kamen. Termine wurden nicht eingehalten, Besuchszeiten waren unverbindlich. Alle arbeiteten, bis sie umfielen vor Müdigkeit, aber oft ohne Plan und Organisation. Sie folgten Eingebungen, rasten in diese Fabrik oder in jene Versammlung, beruhigten empörte Arbeiter, beendeten Streiks und beruhigten verwirrte Kommunisten, die nicht mehr ein und aus wussten. Eigentlich klappte so gut wie nichts, ausgenommen bei der Tscheka und der Roten Armee. Es ist leichter, Befehle zu geben, als den Sozialismus aufzubauen in einem Land, in dem es nur eine Handvoll Sozialisten gab und in dem nicht einmal diese so genau wussten, was sie wollten.
Dserschinski erwartete ihn erst am Nachmittag zur Abschlussbesprechung, so hatte Zacharias Zeit, seine paar Sachen zusammenzupacken. Er zerbrach sich den Kopf, wie er nach Deutschland kommen könnte. Durch Polen war der kürzeste Weg. Aber die Polen würden so einen wie ihn zurückweisen oder verhaften. Und eine Reise durch die Ukraine könnte gefährlich sein. Mit dem Schiff über Schweden käme er bis nach Hamburg oder Kiel, aber an der Grenzkontrolle würde es gefährlich, sobald der Verdacht aufkäme, er sei ein Abgesandter der Bolschewiki. Zacharias spürte die Unruhe, dachte an die Menschen, die er vielleicht in Berlin wiedertreffen würde. Würde er seinen Auftrag erfüllen können? Was hatte Lenin und Dserschinski auf die Idee gebracht, einem jungen Kerl wie ihm eine solche Weisung zu geben?
Dass es ihn überhaupt hierher verschlagen hatte, ins Zentrum der Weltrevolution, wie manche Bolschewiki stolz sagten. Dass er Lenin kennengelernt hatte, dass der ihm einen Auftrag gegeben hatte, einen so wichtigen Auftrag, der ihn den Führern der Kommunistischen Partei Deutschlands nahe bringen würde. Ein Auftrag, der ihn schwindelig machte. Warum er? Sie hatten keinen anderen gefunden, der Bolschewik war, sogar in der Tscheka gedient hatte und Rosa kannte. Das war ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Wer in einer Arbeiterfamilie aufwächst, träumt nicht von Höherem. Nicht davon, mit Menschen zu verkehren, die Geschichte machten. Sein Vater hatte es als größtmögliche Ehre empfunden, als Bebel einmal bei einem Parteitag ein paar Worte mit ihm wechselte. Er erzählte oft davon, wie freundlich der Arbeiterkaiser gewesen sei und dass der alles genau wissen wollte über die Arbeit, die Wohnung, die Familie. Zacharias hatte sich damals nichts anderes vorstellen können, als Metallarbeiter zu werden wie der Vater. Er hatte seine Lehre gemacht, seine Kollegen achteten ihn, weil er fleißig war und genau. Aber dann hatte ihn der Krieg herausgerissen aus seiner Welt. Er wollte Margarete noch schnell heiraten, aber sie sagte aus irgendeinem Grund, sie werde warten, sie sollten nichts überstürzen, sie kennten sich doch noch nicht so lange.
Zacharias legte sich aufs Bett und starrte an die Decke. Sobald er still lag, begann es zu jucken. Er kratzte sich instinktiv, die Läuse begleiteten ihn seit dem Krieg. Er mühte sich wieder, Bilder der Vorkriegszeit in seine Erinnerung zu heben. Aber sie waren vernebelt, und er ahnte, was er sah, hatte sich verselbstständigt, war mehr eine Illusion als Wahrheit.
Es schneite dicke Flocken. Ein Wagen brachte ihn zur Bolschaja Lubjanka 11, vor Kurzem noch Sitz der Versicherungsgesellschaft Jakor, jetzt Hauptquartier der Tscheka. Zacharias benutzte einen Nebeneingang für Kader und passierte die Eingangskontrolle. Er brachte das Gepäck in ein Wartezimmer, setzte sich an den Tisch und legte die Füße hoch. Nur selten war er hier gewesen, in seiner Moskauer Tscheka-Zeit war er die meiste Zeit auf der Jagd nach Feinden gewesen, die sie manchmal herbrachten zum Verhör oder gleich vor Ort liquidierten. Nachts verfolgten ihn die Augen und der Geruch der Angst. Die leisen Gebete der Popen. Das ungläubige Staunen von Bauern, denen vorgeworfen wurde, Getreide zu horten, und die dafür ihr Leben verlieren sollten. Frauen, die um das Leben ihrer Männer jammerten, kreischende Kinder. Geiseln, die für andere büßen sollten und in deren Augen der Irrsinn stand.
Zuletzt war Zacharias stellvertretender Zugführer gewesen. Je höher man stieg, desto größer die Verantwortung. Und die Schuld, die man sich auflud einer größeren Sache wegen. Weil die Sowjetmacht überleben musste. Um jeden Preis. Um wirklich jeden Preis. Weil sie keine Zeit hatten für Untersuchungen und Gerichtsverfahren, wenn ihnen die Dinge klar schienen. Er redete sich ein, Unrecht zu tun, um schlimmeres Unrecht zu verhindern. Die Geschichte der Menschen beginnt neu, und sie waren die, die die Geschichte machten. Da darf man nicht viel reden, sondern muss handeln.
Dann klopfte es an seiner Tür. Ein Tschekist rief ihn zu Dserschinski. Der saß hinter seinem Schreibtisch und wies auf den Stuhl davor. Als Zacharias saß, schaute Dserschinski ihn an, lächelte kurz und sagte: »Sie haben sich gewiss überlegt, wie Sie nach Deutschland reisen können.« Er machte eine kurze Pause, dann sagte er: »Das ist der einfachste Teil Ihres Auftrags. Sie reisen als entlassener Kriegsgefangener über Riga. Von dort fahren Schiffe nach Kiel oder Hamburg. Eines wird Sie mitnehmen.«
Zacharias lachte.
Dserschinski schaute ihn stirnrunzelnd an, dann lachte auch er. »Sie haben sich wahrscheinlich überlegt, wie Sie im Kugelhagel polnischer Grenzer nach Deutschland robben.«
»Ja, Genosse Dserschinski.«
»Das ist typisch für unsere Bolschewiken. Sie sind verwegen und denken um drei Ecken. Wir haben Ihr Soldbuch verwahrt.« Er nahm es von einem Stapel auf seinem Schreibtisch, und Zacharias fühlte sich einen Augenblick, als kehrte der Krieg zurück. Zögernd nahm er das Buch. Dserschinski merkte es, aber er sagte nichts. Als Zacharias das Buch zum ersten Mal bekommen hatte, war er überzeugt gewesen, die Heimat zu verteidigen gegen Russen und Franzosen. Das sagten die Genossen in der Partei und in den Gewerkschaften. Er hörte zwar, Luxemburg, Liebknecht und wenige andere erklärten, Deutschland führe einen imperialistischen Krieg, aber Rosa war immer anderer Meinung als der Parteivorstand, und die Gewerkschaften hasste sie sowieso. Außerdem kam sie aus Russland, jedenfalls aus dem Teil Polens, der zu Russland gehörte. Sollten sie es zulassen, dass russische Soldaten in Berlin einmarschierten und französische in Köln?
»Das Buch erinnert Sie an etwas? An Ihr früheres Leben?«
Warum erriet Dserschinski immer, was Zacharias dachte? »Es erinnert mich an Fehler, an meine Leichtgläubigkeit. An den Anfang des Kriegs.«
»Damals irrten fast alle bis auf den Genossen Lenin. Der hatte immer recht. Als er forderte, den Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, als er die Revolution plante und als er den Frieden von Brest-Litowsk durchsetzte gegen die Mehrheit des Zentralkomitees. Wir haben das Glück, einen solchen Führer zu besitzen. Und die anderen revolutionären Parteien haben das Pech, solche Führer nicht zu besitzen.« Er schwieg eine Weile, und vielleicht betrachtete er vor seinem inneren Auge die Führer der Oktoberrevolution. Wer von ihnen könnte Lenin ersetzen? »Außer Rosa Luxemburg vielleicht und Leo Jogiches, wenn der nicht so ein Hinterzimmerrevolutionär wäre.« Er schaute Zacharias an. »Sie kennen Jogiches nicht, das ist kein Wunder. Er hält sich im Hintergrund. Man schaut auf Luxemburg, auf Liebknecht, vielleicht noch auf Clara Zetkin und Franz Mehring. Aber Jogiches kennt kaum einer. Dabei ist er der Organisator der Spartakusgruppe gewesen und jetzt der kommunistischen Partei. Er ist, wie soll ich es sagen, der Gefährte der Genossin Luxemburg. Nein, nein, nicht so, wie Sie es vielleicht verstanden haben, das war früher einmal. Er ist das Korrektiv der Genossin Luxemburg und derjenige, der ihre Ideen verwirklicht. Man könnte auch sagen, der Einzige, von dem sie sich was sagen lässt.« Er lächelte, offenbar erinnerte er sich an etwas. »Sie müssen wissen, die Genossin Luxemburg ist so klug wie uneinsichtig. Sie ist unbestechlich und von nichts zu überzeugen, das sie sich nicht selbst ausgedacht hat. Sie hat die polnische Sozialdemokratie programmatisch geprägt und war ihre herausragende Propagandistin. Sie kam nach Deutschland und war binnen Kurzem eine Größe. Sie ist rastlos, eigensinnig, aber treu ihren Freunden gegenüber, wenn diese Rosas Vorrang anerkennen. Wenn Sie anfingen, sie von den Segnungen des Bolschewismus überzeugen zu wollen, dann würde sie Sie anhören und danach genüsslich in der Luft zerreißen. Sie hat den Revisionisten Bernstein in einer Weise verprügelt, dass der sich bis zu seinem Lebensende nicht erholen wird davon. Sie sollten diese Schriften lesen.«
»Das gegen Bernstein habe ich gelesen und manches andere in der Parteipresse auch.«
Dserschinski winkte ab. »Immerhin«, sagte er. Es klang, als freute er sich, keinem hoffnungslosen Fall gegenüberzusitzen. »Wir alle wissen, dass Bolschewismus und Diktatur die Garanten unserer Revolution sind. Die Genossin Luxemburg lehnt beides ab. Sie hat darüber im Gefängnis eine Schrift verfasst. Versuchen Sie zu verhindern, dass diese Schrift erscheint. Im Namen der Solidarität mit der russischen Revolution. Weil man dem Klassenfeind keine Munition liefert. Weil sie sich besser unterrichten sollte, zum Beispiel indem sie nach Russland reist. Der Genosse Lenin würde sie gerne empfangen mit allen Ehren. Wir haben Bürgerkrieg, und es fehlte uns noch, dass die Menschewiki Argumente aus unserem Lager gegen uns erhalten.« Er goss beiden Tee ein. Dann stand er auf, kratzte sich am Kinnbart und sagte: »Und noch etwas. Wenn die Revolution in Deutschland siegt, dann wird die neue Internationale, die wir in wenigen Wochen gründen werden, ihren Sitz in Berlin haben. Wenn die deutschen Kommunisten sich nicht unseren Auffassungen annähern, dann gibt es« – er suchte das Wort, fand es aber nicht. »Wir müssen dafür kämpfen, dass die Lehren des Bolschewismus überall anerkannt werden. Natürlich ergänzt durch die Erfahrungen unserer deutschen Genossen. Aber wir haben die Revolution gemacht, die anderen werden folgen, und zwar unserem Beispiel. Auch in Deutschland haben die Arbeiter und Soldaten Räte gegründet, wie wir unsere Sowjets. Und ohne Diktatur werden die Kommunisten auch in Deutschland die Konterrevolutionäre nicht niederringen können. Wer, wenn nicht eine deutsche Rote Armee und eine deutsche Tscheka soll die Freikorps und sonstigen Mörderbanden bekämpfen? Wir hoffen, die Genossin Luxemburg entdeckt diese Wahrheit auch. Wenn möglich, nicht zu spät. Sie muss ja immer alles selbst erfinden. Soll sie es. Aber Sie werden ihr dabei helfen. Radek steht in der Hinsicht auf aussichtslosem Posten, die Genossin Luxemburg hasst ihn wegen alter Parteikämpfe, sie wollte ihn nicht nur aus der polnischen, sondern auch aus der deutschen Sozialdemokratie hinauswerfen. Und nun ist der Genosse Radek Lenins Vertrauter in Deutschland. Das macht Ihre Aufgabe nicht leichter.«
Dserschinski stand auf, Zacharias wertete es als Zeichen, dass die Einweisung beendet war. »Noch etwas«, sagte Dserschinski. Er öffnete ein Schreibtischschubfach und holte einen Ledergürtel hervor. Er zeigte Zacharias die Innenseite, da waren kleine Taschen eingearbeitet. Dserschinski öffnete eine Tasche, eine Goldmünze glänzte. »Den Gürtel haben wir in der deutschen Botschaft gefunden. Nehmen Sie ihn mit, die Genossen in Berlin können das Gold bestimmt brauchen. Es ist die einzige Währung, die die Inflation nicht auffrisst.«
Kapitel 3
Er stand vor dem Mietshaus in der Pflügerstraße 32 in Berlin-Neukölln. Der Name stand an der Tür. Seine Hände wurden nass. Er schlug den Eisenklöppel gegen den an der Tür angeschraubten Sockel und wartete. Erst nichts, dann ein Schlurfen. Ein Brauereiwagen fuhr die Kopfsteinpflasterstraße hinunter, der Kutscher rief: »Ho-ho!« Aber das Pferd klapperte so langsam wie zuvor vor sich hin, es schüttelte bedächtig die Mähne. Zacharias suchte mit den Augen die Straße ab, ob Menschen lauerten, das Pferd zu töten und es auf der Straße zu zerfleischen, wie er es in Moskau gesehen hatte. Da öffnete sich die Haustür. Eine Frau mit weißen Haaren schaute ihn an mit großen Augen, dann quollen Tränen hervor. Sie sagte nichts, ging einen Schritt auf ihn zu, fasste ihn an den Schultern und starrte ihm ins Gesicht. Dann umarmte sie ihn. Er spürte ihre Knochen, sie fühlte sich hart an durch die schwere Kleidung. »Sebastian«, sagte sie. Ein Kloß saß ihm im Hals. Dann ließ sie ihn los und schaute ihn wieder an. »Dünn bist du geworden. Komm rein.« Sie ging vor zur Wohnungstür im Erdgeschoss.
»Warum ist die Haustür abgeschlossen?«, fragte Zacharias, um etwas zu sagen. Der Schreck über den Anblick der Mutter lähmte ihn fast. Sie hatte schwarzes Haar gehabt, als Zacharias in den Krieg gezogen war, und ihre Knochen hatte er nie gespürt. Auch schien sie ihm kleiner, unter den Augen hingen Tränensäcke. Die Warze am Kinn war gewachsen.
Die Mutter schaute ihn traurig an. »Es ist alles anders geworden. Der Krieg, der Hunger. Die Leute stehlen wie die Raben, da muss man die Häuser abschließen, auch am Tag.«
Sie führte ihn in die Küche. Er sah, dass sie schlurfte. Die Küche war so, wie er sie in Erinnerung hatte. Aber es war kalt, im Ofen brannte kein Feuer. Davor lagen in einem Korb zwei Stücke Holz. Gleich öffnete die Mutter die Ofenklappe.
»Nein«, sagte Zacharias. »In Russland ist es noch kälter.« Er wusste, es gab nur wenig Brennmaterial in Berlin. »Wo ist Vater?«
Sie schaute ihn traurig an und faltete ihre Hände verkrampft. »Du weißt es ja noch nicht. Er ist gestorben, Typhus. Im Hungerwinter 1917 wurde er krank, es dauerte nicht lange, am 2. Januar haben wir ihn beerdigt.« Vor gut einem Jahr also.
Er schluckte. Dieser verdammte Krieg. Diese Verbrecher, die ihn angezettelt hatten, großkotzig und menschenverachtend. Sie befahlen jeden Tag Tausende in den Tod und fanden es herrlich, am Anfang jedenfalls. Vor Langemark schickten sie Schüler und Studenten singend in die Maschinengewehrsalven des Feinds. Sie nannten es Heldentum. Und in der Heimat hungerten sich die Menschen ins Grab. Aber dann wich der Zorn und Zacharias war nur noch traurig. Er rief sich das Bild seines Vaters in Erinnerung. Seine Kollegen in den Tegeler Borsig-Werken achteten ihn und wählten ihn immer wieder als gewerkschaftlichen Vertrauensmann. Zacharias legte sein Gesicht in seine Hände und verharrte eine Weile so. Episoden mit dem Vater fielen ihm ein. Weihnachten vor vielen Jahren, eine Holzeisenbahn unterm Weihnachtsbaum, und der Vater spielte mit. Oder wenn Besuch kam, Arbeitskollegen des Vaters, die über Bebel sprachen und auf die Opportunisten schimpften. Eine Kanne Bier holen für den Vater. Einmal durfte der kleine Sebastian am Glas nippen, und gleich wurde ihm schlecht. Der Qualm der Sonntagszigarre, über den die Mutter jedes Mal schimpfte, woraufhin der Vater nur lächelte und genüsslich am Fehlfarbstumpen sog. Noch mehr Rauchwolken, noch mehr Gestank.
Die Mutter hatte sich neben Zacharias' Stuhl gestellt und strich ihm vorsichtig übers Haar. »Aber du lebst«, wiederholte sie. »Vater hat oft überlegt, wo du sein könntest. Und er hatte solche Angst, du könntest gefallen sein. Kaum einer hier ist ohne Gefallenen in der Familie. Es war schrecklich, als der Brief kam, du seiest vermisst.«
Er schaute der Mutter ins Gesicht. Sie war so alt geworden. »Und Renate?«
»Die hat vorletztes Jahr geheiratet, den Günther Bäumer. Den kennst du doch noch, der wohnte hier im Viertel, in der Glogauer Straße. Eine Woche nach der Hochzeit hat sie den Brief bekommen. Gefallen an der Westfront. Sie ist fast verrückt geworden. Hat viele Tage nur geweint und nicht gesprochen. Man konnte zuschauen, wie sie verfiel. Ein halbes Jahr später ist sie gestorben, Lungenentzündung. Sie war völlig entkräftet und ohne Hoffnung. Da hatte die Entzündung leichtes Spiel. Vielleicht tröstet es dich, sie hat es so gewollt. Davon bin ich überzeugt.« Die Stimme der Mutter klang rau. Sie räusperte sich. Dann legte sie ihm die Hand auf die Schulter und wiederholte: »Aber du lebst.«
Er schaute sich um in der Küche, ohne etwas zu sehen. Ich hätte in Russland bleiben sollen. Der Gedanke schien auf, dann sah er wieder die Bilder der Menschen, die er getötet hatte, und der Gedanke verschwand. Er war nicht vorbereitet gewesen auf das Elend zu Hause. Er hatte immer noch die Bilder einer Vergangenheit im Kopf, die ihm nun unwirklich vorkam.
»Sebastian, ich koche uns einen Kaffee, und ein Stück Brot habe ich auch, oder was man heute Brot nennt.« Ihr Ton ließ keinen Widerspruch zu. Während die Mutter Feuer im Ofen entzündete, versuchte Zacharias zu begreifen, was sie ihm erzählt hatte. Es war blauäugig zu glauben, der Krieg würde ausgerechnet seine Familie nicht zerstören, wo er doch Millionen von Familien in allen Krieg führenden Ländern zerstört hatte. Millionen Ehemänner, Verlobte, Freunde, Brüder waren erschossen, zerquetscht, zersprengt, erstochen worden. In der Heimat waren sie an Hunger, Diphtherie, Tuberkulose, Grippe gestorben.
Die Mutter schloss die Ofenklappe, es roch nach Papierrauch. Sie nahm vom Brett an der Wand eine Blechdose und gab etwas daraus in eine Kanne. Dann füllte sie den Wasserkessel und stellte ihn auf den Herd. »Zichorie«, sagte sie, als müsste sie sich entschuldigen.
Zacharias hatte die Frage nach Margarete auf der Zunge, aber er traute sich nicht. Wenn sie auch tot war? Aber dann fragte er doch: »Und Margarete, lebt sie noch?«
»Ich glaube schon, aber sicher bin ich nicht. Als keine Briefe mehr von dir kamen, ist sie anfangs oft hier gewesen und hat nach dir gefragt. Wir wussten ja auch nichts.« Sie hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. »Irgendwann blieb sie weg. Ich kann es verstehen. Wir mussten sie immer enttäuschen.«
Als der Ersatzkaffee fertig war, saßen sie schweigend am Tisch. Er war versunken in Erinnerungen. Wann hatte er den Vater zum letzten Mal gesehen? Am Morgen seiner Einberufung. »Jetzt, wo du zu Kaisers gehst, bin ich beruhigt, die Russen werden nicht in Berlin einmarschieren.« Es war ein Scherz. Der Vater hatte ihn lange angeschaut und ihn dann kurz in den Arm genommen. Das hatte er noch nie getan. In seinen Augen hatte es geglänzt, und als er zur Arbeit ging, schlug er die Tür lauter zu als sonst. Und die Schwester? Die hatte geweint. Um sie zu beruhigen, hatte Zacharias gesagt: »Ich komme gar nicht mehr an die Front. Wenn die mich geschliffen haben, ist der Krieg vorbei.«
»Bestimmt?«, hatte Renate gefragt.
»Steht sogar im Vorwärts, dass die Franzosen die Hosen voll haben. Sie rennen weg, und wir sind bald in Paris.«
Er fragte sich, ob er es geglaubt hatte. Ja und nein. Er hatte es gehofft. Aber bald war die Hoffnung verflogen, die Franzosen rannten nicht weg, sie gruben sich ein wie die Deutschen auch.
Jetzt erst spürte er die Müdigkeit. Die Reise war ohne Schwierigkeiten verlaufen, aber auf der Schiffspassage von Riga nach Hamburg hatte er sich einige Male übergeben müssen wegen der rauen See. Die Mutter schmierte Brote mit Margarine. »Viele haben nicht mal mehr das«, sagte sie.
Er trank und aß. »Kriegst du eine Rente?«
»Nein«, sagte die Mutter. »Nur wenn ich selbst ein Krüppel wäre. Wäre der Krieg nicht gewesen, dann wären der Vater und Renate noch am Leben.«
Ja, hätte es doch keinen Krieg gegeben. Er hat alles zerstört, und nicht einmal die Sieger haben etwas gewonnen. Zacharias dachte an die ersten Tage des Kriegs, so viele waren begeistert gewesen, aber nicht alle. Auch mancher, der jubelte, schrie umso lauter, je näher die Angst ihm rückte. Damals glaubten fast alle, Deutschland müsse sich verteidigen gegen Russland, den Hort der Reaktion. Siegte der Zar, gäbe es nichts mehr von dem bisschen Freiheit und würden die Organisationen der Arbeiter unterdrückt. Wenn es gegen Russland ging, hätte selbst Bebel den Schießprügel geschultert. Das hörten sie und lasen es damals in den sozialdemokratischen Zeitungen. Aber Bebel war lange tot, und Deutschland hatte sich nicht verteidigt, sondern angegriffen, vor allem die Habsburger ermutigt, mit den Serben abzurechnen, weil die angeblich schuld waren am Attentat auf den Thronfolger und seine Frau. Sie waren belogen worden.
Die Mutter saß ihm gegenüber und schaute ihn an. »Was willst du nun tun? Wie war es in Russland? Erzähl!«
»In Russland war es kalt, und die Menschen haben noch weniger zu essen als hier. Aber sie haben den Zaren verjagt und eine Revolution gemacht für die Arbeiter und die Bauern. Noch geht es drunter und drüber, aber wir werden das schon schaffen.«
»Wir?«
»Ja, ich auch. Ich habe mitgemacht, und ich bin stolz, dass ich es durfte.«
»Revolution gab es hier auch«, sagte die Mutter. Es schien ihr egal zu sein, jedenfalls klang sie unbeteiligt.
»Aber sie ist auf halbem Weg stecken geblieben. Vielleicht hätte Vater es auch so gesehen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls machen sie überall Jagd auf Spartakisten, und sie schießen sie tot. Was willst du nun tun? Es gibt so viele Soldaten, die Arbeit suchen.« Sie sah so alt aus und so müde.
Er schüttelte den Kopf. »Ich will helfen, die Revolution weiterzuführen, bis sie ihren Namen verdient.«
Die Mutter schaute ihn traurig an. »Noch mehr Tote, noch mehr Elend. In Russland gibt's doch auch nur Mord und Totschlag. Das sagen alle.«