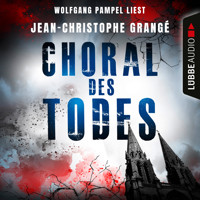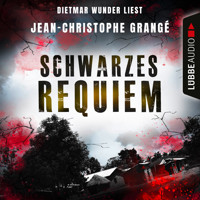7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Atemberaubende Spannung von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1
- Sprache: Deutsch
Beginne nie eine Brieffreundschaft mit einem Mörder. Eines Tages will er dich kennenlernen ...
Der Serienmörder Jaques Reverdi wartet im Gefängnis von Malaysia auf sein Urteil. Wie eine Blutspur ziehen sich seine grausamen Ritualmorde durch Südostasien. Der Pariser Sensationsreporter Mark Dupeyrat will einen Bestseller über diesen Mann schreiben. Als "Elisabeth" nimmt er schriftlich Kontakt mit Reverdi auf, um sich dessen makabres Universum zu erschließen. Als der Mörder Feuer fängt und sich sogar in die unbekannte Briefeschreiberin verliebt, schickt Mark ihm ein Foto seiner Bekannten Khadidscha. Doch dann entkommt Reverdi aus dem Gefängnis - und für Mark und Khadidscha beginnt ein Alptraum ...
»Jean-Christophe Grangé begibt sich in die Abgründe der menschlichen Seele.« HR-ONLINE
Weitere spannende Meisterwerke des Thriller-Genies Jean-Christophe Grangé bei beTHRILLED:
Der Flug der Störche
Der steinerne Kreis
Das Imperium der Wölfe
Das Herz der Hölle
Choral des Todes
Der Ursprung des Bösen
Die Wahrheit des Blutes
Purpurne Rache
Schwarzes Requiem
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Der Kontakt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Die Reise
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Die Rückkehr
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Der Serienmörder Jaques Reverdi wartet im Gefängnis von Malaysia auf sein Urteil. Wie eine Blutspur ziehen sich seine grausamen Ritualmorde durch Südostasien. Der Pariser Sensationsreporter Mark Dupeyrat will einen Bestseller über diesen Mann schreiben. Als »Elisabeth« nimmt er schriftlich Kontakt mit Reverdi auf, um sich dessen makabres Universum zu erschließen. Als der Mörder Feuer fängt und sich sogar in die unbekannte Briefeschreiberin verliebt, schickt Mark ihm ein Foto seiner Bekannten Khadidscha. Doch dann entkommt Reverdi aus dem Gefängnis - und für Mark und Khadidscha beginnt ein Alptraum …
Jean-Christophe Grangé
Das Schwarze Blut
Roman
Aus dem Französischen von Barbara Schaden
Für Priscilla
Der Kontakt
Kapitel 1
Der Bambus.
Auf Dschungelpfaden und zwischen raschelnden Blätterwänden hatte er ihn bis hierher geführt. Wie immer hatten ihm die Bäume die Richtung gewiesen, der er folgen musste – und hatten ihm zugeraunt, was er zu tun hatte. So war es immer gewesen. In Kambodscha. In Thailand. Und jetzt hier, in Malaysia. Die Blätter streiften sein Gesicht, riefen ihn, gaben ihm das Signal …
Doch auf einmal wandten die Bäume sich gegen ihn.
Auf einmal stellten sie ihm eine Falle. Er wusste nicht, wie ihm geschah – die Stämme des Bambuswalds waren zusammengerückt, standen in Reih und Glied, hatten sich in eine hermetisch verschlossene Zelle verwandelt.
Mit den Fingern fuhr er die Tür entlang, versuchte sie unter die Kante zu schieben. Unmöglich. Er scharrte auf dem Fußboden in der Hoffnung, die Bretter auseinander zu schieben. Vergeblich. Er hob den Blick und sah über sich nichts als ein dichtes Dach aus Palmenblättern. Wie lange hatte er nicht geatmet? Eine Minute? Zwei Minuten?
Eine Bruthitze herrschte hier, wie in einem Backofen. Sein Gesicht troff von Schweiß. Er konzentrierte sich auf die Wand: Rattanhalme verstopften jede Ritze. Wenn es ihm gelang, eine dieser Fasern zu lösen, käme vielleicht ein wenig Luft herein. Mit zwei Fingern versuchte er es – aber es war nichts zu machen. Er krallte sich in die Wand und zerschrammte sich dabei nur die Nägel. Wütend hämmerte er mit der Faust dagegen und ließ sich auf die Knie fallen. Er würde krepieren. Er, der Meister des Freitauchens, er würde in dieser Hütte ersticken.
Dann fiel ihm die eigentliche Gefahr wieder ein. Er warf einen Blick über die Schulter: Dunkle Schlieren kamen auf ihn zu; langsam, schwer, wie Ströme von Teer. Das Blut. Es würde ihn bald erreichen, überschwemmen, ertränken …
Stöhnend presste er sich an die Wand. Je mehr er sich bewegte, desto mehr wuchs der Drang zu atmen – eine Gier nach Luft, die seine Lungen marterte und ihm wie eine giftige Blase in die Kehle stieg.
Er kauerte sich nieder und folgte der unteren Kante der Wand in der Hoffnung, eine kleine Lücke zu entdecken. Während er sich auf allen vieren vorwärts bewegte, blickte er noch einmal zurück. Das Blut war nur noch wenige Zentimeter entfernt. Er schrie auf, rücklings an die Wand gedrückt, stemmte die Fersen in den Boden und versuchte zurückzuweichen.
Die Wand hinter ihm gab nach. Ein mächtiger Schwall weißes Licht drang in die Zelle, gemischt mit Stroh und Staub. Hände rissen ihn vom Boden hoch. Er hörte Schreie, Befehle auf Malaiisch. Von unten sah er die Palmen, den grauen Strand, das tief blaue Meer. Er japste nach Luft. Es roch nach Fisch. Zwei Namen schossen ihm durch den Kopf: Papan, Chinesisches Meer …
Die Hände schleppten ihn fort, während die Männer sich über die Schwelle der Strohhütte beugten. Fäuste schlugen auf ihn ein, Harpunen stachen ihn. Er nahm es gleichgültig hin. Er hatte nur einen Gedanken: Jetzt, da er frei war, wollte er sie sehen.
Die Quelle des Blutes.
Die Bewohnerin des Zwielichts.
Er blickte zu der herausgerissenen Tür hinüber. Im Hintergrund war eine nackte junge Frau an einen behelfsmäßigen Pranger gefesselt. Ihr Körper war übersät von Wunden – an den Schenkeln, den Armen, am Rumpf, im Gesicht. Jemand hatte sie ausbluten lassen. Hatte sie aufgeschlitzt und dafür gesorgt, dass sich ihr Blut in langsamen, unaufhaltsamen Rinnsalen auf den Boden ergoss.
Im selben Moment überkam ihn die Erkenntnis: Diese Obszönität war sein Werk. Über die Schreie, die Schläge hinweg, die ihn ins Gesicht trafen, gestand er sich die entsetzliche Wahrheit ein.
Er war der Mörder.
Der Urheber des Gemetzels.
Er wandte den Blick ab. Die Horde der Fischer zerrte ihn wütend zum Strand hinunter.
Durch den Tränenschleier sah er an einem Ast das Seil baumeln.
Kapitel 2
[Exklusivbericht]
EIN MASSENMÖRDER IN DEN TROPEN?
7. Februar 2003. Elf Uhr Ortszeit. In Papan, einem kleinen Dorf im Sultanat Johor an der Südostküste der Malaiischen Halbinsel, ist es ein Tag wie jeder andere. Touristen, Händler, Seeleute begegnen einander auf der Straße entlang dem endlosen Strand aus grauem Sand. Auf einmal erhebt sich Geschrei. Ein Aufruhr von Fischern unter den Palmen. Etliche sind bewaffnet: Stöcke, Harpunen, Messer …
Sie biegen in den Pfad am Ende des Strands ein, der zum Wald hinaufführt. In ihren Augen glimmt der Hass, in ihren Mienen steht Mordlust geschrieben. Bald erreichen sie den nächsten Hügel, wo der eigentliche Dschungel einem Bambuswald weicht. Jetzt zwingen sie sich zur Ruhe, sie marschieren stumm weiter. Sie haben entdeckt, was sie suchten: das getarnte Dach einer Hütte. Sie nähern sich. Die Tür ist verschlossen. Ohne zu zögern rammen sie ihre Harpunen hinein und reißen sie heraus.
Was sie sehen, ist ein Anblick aus der Hölle. Ein Mann, ein mat salleh (ein Weißer), kauert mit nacktem Oberkörper halb besinnungslos vor der Türschwelle. Im hinteren Teil der Hütte ist eine Frau an einen Sitz gefesselt, ihr Körper ist eine einzige blutende Wunde. Zu ihren Füßen liegt die Tatwaffe: ein Tauchermesser.
Die Fischer packen den Täter und schleifen ihn zum Strand hinunter, wo schon ein Galgen auf ihn wartet. In dem Moment aber kommt es zu einer überraschenden Wende: Die Polizisten aus Mersing, einer zehn Kilometer nördlich von Papan gelegenen Stadt, treten auf den Plan. Von Augenzeugen herbeigerufen, treffen sie gerade rechtzeitig ein, um den Lynchmord zu verhindern. Der Mann wird gerettet und im zentralen Polizeirevier von Mersing inhaftiert.
Das ist die verblüffende Szene, die sich vor drei Tagen unweit der Grenze zu Singapur abgespielt hat. In Wahrheit ist sie weniger erstaunlich, als es den Anschein hat. Standrechtliche Hinrichtungen sind in Südostasien noch recht verbreitet. Ungewöhnlich ist diesmal aber der mutmaßliche Täter: Jacques Reverdi, ein Franzose, der kein Unbekannter ist. Als Freitaucher von internationalem Rang hat er zwischen 1977 und 1984 in den Kategorien »No Limits« und »Konstantes Gewicht« mehrfach den Weltrekord gebrochen.
Nach seinem Ausstieg aus dem aktiven Tauchsport Mitte der Achtziger lebt der heute 49-Jährige seit mehr als fünfzehn Jahren als Tauchlehrer in Südostasien, abwechselnd in den Ländern Malaysia, Thailand und Kambodscha. Nach den Aussagen der ersten Zeugen war er ein freundlicher, umgänglicher Mensch, aber auch ein Einzelgänger, der es vorzog, in den abgeschiedenen kleinen Buchten der Küstenregion ein Robinson-Dasein zu führen. Was ist am 7. Februar 2003 geschehen? Wie ist die Leiche einer jungen Frau in die Hütte gelangt, die er seit mehreren Monaten bewohnte? Und warum wollten die malaiischen Fischer sofort Selbstjustiz üben?
Jacques Reverdi war bereits 1997 in Kambodscha wegen Mordes an Linda Kreutz, einer jungen deutschen Touristin, festgenommen, aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen worden. In Südostasien jedoch hatte die Sache weite Kreise gezogen. Als er sich in Papan niederließ, erkannten alle ihn wieder – und behielten ihn im Auge. Als bekannt wurde, dass eine Dänin, eine gewisse Pernille Mosensen, zu ihm in seine Hütte gezogen war, wuchs der Argwohn. Dann war die junge Europäerin mehrere Tage nicht im Dorf gesehen worden – mehr brauchte es nicht, um den schwelenden Verdacht auflodern zu lassen und die Gemüter zu erhitzen …
Ersten Verlautbarungen zufolge stellten die Ärzte im Allgemeinen Krankenhaus von Johor Baharu an den Gliedmaßen, im Gesicht, an der Kehle, am Rumpf sowie in der Genitalregion der Leiche siebenundzwanzig Wunden fest, »zugefügt mit einer Hieb-, Stich- und Stoßwaffe«. Ein »pathologisches Gemetzel«, kommentierten die Experten auf der am 9. Februar abgehaltenen Pressekonferenz.
In Malaysia reden die Zeitungen bereits von amok, jenem wütenden Zerstörungs- und Tötungswahn, der sich gelegentlich der malaiischen Eingeborenen bemächtigt.
Nach einer Nacht in Mersing wurde Reverdi in das psychiatrische Krankenhaus von Ipoh verlegt, die bekannteste Fachklinik von Malaysia. Seit seiner Festnahme hat er kein Wort gesprochen, anscheinend steht er unter Schock. Nach Meinung der Ärzte ist dieser posttraumatische Zustand vorübergehender Natur. Wird er, sobald er wieder bei Sinnen ist, ein Geständnis ablegen? Oder wird er seine Unschuld beteuern?
Wir, die Redaktion des Limier, sind fest entschlossen, Licht in den Fall zu bringen. Schon am Tag nach der Festnahme ist unser Team auf den Spuren von Jacques Reverdi nach Kuala Lumpur aufgebrochen. Wir wollen seine Route nachzeichnen und überprüfen, ob noch weitere Leichen seinen Weg pflastern …
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besitzen wir exklusive Informationsquellen, die darauf hindeuten, dass es sich lediglich um die Spitze des Eisbergs handelt. In unserer nächsten Ausgabe erfahren Sie sehr mehr über das geheime Gesicht dieses unheilbringenden »Fürsten der Meere«.
Mark Dupeyrat,
Sonderberichterstatter des Limier,
aus Kuala Lumpur
Kapitel 3
Mark Dupeyrat lächelte, als er die letzten Zeilen seines Artikels überflog.
Das erwähnte »Team« bestand aus ihm selbst, und seine Reise hatte ihn nicht über das 9. Pariser Arrodissement hinausgeführt. Was seine »exklusiven Informationsquellen« betraf, so beschränkten sie sich auf ein paar Kontakte mit dem Büro der AFP in Kuala Lumpur und die malaiischen Tageszeitungen. Wirklich nicht beeindruckend. Er öffnete seine Mailbox, tippte ein paar Zeilen an Verghens, seinen Chefredakteur, und hängte den Artikel an. Dann schloss er sein Notebook an die erstbeste Telefonbuchse an und schickte die Nachricht ab.
Während er das Symbol beobachtete, das ihm die Übertragung der Daten anzeigte, hing er seinen Gedanken nach. Dass er die Wahrheit hin und wieder frisieren musste, war reine Routine. Le Limier pflegte sich nicht mit Skrupeln herumzuschlagen: Nicht umsonst nannte er sich »Der Spürhund«. Trotzdem würde sich Verghens damit noch nicht zufrieden geben: Sein Magazin, das sich auf spektakuläre Verbrechen und Sensationsmeldungen aller Art spezialisiert hatte, war es sich schuldig, der Konkurrenz immer um eine Nasenlänge voraus zu sein. In diesem Fall hinkte Mark eher Tausende Kilometer hinterher …
Er reckte sich und ließ den Blick durch das braungoldene Halbdunkel ringsum, über Ledersessel und blankpoliertes Kupfer, wandern. Vor Jahren schon hatte Mark sein Hauptquartier in dieser luxuriösen Hotelbar nahe der Place Saint-Georges aufgeschlagen, weil sie nur ein paar hundert Meter von seinem Atelier entfernt war: Er schwor auf diese altenglische Pubatmosphäre, in der sich die Kaffeedüfte mit Zigarrenrauch mischten und Stars in aller Diskretion Interviews gaben.
Im stillen Kämmerchen konnte er nicht schreiben. Als Student, ja schon zu Schulzeiten hatte er seine Hausarbeiten in überfüllten Cafés erledigt, eingebettet in Stimmengewirr und das Fauchen der Espressomaschinen. Die menschliche Gegenwart half ihm, die Schreibblockade zu überwinden. Und die Angst vor sich selbst: Mark fürchtete sich vor der Einsamkeit. Vor einer leeren Wohnung, in die sich ein Fremder einschleichen konnte, um ihn umzubringen. Jähe Kälte überkam ihn wie ein Luftzug, der durch seinen Körper fuhr. Mit vierundvierzig war er noch immer nicht über seine kindlichen Albträume hinaus.
»Darf ich Ihnen noch etwas bringen?«
Der Kellner im weißen Jackett musterte zuerst ihn, dann die Unterlagen, die sich über zwei Tische breiteten:
»Dies ist eine Bar, mein Herr, keine Bibliothek.«
Mark kramte in der Hosentasche und fand darin ein paar Münzen.
In spöttischem Ton fügte der Kellner hinzu:
»Einen Kaffee vielleicht? Mit einem Glas Wasser?«
»Mit einem Glas Wasser. Unbedingt.«
Der Kellner entfernte sich. Mark betrachtete die im Lampenlicht schimmernden Euromünzen in seiner Hand, die seine finanzielle Situation treffend ausdrückten. In Gedanken ging er seine privaten Reserven durch und fand nichts, weder auf der Bank noch anderswo. Wie hatte er sich so herunterwirtschaften können? Er, der noch vor zehn Jahren einer der bestbezahlten Reporter von Paris gewesen war?
Er stellte eine Münze hochkant auf den Tisch und brachte sie mit zwei Fingern zum Kreiseln. Der Anblick erinnerte ihn an eine Laterna magica, die sein Leben wie einen Film vor ihm ablaufen ließ. Welchen Titel müsste er ihm geben? Er überlegte kurz und entschied sich für »Porträt eines Besessenen«.
Besessen vom Verbrechen.
Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen.
Mit dem Klavier. In seinen jungen Jahren war Mark der festen Überzeugung gewesen, dass sein Dasein wie eine Partitur geordnet sei. Musikunterricht im Gymnasium. Konservatorium in Paris. Konzerte und Platteneinspielungen. Als Pianist legte Mark Wert auf Pragmatismus und lehnte jegliches Pathos, jedes Abgleiten in romantisches Gefühl strikt ab. Spielte er die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, so benutzte er niemals das Pedal, sondern arbeitete den mathematischen Charakter des Kontrapunkts heraus. Spielte er Chopin, sorgte er für ein möglichst dezentes Rubato der linken Hand, um das Stück nicht ins Schlingern geraten zu lassen wie ein leckes altes Schiff. Und bei Rachmaninow liebte er es, die Melodie im Zweivierteltakt mit angespannter, geradliniger Strenge von den Triolen der linken Hand abzusetzen.
So liefen die Gewissheiten unter seinen Fingern dahin. Nicht den kleinsten falschen Ton zog er für sein Leben in Betracht. Doch er kam, der falsche Ton, mit unausweichlicher Wucht. Im Frühjahr 1975. D’Amico, sein bester Freund, mit dem er die Gymnasialzeit verbracht hatte, kam ums Leben, und sein Tod schleuderte Mark aus der Bahn. Im Übrigen weigerte er sich, das Ereignis zur Kenntnis zu nehmen: Er versank im Koma, aus dem er erst sechs Tage später ins Bewusstsein zurückkehrte. Beim Erwachen erinnerte er sich an nichts, weder an die Entdeckung der Leiche noch an die wenigen Stunden vor der Katastrophe.
Sehr bald begriff er, dass ihn der Unfall nicht einfach nur maßlos erschüttert hatte, sondern auch eine perfide unterschwellige Wirkung entfaltete: Seine Musikalität hatte sich verändert. Wenn er jetzt am Klavier saß, beschlich ihn ein fatales Unbehagen, ein Abscheu, der ihn zwar nicht am Spielen hinderte, doch jegliche Empfindsamkeit untergrub und aus seiner Interpretation eine mechanische Aneinanderreihung von Tönen werden ließ. Ein Spalt hatte sich aufgetan, der immer weiter auseinander klaffte. Alle seine Hoffnungen schwanden dahin, das Konservatorium, die Wettbewerbe, die Konzerte … Seinen Eltern sagte er nichts davon, auch nichts dem Psychiater, den er seit seinem Koma regelmäßig aufsuchte. Sein Musikabitur bestand er mehr schlecht als recht, doch die Saite war gerissen: Die Hoffnung, sich je über andere Virtuosen erheben zu können, einen wie auch immer gearteten Beitrag zur Geschichte der großen Interpreten zu leisten, konnte er begraben. Deshalb entschied er sich stattdessen für die Literatur und schrieb sich an der Sorbonne ein.
Er war mitten in der Magisterprüfung, als in kurzem Abstand hintereinander seine Eltern starben. Am selben Krebs. Mark, noch halb betäubt von seinem letzten Trauma, erlebte die Tragödie wie aus weiter Ferne. Er hatte ohnehin nie sehr an den beiden gehangen, dem Apothekerehepaar aus Nanterre, das für seine Ambitionen kein Verständnis hatte. Sie hatten ihn immer an zwei Fahrkartenzangen denken lassen, die sich in ein und dasselbe Ticket verbissen hatten – was hatten sie mit seinen Träumen von einer weltfernen Musikerlaufbahn gemein? Mark hatte noch eine Schwester, die nach demselben kleinbürgerlichen Muster gestrickt war und nichts Eiligeres zu tun hatte, als die Apotheke zu übernehmen. Antritt der Nachfolge, Antritt des Erbes.
Mark beendete seine Magisterarbeit, »Apuleius und die Metamorphosen des Wortes«, und lernte anschließend den Arbeitsmarkt kennen. Mit großer Sorgfalt verfasste er Lebenslauf und Bewerbung und kam sich vor wie ein Schiffbrüchiger, der eine Flaschenpost nach der anderen auf den Weg schickt, aber nur das Etikett verschönt, weil in der Flasche keine Botschaft ist. Wer konnte auf dem gegenwärtigen Arbeitsmarkt einen Spezialisten für neuplatonische Dichter brauchen? Er bewarb sich in allen Bereichen, in denen seine redaktionellen Fähigkeiten gefragt sein könnten: Journalismus, Werbung, Verlagswesen … Im Grunde war ihm alles egal: Er litt nach wie vor an seiner inneren Wunde, dem Verlust der Musik.
Das Wunder geschah. Eine Lokalzeitung schickte eine positive Antwort. Ein kleines Blättchen mit Sitz in Nîmes, aber das spielte keine Rolle: Das Wichtigste war, dass man ihn fürs Schreiben bezahlen wollte! Mit Feuereifer widmete er sich seinem neuen Beruf. Er begeisterte sich für den Süden Frankreichs und fand all die Klischees über den malerischen Midi bestätigt – die Sonne, die weiten goldenen Ebenen, die Pastelltöne von Lavendel und Rosmarin. Jedes sinnliche Empfinden war für ihn wie eines dieser kleinen Säckchen mit getrockneten Kräutern, die man zwischen die Wäsche schiebt. Die Düfte drangen in ihn ein und erfüllten ihn mit einer heimlichen, gedämpften Süße.
Die Jahre vergingen. Er kam voran, verdiente besser. Seinen Anteil an der Familienapotheke verkaufte er seiner Schwester und erstand dafür ein Haus in der Umgebung von Sommières. Dort hatte er seinen Freundeskreis, seine festen Gewohnheiten und einen Kreis von »Verlobten«. Mit dreißig Jahren war er ein Kind des Südens geworden. Der Tod seines Freundes schien ferne Vergangenheit, sein einziges Bestreben galt jetzt dem Schreiben – und natürlich trug er sich inzwischen mit dem Plan zu einem Roman. Jeden Morgen stand er früher auf, um an seinem »Meisterwerk« zu schreiben. Vor allem aber waren seine psychischen Störungen nahezu verschwunden. Zwar ging er noch immer zu einem Therapeuten in Nîmes, doch seine Albträume wurden seltener. Und das Rot, dieses Rot, das manchmal seinen Schädel inwendig überschwemmte, lichtete sich so weit, dass es sich, wenn er erwachte, in der diffusen Helle des Morgens auflöste.
Von ihm unbemerkt, schlich sich ein neues Gift in sein Leben ein: die Routine. Immer enger schlossen sich die konzentrischen Kreise seines Daseins um ihn, bis er zu ersticken meinte. Jeder Tag lähmte ihn ein wenig mehr. Er schlief immer länger, stand meist erst so spät auf, dass er gerade noch rechtzeitig zur morgendlichen Redaktionssitzung kam, und abends setzte er sich vor den Fernseher – weil er ja den ganzen Tag »wie ein Berserker geschuftet« hatte. Nach und nach wichen seine Schriftstellerträume den winzigen, doch handfesten Notwendigkeiten seines beruflichen Alltags. Er sprach den leiblichen Genüssen zu, wurde aufgedunsen, fand zunehmend Geschmack am Nichtstun. Er hatte sich sogar wieder dem Klavier zugewandt, aber so, wie man sich ans Basteln macht.
Dann traf er sie.
Zuerst sah er sie gar nicht. Wie bei diesen Psychotests, bei denen der Proband unmögliche Spielkarten, die ihm untergeschoben werden – ein rotes Pik-Ass, eine schwarze Karo-Zehn –, mit den normalen Karten gleichsetzt und keinen Unterschied merkt, reihte Mark Sophie in die gewohnte Umgebung ein und nahm die Unterschiede nicht wahr.
Sie war ganz einfach die unmögliche Karte.
Er lernte sie in Saignon kennen, im Naturpark des Lubéron, wo nach der Entdeckung fossiler Fußabdrücke von prähistorischen Tieren in einer Kalksteinplatte eine archäologische Grabung eröffnet wurde. Sophie war es, die den Kontakt herstellte: Sie war die Pressesprecherin der Stiftung, von der die Grabung finanziert wurde. Er bemerkte sie nicht. Eine rote Kreuz-Dame, eine schwarze Herz-Königin. Sie musste Hartnäckigkeit an den Tag legen, musste ihn mehrfach auf andere von ihrer Stiftung finanzierte Grabungsstätten einladen, bis ihm endlich ein Licht aufging.
Sophie entsprach haargenau seiner Idealvorstellung einer Frau.
Sie war das Bild, das seit jeher durch seine Träume gegeistert war, der geheime Wunsch, den er nicht zu formulieren wagte, aus Furcht, er könnte sich verflüchtigen, sobald er mit konkreten Gedanken in Berührung käme. Noch jetzt wäre er außerstande gewesen, sie zu beschreiben. Groß, dunkel, präzise und vage zugleich. Er erinnerte sich nur an perfekte Ausgewogenheit. An vollendete Anmut. Er war stets überzeugt gewesen – und hatte jetzt den Beweis dafür –, dass die Farbe der Haare, des Teints, die Beschaffenheit der Haut keine Rolle spielen: Es zählt allein die Harmonie des Ganzen. Die Reinheit der Linien, die Strenge der Form. Wie das Wunder einer Melodie, die auf jedem beliebigen Instrument gespielt werden kann, ohne an Intensität zu verlieren.
Unmöglich auch konnte er sagen, ob er ihren Geist liebte oder ihre Persönlichkeit, denn alles, wirklich alles an ihr – Bemerkungen, Entscheidungen, Verhalten – war von dieser unaussprechlichen Anmut erfüllt. Er hörte ihr nicht zu: Er schwebte. Er liebte sie nicht: Er betete sie an. Er hatte nur den einen Wunsch, in ihrer Nähe zu leben und diese Schönheit bis ans Ende zu begleiten, so wie man eine Wallfahrt unternimmt. Er wollte sie runzelig werden sehen, wollte ihre Schönheit zähmen, doch nie versuchen, sie zu begreifen oder ihr Geheimnis zu lüften. Er hoffte ganz einfach, in ihrer Geschichte aufzugehen, wie ein Priester im Glauben, in der Kraft seiner Gebete aufgeht, ohne die Ratschlüsse Gottes zu erfassen.
Auf beruflicher Ebene bekam er neuen Auftrieb. Seit zwei Jahren war er Kontaktmann einer großen Fotoagentur in Paris. Wenn irgendein Ereignis in seiner Region von landesweiter Bedeutung war, verständigte er die Zentrale, die ihm einen Fotografen schickte. Dadurch kam er mit berühmten Reportern zusammen, mit Leuten, die ständig auf Reisen waren und auf einer anderen Ebene der Wirklichkeit lebten. Mark schlug seinen Auftraggebern eine Zusammenarbeit vor – das berühmte Tandem Journalist-Fotograf –, und zwar auf weltweiter Ebene.
Man schenkte ihm Vertrauen. Fortan war er viel auf Reisen, befasste sich mit den unterschiedlichsten Themen, mit den letzten Urvölkern, mit wahnsinnigen Milliardären, mit Bandenkriegen – er machte alles. Unter einer Bedingung: Es musste unfassbar sein, beispiellos, ein Nervenkitzeln auf Hochglanzpapier. Sein Einkommen stieg. Desgleichen die Risiken, die er einging. Er verkaufte sein Haus in Sommières und kehrte nach Paris zurück. Sophie ging natürlich mit – ohnehin geschah das alles nur ihretwegen. Denn paradoxerweise unternahm er seine Reisen, um ihr näher zu kommen, um den gemeinsamen Alltag mit zündendem Stoff zu füllen und ihre intime Beziehung zu intensivieren. Vor ihrer Schönheit blieb ihm nichts anderes übrig, als zum Helden zu werden. Eine Frage der Ausgewogenheit.
Ende 1992 begann Mark mit einer umfangreichen Reportage über die sizilianische Mafia. Seine Route führte ihn durch mehrere Städte, Palermo, Messina, Agrigent. Er überredete Sophie, am Ende seiner Reise zu ihm zu stoßen, und erwartete sie in Catania, am Fuß des Ätna.
Dort, in der Stadt aus Lavagestein, wiederholte sich das Drama.
Sophie starb am 14. November 1992. Niemals würde er diesen Tag vergessen. Die geheiligte Frau, die Pythia, wurde von derselben Farbe verschlungen wie d’Amico: Rot. So jedenfalls stellte er es sich im Nachhinein vor, denn er hatte nicht die leiseste Erinnerung. Als er ihre Leiche fand, verlor er das Bewusstsein und versank in einem traumlosen Schlaf. Alles war genau so wie beim ersten Mal. Die Entdeckung der Leiche. Der Schock. Das Koma.
In einem Pariser Krankenhaus wachte er wieder auf. Mit großer Behutsamkeit erklärte man ihm, was geschehen war. Zwei Monate waren vergangen. Man hatte ihn nach Paris verlegt. Sophie war in der Nähe ihrer Familie, in der Gegend von Avignon begraben. Mark konnte nicht mehr sprechen. Von überall her kehrten die alten Gespenster zurück: seine Schwester, die Amnesie-Experten, der Psychiater, der ihn schon beim ersten Mal behandelt hatte. Er hörte zu, aß, schlief. Aber er empfand nichts, nicht das Geringste – er spürte nur einen zementähnlichen Geschmack im Mund, wie nach einer sehr langen Sitzung beim Zahnarzt. Dieser Geschmack drang in ihn ein, breitete sich in ihm aus und lähmte ihn. Er versteinerte, war keines Gedankens, keiner Reaktion mehr fähig.
Er brauchte zwei Wochen, bis er wieder aufstehen konnte. Er musterte sich im Spiegel und fand sich bloß abgemagert. Seine Haut hatte die Farbe von Gips, und sein Atem verströmte noch immer diesen Geruch nach Mörtel.
Einen Monat später konnte er wieder klar denken. Er begriff, dass er alles verloren hatte. Nicht nur Sophie, sondern auch die letzte Erinnerung an Sophie. Dieses schwarze Loch verfolgte ihn, während er im Pyjama durch die Klinikflure wanderte, wie ein Riss in der Zeit: Diese ausgelöschte Seite würde ihm immer fehlen, kein Ersatz die Lücke je schließen.
Als Nächstes erfasste er das Ausmaß seiner Verwandlung. Mit d’Amicos Tod hatte er die Lust an der Musik verloren. Jetzt verlor er die Lust am Leben, an der Zukunft, an jeglicher Aktivität. Er ließ sich in eine Spezialklinik einweisen und bezahlte den Aufenthalt vom Erlös des Hauses in Sommières. Monate vergingen. Im Spiegel sah sich Mark von Tag zu Tag dürrer werden. Hostiengleicher Teint, spitz vorspringende Wangenknochen. Er entmaterialisierte sich, hatte der Welt, die ihn draußen erwartete, kein Gewicht mehr entgegenzusetzen.
Und doch fand er einen Ausweg: den Zynismus.
Sich von Sophies Tod zu erholen hieß, das Schlimmste überstehen. Er wollte seinen Beruf wieder aufnehmen, allerdings ohne Skrupel und ohne Illusion. Er würde nur noch für die Kohle arbeiten. Und so viel Kohle wie möglich herausschlagen. Er kannte die Medien gut genug, um zu wissen, dass nur ein einziger Weg sich wirklich auszahlte: Prominentenjagd und Indiskretion. An dem Morgen, an dem er seinen Entschluss fasste, lächelte er sich unter dem Schnurrbart an, den er sich hatte wachsen lassen, um sein asketisches Gesicht ein wenig zu polstern.
Nachdem es keine Hoffnung mehr gab, wollte er seine Hoffnungslosigkeit gewinnbringend nutzen …
Und Paparazzo werden.
Tiefer konnte ein Journalist nicht sinken. Ein Paparazzo, das war das unterste Ende. Keine Werte, keine Prinzipien, alles ist erlaubt, so lang es nur einträglich ist. Gleichzeitig war es ein anstrengender Job voller Nervenkitzel, der sehr viel Ermittlungsarbeit verlangte. Mehr noch, man musste zum Spürhund werden, auf der Lauer liegen, sich verstellen, hochstapeln. Zu schweigen von den Gefahren, die durchaus real waren: In diesem Beruf zählte keiner, wie oft er auf die Schnauze gefallen, wie viel Material dabei zu Bruch gegangen war. Genau das Richtige für ihn. Er war kein Fotograf, aber als Ermittler würde ihm keiner so leicht das Wasser reichen.
Ein Knüllerfänger.
Tatsächlich wurde er innerhalb weniger Jahre einer der Besten seines Standes. Das heißt, einer der Schlimmsten. Ein Schnüffler, Lügner, gerissener Fuchs. Es glitt in eine Art Zwischenwelt ab, einen Sumpf, in dem er nach Gold schürfte. Er verkehrte mit Prostituierten schweren Kalibers, mit hoch verschuldeten Bullen, mit zwielichtigen Spitzeln. Er lernte Hausmeister, Taxifahrer, Ärzte zu bestechen. Er wurde Experte im Durchsuchen von Mülltonnen wie auch in der Kunst, sich Zutritt zu exklusiven Partys zu verschaffen.
Bald hatte er den Spitznamen »der Abstauber«. Seine Spezialität: der Diebstahl intimer Familienfotos von Leuten, die aus irgendeinem Grund plötzlich im Rampenlicht standen. Waren Eltern vom Medienerfolg ihres Nachwuchses überrumpelt, war er, lächelnd und herzlich, zur Stelle und ließ diskret die Porträts vom Kaminsims mitgehen. Waren ein Vater, eine Mutter nach dem Mord an ihrer kleinen Tochter niedergeschmettert und sprachlos, bekundete er sein Mitgefühl und nutzte die Gelegenheit, um in der Schuhschachtel mit den gesammelten Fotos zu stöbern.
Wenn »echte« Aufnahmen erforderlich waren, tat er sich mit dem je nach Projekt besten Fotografen zusammen, der meist aus einem ganz anderen Fachgebiet herkam. Ging es um einen superheißen Job auf dem Felsen von Monaco? Mark kontaktierte einen Bergsteiger, der in der Lage war, sich Zutritt zum Fürstentum zu verschaffen, ohne den Zoll zu passieren, nämlich in der Direttissima über die Wand. Brauchte er einen Schnappschuss des nackten Busens von Ophélie Winter? Dann hatte er den schnellsten Fotografen zur Hand, einen Crack der Olympischen Spiele, der imstande war, beim Hundert-Meter-Start ein perfekt scharfes Bild zu schießen. Oder eine Nachtszene auf mehr als achthundert Metern Entfernung? Mark wandte sich an einen Tierfotografen, Experten für Nachtaufnahmen und genialen Bastler, der Infrarotobjektive erfunden hatte.
1994 fand er endlich einen vollwertigen Partner, der sich an sämtlichen Fronten bewährte. Vincent Timpani, ein langhaariger Koloss, überschwänglich und unflätig, doch imstande, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen und, mehr noch, in allen Situationen ein scharfes Bild zustande zu bringen. Ein Gorilla, der es notfalls mit Leibwächtern aufnahm und auch nicht vor illegalen Aktionen zurückschreckte – mehrmals waren sie gemeinsam bei Stars eingebrochen: riskant, aber rentabel.
In den grünen Bomberjacken der englischen Piloten, vermummt mit schwarzen Mützen, die sie tief ins Gesicht zogen, organisierten sie regelrechte Kommandooperationen. Ihr Alltag war ereignisreich, an Aufregungen fehlte es nie. Sie hatten eine endlose Glückssträhne. Mitte der neunziger Jahre lieferten sich die französischen Skandalblätter einen erbitterten Konkurrenzkampf. Paris-Match, Voici, Gala, Point de vue führten einen offenen Krieg um die besten Abzüge.
Mark und Vincent kassierten ein Vermögen.
Aber Mark ging es gar nicht ums Geld. Eben hatte er sich ein Atelier im 9. Arrondissement gekauft – und bar bezahlt – und sich gar nicht erst die Mühe gemacht, es einzurichten. Er suchte etwas anderes: Vergessen. Sein einziger Triumph war, dass es ihm mit seiner Umtriebigkeit gelungen war, die Albträume im Zaum zu halten und Sophies Bild in einen fernen Winkel seines Bewusstseins zu drängen. Verarbeitet hatte er gar nichts: Er funktionierte, und das war ein Erfolg. Dass er ein mieser Kerl war, trug er mit Stolz zur Schau.
Mark war ein Überlebender.
Und Überlebende haben alle Rechte.
1997. Mark und Vincent reisten von der Insel Mustique nach Gstaad, vom Anwesen Sperone auf Korsika nach Palm Beach in Florida, und niemand konnte sie aufhalten: Paparazzi waren gefragt wie nie. Mark ahnte, dass es nicht ewig so weitergehen würde, irgendwann würde der Wind sich drehen, nicht nur für sie beide, sondern für alle. Die Boulevardpresse brach unter den indiskreten Fotos zusammen. Und unter den blauen Umschlägen der Gerichte, die nach Erscheinen jeder Ausgabe ins Haus flatterten. Die Prominenten schlugen zurück, bedienten sich der übrigen Medien als Forum, und den Lesern begann bei so viel Voyeurismus unbehaglich zu werden. Die Grenze der Toleranz näherte sich.
Mark rechnete mit einem allmählichen Rückgang, einem gebremsten Sturz sozusagen. Nie hätte er gedacht, dass es so schnell gehen würde, mit der Geschwindigkeit eines herabsausenden Fallbeils.
Das Fallbeil schlug in der Nacht des 30. August 1997 zu.
Für Lady Di hatte Mark sich nie interessiert: zu viel Konkurrenz. Er war lieber Einzelkämpfer, zog die Umwege und Überraschungen vor. Die Nachricht von ihrem Tod hätte er also wie jeder andere am nächsten Morgen, dem 31., aus dem Radio oder Fernsehen erfahren müssen.
Aber nein. Um ein Uhr morgens rief Vincent ihn an.
Mark brauchte ein paar Minuten, um zu verdauen, was passiert war: Diana und Dodi al-Fayed entlang dem Seine-Ufer von Paparazzi verfolgt und schließlich der Unfall im Alma-Tunnel. Vincent war einer der Fotografen, die dem Mercedes gefolgt waren. Am Telefon überstürzte er sich förmlich und überschüttete ihn mit Details: zwischen Blechen verkeilte Körper, die Hupe blockiert, sodass ein Dauerton durch den Tunnel hallte, Kollegen, die wie rasend fotografierten, und andere, die erste Hilfe zu leisten versuchten.
Mark ahnte, dass dieser unfassbare Unfall das Ende des Berufsstandes ankündigte – und der Kohle, die damit zu machen war. Das war die langfristige Perspektive. Kurzfristig begriff er, dass der Koloss Fotos geschossen hatte. Und dass ihm die Flucht gelungen war, während die anderen Paparazzi von der Polizei festgenommen worden waren. Für ein paar Stunden war Vincent im Besitz der einzigen Fotos auf dem Markt. Ein Vermögen.
Mark stellte sich die Frage: Bist du ein Mensch oder ein Aasgeier? Statt einer Antwort hörte er sich eiskalt fragen:
»Deine Fotos, sind sie digital?«
Sie verabredeten sich in der Redaktion einer der größten Pariser Zeitschriften. Vincent musste zuerst in aller Eile seine Bilder entwickeln – er fotografierte nicht mit Digitalkameras. Mark tauchte um halb drei auf. Als er die Leute sah, die noch im Arbeitskittel am Leuchttisch zugange waren, wurde ihm klar, dass sich die Lage verschlimmert hatte. Diana lag im Krankenhaus La Pitié-Salpêtrière und rang mit dem Tod. Nach zweimaligem Herzstillstand wurde sie jetzt operiert.
Mark trat an den Tisch, auf dem die Dias ausgebreitet waren. Er hatte Bilder von aufgerissenem Fleisch, von Blutspuren auf zerbeultem Blech, einem abscheulichen Gemetzel erwartet. Stattdessen sah er das durchscheinende, leuchtende Gesicht der Prinzessin. Ihre geschlossenen Lider waren leicht geschwollen, ein Tropfen Blut rann ihr über die Schläfe – sonst war ihre Schönheit unversehrt. Mehr noch, auch unter den Anzeichen der Quetschung schien sie von erschütternder Frische und Jugendlichkeit. Sie war ein Fleisch gewordener Engel, mit Schatten unter den Augen, Prellungen, blutigen Wunden, und von einer Ausstrahlung, die einem die Kehle zuschnürte.
Viel schlimmer war ein anderes Bild – zweifellos das letzte, das Diana bei wachem Bewusstsein zeigte. Es war ihr verängstigter, vom Blitzlicht erfasster Blick durch das Rückfenster des Wagens zu den Fotografen, die Jagd auf sie machten. In diesem Blick erkannte Mark die Wahrheit. Nicht an einem fatalen Fehler des Fahrers starb die Prinzessin, auch nicht wegen der Fotografen, die ihr an diesem Abend auf den Fersen waren, sondern wegen der endlosen Jahre der Verfolgung, der Hetzjagd und dauernden Beobachtung, nicht nur der Paparazzi, sondern der ganzen Welt. Sie starb an der Neugier der Menschen, an dieser dunklen Macht, die sämtliche Blicke gebannt und sämtliche Begehrlichkeiten auf sie gerichtet hatte. Eine Treibjagd, die vor Urzeiten begonnen hatte, aus dem unwiderstehlichen Drang heraus, alles zu sehen, alles zu wissen, der dem Menschen im Blut liegt.
»Eins sag ich euch. Ich verkaufe sie nicht.«
Mark kannte den Fotografen, der gesprochen hatte: Tränen standen ihm in den Augen. Offensichtlich stammte das Bild »Rückfenster« von ihm; die übrigen Fotos – Diana zwischen zerbeultem Blech – waren von Vincent. Mark suchte seinen Blick: Der Koloss wirkte fassungslos, schwankend stand er da, den Sturzhelm in der Hand.
Mark musterte die anderen – die Journalisten vom Dienst, den Leiter des Fotoservice, der mitten in der Nacht aus dem Bett geholt worden war. Alle waren bleich, geradezu fahl im Licht des Leuchttisches, das sie von unten beschien. In diesem Moment wurde ein stillschweigendes Abkommen getroffen, ohne dass ein Wort fiel: Diese Bilder würde niemand verkaufen oder veröffentlichen.
Um vier Uhr kam die Nachricht von Dianas Tod.
Nun brach eine fieberhafte Hektik aus. Die Mobiltelefone liefen heiß. Aus aller Welt kamen die Angebote der Redaktionen. Die Gebote überschlugen sich. Verstohlen beobachtete Mark Vincent und ein paar andere Fotografen, die inzwischen mit weiteren Abzügen eingetroffen waren. Sie reagierten zögernd, im Bewusstsein des Jackpots, der von Minute zu Minute wuchs. Manchmal sahen sie ihr Spiegelbild in den Fensterscheiben der Redaktion, und wahrscheinlich fragten auch sie sich: Menschen oder Aasgeier? Gegen sechs Uhr morgens verdrückte sich Mark, nachdem er sich mit Vincent verständigt hatte: Sie würden nichts verkaufen.
Mark war auf dem Weg zum Auto, als sein Telefon zu pfeifen anfing. Er erkannte die Stimme, es war einer seiner Kontaktleute aus dem Polizeipräsidium am Quai des Orfèvres. »Diana. Wir erwarten den Totenschein. Interessiert dich das?« Mark stellte sich den bleichen Körper auf dem OP-Tisch vor, diesen Körper, den er selbst vor etlichen Jahren entweiht hatte, als er Fotos von den Oberschenkeln der Prinzessin mit ersten Ansätzen von Zellulitis verschacherte. Die Zeitung hatte einen vergrößerten Bildausschnitt veröffentlicht, in dem die »interessante« Zone rot eingekreist war. Mark hatte für diese Reportage von allgemeinem Interesse achtzigtausend Francs kassiert. Das war die Welt, in der er lebte. Er schaltete das Telefon ab, ohne zu antworten.
Eine Stunde später rief der Bulle wieder an: »Wir haben den Totenschein, per Fax eingetroffen. Außerdem die Ergebnisse der Blutuntersuchung. Sie war vielleicht schwanger. Interessiert’s dich immer noch nicht?« Mark zögerte, aber nur der Form halber; dann sagte er, von dem dumpfen Bedürfnis getrieben, so tief zu sinken, wie es nur ging: »Ich bin in dreißig Minuten im Soleil d’Or. Papier bring ich mit.« Das Soleil d’Or war das dem Polizeipräsidium am Quai des Orfèvres 36 nächstgelegene Café. Mit dem »Papier« war das Standard-Büropapier gemeint, das man mitbringen musste, wenn man von seinem Informanten etwas kopieren wollte, denn das polizeieigene Kopierpapier trug charakteristische Merkmale und stellte im Fall einer Ermittlung einen materiellen Beweis gegen die Polizei dar.
Eine Stunde später hatte er die Kopie des Dokuments in Händen. Zwei Stunden später bot er sie einer der größten Pariser Redaktionen an. Ein unschätzbarer Scoop. Doch die Redaktionsleitung zögerte: Es gab keine Garantie für die Echtheit des Totenscheins, und ohnehin ging das zu weit, es war einfach zu viel. Draußen war schon jetzt die Rede davon, dass man die Paparazzi und überhaupt die Medien lynchen müsse, die »Mörder von Prinzessin Diana«. Noch war keine Entscheidung gefallen, gleichwohl zahlte das Magazin eine »Garantie« und arbeitete bereits am Layout – Mark selbst verfasste an Ort und Stelle den Artikel dazu. Aber nun geschah etwas Unerhörtes: Die Sekretärinnen vom Schreibdienst lehnten es ab, den Artikel zu tippen. Zu viel ist zu viel. Dieser Aufstand gab den Ausschlag: Die Redaktion verzichtete. Und entschied sich für einen Kompromiss: In dem Artikel sollte zwar die mögliche Schwangerschaft erwähnt werden, doch der Totenschein würde auf keinen Fall veröffentlicht.
Wutentbrannt schnappte sich Mark sein Beweisstück und marschierte zu den Toiletten. In einer Kabine verbrannte er das Papier. Im selben Moment packte ihn der Abscheu vor sich selbst. Er war ein widerwärtiges Schwein. Er betrachtete die zwischen seinen Fingern züngelnden Flammen und beschloss, endgültig Schluss zu machen. Fünf Jahre lang hatte er mit dem Teufel paktiert: Mit dieser Geste verbrannte er symbolisch seinen fatalen Vertrag.
Er ging auf Reisen. Beinahe gegen seinen Willen fuhr er nach Sizilien und fand sich nach nur zwei Tagen, ohne darüber nachgedacht zu haben, in Catania wieder. Es war wie eine Wallfahrt, nur dass er sich an nichts erinnerte. Auf den Straßen aus schwarzer Lava versuchte er sich wieder und wieder an die wenigen Stunden vor Sophies Tod zu erinnern. Was waren ihre letzten Worte gewesen? Obwohl seine Liebe zu ihr ungebrochen war, obwohl kein Tag verging, ohne dass er an sie dachte, war er unfähig, ihre letzten Stunden zu rekonstruieren.
In Sizilien traf er eine neue Entscheidung. Wie ein Mann, der jahrelang gehetzt wurde, dann aber plötzlich innehält, kehrtmacht und seinen Verfolgern die Stirn bietet, entschloss sich Mark, sich – endlich – seinen Dämonen zu stellen. Diese fünf Jahre der hektischen Betriebsamkeit, der Schiebereien und voyeuristischen Fotos hatten nur dem einen Zweck gedient, die Karten durcheinander zu werfen, die Besessenheit, die ihn umtrieb, zu verschleiern. Es war an der Zeit, dass er seiner wahren Obsession nachging.
Dem Verbrechen.
Blut und Tod.
Er bewarb sich um eine Stelle, die bei einem neuen Skandalblatt ausgeschrieben war, Le Limier. Mark hatte nicht das passende Profil für die Stelle, doch seine bisherige Laufbahn sprach für sein Ermittlertalent. Mit vierzig Jahren fing er noch einmal bei null an. Zum fünften Mal. Nachdem er Pianist, Lokalredakteur, internationaler Starreporter und Paparazzo gewesen war, verlegte er sich jetzt auf Tratsch aller Art. Man vertraute ihm das Ressort Justiz an. Er verbrachte seine Tage im Gericht, verfolgte die scheußlichsten Verbrechen, beobachtete die Mörder auf der Anklagebank. Vergeltungsakte, niederträchtiger Raub, Eifersuchtsdramen, Kindsmord, Inzest … keine Schandtat fehlte. Mark war enttäuscht. Vom Verhör der Angeklagten hatte er sich die Erkenntnis einer Wahrheit erwartet. Er wollte das Urmerkmal des Verbrechers kennen lernen.
Was er stattdessen zu sehen bekam, war ungleich erschreckender: Er erkannte gar nichts. Die Banalität des Bösen. Mehr oder minder reumütige, mehr oder minder aufschlussreiche Gesichter. Die immer so wirkten, als hätten sie mit den Ereignissen, über die da verhandelt wurde, nicht das Geringste zu tun. Diese Menschen, die ihre Kinder getötet, ihre Lebensgefährten massakriert, wegen ein paar Euro ihren Nachbarn umgebracht hatten, schienen im Augenblick der Tat von einer unbekannten Macht fremdgesteuert worden zu sein.
Manchmal beschlich Mark auch das umgekehrte Gefühl, und er dachte, dass der Zerstörungstrieb schon immer da gewesen war und tief im Bewusstsein lauerte. Dass er genetisch im Menschen verankert, in seinem Stammhirn angelegt war – und nur auf die erstbeste Gelegenheit wartete, um hervorzubrechen.
Die Jahre vergingen. Mark bearbeitete Hunderte von Fällen, berichtete von Prozessen, aber auch von nicht aufgeklärten Verbrechen, kannte sämtliche Mitarbeiter der Kriminalpolizei, die Richter, die Anwälte. Und die Mörder. In der »crim«, dem Morddezernat am Quai des Orfèvres, war er ebenso zu Hause wie im Besuchsraum von Fresnes. Er ging mit den besten Ermittlern essen und interviewte die schlimmsten Killer. Er fahndete, beobachtete, jagte. Aber das Wesentliche entging ihm immer: Das Gesicht des Bösen zu erkennen gelang ihm nie.
Trotzdem gab er die Hoffnung nicht auf: Nach fünf Jahren beim Limier wartete er immer noch auf den Fall, das Superverbrechen, das Geständnis, das ihm endlich den Blick auf das schwarze Licht freigäbe. Er war schon ganz in der Nähe – eines Tages würde er ihm zweifellos begegnen.
»Noch einen Kaffee vielleicht?«
Wieder stand der Kellner vor ihm. Mark warf einen Blick auf die Uhr: fünf Uhr nachmittags. Die Bilanz seines Lebens hatte mehr als eine Stunde in Anspruch genommen. Er rieb sich die Augen, als käme er aus dem Kino.
»Nein, danke. Genug für heute.«
Der Kellner schenkte Mark ein zufriedenes Lächeln, zumal er ihn seine Unterlagen und Notizen einsammeln sah. Bevor Mark aufbrach, suchte er noch die Toilette auf, um sich frisch zu machen. Er fühlte sich so zerknittert wie das Taschentuch eines jungen Mädchens mit Liebeskummer.
Er betrachtete sich im Spiegel. Wie immer wusste er mit seinem Gesicht nichts Rechtes anzufangen: Sah er aus wie ein Pianist, ein Literaturwissenschaftler, Reporter, Paparazzo, wie ein Gerichtsjournalist? Eher wie ein Kleinkrimineller, zu dem keine dieser Rollen passte. Stämmig, rothaarig, schnauzbärtig, ähnelte er einem verkleinerten Rugbyspieler aus der englischen oder irischen Mannschaft.
Er hatte sich ein ganzes Sortiment an Accessoires zugelegt, um seine Erscheinung zu verbessern. So trug er nur taillierte, dezent braun und kremfarben gemusterte Westen, über weißen Hemden mit englischem Kragen, deren Manschetten unter den Sakkoärmeln hervorspitzten. Dabei war er nicht sicher, ob das Ergebnis überzeugte. An seinen guten Tagen fand er sich sehr elegant, sehr »british«. An den schlechten kam er sich mit seinen schokoladebraunen, kaffeeschwarz schillernden Westen eher wie das Schaufenster einer Konditorei vor.
Er tauchte sein Gesicht in kaltes Wasser. Dieser Rückblick auf sein Leben hatte ihn ausgelaugt. Wer war er tatsächlich geworden? Seine Leidenschaft für das Verbrechen nahm ihn ganz und gar gefangen. Der Gedanke brachte ihn auf das Thema des Tages zurück: Jacques Reverdi.
»Ein Massenmörder in den Tropen« – wirklich?
Er drehte den Wasserhahn ab und warf seine Haare zurück.
Es war an der Zeit, sich das Gesicht des Mörders anzusehen.
Kapitel 4
Reine weiße Linien.
Ein Zen-Raum von vollendeter Symmetrie.
Jedes Mal, wenn er hier eintrat, empfand er wieder dasselbe. Dieses professionelle Fotolabor kam ihm vor wie ein Ort der Meditation. Ein Vorzimmer mit weißen Wänden, an denen schwarz gerahmte Abzüge hingen. Dann ein Flur mit kleinen Hängelampen, der zum eigentlichen Labor führte. Die Fotografen gaben hier ihre Filme ab und bekamen ihre Abzüge zurück. Auch hier wieder Weiß und Reinheit … alles schien darauf ausgelegt, den Geist leer werden zu lassen, die Seele zu sammeln. Sogar die Leuchttische, weiß funkelnde Blöcke, deren milchiger Widerschein auf den Gesichtern der Reporter lag, begannen irgendwann futuristischen Gebetsstühlen zu ähneln.
Mark hatte sich für 17.30 Uhr mit Vincent Timpani verabredet. Es war schon sechs Uhr, doch der Koloss war wie immer zu spät. Auf dem Weg zur Cafeteria entdeckte er ein bekanntes Gesicht: Milton Savario, Fotograf aus Südamerika und Nachrichtenreporter der Spitzenklasse. Ein Hungerkünstler, der immer wie ein Überlebender zwischen zwei Kriegen wirkte.
Savario winkte ihm zu. Sie tauschten einen Händedruck. Mit einer Kopfbewegung deutete Mark zu den auf dem Leuchttisch ausgelegten Dias hinüber:
»Fotografierst du nicht digital?«
»Nicht bei dieser Art Thema.«
»Worum geht’s?«
»Den Hunger in Argentinien.«
»Darf ich?«
Mark griff nach dem Fadenzähler, einer kleinen Lupe auf einem verchromten Gestell, und beugte sich über die Dias. Ein zaundürres Kind mit ausgemergeltem Gesicht, an Infusionsschläuchen auf einem Klinikbett. Ein grünlicher Säugling mit riesigem Schädel in einem Sarg mit kleinen Engelsflügeln. Eine Krankenschwester mit einem leblosen Kind in den Armen, die Beine nur noch zwei lange, reglose Knochen, auf einer grauen Treppe. Mark richtete sich wieder auf.
»Das muss hart gewesen sein?«
»Was?«
»Na, diese Kinder, die Hungersnot …«
Savario lächelte. Mit seinem Dreitagebart und seiner struppigen schwarzen Mähne sah er aus, als hätte er sich mit Holzkohle geschminkt.
»Es gibt keine Hungersnot in Argentinien.«
»Und diese Fotos?«
Der Südamerikaner schob wortlos die Dias in einen Umschlag, legte seinen Fadenzähler zusammen und schaltete den Leuchttisch aus.
»Ich lad dich auf einen Kaffee ein. Dann erzähle ich’s dir.«
Sie gingen in die Cafeteria. Auch hier war alles weiß, Automaten, Tischchen, Stühle. Der Fotograf schwang sich auf einen hohen Barhocker.
»Es gibt keine Hungersnot«, wiederholte er und blies auf seinen Becher mit kochend heißem Kaffee. »Wir sind alle drauf reingefallen.«
Aus seiner Fototasche zog er das Bild eines Kindes mit Infusionsschlauch und deformierten Gliedmaßen hervor.
»Von wegen Hunger. Das ist Kinderlähmung.«
»Kinderlähmung?«
»Das Foto ist wohl irrtümlich in Umlauf gekommen. In den Agenturen. Im Internet. Wir haben uns alle draufgestürzt. Eine Hungersnot in Argentinien, das schien uns doch unglaublich. Aber vor Ort, in Tucumán, keine Spur von Hunger.«
»Was hast du gemacht?«
»Dasselbe wie alle anderen: Ich hab den kleinen Poliokranken fotografiert. Weißt du, was ein Ticket nach Argentinien kostet?«
Weitere Erklärungen waren überflüssig. Nachdem das Geld schon mal ausgegeben war, konnte Savario unmöglich mit leeren Händen zurückkehren. Also machte er ein paar Aufnahmen von einem ausgemergelten Kind, ein paar weitere von Polykliniken, von elenden Slums, und die Sache war geritzt. Irgendein Magazin fand sich immer, das die Bilder kaufte und sich über Unterernährung ausließ. Niemand hatte rundheraus gelogen, die Ehre war gerettet – und das Geld gut angelegt. Der Latino hob seinen Becher:
»Auf die Information!«
Mark trank ihm zu. Er war dem Mahlstrom der Agenturen entronnen, seit fünf Jahren, seitdem er sich mit der Gerichtschronik befasste, doch er konstatierte mit einer gewissen Genugtuung, dass sich nichts, absolut nichts geändert hatte.
»Na, wird wieder die Welt umgeschrieben?«, tönte eine tiefe Stimme hinter ihnen.
Mark drehte sich auf seinem Hocker herum und erblickte Vincent Timpani. Ein Meter neunzig, hundert Kilo, halb Muskeln, halb erschlafftes Fleisch, in einem hellen Leinenanzug, in dem er aussah wie ein Pflanzer in den Tropen. Rätselhafterweise war er von immerwährend sonnigem Gemüt: Er stammte aus Nizza und hatte sich einen leichten südlichen Akzent bewahrt.
Mit fröhlichem Lachen begrüßte er Mark und Savario und ging dann zum Getränkeautomaten hinüber. Savario nutzte die Gelegenheit, um sich zu verdrücken. Vincent kam mit einer Coladose in der Hand zurück und sah dem Fotografen nach:
»Hab ich den Helden etwa in die Flucht geschlagen?«
»Hast du die Bilder?«
Der Koloss zog drei Umschläge aus seinem Jackett. Seit dem Drama um Lady Di hatte er sich der Modefotografie zugewandt, doch um der alten Erinnerungen willen erklärte er sich hin und wieder bereit, ein paar Abzüge als Illustration zu Marks Ermittlungsergebnissen zu basteln. In gespielt vorwurfsvollem Ton bemerkte er:
»Ich frag mich wirklich, wieso ich mich damit herumquäle, Verbrechervisagen zu reproduzieren. Wenn ich an die göttlichen Mädchen denke, die im Studio auf mich warten …«
Mark steckte die Hand in den ersten Umschlag und zog ein anthropometrisches Porträt von Jacques Reverdi hervor. Er las die Bildunterschrift.
»Das stammt von seiner Verhaftung in Kambodscha. Eine Aufnahme aus Malaysia hast du nicht?«
»No, Sir. Ich hab die AFP in Kuala Lumpur angerufen: Es gibt kein offizielles Porträt aus Malaysia. Die Polizei hat ihn nicht lang genug behalten, sondern sofort in die Psychiatrie abgeschoben, und jetzt …«
»Danke, das ist mir bekannt.«
Mark betrachtete Reverdis Gesicht. Die Fotos, die er bisher gesehen hatte, stammten aus seiner glorreichen Vergangenheit als Freitaucher – Bilder eines strahlenden Siegers im Taucheranzug, in der Hand die Plakette mit der Angabe seines Tiefenrekords. Ganz anders das Porträt aus Kambodscha. Aus Reverdis schmalem, muskulösem, gefurchtem Gesicht war jedes Lächeln verschwunden. Um seine Mundwinkel war etwas Verdrossenes, und der Blick war schwarz und unergründlich.
Mark öffnete den nächsten Umschlag und erblickte eine junge Frau, fast noch ein Mädchen. Pernille Mosensen. Helle Augen, ein engelhaftes Gesicht, umrahmt von tiefschwarzen, sehr glatten Haaren. Und eine durchscheinende, beinahe leuchtende Haut. Mark fühlte sich an das helle Fleisch exotischer Früchte erinnert.
»Das ist alles, was die Leute von der AFP mir geschickt haben«, sagte Vincent. »Es ist ihr Passfoto. Ich hab’s am Rechner bearbeitet …«
Der Gesichtsausdruck der jungen Dänin verriet das Bestreben, ernst zu wirken. Doch trotz der braven Miene spürte man eine überschwängliche Jugend unter ihren Wimpern strahlen, und auf ihren Lippen bebte ein kaum im Zaum gehaltenes Lächeln. Er stellte sich vor, wie sie sich auf Südostasien vorbereitete – sicher ihre allererste große Reise …
»Und der Körper?«, fragte er.
»Nada. Das oberste Gericht von Malaysia hat nichts herausgerückt. Offenbar wollen sie keine Werbung machen.«
»Und die andere? Die Frau aus Kambodscha?«
Vincent nahm einen kräftigen Schluck aus seiner Coladose und legte den dritten Umschlag auf den Tisch.
»Da hab ich nur das hier gefunden. Aus dem Archiv des Parisien. Und das war harte Arbeit, das kannst du mir glauben. Es ist eine Reproduktion aus den Käseblättern von Phnom Penh. Du siehst das Raster der Druckerei.«
Linda Kreutz war eine Rothaarige mit zarten Gesichtszügen, die sich nur in ganz feinen, leichten Andeutungen verrieten. Eine schwerelose Physiognomie, teils verborgen unter einer Lockenmähne, die aber bei dem groben Korn des Zeitungsdrucks kaum ins Gewicht fiel. In der gerasterten Wiedergabe verlor sich ihr Gesichtsausdruck und bekam etwas Unwirkliches. Ein Phantom aus der Nachrichtenredaktion.
»Und es gibt auch von ihr keine Aufnahme der Leiche?«
»Nichts, was sich veröffentlichen ließe. Cambodge Soir hat mir Fotos geschickt. Das Mädchen wurde drei Tage nach seinem Tod in einem Fluss gefunden. Der Körper so aufgebläht, dass er fast am Platzen war. Die Zunge wie eine Salatgurke. Glaub mir, das ist nichts für die Veröffentlichung. Nicht mal in deinem Mistblättchen.«
Mark steckte die drei Umschläge ein. Vincent schlug einen vertraulichen Ton an:
»Hast du heut Abend schon was vor?«
Das Gesicht des Fotografen war nach derselben Vorlage modelliert wie sein Körper: massig, rötlich, schlaff. Ein Menschenfressergesicht, halb versteckt hinter einer Haarsträhne, die ihm über das linke Auge fiel und an das Stirnband eines Piraten denken ließ. Sein Mund stand immer halb offen, wie bei einer hechelnden Dogge. Mit breitem Grinsen schwenkte er einen weiteren Umschlag:
»Interessiert dich das vielleicht?«
Mark warf einen Blick hinein: Aufnahmen von nackten jungen Frauen. Neben seinen offiziellen Aufträgen für Zeitschriften machte Vincent auch Bewerbungsfotos für Models in spe. Er nutzte die Gelegenheit, um sie auch ohne Hüllen zu fotografieren.
»Nicht schlecht, was?«
Sein Atem verströmte eine Mischung aus Cola- und Alkoholschwaden. Mark blätterte den Stapel durch: kaum erwachsene Körper, mit Idealmaßen gesegnet; milchweiße, makellose Haut; Gesichter von katzenartiger Eleganz.
»Soll ich eine anrufen?«, fragte Vincent mit einem Augenzwinkern.
»Sorry«, antwortete Mark und gab die Bilder zurück. »Ich bin nicht in Stimmung.«
Mit leiser Verachtung nahm Vincent seine Fotos wieder an sich.
»Du bist nie in Stimmung. Da liegt dein Problem.«
Kapitel 5
Die Gesichter waren da.
Vertraut und erschreckend zugleich.
Verzerrt, platt gedrückt, deformiert hinter dem Rattangeflecht. Jacques Reverdi zügelte seine Angst und stellte sich ihnen: Er sah die abgeflachten Wangen, die in Falten gelegten Stirnen, die verfilzten Haare. Ihre Augen suchten ihn im Halbdunkel auszumachen, ihre Hände krallten sich in die Wände. Er hörte auch ihre gedämpften Stimmen, die durcheinander flüsterten, verstand aber nicht, was sie sagten.
Bald erkannte er Einzelheiten, die nicht sein konnten. In einem Gesicht waren die Lider zugenäht, ein anderes hatte keinen Mund, nur geschlossene Haut zwischen den Wangen, wieder ein anderes ein Kinn wie ein Vordersteven – als wäre der Knochen, maßlos vergrößert und aufgebogen, nahe daran, die Haut zu durchstoßen. Ein anderes schwitzte dicke Tropfen, aber dieser Schweiß, sah er, bestand aus verflüssigtem Fleisch, sodass bald alle Gesichtszüge verschwammen und zu einem zähen Brei zerrannen.
Jacques begriff, dass er noch schlief. Diese Gesichter stammten aus seinem wohlbekannten Albtraum, dem Traum, der ihn nie verließ. Er zwang sich zur Ruhe. Er wusste, dass ihn diese Ungeheuer hinter den Rattanhalmen nicht sehen konnten – in der Dunkelheit war er sicher vor ihnen. Niemals würde es ihnen gelingen, den Schrank zu öffnen und ihn aus seinem Versteck zu zerren.
Trotzdem – er spürte auf einmal, wie ihre Monstrosität nach und nach durch das Rattangeflecht drang und in die Poren seiner Haut einsickerte. Sein Gesicht hob sich an, die Muskeln dehnten sich in die Länge, die Knochen knackten … er ähnelte ihnen immer mehr; er verwandelte sich in »sie«! Er biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien. Sein Gesicht verzerrte sich, es zerfiel, doch er durfte nicht schreien, er durfte nicht verraten, dass er in diesem Schrank war, er …
Sein Körper versteifte sich, der Brustkorb erstarrte. Sein ganzes Sein verriegelte sich gegen die Außenwelt. Er stellte sich vor, wie sich die Baumstruktur des Atemapparats über der Dunkelheit der inneren Organe schloss. Das war die Apnoe, die er bevorzugte – die sanfteste und natürlichste. Der nächtliche Atemstillstand, der die Neugeborenen im Schlaf überrascht und manchmal auch umbringt.
Jacques schlief nicht mehr, hielt aber die Augen geschlossen. Er zählte die Sekunden. Er brauchte keine Uhr und keinen Sekundenzeiger: Sein Pulsschlag war seine Uhr. Verlangsamt. Beruhigt. Nach ein paar Sekunden verstummten die Stimmen, kurz darauf verblassten die Gesichter. Die Rattanwände wichen zurück, als hätte der Druck auf der anderen Seite nachgelassen. Er war der Stärkere. Stärker als die Blicke, als die Ungeheuer, als die …
Er öffnete die Augen, sein Kopf war vollkommen leer. Er holte tief Luft. Doch er bekam etwas anderes, das bitter und köstlich zugleich war. Einen Mund voll grünen Tee. Wo war er? In langen Wogen kehrte sein Bewusstsein zurück. Er lag ausgestreckt in der Dunkelheit. Die Hitze war allgegenwärtig. Seine fünf Sinne begannen mit ihrer Sondierungsarbeit. Er spürte den heißen Wind im Gesicht. Dann einen schweren, berauschenden, beinahe widerlichen Geruch: das Aroma des Waldes. Die Üppigkeit der Vegetation.
Gedämpfte Geräusche. Stimmen. Ganz andere als in seinem Albtraum. Sie bemühten sich, Englisch zu sprechen, mit starkem malaiischem Akzent: »Hello … Hello …«, »Cigarettes?«
Er drehte den Kopf nach rechts und erkannte zwischen grün gestrichenen Holzstäben dunkle, verwirrte runde Gesichter. War er im Gefängnis? Er blickte nach links. Ein unermesslicher, sternenflimmernder Nachthimmel. Nein. Er war im Freien.
Er zwang sich, ruhig zu bleiben – und alles genau zu analysieren. Es war Nacht. Eine blau-grüne Nacht voller tropischer Düfte. Er lag in einer Galerie. Links ein weiter betonierter Innenhof, rechts die Gitterwand, hinter der sich Menschen drängten, Häftlinge: In ihrem Rücken erkannte er einen großen Saal mit eisernen Betten. Er war also doch im Gefängnis. Allerdings in einem Freiluftgefängnis.
Unwillkürlich versuchte er aufzustehen, doch es ging nicht: Handgelenke und Knöchel waren mit Riemen ans Bett gefesselt. Im nächsten Moment entdeckte er die gebogene Chromstange über seinem Bett – einem Krankenhausbett. Gleichzeitig stellte er fest, dass er einen grünen Kittel trug, genauso wie die Gefangenen hinter dem Gitter. Und noch etwas fiel ihm an ihnen auf: ihre kahl geschorenen Köpfe. In der Dunkelheit glichen ihre weit aufgerissenen Augen weißen Wunden. Sie grinsten, knurrten, grunzten. Er spitzte die Ohren und verstand einzelne Worte, auf Malaiisch, Chinesisch, Thai … Absurdes, zusammenhangloses Gefasel. Das waren Verrückte.
Er war in einem Irrenhaus.
Ein Name kam ihm in den Sinn: Ipoh, die größte psychiatrische Anstalt Malaysias. Eine jähe Furcht ergriff ihn. Warum hatte man ihn hierher gebracht? Er war nicht verrückt, trotz der Gesichter, trotz der Albträume – verrückt war er nicht. Er versuchte sich die letzten Tage ins Bewusstsein zu rufen, erinnerte sich aber nur an Bambusblätter, an Wände aus Rattangeflecht. Was war geschehen? Hatte er wieder eine Krise gehabt?
Er hörte Geräusche hinter sich, das Knarzen eines Sessels, das Rascheln von Papier. Mitten in der Nacht waren diese Geräusche noch sonderbarer als alles Übrige. Reverdi verrenkte sich den Hals, um ihre Ursache zu ergründen. Ein paar Meter entfernt entdeckte er einen eisernen Schreibtisch, auf dem sich Papierstapel türmten.
Ein Wärter, der hinter dem Tisch gedöst hatte, war aufgestanden und richtete seinen Gürtel, an dem ein Revolver, eine Tränengasbombe und ein Schlagstock hingen. Nicht gerade typisch für einen Krankenpfleger. Jacques befand sich also in der Abteilung für Straftäter. Der Mann knipste eine Taschenlampe an und kam auf ihn zu. Reverdi forderte auf Malaiisch:
»Tutup lampu tu« – mach das aus.
Der Wärter machte vor Verblüffung einen Satz zurück. Noch mehr hatten ihn die malaiischen Worte überrascht. Nach kurzem Zögern schaltete er die Lampe aus und umrundete vorsichtig das Bett. Jacques sah ihn in der Dunkelheit nach einem Lichtschalter tasten.
»Kein Licht«, befahl er.
Der Mann erstarrte. Seine andere Hand umklammerte die Schusswaffe am Gürtel. Ringsum herrschte jetzt vollkommene Stille, die Gefangenen waren verstummt. Nach ein paar Sekunden nahm der Wärter die Hand vom Schalter.
»Ich will dein Gesicht nicht sehen«, zischte Reverdi. »Kein Gesicht. Nicht jetzt.«
»Ich hole den Pfleger. Du kriegst eine Spritze.«
Reverdi zuckte zusammen. Augenblicklich war sein Körper schweißüberströmt. Er durfte nicht mehr schlafen. Im Schlaf warteten die »anderen« hinter dem Rattangeflecht auf ihn.
»Nein«, flüsterte er, »das nicht.«
Der Malaie grinste, seine Selbstsicherheit kehrte zurück. Er ging zum Wandtelefon.
»Warte!«
Der Wärter fuhr zornig herum, die Hand am Schlagstock. Er hatte keine Lust mehr, sich von einem mat salleh verrückt machen zu lassen.
»Schau mir in den Hals«, befahl Reverdi.
Widerwillig kam der Wärter zum Bett zurück. Jacques riss den Mund auf und fragte:
»Was siehst du?«
Der Malaie beugte sich misstrauisch vor. Jacques streckte die Zunge heraus und biss mit aller Kraft die Kiefer zusammen. Aus seinen Mundwinkeln spritzte das Blut.
»Himmel …«, stieß der Wärter hervor und stürzte zum Telefon.
Ehe er den Hörer abnahm, rief Reverdi ihm zu:
»Hör zu! Wenn du den Pfleger rufst, hab ich sie komplett durchgebissen, bevor er hier ist.« Er lächelte; auf seinem Kinn bildeten sich warme Blasen. »Ich werde behaupten, du hast mich geschlagen und gefoltert …«
Der Mann stutzte, und Jacques nutzte seinen Vorteil:
»Rühr dich nicht von der Stelle. Ich werde mich schlafend stellen und bis morgen früh still halten. Es geht alles gut. Beantworte mir nur meine Fragen.«
Der Malaie schien noch zu zögern, dann ließ er die Schultern sinken; er kapitulierte. Von einem fahrbaren Tisch nahm er eine Rolle Klopapier, trat argwöhnisch auf Jacques zu und wischte ihm den Mund ab. Reverdi dankte ihm mit einem Nicken.
»Bin ich in Ipoh?«
Der Wärter bejahte. Ein Schnurrbart teilte sein Gesicht, das von Aknenarben übersät war – regelrechte Abgründe klafften darin, die im nächtlichen Dunkel an Mondkrater erinnerten.
»Seit wann bin ich hier?«
»Seit fünf Tagen.«
Nach einer raschen Überschlagsrechnung fragte Jacques nach: »Haben wir Dienstag, Mittwoch?«
»Mittwoch. 12. Februar. Zwei Uhr morgens.«
Er hatte keinerlei Erinnerung an die Zeitspanne, die ihn vom vergangenen Freitag trennte. In welchem Zustand war er hier eingetroffen? Wieder brach ihm der Schweiß aus allen Poren.
»War ich … bei Bewusstsein?«
»Wirres Zeug hast du geredet.«
Sein Schweiß wurde eiskalt. Die Tröpfchen prickelten und stachen auf seiner Brust, wie lauter Spritzer der Angst.
»Was habe ich gesagt?«
»Keine Ahnung. Es war Französisch.«
»Verzieh dich«, befahl er.